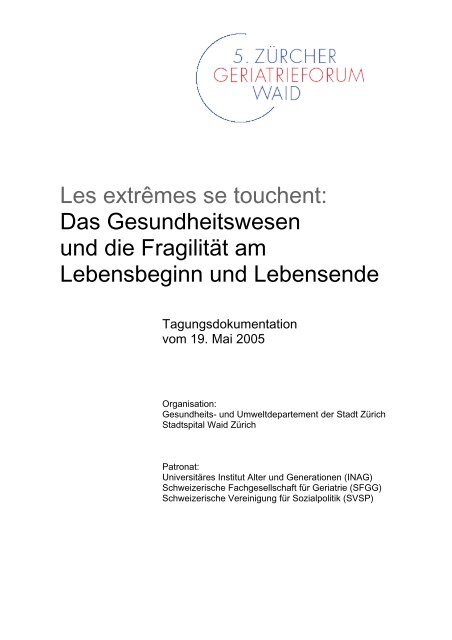Tagungsdokumentation - SVSP
Tagungsdokumentation - SVSP
Tagungsdokumentation - SVSP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen<br />
und die Fragilität am<br />
Lebensbeginn und Lebensende<br />
<strong>Tagungsdokumentation</strong><br />
vom 19. Mai 2005<br />
Organisation:<br />
Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich<br />
Stadtspital Waid Zürich<br />
Patronat:<br />
Universitäres Institut Alter und Generationen (INAG)<br />
Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG)<br />
Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (<strong>SVSP</strong>)
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Programm…………………………………………………………………………………. 3<br />
Referentinnen und Referenten………………………………………………………..... 4<br />
Tagungsbeschreibung.....................………………………………………………….... 5<br />
Umgang mit pflegebedürftigen Menschen im Gesundheitswesen –<br />
heute und morgen………………………………………………………………………... 6<br />
Funktionelle Gesundheit – die pädiatrische/heilpädagogische Sicht……………... 26<br />
Funktionelle Gesundheit – die geriatrische Sicht……………………………………. 29<br />
Die Bedeutung des sozialen Umfelds in sensiblen Lebensphasen<br />
der Frau………………………………………………………………………………….. 35<br />
Kurzvorstellung <strong>SVSP</strong>………………………………………………………………….. 37<br />
Kurzvorstellung INAG…………………………………………………………………... 39<br />
Kurzvorstellung SFGG…………………………………………………………………. 43<br />
2 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Programm<br />
13.30 – 13.45 Begrüssung, Einleitung<br />
Stadtrat Robert Neukomm<br />
13.45 – 14.15 Umgang mit pflegebedürftigen Menschen im Gesundheitswesen –<br />
heute und morgen<br />
Dr. iur. Erwin Carigiet<br />
14.15 – 14.35 Funktionelle Gesundheit – die pädiatrische/heilpädagogische Sicht<br />
Dr. med. Ueli Bühlmann<br />
14.35 – 14.45 Diskussion<br />
Moderation Dr. med. Daniel Grob<br />
14.45 – 15.15 Pause<br />
15.15 – 15.35 Funktionelle Gesundheit – die geriatrische Sicht<br />
Dr. med. Daniel Grob<br />
15.35 – 15.45 Diskussion<br />
Moderation Dr. iur. Erwin Carigiet<br />
15.45 – 16.05 Die Bedeutung des sozialen Umfelds in sensiblen Lebensphasen<br />
der Frau<br />
Dr. med. Brida von Castelberg<br />
16.05 – 16.15 Diskussion<br />
Moderation Dr. med. Daniel Grob<br />
16.15 – 16.30 Pause<br />
16.30 – 17.30 Podiumsdiskussion: Die Stellung von chronisch kranken<br />
Menschen in unserem Gesundheitswesen<br />
Erika Forster-Vannini, Ständerätin, Josy Gyr-Steiner, Nationalrätin,<br />
lic.iur. Ruth Humbel Näf, Nationalrätin, Theresia Weber-Gachnang,<br />
Kantonsrätin, Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka,<br />
Moderation: Ellinor von Kauffungen<br />
Ab 17.30<br />
Apéro<br />
3 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Referentinnen und Referenten<br />
Ueli Bühlmann, Chefarzt Klinik für Kinder und Jugendliche, Stadtspital Triemli (Zürich)<br />
Erwin Carigiet, Departementssekretär des Gesundheits- und Umweltdepartements der Stadt<br />
Zürich, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik (<strong>SVSP</strong>)<br />
Erika Forster-Vannini, Ständerätin (FDP, St Gallen), Geschäftsfrau<br />
Daniel Grob, Chefarzt Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital Waid (Zürich), Präsident der<br />
Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG)<br />
Josy Gyr-Steiner, Nationalrätin (SP, Schwyz), Bezirksrätin, Präsidentin der Fürsorgekonferenz<br />
des Kantons Schwyz<br />
Ruth Humbel Näf, Nationalrätin (CVP, Aargau), Regionenleiterin Santésuisse<br />
Robert Neukomm, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements der Stadt Zürich<br />
Gabriela Riemer-Kafka, Professorin für Sozialversicherungsrecht, Universität Luzern<br />
Brida von Castelberg, Chefärztin Frauenklinik Maternité, Stadtspital Triemli (Zürich)<br />
Ellinor von Kauffungen, Journalistin, Moderatorin, Dozentin<br />
Theresia Weber-Gachnang, Kantonsrätin (SVP, Zürich), Onkologieschwester, Bäuerin<br />
4 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Tagungsbeschreibung<br />
Im 5. Geriatrieforum Waid soll der Blick über die Grenzen der Altersmedizin hinaus geöffnet<br />
werden.<br />
Heute hat die Medizin die meisten Akutkrankheiten ‚im Griff’. Auf die zunehmenden chronischen<br />
Leiden unserer Zeit jedoch scheint das Gesundheitswesen bisher noch keine ‚echte’<br />
Antwort gefunden zu haben. Chronisch kranke Menschen werden wie Akutkranke behandelt.<br />
Dabei nehmen die Ausgaben zu, nicht aber die Gesundheit der Betroffenen. Menschen mit<br />
chronischen Erkrankungen stellen andere Anforderungen an das Gesundheitswesen als verunfallte<br />
oder akut erkrankte Menschen.<br />
Folgende Fragen stehen im Zentrum der Tagung: Kann unser Gesundheits- und insbesondere<br />
unser Spitalwesen das Bedürfnis nach Autonomie (Selbständigkeit und Selbstbestimmung)<br />
von chronisch und schwer kranken Menschen erfüllen? Wie gehen wir im Spital mit<br />
diesen Menschen um? Wie sehen die Entscheidungsprozesse aus und wo bestehen besondere<br />
Probleme? Welchen Stellenwert haben die funktionelle Gesundheit, die Prognose und<br />
der Wille der Patientin / des Patienten für die Abklärungs- und Behandlungsplanung? Wie<br />
sieht die Situation bei schwer kranken Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen aus? Gibt es<br />
Parallelen zum Umgang mit Hochbetagten? Kann es sein, dass sich das Gesundheitswesen<br />
an beiden Enden des Lebenszyklus mit ähnlichen Problemen der Entscheidungsfindung, der<br />
Ressourcenallokation und der gesellschaftlichen Rechtfertigung konfrontiert sieht? Sind chronisch<br />
kranke Menschen in unserem Gesundheitswesen generell einem höheren Kosten- und<br />
damit Rechtfertigungsdruck ausgesetzt?<br />
Der zunehmende ökonomische Druck auf das Gesundheitswesen lässt befürchten, dass vor<br />
allem chronisch kranke Patientinnen und Patienten – ungeachtet ihres Alters − die Sparanstrengungen<br />
zu spüren bekommen. Könnte es sein, dass die vielfach heraufbeschworene<br />
Bedrohung des Generationenvertrags aus gesundheitspolitischer Sicht weniger ein Generationenproblem<br />
als vielmehr auch Ausdruck einer Sinnkrise der Medizin ist?<br />
5 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Umgang mit pflegebedürftigen Menschen im Gesundheitswesen<br />
- heute und morgen<br />
Erwin Carigiet, Departementssekretär des Gesundheits- und Umweltdepartements<br />
der Stadt Zürich, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik<br />
(<strong>SVSP</strong>)<br />
A. Altersmedizin ist anders – Beispiele aus der Praxis<br />
1. Ein Sturz mit Folgen<br />
2. Störrischer alter Mann – nicht ernst genommen<br />
3. 40 Treppenstufen – als 84-jährige mit Training und Ermunterung zum Erfolg<br />
4. Einzelfälle oder typische Konstellationen? - Grundsätzliches<br />
B. Medizin für chronisch kranke Menschen ist anders als Akutmedizin<br />
1. Lebenserwartung – Indikator für den Nutzen des Gesundheitswesens<br />
2. Medizinischer Fortschritt – Ursprung mancher Chronifizierung<br />
3. Ganzheitlichkeit und Lebensqualität als Massstäbe<br />
C. Finanzierung der Alterspflege<br />
1. Langzeitpflege – ein strukturelles Risiko<br />
2. Wer finanziert wie viel in der Langzeitpflege? Fiktion und Realität<br />
3. Prämien oder Steuern? Angemessene Mischfinanzierung der Langzeitpflege<br />
anstelle eines Kampfes der Generationen<br />
4. Ergänzungsleistungen zur AHV: die Heimpflegeversicherung der Schweiz<br />
5. Vermögen verscherbelt – soziale Absicherung durch Ergänzungsleistungen<br />
zur AHV? Mechanismus gegen Missbrauch<br />
D. Ausblick: Drei Thesen anstelle einer Zusammenfassung<br />
Schlussbemerkungen<br />
6 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
A. Altersmedizin ist anders – Beispiele aus der Praxis<br />
1. Ein Sturz mit Folgen<br />
a) Einschränkungen – ein gutes Leben zu Hause<br />
Die 92-jährige Heidi Müller (Name geändert) lebt allein in einer Wohnung in Ausser-Kellikon<br />
(Gemeindename fiktiv). Sie konnte sich bis anhin mit der Haushalthilfe der Spitex selber versorgen.<br />
Dies trotz fast vollständiger Erblindung (Restvisus 5 % an einem Auge) und starker<br />
chronischer Arthrose-Beschwerden.<br />
b) Ein Sturz – Behandlung im Akutspital<br />
Anfang dieses Jahres stürzte Heidi Müller über ein Telefonkabel in ihrer Wohnung und zog<br />
sich eine stark blutende Kopfwunde zu. Zufälligerweise war gerade ein Handwerker in der<br />
Wohnung, welcher die Rettungssanität des Bezirks benachrichtigte. Heidi Müller wurde ins<br />
nächst gelegene Spital transportiert (ein Spital ausserhalb der Stadt Zürich). Dort wurde die<br />
Kopfwunde versorgt und ein Computertomogramm des Schädels durchgeführt. Dies, um eine<br />
Hirnverletzung auszuschliessen. Die alte, geistig rüstige Frau blieb fünf Tage im Spital.<br />
Danach wurde sie in die Obhut und Wohnung des 60-jährigen Sohnes Martin Müller (Name<br />
geändert) in Brüllikon-Nord (Gemeindename fiktiv) entlassen.<br />
c) Vom Akutspital ins Pflegeheim?<br />
Martin Müller war etwas ratlos, da der gesundheitliche Zustand seiner Mutter eine Rückkehr in<br />
ihre Wohnung nicht zuliess. Er telefonierte anfangs Februar deshalb dem Blindenverband,<br />
welcher ihn an die Klinik für Akutgeriatrie am Stadtspital Waid weiter verwies. Hier fragte er,<br />
was er für seine Mutter noch tun könne. Sie sei weiterhin sehr schlecht mobil, habe Schmerzen<br />
und es sei undenkbar, dass sie wieder in ihre eigene Wohnung zurückkehren könne, was<br />
doch eigentlich das Ziel sei. Dort finde sie sich mit ihrer schweren Sehbehinderung einigermassen<br />
zurecht, zumal die Leistungen der Spitex wertvolle ergänzende Hilfe leisteten. Die<br />
Empfehlung der Auskunft erteilenden Ärztin lautete: Rücksprache mit dem Hausarzt und<br />
durch diesen Einweisung in die Klinik für Akutgeriatrie.<br />
Heidi Müller traf Mitte Februar in der Klinik für Akutgeriatrie ein: Als Hauptprobleme stellten<br />
sich eine ausgeprägte Geh-Unsicherheit und diffuse, anhaltende Schmerzen im Rücken- und<br />
Hüftbereich heraus. Zudem litt die vom Sohn als vor dem Sturz als ausgesprochen lebenslustig<br />
beschriebene Frau an einer starken Depression.<br />
d) Genauer hingeschaut – Lebensqualität zurückgewonnen<br />
Die Mitarbeitenden der Klinik für Akutgeriatrie besprachen den Fall im interdisziplinären Team<br />
und ordneten weitere Abklärungen inkl. Skelettszintigrafie an. Diese ergaben frische<br />
Knochenbrüche des 11. Brustwirbelkörpers, des Steissbeins sowie beider Schambeinäste<br />
links. Diese Brüche bedurften keiner chirurgischen Intervention, aber einer intensiven Physiound<br />
Schmerztherapie.<br />
Bereits nach wenigen Tagen befand sich die Patientin auf dem Wege der Besserung. Die<br />
Mobilität nahm wieder zu, die Schmerzen ab und die depressive Episode klang unter entsprechender<br />
Behandlung ab. Mit Hilfe des Übergangspflegedienstes der Klinik für Akutgeriatrie<br />
konnte Heidi Müller nach 6 Wochen definitiv nach Hause entlassen werden.<br />
7 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
2. Störrischer alter Mann – nicht ernst genommen<br />
a) Störungen – störend?<br />
Der 68-jährige Thomas Burger (Name geändert) wurde im Dezember des vergangenen Jahres<br />
wegen immobilisierenden Rückenschmerzen in eine medizinische Klinik eingewiesen.<br />
Deswegen war er bereits im Frühling des gleichen Jahres mehrwöchig hospitalisiert gewesen<br />
mit nachfolgender Rehabilitation (so genanntes „bekanntes Leiden“). Gemäss Bericht der<br />
medizinischen Klinik führte die „Dekompensation der sozialen Verhältnisse“ durch die anhaltenden<br />
Schmerzen und die Alkoholkrankheit der Ehefrau zur jetzigen Hospitalisation.<br />
Der Patient wurde während 13 Tagen in der Physiotherapie des Spitals behandelt, wobei er<br />
„äusserst passiv“ gewesen sei, er habe „täglich zur Therapie motiviert werden müssen“ –<br />
„auch bezüglich der Schmerzempfindung scheint eine tiefere Schmerzschwelle vorhanden zu<br />
sein“ (zitiert aus dem Austrittsbericht). Röntgenbilder wurden keine angefertigt. Thomas<br />
Burger wurde nach 13 Tagen in die Klinik für Akutgeriatrie des Stadtspitals Waid verlegt mit<br />
der Bemerkung, „möglicherweise werde die gesamte Situation auf eine Pflegeheim-Anmeldung<br />
hinauslaufen“.<br />
b) Schmerzen ernst genommen – Leiden reduziert<br />
Bei der Aufnahme in die Klinik für Akutgeriatrie Ende des Jahres wurden von den schmerzhaften<br />
Regionen Röntgenbilder angefertigt (Wirbelsäule, Becken) und es fand sich ein recht<br />
frischer Bruch der rechten Hüfte – vereinbar mit einem Bruchdatum Ende November/Anfang<br />
Dezember (Schenkelhalsfraktur rechts).<br />
Da der Patient in schlechtem Allgemeinzustand war, konnte er nicht sofort operiert werden –<br />
er bedurfte vorab einer Bluttransfusion und einer medikamentösen Behandlung des Herzens.<br />
Drei Tage später wurde er auf die Chirurgie des Stadtspitals Waid verlegt, wo ihm erfolgreich<br />
ein künstliches Hüftgelenk eingebaut wurde. Der Patient war nach der Operation wieder mobil,<br />
und zwar mit deutlich weniger Schmerzen als vor dem Eingriff, und konnte ohne Probleme an<br />
der Physiotherapie teilnehmen.<br />
Thomas Müller kehrte in seine eigene kleine Wohnung zurück. Er war zuversichtlich, dort<br />
noch viele Jahre leben zu können, und sehr glücklich darüber, nicht in ein Pflegeheim eintreten<br />
zu müssen. Die Mitarbeitenden der Klinik für Akutgeriatrie hatten seine Wohnung<br />
besichtigt und dem Patienten nützliche Tipps zur Anpassung gegeben.<br />
3. 40 Treppenstufen – als 84-jährige mit Training und Ermunterung zum Erfolg<br />
a) Sturz am Muttertag<br />
Als Lukretia Bauer (Name geändert) am Muttertag letzten Jahres auf einem Zürichseeschiff<br />
ausrutschte und hinfiel, dachte sie weniger an die Schmerzen als an die Worte der Ärzte, als<br />
sie damals nach ihrem letzten Sturz endlich das Spital verlassen konnte: "Wenn Sie noch<br />
einmal stürzen, ist es wahrscheinlich, dass sie nicht mehr zu Hause leben können."<br />
Bereits in ihrem 60. Lebensjahr war Lukretia Bauer in den Ferien gestürzt und hatte sich den<br />
Oberarm gebrochen. Mit 75 und 83 Jahren brach sie sich je den einen und den anderen<br />
Oberschenkelhals. Den Spitalaufenthalten folgte hartes Training. Nach dem Oberarmbruch<br />
waren kleine alltägliche Verrichtungen wie Zähne putzen oder Haare kämmen schier unmöglich.<br />
Auch nach dem intensiven Training waren diese selbstverständlichen Verrichtungen<br />
immer für lange Zeit noch mit Schmerzen verbunden.<br />
8 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Lukretia Bauers von Arthrose befallenen Kniegelenke machten ihr ebenfalls zu schaffen,<br />
manchmal waren die Schmerzen so stark, dass sie diese ohne starke Medikamente fast nicht<br />
aushielt. Sie musste die Medikamente sparsam einnehmen, da diese schon öfters ihre<br />
Magenschleimhaut angegriffen hatten.<br />
Zudem hatte in den letzten Jahren auch ihr Herz unter hohem Blutdruck gelitten, was bei allzu<br />
grossen Anstrengungen deutlich zu spüren war: Lukretia Bauer kam schnell ausser Atem.<br />
Deshalb ging sie langsam und an zwei Stöcken, um ihre Knie zu entlasten. Dies gab ihr<br />
Sicherheit und nahm ihr die Angst, erneut zu stürzen.<br />
Und trotzdem passierte es wieder! Ausgerechnet am Muttertag!<br />
Im Spital wurde eine harmlose aber schmerzhafte Fraktur im Beckenbereich festgestellt.<br />
Lukretia Bauer konnte mit Schmerzmedikamenten wieder gehen. Kurz nach dem Austritt<br />
jedoch war das plötzlich nicht mehr möglich, und sie musste erneut ins Spital eingewiesen<br />
werden. Die Ärzte erklärten ihr, dass das Becken an mehreren Stellen gebrochen war und<br />
dass sie deswegen viel liegen müsse.<br />
Es war wie ein Albtraum! Schmerzen im Liegen und beim Bewegen. Lukretia Bauer konnte<br />
zusehen, wie die Muskeln an den Beinen schwanden. Sie fühlte sich immer schwächer. Die<br />
Genesung machte keine Fortschritte. Am meisten fürchtete sie aber, dass sie nicht mehr nach<br />
Hause zurückkehren könnte. Es wurden weitere Abklärungen gemacht, sie musste täglich<br />
viele starke Schmerzmedikamente einnehmen, damit sie überhaupt mit der Physiotherapeutin<br />
arbeiten konnte. Ihr innigster Wunsch, wieder in ihre schöne Wohnung zurückzukehren, gab<br />
ihr Kraft und motivierte sie! In Begleitung konnte sie schon bald einige Schritte gehen, was<br />
jedoch nicht genügte. Sie wusste: Um ohne Lift in ihre Wohnung im 3. Stock zu gelangen,<br />
musste sie 40 Treppen steigen können.<br />
Eines Tages konnte Lukretia Bauer nicht mehr länger im Spital bleiben. Ihr Bett wurde anderweitig<br />
gebraucht. Für eine Rückkehr nach Hause war sie jedoch zu schwach und unsicher auf<br />
den Beinen. Sie brauchte mehr Zeit, um zu genesen.<br />
Die Verlegung in ein Pflegezentrum wurde unumgänglich.<br />
b) Langsam aber stetig zurück in die Selbständigkeit<br />
Lukretia Bauer trat in die Temporärabteilung des Pflegezentrums Käferberg ein. Hier werden<br />
die Patientinnen und Patienten durch ein vielfältiges, auf den Einzelnen ausgerichtetes Angebot<br />
auf eine selbständige Lebensführung vorbereitet und auf dem Weg zurück in die Eigenständigkeit<br />
während einer Überbrückungszeit begleitet . Man erklärte Lukretia Bauer, dass die<br />
Temporärabteilung betagten Menschen, die den Wunsch und das Potential hätten, nach<br />
Hause zurückzukehren, die Möglichkeit gibt, ihr Ziel zu erreichen (Slow-Stream-Rehabilitation).<br />
Dazu kann auch eine genügend lange Erholungszeit gewährt werden. Es wurde für<br />
Lukretia Bauer eine schmerzliche Erfahrung, erleben zu müssen, dass der Aufbau der Muskulatur<br />
im Alter ein langsamer Prozess ist. So viel wie möglich selbständig machen, auch<br />
wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt, lautete die Devise.<br />
Die Schmerzen wurden allmählich schwächer, Lukretia Bauer erkundigte sich, ob die vielen<br />
Medikamente nicht reduziert werden könnten. Die Ernährung leiste einen wichtigen Beitrag an<br />
den Erfolg ihres Vorhabens, die tägliche Pillenration beeinträchtige jedoch den Appetit! Die<br />
Medikamente konnte erfolgreich reduziert werden. Physiotherapie mit Gleichgewichts- und<br />
Kräftigungsübungen gehörte zum täglichen Programm. Die Spaziergänge auf eigene Faust<br />
wurden immer länger, nach einem Monat konnte Lukretia Bauer aber erst drei Treppenstufen<br />
steigen. Sie geriet schnell ausser Atem. Das Herz machte noch nicht ganz mit.<br />
Die Handgelenke wurden durch den Zweistockgang stark beansprucht, sie schmerzten stark.<br />
Ein Rückschlag: Das Training musste reduziert und die Therapie angepasst werden. Nun war<br />
9 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Velo fahren angesagt; zwei Mal täglich auf dem Spezialvelo. So konnten sich die Handgelenke<br />
erholen und gleichzeitig die Beinmuskeln weiter trainiert werden. Von den Therapeuten<br />
und dem Pflegepersonal wurde die alte Dame stets moralisch unterstützt, denn ihr<br />
Wille und ihr Mut waren der Motor zum erfolgreichen Weitermachen!<br />
Langsam ging es aufwärts, und nach zweieinhalb Monaten bewältigte Lukretia Bauer die 40<br />
Treppenstufen! Dem "Probewohnen" stand nun nichts mehr im Wege.<br />
Lukretia Bauer war überglücklich und stolz: Sie konnte in die Wohnung zurückkehren und mit<br />
Hilfe der Spitex und gelegentlicher Unterstützung ihrer Tochter definitiv in den eigenen vier<br />
Wänden leben.<br />
Lukretia Bauer besucht noch heute einmal wöchentlich das Pflegezentrum, isst hier zu Mittag,<br />
trainiert am Velo, und lässt sich anschliessend von der Coiffeuse frisieren.<br />
4. Einzelfälle oder typische Konstellationen? - Grundsätzliches<br />
Heidi Müllers Sohn – informiert über die Befunde – zeigte sich erstaunt, dass im Erstspital die<br />
multiplen Brüche nicht erkannt und die Patientin in diesem Zustand nach Hause entlassen<br />
worden sei.<br />
Fachleute der Geriatrie sind nicht erstaunt: Der primäre Anlass (Hauptdiagnose) wurde zwar<br />
seriös abgeklärt und behandelt, die effektiv versteckten weiteren Ursachen der Schmerzen<br />
und Pflegebedürftigkeit wurden aber weder aufgedeckt, noch behandelt.<br />
Die Gründe sind vielfältig und liegen wohl in einer Mischung von<br />
• Unwissen (die Aspekte der alternden Gesellschaft werden in der medizinischen Grundausbildung<br />
oft noch zu wenig berücksichtigt) und<br />
• mangelnder Sensibilisierung des Personals sowie der Angehörigen für die Bedürfnisse der<br />
alten Menschen und<br />
• fussen grundsätzlich im gesellschaftlichen Altersbild.<br />
Alte Menschen sind nicht Patientinnen und Patienten, die sich lediglich im Alter von den<br />
jüngeren Altersgenossen unterscheiden:<br />
• Die Krankheiten alter Menschen manifestieren sich oft als Gebrechlichkeit, als Frailty oder<br />
auch als Disability.<br />
• Alte Menschen zeigen bekannterweise oft eine völlig atypische Symptom-Präsentation<br />
(wie z.B. einen Herzinfarkt ohne Brustschmerzen, der sich nur durch plötzliche Gebrechlichkeiten<br />
und etwas Atemnot manifestiert).<br />
• Die Therapieverweigerungen gerade alter und/oder chronisch kranker Menschen erweisen<br />
sich retrospektiv oft durchaus als nachvollziehbar. Oft haben sie das Gefühl ihr aktuelles<br />
Problem sei der Anfang vom Ende, eine Therapie würde lediglich das Leiden verlängern,<br />
könne das Unausweichliche eh nicht abwenden und sie wüssten zu wenig, um das Leiden<br />
alltagsrelevant zu bessern. Deshalb handeln sie nach dem vermeintlichen Motto Lieber ein<br />
schnelles Ende, als ein Schrecken ohne Ende.<br />
10 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Weitere Unterschiede ergeben sich aus<br />
• dem höheren Bedarf an Rehabilitationsleistungen, die ältere Menschen benötigen, um zu<br />
genesen;<br />
• der raschen Zustandsverschlechterung, wenn die aufgetretenen Symptome nicht behandelt<br />
werden;<br />
• der hohen Wahrscheinlichkeit von sekundären Krankheits- resp. Therapie-Komplikationen;<br />
• der hohen Bedeutung von Umweltfaktoren für die Genesung und Rückkehr nach Hause<br />
(Gestaltung des Wohnumfelds, familiäres und übriges soziales Beziehungsnetz).<br />
Fazit:<br />
Alte Menschen sind in Spital und Arztpraxis ebenso ernst zu nehmen wie jüngere Menschen:<br />
Ernstnehmen und Nachschauen, wo es weh tut.<br />
B. Medizin für chronisch kranke Menschen ist anders als Akutmedizin<br />
1. Lebenserwartung – Indikator für den Nutzen des Gesundheitswesens<br />
Zahlen zur Lebenserwartung bestehen in der Schweiz seit 1876, so dass sich die Entwicklung<br />
über längere Zeit beobachten lässt. Die Lebenserwartung bei Geburt ist in diesem Zeitraum<br />
stark angestiegen. Im 19. Jahrhundert lag sie unter 50 Jahren. Sie betrug 2001 für Frauen<br />
rund 83 Jahre, für Männer demgegenüber etwas über 77 Jahre. Die schweizerische Wohnbevölkerung<br />
hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt: Gegen Ende des 20. Jahrhunderts<br />
hat sie die Siebenmillionen-Marke überschritten. Die Zahl der über 65-jährigen Menschen<br />
hat sich in diesem Zeitraum verfünffacht, jener der Hochbetagten, d.h. der über 80-jährigen<br />
verfünfzehnfacht.<br />
Selbstverständlich ist nicht allein der medizinische Fortschritt für das Altern der Gesellschaft<br />
verantwortlich, aber er spielt eine entscheidende Rolle. Die Ernährung und die Hygiene sind<br />
von vergleichbarer Wichtigkeit. Die Menschen der Moderne leben länger als die Altvorderen<br />
und erfreuen sich dabei auch länger einer guten Gesundheit. Das Ende des Lebens bleibt<br />
aber oft von Krankheit und Hinfälligkeit gezeichnet.<br />
Insgesamt kann die Lebenserwartung also als ein wichtiger Indikator für den Nutzen des<br />
Gesundheitswesens gewertet werden.<br />
2. Medizinischer Fortschritt – Ursprung mancher Chronifizierung<br />
Heute hat die Medizin die meisten Akutkrankheiten „im Griff“. Viele früher tödliche Erkrankungen<br />
(wie AIDS, manche Krebskrankheiten usw.) sind zwar nicht heilbar, aber doch überlebbar<br />
geworden. Oft sogar mit einer verhältnismässig akzeptablen Lebensqualität. Trotzdem<br />
prägt die Akutmedizin die ganze Medizin: Chronisch kranke Menschen werden oft wie Akutkranke<br />
behandelt, obwohl es wenig Sinn macht, bei chronischen Krankheiten so vorzugehen<br />
und zu handeln, wie wenn eine Heilung möglich wäre.<br />
Auf die zunehmenden chronischen Leiden unserer Zeit scheint das Gesundheitswesen bisher<br />
noch keine „echte“ Antwort gefunden zu haben. Nicht jede akut-medizinisch indizierte Inter-<br />
11 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
vention ist sinnvoll, insbesondere, wenn die Patientinnen und Patienten ganzheitlich wahrgenommen<br />
werden.<br />
Als Beispiel diene der Alterskrebs: Dass Krebs im Wesentlichen eine "Alterskrankheit" geworden<br />
ist, wird immer noch gern verdrängt. Im hohen Alter ist Krebs oft eine von vielen Krankheiten,<br />
an denen die Betroffenen leiden, selten die Krankheit. Bei 80 Prozent der über 60<br />
Jahre alten Krebspatientinnen und -patienten liegt mindestens eine weitere, bei den 70- bis<br />
90-jährigen liegen sogar fünf bis neun nebeneinander existierende, zumeist chronische<br />
Krankheiten vor. Dazu gehören Bluthochdruck, Herzschwäche, Diabetes und chronische<br />
Atemwegserkrankungen. Darüber hinaus treten bei alten Menschen sehr viel häufiger<br />
Depressionen und Demenzen auf als bei der jüngeren Bevölkerung. Zwei Drittel der über 65-<br />
Jährigen nehmen regelmässig ein bis drei verschreibungspflichtige Medikamente ein.<br />
Bei der Behandlung alter Krebspatientinnen und -patienten ist solchen Tatsachen unbedingt<br />
Rechnung zu tragen. Bei der Dosierung von Krebsmedikamenten müssen beispielsweise die<br />
erniedrigte Filterleistung der Niere und die beeinträchtigte Entgiftung über die Leber berücksichtigt<br />
werden. Alte Menschen haben weniger Wasser und mehr Fett im Körper: Wasserlösliche<br />
Medikamente verteilen sich daher schlechter, fettliebende dagegen besser. Die Reservekapazität<br />
des Knochenmarks ist bei alten Menschen ebenso eingeschränkt, wie die Fähigkeit<br />
der Schleimhautzellen sich zu erneuern. Alte Krebspatienten erholen sich damit sehr viel<br />
langsamer von den Nebenwirkungen einer Chemotherapie als jüngere Betroffene.<br />
Das macht die Phasen mit guter Lebensqualität zwischen den Chemotherapie-Zyklen oft kürzer<br />
und kann das Vorteil-/Nachteil-Verhältnis der Therapien wesentlich schlechter werden<br />
lassen, als dies die Studien vorrechnen, die meist bei im übrigen gesunden Probandinnen und<br />
Probanden gemacht worden sind. Die Anordnung solcher Behandlungen, ohne die hier skizzierten<br />
Informationen den Betroffenen und ihren Angehörigen weiterzugeben, ist schon als<br />
moralischer Betrug bezeichnet worden.<br />
Der Einbezug der Angehörigen ist sehr wichtig. Ihr persönlicher Erfahrungshintergrund unterscheidet<br />
sich meist wesentlich von dem der älteren Menschen. Dies kann dazu führen, dass<br />
sie für ihre betroffenen Angehörigen mehr verlangen, als diese letzten Endes überhaupt<br />
möchten oder ihnen gut tut. Hilflosigkeit, Trauer über den sich abzeichnenden menschlichen<br />
Verlust und unerfüllbare Erwartungen in die moderne Medizin bilden immer wieder eine kontraproduktive<br />
Allianz.<br />
Hier ist es die vornehme Aufgabe der Fachpersonen, die notwendige Aufklärung vorbehaltlos,<br />
aber auch in ihrer ganzen Komplexität darzustellen. Dies stellt besondere Ansprüche an vernetztes<br />
Denken und erfordert ständige Weiterbildung, die sich im Spannungsfeld zwischen<br />
heilender (eher technischer) und pflegender (oft palliativer) Medizin bewegt.<br />
3. Ganzheitlichkeit und Lebensqualität als Massstäbe<br />
Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat sich jüngst zur<br />
nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftspolitisch relevanten Fragestellung des<br />
Umgangs mit pflegebedürftigen Menschen geäussert. In ihrem Bericht Die Zukunft der Medizin:<br />
Die Diskussion ist eröffnet (aufzufinden unter www.samw.ch) verlangt sie in der Quintessenz<br />
eine ganzheitlichere Behandlung der Patientinnen und Patienten: Im Einzelfall soll<br />
nicht alles medizinisch Mögliche, sondern vor allem das für den betroffenen Menschen Sinnvolle<br />
gemacht werden. Selbstverständlich ist dies eine schwierige und herausfordernde Aufgabe.<br />
Sie kann nur im vertrauensvollen Zusammenspiel zwischen Fachpersonen, kranken<br />
Menschen und deren Angehörigen verwirklicht werden.<br />
12 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Die Fachpersonen sind bei existenziellen Fragen nicht nur in ihrer Professionalität, sondern<br />
ebenso in ihrer Beziehung von Mensch zu Mensch gefordert. Nebst den an und für sich oft<br />
wunderbaren Errungenschaften des medizinischen Fortschritts müssen Zuwendung und Fürsorge<br />
in der Medizin und Pflege ihre einstmals wichtigste Bedeutung zurück gewinnen. In<br />
alternden Gesellschaften,<br />
• wo chronische Krankheiten die häufigste Ursache für Leiden und Tod sind,<br />
• müssen die kurative und die pflegende beziehungsweise rehabilitative Medizin eine gleichwertige<br />
Bedeutung erhalten.<br />
Der medizinische Fortschritt bleibt mit allen seinen Techniken immer wieder sozusagen auf<br />
halbem Weg stecken. Krankheiten werden zwar überlebbar, aber sie bleiben bestehen. Medizinischer<br />
Fortschritt, der allein auf die Technik vertraut, lässt die kranken Menschen mit ihren<br />
existentiellen Bedürfnissen und Nöten allein. Diese Diagnose verlangt selbstverständlich<br />
nicht, dass ins andere Extrem verfallen wird und bei chronischen Krankheiten allein auf<br />
Empathie und Zuwendung gesetzt werden soll. Das Spannungsfeld ist gegeben, ebenso die<br />
Ambivalenz.<br />
Lebensqualität sollte vermehrt zum Leitsatz auch des medizinischen Handelns werden.<br />
Andernorts wurde es so formuliert: Den Jahren mehr Leben geben und nicht dem Leben<br />
Jahre. Ohne den konsequenten Fokus auf die Lebensqualität werden in Zukunft in erster Linie<br />
wahrscheinlich die Ausgaben, nicht aber die Gesundheit der Betroffenen zunehmen.<br />
Die Gesellschaft des langen Lebens steht in einem neuen Spannungsfeld<br />
• zwischen einer durchaus berechtigten und wünschenswerten Aktivierung des Alters und<br />
• neu zu lernenden Abhängigkeiten und Gebrechlichkeiten.<br />
Im 20. Jahrhundert ist der Menschheit das dritte Lebensalter (65 – 85 Jahre) geschenkt worden.<br />
Es ist gekennzeichnet von vielen neuen Chancen und Möglichkeiten, die die vorangegangenen<br />
Zeitalter so nicht gekannt haben. Allerdings erleben einige ältere Menschen<br />
diese neuen Freiheiten eher negativ als Frei-setzung oder als „Abgeschoben-Werden“. Die<br />
Moderne hat aber nicht nur dieses meist positiv erlebte dritte Lebensalter mit sich gebracht,<br />
sondern auch das vierte Lebensalter (ab 85 Jahren). Paul Baltes, seit 1980 Direktor des Max<br />
Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, hat es wie folgt formuliert: „Da es sich beim<br />
Alter um eine junge Errungenschaft in der Menschheitsgeschichte handelt, gibt es kein steuerndes<br />
genetisches Programm. Die Evolution ist keine Freundin des Alters. …Der Körper wird<br />
zur Hypothek des Geistes.“ (Tages-Anzeiger vom 21. April 2005).<br />
Die alten Ewigkeitsträume der Menschheit lassen sich trotz des medizinischen Fortschritts<br />
nicht verwirklichen: Der medizinische Machbarkeitswahn verdrängt die Angst, in der letzten<br />
Lebensphase oder in besonderen Lebensumständen von anderen Menschen abhängig zu<br />
werden. Viele kranke und pflegebedürftige Menschen ziehen sich aus der Öffentlichkeit<br />
zurück und schämen sich ihrer Abhängigkeit und Hinfälligkeit. Die Ökonomisierung vieler<br />
Gesellschaftsbereiche trägt zusätzlich zu diesem Schamgefühl bei. Es gilt also, nicht nur die<br />
Würde der Abhängigkeit (wieder) zu entdecken, sondern auch<br />
• die vorherrschende Orientierung an körperlichen oder geistigen Defiziten<br />
• zu Gunsten einer „menschlicheren“ Ausrichtung an den verbliebenen körperlichen oder<br />
geistigen Ressourcen<br />
13 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
aufzugeben. Diese Besinnung und Konzentration auf vorhandene Fähigkeiten und Möglichkeiten<br />
berücksichtigt, dass Menschen nicht nur biologisch gesteuerte Wesen, sondern in jeder<br />
Phase ihres Lebens von Gefühlen und Empfindungen geprägt und geleitet sind.<br />
Die Medizin und das Gesundheitswesen sind stets auch ein Spiegel der Gesellschaft. Die<br />
bereits angedeutete Vision vom Sterben des Todes bzw. die Angst vor dem Tod, wie sie für<br />
ausgeprägt materialistisches Denken typisch sind, setzen in der Prioritätensetzung praktisch<br />
vorbehaltlos auf den medizinischen Fortschritt und damit auf die flächendeckende Anwendung<br />
hoch spezialisierter Medizin.<br />
Dabei kann sich der medizinische Fortschritt in sein Gegenteil verwandeln, wie es in den<br />
vorangegangenen Erwägungen angedeutet worden ist. Und dies erst noch unter gewaltigen<br />
Kosten. Allerdings können für derartige Entwicklungen nicht einseitig die Ärztinnen und Ärzte<br />
oder das Gesundheitswesen verantwortlich gemacht werden. Aber sie können ebenso wenig<br />
von jeder Mitverantwortung entbunden werden.<br />
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang beispielsweise,<br />
• dass es noch nicht an allen schweizerischen medizinischen Fakultäten Lehrstühle für<br />
Geriatrie oder Altersmedizin gibt;<br />
• dass es in der Schweiz nur wenige Lehrstühle für Pflegewissenschaft gibt, die sich naturgemäss<br />
schwergewichtig der Langzeitpflege widmen;<br />
• dass die Palliation, die Wissenschaft von der Schmerzbekämpfung und -linderung, immer<br />
noch verhältnismässig wenig Anerkennung und Bedeutung in Ausbildung, Forschung und<br />
Praxis geniesst;<br />
• dass die Anzahl der Hausärztinnen und Hausärzte rückläufig ist und sich dadurch an verschiedenen<br />
Orten Versorgungsengpässe abzeichnen.<br />
Erfreuliche Entwicklungen seien ebenfalls erwähnt. So ist vor kurzem an der Medizinischen<br />
Fakultät der Universität Basel das erste Institut für Hausarztmedizin der Schweiz gegründet<br />
worden. Damit soll das Image der Grundversorgerinnen und Grundversorger aufgewertet<br />
werden. Das neue Lehrinstitut soll der Hausarztmedizin mit eigenen Lehrinhalten und eigener<br />
Forschung universitäres Prestige verleihen.<br />
Im Kanton Zürich scheiterte demgegenüber die Schaffung eines solchen Instituts bisher am<br />
Widerstand der Medizinischen Fakultät.<br />
Im Kanton Bern wurde an der medizinischen Fakultät der Universität Bern anfangs 2005 ein<br />
Lehrstuhl für Geriatrie gegründet mit einer kommunalen geriatrischen Klinik als Zentrum. Die<br />
medizinische Fakultät der Universität Zürich hat es bis anhin ebenso hartnäckig unterlassen,<br />
einen Lehrstuhl für Altersmedizin einzurichten. Dies trotz Ko-Operationsangeboten der städtischen<br />
Stellen, insbesondere der renommierten Klinik für Akutgeriatrie am Stadtspital Waid.<br />
14 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
C. Finanzierung der Alterspflege<br />
1. Langzeitpflege – ein strukturelles Risiko<br />
Der zunehmende ökonomische Druck auf das Gesundheitswesen lässt befürchten, dass vor<br />
allem chronisch kranke und alte Patientinnen und Patienten die wahrscheinlichen zukünftigen<br />
Sparanstrengungen zu spüren bekommen. Die Pflegebedürftigkeit (meist tritt sie erst im Alter<br />
auf) stellt für den Einzelnen ein finanzielles Grossrisiko dar. Es ist voraussehbar und trifft<br />
viele. De facto sterben 90 % aller über 65-Jährigen nach einer Phase mehrmonatiger Pflege,<br />
50 % davon nach 7 Jahren langsam zunehmender Pflegebedürftigkeit. Dies bewirkt, dass die<br />
Frage der Pflegefinanzierung eine breitere Öffentlichkeit zu interessieren beginnt.<br />
Ein Spitaltag kostet Fr. 700 bis Fr. 1’000 (ohne aufwändige Behandlungen und Eingriffe), also<br />
bis zu Fr. 30'000 im Monat. Ein Tag in einem Pflegeheim kostet – je nach Pflegebedürftigkeit<br />
– Fr. 250 bis Fr. 350, also bis zu Fr. 10'000 im Monat. Je nach Lebensdauer ergeben sich<br />
Kosten von insgesamt mehreren 100’000 Franken.<br />
Seit der Einführung der obligatorischen sozialen Krankenversicherung 1996 hat sich die<br />
Beteiligung der Krankenkassen an den (Langzeit-)Pflegekosten stetig erhöht. Heute bezahlen<br />
sie rund 20 Prozent der Kosten von Pflegeaufenthalten. Die vollumfängliche Übernahme des<br />
Pflegeaufwands durch die Krankenkassen - was sie aufgrund der bestehenden Gesetzesgrundlagen<br />
müssten - führte schätzungsweise zu einer Prämiensteigerung von 10 Prozent.<br />
Die Alters- und Pflegeheimkosten müssen<br />
• in erster Linie von den Betroffenen getragen werden.<br />
• Die sozialen Krankenversicherungen übernehmen in zweiter Linie einen Teil der<br />
Pflegekosten, je nach Pflegestufe bis zu knapp Fr. 2’500 pro Monat.<br />
• In dritter Linie decken Ergänzungsleistungen zur AHV (und die Hilflosenentschädigungen<br />
der AHV) die verbleibende Differenz zwischen anerkannten Ausgaben (Kost, Logis,<br />
Betreuung, Pflege) und anrechenbaren Einnahmen. Darauf ist noch einzugehen.<br />
• In vierter Linie übernehmen die Sozialhilfe oder verwandte Bedarfsleistungen wie Pflegebeiträge<br />
ein darüber hinaus nicht gedecktes Defizit.<br />
Anstrengungen, die ein Verbleiben in den eigenen vier Wänden ermöglichen, lohnen sich<br />
also, wenn die Aufwendungen für die stationäre Pflege in die Rechnung miteinbezogen werden.<br />
2. Wer finanziert wie viel in der Langzeitpflege? Fiktion und Realität<br />
Zurzeit herrscht in der Öffentlichkeit an vielen Ort der Eindruck vor, „dass es die Alten sind,<br />
welche die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu verantworten haben“. Wie oben dargestellt,<br />
haben die Krankenkassen seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes<br />
(KVG) im Jahr 1996 immer mehr Kosten für die so genannte Langzeitpflege vor allem alter<br />
Menschen übernehmen müssen. Das ist eine Realität. Allerdings bedeutet diese Realität<br />
nicht, dass die Kosten in der Langzeitpflege an und für sich derart gewachsen sind, sondern<br />
dass sie sich lediglich teilweise auf andere Finanzierer, eben die sozialen Krankenversicherer,<br />
verschoben haben.<br />
15 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Vor der Einführung des KVG waren die Kosten der Langzeitpflege von der Krankenversicherung<br />
nur sehr limitiert übernommen worden. Ebenso konnten die Prämien je nach Alter, Risiko<br />
oder auch Geschlecht unterschiedlich hoch ausfallen. Es herrschte also keine Solidarität<br />
• zwischen Alten und Jungen oder<br />
• zwischen Gesunden und Kranken oder<br />
• zwischen Männern und Frauen.<br />
Seit 1996 müssen Frauen oder alte Menschen keine höheren Krankenkassenprämien mehr<br />
bezahlen als Männer oder junge Menschen. Überdies können Chronischkranke von ihren<br />
Krankenkassen nicht mehr ausgesteuert werden. Wichtige Errungenschaften des KVG!<br />
Die vollständige Übernahme der in Alters- und Pflegeheimen oder in der Spitex entstehenden<br />
Pflegekosten ist trotz der expliziten Gesetzesbestimmungen nie realisiert worden. Mit der<br />
Begründung einer ungenügenden Kostentransparenz wurden sowohl für die Pflegeheime wie<br />
für Spitex Rahmentarife eingeführt, welche nicht kostendeckend sind. Die Krankenkassen<br />
zahlen lediglich Beiträge an den entstehenden Aufwand, abgestuft nach Pflegeintensität zwischen<br />
Fr. 10 und Fr. 80 pro Tag. Der tatsächliche Aufwand kann gut das Doppelte betragen.<br />
Dass sie seit 1996 erhöhte Leistungen in der Langzeitpflege zu erbringen haben, hat die<br />
Krankenversicherer erschreckt und mobilisiert. Mit ihrem rituellen Wehklagen bei jeder jährlichen<br />
Ankündigung der neuen Prämien haben sie das Bild von den „teuren Alten“ geschürt<br />
oder zumindest in Kauf genommen: Der Eindruck, dass die Langzeitpflege vor allem von<br />
Krankenkassenmitgliedern – und dies erst noch von den jungen Mitgliedern - über ihre Prämien<br />
finanziert wird, stellt aber eine Fiktion dar. Ebenfalls der Eindruck, dass die Kosten der<br />
Pflege in den Alters- und Pflegeheimen oder in der Spitex im Vergleich zu den übrigen<br />
Gesundheitskosten übermässig ansteigen. Darauf wird einzugehen sein.<br />
Die grundsätzlichen Finanzierungsverhältnisse in der stationären Langzeitpflege werden im<br />
Folgenden an Zahlen aus den Heimen der Stadt Zürich illustriert (Stand 2002).<br />
Private Haushalte<br />
Grundtaxen (Kost/Logis) Fr. 110'102’000 38 %<br />
Obligatorische Krankenversicherung<br />
Leistungen für Pflege Fr. 61'024’000 21 %<br />
Beiträge öffentliche Hand<br />
Bund<br />
Kanton<br />
Stadt Zürich<br />
Total<br />
Fr. 259’000<br />
Fr. 362’000<br />
Fr. 59'776’000<br />
Fr. 60'397’000 20 %<br />
Ergänzungsleistungen zur<br />
AHV Fr. 42'800’000 15 %<br />
AHV Hilflosenentschädigungen<br />
Fr. 8'431’000 3 %<br />
Sozialhilfe<br />
Tarifreduktionen Fr. 2'446’000 1 %<br />
Unfallversicherung Fr. 24’000 -<br />
Diverses<br />
Übrige Patienten- und<br />
Betriebserträge Fr. 7'086’000 2 %<br />
Gesamttotal Fr. 292'310’000 100 %<br />
Diese Leistungen werden über<br />
die Prämien vollumfänglich<br />
durch die privaten Haushalte<br />
finanziert.<br />
Dies sind Betriebsbeiträge.<br />
Hinzu kommen noch Investitionsbeiträge.<br />
Diese Leistungen werden über<br />
die Steuern (Bund, Kanton,<br />
Gemeinden) vollumfänglich<br />
durch die privaten und juristischen<br />
Haushalte finanziert.<br />
16 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Das Gesamttotal betrifft nur die Altersheime und Pflegezentren, welche die Stadt Zürich selber<br />
führt. Die für die Versorgung ebenfalls wichtigen privaten oder gemeinnützigen Heime müssten<br />
noch dazu gerechnet werden.<br />
Für die Grundsatzfrage, wer wieviel an die Finanzierung der Alters- und Pflegeheime beiträgt,<br />
sind die Zahlen der städtischen Einrichtungen durchaus exemplarisch und aussagekräftig:<br />
• Insgesamt zahlen die Krankenkassen in der Stadt Zürich etwas über 20 % an die entstehenden<br />
Alters- und Pflegeheimkosten.<br />
• Den Rest bezahlen die Betroffenen selber (sog. Selbstzahler), in Form von Taxen (40 %)<br />
• oder er wird von der Allgemeinheit über Betriebsbeiträge an die Einrichtungen (20 %)<br />
• oder über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (15 %)<br />
• oder durch Taxreduktionen oder die Sozialhilfe (1 %) übernommen.<br />
Die Aufenthaltsdauer in den Spitälern reduziert sich infolge der besseren medizinisch-technischen<br />
Möglichkeiten und neuer Abgeltungsmodelle ständig. Die Spitäler werden vermehrt mit<br />
Pauschalen entschädigt und immer weniger nach Pflegetagen, was Anreize zur möglichst<br />
frühen Entlassung der Patientinnen und Patienten schafft. Dies führt gerade auch bei älteren<br />
Patientinnen und Patienten zu vermehrten Zuweisungen an Pflegeheime und Spitex.<br />
Neu ist die Entwicklung, dass der Eintritt in ein Pflegeheim für viele Menschen nicht mehr „die<br />
Endstation“ bedeutet: Heute können bereits über ein Drittel der Patientinnen die stadtzürcherischen<br />
Pflegezentren, insbesondere die neu eingerichteten Temporärstationen, wieder so<br />
weit instand gestellt verlassen, dass sie den eigenen Haushalt besorgen können.<br />
Die Zuweisungen an die Pflegeinstitutionen entlasten die Spitäler und somit die Kostenträger<br />
Kantone und Krankenversicherer finanziell. Da die Kosten eines Spitalaufenthaltes im Vergleich<br />
zu Spitex oder zum Pflegeheim wesentlich höher liegen, trägt die Pflege dieser Patientinnen<br />
und Patienten durch Spitex und Pflegeheime eigentlich zur Senkung der Gesundheitskosten<br />
bei.<br />
In der Langzeitpflege gewinnt die spitalexterne Pflege (Spitex) stetig an Bedeutung, weshalb<br />
auch hier die grundsätzlichen Finanzierungsverhältnisse interessieren. Sie werden im Folgenden<br />
an Zahlen aus den von der Stadt Zürich mit Beiträgen unterstützten gemeinnützigen<br />
Spitex-Organisationen dargestellt (Stand 2002).<br />
Private Haushalte<br />
Grundtaxen (Hauswirtschaftliche<br />
Fr. 9'255’000 16 %<br />
Leistungen, Mahlzeiten-<br />
und Reinigungsdienst)<br />
Obligatorische Krankenversicherung<br />
Leistungen für Pflege Fr. 18'328’000 33 %<br />
Beiträge öffentliche Hand<br />
Bund<br />
Kanton<br />
Stadt Zürich<br />
Total<br />
Fr. 10’161’000<br />
Fr. 3’637’000<br />
Fr. 11’761’000<br />
Fr. 25’559’000 46 %<br />
Diese Leistungen werden über<br />
die Prämien vollumfänglich<br />
durch die privaten Haushalte<br />
finanziert.<br />
Dies sind Betriebsbeiträge.<br />
Hinzu kommen teilweise noch<br />
Investitionsbeiträge.<br />
17 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Ergänzungsleistungen zur<br />
AHV Fr. 1'397’000 3 %<br />
Diverses<br />
Spendeneinnahmen Spitex-<br />
Organisationen Fr. 1'020’000 2 %<br />
Gesamttotal Fr. 55’559’000 100 %<br />
Diese Leistungen werden über<br />
die Steuern (Bund, Kanton,<br />
Gemeinden) vollumfänglich<br />
durch die privaten und juristischen<br />
Haushalte finanziert.<br />
Die Prozentsätze können von Institution zu Institution und von Ort zu Ort, je nach den<br />
sozioökonomischen Verhältnissen und dem regionalen Preisniveau variieren. In den Grundzügen,<br />
im Trend sehen sie allerdings in der ganzen Schweiz ähnlich aus (die folgenden Zahlen<br />
stammen aus der Publikation Das Gesundheitswesen in der Schweiz, Ausgabe 2004,<br />
herausgegeben von der Interpharma, Basel: www.interpharma.ch): ∗<br />
• 2002 haben die Kosten der stationären Langzeitpflege in der Schweiz insgesamt (Beträge<br />
im Folgenden gerundet) knapp 6 Milliarden Franken betragen. Davon haben die Krankenkassen<br />
für die Pflegeheime knapp 1,4 Milliarden Franken (23 %) übernehmen müssen.<br />
Von den 17,1 Milliarden Franken Gesamtausgaben der Krankenversicherer machen diese<br />
1,4 Milliarden Franken lediglich 8,2 % aus. Im Vergleich dazu sind 5,8 Milliarden Franken<br />
für Spitalbehandlungen (34 %), 4,1 Milliarden Franken für ambulante Arztbesuche (24 %)<br />
und 3,8 Milliarden Franken für Medikamente (ohne stationäre Behandlung 22 %) aufgewendet<br />
worden.<br />
1998 haben die Kosten für die stationäre Langzeitpflege noch 4,8 Milliarden Franken ausgemacht<br />
und die Krankenkassen hatten davon 1,1 Milliarden (23 %) zu tragen. Von den<br />
14 Milliarden Franken Gesamtausgaben der Krankenversicherer machten diese 1,1 Milliarden<br />
Franken lediglich 7,9 % aus. Der prozentuale Anteil hat sich also von 7,9 % im Jahr<br />
1998 ganz leicht auf 8,2 % im Jahr 2002 erhöht.<br />
• 2002 haben die Kosten der ambulanten Langzeitpflege in der Schweiz insgesamt knapp<br />
977 Millionen Franken betragen, davon haben die Krankenkassen für die Spitex 290 Millionen<br />
Franken (30 %) übernehmen müssen. Von den 17,1 Milliarden Gesamtausgaben der<br />
Krankenversicherer sind dies 2 %.1998 haben diese Kosten noch 815 Millionen Franken<br />
ausgemacht und die Krankenkassen hatten 224 Millionen Franken (27 %) davon zu tragen.<br />
Der prozentuale Anteil der sozialen Krankenversicherer ist somit seit 1998 etwas<br />
angestiegen.<br />
Ein Streitpunkt zwischen Leistungserbringern und den Krankenversichern beschlägt die<br />
Frage, welche Pflege denn nun krankheits- und welche altersbedingt ist. Die Krankenversicherer<br />
erklären sich nur verantwortlich für die krankheitsbedingten Pflegekosten. Die Unterscheidung<br />
ist in der Praxis allerdings schwierig, heikel und umstritten. Darauf ist noch einzugehen.<br />
Alter ist keine Krankheit. Alter allein führt auch praktisch nie zu Pflegebedürftigkeit. Pflegebedürftigkeit<br />
im Alter ist immer die Folge einer Grunderkrankung, wobei die entsprechenden<br />
Krankheiten im Alter oft gehäuft auftreten, wie z.B. Erkrankungen des Bewegungsapparates,<br />
Stoffwechselerkrankungen oder hirnorganische Erkrankungen.<br />
∗ Vgl. auch die vom Bundesamt für Statistik (BfS), Neuenburg herausgegebene Schweizerische<br />
Sozialversicherungsstatistik 2004 – www.bfs.admin.ch<br />
18 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
3. Prämien oder Steuern? Angemessene Mischfinanzierung der Langzeitpflege<br />
anstelle eines Kampfes der Generationen<br />
Wenn leichtsinnigerweise ein Kampf der Generationen angezettelt wird, wenn suggeriert wird,<br />
das Alter, die alten Menschen seien für den Rest der Gesellschaft, also für die Jungen und<br />
Mittelalterlichen, die sogenannte Sandwich-Generation, nicht mehr tragbar, wird es nur Verlierer<br />
geben: Junge und Alte. Wenn nun die dank der Errungenschaften des Sozialstaates überwundene<br />
Gleichung alt = arm durch den Mythos der teuren Alten, etwa in Form der Gleichung<br />
alt = krank und teuer ersetzt wird, erweist sich die Gesellschaft einen Bärendienst.<br />
Der Bundesrat hat im Februar 2005 einen Entwurf zur Neuordnung der Pflegefinanzierung<br />
vorgelegt. Neu soll nur noch die Behandlungspflege von der Krankenversicherung vollständig<br />
abgegolten werden. Die Behandlungspflege umfasst Handlungen wie beispielsweise einen<br />
Verband wechseln oder eine Injektion verabreichen. An die Grundpflege soll die<br />
Krankenversicherung inskünftig lediglich einen fixen Frankenbeitrag leisten. Zur Grundpflege<br />
gehört zum Beispiel die Unterstützung bei der Körperpflege, beim Ankleiden oder beim Essen.<br />
Diese an und für sich mögliche unterschiedliche Finanzierung von Grund- und Behandlungspflege<br />
kann zu negativen Mechanismen führen, z.B. dass die Dienstleister möglichst viele<br />
Massnahmen der Behandlungspflege „zuordnen“. Ein Beispiel: Eine Zuckerkrankheit wird mit<br />
Insulinspritzen (Behandlungspflege) anstatt mit Tabletten, die sich die Patientin oder der Patient<br />
selber zuführt (Grundpflege), behandelt, obwohl beide Massnahmen medizinisch gleichwertig<br />
sind.<br />
Die Pflege zu Hause soll darüber hinaus nach den Vorstellungen des Bundesrates mit einer<br />
Hilflosenentschädigung zur AHV mitgetragen werden. Diese soll neu bereits bei einer Hilflosigkeit<br />
leichten Grades ausgerichtet werden. Für Heimbewohnerinnen und –bewohner ist<br />
zudem vorgesehen, die Höchstgrenze von jährlich rund 30'000 Franken der Ergänzungsleistungen<br />
aufzuheben.<br />
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell hätte demnach in erster Linie eine Umverteilung<br />
der finanziellen Lasten zur Folge. Es hätte aber auch einen dämpfenden Effekt auf die Kosten-<br />
und Prämienentwicklung in der Krankenversicherung. Dies ist aus Sicht des Bundesrats<br />
zentral angesichts der demografischen Entwicklung, welche künftig Pflegeleistungen vermehrt<br />
in Anspruch nehmen lassen wird. Bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung der Pflegefinanzierung,<br />
längstens aber bis Ende 2006, hat das Parlament in der Herbstsession 2004 beschlossen,<br />
die 1998 eingeführten Rahmentarife grundsätzlich weiterzuführen. Damit wurden die<br />
Pflegetarife eingefroren.<br />
Nach der ersten Präsentation der Vorlage drehte sich die öffentliche Debatte vor allem um die<br />
in der Praxis nicht ganz einfach zu handhabende Aufspaltung zwischen Grund- und Behandlungspflege<br />
und die davon abhängige, unterschiedliche finanzielle Beteiligung der Krankenversicherer<br />
an den Kosten. Dabei wird verkannt, dass die Botschaft sich ganz grundsätzlich<br />
darüber auslässt, wie die Kosten eines Heimaufenthaltes, der nebst der Pflege ja auch<br />
Betreuung und Unterkunft umfasst, finanziert werden sollen. Der Bundesrat hat<br />
• das Verhältnis zwischen Eigenleistung und Sozialversicherungsleistungen (Krankenkassenleistungen,<br />
Hilflosenentschädigung und Ergänzungsleistungen) definiert und<br />
• Grundsatzentscheide zu Fragen bezüglich der Einführung einer Pflegeversicherung und<br />
altersabhängigen Krankenkassenprämien gefällt.<br />
Der Bundesrat will die immer wieder aufgebrachte Idee, die wirtschaftlichen Folgen der<br />
Pflegebedürftigkeit mit einer eigenständigen, zusätzlichen Sozialversicherung, einer Pflegeversicherung,<br />
wie es sie in Deutschland seit einigen Jahren gibt, aufzufangen, nicht mehr<br />
19 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
weiter verfolgen. Eine vernünftige Entscheidung: Erstens käme eine derartige Versicherung<br />
unverhältnismässig teuer zu stehen. Und zweitens müssten wesentliche Errungenschaften der<br />
sozialen Krankenversicherung, wie einheitliche Prämien für Erwachsene, unabhängig von<br />
Alter und Geschlecht, sowie der Wegfall von Versicherungsvorbehalten, im Langzeitpflegebereich<br />
eingeschränkt oder aufgehoben werden.<br />
Doch was ist zu tun,<br />
• wenn die Pflegekosten für viele Betroffene nicht mehr selber bezahlbar sind,<br />
• die Prämien der sozialen Krankenversicherung zur Deckung des Pflegerisikos nicht erhöht<br />
werden dürfen und<br />
• eine eigenständige Pflegeversicherung kein praktikabler Weg darstellt?<br />
Mit den Ergänzungsleistungen zur AHV steht zur teilweisen Neuregelung der Finanzierung<br />
der Altersgesundheitsversorgung ein bewährtes System bereit. Es hat schon seit 1987 für 60<br />
% der Heimbewohnerinnen und –bewohner Aufgaben der sozialen Krankenversicherung<br />
übernommen.<br />
Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV können also für zusätzliche Bevölkerungssegmente<br />
erschlossen werden. Dadurch werden die Prämienzahlenden inskünftig zu Lasten der Steuerzahlenden<br />
entlastet, was in diesem Bereich gesellschaftliche Solidarität verwirklicht. Überdies<br />
entfällt die für die Betroffenen unwürdige Auseinandersetzung darüber, ob die (an und für<br />
sich unbestrittenen) notwendigen Leistungen der Krankenpflege oder der infolge von Alter und<br />
Gebrechlichkeit notwendigen Betreuung zuzuordnen sind. Die Kosten werden insgesamt nicht<br />
reduziert, es ändert sich nur der Kostenträger.<br />
Auch wenn neu die Ergänzungsleistungen zur AHV in erhöhtem Ausmass Pflegekosten übernehmen,<br />
muss mit gesetzgeberischen Massnahmen dafür gesorgt werden, dass sich die<br />
Krankenkassen auch künftig - zumindest im heutigen Verhältnis - an den Pflegekosten beteiligen.<br />
Wenn ein Teil der Krankenpflege, nämlich die Langzeitpflege für alte Menschen ganz<br />
oder in hohem Mass vom Rest der Pflege abgekoppelt wird, kann dies ein erster und ernster<br />
Schritt zurück in den Fürsorgestaat sein. Wesentliche soziale Risiken würden nicht mehr -<br />
wenigstens teilweise - sozialversicherungsrechtlich, sondern nur noch „sozialhilfemässig“<br />
abgedeckt. Dadurch würden wichtige psychosoziale Gesichtspunkte bei der Gesetzgebung<br />
missachtet (vgl. Erwin Carigiet. Gesellschaftliche Solidarität, Prinzipien, Perspektiven und<br />
Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit, Helbing und Lichtenhahn, Basel/Genf/München<br />
2001).<br />
Leistungen, die nach dem Versicherungsprinzip ausgerichtet werden, werden im Allgemeinen<br />
als wohlerworben und wohlverdient wahrgenommen, da die Versicherten durch ihre Beiträge<br />
wesentlich zur Finanzierung beigetragen haben. Es geht um eigentumsähnliche Rechtsansprüche.<br />
Der Sozialhilfe fehlt dieser emanzipatorische Effekt. Demgegenüber werden die<br />
Ergänzungsleistungen zur AHV für das Risiko „Alter“ und die damit verbundenen Aufwendungen<br />
von der Bevölkerung zwar auch nicht „geliebt“, aber mittlerweile dennoch als notwendig<br />
und zweckmässig akzeptiert.<br />
Anzumerken bleibt, dass jedes Finanzierungssystem Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken<br />
in sich birgt. Wenn Akut- und Langzeitpflege unterschiedlich finanziert werden, besteht<br />
zum Beispiel die Gefahr<br />
• der übermässigen Reduktion der Aufenthaltsdauer in den Akutkliniken (zu frühe Überweisung<br />
in Rehabilitationseinrichtungen oder Pflegeheime – dadurch nehmen hier die akutmedizinischen<br />
Aufgaben in gleichem Masse zu),<br />
20 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
• des Einsatzes suboptimaler medizinischer Verfahren für „betriebswirtschaftlich weniger<br />
attraktive“ Patientinnen und Patienten,<br />
• der ungerechtfertigten Risikoselektion (Verlegung von „aufwändigen“ Patientinnen und<br />
Patienten in andere Spitäler oder sonstige Einrichtungen, verdeckte Verweigerung von<br />
Behandlungen aus wirtschaftlichen Gründen),<br />
• der teilweisen Abschiebung von stationär-indizierten Fällen/Behandlungen in den ambulanten<br />
Bereich.<br />
Derartige Mechanismen können in jedem Finanzierungssystem gefunden werden. Politisch<br />
und berufsethisch müssen diese Haltungen aufgedeckt und energisch bekämpft werden. Den<br />
Rahmenbedingungen und Anreizen für Leistungserbringer, Versicherer und Patientinnen und<br />
Patienten kommt deshalb besondere Bedeutung zu.<br />
4. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: die Heimpflegeversicherung der Schweiz<br />
Im Bereich der Absicherung kranker und pflegebedürftiger AHV-Rentnerinnen und -Rentner<br />
haben sich die Ergänzungsleistungen zur AHV geradezu zu einer Heimpflege-Versicherung<br />
entwickelt und stellen in der Gesundheitsversorgung eine wesentliche Säule für Heimaufenthalte<br />
und in einem geringeren Masse für spitalexterne Pflege und Betreuung dar. Da sich die<br />
Kosten der Pflegeheime übermässig entwickeln und die Leistungen der Krankenversicherungen<br />
an die Pflege seit 1998 stagnieren, beziehen heute z.B. ca. 45 % der EL-Berechtigten<br />
das Maximum an Ergänzungsleistungen.<br />
Der Wirkungskreis der Ergänzungsleistungen zur AHV hat sich weit aus den einkommensschwachen<br />
Segmenten in den Mittelstand hinein entwickelt: rund 60 % der in einem Altersoder<br />
Pflegeheim lebenden AHV-Berechtigten sind auf derartige Leistungen angewiesen.<br />
Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV werden die anfallenden anerkannten<br />
Ausgaben den Einnahmen gegenüber gestellt (vgl. Erwin Carigiet, Uwe Koch, Ergänzungsleistungen<br />
zur AHV/IV, Supplement, Schulthess, Zürich 2000). Die bestehende Differenz<br />
ergibt die Leistungshöhe. Bei Heimaufenthalten fallen in der Regel als Ausgaben an:<br />
• Grundtaxe des Heimes<br />
• Zuschläge für Pflege und Betreuung<br />
• persönliche Auslagen (im System der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wird hierfür ein<br />
pauschalisierter Betrag eingesetzt)<br />
• Krankenkassen-Prämien<br />
Als Einnahmen werden angerechnet:<br />
• AHV-Rente<br />
• Leistungen der Pensionskasse<br />
• Vermögensertrag und ein nach bestimmten Grundsätzen berechneter Vermögensverzehr<br />
• Leistungen der Krankenversicherungen<br />
Im Folgenden wird am (fiktiven) Beispiel der 87-jährigen Linda Meyer, einer allein stehenden<br />
AHV-Rentnerin, dargestellt, wie sie im Jahr 2005 ihren Pflegeheimaufenthalt finanziert.<br />
21 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Ausgaben (im Monat)<br />
Fr.<br />
Grundtaxe 4’715<br />
Pflegezuschlag 2’738<br />
Pers. Auslagen 500<br />
KK-Prämie 335<br />
Total 8’288<br />
Einnahmen (im Monat)<br />
Fr.<br />
AHV 2’150<br />
Pensionskasse 600<br />
Aus Vermögen 658<br />
KK-Leistung 2’738<br />
Total 6’146<br />
EL zur AHV/IV 2’142<br />
(max. Fr. 2'910)<br />
Total 8’288<br />
Die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen ergibt einen Betrag von Fr. 2'142 pro<br />
Monat. Maximal auszahlbar sind Ergänzungsleistungen zur AHV/IV von Fr. 2'910 pro Monat<br />
(dieses Maximum gilt in der Stadt Zürich: das Maximum setzt sich wie folgt zusammen: 175 %<br />
des Maximalbetrags für die allgemeinen Lebenskosten, erhöht um die regionale Durchschnittsprämie<br />
für die obligatorische Krankenpflegeversicherung). Die Rentnerin erhält somit<br />
Fr. 2'142 pro Monat und kann ihren Pflegeheim-Aufenthalt vollumfänglich finanzieren.<br />
Die Leistungen aus Linda Meyers Vermögen haben sich wie folgt berechnet:<br />
• Vermögensertrag (Zinssatz 1,5 %) Fr. 900<br />
• Vermögensverzehr: Vom Vermögen der AHV-Rentnerin in der Höhe von Fr. 60'000 wird<br />
zuerst die Freigrenze von Fr. 25'000 abgezogen, was ein anrechenbares Vermögen von<br />
Fr. 35'000 ergibt. Von diesen Fr. 35'000 muss sich Linda Meyer einen Fünftel als Vermögensverzehr<br />
anrechnen lassen, in diesem Fall somit Fr. 7'000.<br />
Pro Monat leistet die AHV-Rentnerin aus ihrem Vermögen somit einen Betrag von Fr. 658 an<br />
die entstehenden Heimauslagen.<br />
Mit den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV werden die teilweise bedeutenden Unterschiede<br />
und Ungleichheiten innerhalb der älteren Bevölkerung effizient ausgeglichen. Die<br />
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV werden auch für den wachsenden alternden Teil der<br />
Bevölkerung ausländischer Herkunft wichtig werden.<br />
Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV werden vollumfänglich aus Steuermitteln finanziert. Die<br />
Gesellschaft verwirklicht durch diese Art der Finanzierung gesellschaftliche Solidarität. Die zu<br />
übernehmenden Risiken sollen nicht vom Individuum allein getragen werden, weil sie struktureller<br />
Art sind.<br />
Beim Alter ist akzeptiert, dass es sich um ein strukturelles Risiko handelt, das nicht von den<br />
einzelnen Menschen allein getragen werden kann. Dies gilt insbesondere für den Aufwand in<br />
der Langzeitpflege. Die Eigenverantwortung zeigt sich in diesem Umfeld darin, dass bei der<br />
Berechnung der Leistungen das vorhandene Vermögen in einem bestimmten Umfang miteinbezogen<br />
wird. Dieses ist ja gerade auch im Sinne der 3. Säule für die besonderen Bedürfnisse<br />
im Alter angespart worden. Jene Menschen aber, die aufgrund ihrer bescheidenen<br />
Einkommens- und Vermögensverhältnisse gar nicht in der Lage waren, in diesem Sinne vorzusorgen,<br />
kommen vorbehaltlos in den Genuss von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV.<br />
22 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
5. Vermögen verscherbelt – soziale Absicherung durch Ergänzungsleistungen<br />
zur AHV/IV? Mechanismus gegen Missbrauch<br />
Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV werden Einkünfte und Vermögensteile, auf welche<br />
die Berechtigten verzichtet, d.h. die sie verschenkt (bzw. für die Vermögenshingabe keinen<br />
angemessenen Gegenwert erhalten) haben, bei der Leistungsbemessung angerechnet werden,<br />
wie wenn sie noch vorhanden wären. Diese Regelung ist ein wirksamer Mechanismus<br />
gegen Missbrauch. Voraussetzung ist allerdings, dass die Durchführungsstellen über Steuerregister<br />
und andere Abklärungen den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der<br />
Berechtigten auf einige Jahre vor der Gesuchstellung zurück nachgehen. Unerheblich ist<br />
dabei, ob beim Verzicht auf Einkommen oder Vermögen der Gedanke an Ergänzungsleistungen<br />
eine Rolle gespielt hat oder nicht.<br />
Bei der Prüfung relevanter Verzichtshandlungen ist jedoch zu beachten, dass das Zusatzleistungssystem<br />
keine gesetzliche Handhabe für eine wie auch immer geartete Lebensführungskontrolle<br />
bietet. Wie im gesamten Sozialversicherungsrecht ist bei der Durchführung der<br />
Verhältnismässigkeits-Grundsatz zu beachten. Nicht jede noch so kleine Ungereimtheit in den<br />
Vermögensverhältnissen ist zu „erforschen“.<br />
Die genaue Abklärung derartiger Tatbestände ist nicht als Einmischung in Privatangelegenheiten<br />
oder als Schikane gedacht, sondern dient der rechtsgleichen Behandlung aller<br />
Anspruchsberechtigten. Verzichtshandlungen führen zu Leistungskürzungen oder gar –verweigerungen.<br />
In solchen Fällen muss allenfalls die Sozialhilfe einspringen. Dann kommt unter<br />
Umständen das Instrument der Verwandtenunterstützung nach Art. 328 ff. ZGB zum Tragen.<br />
Dies erscheint besonders als gerechtfertigt, wenn nahe Angehörige zu einem früheren Zeitpunkt<br />
durch die Leistungsansprechenden begünstigt wurden, vor allem durch Schenkungen<br />
oder Erbvorbezüge. Die Verwandtenunterstützung, ein grundsätzlich eher nicht mehr zeitgemässes<br />
Instrument, macht in derartigen Fällen durchaus Sinn.<br />
Der beschriebene Mechanismus gegen Missbrauch lässt sich an einem Beispiel wie folgt<br />
illustrieren: Die weiter oben beschriebene Linda Meyer hat vor fünfzehn Jahren ihrem einzigen<br />
Sohn ihr Einfamilienhaus überschrieben. Die Liegenschaft hatte zum Zeitpunkt der Schenkung<br />
einen Steuerwert von Fr. 450'000 und einen Verkehrswert von Fr. 780'000. Sie machte<br />
ihrem Sohn, der mit seiner Ehefrau zusammen drei Kinder hat, dieses Geschenk, damit er in<br />
ihre Nähe ziehen konnte. Die AHV-Rentnerin mietete sich eine kleine Alterswohnung in einer<br />
benachbarten Siedlung. Als genügsame Frau verzichtete sie auf finanzielle Unterstützung<br />
durch den Sohn. Im Gegenteil, sie unterstützte ihrerseits die Familie immer wieder mit kleinen<br />
Geldgeschenken. Auf der Liegenschaft lastete eine Hypothek von Fr. 120'000. Diese übernahm<br />
der Sohn beim Eigentumsantritt.<br />
Die Durchführungsstelle für die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV hat bei der Gesuchstellung<br />
durch das Pflegeheim diesen Sachverhalt festgestellt. Sie wird der AHV-Rentnerin den<br />
seinerzeitigen Verkehrswert der Liegenschaft, verringert um die übertragene Hypothek<br />
anrechnen (zusätzlich vermindert um Fr. 10'000 pro Jahr seit die Schenkung erfolgte), wie<br />
wenn die Liegenschaft noch im Besitz der Rentnerin wäre. Dies führt dazu, dass die Linda<br />
Meyer ein so hohes Vermögen ausweist, bzw. einen entsprechenden Vermögensverzehr,<br />
dass sie nicht in den Genuss von Ergänzungsleistungen zur AHV kommt.<br />
In diesem Fall muss die Sozialhilfe der Gemeinde einspringen und den Fehlbetrag des Pflegeheim-Aufenthalts<br />
decken. Die Fürsorgebehörde wird ihrerseits an den Sohn gelangen und<br />
ihn um eine entsprechende Unterstützung ersuchen. Dadurch wird er allenfalls gezwungen<br />
sein, die Hypothek der Liegenschaft entsprechend zu erhöhen, damit der Heimaufenthalt<br />
seiner Mutter finanziert werden kann.<br />
23 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Ob der Sohn allenfalls Verrechnung mit Erbansprüchen gegenüber seinem früh verstorbenen<br />
Vater geltend machen kann, hängt davon ab, ob die Liegenschaft von seinen Eltern gemeinsam<br />
während der Ehe erworben oder von der Mutter in die Ehe eingebracht worden ist.<br />
Anzumerken bleibt, dass im Gegensatz zu Leistungen der Sozialhilfe die Ergänzungsleistungen<br />
zur AHV/IV ganz generell keinen Rückgriff auf die Verwandten auslösen. Ein solcher ist<br />
vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.<br />
D. Ausblick: Drei Thesen anstelle einer Zusammenfassung<br />
These 1<br />
Die Alterung der Gesellschaft ist etwas durchwegs Positives:<br />
• Wir leben länger, und wir leben auch länger gesund,<br />
• aber die Jahre, die wir am Schluss des Lebens mit Krankheit oder Gebrechlichkeit verbringen,<br />
werden auch mit dem medizinischen Fortschritt – wenigstens aufgrund des heutigen<br />
Wissensstandes – nicht notwendigerweise weniger.<br />
• Der medizinische Fortschritt kann und soll hier jedoch mit seinen aktuellen und seinen sich<br />
weiter entwickelnden Möglichkeiten der Schmerzlinderung und -bekämpfung fürsorglich<br />
Hilfe bieten.<br />
These 2<br />
Diagnostik und Therapie in allen medizinischen Bereichen sind von der alternden Gesellschaft<br />
betroffen und erfordern entsprechendes medizinisches Spezialwissen, das sich mit sozialmedizinischem<br />
Know-how in hohem Mass ergänzt.<br />
Die Alterung der Gesellschaft verlangt mithin nach der Schaffung von zusätzlichen Lehrstühlen<br />
der Geriatrie, der Pflegewissenschaft, der Hausarztmedizin und der Palliation. Dieses<br />
Wissen muss in der medizinischen und pflegerischen Grundausbildung allen Studierenden<br />
näher gebracht werden als dies heute geschieht.<br />
These 3<br />
Von einer pflegebedürftigen Person darf und kann verlangt werden, im Alter ihre laufenden<br />
Einkünfte (AHV-Rente, Hilflosenentschädigung, Renten der 2. Säule, Zinserträge) und ihr<br />
Vermögen zur Mit-Finanzierung der benötigten Langzeitpflege zu verwenden. Diese Mit-<br />
Finanzierung geht dem Erhalt des Erbes vor.<br />
Die soziale Krankenversicherung soll einen auf Gesetzesstufe definierten Beitrag an die<br />
Langzeitpflege im Alter leisten, der auch in Zukunft in etwa dem heutigen Niveau entspricht.<br />
Für die Langzeitpflege vor Erreichung des Pensionierungsalters sollen die Kosten durch die<br />
Krankenversicherung vollumfänglich übernommen werden, wie es das heutige Recht eigentlich<br />
vorsieht.<br />
Wenn die Vorsorgefähigkeit der Betroffenen fehlt oder eingeschränkt ist, sollen im Alter die<br />
Ergänzungsleistungen zur AHV die nicht gedeckten Pflegekosten vollumfänglich übernehmen.<br />
Dabei ist das System der Ergänzungsleistungen zur AHV als bewährte schweizerische Heimpflegeversicherung<br />
den dadurch entstehenden neuen Bedürfnissen anzupassen (Erhöhung<br />
24 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
der Leistungsgrenzen usw.). Pflegebedürftigkeit im Alter soll keine Sozialhilfebedürftigkeit<br />
auslösen.<br />
*****<br />
Schlussbemerkungen<br />
Es bedarf neuer Formen der Generationsbeziehungen. Diese sind heute nicht mehr allein<br />
darauf ausgerichtet, dass die Älteren ihr Wissen, ihr Vermögen und ihre Werte an die jüngere<br />
Generation weiter vermitteln - in der Hoffnung, dass die Jüngeren mit diesen Gütern etwas<br />
anfangen können. Es sind Probleme zu lösen, die sich so in den vorhergehenden Generationen<br />
noch nicht gestellt haben. In einer Gesellschaft des langen Lebens werden Generationsbeziehungen<br />
wesentlich dadurch gekennzeichnet sein, dass zwischen den Generationen<br />
lebenslange Beziehungen aufgebaut werden müssen.<br />
Die Gleichung alt = arm gilt heute in der Schweiz nicht mehr wie noch bis Anfang der 60er<br />
Jahre des 20. Jahrhunderts. Alter und Gebrechlichkeit bedeuten heute kaum mehr finanzielle<br />
Abhängigkeit von der Sozialhilfe oder von Verwandten – dank der AHV, der beruflichen Vorsorge,<br />
den Ergänzungsleistungen zur AHV und dank der sozialen Krankenversicherung und<br />
einer ausgebauten Gesundheits- und Heimversorgung. Dies soll auch in Zukunft so bleiben!<br />
25 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Funktionelle Gesundheit – die pädiatrische/heilpädagogische<br />
Sicht<br />
Ueli Bühlmann, Chefarzt Klinik für Kinder und Jugendliche, Stadtspital<br />
Triemli<br />
Definitionen / Einleitung<br />
"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the<br />
absence of disease or infirmity. – Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen,<br />
psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht einfach das Fehlen einer Krankheit<br />
oder einer Behinderung.” So steht es in der Präambel der Constitution of the World Health<br />
Organizations, die anlässlich der International Health Conference vom 19.- bis 22. Juni<br />
1946 in New York verabschiedet wurde, und welche am 7. April 1948 in Kraft gesetzt<br />
wurde.<br />
Funktionelle Gesundheit ist ein Begriff, der in seiner grundsätzlichen Form die Fähigkeit<br />
eines Menschen zur Ausübung der fundamentalen Aktivitäten im Alltag beschreibt. Diese<br />
Definition enthält auch die Aspekte psychosozialen Funktionierens, insbesondere das<br />
Erfassen, das Verhalten und das Ausfüllen einer bestimmten Rolle im sozialen Kontext.<br />
Für erwachsene Menschen beinhaltet dieser soziale Kontext unter anderem<br />
Alltagsaktivitäten wie Kochen, Einkaufen, Waschen und/oder andere Aufgaben, die in<br />
unserer Gesellschaft Erwachsenen zugeordnet werden. Kinder und Jugendliche befinden<br />
sich in sehr unterschiedlichen Stadien der psychosozialen Entwicklung, und entsprechend<br />
müssen auch die Ansprüche an ihr Funktionieren im Alltag angepasst werden.<br />
An drei Beispielen wird in der Folge aufgezeigt, welche enorme Bandbreite die Thematik<br />
der funktionellen Gesundheit in der Kinder- und Jugendmedizin einnimmt. Absichtlich wird<br />
in jedem Beispiel eine genetische Ursache für die Problemstellung gewählt. Dadurch soll<br />
eine gewisse (scheinbare) Gleichstellung der Ausgangslage erreicht werden, gleichzeitig<br />
lässt sich auf diese Weise auch demonstrieren, wie fehl ein Schwarz-Weiss-Denken am<br />
Platz ist, und welch differenzierte Ansätze der medizinischen Problemlösung geboten<br />
sind.<br />
Von der Ungewissheit im Spital zur Realität des Alltags Zuhause – oder:<br />
über die Genauigkeit von medizinischen Prognosen<br />
Im Regelfall erfolgt beim Menschen die Steuerung aller biologischen Funktionen durch die<br />
genetische Information, die in 46 Chromosomen gespeichert ist. Dabei lagern sich im<br />
Rahmen der Befruchtung je 23 Chromosomen von beiden Elternteilen zu Paaren<br />
aneinander. Selbst geringe Abweichungen führen zu Konsequenzen beim betroffenen<br />
Individuum.<br />
Eine mögliche Variante einer genetischen Störung besteht darin, dass ein Chromosom zu<br />
viel vorliegt, total also 47 Chromosomen in den Zellkernen gefunden werden. Ein Beispiel<br />
dafür ist die Trisomie 18, bei der, wie der Name sagt, das Chromosom Nr. 18 dreifach und<br />
nicht nur doppelt vorkommt. Anhand der Geschichte eines Kindes mit diesem<br />
Chromosomendefekt werden Schwierigkeiten für die Prognose und die daraus<br />
resultierenden Fragen diskutiert.<br />
Epidemiologische Daten zeigen, dass bei Trisomie 18 nur 5 – 10% der Kinder das erste<br />
Jahr überleben, und dies nur mit schweren Behinderungen. Entsprechend stellt sich die<br />
Frage für das medizinische Management: wie weit sollen die Massnahmen auf der<br />
Neonatologiestation gehen, insbesondere beim Auftreten von Komplikationen, und welche<br />
26 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
ethischen Überlegungen müssen in diesem Zusammenhang angestellt werden? Welche<br />
Schritte müssen unternommen werden, um trotz der belastenden Prognose eine<br />
Entlassung nach Hause zu ermöglichen?<br />
Aus diesem Beispiel lässt sich eine Kernfrage ableiten, die sich im Neugeborenen- und<br />
Säuglingsalter immer wieder stellt: wie weit ist man berechtigt, auf Grund<br />
epidemiologischer Daten Entscheide über Interventionen bei einem schwer behinderten<br />
Kind zu treffen? Welches sind allenfalls die anderen Faktoren, die einbezogen werden<br />
müssen? Das Ziel ist klar: ein ethisch solid abgestütztes Vorgehen soll es in enger<br />
Zusammenarbeit aller Beteiligten (Eltern, Pflegeteam, ÄrztInnen, u.a.m.) ermöglichen,<br />
einen für das betroffene Kind bestmöglichen Weg zu finden.<br />
Fazit: auch bei einer definierten medizinischen Ausgangslage lassen sich die<br />
Fragestellungen nicht nach schwarz – weissen Kriterien einteilen und einfache Lösungen<br />
sind kaum zu finden. Auch ein noch so kleines Individuum hat Anrecht auf eine<br />
differenzierte Beurteilung. Selbst ohne riesigen Aufwand lassen sich dabei erstaunliche<br />
Verläufe und Resultate beobachten – funktionelle Elemente auch bei schwerer<br />
Beeinträchtigung!<br />
Vom mongoloiden Kind zum Menschen mit Down Syndrom – oder: das<br />
Überwinden vorgefasster Meinungen<br />
Auch beim Down Syndrom handelt es sich um einen Zustand, der durch ein zusätzliches<br />
Chromosom bedingt ist. In diesem Falle ist das Chromosom 21 dreifach vertreten, was in<br />
der medizinischen Terminologie zum Ausdruck der Trisomie 21 geführt hat. Durch den<br />
charakteristischen Gesichtsausdruck, verbunden mit anderen deutlich erkennbaren<br />
Merkmalen, ist das Down Syndrom wohl eine der am besten bekannten chromosomalen<br />
Störung.<br />
Wirft man einen Blick in alte medizinische Lehrbücher, so finden sich erstaunliche<br />
Beschreibungen dieser betroffenen Kinder. Noch vor etwas mehr als dreissig Jahren, ja<br />
vielleicht auch noch später, wurden sie von Anfang an zu Randfiguren gestempelt.<br />
Entsprechend war das Thema der Förderungsmassnahmen für lange Zeit nicht existent.<br />
Die Kombination von körperlichen Stigmata, verbunden mit einer gewissen mentalen<br />
Einschränkung, reichte aus, um diese Menschen auszugrenzen.<br />
Im Rahmen eines Down Syndroms treten häufiger als in der übrigen Bevölkerung<br />
angeborene Herzfehler auf. Auch in der Behandlung dieser rein medizinischen Probleme<br />
wurden früher andere Massstäbe angelegt. Gewisse Operationen wurden bei den<br />
betroffenen Kindern nicht durchgeführt.<br />
Ein Projekt soll stellvertretend für andere zeigen, wie bei einer anderen grundsätzlichen<br />
Einstellung zur Problematik, verbunden mit den richtigen Fördermassnahmen, andere<br />
Ziele erreicht werden können. Im Rahmen des Projekts „Ohrenkuss“ sind junge Menschen<br />
mit Down Syndrom selbständig journalistisch tätig und redigieren eine eigene Zeitschrift.<br />
Sowohl die gewählten Themen, die darin publiziert werden, wie auch der erstaunliche Stil<br />
der Beiträge zeigen, welche Möglichkeiten Menschen mit Down Syndrom gegeben sind.<br />
Fazit: Möglichkeiten zur Förderung sind oft grösser, als dies aus einer traditionellen<br />
Sichtweise heraus erscheint. Es ist evident, dass durch eine fachgerechte Unterstützung<br />
Ziele erreicht werden können, welche den betroffenen Menschen ein hohes Mass an<br />
Selbständigkeit verleihen. In einer bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise bedeutet dies<br />
auch funktionelle Gesundheit!<br />
27 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Von der Mukoviszidose zur Cystischen Fibrose (CF) – oder: wie die Medizin<br />
Angaben zur Lebenserwartung korrigieren muss<br />
1935 wurden durch Carl Knauer im Rahmen einer Dissertation am Kinderspital Zürich<br />
zwei Fälle von Kindern publiziert, die an einer schweren Lungenerkrankung verstorben<br />
waren. Gleichzeitig wiesen diese Kinder aber auch Veränderungen an der<br />
Bauchspeicheldrüse auf, die zu grössten Ernährungsproblemen in der frühen Kindheit<br />
geführt hatten. Unter dem Begriff der „Mukoviszidose“ fand diese neu definierte Krankheit<br />
Einzug in die medizinische Weltliteratur. Verantwortlich für die Symptome ist ein<br />
Gendefekt auf dem Chromosom 7, der zu einer Fehlsteuerung verschiedener Vorgänge<br />
an den Membranen bestimmter Zellen im Organismus führt. Mit der Zeit werden die<br />
betroffenen Organe zunehmend geschädigt und in ihrer Funktion bis hin zum Tod<br />
eingeschränkt.<br />
Es würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, diese Krankheit detailliert zu<br />
beschreiben. Dagegen eignet sie sich sehr gut, um den Wandel der therapeutischen<br />
Massnahmen im Verlauf zunehmender Kenntnisse zu beschreiben. Aus einer Krankheit,<br />
die noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in den meisten Fällen im<br />
Kindesalter zum Tod geführt hat, ist eine Krankheit geworden, bei welcher die<br />
durchschnittliche Lebenserwartung weit ins Erwachsenenalter reicht.<br />
Kannte man anfänglich nur die Symptome der Lungen und der Bauchspeicheldrüse, so<br />
sind heute auch weitere Probleme bei der CF bekannt. Betroffen sind in unterschiedlicher<br />
Häufigkeit und Intensität auch andere Organsysteme. Daraus resultieren aufwändige<br />
Therapiemassnahmen, die je nach Schweregrad eine zeitlich grosse Belastung für CF-<br />
Betroffene darstellen. Es ist heute jedoch sehr gut dokumentiert, dass sich der<br />
therapeutische Aufwand lohnt, sind doch Hospitalisationen im Gegensatz zu früher<br />
seltener geworden.<br />
Eine wesentliche Änderung im Verlauf der CF brachte auch die Einführung der<br />
Lungentransplantation. So ist es möglich geworden, den schwerst lungenkranken<br />
Betroffenen wieder eine neue Perspektive zu bieten. Damit verbunden ist auch ein Schritt,<br />
der aus einem Zustand der schweren Invalidität wieder zu einer normalen Lungenfunktion,<br />
und damit auch wieder zu einer annähernd normalen Leistungsfähigkeit führt.<br />
Fazit: Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass schwere Krankheiten, die früher<br />
meist im Kindesalter zum Tode führten, einen völlig anderen Verlauf nehmen. Dies zwingt<br />
dazu, die Überlegungen auf therapeutischer Ebene ständig anzupassen. Ziel muss es<br />
sein, in jeder Phase einer Erkrankung einen optimalen Behandlungsweg zu finden, um<br />
den CF-betroffenen Menschen ein höchstes Mass an Autonomie, und damit an<br />
funktioneller Gesundheit zu ermöglichen.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Ein wesentliches Element in der Diskussion um funktionelle Gesundheit stellt die<br />
Autonomie des Individuums dar. In der Pädiatrie muss dies im Kontext der verschiedenen<br />
Entwicklungsstadien gesehen werden. Stehen beim schwer kranken kleinen Kind die<br />
Massnahmen für die Familie im Vordergrund, so steht in der Folge die Förderung des<br />
einzelnen Kindes oder Jugendlichen im Zentrum. Dabei stehen neben den klassischmedizinischen<br />
Therapien oft auch psycho-soziale Themen im Zentrum. Je weniger Kinder<br />
und Jugendliche, die durch chronische Krankheit oder Behinderung betroffen sind,<br />
marginalisiert werden, desto grösser werden ihre Entwicklungsmöglichkeiten, oder anders<br />
formuliert, desto grösser wird das Mass ihrer funktionellen Gesundheit.<br />
28 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Funktionelle Gesundheit - die geriatrische Sicht<br />
Daniel Grob, Chefarzt Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital Waid,<br />
Präsident der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG)<br />
Gesundheit hat viele Dimensionen: eine körperliche und eine psychische, aber auch eine<br />
soziale und eine ökonomische und nicht zuletzt – hier interessierend – eine funktionelle.<br />
Die Bedeutung der funktionellen Gesundheit ist bei alten, chronisch kranken Menschen<br />
überragend – deren Wiederherstellung das primäre Ziel medizinischer Interventionen.<br />
Entsprechende Massnahmen setzen geeignete diagnostische und therapeutische Methoden<br />
voraus, geschulte Mitarbeitende, die in funktionellen Kategorien denken und insbesondere<br />
ein Gesundheits- und Spitalsystem, welches diese Ziele unterstützt und entsprechende<br />
Strukturen (Kliniken, Abteilungen, Teams) unterhält.<br />
Gewisse Entwicklungen des modernen Akutspitals (Stichworte: Verkürzung der Aufenthaltsdauern<br />
unter Kostendruck und diagnosebezogene Fallkostenpauschalen; hohe<br />
Technisierung, Verlust der Einheit der Führung mit Fragmentierung der Berufsgruppen)<br />
stehen im Widerspruch zu den Bedürfnissen alter, chronisch kranker Menschen nach<br />
Wiederherstellung ihrer funktionellen Gesundheit.<br />
Im folgenden Beitrag wird dieses Spannungsfeld andiskutiert.<br />
Was meint „funktionelle Gesundheit“?<br />
Krankheiten und Unfallfolgen werden heute weltweit mit der von der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) entwickelten ICD-Klassifizierung („International Statistical Classification<br />
of Diseases“) beschrieben: Einer diagnostizierten Organerkrankung wird ein mehrstelliger<br />
Code zugeordnet. Dieses Klassifizierungssystem ist heute nach einer<br />
10. Revision weit verbreitet (ICD-10); es ist geeignet, z.B. Todesursachen zu beschreiben<br />
oder das Auftreten von Infektionskrankheiten in einer Gemeinschaft zu überwachen. Es<br />
wird auch benutzt als Grundlage der Leistungsvergütung („diagnosis related groups“ –<br />
Leistungs-vergütung über diagnosebezogene Fallkostenpauschalen).<br />
Allerdings liefert eine solche auf die Krankheiten von Organen bezogene Klassifizierung<br />
keine weiteren Informationen über den Gesundheitszustand der Menschen, d.h. zum Beispiel<br />
über deren Behinderungsgrad und ist damit bei chronisch und mehrfach kranken<br />
Menschen auch ein schlechter Prädiktor für die Aufenthaltsdauer im Akutspital oder den<br />
Ressourcenverbrauch.<br />
Die WHO hat deshalb bereits 1980 die erste Version einer ergänzenden Klassifikation<br />
vorgestellt, die „International Classification of Function, Disability and Health“, früher<br />
ICIDH-Klassifikation genannt, heute bekannt als ICF-Klassifikation. Diese beschreibt nicht<br />
Organkrankheiten, sondern bezieht sich auf Veränderungen der Körperfunktionen und –<br />
Struktur und der Einbettung des Individuums in die Gesellschaft. Im Diagramm 1 ist das<br />
Strukturmodell dargestellt, welches der ICF-Klassifikation zugrunde liegt und Behinderung<br />
beschreibt: Im Zentrum steht die Aktivität einer Person und damit deren Möglichkeiten zur<br />
autonomen Lebensführung oder indirekt deren Pflege- und Hilfsbedarf. Diese determinieren<br />
ihre Möglichkeiten der Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten („Participation“)<br />
und sind ihrerseits abhängig von veränderten Körperfunktionen und zugrunde liegenden<br />
Erkrankungen. Kontext-Faktoren spielen eine grosse Rolle, indem die Manifestation einer<br />
29 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Behinderung nicht nur von der Person selber abhängt, sondern ebenso sehr von<br />
Umgebungsfaktoren und persönlichen Faktoren.<br />
Abb. 1: ICF-Klassifikation (WHO)<br />
Funktionelle Gesundheit ist damit<br />
ein komplexes Konstrukt und von<br />
verschiedensten Faktoren abhängig.<br />
Deren Beschreibung beantwortet<br />
die wichtige Frage, was ein<br />
Mensch mit einer bestimmten<br />
Erkrankung tun kann oder nicht.<br />
Parameter der funktionellen<br />
Gesundheit sind auch wichtig zur<br />
Beurteilung der Aufenthaltsdauern<br />
im Akutspital oder der Ressourcen-Benützung<br />
im ambulanten<br />
Bereich.<br />
Vereinfacht ist funktionelle Gesundheit im Alter die Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen<br />
(„Alltagskompetenz“) und aktiv am sozialen Leben teilzunehmen.<br />
Die Alltagskompetenz im Alter<br />
Für alte und sehr alte Menschen ist neben den Schmerzproblemen diese Alltagskompetenz<br />
absolut zentral für die Beurteilung ihrer eigenen Befindlichkeit: Gesundheit wird<br />
daran gemessen, ob man noch fähig ist, sich selber zu versorgen und selbständig zu<br />
leben.<br />
Defizite in der funktionellen Gesundheit führen zu Pflege- resp. Hilfsbedarf. Funktionale<br />
Pflegebedürftigkeit ist der Endpunkt eines komplexen Prozesses, wobei zu berücksichtigen<br />
ist, dass viele spezifische funktionale Einschränkungen ein Leben zuhause nicht a<br />
priori verunmöglichen – die Kontextfaktoren (Wohnsituation, öffentlicher Verkehr, Verfügbarkeit<br />
von Hilfen, etc) spielen hier eine wesentliche Rolle.<br />
Was bedeutet funktionelle Gesundheit aus einer gesundheitspolitischen Sicht im Hinblick<br />
auf die Zunahme der älteren Bevölkerung ?<br />
Der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung ist wohl rasch wachsend, wird aber<br />
in der öffentlichen Wahrnehmung oft massiv überschätzt 1 . Eine kürzliche unselektierte<br />
Strassenumfrage des Fernsehmagazins 10 vor 10 zeigte, dass befragte Passantinnen<br />
und Passanten den Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung auf 50%, 60% oder<br />
sogar 70% schätzten (er beträgt in Tat und Wahrheit im Jahre 2003 15.7% und wird in<br />
den nächsten 30 Jahren auf gegen 25% steigen – siehe Grafik 3) 2 .<br />
1 Eine Folge der häufig kommunizierten Katastrophenszenarien in der Altersvorsorge?<br />
2 Pressemitteilung Bundesamt für Statistik April 2001: Markante Alterung zwischen 2005 und 2035.<br />
30 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Für alte und hochbetagte Menschen ist die Erhaltung der Selbständigkeit zentrales Anliegen<br />
– autonome Lebensführung das Ziel. Neuere Studien von Höpflinger 3 zeigen, dass in<br />
Zukunft die Zahl behinderter Lebensjahre eher sinken dürfte, dass damit die Zunahme der<br />
Lebenserwartung nicht zwingend mit einer Zunahme der Jahre in Behinderung verbunden<br />
ist. So stieg im Zeitvergleich<br />
zwischen 1981/82 und 1997/99<br />
die behinderungsfreie Lebenserwartung<br />
für 65-jährige Männer<br />
von 11.5 auf 13 Jahre, für<br />
Frauen sogar von 12 auf 16<br />
Jahre.<br />
Gut 2/3 der hochbetagten, über<br />
85-jährigen Menschen in der<br />
Schweiz sind selbständig und<br />
somit frei von funktional definierter<br />
Pflegebedürftigkeit. Insgesamt<br />
nur rund 10-12 % der<br />
über 65-Jährigen sind als pflegedürftig<br />
zu betrachten, wobei<br />
bei den 65- bis 74-Jährigen dieser<br />
Anteil gut unter 10 % liegt. Er steigt dann bei den über 85-Jährigen auf 30-35 % 4 .<br />
Moderne medizinische Interventionen, heute oft auf hohem technischem Niveau, können<br />
die Fähigkeit alter Menschen zur selbständigen Lebensführung unterstützen und verbessern<br />
– man denke hier an die Operationen des grauen Stars oder an Gelenksersatz-<br />
Operationen. Sie tragen auch zu einer Verbesserung der Behandlung von akuten Erkrankungen<br />
und deren Rehabilitation bei, was wiederum die Chancen erhöht, nach Unfall oder<br />
Krankheit die selbständige Lebensführung wiederzuerlangen.<br />
Die Alltagserfahrung zeigt zudem, dass bei hochbetagten, chronisch kranken Menschen<br />
Sterben nicht mehr den zentralen Stellenwert hat wie bei jüngeren Menschen. Sterben<br />
wird oft hingenommen als unabwendbarer Endpunkt des bis zu diesem Zeitpunkt bereits<br />
langen gelebten Lebens – was nicht hingenommen wird, ist die Aussicht auf eine lange<br />
Dauer von Pflegebedürftigkeit, schlechter Lebensqualität und Abhängigkeit.<br />
Medizin mit und beim alten Menschen bedeutet damit, die Alltagsfunktionen in das Zentrum<br />
der Bemühungen zu stellen. Dies setzt spezielle Methoden der Diagnostik voraus<br />
(multidimensionales geriatrisches Assessment) ebenso wie spezielle Methoden der<br />
Behandlung (Verbindung von akutmedizinischen mit rehabilitativen Methoden) 5 .<br />
Welche Versorgungsstrukturen sind nun geeignet, den Wunsch alter, chronisch kranker<br />
Menschen nach Unabhängigkeit zu unterstützen ? Genügen die jetzigen Strukturen ?<br />
3 Zusammenfassung in: Höpflinger F. Gesundheitliche Situation und Pflegebedürftigkeit älterer<br />
Menschen in der Schweiz. In: Carigiet E., Grob D. (Hrsg): Der alte Mensch im Spital –<br />
Altersmedizin im Brennpunkt. Eigenverlag des Gesundheits- und Umweltdepartementes der Stadt<br />
Zürich 2003<br />
4 Höpflinger F. siehe (2)<br />
5 Truttman B. Gilgen R. Das geriatrische Assessment und die geriatrische Rehabilitation:<br />
Kernmethoden altersmedizinischer Arbeit. In: Carigiet E, Grob D. (Hrsg): Der alte Mensch im Spital<br />
– Altersmedizin im Brennpunkt. Eigenverlag des Gesundheits- und Umweltdepartementes der<br />
Stadt Zürich 2003.<br />
31 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Unser Gesundheitssystem: Netzwerk oder Einbahnstrasse ?<br />
Das heutige Gesundheitswesen atmet weiterhin den Geist des 20. Jahrhunderts, in dessen<br />
Anfängen es mit zunehmendem, oft spektakulärem Erfolg gelang, akute Erkrankungen<br />
zu heilen (Infektionskrankheiten, Verletzungen, u.a.). Es ist geprägt von einem „linearen<br />
Paradigma“ 6 : Zunehmende Dominanz der hochspezialisierten akutmedizinischen Versorgung<br />
und damit Fragmentierung der Behandlungswege. Viele Versorgungsketten sind<br />
geprägt von der Vorstellung eines plötzlichen Krankheitseintrittes, der erfolgreich behandelt<br />
werden kann um den Patienten letztlich weitgehend geheilt in seine angestammte<br />
Umgebung zu entlassen. Von einer fortschreitenden Spezialisierung verspricht man sich<br />
optimierte Behandlungsabläufe.<br />
Dieses lineare Modell (hochspezialisiertes Akutspital / Rehabilitation / Langzeitpflege)<br />
kann nur erfolgreich sein, wenn vor einem plötzlichen Krankheitseintritt funktionelle<br />
Unabhängigkeit besteht und wenn der davon betroffene Mensch genügend funktionelle<br />
Reserven besitzt, die es ihm erlauben, nach durchgeführter Behandlung wieder an seinen<br />
funktionellen Zustand anzuknüpfen.<br />
Diese Bedingungen sind bei kranken, hochbetagten Menschen oft nicht gegeben: Sie<br />
leiden einerseits an mehreren Erkrankungen (was sich in hochspezialisierten Spitalsystemen<br />
als grosse Herausforderung herausstellt), und sie haben wenig Reserven in verschiedensten<br />
Bereichen: Kraftreserven, Ernährungsreserven, kognitive Reserven u.a.<br />
Gefordert wird für diese Gruppe von Menschen ein Netzwerkmodell, das sowohl Spitäler<br />
wie spitalexterne Pflege, Rehabilitation und Langzeitpflege einschliesst und damit u.a.<br />
auch präventiv-gesundheitsfördernd intervenieren kann.<br />
Damit hat die moderne Entwicklung der Akutspitäler aus der Sicht alter, chronisch kranker<br />
Menschen zwei Seiten:<br />
Einerseits ist die hohe Technisierung sehr altersgerecht. Sie gestattet es, mit wenig<br />
Belastung von Patientinnen und Patienten Diagnosen zu stellen und Behandlungen vorzunehmen<br />
(Beispiele sind die modernen bildgebenden Verfahren wie Computertomografie<br />
(CT) und Magnetresonanztomografie (MRI), die endoskopischen Methoden („Schlüsselloch-Chirurgie“)<br />
wie auch die immer ausgefeilteren Möglichkeiten der Labordiagnostik.<br />
Solche Abklärungen bilden die Grundlage der folgenden Behandlung und machen Ärztinnen<br />
und Ärzte bis zu einem gewissen Grad prognosefähig, was für den folgenden Einsatz<br />
der therapeutischen und pflegerischen Ressourcen entscheidend ist. Natürlich hat eine<br />
Patientin oder ein Patient das Recht, eine vorgeschlagene Behandlung abzulehnen – aber<br />
auch dies setzt die Kenntnis der zugrunde liegenden Erkrankung voraus, um rational<br />
zusammen mit dem Arzt/der Ärztin entscheiden zu können.<br />
Andererseits ist der Preis dieser hohen Technisierung aber eine zunehmende Spezialisierung<br />
und damit eine Fragmentierung der Behandlungsketten, was stark zunehmende<br />
Schnittstellenprobleme und damit einen hohen Kommunikationsbedarf bedeutet.<br />
Ein Akutspitalsystem, welches von zunehmender Fragmentierung und Spezialisierung<br />
geprägt ist, benötigt damit für chronisch kranke, von funktioneller Behinderung bedrohte<br />
alte Menschen ergänzend eine ihnen angepasste Struktur.<br />
6 Wächter M. Für eine solidarische Gesundheitspolitik. Der Reformprozess des schweizerischen<br />
Gesundheitswesens aus sozialpolitischer Sicht. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für<br />
Sozialpolitik 2004<br />
32 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Eine solche altersmedizinische Dienstleistung im Akutspital hat einerseits als offenes<br />
„Rettungssystem“ zu funktionieren und damit jene Menschen wieder ins Akutspitalsystem<br />
zurückzubringen, welche durch die hochspezialisierten Maschen zu fallen drohen; 7<br />
andererseits kann sie genügend Raum und Zeit für die Kommunikation und Vernetzung<br />
der verschiedenen Leistungserbringer zur Verfügung stellen (wobei diese Leistungserbringer<br />
nicht zwingend professionell sein müssen – die Bedeutung von informellen Hilfestellungen<br />
wie Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfegruppen, Freiwilligenorganisationen ist überragend<br />
und hat heute gerade in städtischen Agglomerationen noch ein hohes Potential).<br />
Es erstaunt deshalb mit Blick auf die heutigen Entwicklungen des Akutspitalsystems nicht,<br />
dass die Klinik für Akutgeriatrie in zunehmendem Masse PatientInnen aus anderen<br />
Spitälern aufnimmt, welche wegen der Polymorbidität dieser PatientInnen, ihrer chronischen<br />
Erkrankungen und des damit verbundenen hohen Rehabilitationsbedarfs an die<br />
Grenzen ihrer Möglichkeiten stossen.<br />
Akutgeriatrische Kliniken versuchen, die Behandlungsketten zu integrieren und High-<br />
Tech-Medizin im Sinne des Patienten zu nutzen ohne jedoch das Ziel, nämlich die Wiederherstellung<br />
der Alltagsfunktion, aus den Augen zu verlieren.<br />
Sie sind damit eigentlich eine real existierende Rückbesinnung auf die historisch angestammte<br />
Funktion von Spitälern, nämlich die Übernahme sozialer Verantwortung und die<br />
Erfüllung eines im wahrsten Sinne des Wortes gemeinnützigen Auftrags. 8<br />
Das folgende Beispiel mag illustrieren, wie wichtig es sein kann, moderne Medizin-Technologie<br />
zu nutzen und gleichzeitig dem Patienten genügend Raum und Zeit für Kommunikation<br />
und Entscheidungen zu belassen.<br />
Mehrfach und chronisch krank, von Pflegebedürftigkeit bedroht: Ein Beispiel<br />
Ein 87-jähriger, verheirateter Mann akkumulierte im Verlauf seines langen Lebens verschiedene<br />
chronische Erkrankungen: Eine Erkrankung seiner Gefässe mit Durchblutungsstörungen<br />
in den Beinen und im Gehirn, eine Herzerkrankung mit Zustand nach<br />
Herzinfarkt, eine Nierenerkrankung mit verschlechterter Nierenfunktion. Er lebte damit bis<br />
zu seinem Eintritt ins Spital selbständig zu Hause, Hilfestellungen in der Haushaltsführung<br />
erbrachte seine um einige Jahre jüngere Ehefrau.<br />
Zum notfallmässigen Spitaleintritt führte eine Verletzung am linken Fuss, die wegen der<br />
schlechten Durchblutung infizierte. In der chirurgischen Klinik musste ihm der linke Vorderfuss<br />
teilweise amputiert werden. Damit war das akute Problem fachgerecht gelöst, und<br />
ein jüngerer Patient in der gleichen Situation mit weniger Zusatzerkrankungen wäre dann<br />
nach der Wundheilung und der Anpassung entsprechenden Schuhwerks wohl problemlos<br />
nach Hause entlassen worden.<br />
7 Man kann diese Funktion der Klinik für Akutgeriatrie in Anlehnung an die grossen Velorennen<br />
(„Tour de Suisse“) als „Besenwagenfunktion“ bezeichnen: Der Besenwagen am Schluss des<br />
Fahrer-Feldes nimmt alle jene müden, maroden, gestürzten oder sonst wie behinderten<br />
Rennfahrer, die mit dem Rennverlauf nicht mehr Schritt halten können, wieder auf und bringt sie an<br />
den Zielort.<br />
8 Fritschi RM. Das Akutspital im Wandel der Zeit. In: Carigiet E, Grob D. (Hrsg): Der alte Mensch im<br />
Spital – Altersmedizin im Brennpunkt. Eigenverlag des Gesundheits- und Umweltdepartementes<br />
der Stadt Zürich 2003.<br />
33 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Dieser chronisch kranke, hochbetagte Patient schaffte dies jedoch nicht: Die Wundheilung<br />
verlief schleppend, der operative Eingriff zehrte an seinen eh schon sehr begrenzten<br />
Reserven.<br />
Die geriatrische Abklärung ergab als Befund wesentliche (zunächst versteckte) rehabilitationshemmende<br />
Faktoren wie eine ausgeprägte Ernährungsstörung (der Patient mochte<br />
nicht essen) und eine mittelschwere Depression.<br />
Der Patient war zudem äusserst ambivalent in Bezug auf seine Zukunftsvorstellungen:<br />
Einerseits äusserte er den Wunsch, am liebsten sterben zu wollen, wenn sein massiver<br />
Pflegebedarf sich nicht reduzieren liesse („nichts Schlimmeres als abhängig zu sein“),<br />
andererseits wünschte er am liebsten wieder zu seiner Frau nach Hause zu gehen.<br />
Zusammen mit dem Patienten wurde im Sinne eines „shared decision making“ ein<br />
Behandlungsprozess in die Wege geleitet, welcher die Grundlagen einer potentiell erfolgreichen<br />
Rehabilitation verbesserte: Optimierung der Ernährungssituation durch Einlage<br />
einer Ernährungssonde und medikamentöse Behandlung der Depression. Die Wundversorgung<br />
am Fuss wurde optimiert durch Anlegen von permanentem, leichtem Unterdruck<br />
(„Vac-Verbände“).<br />
Mit dieser High-Tech-Prozedur wurden dem Patienten die Chancen einer erfolgreichen<br />
Rehabilitation eröffnet, ohne eine Lebensverlängerung mit allen Mitteln zu erzwingen. In<br />
wöchentlichen Meetings wurde mit ihm und seinen Angehörigen der aktuelle Zustand<br />
ermittelt und die weitere Prozedur geplant. Das Ziel des Patienten bezog sich immer auf<br />
seinen funktionellen Zustand – und nicht auf sein Überleben.<br />
Solche Behandlungsprozesse sind einerseits sehr zeit- und kommunikationsintensiv und<br />
setzen ein gut vernetztes, interdisziplinäres Betreuungsteam voraus. Für Akutkliniken mit<br />
dem auf ihnen lastenden Druck bezüglich der Aufenthaltsdauern und der hochspezialisierten<br />
Abklärungs- und Behandlungsangebote sind solche speziellen Behandlungsprozesse,<br />
welche auch psychosoziale und rehabilitative Massnahmen integrieren, eine<br />
grosse Herausforderung. „Behandlung erfolgreich abgeschlossen, Patient weiterhin pflegebedürftig“<br />
– hier sind integrierte Ansätze notwendig.<br />
Diese Integration führt nicht a priori zu einer teureren Medizin – im Gegenteil, sie verhindert<br />
in fragmentierten, hochspezialisierten Gesundheitssystemen Über- und Fehlversorgung.<br />
Zum Schluss<br />
Alte und insbesondere chronisch kranke Menschen messen ihrer funktionellen Gesundheit<br />
überragende Bedeutung zu. Nichts ist für gesunde Menschen so bedrohlich wie die<br />
Vorstellung, langzeitig pflegebedürftig zu sein. Allerdings ist der Mensch auch ein sehr<br />
adaptationsfähiges Wesen: Viele Menschen lernen mit Behinderung und Pflegebedarf<br />
umzugehen und erhalten sich trotzdem eine subjektiv gute Lebensqualität. Mit chronisch<br />
kranken, alten Menschen diesen Weg zu wiedergewonnerer Selbständigkeit zu suchen<br />
und zu gehen – das ist die Hauptaufgabe der Akutgeriatrie – im Netz und Verbund mit<br />
Spitexorganisationen, Hausärztinnen und Hausärzten, Alters- und Pflegeheimen und<br />
informellen Hilfenetzen (Angehörige, Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfegruppen u.a.).<br />
Geriatrische Institutionen ersetzen nicht Akutspitäler – aber sie sind eine notwendige<br />
Ergänzung, um die gesundheitlichen Bedürfnisse alter, chronisch kranker Menschen zu<br />
erfüllen. Und dies ist gerade heute im Hinblick auf die Demografie wie auch auf die<br />
raschen Umwälzungen im Akutspitalsystem nötiger denn je.<br />
34 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Die Bedeutung des sozialen Umfeldes in sensiblen<br />
Lebensphasen der Frau<br />
Brida von Castelberg, Chefärztin Frauenklinik Maternité, Stadtspital Triemli<br />
Was wird unter sensiblen Lebensphasen der Frau verstanden:<br />
- Schwangerschaft und Geburt bzw. Übergang zur Elternschaft<br />
- eigene Krankheit<br />
- Erkrankung eines Kindes oder des Partners<br />
- unfreiwillige Untätigkeit<br />
- Erleben von häuslicher Gewalt<br />
Schwangerschaft und Geburt und der Übergang zur Elternschaft bedeuten den<br />
Übergang von einer Lebensphase in eine neue. Häufig muss die Frau ihren Beruf aufgeben<br />
oder ihre Arbeit reduzieren. Es ergeben sich auch Veränderungen im sozialen Netz:<br />
Kontaktpersonen gehen zurück, sowohl im Privaten als auch bei der Arbeit. Da Mütter<br />
auch ein Risiko für Arbeitgeber darstellen, wird es für sie schwieriger, die notwendigen<br />
Teilzeitanstellungen zu finden.<br />
Der Übergang zur Elternschaft ist eine Herausforderung, die nur mit guter sozialer Unterstützung<br />
entschärft werden kann. Mit der Hilfe durch Freunde und Verwandte sind auch<br />
flexible und bezahlbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten unabdingbar.<br />
Die Erkrankung eines Kindes oder des Partners sind Lebensphasen, in denen das<br />
soziale Umfeld wichtig ist. Vor allem, wenn ein Kind chronisch krank ist, ist es häufig die<br />
Frau, die ihren Beruf aufgibt und sich voll der Pflege des Kindes widmet.<br />
Die Erkrankung einer Frau, welche für eine Familie vor allem mit Kindern verantwortlich<br />
ist, kann zu Krisensituationen führen. In der Familie wird viel wenig wertgeschätzte und<br />
als selbstverständlich angesehene Sozialarbeit geleistet. Die eigenen Bedürfnisse werden<br />
dabei häufig vernachlässigt. Fällt nun eine Frau wegen eigener Erkrankung aus, so fällt<br />
das ganze soziale Gefüge zusammen. Vor allem, wenn zu Hause Kleinkinder betreut<br />
werden müssen, führt dies zu schwierigen Konfliktsituationen, wo eigene Gesundheit und<br />
Wohl der Familie gegeneinander abgewägt werden müssen.<br />
Unfreiwillig untätige Frauen: Wenn Kinder gross und selbständig sind und sich der<br />
Mann fremdorientiert hat, ist meist ein Wiedereinstieg in den ursprünglichen Beruf nicht<br />
mehr möglich. Zudem sind Frauen ab einem gewissen Alter zu teure Arbeitskräfte. Dies<br />
führt zu grossen Sinnkrisen und auch psychischen und psychosomatischen Erkrankungen<br />
bei diesen Frauen, die arbeitswillig und belastbar, aber nicht mehr gefragt sind. Dieses<br />
grosse Potential motivierter Arbeitskräfte sollte vermehrt für erschwingliche Kinderbetreuung<br />
eingesetzt werden.<br />
Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen: Das Büro für Gleichstellung von Frau und<br />
Mann der Stadt Zürich sowie die Frauenklinik Maternité des Stadtspitals Triemli führten in<br />
den letzten zwei Jahren eine grosse Untersuchung über dieses Thema durch. 4000<br />
Frauen wurden befragt, 47 % davon gaben detailliert Auskunft über ihre Gewaltbetroffenheit,<br />
10 % aller Frauen berichteten über erlebte häusliche Gewalt im Verlauf des letzten<br />
Jahres.<br />
35 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Häusliche Gewalt führt zu totaler Verunsicherung, da der Ort, der normalerweise Schutz<br />
und Geborgenheit bedeutet, zur Bedrohung wird. Es ist auch ein schambeladenes Thema<br />
und sowohl bei den Frauen als auch in der Gesellschaft ein Tabuthema. Bei vielen Frauen<br />
hat die erlebte häusliche Gewalt psychische und somatische Auswirkungen. Es erstaunt<br />
deswegen nicht, dass das Gesundheitswesen Anlaufstelle Nr. 1 für gewaltbetroffene<br />
Frauen ist. In unserer Klinik haben wir sämtliche Mitarbeitenden ausführlich zu diesem<br />
Thema geschult, und soweit möglich werden alle Frauen zu ihrer Gewaltbetroffenheit<br />
befragt.<br />
Die Beziehung zwischen Familie und Staat ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Familien<br />
können auf den Staat nicht verzichten, jedoch kann der Staat auch nicht auf Familien<br />
verzichten. Damit das grosse Potential an Wissen, Können und Kreativität der jungen<br />
Frauen dem Staat nicht verloren geht, sollten genügend bezahlbare und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Auch geeigneter Wohnraum, weg von Durchgangsstrassen, wo Kinder unbetreut spielen<br />
können, sollte für Familien reserviert sein. Da Familien mit Kleinkindern unbeliebte Mieter<br />
sind, sollten sie in städtischen Immobilien Priorität vor andern Mietern haben.<br />
In allen oben erwähnten Situationen sind Frauen nicht nur auf ihr privates soziales Umfeld<br />
angewiesen, sondern auch auf Unterstützung durch das Gesundheits-, Bildungs- und<br />
Sozialwesen.<br />
36 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Kurzvorstellung <strong>SVSP</strong><br />
In den über 75 Jahren ihres Bestehens hat die <strong>SVSP</strong> Anstösse zur Entwicklung der<br />
Sozialpolitik gegeben, sie begleitet, gefördert, kritisiert und sich dabei selbst gewandelt.<br />
Die Konstanten in diesem Wandel können mit fünf Stichwörtern charakterisiert werden:<br />
1. Das Diskussionsforum für die Sozialpolitik<br />
In der Vorkriegsphase, als Sozialpolitik vor allem eine Angelegenheit der Sozialpartner<br />
war, war die <strong>SVSP</strong> die Plattform auf der die Vorstellungen und Argumente in einer sachlichen<br />
Atmosphäre diskutiert werden konnten, vor dem Kampf auf der politischen Bühne.<br />
Nach dem zweiten Weltkrieg nahm sich der Bund des Auf und Ausbaus der Sozialversicherungen<br />
an, und die <strong>SVSP</strong> bot sich als Forum der Diskussion zwischen ihm und den<br />
Sozialpartnern an. Seit etwa 1980, als die Entwicklung der Sozialpolitik zu stagnieren<br />
begann, und erst recht in den neunziger Jahren angesichts der von verschiedenen Seiten<br />
proklamierten Krise des Sozialstaates tritt die <strong>SVSP</strong> mit Tagungen und Publikationen auf<br />
und versucht, die verschiedenen Kräfte der Sozialpolitik mit Impulsen und Ideen von ihren<br />
vorwiegend defensiven Standpunkten weg an einen Ort zu bewegen, an dem gemeinsam<br />
Lösungen für die schwierigen Probleme gefunden werden können.<br />
2. Gesamtschau der Sozialpolitik<br />
Die <strong>SVSP</strong> hat die Sozialpolitik immer als Ganzes gesehen. Diese Optik hat in den letzten<br />
Jahren an Bedeutung gewonnen, denn es zeigt sich, dass die bisherige Praxis der<br />
Segmentierung der sozialen Sicherheit keine tragfähigen Lösungen für die absehbaren<br />
sozialen Probleme mehr anbieten kann. Es geht darum, die Zusammenhänge zwischen<br />
den verschiedenen sozialen Risiken zu erkennen, zu einer Gesamtschau der Sozialversicherungszweige<br />
zu kommen und diese in die Suche nach Lösungen einzubeziehen. Das<br />
bedeutet auch, dass Zuständigkeitsgrenzen überschritten werden müssen, da noch auf<br />
absehbare Zeit die sozialen Risiken (z.B. Alter, Gesundheit, Existenzsicherung, Arbeit)<br />
sowohl rechtlich (ARVG, ALVG, Sozialhilfe usw.) und verwaltungsmässig (BSV, seco,<br />
Departemente der Kantone, Gemeinderessorts usw.) wie auch auf der Seite der Interessenvertreter<br />
von unterschiedlichen Strukturen wahrgenommen werden.<br />
37 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
3. Verknüpfung von Theorie und Praxis<br />
Die <strong>SVSP</strong> hat sich immer als Katalysator verstanden und den Dialog zwischen Politik,<br />
Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft verstärkt, weil sie der Überzeugung war und<br />
ist, dass nur gemeinsame Anstrengungen zu tragfähigen Lösungen führen. Ein Problem,<br />
das angeprangert werden muss, ist die vor allem in der Deutschschweiz sehr schwache<br />
Basis der Sozialpolitik-Wissenschaft : Es fehlt nach wie vor ein universitäres Institut, das<br />
sich kontinuierlich mit Sozialpolitik befassen würde Nationale Forschungsprogramme sind<br />
dafür kein Ersatz.<br />
4. Vorausdenken<br />
Was schon im Zweckartikel angelegt ist, hat die Arbeit der <strong>SVSP</strong> auch in der näheren<br />
Vergangenheit geprägt: 1983 rief die Vereinigung beispielsweise im Rahmen einer<br />
Tagung dazu auf, die Perspektiven der Sozialpolitik für das Jahr 2000 zu diskutieren.<br />
1989 hiess ein Tagesthema "Die schweizerische Sozialpolitik im Rahmen der Europäischen<br />
Union", 1996 befassten wir uns unter dem Titel "Mehr Föderalismus weniger soziale<br />
Sicherheit?" mit den sozialpolitischen Konsequenzen des Finanzausgleichs.<br />
5. Gesamtschweizerisch<br />
Von Anfang an hat sich die <strong>SVSP</strong> als gesamtschweizerische Organisation verstanden und<br />
sich bemüht, die zum Teil unterschiedlichen sozialpolitischen Grundpositionen zur<br />
Geltung kommen zu. lassen. Die letzten drei Präsidenten waren ein italienisch Bündner,<br />
ein Romand und ein Deutschschweizer.<br />
Trotz ihres Alters ist die <strong>SVSP</strong> hochaktuell. Sie stellt ein Forum für die unvoreingenommene<br />
Diskussion sozialpolitischer Fragen zur Verfügung, erarbeitet Unterlagen für die<br />
Behandlung wichtiger sozialpolitischer Probleme und informiert die Öffentlichkeit auf<br />
unabhängige Weise mittels Tagungen oder Publikationen zu laufenden oder bevorstehenden<br />
Entscheidungsprozessen im Bereich der Sozialpolitik.<br />
Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (<strong>SVSP</strong>)<br />
Mühlenplatz 3<br />
Postfach 85<br />
3000 Bern 13<br />
Tel. 031 326 19 20<br />
Fax 031 326 19 10<br />
38 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Kurzvorstellung INAG<br />
Institut universitaire Âges et Générations<br />
Universitäres Institut Alter und Generationen<br />
Istituto universitario Età e Generazioni<br />
Swiss Institute Ageing and Generation<br />
Universitäres Institut Alter und Generationen<br />
Valérie Hugentobler, collaboratrice scientifique<br />
Institut Universitaire Âges et Générations – INAG<br />
c/o Institut Universitaire Kurt Bösch<br />
Case postale 4176<br />
CH- 1950 Sion<br />
Tél. +41 (0) 27 205 73 00<br />
Fax +41 (0) 27 205 73 01<br />
e-mail : inag@iukb.ch<br />
39 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
INAG - im Dienst der Forschung über Generationenbeziehungen<br />
Am 12. Oktober 1998 wurde in Sion das Universitäre Institut 'Alter und Generationen'<br />
(INAG) gegründet. Unterstützt wurde die Gründung dieses Instituts einerseits durch den<br />
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und<br />
zwei Universitäten (Basel und Genf). Unterstützung erfolgte andererseits auch durch die<br />
Pro Senectute Schweiz, die Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie (SGG), das<br />
Universitäre Institut Kurt Bösch, den Kanton Wallis sowie mehrere Persönlichkeiten aus<br />
Wissenschaft, Altersarbeit und Politik.<br />
Das INAG versteht sich als Instrument der Kooperation, mit dem Ziel, die Beziehungen<br />
zwischen den Generationen in einer rasch wandelnden soziopolitischen Umwelt zu verstehen<br />
und zu verbessern. Seine Aufgabe besteht darin, an den Diskussionen über die<br />
Zukunftsoptionen zu Beginn des dritten Jahrtausends teilzunehmen.<br />
Information, Austausch, Weiterbildung, Forschung und Kooperation sind die Leitwörter,<br />
welche die Aktivitäten des Instituts bestimmen.<br />
Prof. Hermann-Michel Hagmann<br />
Präsident des INAG<br />
Die Ziele des Instituts<br />
Die Ziele<br />
Ausgangspunkt<br />
Allgemeine Zielsetzungen<br />
Die Ziele des Instituts sind die folgenden :<br />
a) Das INAG sichert die Kontinuität von Diskussionen und vertiefte Analysen über die mit<br />
Altern und Generationenbeziehungen verbundenen Fragebereichen, und dies in der<br />
gesamten Schweiz.<br />
b) In Zusammenarbeit mit den Universitäten und interessierten Fachhochschulen fördert<br />
das INAG die Entwicklung der Ausbildung und der angewandten Forschung in den unter<br />
a) angeführten Themenbereichen.<br />
c) Gleichzeitig strebt das INAG in seinen Themenbereichen die Diffusion von Informationen<br />
im allgemeinen und entsprechender Forschungsresultate im speziellen. Dies soll<br />
prinzipiell im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit den im Altersbereich tätigen<br />
Fachorganisationen und<br />
Institutionen durchgeführt werden.<br />
Der formelle Sitz des Vereins ist das universitäre Institut Kurt Bösch in Sion. Die Beziehungen<br />
zwischen dem Institut Kurt Bösch und dem INAG werden durch einen Vertrag<br />
geregelt.<br />
Ausgangspunkt<br />
Die demographische Alterung der Schweiz wird sich in den nächsten Jahrzehnten<br />
beschleunigen. Gleichzeitig führt das Eintreten neuer Generationen ins Alter auch zu<br />
neuen Werthaltungen und Vorstellungen zum Altern. Diese Entwicklungen haben bedeutsame<br />
sozial-, arbeitsmarkt- und gesundheitspolitische Auswirkungen. Auch die Generationenbeziehungen<br />
verändern sich aufgrund demographischer, familialer und sozial-politischer<br />
Entwicklungen rasch.<br />
Zur Bewältigung der neuen Entwicklungen von Altern und Generationenbeziehungen sind<br />
kontinuierliche wissenschaftliche Analysen und ihre systematische Umsetzung in die<br />
Praxis unabdingbar. Die letzten Jahre brachten der gerontologischen Forschung wichtige<br />
Impulse. Gefährdet ist jedoch weiterhin die Kontinuität in Lehre, Forschung und For-<br />
40 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
schungsanwendung. Der wissenschaftliche Austausch zwischen Fachleuten verschiedener<br />
Diszipline sowie der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis der Altersarbeit<br />
erfordern gerade in einem sich rasch verändernden Themenfeld, wie dies das Altern und<br />
die Generationenbeziehungen darstellen, immer wieder neue Denkansätze und einen<br />
stetigen fachlichen Gedankenaustausch. Ohne eine gezielte Förderung der Kontinuität<br />
gerontologischer Arbeiten und Diskussionen gehen bisher erarbeitete Kompetenzen und<br />
Kontakte wieder verloren.<br />
Allgemeine Zielsetzungen des INAG<br />
Das INAG strebt an, zusammen mit anderen Partnern aus den Universitäten und der<br />
Alterspraxis, fachliche Diskussionen und Analysen von Alters- und Generationenfragen zu<br />
garantieren. Damit soll in Zusammenarbeit mit den Universitäten und Fach-hochschulen<br />
die gerontologische Forschung und Lehre in der Schweiz gesichert und ausgebaut werden.<br />
Gleichzeitig soll die Diskussion und Diffusion von Forschungsresultaten gefördert<br />
werden.<br />
Das INAG ist explizit den drei folgenden Grundsätzen verpflichtet :<br />
a) Förderung von disziplinübergreifenden Austauschbeziehungen und Diskussionen zum<br />
Themenbereich Alter und Generationen<br />
b) Förderung gesamtschweizerischer und sprachübergreifender Perspektiven und Kooperation<br />
in der angewandten gerontologischen Forschung und Lehre.<br />
b) Förderung der Verknüpfung zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung<br />
und professioneller Altersarbeit.<br />
Diese Grundsätze bestimmen Form, Aufbau und Aktivitäten des INAG. Das INAG will<br />
bestehende universitäre Strukturen keineswegs duplizieren, sondern sein Ziel ist es, diese<br />
zu ergänzen. Deshalb wird der Aufbau eines flexiblen Kooperations- und Kompetenz-<br />
Netzwerkes angestrebt.<br />
Aktivitätsschwerpunkte<br />
Die Aktivitätsschwerpunkten des INAG in einer ersten Aufbauphase liegen auf vier<br />
Ebenen :<br />
a) Forum<br />
Das INAG bietet eine Plattform für Informationen und Diskussionen zu den Themenbereichen<br />
Alter und Generationen. Neben der Organisation gerontologischer Tagungen und<br />
interdisziplinärer Workshops ist zu diesem Zweck auch der Aufbau eines umfassenden<br />
Informationsdossiers und die Erarbeitung themenspezifischer Arbeitshefte vorgesehen.<br />
Damit sollen ForscherInnen, Studierenden, aber auch Fachleuten aus der Praxis theoretische,<br />
methodische und praktische Hilfsmittel für ihre gerontologische Weiterarbeit zur<br />
Verfügung gestellt werden.<br />
b) Weiterbildung<br />
Das INAG wird sich - in Zusammenarbeit mit den Universitäten - an der gerontologischen<br />
Weiterbildung (z.B. Postgraduierten-Programme) beteiligen, sei es durch Mitorganisation<br />
von Weiterbildungs-Modulen, sei es durch Bereitstellung von Lerneinheiten usw.<br />
c) Expertisen und Fachberatung<br />
Im Rahmen des INAG sollen fachliche Expertisen ent-wickelt werden, welche die angewandte<br />
gerontologische Forschung und ihre Umsetzung fördern (z.B. Liste wichtiger<br />
Forschungsfragen, Beratung bei der Planung von Forschungsvorhaben u.a.). Gleichzeitig<br />
sollen auch Expertisen erarbeitet werden, die für Anwender von Interesse sind (z.B.<br />
Expertisen über Zukunftsperspektiven, Fachberatung bei der wissenschaftlichen Evaluation<br />
von Projekten usw.).<br />
41 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
d) Forschung<br />
Das INAG arbeitet und kooperiert bei Forschungsprojekten zu Themenbereichen wie<br />
Lebensverläufe, Generationenbeziehungen, Lage und Probleme älterer Menschen, usw…<br />
Die wissenschaftliche Direktion und die Mitglieder des Komitees INAG waren an der<br />
Erarbeitung verschiedener Forschungsprojekte beteiligt, welche im Rahmen von NFP’s,<br />
SPP « Zukunft Schweiz » ausgearbeitet wurden. Diese Aktivitäten wurden in Zusammenarbeit<br />
mit Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates INAG und seines Netzwerkes realisiert.<br />
42 / 43
5. Zürcher Geriatrieforum Waid, 19. Mai 2005, Les extrêmes se touchent:<br />
Das Gesundheitswesen und die Fragilität am Lebensbeginn und Lebensende<br />
Kurzvorstellung SFGG<br />
Die Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie SFGG versteht sich als Vereinigung<br />
der in der Schweiz tätigen Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeinmedizin und Innerer<br />
Medizin mit abgeschlossener oder laufender Schwerpunktweiterbildung in Geriatrie<br />
(Altersmedizin) und weiterer geriatrisch interessierter Ärztinnen und Ärzte. Sie ist eine<br />
Schwestergesellschaft der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie SGG-SSG.<br />
Die SFGG hat zum Zweck<br />
ein Ort der Begegnung und ein Diskussionsforum für Geriater/Geriaterinnen und die<br />
anderen in der Schweiz im Bereiche der Geriatrie tätigen Ärztinnen und Ärzte zu sein;<br />
die Aufgaben im Bereich der Weiterbildungs- und der Fortbildungsordnung der<br />
Schweizerischen Ärztegesellschaft FMH für das Schwerpunktgebiet Geriatrie in<br />
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin SGAM und<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin SGIM wahrzunehmen;<br />
sich für eine qualitativ hochstehende Geriatrie einzusetzen und zur Sicherung deren<br />
Qualität beizutragen;<br />
die Zusammenarbeit mit den anderen Berufen und Personenkreisen, die sich mit den<br />
körperlichen, psychischen und sozialen Vorgängen im Laufe des Alterns befassen, zu<br />
pflegen;<br />
die Forschung und Entwicklung im Gebiete der Geriatrie anzuregen und zu<br />
unterstützen, und den akademischen Nachwuchs zu fördern;<br />
die Erkenntnisse in der Geriatrie und Gerontologie der Ärzteschaft zugänglich zu<br />
machen;<br />
das Verständnis für die Geriatrie und die Gerontologie bei allen Partnern im<br />
Gesundheitswesen und in der Öffentlichkeit zu fördern;<br />
für die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder unter Berücksichtigung der Anliegen der<br />
ganzen Ärzteschaft einzutreten;<br />
sich als ein aktiver und anerkannter Partner der ihr verwandten nationalen und<br />
internationalen Organisationen zu betätigen.<br />
Präsident der SFGG ist zurzeit Dr. med. Daniel Grob, Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie,<br />
Stadtspital Waid, Zürich. Ihre Geschäftsstelle befindet sich bei derjenigen der SGG-SSG<br />
im Spital Bern Ziegler.<br />
Präsident Dr. med. Daniel Grob, MHA, Chefarzt, Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital Waid, Tièchestr. 99, 8037 Zürich, daniel.grob@waid.stzh.ch<br />
Administration Geschäftsstelle SFGG•SPSG, Pia Graf-Vögeli, Spital Bern-Ziegler, 3001 Bern, Tel. 031 970 77 98, Fax 031 970 78 05,<br />
pia.graf@spitalbern.ch<br />
www.geriatrie-schweiz.ch<br />
43 / 43