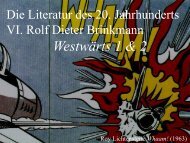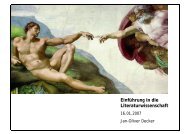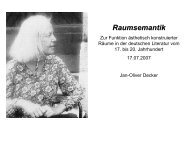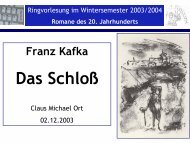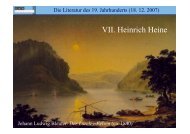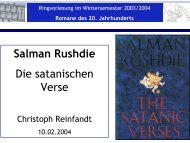Besprochene Situation - Literaturwissenschaft-online
Besprochene Situation - Literaturwissenschaft-online
Besprochene Situation - Literaturwissenschaft-online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einführung in die<br />
<strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
Jan-Oliver Decker<br />
05.12.2006
SPRECHSITUATION<br />
und<br />
BESPROCHENE SITUATION<br />
Fiktionale, textinterne<br />
Kommunikationssituation
textexterne Kommunikationssituation<br />
obligatorisch / real / notwendig<br />
Kanal / Kode / Referent<br />
Sender à à Empfänger<br />
Nachricht<br />
intendierte<br />
Bedeutung<br />
faktische Textbedeutung<br />
= Gegenstand der wissenschaftlichen<br />
Interpretation<br />
zugewiesene<br />
Bedeutung<br />
Drei Möglichkeiten der zuordenbaren Bedeutungen
Die fiktionale textinterne<br />
Kommunikationssituation, die literarische Texte<br />
wahlweise aufbauen können, ist grundsätzlich<br />
von der obligatorischen, realen und<br />
textexternen Kommunikationssituation zu<br />
unterscheiden.
„Davon schreibst Du eine<br />
Geschichte: aber süß! Keine aus<br />
der rabiaten Kiste! (Denn sie hatte<br />
den Leviathan gelesen.)“<br />
Arno Schmidt (1914–1979)<br />
Brand’s Haide (1951)
Das Sprecher-Ich in einem fiktionalen<br />
literarischen Text ist grundsätzlich und<br />
prinzipiell niemals mit dem realen Sender in<br />
einer realen textexternen<br />
Kommunikationssituation identisch und darf<br />
niemals mit diesem verwechselt werden.
Die Ebene der Sprechsituation:<br />
Die Sprechsituation ist der Kontext, in dem sich eine<br />
konkrete Äußerung ereignet. Die Sprechsituation<br />
beschreibt die Äußerung als Akt eines oder<br />
mehrerer Sprecher, die an einen oder mehrere<br />
Adressaten gerichtet sein kann und sich an einem<br />
bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit<br />
ereignet.<br />
Die Ebene der <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong>:<br />
Die <strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong> ist das in einer<br />
Sprechsituation Geäußerte. Zur <strong>Besprochene</strong>n<br />
<strong>Situation</strong> gehört all das, worüber geredet wird.<br />
Die <strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong> beschreibt die<br />
Äußerung als Inhalt.
Die Sprechsituation kann Teil der <strong>Besprochene</strong>n<br />
<strong>Situation</strong> sein, wenn in der <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> die<br />
Sprechsituation thematisiert wird.<br />
Die Sprechsituation ist eine hochrangige Textstruktur,<br />
von der der Stellenwert aller anderen Daten in einem<br />
Text abhängt.
textexterne Kommunikationssituation<br />
obligatorisch / real / notwendig<br />
Kanal / Kode / Referent<br />
Sender à à Empfänger<br />
Nachricht<br />
Fiktionale, textinterne Kommunikationssituation<br />
mögliche Sprechsituation in literarischen Texten
Ebene der SS 1 (Gesamttext)<br />
Sprecher 1 Adressat 1<br />
BS 1a<br />
Sprecher 2a<br />
= SS 2a (Teiltext) BS 1b<br />
= SS 2b<br />
Adressat 2a<br />
Sprecher 2b<br />
Adressat 2b<br />
usf.<br />
BS 2a<br />
BS 2b
Von einem Sprecher in einer Sprechsituation wollen wir<br />
künftig nur dann reden, wenn wir durch<br />
Personalpronomen („ich“, „wir“) oder<br />
Possessivpronomen („mein“, „unser“) in einem Text<br />
einen solchen Sprecher linguistisch fassen können.<br />
Aus der Existenz eines Sprechers kann dabei nicht<br />
notwendig auf die Existenz eines Adressaten<br />
geschlossen werden.
Von einem Adressaten in einer Sprechsituation wollen wir<br />
künftig nur dann reden, wenn wir durch<br />
Personalpronomen („du“, „ihr“) oder Possessivpronomen<br />
(„dein“, „ihr“) in einem Text einen solchen Adressaten<br />
linguistisch fassen können. Aus der Existenz eines<br />
Adressaten können wir hinreichend auf die Existenz<br />
eines Sprechers schließen, der den Adressaten<br />
anspricht.
Ebene der SS 1 (Gesamttext)<br />
Sprecher 1 Adressat 1<br />
BS 1a<br />
Sprecher 2a<br />
= SS 2a (Teiltext) BS 1b = SS 2b<br />
Adressat 2a<br />
Sprecher 2b<br />
Adressat 2b<br />
usf.<br />
BS 2a<br />
= SS 3a BS 2b = SS 3b<br />
Sprecher 3a<br />
Adressat 3a<br />
Sprecher 3b<br />
Adressat 3b<br />
usf.<br />
usf.
1. Fragen zu Sprecher und Adressat<br />
2. Fragen zur lokalen und temporalen Situierung der<br />
Äußerung und dadurch zu den Beziehungen von<br />
Sprecher und Adressat<br />
3. Fragen zur Beziehung von Sprechsituation und<br />
<strong>Besprochene</strong>r <strong>Situation</strong>
1. Fragen zu Sprecher und Adressat:<br />
Gibt es Sprecher und Adressat/en und wie manifestieren sich<br />
diese?<br />
Welche Merkmale lassen sich für Sprecher und Adressat/en<br />
ableiten (z.B. biologische, soziale, psychische usw. oder<br />
Geschlecht, Alter, Beruf, Aussehen, soziale Schicht, Bildung<br />
usw.).
2. Fragen zur lokalen und temporalen Situierung der<br />
Äußerung und dadurch zu den Beziehungen von Sprecher<br />
und Adressat<br />
Lassen sich Angaben zur raumzeitlichen Situierung von<br />
Sprecher/n und Adressat/en machen?<br />
In welcher Beziehung steht der Sprecher zum Adressaten:<br />
a) raumzeitlich bezüglich der Sprechsituation,<br />
b) bezüglich der allgemeinen Beziehung von Sprecher<br />
und Adressat in der besprochenen <strong>Situation</strong>?
3. Fragen zur Beziehung von Sprechsituation und<br />
<strong>Besprochene</strong>r <strong>Situation</strong><br />
In welchen raumzeitlichen Verhältnissen stehen Sprechsituation<br />
und <strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong> zueinander?<br />
a) SS ist gleichzeitig mit BS<br />
b) SS liegt zeitlich nach der BS<br />
c) SS liegt zeitlich vor der BS (Sonderfall z.B. bei<br />
göttlichen Offenbarungen und Prophezeiungen)
Wird die Sprechsituation in der <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> thematisiert und wenn<br />
ja, wie hoch ist ihr Anteil an der <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> und welche Größen<br />
des Sprechaktes werden thematisiert?<br />
In welcher Beziehung steht der Sprecher zur <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong>?<br />
Woher hat der Sprecher sein Wissen über die <strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong>?<br />
Wodurch ist der Sprechakt motiviert? Was ist der Sprechanlass und die<br />
Funktion des Sprechaktes?<br />
Wie sind die Modalitäten des Sprechaktes? Welches Medium, welcher Kode,<br />
welcher Texttyp wird gewählt? Welchen Stellenwert hat der Sprechakt<br />
beziehungsweise der geäußerte Text?<br />
Gibt es Sprecher- und/oder Adressatenwechsel?<br />
Gibt es verschiedene untereinander hierarchisierte Sprechebenen? In welcher<br />
Beziehung stehen diese einzelnen Sprechebenen in all ihren einzelnen<br />
Elementen zueinander?
Zusammenfall von Sprechsituation und <strong>Besprochene</strong>r<br />
<strong>Situation</strong><br />
Bsp.: „Hiermit verurteile ich Sie zu 3 ½ Jahren Gefängnis.“<br />
Deiktische Projektion<br />
Bsp.: „Rühren Sie jetzt das Puddingpulver in die kochende<br />
Milch.“
Jägers Nachtlied (1776)<br />
Im Felde schleich ich still und wild,<br />
Lausch mit dem Feuerrohr,<br />
Da schwebt so licht dein liebes Bild,<br />
Dein süßes Bild mir vor.<br />
Du wandelst jetzt wohl still und mild<br />
Durch Feld und liebes Tal,<br />
Und, ach, mein schnell verrauschend Bild<br />
Stellt sich dir’s nicht einmal?<br />
Des Menschen, der in aller Welt<br />
Nie findet Ruh noch Rast,<br />
Dem wie zu Hause so im Feld<br />
Sein Herze schwillt zur Last.<br />
Johann Wolfgang Goethe<br />
(1745-1832)<br />
Mir ist es, denk ich nur an dich,<br />
Als säh’ den Mond ich an;<br />
Ein stiller Friede kommt auf mich,<br />
Weiß nicht, wie mir getan.
Jägers Nachtlied<br />
Zusammenfall von Sprechsituation<br />
und <strong>Besprochene</strong>r <strong>Situation</strong>.
1. Die Abwesenheit des weiblichen „Du“ wird dem männlichen Ich-Sprecher<br />
des Nachts bei der Jagd in den Strophen 1 und 2 plötzlich bewusst.<br />
2. Die Vorstellung des weiblichen „Du“ löst dabei in Strophe 3 zuerst eine<br />
Unruhe des männlichen „Ich“ aus.<br />
3. Zugleich ist die Vorstellung des absenten weiblichen „Du“ aber nicht nur<br />
Auslöser der Unruhe des männlichen „Ich“ in Strophe 3, sondern führt<br />
auch zur Ruhe des „Ich“ in Strophe 4.<br />
4. Das männliche „Ich“ produziert aufgrund dieses Erlebens in der<br />
<strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> nun zeitgleich einen Sprechakt in einer<br />
volksliedhaften Form, in der das männliche „Ich“ im Augenblick des<br />
Erlebens dieses Erleben zeitgleich thematisiert. Sprechsituation und<br />
<strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong> fallen also in eins und sind identisch.
Sprechen ist in diesem Gedicht<br />
die Transformation eines Erlebens in eine<br />
Rede.<br />
Wir haben in diesem Gedicht ein Erleben,<br />
das eine Rede auslöst,<br />
in der das Erleben gleichzeitig in<br />
literarische Sprache,<br />
nämlich das Lied, überführt wird.<br />
Erlebnispostulatslyrik,<br />
Geniekonzept: Gleichzeitigkeit von Erleben<br />
und Dichten
Das Schloß am Meer (1805)<br />
Hast du das Schloß gesehen,<br />
Das hohe Schloß am Meer?<br />
Golden und rosig wehen<br />
Die Wolken drüber her.<br />
Es möchte sich niederneigen<br />
In die spiegelklare Flut;<br />
Es möchte streben und steigen<br />
In der Abendwolken Glut.<br />
"Wohl hab ich es gesehen,<br />
Das hohe Schloß am Meer,<br />
Und den Mond darüber stehen,<br />
Und Nebel weit umher."<br />
Der Wind und des Meeres Wallen<br />
Gaben sie frischen Klang?<br />
Vernahmst du aus hohen Hallen<br />
Saiten und Festgesang?<br />
"Die Winde, die Wogen alle<br />
Lagen in tiefer Ruh',<br />
Einem Klagelied aus der Halle<br />
Hört' ich mit Tränen zu."<br />
Sahest du oben gehen<br />
Den König und sein Gemahl?<br />
Der roten Mäntel Wehen,<br />
Der goldnen Kronen Strahl?<br />
Führten sie nicht mit Wonne<br />
Eine schöne Jungfrau dar,<br />
Herrlich wie eine Sonne,<br />
Strahlend im goldnen Haar?<br />
"Wohl sah ich die Eltern beide,<br />
Ohne der Kronen Licht,<br />
Im schwarzen Trauerkleide;<br />
Die Jungfrau sah ich nicht."<br />
Ludwig Uhland<br />
(1787-1862)
Ebene der SS 1 (Gesamttext)<br />
Sprecher 1 = unbesetzt<br />
Adressat 1 = unbesetzt<br />
Sprecher A =<br />
Adressat B<br />
SS 2a (Teiltext)<br />
Adressat A =<br />
Sprecher B<br />
Sprecher B =<br />
Adressat A<br />
SS 2b<br />
Sprecher A =<br />
Adressat B<br />
BS A<br />
BS B<br />
Zustand A des Schlosses<br />
Zustand B des Schlosses
Segment a: Strophe 1 bis 3<br />
(2 Strophen von Sprecher A, 1 Strophe von Sprecher B)<br />
Segment b: Strophe 4 und 5<br />
(1 Strophe von Sprecher A, 1 Strophe von Sprecher B)<br />
Segment c: Strophe 6 bis 8<br />
(2 Strophen von Sprecher A, 1 Strophe von Sprecher B)
• Fragen<br />
Sprecher A<br />
• Antworten<br />
Sprecher B<br />
• adressiert immer B explizit<br />
grammatikalisch als „Du“<br />
• redet von sich niemals explizit<br />
grammatikalisch als „Ich“<br />
• Seine Redeanteile stehen nie in<br />
Anführungszeichen.<br />
• adressiert niemals A explizit<br />
grammatikalisch als „Du“<br />
• redet von sich immer explizit<br />
grammatikalisch als „Ich“<br />
• Seine Rede steht immer in<br />
Anführungszeichen.<br />
Sprechsituation<br />
Sprecher A und Sprecher B sind hinsichtlich jeder textintern<br />
vorhandenen Kategorie der Sprechsituation oppositionelle<br />
Sprecher.
Zustand des<br />
Schlosses t1<br />
durch<br />
Sprecher A<br />
Zustand des<br />
Schlosses t2<br />
durch<br />
Sprecher B<br />
Sprechzeitpunkt t3<br />
Zeit<br />
t1<br />
„abends“<br />
t2<br />
„nachts“<br />
t3<br />
mehr als ein Tag<br />
unbestimmbare Zeitspanne
Sprecher A<br />
SS: Im Vergleich zur Rede von<br />
Sprecher A eher unmittelbarere und<br />
übergeordnete Rede ohne<br />
Anführungszeichen<br />
Sprecher B<br />
SS: Im Vergleich zur Rede von<br />
Sprecher A eher vermittelte und<br />
untergeordnete Rede in<br />
Anführungszeichen<br />
BS: Im Vergleich zu Sprecher B<br />
eher untergeordnetes Wissen,<br />
also eher untergeordnete Rede<br />
BS: Im Vergleich zu Sprecher A eher<br />
übergeordnetes Wissen, also eher<br />
übergeordnete Rede<br />
Der Status beider Sprecher oszilliert auf allen Ebenen der<br />
Sprechsituation und der <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> zwischen<br />
Überordnung und Unterordnung.
Status der Rede<br />
Sprecher A<br />
Sprecher B<br />
vs.<br />
übergeordnet<br />
˜<br />
˜<br />
untergeordnet<br />
vs.<br />
Sprecher B<br />
Sprecher A<br />
Wissen
Sprechsituation<br />
(nach Fragen von Sprecher A<br />
und Antworten von Sprecher B)<br />
Segment a: Strophe 1 bis 3<br />
Segment b: Strophe 4 und 5<br />
Segment c: Strophe 6 bis 8<br />
<strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong><br />
(nach den in den einzelnen<br />
Segmenten thematisierten<br />
Wahrnehmungen)<br />
Optische Wahrnehmungen:<br />
Äußeres des Schlosses und<br />
seiner Umgebung aus der<br />
Ferne<br />
Akustische Wahrnehmungen<br />
von Äußerem und<br />
Schlossinnerem, von Nicht-<br />
Menschlichem und<br />
Menschlichem<br />
Optische Wahrnehmungen<br />
Von Schlossinnerem und<br />
Menschlichem
Sprecher A und B<br />
• nicht in die BS involviert,<br />
außen stehend<br />
• uncharakterisiert<br />
Figuren<br />
• in die BS involviert<br />
• charakterisiert
Figuren in der <strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong><br />
• älter<br />
Eltern<br />
(„König“ und „Gemahl“)<br />
• jünger<br />
Kinder<br />
(„Jungfrau“)<br />
• derzeit herrschend<br />
• Träger sozialer Zeichen<br />
(Kleidung und Kronen)<br />
• verheiratet<br />
• künftig herrschend<br />
• Träger biologischer Zeichen<br />
(Schönheit und blondes Haar)<br />
• unverheiratet
In der Sprechsituation sind Ort,<br />
Zeitpunkt und Sprechanlass unbestimmt.<br />
Sprechsituation und <strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong> verhalten sich<br />
hinsichtlich ihrer lokalen und zeitlichen Situierung<br />
komplementär und oppositionell zueinander.
Sprechsituation<br />
Keine absolute und<br />
relative zeitliche und<br />
lokale Situierung der<br />
Sprechsituation möglich.<br />
<strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong><br />
Eine relative Situierung<br />
der zeitlichen Situierung<br />
und eine ziemlich genaue<br />
lokale Verortung der<br />
<strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong><br />
sind möglich.
Sprechsituation, Geschichte 1 des Dialogs<br />
von Sprecher A und Sprecher B<br />
Gesprächsanfang<br />
—<br />
(Leerstelle)<br />
Gesprächsmitte<br />
Gesamttext<br />
Gesprächsende<br />
—<br />
(Leerstelle)<br />
<strong>Besprochene</strong> <strong>Situation</strong>, Geschichte 2 von<br />
König, Gemahl und Jungfrau<br />
Ausgangszustand<br />
Textteile von<br />
Sprecher A<br />
Transformation/<br />
zentrales<br />
Ereignis<br />
—<br />
(Leerstelle)<br />
Endzustand<br />
Textteile von<br />
Sprecher B
SS<br />
G1<br />
—<br />
(Leerstelle)<br />
Austausch von<br />
Informationen über<br />
die Geschichte 2 in<br />
einem Dialog<br />
zwischen Sprecher<br />
A und Sprecher B<br />
—<br />
(Leerstelle)<br />
BS<br />
G2<br />
Ausgangssituation:<br />
• Übergeordneter<br />
Sprecher<br />
• Untergeordnetes Wissen<br />
• Kenntnis des früheren<br />
Zustands<br />
• Erwartung von Dauer<br />
• Setzen von Annahmen<br />
Transformation:<br />
—<br />
(Leerstelle:<br />
Tod der Jungfrau)<br />
Endsituation:<br />
• Untergeordneter<br />
Sprecher<br />
• Übergeordnetes<br />
Wissen<br />
• Kenntnis des<br />
späteren Zustands<br />
• Beweis von<br />
Wandel<br />
•Widerlegung von<br />
Annahmen
Der Tod der Jungfrau in der Geschichte 2 in der<br />
<strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> wird durch die Rede der<br />
außen stehenden Sprecher A und B auf der Ebene der<br />
Sprechsituation ersetzt.<br />
Der Tod der Jungfrau in der Geschichte 2 in der<br />
<strong>Besprochene</strong>n <strong>Situation</strong> ist also das zentrale Ereignis<br />
des Textes, das aber expressis verbis ungenannt<br />
bleibt.<br />
Realismus (1850 bis 1890)<br />
Realismus (1850 bis 1890)<br />
Uneigentliches literarisches Sprechen über<br />
Tiefenrealität „Tod“.