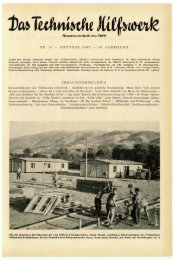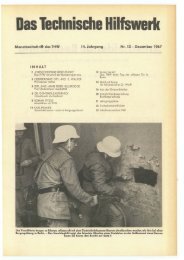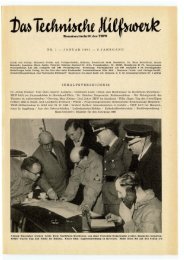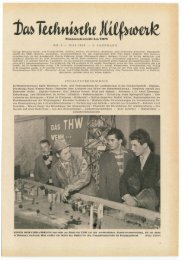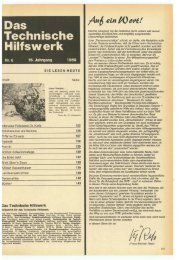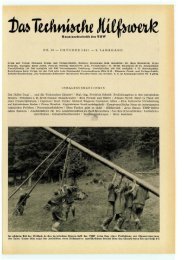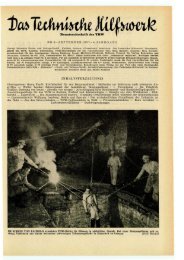INHALTSVERZEICH IS
INHALTSVERZEICH IS
INHALTSVERZEICH IS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
N R. 4 - A P R I L 1 9 5 6 - 3. J A H R G A N G<br />
Verlag: Rhenania Druck- und verlags-GmbH., Koblenz, Roonstr. (Pressehaus). Redaktion: "Das Technische Hilfswerk", Monatszeitschrift<br />
des THW, Koblenz, Görresplatz. Verantwortlichkeit für den redaktionellen Teil: Hans Haffner; Graphik: Max Suttner;<br />
verantwortlich für den Anzeigenteil: Hennig Fahlberg. Druck Rhenania-Druckerei, Koblenz. Fernruf für Verlag, Redaktion und<br />
Druckerei: Koblenz Sa.-Nr. 2301, Fernschreiber Nr. 086817. Beide Anschlüsse sind unter "Pl'essehaus" registriert. Anzeigen werden<br />
nach dem z. Z. gültigen Tarif Nr. 1 berechnet. Für die monatlich erscheinende Zeitschrift gelten folgende Bezugsbedingungen: Einzelpreis<br />
50 Pf, Abonnementspreise: Vierteljährlich DM 1,50 zuzüglich 25 Pf ortsübl. Zustellgeld; durch die Post vierteljährlich DM 1,50<br />
einschl. 10,2 Pf Postgebühren zuzügl. 9 Pf Zustellgeld. Jahresabonnement DM 6,- zuzügl. Nebenkosten. Direktversand vom Verlag<br />
50 Pi monatlich zuzügl. 15 Pf anteilige Porto- und Versandkosten. Bestellungen beim Verlag, bei der Post oder beim Buchhandel.<br />
Postscheckkonto Köln 2959 - "Rhenania" - Druck- und Verlags-GmbH., Zeitschriftenabteilung "Das Technische Hilfswerk" in Koblenz,<br />
Bankkonto: Rhein-Main Bank, Koblenz<br />
<strong>INHALTSVERZEICH</strong> <strong>IS</strong><br />
Dr. Otto Meli.bes: THW im Wdnterein.satz - Dipl.-Ing. W. Flentge: Die Vorteile beim Großverbundbetrieb - Dipl.<br />
Ing. A. Bantzer: Das Tätigkeitsfeld einer Kraftwerksbelegschaft - Oberingenieur Georg Feydt: Die Taktik der Bergungsarbeit<br />
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Schadenswirkungen - G. F.: Sprengausbildung für die Helfer<br />
des Bul-Dienstes - LuftschutZistreiflichter - Ein VorbdJd - Ortsverbände des THW am Werk - Ergebnis des PreisaUSiSchreibens<br />
"THW im Bilde" - Bücherschau - Zeitschriftemchau - Lehrgänge in Mal1ienthal<br />
Die THW-Helfer hatten in der Zeit d er Hochwasser- und Eisnot im Februar und März viel zu tun. Hab und Gut<br />
galt es zu retten, oft auch das Leben der Bedrohten, wenn sie sich selbst nicht mehr helfen konnten. (B ild Sting)
D,.. Otto Meibes:<br />
TDW iDl Wintereinsatz<br />
Dem verhättnismäßig milden Januar folgte eine Kälteperiode, wie sie an Umfang<br />
und Dauer selten vorkommt. Vorübergehende Temperaturmilderungen<br />
wurden von starken Schneefällen begleitet. Die Flüsse froren zu, an den<br />
Küsten von Nord- und Ostsee bildete sich Packeis. - Besondere Gefahrenquellen<br />
entwickelten sich u. a. an der Donau im Raum Vilshofen und am Rhein<br />
oberhalb der Loreley. An beiden SteHen waren starke Eisversetzungen entstanden,<br />
die das Wasser aufstauten und überschwemmungen hervorriefen.<br />
I<br />
Kampf mit dem Eis<br />
Schon in den ersten Februartagen<br />
wurden .Ortsverbände des THW zur<br />
Hilfeleistung bei Eisschäden eingesetzt.<br />
In Schifferstadt sprengten THW<br />
Helfer des Ortsverbandes Speyer die<br />
Eisdecke eines Baches von 300 m<br />
Länge, weil die Gefahr bestand, daß<br />
das Städtchen durch Rückstau überflutet<br />
wurde. Wenige Tage später<br />
wurden die niedriggelegenen Stadtteile<br />
von Vilshofen überschwemmt.<br />
300 Häuser mußten geräumt werden,<br />
1200 Menschen wurden obdachlos, der<br />
Notstand wurde ausgerufen. Helfer<br />
des Ortsverbandes Passau halfen bei<br />
der Bergung von Menschen und Hausrat<br />
sowie beim AufpickeIn und Abfahren<br />
einer dicken Eisdecke, die das<br />
abfließende Donauwasser hinterlassen<br />
hatte . .<br />
In der Gegend von Kaub staute das<br />
Eis das Wasser des Rheins in wenigen<br />
Stunden auf etwa sechs Meter über<br />
normal auf. Zur Beseitigung der Gefahr<br />
sollte das THW Eissprengungen<br />
durchführen. Weil das Eis zu mürbe<br />
war, war ein Betreten nicht möglich.<br />
Der Landesbeauftragte stellte jedoch<br />
Sprenggruppen aus den Ortsverbänden<br />
Mainz und Koblenz vorsorglich<br />
bereit.<br />
Kälte und Schneeverwehungen beeinträchtigten<br />
stellenweise den Eisenbahnverkehr<br />
erheblich. Signale und<br />
Weichen froren ein. Auf Anfordern<br />
der Deutschen Bundesbahn wurden<br />
THW-Helfer in Mainz und in Köln<br />
eingesetzt. In Köln erfolgte die Alarmierung<br />
von 40 Helfern in der Nacht<br />
zum Aschermittwoch. In enger Zusammenarbeit<br />
mit belgischen Truppeneinheiten,<br />
Bahnpolizei und Privatfirmen<br />
konnte hier in drei nächtlichen<br />
Einsätzen der Verkehr in Gang gehalten<br />
werden. Der Ortsverband<br />
Mannheim wurde für ähnliche Hilfeleistungen<br />
von der Deutschen Bundesbahn<br />
angefordert. Der Ortsver-<br />
2<br />
band Eckernförde konnte mit einem<br />
Räumkommando bei der Aufrechterhaltung<br />
einer für den Berufsverkehr<br />
wichtigen Strecke helfen.<br />
Mehrfach wurden Ortsverbände des<br />
THW zur Hilfeleistung in Hafenanlagen<br />
angefordert. Durch Eis und Niedrigwasser<br />
gerieten Schiffe in Gefahr.<br />
Am Rhein legten Helfer des Ortsverbandes<br />
Ahrweiler von einem 45 m<br />
vom Ufer entfernt eingefrorenen<br />
Lieferkahn vier untereinander verbundene<br />
Förderbänder und halfen<br />
mit der Feuerwehr die Ladung von<br />
150 t Briketts löschen. In Koblenz<br />
wurden mehrere eingefrorene private<br />
Wohnschiffe durch Abschlagen des<br />
Eises vor dem Sinken bewahrt. Der<br />
Ortsverband Ludwigshafen sprengte<br />
eine Eisbarriere an der Mündung des<br />
Hafens in den Rhein und erhielt dadurch<br />
die dort liegenden Schiffe<br />
schwimmfähig. Helfer des Ortsverbandes<br />
Bamberg befreiten ein eingeklemmtes<br />
Motorschiff vom Eis und<br />
schützten es vor dem Absacken. In<br />
Rosenheim am Inn wurde ein 50-t<br />
Schwimmbagger, der mit einer starken<br />
Eispackung abgetrieben war und<br />
sich an einer Brücke festgesetzt hatte,<br />
abgefangen, am Ufer verankert und<br />
so vor der Zerstörung gesichert.<br />
Diese Beispiele, die keinen Anspruch<br />
auf Vollständigkeit erheben,<br />
geben einen Einblick in die Vielgestaltigkeit<br />
typischer Wintereinsätze,<br />
die für die meisten beteiligten Ortsverbände<br />
neuartig waren.<br />
I!<br />
Vorbereitungen auf Hochwasserschutz<br />
Durch die anhaltende Frostperiode<br />
und die häufig eintretenden Schneefälle<br />
entstand in manchen betroffenen<br />
Gebieten in der Bevölkerung eine<br />
Angstpsychose vor dem kommenden<br />
Tauwetter, die schon fast an eine<br />
panikartige Stimmung grenzte. Andererseits<br />
nutzten die zuständigen<br />
Behörden die Zeit mit Ruhe und Umsicht,<br />
um Vorbereitungen zur Bekämpfung<br />
der zu erwartenden Hochwasserwellen<br />
zu treffen. Die Katastrophenausschüsse<br />
der Regierungen<br />
und Kommunalverwaltungen wurden<br />
einberufen, genaue Einsatzpläne besprochen,<br />
Materialien bereitgestellt,<br />
Alarmdienste eingerichtet und die<br />
Hilfeleistungen auf die vorhandenen<br />
Hilfs- und Schutzorganisationen verteilt.<br />
Auch das THW wurde neben<br />
Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und<br />
Bundesgrenzschutz an diesen vorbeugenden<br />
Maßnahmen beteiligt. Die<br />
Bevölkerung wurde durch die lokale<br />
Presse über die getroffenen Maßnahmen<br />
unterrichtet. Hierdurch trat eine<br />
wesentliche Beruhigung ein.<br />
Die THW-Verbände in den Katastrophengebieten<br />
bereiteten sich vorsorglich<br />
auf Einsätze vor. Einige besonders<br />
eifrige Ortsverbände veranstalteten<br />
übungen zur Abwehr von<br />
Eisgang und Hochwasser, für den Bau<br />
von Behelfsbrücken und Notstegen,<br />
für Eissprengungen, Brückensicherungen<br />
u. dgl. Auch das erforderliche<br />
Arbeitsgerätwurde vorsorglich sichergestellt.<br />
Die Landesbeauftragten der gefährdeten<br />
Gebiete erhielten laufend Wetter-<br />
und Wasserstandsmeldungen. An<br />
Hand früherer Einsätze wurden<br />
die voraussichtlichen Gefahrenbrennpunkte<br />
ermittelt, Vorsorgemaßnahmen<br />
getroffen und an die Ortsverbände<br />
weitergegeben.<br />
Die Hauptstelle Bonn bereitete sich<br />
vorsorglich auf einen überörtlichen<br />
Kräfte- und Materialausgleich vor.<br />
Der Direktor flog mit einem Hubschrauber<br />
die Gefahrenstrecken am<br />
Rhein ab und hielt weitere Hubschrauber<br />
für etwa notwendig werdende<br />
Einsätze, z. B. Abwurf von<br />
Sprengmunition bei Eisstockungen,<br />
bereit. Der Verwaltung des Bundeshauses<br />
wurde die Mitwirkung des<br />
THW neben der Hilfe des Bundesgrenzschutzes<br />
angeboten.<br />
II!<br />
Tauwetter bringt Eisgang<br />
Anfang März setzte das langerwartete<br />
Tauwetter ein. Warmluft wanderte<br />
schnell von Norden nach Süden.<br />
Regengüsse brachten das Eis zum<br />
Schmelzen und ließen das Wasser ansteigen.<br />
Kleine Gebirgsbäche wurden<br />
in kurzer Zeit zu reißenden Flüssen.<br />
An den großen Flüssen setzten sich<br />
die kilometerweiten Eisversetzungen<br />
in Bewegung.<br />
Der Eisgang der Nebenflüsse kam<br />
glücklicherweise etwas früher als<br />
derjenige an den Hauptströmen. Der<br />
geringe Vorsprung genügte, um die<br />
befürchteten großflächigen überschwemmungen<br />
zu verhüten; typische<br />
Hochwasserkatastrophen gab es meist<br />
nur örtlich. In den betroffenen Land-
... und s o packten die THW -Helfer zu<br />
•<br />
3
Eisstoß bei Vilshofen (Donau)<br />
strichen hatten die Ortsverbände des<br />
THW allerdings viel zu tun. Der Direktor<br />
des THW ordnete für diejenigen<br />
Landesverbände, in denen die am<br />
meisten bedrohten Gebiete lagen, sowie<br />
für die Hauptstelle jederzeitige<br />
Erreichbarkeit an.<br />
An den Küstengebieten half sich<br />
die Natur selbst: Die Packeisgefahr<br />
ging an der Nordsee durch Fluteinwirkung,<br />
an der Ostsee durCh starken<br />
Westwind vorüber. Nur in Hamburg<br />
mußte Z11r Sicherung des bekannten<br />
Alster-Pavillons v or überflutung<br />
durch Stauwasser ein Nachteinsatz<br />
erfolgen. THW-Helfer schöpften mit<br />
Eimer n das eingedrungene Wasser<br />
aus und verstopften die Einbruchsstelle.<br />
In Niedersachsen fanden überflutungen<br />
im Raum Celle statt, zu<br />
deren Bekämpfung die Ortsverbände<br />
Celle, Hannover und Salzgitter eingesetzt<br />
waren. Der Landesbeauftragte<br />
für Niedersachsen ordnete zu ihrer<br />
Unterstützung drei Einsatzwagen ab.<br />
Besondere Gefahrenpunkte en tstanden<br />
fast zu gleicher Zeit in der Gebirgsstrecke<br />
des Rheins, an der Donau<br />
und im Schwarzwald. Vom Landesverband<br />
Rheinland-Pfalz wurden<br />
über 200 THW-Helfer in mehr als<br />
6000 Einsatzstunden zur Bekämpfung<br />
der Hochwasserfolgen eingesetzt. Der<br />
junge Ortsverband Boppard errichtete<br />
mehrere Eisabweiser, die Uferstraßen<br />
und Hotels vor Eisstößen<br />
schützten. Der Ortsverband<br />
Koblenz brach durch umfangreiche<br />
Eissprengungen<br />
das mürbe gewordene Eis zwischen<br />
der Rheininsel Niederwerth<br />
und dem Ufer auf und<br />
stellte die Verbindung der<br />
völlig abgeschlossenen Einwohnerschaft<br />
mit der Außenwelt<br />
wieder her. Aus überfluteten<br />
Wohnungen und Kellern<br />
wurden Hausrat und wertvolle<br />
Maschinen geräumt. Mehrere<br />
Ortsverbände von Rheinland<br />
Pfalz sprengten Eisbarrieren<br />
und verhinderten ein überfluten der<br />
betroffenen Ortschaften, so u. a. Bad<br />
Kreuznach und Kirn. Andere Ortsverbände<br />
wie z. B. Mainz räumten<br />
wertvolles Gut von Lagerplätzen und<br />
bewahrten es vor der überschwemmung<br />
oder führten, wie in Worms,<br />
Sicherungsarbeiten an Gebäuden von<br />
Wassersportvereinen, Schwimmbädern<br />
und dergleichen durch.<br />
Die Ortsverbände von Baden-Württemberg<br />
waren in der kritischen Zeit<br />
an etwa 20 Stellen mit mehr als 300<br />
THW-Helfern über 4100 Stunden im<br />
Einsatz. Vielfach wurden sie in der<br />
Nacht alarmiert. Helfer der Ortsverbände<br />
Eßlingen und Stuttgart beteiligten<br />
sich unter Zuhilfenahme von<br />
Notstromaggregaten, Scheinwerfern<br />
und Schlauchbooten an der Evakuierung<br />
der Bevölkerung, hielten die<br />
Verbindung zu den vom Hochwasser<br />
abgeschnittenen Ortschaften und Gehöften<br />
aufrecht, wirkten mit bei der<br />
Wiederingangsetzung unterbrochener<br />
Stromversorgungen, befestigten beschädigte<br />
Dämme oder bewahrten<br />
wertvolle Fabrikanlagen vor überschwemmung<br />
und Beschädigung. Ähn-<br />
. liche Aufgaben erfüllten die Orts verbände<br />
Crailsheim und Heilbronn. Unter<br />
Lebensgefahr bargen THW-Helfer<br />
des Ortsverbandes Aalen Menschen,<br />
die sich vor den Fluten in eine Baumkrone<br />
geflüchtet hatten. In Nachteinsätzen<br />
wurden in Heidelberg Bew ohner<br />
Und Hausrat aus den überfluteten<br />
Stadtgebieten geborgen. Vielfach<br />
mußten Brücken durch Einbau von<br />
Eisbrechern oder durch Eissprengungen<br />
gesichert werden.<br />
Im Bereich des Landesverbandes<br />
Hessen kam es zu Einsätzen bei Lorch,<br />
in Stockstadt, bei Bruchmühle, Michelstadt<br />
und Limburg, an denen sich<br />
auch die Helfer der Ortsverbände<br />
Darmstadt und Frankfurt beteiligten.<br />
Sicherung unterbrochener Stromversorgungen,<br />
Eissprengungen, Verstopfung<br />
von Dammbrüchen, Räumung<br />
wertvoller Lebensmittellager waren<br />
auch hier notwendig.<br />
Besonders umfangreiche Einsätze<br />
erfolgten im Bereich des Landesverbandes<br />
Bayern. 20 Ortsverbände waren<br />
an 33 verschiedenen Stellen mit<br />
600 Helfern über 16000 Stunden im<br />
Einsatz.<br />
Auf die bedrohte Drei-Flüsse-Stadt<br />
Passau entfallen allein fast 7300 Einsatzstunden.<br />
Die Donau stieg hier in<br />
kürzester Zeit von 4,20 m auf etwa<br />
10 m. Zusammen mit allen Hilfsorganisationen<br />
beteiligten sich die THW<br />
Helfer - vielfach in Nachteinsätzen -<br />
an der Bergung von Bewohnern und<br />
Hausrat sowie der Räumung der Lager<br />
und Betriebe. Unweit Pass au<br />
konnten sie die zugefrorenen Grundschütze<br />
einer Kraftwerksanlage unter<br />
schwierigsten Umständen öffnen<br />
und das überlaufen des Wassers über<br />
das Staubecken verhindern. Der Landesbeauftragte<br />
für Bayern, der persönlich<br />
an Ort und Stelle war, entsandte<br />
Spezialfahrzeuge und Helfer<br />
zur Verstärkung nach Passau.<br />
Alle eingesetzten Ortsverbände des<br />
Landesverbandes Bayern mußten an<br />
den reißenden Flußläufen, die vielfach<br />
große Eismengen führten, zahlreiche<br />
Sprengungen durchführen, gefährdete<br />
Brücken absichern und sich<br />
unter schwersten Wetterbedingungen<br />
bei Tag und Nacht, oft in Dauereinsätzen,<br />
an der Bergung vo; Menschen<br />
und Gütern beteiligen. Sie haben sich<br />
alle in gleicher Weise bewährt. Einen<br />
Die Eiswüste des Rheins während der Februar-Frostperiode bei Kaub (links) und unterhalb von überwesel (rechts)<br />
4<br />
•
Dipl.-Ing. W. Flentge:<br />
Die Vorteile beim Gro6verbundbetrieb<br />
In Heft Nr. 4 vom Jahre 1955 wurden die Energie quellen, aus denen die elektrische<br />
Arbeit im Bundesgebiet fast ausschließlich gewonnen wird, nämlich<br />
Steinkohle, Braunkohle und Wasser, erwähnt und die zur Ausnutzung dieser<br />
Energiequellen verschiedenen Kraftwerksarten beschrieben. Nachstehend soll<br />
das Zusammenarbeiten der Kraftwerksarten im Verbund behandelt werden.<br />
Unter Verbund versteht man eine<br />
Verbindung von Kraftwerken zu betrieblichen<br />
Einheiten. Zweck dieser<br />
Verbindungen ist, die Belieferung der<br />
Abnehmer möglichst sicher und auch<br />
billig zu gestalten. Die größere Sicherheit<br />
der Belieferung wird dadurch<br />
erreicht, daß mehrere Werke an der<br />
Lieferung beteiligt sind, und die Verbilligung<br />
dadurch, daß in jedem einzelnen<br />
mit dem Verbundnetz verbundenen<br />
Kraftwerk weniger Reserveleistung<br />
an Kesseln und Maschinen<br />
vorhanden zu sein braucht.<br />
Laufend ansteigender Stromverbrauch<br />
hatte zur Folge, daß immer<br />
mehr Verbindungsleitungen gebaut<br />
werden mußten, um ausreichende<br />
Leitungsquerschnitte für den Ener- .<br />
gietransport zur Verfügung zu haben.<br />
Da die Übertragungsleistung einer<br />
Leitung mit dem Quadrat der Betriebsspannung<br />
wächst, die Baukosten<br />
aber nur proportional der Spannung<br />
zunehmen, erhöhte man im Laufe der<br />
Entwicklung die Betriebsspannung<br />
der Verbindungsleitungen immer<br />
mehr. Zwischen der Jahrhundertwende<br />
und dem Anfang des ersten<br />
Weltkrieges wuchsen die Betriebsspannungen<br />
von 10 kV auf 110 kV; die<br />
erste 220-kV-Leitung errichtete das<br />
RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)<br />
im Jahre 1929. Heute<br />
ist man bei Betriebsspannungen von<br />
380 kV (380 000 Volt) angelangt.<br />
Diese Erhöhung der Betriebsspannungen<br />
war der Anlaß zum übergang<br />
von ihnen hervorzuheben, würde bedeu<br />
ten, die Leistungen der übrigen<br />
zu schmälern.<br />
Das THW hat sich bewährt<br />
Wieder einmal ist ein Großeinsatz<br />
des THW vorüber, an dem mehr als<br />
1000 freiwillige Helfer in den verschiedensten<br />
Gegenden des Bundesgebietes<br />
ihre Hilfsbereitschaft und ihr<br />
technisches Können unter Beweis gestellt<br />
haben.<br />
Kennzeichnend für den Willen zum<br />
Helfen ist es, daß zahlreiche Ortsverbände,<br />
die nicht selbst zum Einsatz<br />
gelangt waren, ihren Landesverbänden<br />
die Hilleleistung dringend anboten_<br />
auf den Großverbundbetrieb. Unter<br />
Großverbundbetrieb versteht man die<br />
Verbindung von Kraftwerken auf<br />
verschiedenen natürlichen Energievorkommen.<br />
Die Nutzbarmachung<br />
der großen alpinen Wasservorkommen<br />
und auch der Flüsse zur Stromerzeugung<br />
war erst möglich, nachdem<br />
die Frage des Transportes der Energie<br />
gelöst war. Nachdem dies geschehen<br />
ist, ist der Ausbau sowohl der<br />
alpinen als auch der Flußwasserkräfte<br />
in allen Ländern im Gange.<br />
Da die Wasserkräfte erheblichen<br />
klimatischen und jahreszeitlichen<br />
Schwankungen unterliegen, muß<br />
außer ausreichenden Transportmöglichkeiten<br />
auch ein Netz vorhanden<br />
sein, das in der Lage ist, die anfallende<br />
Stromerzeugung aus Wasservorkommen<br />
jederzeit voll aufzunehmen<br />
und in Zeiten kleiner Wasserführung<br />
den Ausfall durch Wärmekraftwerke<br />
zu decken. Wenn diese<br />
Voraussetzungen erfüllt sind, lohnt es<br />
sich, die Wasserkraftwerke für die<br />
volle Ausnutzung des Wasserdargebotes<br />
auszubauen. Es folgt daraus<br />
aber auch die wirtschaftliche Verpflichtung,<br />
die kostenlos anfallende<br />
Wasserkraft jederzeit abzunehmen.<br />
Um dies sicherzustellen, werden sowohl<br />
die Wasserkraftwerke als auch<br />
die Wärmekraftwerke nach einem<br />
täglich festzulegenden Fahrplan eingesetzt.<br />
Dabei ist zu unterscheiden zwischen<br />
Grundlastkraftwerken, Fahrplankraftwerken<br />
und Spitzenkraft-<br />
Hervorzuheben ist auch die hervorragende<br />
Zusammenarbeit mit den zuständigen<br />
Behörden und allen beteiligten<br />
deutschen Hilfs- und Schutzorganisationen,<br />
zu denen sich an einigen<br />
Einsatzorten auch amerikanische,<br />
französische und belgische Einheiten<br />
gesellten. Es hat sich ferner bewährt,<br />
daß die Vorbeugungsmaßnahmen<br />
vielfach von langer Hand vorbereitet<br />
wurden. Die Einsätze haben schließlich<br />
eine beachtliche Steigerung der<br />
technischen Leistungen, insbesondere<br />
auf dem Gebiete von Eissprengungen,<br />
gezeigt. Behörden, Presse, Rundfunk,<br />
Fernsehfunk und schließlich die betroffene<br />
Bevölkerung selbst haben die<br />
Hilfeleistung des THW dankbar anerkannt.<br />
.<br />
werken. Als Grundlastkraftwerke<br />
werden betrieben:<br />
• 1. Laufwasserkraftwerke<br />
• 2. Braunkohlenkraftwerke (größtenteils)<br />
Als Fahrplankraftwerke werden im<br />
allgemeinen eingesetzt:<br />
• 1. Steinkohlenkraftwerke<br />
• 2. Braunkohlenkraftwerke (in<br />
kleinem Ausmaß)<br />
Die auftretenden Belastungsspitzen<br />
werden von den Spitzenkraftwerken<br />
gedeckt. Hierzu verwendet man:<br />
• 1. Mittlere Steinkohlenkraftwerke<br />
(auch älteren Jahrgangs)<br />
• 2. Speicherwasserkraftwerke (mit<br />
natürlichem Zufluß und Pumpbetrieb).<br />
Die Beteiligung der verschiedenen<br />
Kraftwerksarten an der Deckung des<br />
Energiebedarfs und ihr Einsatz auf<br />
Grund eines "Fahrplanes" soll an<br />
Hand des Bildes 1 erläutert werden.<br />
Im Bild 1 ist der ungefähre Verlauf<br />
der Belastung eines Netzes während<br />
eines Tages dargestellt. Die Belastung<br />
wird von den Verbrauchern bestimmt<br />
und muß von den Lieferwerken j ederzeit<br />
gedeckt werden. Der voraussichtliche<br />
Verlauf der Belastungskurve ist<br />
auf Grund von Erfahrungen bekannt,<br />
er wird beeinflußt von Jahreszeit und<br />
Wetter, und zwar ist die Belastung<br />
niedriger im Sommer und an hellen<br />
:ragen, höher im Winter und bei dunklem<br />
Wetter. Die höchste Belastungsspitze<br />
tritt im allgemeinen kurz vor<br />
Weihnachten auf.<br />
Die den Fahrplan festlegende<br />
Dienststelle setzt nun zunächst die<br />
Grundlastwerke ein, deren Leistung<br />
auf Grund von Meldungen über Wasserdargebot<br />
und Einsatzfähigkeit von<br />
Kesseln und Maschinen bekannt ist.<br />
Auf diese Leistungslinie wird die von<br />
den Fahrplankraftwerken zu liefernde<br />
Leistung aufgesetzt. Der noch verbleibende<br />
Rest der Netzbelastung<br />
muß von den Spitzenkraftwerken abgefahren<br />
werden. Einen Teil der Spitzenleistung<br />
übernehmen die älteren<br />
Dampfkraftwerke, die Abdeckung der<br />
kürzeren Spitzen überträgt man den<br />
Speicherwasserkraftwerken. An Hand<br />
dieses Fahrplanes fahren nun die<br />
einzelnen Werke. Die Grundlastwerke<br />
fahren ihre volle Leistung den ganzen<br />
Tag über aus, und die Fahrplanwerke<br />
halten sich an ihren Fahrplan. Nehmen<br />
wir nun einmal an, es herrsche<br />
bei der Normalfrequenz von 50 Hz<br />
in irgendeinem Augenblick gerade<br />
5
Gleichgewicht zwischen der Netzbelastung<br />
und der den Antriebsmaschinen<br />
'zugeführten Leistung. Tritt jetzt<br />
eine Zusatzlast auf, so wird, wenn<br />
den Antriebsmaschinen nicht mehr<br />
Energie zugeführt wird, die Frequenz<br />
absinken, weil die Zusatzlast der lebendigen<br />
Energie der Maschinen entnommen<br />
wird und dadurch die rotierenden<br />
Massen abgebremst werden.<br />
Es ist nun die Aufgabe des Spitzenwerkes,<br />
dafür zu sorgen, daß ständig<br />
die Frequenz 50 gehalten wird. Bei<br />
Bild 1: Tagesfahrplan für Verbundbetrieb<br />
a) Laufwasserkraftwerke<br />
b) Braunkohlenkraftwerke<br />
(Grundlastwerke)<br />
c) Steinkohlenkraftwerke (Fahrplanwerke)<br />
d) Steinkohlenkraftwerke<br />
e) Speicherwasserkraftwerke<br />
(Spitzenwerke)<br />
f) Abgabe an Speicherpumpen<br />
steigender Last muß das Spitzenwerk<br />
seinen Antriebsmaschinen zusätzlich<br />
so viel Energie zuführen, daß die Frequenz<br />
yon 50 Hz aufrechterhalten<br />
bleibt. Damit das Spitzenwerk Frequenzänderungen<br />
sofort erkennt, ist<br />
es erforderlich, daß sich alle anderen<br />
Werke, die auf das Netz arbeiten,<br />
nicht um die Frequenz kümmern,<br />
sondern genau ihren Fahrplan einhalten.<br />
Es ist durchaus möglich, daß<br />
die Aufgabe der Frequenzhaltung im<br />
Laufe eines Tages von dem einen auf<br />
das andere Werk übergeht.<br />
Aus der Belastungskurve ist weiterhin<br />
ersichtlich, daß die Belastungsänderungen<br />
in sehr kurzer Zeit vor sich<br />
gehen. Soweit die Spitzen von Dampfkraftwerken<br />
abgefahren werden, benutzt<br />
man bevorzugt Kessel und<br />
Turbinen, die ein schnelles Anfahren<br />
zulassen, die also bei schnellen Laständerungen<br />
keine unzulässige Materialbeanspruchung<br />
durch Wärmespannungen<br />
erleiden. Man greift daher<br />
häufig auf kleinere und mittlere Maschinen<br />
älterer Bauart zurück, deren<br />
erhöhter Kohleverbrauch für die kurze<br />
6<br />
Zeit ihrer Betriebsdauer in Kauf genommen<br />
werden kann.<br />
Von großem Wert für das Abdekken<br />
der Spitze sind aber die Speicherwasserkraftwerke,<br />
die in kürzester<br />
Zeit den Leistungsanforderungen<br />
nachkommen können. Da häufig der<br />
natürliche Zufiuß der Speicher nicht<br />
ausreicht, um große Wassermengen<br />
längere Zeit zu entnehmen, ist man<br />
dazu übergegangen, das während der<br />
Spitzenabdeckung durch die Turbinen<br />
abgeflossene Wasser während der<br />
Nachtstunden, also zu Zeiten<br />
geringer Nutzbelastung, wieder<br />
in die Speicher zurückzupumpen.<br />
Obgleich der Wirkungsgrad<br />
solcher Pumpspeicherwerke<br />
nur bei etwa 60 0 / 0<br />
liegt, lohnt sieh ihre Errichtung<br />
als Spitzenwerke.<br />
Der Großverbundbetrieb ist<br />
heute der Hauptträger der<br />
Elektrizi tä tserzeugung. Der<br />
Zusammenschluß der großen<br />
Kraftwerke über ein betriebssicheres<br />
Leitungsnetz und der<br />
wirtschaftliche Einsatz der<br />
Werkehaben na turgemäß auch<br />
die Bauformen und die Größenordnung<br />
der Kraftwerke<br />
und Maschineneinheiten ben<br />
einflußt. So wird z. B. durch die<br />
Abgabe von Strom an die<br />
Pumpspeicherwerke die tiefe<br />
Senke der Nachtbelastung<br />
(siehe f in Bild 1) aufgefüllt,<br />
und die Dampfkraftwerke<br />
können mit gleicher<br />
Belastung durchfahren, was<br />
sich günstig auf den Kohleverbrauch<br />
auswirkt. Um die<br />
Kohle mit bestem Wirkungsgrad<br />
zu verwerten und an<br />
Anlagekosten zu sparen, wurden<br />
die Kessel und Maschinen<br />
für immer größere<br />
Leistungen gebaut. Die Steigerung<br />
der Leistung je Maschineneinheit<br />
ist jedoch durch konstruktive und<br />
~caV~ ~<br />
500 0<br />
40 00<br />
30 00<br />
20 00<br />
/0 00<br />
:\ :<br />
\EiN>oit~wich t<br />
Ikg/kWJ<br />
,<br />
,<br />
Gr.1l .ist .<br />
rMWI<br />
T<br />
T<br />
•<br />
11<br />
''; •<br />
•... Wö,.",.vorbrollCl<br />
kcrii1kW1><br />
.~, ...... 7<br />
•<br />
'....<br />
;> f< ..<br />
~<br />
) ......<br />
~ .<br />
", .... ..<br />
MW kq/kW<br />
00 40<br />
1 80 ,]6<br />
/ 60 32<br />
/<br />
/ 20 U<br />
/ 00 20<br />
80 /6<br />
60 12<br />
40 8<br />
20<br />
0 o<br />
1900 1910 /920 1930 1940 1950 Jahr<br />
Bild 2: Grenzleistung, Einheitsgewicht<br />
und Wärmeverbrauch von Kondensationsturbinen<br />
o<br />
100<br />
90<br />
r 70<br />
-t<br />
~ 60<br />
'e<br />
~50<br />
g<br />
"><br />
I 40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0 +-----r----.-----r----,----JJ~I<br />
1900 1910 1920 1930 1940 1950<br />
Bild 3: MittLere Strompreise, bezogen<br />
auf Lebenshaltungsindex<br />
auch durch betriebliche Gesichtspunkte<br />
begrenzt . . Konstruktiv liegen<br />
die Schwierigkeiten in der Ausgestaltung<br />
der Endstufen von Kondensationsdampfturbinen.<br />
Betrieblich hat<br />
die Aufstellung sehr großer Maschinensätze<br />
nur Sinn, wenn ein Netz<br />
vorhanden ist, das einmal die große<br />
Leistung auch während der Schwachlastzeiten<br />
aufnehmen kann und das<br />
auch in der Lage ist, den Ausfall einer<br />
großen Maschine durch die übrigen<br />
auf das Netz arbeitenden Maschinen<br />
ohne zusätzliche Reservehaltung zu<br />
kompensieren. Maschinengröße und<br />
Gesamtleistung sämtlicher parallel<br />
auf das Verbundnetz arbeitenden<br />
Maschinen stehen also in einem gewissen<br />
Verhältnis zueinander. Mit<br />
zunehmender Leistung der Maschinen,<br />
zunehmendem Druck und zunehmender<br />
Temperatur des Dampfes fallen<br />
die Materialgewichte und der Wärmeverbrauch.<br />
Bild 2 zeigt die Grenzleistung, das<br />
Einheitsgewicht und den Wärmeverbrauch<br />
von Kondensationsturbinen.<br />
Der Großverbundbetrieb hat durch<br />
Steigerung der Maschinengrößen,<br />
Verringern der notwendigen Reserveleistung,<br />
bessere Ausnutzung der<br />
Werke und andere Maßnahmen eine<br />
erhebliche Verbilligung der elektrischen<br />
Energie herbeigeführt, deren<br />
Ausmaß aus Bild 3 ersichtlich ist.<br />
Hand in Hand mit der Verbesserung<br />
und Verbilligung der Stromerzeugung<br />
und Stromverteilung ging die<br />
Entwicklung der elektrischen Antriebsmaschinen<br />
und mannigfachen<br />
elektrischen Geräte. Der elektrische<br />
Betrieb hat sich wegen einer steten<br />
Betriebsbereitschaft und seiner Sauberkeit<br />
immer mehr eingeführt. Ohne<br />
Vorhandensein von elektrischer Energie<br />
ist ein geregelter Ablauf des<br />
öffentlichen Lebens nicht mehr denkbar.<br />
Die Steigerung des Stromverbrauches<br />
beträgt etwa 7,5 Ofo im Jahr,<br />
was einer Verdoppelung des Verbrauches<br />
in 10 Jahren entspricht.
D;pl.-lng. A. Banfzer:<br />
Das Tätig~keitsfeld<br />
eine r Kraftwerksbelegsehaft<br />
Nachdem in dieser Zeitschrift bereits mehrfach aus dem<br />
Gebiet der Elektrizitätsversorgung berichtet worden ist,<br />
dürfte es die Leser interessieren, zu hören, welche Aufgaben<br />
dabei dem Bedienungspersonal der Anlagen zufallen<br />
und wie der Betrieb organisiert ist. Es sei hier der<br />
Betrieb eines Dampfkraftwerkes der herkömmlichen Art<br />
betrachtet, der, wie man erkennen wird, recht vielseitig<br />
ist. Es müssen dabei gewisse Kenntnisse eines Kraftwerkes<br />
vorausgesetzt werden, da sonst dieser Aufsatz zU umfangreich<br />
werden würde. Wer nicht einen Lehrgang auf der<br />
fachtechnischen Schule des THW in Kiel besucht hat oder<br />
sonst etwas Bescheid weiß, sei auf den Artikel über das<br />
"Großkraftwerk Reuter" - zwischen Siemensstadt und<br />
Spandau - von Dipl.-Ing. W. Abraham in Nr. 6/55 verwiesen.<br />
Die Leitung eines Kraftwerkes hat<br />
der Betriebsdirektor, dem ein Stab<br />
von Betriebsingenieuren zur Seite<br />
steht, je nach Größe des Werkes von<br />
verschiedenem Umfang. Zumindest<br />
wird ein Ingenieur für den Dampfteil<br />
und ein Ingenieur für den elektrischen<br />
Teil vorhanden sein. Die Ingenieure<br />
werden unterstützt von den<br />
Meistern, die für die einzelnen Betriebe<br />
und Schichten sowie die Reparaturkolonnen<br />
eingesetzt sind.<br />
Außerdem gehört zur Betriebsleitung<br />
die Verwaltungsabteilung mit<br />
vorwiegend kaufmännischen Aufgaben<br />
(Buchhaltung, Lohnabrechnung,<br />
Einkauf, Lager), aber auch ein technisches<br />
und ein statistisches Büro sowie,<br />
nicht zu vergessen, ein chemisches<br />
Laboratorium für die laufende Untersuchung<br />
der Betriebstoffe (Kohle,<br />
Wasser, Öl) und sonstiger Materialien.<br />
Da bekanntlich die Kraftwerke mit<br />
wenigen Ausnahmen Tag und Nacht<br />
durchlaufen müssen, ist das Bedienungspersonal<br />
der Betriebsanlagen in<br />
drei Schichten (je acht Stunden) tätig.<br />
Daneben gibt es eine große Zahl Einschichter,<br />
insbesondere die Handwerker<br />
für die Instandhaltung.<br />
Wenn wir nun die Betriebsabteilungen<br />
dem Fertigungsgang entsprechend<br />
vom Rohstoff Kohle bis zum<br />
Fertigprodukt Strom durchgehen, so<br />
kommt zuerst also die Abteilung Bekohlung,<br />
die die mit Bahn oder Schiff<br />
ankommende Kohle zu entladen und<br />
in die Kesselhäuser zu fördern, bzw.<br />
zwischenzeitlich auf Lager zu nehmen<br />
hat. Dazu dienen mechanische Einrichtungen<br />
wie Greiferkrane, Waggonkipper,<br />
Becherwerke, Elektrohängebahnen<br />
und Förderbänder, die<br />
in verschiedenen Zusammenstellungen<br />
vereinigt und verwendet werden.<br />
Sie werden von Elektromotoren angetrieben<br />
und sind von dem Betrrlebspersonal<br />
ein- und auszuschalten sowie<br />
auf richtiges Arbeiten zu überwachen.<br />
Die Bedienung von Krananlagen erfordert<br />
besonderes Geschick und<br />
übung. Trotz dieser vollständigen<br />
Mechanisierung der Kohlenförderung<br />
beansprucht dieser Betriebsteil verhältnismäßig<br />
viel Leute, vor allem<br />
bei den Braunkohlenkraftwerken. Der<br />
Bedienungsmann muß nicht nur mit<br />
seiner maschinellen Einrichtung vertraut<br />
sein, sondern auch in dem ganzen<br />
Bekohlungsbetrieb und mit den<br />
Anforderungen des Kesselhauses an<br />
die Kohlenversorgung genau Bescheid<br />
wissen.<br />
Niit der Bekohlung meist organisatorisch<br />
durch gemeinsame Spitze von<br />
Betriebsingenieuren und Meistern<br />
verbunden ist der Entaschungsbetrieb.<br />
Die Entaschung der Kessel erfolgt<br />
nicht mehr durch Handabzug, der nur<br />
noch in veralteten Anlagen zu finden<br />
sein mag, sondern auf mechanischem,<br />
hydraulischem oder pneumatischem<br />
Weg, wodurch das Personal gegen<br />
Staub- und Hitzeeinwirkung in der<br />
Turbinenleitstand<br />
Hauptsache geschützt ist. Dafür stellt<br />
die Bedienung von Entaschungsapparaturen<br />
oder Pumpen höhere Anforderungen<br />
als die frühere Handarbeit.<br />
Auch im Kesselbetrieb ist die Handbedienung<br />
der Feuerung durch die<br />
Heizer verschwunden und ersetzt<br />
worden durch mechanische Roste<br />
oder Kohlenstaubfeuerungen, wodurch<br />
erst die großen Dampfleistungen<br />
der Kessel erzielt werden konntf'n.<br />
Die Beobachtung der Feuerwirkung<br />
auf die Dampferzeugung im<br />
Kessel, die durch zahlreiche Instrumente<br />
auf dem Kesselpult ermöglicht<br />
wird, erfordert die richtigen Rückschlüsse<br />
zur Bedienung .der mechanischen<br />
Feuerung oder der Kohlenstaubmühlen<br />
und der Luftzuführung,<br />
die außer durch den Schornsteinzug<br />
noch durch Unterwind- und 'oder<br />
Saugzugventilatoren geregelt werden<br />
kann. Der Dampfkessel ist im Lauf<br />
seiner neuzeitlichen Entwicklung immer<br />
mehr zu einer Maschine mit<br />
vielen Einzelantrieben geworden, so<br />
daß auch große Einheiten von einem<br />
Mann bedi~nt werden können, ja es<br />
ist so weit gekommen, daß der Bedienungsmann<br />
eines Groß kessels in der<br />
abgeschlossenen Kesselwarte sitzt<br />
(siehe Abbildung zum obengenannten<br />
Aufsatz in Nr. 6/1955) und nur nach<br />
den Instrumenten den Kessel fährt,<br />
ohne diesen oder das Feuer vor Augen<br />
zu haben, was natürlich besondere<br />
Erfahrung erfordert. Im Kesselhaus<br />
selbst ist dann nur noch Personal zur<br />
äußeren Betriebsüberwachung anwesend,<br />
darunter die Kesselspeiser, die<br />
trotz der meist vorhandenen automatischen<br />
Speisewasserregler darüber zu<br />
wachen haben, daß die Kessel das<br />
nötige Speisewasser erhalten.<br />
Dieses wird von den Kesselspeisepumpen<br />
gefördert, die, elektrisch oder<br />
dampfangetrieben, meist in Zwischenbauten<br />
oder im Maschinenhaus<br />
aufgestellt sind. Der Posten der<br />
Speisepumpenwärter ist recht verantwortungsvoll,<br />
da beim Versagen der<br />
Kesselspeisung die Dampferzeugung<br />
innerhalb von Minuten eingestellt<br />
oder wenigstens eingeschränkt werden<br />
muß, was einen Leistungsausfall des<br />
Werkes zur Folge hat. Aus Sicherheitsgründen<br />
ist zwar schon im<br />
Dampfkesselgesetz eine reichliche<br />
Reserve an Kesselspeisepumpenleistung<br />
vorgeschrieben, um notfalls den<br />
Wasserstand in den Kessel halten zu<br />
können, aber das Anfahren und Zuschalten<br />
der Reserveaggregate kostet<br />
natürlich Zeit.<br />
Zum Kesselbetrieb gehört noch die<br />
Aufbereitung des Zusatzwassers (zur<br />
Vermeidung von Kesselstein) auf mechanischem<br />
und chemischem Weg<br />
oder durch Verdampfung. Jedenfalls<br />
erfordert diese Einrichtung ebenfalls<br />
eine Bedienung, die wenigstens angelernt<br />
sein muß. Oft kann sie mit der<br />
Wartung der Speisepumpen verbunden<br />
werden.<br />
Im Maschinenhaus versehen die<br />
Maschinisten, für deren Posten mög-<br />
7
Hochdruckturbogenerator<br />
lichst Schlosser genommen werden,<br />
ihren Dienst an einem oder mehreren<br />
Turbogeneratoren, je nach deren<br />
Größe. Beim ersten Blick !in das<br />
Maschinenhaus sieht das recht einfach<br />
aus, denn die Männer brauchen anscheinend<br />
IlJUr um ihre Maschinen<br />
herumzugehen und alle viertel oder<br />
halbe Stunden die Werte der anzeigenden<br />
Instrumente für Leistung,<br />
Drücke und Temperaturen (diese von<br />
Dampf, Wasser und Öl) in eine Tabelle<br />
oder auf Millimeterpapier einzutragen.<br />
Aber damit allein ist es<br />
nicht getan, denn sie müssen sehr<br />
genau auf etwaige Abweichungen im<br />
regelmäßigen Geräusch der laufenden<br />
Maschine oder in den Ablesungen<br />
achten, die Anzeichen von Fehlern<br />
oder sogar von Gefahr für die Maschine<br />
bedeuten können. Die Kondensat-<br />
und Kühlwasserpumpen, die,<br />
elektrisch- oder dampfangetrieben,<br />
meist neben dem Kondensator im<br />
Keller aufgestellt sind, erfordern<br />
ebenfalls Maschinistenbedienung. Besondere<br />
Aufmerksamkeit und Kenntnisse<br />
der Anlage werden beim Anfahren<br />
und Abstellen der Turbosätze<br />
von allen Maschinisten verlangt,<br />
wenn auch in der Regel die Obermaschinisten<br />
oder Maschinenmeister,<br />
wenn nicht gar der Maschinenbetriebsingenieur<br />
selbst, dabei sind,<br />
denn die großen Einheiten stellen<br />
nicht nur erhebliche Werte dar, sondern<br />
sollen ja auch der Stromerzeugung<br />
nicht durch etwaige Bedienungsfehler<br />
entzogen werden. Man läßt sie<br />
möglichst wochenlang durchlaufen.<br />
Für die Kühlwasserversorgung ist,<br />
insbesondere bei Frischwasserkühlung<br />
aus einem Fluß, Personal erforderlich<br />
zur Bedienung des Pumpenhauses,<br />
der mechanischen Wa~serreinigungsanlage<br />
sowde eines etwaigen<br />
Wehres. Je nach den örtlichen Verhältnissen<br />
mÜS
Oberingenieur Georg Feydt:<br />
Die Taktik der Berg'ungsarbeit<br />
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Schadenswirkungen<br />
In einem ersten Aufsatz über die<br />
Taktik der Bergungsarbeit hatte<br />
der Verfasser in Heft 3/56 unserer<br />
Zeitschrift über die Besonderheit<br />
der Forderungen an die Speziatausbildung<br />
der Einsatzkräjte berichtet.<br />
Wir setzen die Reihe fort.<br />
Die Gespräche und Diskussionen<br />
mit den alten Praktikern des Bergungsdienstes<br />
des letzten Krieges lassen<br />
in der Mehrzahl der Fälle erkennen,<br />
daß sich viele ehemalige Führungskräfte<br />
der Luftschutzpolizei und<br />
des Instandsetzungsdienstes von der<br />
Größenordnung der in einem Zukunftskrieg<br />
zu erwartenden Zerstörungen<br />
ein völlig falsches Bild machen.<br />
Eine alte Regel hat gelehrt, daß<br />
Zukunftskriege meist hinsichtlich des<br />
Umfanges der Waffenwirkung dort<br />
beginnen, wo im vorhergehenden<br />
Krieg diese Wirkungen größten Umfang<br />
erreicht hatten oder daß diese<br />
Wirkungen des vergangenen Krieges<br />
um ein Vielfaches übertroffen werden.<br />
Hier sei schon zu Anfang vorweggenommen,<br />
daß selbstverständlich auch<br />
die Art der Waffen, die die Zerstörung<br />
verursachen, ebenfalls von nicht<br />
zu unterschätzender Bedeutung ist.<br />
Denken wir an maximale Angriffswirkungen<br />
des vergangenen Krieges,<br />
so müssen wir die Wirkung von<br />
Sprengbombenangriffen in Vergleich<br />
setzen zu den voraussichtlichen Wirkungen<br />
von Angriffen mit Kernwaffen.<br />
Die Erscheinungsform, die beispielsweise<br />
nach den Feuerstürmen und<br />
Flächenbränden in Hamburg oder<br />
Dresden sich den Kräften des Bergungsdienstes<br />
darboten, ist eine völlig<br />
andere als die einer durch reinen<br />
Sprengbombenangriff zerstörten<br />
Stadt. Während die Trümmer der<br />
großen Brandangriffe überwiegend<br />
aus unbrennbaren Bauelementen bestanden,<br />
nämlich aus steinen und<br />
Eisenteilen, bieten die Trümmer, die<br />
auf reine Sprengwirkung ohne primäre<br />
oder sekundäre Branderscheinun<br />
gen zurückzuführen sind, ein völlig<br />
anderes und für den Bergungsdienst<br />
viel schwierigeres Bild. Sie<br />
bestehen aus einer engen Verftlzung<br />
nicht nur aller Bauteile der Gebäude,<br />
sondern auch aller in diesen vorhanden<br />
gewesenen Einrichtungsgegenständen.<br />
Die Trümmer werden dadurch<br />
zunächst einmal sperriger, ihre<br />
anfallende Menge ist durch die Zwischenschichtung<br />
der Stockwerks inhalte<br />
voluminöser und die Beräumung<br />
durch die Verftlzung aller innerhalb<br />
der Trümmer vorhandenen Bauteile<br />
und Einrichtungsgegenständen um ein<br />
Vielfaches schwieriger als die Beseitigung<br />
der Trümmer zusammengebrochener,<br />
aber vorher entkernter oder<br />
nach dem Zusammenbruch ausgebrannterTrümmerkegel.<br />
Zur Illustration<br />
möge die Abbildung 1 dienen, die<br />
48 Stunden nach dem Angriff einen<br />
Blick auf den Stadtkern von Dresden<br />
zeigt, und die Abbildung 2, welche die<br />
Verschüttung auf der Mathilden<br />
Straße ebenfalls 40 Stunden nach dem<br />
Angriff wiedergibt.<br />
Bild 1 zeigt, daß die Gebäude des<br />
Stadtkerns wie überhaupt alle Gebäude,<br />
die innerhalb des Flächenbrandes<br />
lagen, restlos entkernt sind.<br />
Bild 2 zeigt, daß ein fast homogenes<br />
Trümmerschuttgemisch die Straße bedeckt,<br />
das überwiegend nur aus Bausteinen<br />
besteht. Dabei ist noch zu<br />
beachten, daß die Verschüttungserscheinungen<br />
in Bild 2 wahrscheinlich<br />
darauf zurückzuführen sind, daß der<br />
zweite Angriff in der Nacht vom<br />
13. Februar 1945 mit seinen Sprengbombenwürfen<br />
in einzelnen Stadtteilen<br />
schon halb niedergebrannte Gebäude<br />
traf und nun nur zum größten<br />
Teil die unverbrennbaren Bauteile<br />
zum Einsturz gebracht wurden.<br />
Nach internationalen Vereinbarungen<br />
unterscheidet man bei den Zerstörungen<br />
durch Atombomben oder Wasserstoffbomben<br />
vier Zerstörungszonen,<br />
die mit den Buchstaben A, B, C<br />
und D bezeichnet werden, wobei diese .<br />
Zerstörungszonen nach dem Grade der<br />
in ihnen zu erwartenden Zerstörung<br />
eingeteilt werden.<br />
Zone A: Zone vollständiger Zerstörung,<br />
Zone B: Zone scltwerer, nicltt reparierbarer<br />
Zerstörungen,<br />
Zone C: Zone großer, reparierbarer<br />
Zerstörungen,<br />
Zone D: Teilzerstörungs-Zone.<br />
Versucht man nun, sich über den<br />
für den Bergungsdienst wichtigen, zu<br />
erwartenden Umfang der Trümmerschuttverteilung<br />
ein Bild zu machen,<br />
so ist dieses nicht für jede getroffene<br />
Stadt ein gleichartiges. Wichtige Faktoren,<br />
die dabei zu berücksichtigen<br />
sind, werden sein:<br />
• 1. Die Bebauungsdichte,<br />
• 2. die Höhe der Gebäude,<br />
• 3. die Gebäudestruktur, ob Ziegetbauten<br />
oder Betonbauten oder<br />
Stahtsketettbau,<br />
• 4. die Straßenbreite zwischen den<br />
Gebäudefronten,<br />
• 5. die Richtung der Straßen zum<br />
BodennuHpunkt (ob radiat von<br />
ihm ausgehend oder konzentrisch<br />
zu ihm Hegend) und<br />
• 6. die Entfernung vom Bodennullpunkt<br />
(Zone).<br />
Wenn auch bestimmte Erfahrungssätze<br />
für den Zusammenbruch von<br />
Gebäuden bei Bombentreffern (straßenseitige,<br />
hofseitige oder innerhalb<br />
der Gebäude) vorhanden sind, und auf<br />
Grund dieser Erfahrungssätze die<br />
Größenordnung der zu erwartenden<br />
Trümmerkegel bzw. Straßenverschüttungen<br />
abgeleitet wurde, so ist doch<br />
zu bedenken, daß bei der Kernwaffenwirkung<br />
das Produkt aus Druck und<br />
Zeit, das für das Zerstörungsvermögen<br />
von Sprengbomben maßgeblich<br />
ist und mit dem Begriff Impuls bezeichnet<br />
wird, nicht der ausschlaggebende<br />
Faktor sein wird. Die Wirkung<br />
der Atomexplosion ist mehr mit einer<br />
Sturmwirkung zu vergleichen. Ist der<br />
statische Widerstand eines Gebäudes<br />
groß genug, diesem Höchstdruck, der<br />
in einer entsprechenden Entfernung<br />
auftreten kann, zu widerstehen, so<br />
wird das Gebäude erhalten bleiben;<br />
ist jedoch der Druck größer als der<br />
statische Widerstand der Gebäude, so<br />
muß damit gerechnet werden, daß<br />
gleichzeitig ganze Häuserreihen,<br />
welche etwa den gleichen statischen<br />
Widerstand haben, durch den Explosionsdruck<br />
umgeworfen werden wobei<br />
noch hinzukommt, daß bei g~ößeren<br />
als "nominellen" Atombomben<br />
mit einer nennenswerten Verstreuung<br />
der Bauelemente der zusammengebrochenen<br />
Gebäude in der Nähe des<br />
Bodennullpunktes, zumindest in der<br />
A- und einem Teil der B-Zone, gerechnet<br />
werden muß.<br />
Bei diesem bebauten Stadtkern<br />
muß daher mit Verschüttungen gerechnet<br />
werden, welche das herkömmliche<br />
Maß bei weitem übertreffen.<br />
Bild 3 zeigt, daß schon Sprengbomben-Teppich-Würfe<br />
in dichtbebauten<br />
Stadtteilen im letzten KriegVerschüttungen<br />
von mehreren Metern Höhe<br />
über die ganze Straßenbreite hervorriefen.<br />
Dabei ist aber zu beachten, daß<br />
9
Bild 1<br />
Blld 4<br />
Bilder aus dem letzten Krieg als<br />
Beispiele für die Bergull<br />
Bild 3<br />
Bild 5<br />
10
it<br />
es sich hier um Verschüttungen handelt,<br />
die nur durch einen Teil der in<br />
einem Gebäude vorhandenen Massen<br />
hervorgerufen wurden, da einmal ein<br />
Teil der Umfassungsmauern, wie im<br />
Bild sichtbar, noch steht, zum anderen<br />
aber diese Gebäude der Webergasse<br />
in Dresden zum Zeitpunkt des zweiten<br />
Angriffs wahrscheinlich schon bis zur<br />
Höhe des 1. Stockwerkes ausgebrannt<br />
waren.<br />
Um überhaupt taktische Grundregeln<br />
für das Vorgehen des Bergungsdienstes<br />
aufstellen zu können,<br />
muß man sich ein theoretisches Bild<br />
der wahrscheinlich zu erwartenden<br />
Zerstörungen machen. Diese Zerstörungen<br />
werden voraussichtlich in den<br />
o. a. Zonen folgenden Umfang annehmen<br />
können:<br />
Zone A: Die Straßen sind von<br />
Trümmerschutt völlig blockiert, bei<br />
radial verlaufenden Straßen normaler<br />
Breite durch Zusammenwachsen der<br />
Randtrümmer A und B von beiden<br />
Seiten, bei konzentrisch zum Bodennullpunkt<br />
verlaufenden Straßen durch<br />
die von einer Seite über die Straße<br />
geworfenen Gebäude, bei denen sich<br />
auch durch den Schub der höchste<br />
Punkt des Trümmerkegels aus der<br />
Gebäudemitte nach der Straße verlagern<br />
wird. Bei vorsichtiger Schätzung<br />
wird man mit Verschüttungen der<br />
Straßen in Höhen bis zu drei Metern<br />
rechnen müssen, wobei voraussichtlich<br />
die Schutthöhe in den konzentrisch<br />
verlaufenden Straßen eine größere<br />
sein wird als in den radial zum Bodennullpunkt<br />
gerichteten Straßen.<br />
Zone B: Die Straßen sind durch<br />
Randtrümmer und durch Trümmerkegel<br />
in einem Umfang von Trümmerschutt<br />
blockiert, daß ein Fahrverkehr<br />
kaum möglich ist (Bild 4).<br />
Zone C: Bauteile, Teile der Dachstühle,<br />
Ziegel, Einrichtungsgegen-<br />
stände, Fensterrahmen werden vor<br />
allem in Form von Randtrümmern B<br />
die Straße bedecken und einen Verkehr<br />
erschweren. Es müßte aber möglich<br />
sein, mit geländegängigen Fahrzeugen<br />
des Bergungsdienstes, unter<br />
Freimachung der Fahrbahn von sperrigen<br />
Teilen, in diese Zone vorzudringen,<br />
unter allen Umständen auf<br />
radial zum Bodennullpunkt gerichteten<br />
Straßen normaler Breite.<br />
Zone D: Die Straße wird nur mit<br />
leichteren Bauteilen, Glassplittern,<br />
Holzbauteilen und Ziegeln bedeckt<br />
sein, jedoch begehbar und befahrbar.<br />
Es ist wiederholt versucht worden,<br />
auf Grund der in Nagasaki und Hiroshima<br />
festgestellten Erscheinungen,<br />
Radien für den bei einer nominellen<br />
(20000 Tonnen, TNT-Energie-Äquivalent)<br />
Atombombe festzulegen, jedoch<br />
ist dabei zu bedenken, daß die<br />
japanische Bauweise in nichts mit<br />
unseren Städtebauweisen vergleichbar<br />
ist, so daß Rückschlüsse auf Grund<br />
der japanischen Zerstörungen unmöglich<br />
erscheinen.<br />
überlegungen der ausländischen<br />
Bergungsdienste gehen dahin, daß<br />
bei einer nominellen Atombombe der<br />
Umfang der Verschüttungen um den<br />
Bodennullpunkt angenommen werden<br />
sollte:<br />
Verschüttungsform nach A: 0,8 km,<br />
radial verlaufende Straßen bis etwa<br />
0,4 km,<br />
Verschüttungsform nach Bund C:<br />
zwischen 0,8 bis 1,2 km,<br />
Verschüttungsform nach C: bei konzentrischen<br />
Straßen auch noch nach<br />
B: von 1,2 km bis 1,6 km,<br />
Verschüttungsform nach C und D:<br />
von 1,6 km bis 2,4 km,<br />
Verschüttungsform nach D: von 2,4<br />
km bis 3,2 km.<br />
Je nach der Größe des · Bombenkalibers,<br />
welches bekanntlich in einem<br />
Mehrfachen (x-fachen) der nominellen<br />
Atombombe ausgedrückt wird, werden<br />
sich die Radien in bezug auf die<br />
Schuttwirkung vergrößern. Die international<br />
gebräuchliche Rechnungsform<br />
geht dahin, daß die Vergrößerung<br />
der Radien mit einem Faktor<br />
erfolgt, welcher der V 3 aus dem Mehrfachen<br />
der nominellen Bombengröße<br />
entspricht. Eine 27-X-Bombe würde<br />
also theoretisch einen va 27 = Multiplikationsfaktor<br />
3 für die einzelnen<br />
Verschüttungsradien ergeben.<br />
Die Erscheinungsformen in Nagasaki<br />
und Hiroshima haben außerdem<br />
gezeigt, daß Stahlskelettbauten gegenüber<br />
einer nominellen Atombombe<br />
in Standardhöhe eine beachtliche<br />
Standfestigkeit gezeigt haben. In einem<br />
Zukunftskrieg wird jedoch mit<br />
A-Bomben und auch Wasserstoffbomben<br />
von vielfachem Kaliber der nominellen<br />
Atombombe gerechnet werden<br />
müssen, wobei zu bedenken ist,<br />
daß dann auch mit der Zerstörung<br />
von Stahlskelettbauten bzw. mit<br />
einer Verbiegung oder Durchblasung<br />
gerechnet werden muß, und daß für<br />
das Vordringen des Bergungsdienstes<br />
unter Umständen die Trümmer eines<br />
derartig zerstörten Stahlskelettbaues<br />
schlimmere Probleme darstellen, als<br />
die Schuttkegel eines in der Größe<br />
vergleichbaren, zusammengebrochenen<br />
Gebäudes alter Bauweise.<br />
Aus diesen vorhergehenden Betrachtungen<br />
ergibt sich, daß für den<br />
Bergungsdienst das primärste Problem<br />
das Vordringen in die zerstörten<br />
Zonen darstellt. Von diesen überlegungen<br />
ausgehend, wird man mit<br />
großer Wahrscheinlichkeit eine Ausrüstung<br />
mit Trageausrüstungen für<br />
die Kräfte des Bergungsdienstes vorsehen<br />
müssen, und nur das schwere<br />
Gerät bzw. das nicht ohne weiteres<br />
tragbare und nicht in jedem Fall so-<br />
Bild 6<br />
Bild 7<br />
11
fort benötigte Gerät auf einem Gerätekraftfahrzeug<br />
nachziehen.<br />
Herr Dipl.-Ing. G r ü n e wal d hat<br />
in Nr. 2 der THW-Zeitschrift die<br />
verschiedenen Typen der als Mannschafts-<br />
bzw. als Gerätekraftwagen<br />
für den Bergungsdienst vorgesehenen<br />
Fahrzeuge besprochen und durch umfangreiches<br />
Bildmaterial die Geländegängigkeit<br />
dieser Standard-Fahrzeuge<br />
gezeigt.<br />
Es muß hier allerdings erwähnt<br />
werden, daß die Geländegängigkeit<br />
eines Fahrzeuges nur bedingt direkt<br />
mit seiner Trümmergängigkeit verglichen<br />
werden kann. Jedoch haben<br />
Versuche ergeben, daß für einen großen<br />
Teil der Fahrzeuge damit zu<br />
rechnen ist, daß sie zumindest in der<br />
Lage sind, auch noch innerhalb von<br />
Straßenzügen vorzudringen, deren<br />
Verschüttungsform dem Verschüttungsgrad<br />
nach B entspricht. In einer<br />
gewissen Zeit nach Beginn des Einsatzes<br />
ist auch die Möglichkeit gegeben,<br />
die Fahrzeuge und Baumaschinen<br />
der Räumzüge nachzuziehen, die dann<br />
das Freimachen der Fahrbahnen unter<br />
dem Gesichtswinkel der vorherigen<br />
überprüfung, ob sich noch verschüttete<br />
Personen unter diesen befinden,<br />
übernehmen können.<br />
Es ist also damit zu rechnen, daß<br />
die mot. Einheiten, soweit es die Befahrbarkeit<br />
der Straßen trümmer zuläßt,<br />
in das Schadenszentrum vorstoßen.<br />
Sobald jedoch für die Mannschaftskraftwagen<br />
nennenswerte Verzögerungen<br />
des Vordringens durch die<br />
Straßenverschüttungen gegeben sind,<br />
sind die Bergungskräfte zu Fuß, zunächst<br />
mit ihrer Trageausrüstung und<br />
mit leichtem Handwerkszeug nach der<br />
in Heft 3 geschilderten Taktik, gruppenweise<br />
in bestimmten Sektoren der<br />
Schadenszone zum Einsatz zu bringen.<br />
Unter Umständen wird es ratsam<br />
sein, eine Gruppe des Zuges beim<br />
Gerätekraftfahrzeug zu belassen, um<br />
diesem beim weiteren Vordringen auf<br />
der vertrümmerten Straße den Weg<br />
zu weisen bzw. den Weg zu bahnen.<br />
Die Zugführer und Gruppenführer<br />
werden durch vorherige Absprache<br />
den voraussichtlichen Ziel punkt für<br />
den Standort des Gerätekraftwagens<br />
absprechen. Erst wenn dieser nicht<br />
ohne Einsatz von Baumaschinen erreicht<br />
werden kann, sind die Gruppenführer<br />
über den neuen, weiter zurückliegenden<br />
Standort des Gerätekraftwagens<br />
durch Melder zu informieren.<br />
Während in der Zone B noch ein<br />
Vorgehen nach der in Heft 3/56 geschilderten<br />
Taktik möglich und zunächst<br />
zu empfehlen sein wird, erscheint<br />
dies unter Umständen in der<br />
ZoneA außerordentlich schwierig und<br />
wenig erfolgversprechend. Je nach<br />
der Größe der betroffenen Stadt und<br />
nach der Lage der A-Zone im Stadtbild<br />
sind schon in der Vorbereitungszeit<br />
eingehende Studien zu betreiben<br />
(LS-Ortskunde, Planbesprechungen,<br />
Planspiele), welche unterirdischen<br />
Wege zum Vordringen in diese Zone<br />
gegeben sein könnten. Ein stets möglicher<br />
Weg, der sich auch beispielsweise<br />
beim Vordringen in den<br />
teilweise meterhoch vertrümmerten<br />
Stadtkern von Dresden bewährt hatte,<br />
sind Verbindungsgänge zwischen den<br />
untereinander durch Brandmauerdurchbrüche<br />
verbundenen Kellergängen<br />
der Wohnblocks.<br />
Sieht man von den Problemen ab,<br />
die ich vor zwei Jahren in der Zeitschrift<br />
"Ziviler Luftschutz" hinsichtlich<br />
der unterirdischen Verbindungs- .<br />
wege geschildert habe, so haben sie<br />
sich als Möglichkeit für das Vordringen<br />
der Kräfte des Bergungsdienstes<br />
in ausgesprochene Verschüttungsgebiete<br />
hervorragend bewährt. Bestehen<br />
derartige Verbindungsgänge zwischen<br />
den unterirdischen Räumen der<br />
B-Zone, zu denen man voraussichtlich<br />
über die Trümmer von außen her<br />
noch Zugang erlangen wird, so kann<br />
von diesen Stellen aus konzentrisch<br />
in die Kellerräume der A-Zone vorgestoßen<br />
werden, wobei immer wieder<br />
einzelne Gelegenheiten vorhanden<br />
sind, in der A-Zone nach oben in die<br />
Trümmer auszusteigen. Bild 5 zeigt<br />
ein Eckgebäude, von dem aus der Zugang<br />
durch die Brandmauerdurchbrüche<br />
zu dem im Vordergrund sich<br />
erstreckenden Schadensfeld und die<br />
Aufnahme der Gefallenen möglich<br />
war.<br />
Bild 6 zeigt in zeichnerischer Darstellung<br />
(in Anlehnung an eine englische<br />
Darstellung) diese Möglichkeit<br />
der Querverbindung in total zerstörten<br />
Stadtkernen unter der Erde. Unter<br />
dem Gesichtswinkel des Atomkrieges<br />
erscheint dieser unterirdische<br />
Weg in die A-Zone auch der geringeren<br />
Gefährdung der Bergungskräfte<br />
durch radioaktive Strahlung wegen<br />
empfehlenswert. Diese hier erwähnte<br />
Möglichkeit ist auch bei Nichtvorhandensein<br />
von Verbindungsgängen zu<br />
den Wohnblocks, entsprechend dem<br />
vorerwähnten Beispiel (Bild 5), bei<br />
der Gelegenheit des Eindringens an<br />
einer einzigen Stelle in die Kellerräume<br />
von Reihenhäusern und Wohnblocks<br />
gegeben. In nennenswerten<br />
Großstädten jedoch werden außer<br />
dieser unterirdischen Zugangsmöglichkeit<br />
noch verschiedene andere,<br />
unter Umständen sogar verhältnismäßig<br />
bequeme Zugangswege durch<br />
begehbareStadtheizungskanäle, durch<br />
Schächte der U-Bahnen und durch<br />
das Kanalisationsnetz vorhanden<br />
sein.<br />
Bild 7 zeigt einen ganz groben<br />
Querschnitt durch die unterirdische<br />
technische Einrichtung einer modernen<br />
amerikanischen Großstadt, wie<br />
sie ähnlich auch unter allen Umständen<br />
in Hamburg und Berlin anzutreffen<br />
sind. Wir sehen, daß nicht nur die<br />
Schächte der hier im Bild auf zwei<br />
Niveaus geführten U-Bahnen, sondern<br />
auch die großen Abwässerkanäle,<br />
sogar entweder mit Kraftfahrzeugen<br />
oder mit Wasserfahrzeugen<br />
befahrbare unterirdische Wege zum<br />
Stadtzentrum und damit meist in die<br />
A-Zone darstellen.<br />
Es wurde angeregt, die Möglichkeit<br />
zu überprüfen, ob nicht in Großstädten<br />
U-Bahnschächte, die zum Stadtzentrum<br />
führen, so ausgestaltet werden<br />
können, daß die Schienen der<br />
U-Bahn gewissermaßen als Rillenschienen<br />
verlegt sind und der Boden<br />
des Bahntunnels mit einer Asphaltoder<br />
Teerstraßendecke versehen ist, so<br />
daß die Fahrzeuge des Bergungsdienstes<br />
bequem in diesen Tunnels verkehren<br />
können.<br />
Falls die Energieversorgung durch<br />
entsprechende unterirdische Bahnkraftwerke<br />
oder über Kabel unterirdisch<br />
am Verbundnetz angeschlossene<br />
Umspann- bzw. Gleichrichterwerke<br />
auch nach einem Luftangriff<br />
betriebsfähig bleibt, erscheint sogar<br />
die Verwendung der U-Bahn für die<br />
Zwecke des Rettungsdienstes bzw.<br />
öffentlichen Luftschutzhilfsdienstes<br />
gegeben.<br />
Sollen allerdings die Bahntunnels<br />
dann zusätzlich durch Fahrzeuge des<br />
Rettungsdienstes befahren werden,<br />
so sind in bestimmten Abständen<br />
seitliche Ausweichstellen und Einfahrtsrampen<br />
sowie entsprechende<br />
Signalanlagen in der Vorbereitungszeit<br />
rechtzeitig zu planen und einzubauen.<br />
Ebenso erscheint es gegeben,<br />
in den befahrbaren unterirdischen Kanalnetzen<br />
Vorratslager mit Schlauchbooten<br />
einzurichten bzw. motorgetriebene,<br />
flachgehende Wasserfahrzeuge,<br />
die einzelne Strecken dieses Netzes<br />
befahren können, vorzusehen.<br />
Es darf hier in dieser Zusammenstellung<br />
nicht vergessen werden, daß<br />
in den Entwürfen und Richtlinien für<br />
den Schutzraumbau immer wieder<br />
die entweder seitlich der Gebäude<br />
weit hinausgezogenen oder bis<br />
1/ 4 der Gebäudehöhe + 1 m nach der<br />
Erdoberfläche hinausgeführten Notauslässe<br />
vorgesehen sind. Diese geben<br />
ebenso wie oftmals noch erhaltene<br />
Schornsteinschächte gute Möglichkeiten<br />
zum Eindringen in die Kellerräume<br />
und zur Eröffnung unterirdischer<br />
Verbindungswege.<br />
Mit diesen Betrachtungen über den<br />
Umfang der in einem Zukunftskrieg<br />
bei Anwendung von Kernwaffen zu<br />
erwartenden Trümmer und den überlegungen,<br />
die daraus für den Einsatz<br />
der Bergungskräfte resultieren, soll<br />
dieser 2. Teil seinen Abschluß finden.<br />
Z usa m m e n f ass u n g: Es<br />
wurde der Versuch gemacht, die Luftangriffswirkungen<br />
in den Kriegsjahren<br />
1939-1945 mit dem mindest zu<br />
erwartenden Umfange der Verschüttungen<br />
in einem Zukunfts kriege zu<br />
vergleichen une daraus vorläufige<br />
Schlüsse auf die Möglichkeit des Vorgehens<br />
des Bergungsdienstes beim<br />
Eindringen in das Zerstörungszentrum<br />
zu zeigen.<br />
12
Spren;;-ansbildnn;;-<br />
für die Helfer des BnI-Dienstes<br />
Es mehren sich in letzter Zeit die Fälle, daß aus Leserkreisen<br />
Abhandlungen, die die Sprengausbildung betreffen,<br />
an die Schriftleitung gelangen. Die Sprengausbildung<br />
des BuI-Dienstes soll jedoch nach ganz bestimmten Gesichtspunkten<br />
durchgeführt werden, für deren Erfüllung<br />
es nicht genügt, entsprechende Hinweise durch Einzelabhandlungen<br />
in der THW-Zeitschrift zu geben. Ein ordnungsmäßiger<br />
Teil des THW-Handbuches "Sprengen"<br />
befindet sich in Vorbereitung. Nach Fertigstellung wird<br />
dieser Sonderteil den Ortsverbänden und den Sprengstofferlaubnisschein-Inhabern<br />
zugehen, die für die Ausbildung<br />
der THW-Helfer am Orte verantwortlich sind. Dennoch<br />
soll das Thema "Umfang der Sprengausbildung im BuI<br />
Dienst" kurz umrissen werden .<br />
Die Sprengausbildung, welche beispielsweise<br />
an der Bergschule in Siegen<br />
oder bei staatlich anerkannten<br />
Sprenglehrgängen durchgeführt wird,<br />
umfaßt alle Methoden der Erd-, Gesteins-,<br />
Beton-, Holz- und Stahlsprengung.<br />
Dies ist notwendig, um dem<br />
zukünftigen Sprengstofferlaubnisschein-Inhaber<br />
ein umfassendes Bild<br />
seines Arbeitsgebietes zu geben.<br />
Die einzelnen Lehrgänge selbst legen<br />
je nach dem Ziel des Lehrganges<br />
besonderen Wert auf spezielle Arbeitsgebiete.<br />
So liegt der Schwerpunkt<br />
bei der Ausbildung von Steinbruchschießmeistern<br />
auf der Technik<br />
der Gesteinssprengung, bei Lehrgängen<br />
für Sprengmeister von Abbruchunternehmen<br />
und Tiefbaufirmen<br />
überwiegend auf der Ruinensprengung<br />
und Gebäudesprengung, während<br />
bei den Bergschulen wiederum<br />
der Schwerpunkt zwangsläufig auf<br />
dem bergmännischen Schießverfahren<br />
liegen muß.<br />
Den richtigen Umfang des Lehrstoffes<br />
für den Bul-Dienst lehrt z. Z.<br />
die THW -Bundes schule in ihren staatlich<br />
anerkannten Sprenglehrgängen,<br />
die sich nunmehr über 14 Tage erstrecken<br />
und mit einer wesentlichen<br />
Erhöhung des Zeitanteiles für die<br />
praktischen übungen den Schwerpunkt<br />
der Ausbildung auf die Sprengarbeiten<br />
legt, die im BuI-Dienst anfallen<br />
werden. Hier scheint es notwendig,<br />
zwei grundsätzliche Fragen<br />
noch zu besprechen.<br />
• 1. Welchen Umfang hatten die<br />
sprengtechnischen Arbeiten des<br />
SHD im letzten Kriege?<br />
und<br />
• 2. sind die Pionierformeln für die<br />
Sprengungen im LuftschutzhiLfsdienst<br />
geeignet'?<br />
Wird davon abgesehen, über die<br />
Beseitigung nicht detonierter Abwurfmunition<br />
durch Sprengtrupps des<br />
SHD mittels Sprengung einzugehen,<br />
so kann gesagt werden, daß 90 % der<br />
Tätigkeit der SHD-Sprengtrupps darin<br />
bestand, einsturzbedrohte Ruinen,<br />
die die Wiederaufnahme des Verkehrs<br />
gefährdeten, durch Sprengung gerichtet<br />
umzulegen. Nur in etwa 10 Ofo der<br />
Fälle sind spezielle Fälle aufgetreten,<br />
wie beispielsweise die Beseitigung<br />
hoher Schornsteine von Rüstungsbetrieben,<br />
die eindeutige Anftugpunkte<br />
für die feindliche Luftwaffe ergaben,<br />
bzw. die Beseitigung schwerster,<br />
durch Luftangriffswirkung auf Verkehrswege<br />
oder in Bahnhofsanlagen<br />
13
Hohl-Schneidladung an I-Träger seitlich angelegt, 0,5 mm Stahlblech (Bild 1)<br />
Gerichtete Wirkung der Hohl-Schneidladung (Bild 2)<br />
PatronengürteWhnHch angebrachte L adungen an H olz (Bild 3)<br />
geworfener Betonbauteile.<br />
Es ist kaum vorgekommen, daß<br />
Holz- oder Stahlsprengungen angewendet<br />
werden mußten, da die zur<br />
Verfügung stehenden Brennschneidgeräte<br />
wie auch das Holzbearbeitungswerkzeug<br />
es ermöglichten, hölzerne<br />
oder stählerne Bauteile, die sich<br />
den Aufräumungsarbeiten hemmend<br />
in den Weg stellten, schneller und<br />
gefahrloser zu beseitigen als durch<br />
Sprengung. Die wenigen Fälle, bei<br />
denen Stahlsprengungen angewendet<br />
wurden, haben gezeigt, daß die damit<br />
verbundenen Gefahren außerordentlich<br />
groß waren und sogar in einzelnen<br />
Städten tödliche Unglücksfälle<br />
bei weit entfernten Passanten durch<br />
Splitterwirkung vorgekommen sind.<br />
Es sei hier festgestellt, daß die Stahlsprengung<br />
im Luftschutzhilfsdienst<br />
keine Anwendungsberechtigung hat.<br />
Die üblichen Stahlsprengformeln sind<br />
ja auch Pionierformeln, die unter<br />
völlig anderen Voraussetzungen entstanden<br />
sind und d·ie es dem Soldaten<br />
ermöglichen sollen, schnellstens<br />
und oftmals im letzten Augenblick<br />
stählerne Brücken total zu zers'<br />
Die Gefahren, die dabei in Er~<br />
nung treten, sind an der FrOi<br />
vernachlässigen. Schon diese 01<br />
gung zeigt, daß im Luftschutz(<br />
Stahlsprengungen weitestgehet<br />
vermeiden sind und nur dann<br />
Berechtigung aufweisen, w em<br />
unter Umständen bei Fehlen<br />
Un terwasserbrenns ctlneidgerä te<br />
schnelleren Besei tigung spei<br />
Stahlkonstruktionsteile unter ~<br />
in Frage kommen. Ist die Dure<br />
rung einer Stahlsprengung in d<br />
Fall nicht zu umgehen, so wird<br />
sogenannte Sprengschneidpat<br />
verwenden oder bei Nichtvorhai<br />
sein derselben die Technik der :<br />
schneidladung, die durch die 1<br />
1 und 2 erläutert wird, anwende<br />
In diesem Fall ist die Splitte<br />
kung eine geringere, und die bei<br />
wendung von Scheriadungen a1<br />
tenden Gefahren werden weitgl<br />
vermieden. Außerdem erfordel<br />
Anbringung einer HohlRchneidll<br />
im Verhältnis zu einer einwaJ<br />
angebrachten, versetzten Stahl!<br />
sprengladung nur einen Bruchte<br />
für die letztere notwendigen Ze<br />
wandes, ganz abgesehen davon<br />
bei verklemmten und verboI<br />
Konstruktionsteilen unter WassE<br />
mals eine Scheriadung gar nich'<br />
nungsgemäß angebracht werden<br />
Holzsprengungen werden im<br />
Dienst kriegsmäßig ebenfalls<br />
zur Anwendung kommen. Die]<br />
tigung sperriger Holzteile n<br />
Hobelzahnsägen oder Motorsäg<br />
viel leichter und schneller m<br />
und erfordert keinerlei Abspe<br />
gen. Andererseits besteht die<br />
lichkeit, daß im Naturkatastro'<br />
fall die Beseitigung von Flußlau'<br />
rungen, die einen Stau verurs:<br />
schnellstens notwendig wird. Il<br />
sem Fall wird man selbstverstäl<br />
beispielsweise zur Beseitigun~<br />
Rammpfählen oder zusammen€<br />
chenen Brückenkonstruktions<br />
die Holzsprengung zur Anwel<br />
bringen können.<br />
Wird dies notwendig, so ist d<br />
Verfügung stehende Zeit für diE<br />
bereitung der Sprengung auf ein<br />
mum beschränkt, und man wir!<br />
aussichtlich angelegte Ladungel<br />
wenden. In diesem Fall sei c<br />
hingewiesen, daß auch bei der<br />
legten Ladung die Pionierforme<br />
Holz nach oben abgerundete Fo<br />
darstellen, die eine restlose Z<br />
rung gewährleisten, aber aucl<br />
Oberladung mit sich bringen<br />
Möglichkeit wegen, daß bei plötz<br />
Hochwasserkatastrophen diese<br />
jene Sprenggruppe zur Holzsprel<br />
schreitet, sei darauf hingeVl<br />
daß die Pionierformel für ang<br />
Ladungen an Rundholz so abzuä<br />
ist, daß man nicht mit L = D2 re<br />
sondern<br />
(I) L = D2. 0,75.<br />
Handelt es sich jedoch >Um<br />
hölzer mit rechteckigem Quersl<br />
von ungleicher Kantenlänge, ·sc<br />
man auch nicht die Pioruerfon<br />
ihrer alten Form zur Anwe:<br />
bringen, wobei die größte Kl<br />
länge quadriert wurde, sonden<br />
sollte.nach der Formel rechnen:<br />
14
(II ) L _ (a + b)2. a = Länge der kürzeren Kante in cm.<br />
- 2 ' b = Länge der längeren Kante in cm.<br />
Eingehende' Versuche, die viele Male wiederholt worden<br />
sind, haben gezeigt, daß diese Ladeformel bei der Anwendung<br />
von Ammon-Gelit 3 eine einwandfreie Durchtrennung<br />
des Holzes sicherstellt. Wird dabei noch beachtet,<br />
daß die Ladungen, vor allen Dingen bei Rundholz, nach<br />
Art von Bild 3 patronengürtelähnlich aus halben Patronen<br />
am Umfang des Holzes angebracht werden und daß man<br />
in der rechten und linken äußersten Patrone je einen<br />
Momentzünder einsetzt, so bringt man die Wirkung der<br />
Gegenlaufzündung zusätzlich zur Anwendung und erzielt<br />
einen einwandfreien Durchschlag, wie Bild 4 zeigt. Der<br />
geübte Sprengmeister wird sich gerade bei der Anwendung<br />
im Hochwasserfall daran erinnern, daß er die Lademenge<br />
auf die Hälfte reduzieren kann, sobald er die<br />
Ladung mindestens 1 m unter dem Wasserspiegel anordnet.<br />
Außerdem erzielt er damit eine bessere Behebung des<br />
staues.<br />
~ VEREINIGTE DEUTSCHE<br />
I \ METALLWERKE A.G.<br />
Einwandfreier Durchschlag von Holz (Bild 4)<br />
Für alle Gesteinssprengungen sind die Helfer dazu zu<br />
erziehen, daß sie im Ernstfall und bei ausreichend zur<br />
Verfügung stehender Zeit, die bei der Ruinenbeseitigung<br />
stets gegeben sein wird, nur mit Bohrladungen arbeiten<br />
und alle Gesichtspunkte berücksichtigen, die bei friedensmäßigen,<br />
gewerblichen Sprengungen in bezug auf die<br />
Unfälle und Sicherheitsbestimmungen Beachtung finden<br />
müssen. Was die Anwendung der Hauserschen Gesteinssprengungsformel<br />
betrifft, die als P ionierformel entwikkelt<br />
wurde, so sei darauf hingewiesen, daß bei Anwendung<br />
bestimmter, brisanter Sprengstoffe diese Formel für<br />
Gebäudesprengungen ebenfalls zu hohe Lademengen<br />
ergibt.<br />
Eingehende Versuche haben gezeigt, daß die in den<br />
österreichischen Sprengvorschriften verwendeten Sprengstoffaktoren<br />
(Sprengstoffkoeffizient) in die Hausersehe<br />
Formel eingesetzt werden können, so daß diese, auf<br />
deutsche Verhältnisse angewendet, folgende Ladeformel<br />
ergibt:<br />
m.) L = W 3 • C • d . k<br />
Dieses "k" ist einzusetzen für:<br />
AG 3 : k 0,75<br />
AG 2 : k 0,7<br />
AG 1 : k 0,65<br />
Nitropentaerythrit: k = 0,55<br />
Daß selbstverständlich die Gesichtspunkte der besseren<br />
Ladungsverteilung durch Erhöhung der Bohrlochzahl, der<br />
Richtwirkungen steigend oder fallend eingebrachter Bohrlochladungen,<br />
der guten Verdämmung und unter Umständen<br />
der Abdeckung zur Verhinderung von Splitterwirkung<br />
beachtet werden müssen, bedarf keiner besonderen Erläuterung.<br />
Die hier veröffentlichten überlegungen sind nicht dazu<br />
bestimmt, den Anfängern im Sprengwesen Unterlagen<br />
für Ladungsberechnungen zu geben, sondern sie sollen<br />
die die Ausbildung durchführenden Sprengstofferlaubnisscheininhaber<br />
über die neu esten Erfahrungen informieren,<br />
die bei systematischer Kontrolle der Verwendungsmöglichkeit<br />
der P ionierformeln für zivile Sprengungen erarbeitet<br />
wurden. G. F.<br />
...<br />
...<br />
m<br />
ct<br />
:::.::<br />
...<br />
....<br />
....<br />
FRANK FURT / M 0<br />
.....<br />
.....<br />
~<br />
ALTENA<br />
~<br />
DU<strong>IS</strong>BURG<br />
Z<br />
::::»<br />
KöLN<br />
:::.::<br />
•<br />
~<br />
-Z<br />
...<br />
NURN BERG ~<br />
WERDOHL<br />
(,:)<br />
MANN HEI M ::::»<br />
...<br />
...<br />
...<br />
SUDKAB EL N<br />
CI:::<br />
ct<br />
.....<br />
METALL-HALBFABRIKATE<br />
:e<br />
15
Luftschutz-Streiflichter<br />
E in V orbild<br />
Otto S tu P P I aus Herne/Westfalen,<br />
einer der vielen aus den<br />
Reihen der THW-Helfer, hat es<br />
verdient, daß sein vorbildliches<br />
Wirken bekannt wird. Am 22.<br />
A P r i I 1 8 8 2 zu Herne geboren,<br />
lernte er früh Sorgen und Nöte<br />
kennen. Das harte Schicksal des<br />
Vaters, der als Bergmann einen<br />
schweren Grubenunfall erlitt,<br />
hielt den Jungen nicht ab, ebenfalls<br />
den schweren Weg Ins Bergwerk<br />
zu nehmen.<br />
Den ersten Weltkrieg machte<br />
er bis zu seiner Verwundung am<br />
11. November 1914 in Flandern<br />
mit. Nach seiner Wiederherstellung<br />
nahm er den Dienst bei der<br />
Westfälischen Straßenbahn in<br />
Bochum-Gerthe auf.<br />
Die folgenden Jahre fanden Ihn<br />
als Hilfsschlosser für Dampfmaschinen<br />
auf der Zeche, wobei<br />
er auch das "Fahren" von Fördermaschinen<br />
erlernte. Von 1917<br />
bis 1945 war Herr Stuppi Lokführer<br />
auf der Zeche Constantin<br />
der Große. Besonders stolz<br />
ist unser Helfer auf den<br />
Besitz zweier "Deutscher Reichspatente",<br />
und zwar für "eine<br />
Sicherheitsvorrichtung für Standhebel<br />
an Fördermaschinen" un6<br />
"einen Registrierapparat für den<br />
Eisenbahnsicheru ngsdienst".<br />
1936 trat er der Technischen Nothilfe<br />
bei.· Er war als Dienstführerstellvertreter<br />
des Allgemeinen<br />
und Technischen Dienstes eingesetzt.<br />
Während des zweiten<br />
Weltkrieges machte Herr Stuppi<br />
die Einsätze der Ortsgruppe<br />
Herne mit und galt als einer der<br />
Eifrigsten. Nach Ende des Krieges<br />
fand er im Werkschutz Verwendung.<br />
1948 trat Stuppi in den<br />
Ruhestand. .<br />
Selb~tverständlich war er bei<br />
der Gründung des Ortsverbandes<br />
Herne der Bundesanstalt THW<br />
einer der ersten und seitdem die<br />
zllverlässiqste Stütze des OB. Aus<br />
diesem Grunde war die Mitfrp.llde·<br />
über die Verleihung des<br />
THW-Helf"rabze;rhE'ns ;'1 (1n1d<br />
am 7. 5. 1955 durch d"n Direktor<br />
derBundesan
zerstörte Leitungen und Schlammablagerungen<br />
zurückgelassen. Es wartete<br />
viel Arbeit auf die THW-Helfer,<br />
wenn auch vordringlich die technischen<br />
Notstände behoben werden<br />
mußten. Das Aggregat wurde aufgestellt<br />
und an das Stromnetz angeschlossen.<br />
Die Anschlußleitungen wurden<br />
wiederhergestellt. Umfangreiche<br />
Reparaturen mußten im Kraftwerk<br />
vorgenommen werden. E-Motoren<br />
wurden ausgebaut und in der Trafo<br />
Station wichtige Arbeiten ausgeführt.<br />
Zwar waren nur wenige THW-Helfer<br />
in diesem Einsatz. Ihre hochqualifizierte<br />
Arbeit jedoch half kostbare<br />
Werte schützen und erhalten.<br />
In laufendem Einsatz<br />
Der OV Bayreutp. war während der<br />
Hochwassertage in ständigem Einsatz.<br />
Nachdem die Helfer am Freitag, dem<br />
2. März, an der Freilegung des Schwarzen<br />
Steges und anderer Brücken des<br />
Stadtgebietes beteiligt gewesen waren,<br />
forderte der OV Marktredwitz<br />
die Hilfe des Bayreuther THW zum<br />
Schutze verschiedener Brücken in<br />
Arzberg an. Fünf Mitarbeiter des<br />
Bayreuther THW bauten darauf in<br />
Arzberg ein Notstromaggregat auf,<br />
das die Arbeit an den gefährdeten<br />
Brücken unterstützte. Am Samstagnachmittag<br />
löste das THW die amerikanischen<br />
Soldaten ab, die durch zahlreiche<br />
Sprengungen das Steinachtal<br />
bei der Poudremühle von Eisbarrieren<br />
frei machten. Hier wurden nicht<br />
weniger als 32 Sprengladungen angebracht,<br />
durch die das Flußbett völlig<br />
gesäubert wurde. Am Sonntagvormittag<br />
galt es wiederum, die Steinach bei<br />
ihrem Einfluß in den Roten Main unterhalb<br />
Lainecks zu überwachen, während<br />
am Sonntagnachmittag die Helfer<br />
den Eisstau des Mühlbachs bei der<br />
Badstraße durch zwei weitere Sprengungen<br />
beseitigten.<br />
stadt ohne strom<br />
Schon bevor der Neckar im Bereich<br />
von Heilbronn katastrophale Ausmaße<br />
annahm, liefen bereits Hochwassermeldungen<br />
der Neckarzuflüsse<br />
beim. OV Heilbronn ein. Auf einen<br />
Hilferuf der Stadt Gaildorf am Kocher<br />
alarmierte der OV seine Helfer. Eine<br />
am Kocherufer vorbeiführende Hochspannungsleitung<br />
war durch den Eisgang<br />
gerissen, und die Stadt war ohne<br />
Licht:. Weil dadurch auch die elektrisch<br />
getriebenen Pumpen des Wasserwerks<br />
ausfielen, war die Stadt auch<br />
ohne Wasserversorgung. Mit einem<br />
rasch verladenen Boot der Heilbronner<br />
Wasserschutzpolizei kamen die<br />
THW-Helfer dem bereits in Gaildorf<br />
tätigen OV Crailsheim zu Hilfe, und<br />
durch das reißende Hochwasser konnten<br />
jetzt Monteure zu den tief im<br />
Wasser stehenden Masten gebracht<br />
werden .In einem Schaltwerk bei Großaltdorf<br />
war schon über 24 Stunden<br />
ein dort beschäftigter Arbeiter von<br />
den Fluten eingeschlossen; auch hier<br />
bewährten sich die Heilbronner THW<br />
Helfer. In 2 Stunden war eine Fährverbindung<br />
durch das reißende Wasser<br />
hergestellt, und der Eingeschlossene<br />
wurde gerettet.<br />
Gundeisheim in Wassernot<br />
Am schwersten vom Hochwasser<br />
heimgesucht wurde im Landkreis<br />
Bamberg die kleine Ortschaft GundeIsheim.<br />
Der mitten durch die Ortschaft<br />
'fließende Ellerbach schwoll<br />
stark an. Ein starker Eisstau bildete<br />
sich unmittelbar am Ausgang der<br />
Ortschaft. In Erkenntnis der großen<br />
Gefahr wurde der OV Bamberg alarmiert,<br />
der mit einer zwölf Mann starken<br />
Einsatzgruppe in GundeIsheim<br />
ein traf. Sofort gingen die THW -Helfer<br />
daran, den gefährlichen Eisstau in<br />
der Bachkurve zu sprengen; nach dem<br />
vierten erfolgreichen Schuß brach ein<br />
Teil des Eisberges in sich zusammen.<br />
Dabei stürzten drei Helfer, die eben<br />
die fünfte Ladung anbringen wollten,<br />
in die reißenden Fluten und konnten<br />
nur mit vieler Mühe gerettet werden.<br />
Das Wasser stieg immer mehr und<br />
setzte die Ortsdurchfahrt so unter<br />
Wasser, daß sie nicht mehr begehund<br />
befahrbar war. Zu beiden Seiten<br />
des angestauten Baches drangen die<br />
Wasserfluten in die Häuser ein, wo<br />
man in größter Eile den wertvollsten<br />
Hausrat an sicheren Ort schaffte. In<br />
seinem Winterquartier kam auch das<br />
Fahrgastschiff "Bamberg" in größte<br />
Gefahr. Es war mit dem Heck in dem<br />
mehr als einen Meter dicken Grundeis<br />
festgefroren, so daß es voll Wasser<br />
lief. Der OV Bamberg griff auf den<br />
Hilferuf der Besitzer ein. Das Schiff<br />
THW-1Uerkblätter<br />
Beginnend mit dieser Ausgabe<br />
legen wir künftighin<br />
regelmäßig der Zeitschrift<br />
"Das Technische Hilfswerk"<br />
THW-Merkblätter bei. Wir<br />
bitten unsere Helfer, diese<br />
Merkblätter als Ausbildungsunterlagen<br />
sorgfältig zu sammeln.<br />
Die Schriftleitung<br />
wurde leergeschöpft und in langwieriger<br />
Arbeit aus dem Eis gelöst. Kurz<br />
vor 24 Uhr konnte das THW abrücken.<br />
Es hatte hier einen Schaden von rund<br />
60 000 DM verhindert.<br />
28 m Notsteg<br />
Das Wasser der Mümling überstieg<br />
das Flußbett und überschwemmte bei<br />
Michelstadt weite Landstreifen sowie<br />
die Zufahrtstraße zum Gaswerk und<br />
zwei Betriebe. Der OB von Michelstadt<br />
erkundete vorsorglich die Lage<br />
und berichtete dem Bürgermeister<br />
hierüber. Dieser erbat zunächst den<br />
Einsatz des THW zum Bau eines 10 m<br />
langen Notsteges auf einem Fabrikgelände.<br />
Der Einsatz wurde in kurzer<br />
Frist von THW-Helfern durchgeführt.<br />
Inzwischen entstand an einer anderen<br />
Gefahrenstelle eine Situation, die das<br />
Eingreifen des THW notwendig<br />
machte. Der Hammerweg war an<br />
seiner Kreuzung mit der Umgehungsstraße<br />
durch die Fluten von der Stadt<br />
abgeschnitten. Ein bereits am Vortage<br />
durch andere Kräfte angelegter Notsteg<br />
war durch die reißende Flut wieder<br />
abgetrieben worden. Der Bürgermeister<br />
ordnete den nochmaligen Einsatz<br />
des THW an. Sechzehn Helfer<br />
errichteten in eineinhalbstündiger<br />
Arbeit einen 28 m langen Notsteg, der<br />
zum Teil genagelt, zum Teil gebunden<br />
wurde und der der Belastung durch<br />
den Fußgängerverkehr trotz der starken<br />
Strömung standhielt (siehe Bild).<br />
17
Mit Sprengstoff und Sandsäcken<br />
Die Hochwassergefahren bedrohten<br />
auch Gebiete des südhessischen Raumes.<br />
Der Pegel der Modau war ständig<br />
gestiegen. Eisbarrieren verhinderten<br />
den geregelten Abfluß des<br />
Wassers. Bürgermeister Jaeger aus<br />
Pfungstadt, der Vorsitzende des Modau-<br />
und Sandbach-Verbandes, forderte<br />
deshalb die Helfer des OV<br />
Darmstadt zum gemeinsamen Einsatz<br />
mit den kommunalen Katastrophendiensten<br />
auf. Zunächst galt es, die<br />
gefährdeten Dämme der Modau mit<br />
Sandsäcken zu sichern. örtliche Einsatzgruppen<br />
hatten bereits vorher an<br />
dem Sandbach die Unterspülungen<br />
bei Goddelau abgesichert. In zügiger<br />
Zusammenarbeit mit den Sprengmeistern<br />
der kommunalen Dienste beseitigte<br />
dann die THW -Sprenggruppe<br />
unter Einsatz von 150 Schuß Sprengstoff<br />
die Eisbarrieren auf der Modau<br />
in der Nähe der Waldmühle. Gegen<br />
Mittag waren Modau und Sandbach<br />
von Eisbarrieren frei, das Wasser<br />
konnte ungehindert abfließen. Anschließend<br />
wurden Rheindämme an<br />
besonders gefährdeten Stellen mit<br />
Planen gesichert, da eine zwei Meter<br />
hohe Flutwelle vom Oberlauf des<br />
Rheins gemeldet worden war. Vor<br />
allem galt es, die in der Nähe gelegenen<br />
Ölpumpstationen von Stockstadt<br />
vor der Gefahr zu sichern. Für die<br />
Nacht zum Montag wurde ein verstärkter<br />
Einsatz der Deichwachen angeordnet,<br />
die ebenfalls von THW<br />
Helfern unterstützt wurden. Der erste<br />
Einsatz des Ortsverbandes ist zur<br />
vollen Zufriedenheit der Verantwortlichen<br />
verlaufen. Die Bürgermeister<br />
der einzelnen Ortschaften begrüßten<br />
die Unterstützung durch das THW<br />
dankbar.<br />
Einsatzor t P assau<br />
Die Helfer des THW haben der<br />
Stadt Passau in den schweren Tagen<br />
der überschwemmung wertvolle<br />
Dienste erwiesen. Sie waren nicht nur<br />
an der Evakuierung des Lagers<br />
Bschütt beteiligt, auch das Süddeutsche<br />
Furnier- und Sperrholzwerk<br />
verdankt es dem THW, daß ein Drittel<br />
der Sperrholzplatten vor den Fluten<br />
gerettet werden konnte. Darüber<br />
hinaus haben die Männer des Technischen<br />
Hilfswerkes den Geschäftsinhabern<br />
geholfen, Mehllager vor einer<br />
"nassen" überraschung bewahrt und<br />
Kohlen in Sicherheit gebracht. In der<br />
Ilzstadt wurden Stege gebaut, und<br />
für einen geregelten Zillenverkehr in<br />
der Höllgasse und am Rathausplatz<br />
war ebenfalls Sorge getragen. Dadurch<br />
konnten abgeschnittene Hausbewohner<br />
mit Lebensmitteln versorgt<br />
und Berufstätige an ihre Arbeitsstätten<br />
gebracht werden. Die<br />
18<br />
Männer des THW waren immer da,<br />
wenn sie gerufen wurden. Kurzum:<br />
Alle gestellten Aufgaben konnten<br />
rechtzeitig erfüllt werden. Dazu haben<br />
letztlich auch die beiden Einsatzfahrzeuge<br />
des Technischen Hilfswerkes<br />
beigetragen. (Aus "Passauer Neue<br />
Presse".) (siehe Bild oben.)<br />
Hilfe zur rechten Zeit<br />
800 Tonnen wertvolle Hochofenquarzschlacke<br />
wären beinahe dem<br />
Rheinhochwasser zum Opfer gefallen,<br />
wenn nicht der OV Mainz eingegriffen<br />
hätte. Auf dem Lagerplatz der<br />
Firma "Rhenus" am Zollhafen lagen<br />
diese wertvollen Materialien zur Verschiffung<br />
bereit, auf einem Lagerplatz,<br />
der hochwassergefährdet war.<br />
Die Firma entschloß sich daher, noch<br />
während der Nacht die Schlacke verladen<br />
zu lassen, um sie vor der Hochwasserwelle<br />
zu bergen. Dazu war<br />
notwendig, den Verladeplatz und auch<br />
das Kranschiff zu beleuchten und mit<br />
strom zu versorgen. Die THW-Helfer<br />
rückten bei Einbruch der Dunkelheit<br />
mit einem Notstromaggregat und vier<br />
Scheinwerfern an, und schon in kurzer<br />
Zeit war der Lagerplatz in helles Licht<br />
getaucht. In schneller Arbeit wurde<br />
die Hochofenquarzschlacke verladen.<br />
Morgens um acht Uhr, als kaum die<br />
letzte Tonne vom Greifer erfaßt war,<br />
überspülte der Rhein auch schon den<br />
Lagerplatz. Die Hilfe kam zur rechten<br />
Zeit.<br />
Rettung im Schlauchboot<br />
Es ist kein großes Werk, das die<br />
Helfer vom OV Würzburg auf Veranlassung<br />
des Vorsitzenden des Katastrophenausschusses<br />
Würzburg geschaffen<br />
haben, aber ein Beweis ihrer<br />
Einsatzfreudigkeit, als sie sich am<br />
Messeplatz einfanden, um das Messehäuschen<br />
durch eine spitz zulaufende<br />
Schutzwand, die sie aus Eisenträgern<br />
und Brettern bauten, vor dem Treibeis<br />
des Hochwassers zu schützen. Sie<br />
hatten ihre Arbeit zur rechten Zeit<br />
getan, denn das Wasser begann gerade<br />
im Mainviertel aus dem Ufer zu<br />
treten. Am Nachmittag stand bereits<br />
der größte Teil des Messeplatzes unter<br />
Wasser. Als Retter aus der Not<br />
wurden die Helfer auch von den<br />
Wirtsleuten auf der Naturheilinsel<br />
begrüßt, die vom Hochwasser eingeschlossen<br />
und besonders bedroht waren.<br />
Die THW-Helfer setzten mit<br />
einem Schlauchboot über und brachten<br />
nicht nur die Wirtsleute ans<br />
sichere Ufer, sondern sie retteten<br />
auch vom Hausrat, was zu retten war.<br />
Die Aktion war nicht ganz einfach,<br />
denn es mußte gegen die reißende<br />
Strömung gekämpft werden. Außerdem<br />
bestand die Gefahr, daß das<br />
Schlauchboot durch treibende Eisschollen<br />
aufgerissen wurde. Dank der<br />
Gewandtheit der Helfer ging die Rettung<br />
glatt vonstatten.<br />
Vor dem Ertrinken gerettet<br />
Das Hochwasser des Kochers hatte<br />
von der Erlau her die dort liegenden<br />
Industrieanlagen überflutet. Am<br />
Sonntagmorgen erfolgte der Alarm<br />
für den OV Aalen. Sofort wurden die<br />
für diesen Zweck notwendigen Geräte<br />
auf den LKW geladen und mit den<br />
Helfern zur Einsatzstelle gebracht. Es<br />
mußten Sandsackverdämmungen errichtet<br />
werden. Alle Arbeiten konnten<br />
sehr rasch geleistet werden, da in<br />
kurzer Zeit 40 THW-Helfer zur Verfügung<br />
standen. Gegen 11 Uhr war<br />
der Notstand vorüber. Schon am Tage<br />
zuvor erreichte den OV ein Alarmruf<br />
aus Abtsgmünd: 2 Menschen, die sich<br />
auf eine überflutete Straße gewagt<br />
hatten, drohten zu ertrinken. Mit<br />
letzter Kraft hatten sie sich an die<br />
Zweige eines Obstbaumes geklammert.<br />
Unverzüglich fuhr die Bergungsgruppe<br />
des OV an die UnfallsteIle.<br />
Ein schon an der Einsatzstelle<br />
eingetroffener LKW, der die beiden<br />
bereits übernommen hatte, wurde von<br />
der Flut abgetrieben. Den THW-Helfern<br />
gelang es, die beiden Männer zu<br />
befreien und das weitere Abtreiben<br />
des LKW zu verhindern. Ein amerikanischer<br />
Kranwagen barg dann endgültig<br />
das Fahrzeug, während das<br />
Gelände mit Hilfe des THW-Notstrom<br />
aggregats taghell erleuchtet<br />
wurde. Spät kehrte die B-Gruppe<br />
nach Aalen zurück.
Ergebnis des Fotowettbewe.-bes ~~ THW im Bilde"<br />
Auf den Wettbewerb, der in Nr. 10/1955 unserer Zeitschrift ausgeschrieben<br />
w ar, ist eine große AnzahL hervorragender Schnappschüsse aus dem Leben des<br />
THW eingegangen, so daß das Preisgericht, das am 28. März 1956 zur Preisv<br />
erteiLung zusammentrat, vor einer schweren Entscheidung stand. Insgesamt<br />
konnten 38 Preise verteiLt werden. Wir veröffenmchen nachstehend die<br />
Namen der Preisträger. AUe TeiLnehmer am Wettbewerb sind inzwischen<br />
benachrichtigt worden.<br />
1. Preis: Karl Hemz Dau, Hanlburg<br />
Altona,<br />
2. Preis: Gerd Neumann, Kassel,<br />
3. Preis: Walther Krause, UnterlenghartiPOiSt<br />
Gündlkofen<br />
4.-6. Preis: Hanns Knopka, Münster/<br />
Westf., Ortsverband Bamberg<br />
des THW; Orts verband Bayreuth des<br />
THW;<br />
7.-10. Preis: Walter KI1UIIl.llow,<br />
Luc1wig1sJburg; Egon Klebe, Hamburg<br />
Bergedol1f; Egon KLebe, Hambur,g-<br />
Bergedorf; Dipl.-Ing. Johann Krefft,<br />
Hamburg-Rahlstedt;<br />
11.-15. Preis: Ortsverband Bamberg<br />
des THW; Ludwig Ernst, Staf<br />
:EelstemlOfr.; Hanns Knopp1m, Münster/Westf.;<br />
Egb.ert Recklrl.ng, HambUl'g<br />
20; Herbe!'t Dau, HambiuJrg<br />
Bergedorf;<br />
16.-20. Preis: Ortsverband Bnaunschwed,g<br />
des THW; KaTI Heinz Dau,<br />
Hamburg-Altona; Wilhe1m Stürmer,<br />
Hambur,g 21; Gerd Hedler, Schweinfu:rt;<br />
Kurt Bufe, Hamburg 23;<br />
21 .-25. Preis: Hanns Knoppka,<br />
MÜllster/Westf.; Helmar GigLing, Ravensburg;<br />
Peter Mittenhuber, Kempten/Allgäu;<br />
OV Hamburg-Bergedorf<br />
des THW; Karl Heinz DalU, Hamburg-Altona;<br />
26.-30. Preis: Peter Hanne, BerLLn<br />
Steglitz; Ortsverband Aschaf:fienburg<br />
des THW; Ortsverband Rarnburg<br />
Bergedorf des THW; Peter Kriebei,<br />
Düsseldorf; Christian Jourdan,<br />
Worms/Rh.;<br />
31.-38. Preis: Heinrich Müller,<br />
M.Gladbach; Ortsverband Bayreuth<br />
des THW; He1mar Gigldng, Ravensburg;<br />
Helmar Gigling, Ravensburg;<br />
Toni Riedl, K!irn/Nahe; Egbert Recklimg,<br />
Hamburg 20; Redakteur TrinkwaJ.der,<br />
Nahtal-Kurier; Ortsverband<br />
Aanlberg des THW.<br />
Fachkunde für Elektriker, Teil 3, Installation<br />
von Starkstromanlagen und<br />
Lichttechnik, W. Blatzheim, bearbeitet<br />
von K. A. Schwarzendahl, 7. verbesserte<br />
Auflage, 298 Bilder, 32 Zahlentafeln, broschiert<br />
6,40 DM. Von dem bereits in<br />
Nr.2/1956 besprochenen Fachbuch ist die<br />
7. verbesserte Auflage erschienen. Die Tabellen<br />
sind auf den neuesten Stand gebracht<br />
worden, und besonders der Abschnitt<br />
"Lichttechnik" wurde völlig neu<br />
gegliedert, um Schaltungen starterloser<br />
Leuchtstofflampen erweitert und deren<br />
Wirkungsweise eingehend erklärt. Von besonderem<br />
Interesse für die in der Fachrichtung<br />
"Elektrotechnik" tätigen Helfer<br />
ist die neu aufgenommene Beschreibung<br />
der "Fehlerstromschutzschaltungen" in Elnund<br />
Mehrphasen-Netzen. Mit der Aufnahme<br />
dieser Schutzmaßnahmen in die<br />
VDE-Vorschriften ist in Kürze zu rechnen.<br />
Der übrige Inhalt stimmt bis auf einige<br />
Umstellungen im wesentlichen mit der<br />
Besprechung in Heft 2 überein.<br />
Bftehersehan<br />
"Atomwaffen im Landkrieg" von Reinhardt/Kinter,<br />
Verlags gesellschaft Wehr<br />
und Wissen, Darmstadt, 208 Seiten, mit<br />
Bildern und Zeichnungen, Preis 7,80 DM.<br />
Die Atomzertrümmerung zeigt sich am<br />
auffälligsten in ihrer kriegerischen Gestalt.<br />
Ihre Anwendung zu verstehen und<br />
ihre Wirkung einzuschränken, ist Aufgabe<br />
aller verantwortungsbewußten Menschen.<br />
Das Buch der beiden amerikanischen Offiziere<br />
gibt hierzu in nüchterner Form einen<br />
überblick, der die wesentlichsten Erfahrungen<br />
der USA auf diesem Gebiet umfaßt.<br />
Ausgehend von dieser Wirkung atomarer<br />
Waffen, untersuchen die Verfasser<br />
ihre Rolle in Angriff, Verteidigung, besonderen<br />
Operationen und im Versorgungswesen.<br />
An die Forderungen für eine<br />
ne uzeitliche Einzel- und Verbandsausbildung<br />
auf dem Gebiet der Atomwaffen<br />
schließen sich Folgerungen für Taktik<br />
und Organisation der Heeresverbände im<br />
Atomzeitalter an. Auch der passive Schutz<br />
und die Abwehr gegen diese neuen Waffen<br />
nehmen einen breiten Raum ein. Es ist<br />
begrüßenswert, daß, bei aller Anerkennung<br />
der ungeheuren Gewalt der neuen<br />
Mammutwaffe, ihre Wirkung doch aus der<br />
Sphäre propagandistischer übertreibungen<br />
auf das tatsächliche Ausmaß technischer<br />
Wirklichkeit zurückgeführt wird.<br />
Die Atomwaffen werden bleiben. Ob ihre<br />
Anwendung beschränkt oder verboten<br />
wird, läßt sich noch nicht absehen. Deshalb<br />
wird sich jeder Bürger mit diesen<br />
Tatsachen und ihren Folgen auseinandersetzen<br />
müssen. Das Buch dient dabei als<br />
vorzügliche Arbeitsgrundlage, die dem<br />
interessierten THW-Helfer empfohlen werden<br />
kann.<br />
Gordon Dean: "Atomwaffen oder Isotope?"<br />
Industrie- und Fachverlag, Wien,<br />
276 Seiten mit 16 ganzseitigen · Bildern,<br />
Halbleinen 14,- DM. Das Werk behandelt<br />
das Thema Nr. 1 der Zeit, in der wir<br />
leben, das "Atom". Der Autor, Gordon<br />
Dean, der als Vorsitzender der US-Atomenergie<br />
kommission von 1950-1953 maßgeblich<br />
den Atomwettlauf der Welt mit-<br />
bestimmte, gibt mit einzigartiger Sachkenntnis<br />
einen authentischen Bericht über<br />
die Nutzbarmachung des Atoms. In den<br />
Vereinigten Staaten hat dieser Bericht<br />
beträchtliches Aufsehen erregt. Es nimmt<br />
nicht wunder, daß alsbald Ausgaben in<br />
vielen Sprachen folgten. Dean berichtet<br />
von den Uranlagern, der verstärkten<br />
Suche nach neuen Lagerstätten, von langen,<br />
verwickelten, überaus kostspieligen<br />
Prozessen, durch die das Uran in Waffen,<br />
Wärme oder Kraft verwandelt wird, von<br />
vielen schwierigen Problemen der Sicherheit<br />
und der Geheimhaltung. Dean läßt<br />
keinen Zweifel offen, daß die Auslösung<br />
der Atomkraft das Leben der gesamten<br />
Menschheit ändern wird und eröffnet die<br />
Aspekte einer Nutzbarmachung des Atoms<br />
für das friedliche Streben, eingehend auf<br />
die breiten Gebiete der Medizin, Landwirtschaft<br />
und Industrie. Der deutschsprachigen<br />
Ausgabe ist die Rede des Präsidenten<br />
Eisenhower "Atomkraft für den<br />
Frieden" beigefügt. Das Werk sollte jeder<br />
nach sachlicher Information Verlangende<br />
lesen.<br />
Zeitseh.-iftenübe.-sieht<br />
Informationen des Bundes-Luftschutzverbandes<br />
e.V. "Schutz der Zivilbevölkerung".<br />
Herausgeber: Bundes-Hauptstelle, Ref. VI,<br />
Köln, Friesenplatz 16, Febr. 1956, 3. Jahrgang,<br />
Nr. 2. Bundesinnenminister Dr.<br />
Schröder: "Sicherheit verlangt Opfer";<br />
"Stiefkind ziviler Luftschutz"; "Bundesluftschutzgesetz<br />
vor eiem Bundesrat": Das<br />
Dokument: "Das atomare Remis"; "Die<br />
Ko-Existenz und der wahre Frieden" (aus<br />
der Weihnachtsbotschaft Pius' XII.); "Kosten-<br />
und Finanzierungsfrage im Industrie-Luftschutz";<br />
"Das russische Atomflugzeug<br />
u ; "Rund ums Atom",<br />
Ziviler Luftschutz. vormals .. Gasschutz<br />
und Luftschutz", Baulicher Luftschutz.<br />
H. Rumpf: "Berlin im Bombenkrieg 1940<br />
bis 1945"; W: Schult: "Ausweichen - der<br />
natürliche Schutz"; W. Haenschke: "Die<br />
Bedeutung der Fernmeldemittel für den<br />
Luftschutz"; Wiendieck: "Kosten und Betonstahlbedarf<br />
von Schutzbauten"; Rede<br />
des Bundesministers des Innern zur Einbringung<br />
des Entwurfs des Luftschutzgesetzes<br />
in der Plenarsitzung des Bundestages<br />
am 20. Januar 1956; "Labour Party<br />
zum Problem der zivilen Verteidigung";<br />
Mitteilungen des Bundesverbandes der<br />
Deutschen Industrie; K. D. Mielenz: "Wirkung<br />
der Atomwaffen" (12. Fortsetzung).<br />
Für die Führungskräfte des BuI-Dienstes<br />
von besonderer Bedeutung die Abhandlungen<br />
über "Berlin im Bombenkrieg",<br />
"Ausweichen - der natürlichste Schutz",<br />
"Fernmeldemittel für den Luftschutz",<br />
Rede des Bundesministers des Innern und<br />
die Referate im Abschnitt "Neu es über<br />
den Luftschutz" sowie die Fortsetzung<br />
der Abhandlung über die "Wirkung der<br />
Atomwaffen".<br />
Auer - Mitteilungen, Hausmitteilungen<br />
der Auer-Gesellschaft, Berlin N 65, Jahrgang<br />
5, Januar 1956, Heft 1. Dr. Walter<br />
Köhler, Berlin: "Zur Gas-Straßenbeleuchtung<br />
der Gegenwart"; Dr. Richard G.<br />
Franke, Berlin: "Gasleuchten für Wohnräume<br />
und für Sonderzwecke"; Dipl.-Ing.<br />
Alex Wellnitz: "Neuer Kennscheinwerfer<br />
19
für Einsa tzfahrzeuge"; Polizeikommissar<br />
Kurt Böhme, Berlin: "Das neue Einsatzblaulicht<br />
(EBL) in Berlin (West) ; Erfahrungen<br />
der Berliner Feuerwehr mit dem<br />
Einsatzblaulicht Auer-EBL"; Dipl.-Chemiker<br />
Hans Kreis, Berlin: "Zum Gebrauch<br />
von Filter-Atemschutzgeräten". Für die<br />
Ausbilder im Gasschutz von besonderer<br />
Beachtung ist die Abhandlung von H .<br />
Kreis über: "Filter-Atemschutzgeräte".<br />
Draeger - Hefte, Hausmitteilung des<br />
Draeger-Werkes, Lübeck, ApriVDezember<br />
1955, NI'. 227. Dipl.-Ing. H. Neuhaus: "CO<br />
Filterselbstretter auf der Schachtanlage<br />
Welheim der Steinkohlenbergwerke Math.<br />
Stinnes AG., Bottrop-Boy"; Dr. Stampe<br />
und Obering. H. Tietze: "Der Staubschutzatmer<br />
Modell Stinnes-Zeche Kronprinz";<br />
Obering. Fürniß und Dr.-Ing.<br />
F . Hollmann: "Der Pulmotor in neuer<br />
Form" ; Dr. Hollmann und Ing. E. Warncke:<br />
"Farbspritz-Schu tzgerät, Modell PF 62";<br />
Obering. Tietze: "Sauerstoff-Meßgerät,<br />
Modell RM 2656" ; Dr. Franke: "über die<br />
Bestimmung des CO-Gehaltes in der aLlSgeatmeten<br />
Luft mit dem Gasspürgerät";<br />
Dr. Großkopf: "Praktische Durchführung<br />
der CO-Prüfung in der Atemluft"; Dr.<br />
Großkopf: "Prüfröhrchen für Blausäure".<br />
Für die Ausbilder im Gasschutz- und Bergungsdienst<br />
besonders beachtenswert die<br />
Abhandlungen über "Pul motor", "Sauerstoff-Meßgerät",<br />
und "Bestimmung des<br />
CO-Gehaltes" .<br />
Nobel-Hefte (Sprengmittel in Forschung<br />
und Praxis, herausgegeben vom Sprengtechnischen<br />
Dienst der Dynamit-Actien<br />
Gesellschaft, vorm. Alfred Nobel & Co.,<br />
Troisdorf, 22. Jahrgang, Heft 1, Jan. 1956.<br />
Dipl.-Ing. Hahn, Clausthal: "Das Millisekundenschießen"<br />
; Habbel, Clausthal:<br />
"Wann und wodurch wird Kleinstückig<br />
~:eit des Haufwerks beim Einsatz der<br />
Millisekundenintervalle erreicht?"; Dr.<br />
Brauer, Gummersbach: "Die Sprengarbeit<br />
in der westdeutschen Grauwacke unter<br />
besonderer Berücksichtigung der Verwendung<br />
von Sprengpulver"; H. Timmann,<br />
Steimbke (Niedersachsen): "Die<br />
Torpedierung eines Bohrloches in 3000 m<br />
Tiefe"; Die Abhandlungen sind für die<br />
Sprengmeister und Ausbildungsleiter im<br />
Sprengdienst wissenswert.<br />
S V I - der junge ingenieur - Monatszeitschrift<br />
des Studentenverbandes deutscher<br />
Ingenieur schulen, Jahrgang 8, März<br />
1956. Heft 3. Entwicklung und Aufgaben<br />
der Elektroindustrie; Dipl.-Ing. Dittler,<br />
FrankfurtlM: "Der Einfluß der Elektrizität<br />
auf die modernen Verhältnisse" ;<br />
L. Steinecke: "Moderne Energienu; "Größter<br />
Schaufelradbagger der Welt" ; "Das<br />
Vordringen des Supertankers"; "Wie groß<br />
ist ein Atom?U ; "StrahlungsmeßgeräteU;<br />
Beiträge zur Frage der Materialwahl in<br />
der Kanalisationstechnik. Alle Abhandlungen<br />
sind für die Ausbilder des technischen<br />
Dienstes, Fachrichtung Elektrotechnik,<br />
lesenswert.<br />
Bosch - Kurier, Betriebszeitschrift der<br />
Robert Bosch GmbH, kostenlos bei den<br />
Bosch-Diensten erhältlich. NI'. 13, Febr.<br />
1956. Bilderteil; R. Gerwin: "Wie wird die<br />
Welt ihren Energiehunger stillen?"; Revue<br />
neuer Erzeugnisse und viele andere sehenswerte<br />
Bilder und Abbildungen für den<br />
Kraftfahrer. Die Abhandlung "Wie wird<br />
die Welt ihren Energiehunger stillen",<br />
von R. Gerwin, mit ihrem reichen Bildund<br />
Lehr tafelmaterial ist hervorragend<br />
für einen Vortrag für die Helfer der<br />
Netzgruppen NE geeignet.<br />
Das Gas- und Wasserfacb (Gastechnik,<br />
Gaswirtscbaft, Wasserwesen). Verlag: R .<br />
Oldenbourg, München I, Postfach, 97. Jahrgang,<br />
Heft 4, Februar 1956.<br />
Wasser - Abwasser. Steinwender: "Neuzeitliches<br />
über Heberleitungen"; Beier:<br />
"Kunststoffrohre" ; Steinraht: "Die Beurteilung<br />
des korrosionsci1emischen Verhaltens<br />
kalter und warmer Wäss~"; Imhoff<br />
und Sierp: "Amerikanische Rückschau<br />
auf die Abwasserliteratur des Jahre s 1954".<br />
Von besonderem Interesse für die Gruppenführer<br />
der Rohrgruppen des THW sind<br />
die Abhandlungen über Heberleitungen<br />
und übel' Kunststoffrohre, bei denen besonders<br />
auf Asbestzementrohre eingegangen<br />
wird. In de r Zeitschriftenrundschau<br />
sind die Besprechungen über Wasserversorgung<br />
für Kernreaktoren sowie die<br />
Besprechungen über die verschiedene n<br />
Kunststoffe und Anstriche beachtenswert.<br />
L e bt"g änge i n JI ari enthal<br />
von-bis<br />
Lehrg.-<br />
NI'.<br />
Anmeldeschluß<br />
127 14. 5. - 19. 5. 56 30. 4. 56<br />
128 22. 5. - 26. 5. 56 8.5.56<br />
129 28. 5. - 2.6.56 14. 5. 56<br />
130 4.6. - 9.6.56 21. 5. 56<br />
131 12. 6. - 22. 6. 56 29. 5. 56<br />
132 25. 6. - 30. 6. 56 11. 6. 56<br />
Dauer<br />
Art des Lehrganges<br />
6 9. Behelfsbrückenbau-Lehrgang<br />
BuI-Sonderlehrgang<br />
6 B-Gruppenführer-Lehrgang<br />
6 BuI-Grundlehrgang<br />
für Führungskräfte<br />
10 Sprengdienst<br />
6 BuI-Sonderlehrgang<br />
für FÜhrungskräfte<br />
Der Landesverband Bayern betrauert das<br />
Ableben seiner Kameraden<br />
Ob.-Ing. Korvettenkopitän d. R.<br />
Walter Koepke<br />
Ausschußmitglied des OV Landsberg,<br />
verstarben am 18. 12. 1955,<br />
Fobrikdirektor o . D.<br />
Kar. Rals<br />
Mitbegründer und erster Ortsbeauftragter<br />
des OV Rosenhei m, ausgezeichnet<br />
mit dem THW-Helferzeichen in Gold,<br />
verstorben am 5. Januar 1956,<br />
Pensionist Franz Brem<br />
Helfer des OV Augsburg,<br />
verstorben am 7. 1. 1956.<br />
Die Verstorbenen zählten zu den ältesten<br />
und treuesten Mitgliedern der TN<br />
und haben sich bei Gründung des THW<br />
sofort wieder in den Dienst der guten<br />
Sache gestellt.<br />
Sie werden unvergessen bleiben!<br />
Lande sverband Bayern<br />
Wir betrauern das Ableben unseres<br />
Kameraden<br />
Ernst Roßberg<br />
eboren am 20. 6. 1891 in Rochlitz<br />
Sachsen), gestorben am 5. 3. 1956 in<br />
~ osenheim (Oberboyern).<br />
Der Verstorbene gehörte seit dem J ahre<br />
1921 der Technischen Nothilfe und seit<br />
dem Jahre 1952 dem Technischen Hilfswerk<br />
an. In Friedens- wie in Kriegszeiten<br />
war Roßberg ein treuer, zuverlässiger<br />
Helfer. Beim THW hatte er als hauptamtlicher<br />
Mitarbeiter die Geschäftsführung<br />
des Ortsverbandes Rosenheim und<br />
die Betreuung der Ortsverbände Bad<br />
Aibling, Freilassing, Miesbach, Traunstein<br />
und Wasserburg, mit deren Aufbau<br />
sein Name stets verbunden bleiben wird.<br />
Landesverband Bayern<br />
Am 29. Februar 1956 ist unser Kqmerad<br />
Oberingenieur<br />
August Engels<br />
der Vorsitzende des Technischen Ausschusses<br />
des Ortsverbandes Solingen,<br />
nach qualvollem Leiden gestorben.<br />
Er war Mitglied der früheren Technischen<br />
Nothilfe und stellte sich dem Technischen<br />
Hilfswerk im März 1953 zur Verfügung.<br />
Seit dieser Zeit hat uns Kamerad Engels<br />
mit Rat und Tat geholfen. Er wurde für<br />
seine Verdienste mit dem THW-Helferzeichen<br />
in Gold ausgezeichnet.<br />
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen<br />
wirklichen Kameraden und treuen Mitarbeiter<br />
des Ortsverbandes und werden<br />
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.<br />
OV Solingen<br />
Am 11. März 1956 verstarb unerwartet<br />
unser lieber Kamerad<br />
Erhard Gasch<br />
im Alter von 61 Jahren. Trotz seiner<br />
schweren Kriegsbeschädigung war der<br />
Verstorbene stets ein besonders zuverlässiger<br />
und hilfsbereiter Mitarbeiter<br />
unseres Bezirksverbandes .<br />
Wir werden unserem Kameraden Gasch<br />
ein gutes Andenken bewahren.<br />
Bezirksverband Berlin-Rei nickendorf<br />
Beilagenhinweis<br />
Stellenangebote<br />
Bei der Bu ndesanstalt Tech nisches Hilfswerk<br />
werden sofort oder später<br />
mehrere Diplom-Ingenieure<br />
und Oberingenieure<br />
des Bau- ader Maschinenbauwesens eingestellt.<br />
Kennziffer 1/3, Vergütung nach<br />
TO.A.III.<br />
Anforderungen: Abgeschlossene Hochschulbildung<br />
ader HTL-Bildung in den<br />
angegebenen Fachrichtungen und möglichst<br />
praktische Erfahrungen im öffentlichen<br />
Dienst, Neigung zu organisatorischen<br />
Arbeiten und Eignung für Lehrund<br />
Unterrichtstätigkeit.<br />
Bewerber, die THW-Helfer sind ader die<br />
Materie des Technischen Hilfswerks kennen/<br />
werden bevorzugt. Bewerbungen mit<br />
Lebenslauf in Stichworten (mäglichst nach<br />
Vordruck) und kurzer Obersicht über den<br />
Ausbildungs- und beruflichen Werdegang<br />
bis zum 30. 4. 1956 an den<br />
Direktor de r Bundesanstalt<br />
Te chnisches Hilfswerk, Bann, Postfa ch .<br />
Vordrucke für den Lebenslauf können angefordert<br />
werden. Persönliche Vorstellung<br />
nur nach Anforderung.<br />
Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt "Sicherheit in explosionsgefährdeten<br />
Betrieben" von der Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft,<br />
Er1a!Ilgen, bei, den wir Ihrer bes