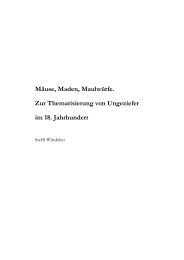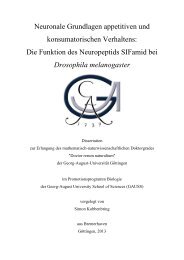Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Auf den Spuren von Yrjö Wichmann<br />
Sprache, Geschichte und Kultur der Moldauer Tschangos<br />
Dissertation<br />
zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades<br />
an der Philosophischen Fakultät<br />
der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>- <strong>Universität</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
vorgelegt<br />
von<br />
Kraus, Andrea<br />
<strong>Göttingen</strong> 2007/2008
Inhaltsverzeichnis<br />
I. Einleitung......................:..............................................................................................................1<br />
II. Geschichte der Moldauer Tschangos…..…………..…………………………………………...4<br />
III. Grundlegende Charakteristika des Moldauer Tschango-Dialektes..........................................18<br />
1. Die wichtigsten phonetischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion...............20<br />
2. Die wichtigsten morphologischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion........21<br />
3. Die wichtigsten lexikalischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion...............26<br />
IV. Aktualisierung des Wörterbuches von Yrjö Wichmann...........................................................28<br />
1. Methodik... ...........................................................................................................................28<br />
1.1. Planung und Zusammenstellung des zur Aktualisierung des Wortschatzes<br />
notwendigen Arbeitsmaterials.......................................................................................33<br />
1.2. Wörter und Kulturgeschichte.........................................................................................38<br />
2. Themenbereich der Pflanzen und des Pflanzenanbaues ......................................................40<br />
2.1. Sachgruppe der Wildpflanzen........................................................................................41<br />
2.2. Sachgruppe der Getreidearten und des Getreideanbaues einschließlich der<br />
landwirtschaftlichen Maschinen und Tätigkeiten..........................................................43<br />
2.3. Sachgruppe des Gemüseanbaues…………………….………………………………..45<br />
2.4. Sachgruppe der Obstarten und des Obstanbaues…………..……………………….....49<br />
2.5. Sachgruppe des Weinanbaues…………..……………………………………………..50<br />
2.6. Sachgruppe der Leinen-, Hanf- und Baumwollverarbeitung……………………….....51<br />
2.7. Zusammenfassung………………………………………………………………….....52<br />
3. Themenbereich der Tiere und der Viehzucht........................................................................53<br />
3.1. Sachgruppe der freilebenden Tiere und Parasiten.......... ...............................................54<br />
3.2. Sachgruppe der Haus- und Nutztiere..............................................................................55<br />
3.3. Sachgruppe der mit der Viehzucht verbundenen Geräte................................................60<br />
3.4. Sachgruppe der Bienenzucht..........................................................................................60<br />
3.5. Sachgruppe des Fischfanges...........................................................................................61<br />
3.6. Sachgruppe der Jagd.......................................................................................................62<br />
3.7. Zusammenfassung..........................................................................................................62<br />
4. Themenbereich des Hauses und des Hausgewerbes..............................................................64<br />
4.1. Sachgruppe des Hauses und der häuslichen Umgebung.................................................64<br />
4.2. Sachgruppe der Hauseinrichtung....................................................................................67<br />
4.3. Sachgruppe des Hausgewerbes.......................................................................................70<br />
4.3.1. Tätigkeiten innerhalb des Hauses und des häuslichen Umfeldes.............................71<br />
4.3.2. Werkzeuge für den häuslichen Gebrauch.................................................................72<br />
4.3.3. Spinn- und Webarbeiten...........................................................................................73<br />
4.4. Zusammenfassung..........................................................................................................75
5. Kurze Kulturgeschichte der Moldauer Tschango-Ungarn......................................................77<br />
5.1. Religiöser Wortschatz, Glaubensvorstellungen, Aberglauben, Gebräuche,<br />
Identität...........................................................................................................................77<br />
5.1.1. Religiöses Leben, kirchliche Riten...........................................................................80<br />
5.1.2. Negative Elemente, Flüche, Verwünschungen.........................................................85<br />
5.1.3. Märchenmotive, Aberglauben, Spuren heidnischer Glaubensvorstellungen............85<br />
5.1.4. Gebräuche.................................................................................................................88<br />
5.2. Tänze...............................................................................................................................93<br />
5.3. Bekleidung......................................................................................................................94<br />
5.4. Ernährungsgewohnheiten...............................................................................................97<br />
5.5. Zusammenfassung........................................................................................................100<br />
6. Berufsbezeichnungen…….......………………………………….………………………….101<br />
6.1. Zusammenfassung..........................................................................................................105<br />
7. Verwandtschaftsterminologie................................................................................................106<br />
7.1. Zusammenfassung……………………………………………………………………..110<br />
8. Namengebung........................................................................................................................111<br />
8.1. Zusammenfassung..........................................................................................................116<br />
9. Handel, Geldsorten und Administration................................................................................116<br />
9.1. Handel.............................................................................................................................116<br />
9.2. Geldsorten.......................................................................................................................117<br />
9.3. Administration, Verwaltung, militärische Fachtermini, Statussymbole,<br />
historische Kategorien....................................................................................................119<br />
9.4. Zusammenfassung..........................................................................................................121<br />
10. Grundwortschatz....................................................................................................................122<br />
10.1. Mensch und Tier...........................................................................................................122<br />
10.1.1. Körperteile............................................................................................................122<br />
10.1.2. Krankheiten........................... ...............................................................................123<br />
10.2. Natur.............................................................................................................................125<br />
10.2.1. Geographische Einheiten......................................................................................125<br />
10.2.2. Wetter...................................................................................................................126<br />
10.2.3. Himmelsrichtungen, Himmelskörper, Jahreszeiten,<br />
Monatsbezeichnungen, Wochentage, Tageszeiten...............................................126<br />
10.3. Numeralien und geometrische Bezeichnungen.............................................................127<br />
10.4. Farbbezeichnungen........................................................................................................127<br />
10.5. Kindersprache…………………………………………………………………………128<br />
10.6. Alltagsvokabular............................................................................................................128<br />
10.7. Sonstiges........................................................................................................................135<br />
10.7.1. Interjektionen..............................................................................................................................135<br />
10.7.2. Onomatopoetische Wörter.....................................................................................135<br />
10.7.3. Partikel...................................................................................................................136<br />
10.7.4. Pronomina..............................................................................................................138<br />
10.8. Zusammenfassung.........................................................................................................138<br />
11. Ergebnis der Untersuchung in Zahlen ausgedrückt……...................................................141<br />
12. Sprichwörter, Phrasen; Rätsel.............................................................................................141
V. Sprachlicher Einfluss des Rumänischen anhand der Kontaktphänomene der im<br />
Dokumentarroman Gazdas verschriftlichten Äußerungen zweisprachiger Moldauer<br />
Tschangos................................................................................................................................143<br />
1. Methodik/Terminologische Fragen…...…………………………………………………..143<br />
2. Direkte/Unmittelbare Entlehnungen....................................................................................155<br />
2.1. Terminologische Fragen...............................................................................................155<br />
2.2. Rumänische Lehnwörter als Bestandteile der regionalen ungarischen<br />
Umgangssprache Rumäniens........................................................................................156<br />
2.3. Rückentlehnungen........................................................................................................158<br />
2.4. Internationalismen........................................................................................................160<br />
2.5. Dubletten/Wortpaare.......................................................... .........................................165<br />
2.6. Integration der rumänischen Lehnwörter in das ungarische Sprachsystem der<br />
Moldauer Tschangos………........................................................................................168<br />
2.6.1. Morphologische Integration der rumänischen Lehnwörter<br />
in das ungarische Sprachsystem der Moldauer Tschangos……............................168<br />
2.6.2. Rumänische Lehnwörter als produktive Wortbildungselemente...........................170<br />
2.7. Gemeinsamer Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte.............................................172<br />
2.8. Verteilung der rumänischen Lehnwörter nach Sachgruppen........................................175<br />
2.9. Verteilung der rumänischen Lehnwörter nach Wortarten................ ...........................178<br />
3. Indirekte/Mittelbare Entlehnungen.......................................................................................180<br />
3.1. Terminologische Fragen................................................................................................180<br />
3.2. Lehnbedeutungen............................................................................................. .............182<br />
3.2.1. Absolute Lehnbedeutungen/Lehnbedeutungen im engeren Sinn............................182<br />
3.2.2. Relative Lehnbedeutungen/Lehnbedeutungen im weiteren Sinn............................189<br />
3.3. Lehnbildungen...............................................................................................................191<br />
3.3.1. Lehnübersetzungen.............. ...................................................................................191<br />
3.3.2. Lehnverbindungen...................................................................................................201<br />
4. Zusammenfassung................................................................................................................203<br />
5. Kodewechsel.........................................................................................................................204<br />
5.1. Terminologische Fragen................................................................................................204<br />
5.2. Grammatikalische Typen des Kodewechsels................................................................207<br />
5.2.1. „B-Typ”-Kodewechsel............................................................................................208<br />
5.2.2. „N-Typ”-Kodewechsel............................................................................................209<br />
5.2.3. „G-Typ”-Kodewechsel............................................................................................212<br />
5.2.4. „F-Typ”-Kodewechsel.............................................................................................213<br />
5.2.5. „X-Typ”-Kodewechsel............................................................................................214<br />
5.3. Funktionen des Kodewechsels.......................................................................................214<br />
5.3.1. Kontextueller Kodewechsel.....................................................................................215<br />
5.3.1.1. Referentielle Funktion des Kodewechsels.........................................................215<br />
5.3.1.2. Sprachliche Auslöseelemente des kontextuellen Kodewechsels.......................222<br />
5.3.2. Situativer Kodewechsel.............................................................................................225<br />
5.3.2.1. Zitierfunktion des Kodewechsels...........................................................................225<br />
5.3.2.2. Expressive Funktion des Kodewechsels................ ................................................227<br />
5.3.2.3. Verdeutlichungsfunktion des Kodewechsels........ .................................................227<br />
5.3.2.4. Metalinguistische Funktion des Kodewechsels......................................................228<br />
5.4. Verteilung der Kontaktphänomene in den 3 Tschango-Dialekten ...................................230
VI. Zusammenfassung..................................................................................................................237<br />
Bibliographie……………………………………………………………………………………245<br />
Abbildungsverzeichnis.................................................................................................................256<br />
Anhang..........................................................................................................................................257
I. Einleitung<br />
Die archaischste ungarisch(sprachig)e Ethnie bilden die Moldauer Tschangos, die schon seit<br />
Jahrhunderten einem starken rumänischen Einfluss ausgesetzt sind.<br />
Schon seit Anfang des 17. Jahrhunderts berichten die das Moldau-Gebiet besuchenden<br />
Missionare regelmäßig vom beginnenden Prozess einer sprachlichen und kulturellen<br />
Assimilation der römisch-katholischen Ungarn an das orthodoxe Rumänentum.<br />
Aus den Reiseberichten Anfang des 19. Jahrhunderts zeigt sich eindeutig, dass die ungarische<br />
Sprache in vielen Dörfern der Moldauer Ungarn eindeutig an Raum verliert.<br />
So wurden auch in der Forschungsliteratur über die Tschango-Ungarn bis heute immer wieder<br />
Stimmen laut, die - was ihren Sprachzustand betrifft - die herderschen Alarmglocken läuten.<br />
In fast jedem Bericht über ihren Sprachzustand findet sich von László (1882: 85) über<br />
Gyırffy (1916: 501) bis Pozsony (2005: 147) die Prophezeiung, dass der endgültige<br />
Sprachwechsel schon innerhalb von 1-2 Generationen eintreten wird:<br />
„Ich behaupte (...) dass in 30 Jahren [von der ungarischen Sprache] nicht mehr viel zu retten sein wird.” (László<br />
1882: 85, zitiert in Vincze 2004: 107)<br />
„(...) die ungarische Sprache [wird] im Moldau-Gebiet in 20 Jahren vollständig und unwiderbringlich<br />
verstummen” (Gyırffy 1916: 501, zitiert in Mikecs 1941: 311)<br />
„[Es ist wahrscheinlich, dass] innerhalb von 1-2 Generationen ganze Dorfgemeinschaften (wie z.B. die<br />
katholischen Siedlungen um Románvásár [d.h. die Nord-Tschangos] ) ihre einstige Muttersprache aufgeben<br />
werden.” (Pozsony 2005: 147)<br />
Die vorliegende Arbeit soll nun auch dazu beitragen, herauszufinden, wie es um die Sprache<br />
der Tschangos tatsächlich bestellt ist. Das konkrete sprachliche Material hierzu liefern das<br />
Wörterbuch Yrjö Wichmanns (1936), der „Sprachatlas der Moldauer Tschango Mundart”<br />
(Szabó T. Attila - Gálffy Mózes - Márton Gyula 1991) und der Dokumentarroman von József<br />
Gazda „Hát én hogyne síratnám” (1993).<br />
Sowohl das Wörterbuch Wichmanns als auch der Tschango-Sprachatlas sind mehr oder<br />
weniger Ansammlungen isolierter Wörter. Zu einer vollständigen Darstellung des<br />
Sprachzustands der Moldauer Ungarn muss jedoch die spontane, freie und ungebundene Rede<br />
in die Untersuchung miteinbezogen werden, wozu der Dokumentarroman Gazdas, der sich<br />
aus den Erinnerungen von über 100 Moldauer Tschangos aller Dialektgruppen – im Grunde<br />
genommen allesamt „Sprachmeister” – zusammensetzt, ein ideales Korpus bietet.<br />
Zusätzlich beschränkt sich die Analyse so nicht nur auf den Sprachzustand der Nord-<br />
Tschangos, sondern kann auch auf die weiteren Dialektgruppen der Moldauer Ungarn, die<br />
Süd- und Székler Tschangos ausgeweitet werden.<br />
1
Konkrete Ziele der vorliegenden Arbeit:<br />
1.) Anhand des Nordtschango-Wörterbuchs von Yrjö Wichmann, das den Sprachzustand<br />
unseres Untersuchungsdorfes Szabófalva (rum. Săbăoani) von 1907 widerspiegelt, soll<br />
herausgefunden werden, inwieweit sich der Wortschatz innerhalb von beinah einem<br />
Jahrhundert verändert hat.<br />
2.) Unter Zuhilfenahme des in den 50-er Jahren gesammelten Datenmaterials des „Sprachatlas<br />
der Moldauer Tschango Mundart” (Szabó T. Attila - Gálffy Mózes - Márton Gyula 1991) soll<br />
– in einer Art „Halbwertszeit”-Analyse – zusätzlich eine Zwischenbilanz gezogen werden, um<br />
so - sofern möglich – die „dynamische” Geschichte der einzelnen Wörter besser<br />
nachverfolgen zu können.<br />
3.) Durch die Analyse des reichhaltigen sprachlichen Materials, das uns der<br />
Dokumentarroman von József Gazda „Hát én hogyne síratnám” (1993) zur Verfügung stellt,<br />
soll der Einfluss der rumänischen Sprache auf den Moldauer Tschango-Dialekt<br />
(Dialektgruppen) anhand der Verteilung der Kontaktphänomene der Lehnwörter,<br />
Lehnbedeutungen, Lehnbildungen sowie des Kodewechsels untersucht werden.<br />
Belege für die Authentizität des Dokumentarromans:<br />
a.) die als Ergebnis der über 20 Jahre lang in Anspruch nehmenden Materialsammlung von<br />
József Gazda entstandenen Tonbandaufnahmen der biographischen Interviews der zahlreichen<br />
Tschango-Informanten können jederzeit beim Autor eingesehen werden<br />
b.) József Gazda versieht die Äußerungen seiner Informanten jeweils mit einer kodierten<br />
Buchstabenverbindung, deren Entschlüsselung sich im Namensverzeichnis des Kapitels V<br />
dieser Arbeit findet, so dass sich ermitteln lässt, welcher konkreten Person und welchem<br />
Siedlungsgebiet der jeweilige Beleg zuzuordnen ist<br />
4.) Anhand des umfangreichen und authentischen Sprachkorpus des oben erwähnten<br />
Dokumentarromans, das sich aus insgesamt 100.122 Wörtern zusammensetzt und sämtliche<br />
Dialektgruppen der Moldauer Tschangos umfasst, kann weiterhin folgenden Fragen nachgegangen<br />
werden:<br />
a.) Stärkegrad des rumänischen Einflusses in den drei Tschango-Dialektgruppen<br />
b.) eventuelle Unterschiede in den einzelnen Dialektgruppen der Moldauer Tschangos in der<br />
Stärke des rumänischen Einflusses<br />
c.) Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung<br />
5.) Die Ergebnisse der Analyse des Dokumentarromans von József Gazda können einen<br />
Beitrag zum Forschungsprojekt „Die ungarische Sprache im Karpatenbecken am Ende des<br />
2
XX. Jahrhunderts” leisten, und dieses durch das sprachliche Material der Moldauer Tschangos<br />
ergänzen.<br />
Das oben genannte Forschungsprojekt wurde 1993 von Miklós Kontra ins Leben gerufen und<br />
beschäftigt sich mit der kontaktlinguistischen Analyse des Sprachzustandes und -gebrauchs<br />
der ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern Ungarns. Die Folgen der<br />
Zweisprachigkeit stellen die bisher erschienen Bände über die ungarische Sprache in der<br />
Ukraine (Transkarpatien), (István Csernicskó 1998), Jugoslawien (Wojwodina) (Lajos Göncz<br />
1999) und Slowakei (István Lanstyák 2000) dar; noch in Erscheinung begriffen sind die<br />
Bände über den ungarischen Sprachzustand in Rumänien (János Péntek und Sándor Szilágyi),<br />
Österreich und Slowenien (István Szépfalusi und Ottó Vörös).<br />
6.) Durch die Integration des Gazda-Materials in das oben erwähnte Forschungsprojekt soll<br />
den Tschangos etwas von ihrem „Stiefkind-Status” innerhalb der Zweisprachigkeits- und<br />
Sprachkontaktforschung genommen werden, auf den z.B. auch Sándor (1996a:51) oder Bodó<br />
(2005: 302) aufmerksam machen.<br />
Bodó (2005: 302) legt als zukünftigen Aufgabenbereich der sprachwissenschaftlichen<br />
Tschango-Forschung die ausführliche Beschreibung der lexikalischen und grammatischen<br />
Folgen des (tschango)ungarisch - rumänischen Sprachkontaktes fest. Mit dem Fehlen dieser<br />
empirischen Forschungen erklärt er u.a. den Umstand, dass die Sprache der Tschangos sowohl<br />
in der ungarischen Öffentlichkeit als auch in der Fachliteratur oft negativ bewertet wird.<br />
Dies zeigt sich z.B. auch darin, dass der pejorative Ausdruck „sprachlicher Prozess der<br />
Tschangoisierung” („nyelvi csángósódás”) mittlerweile zum soziolinguistischen Terminus<br />
technicus geworden ist. Katalin Fodor (2001: 18, zitiert in: Tánczos 2004: 249 ) benutzt ihn<br />
z.B. als Synonym für den Prozess des Sprachabbaus, den sie auf die vielen rumänischen<br />
Lehnwörter und Lehnbildungen zurückführt.<br />
7.) Diese Einschätzung soll nun in dieser Arbeit anhand konkreten sprachlichen Materials<br />
geprüft – und wenn nötig, revidiert werden.<br />
Die Äußerungen der Gazda-Informanten werden jeweils mit einer kodierten Buchstabenverbindung versehen,<br />
deren Entschlüsselung sich im Namensverzeichnis des Anhanges findet, so dass sich ermitteln lässt, welcher<br />
konkreten Person und welchem Siedlungsgebiet der jeweilige Beleg zuzuordnen ist. (József Gazda kennzeichnet<br />
die Männer mit 2, die Frauen wiederum mit 3 Majuskeln)<br />
Die Vertreter der Nord-Tschangos werden mit N, die Süd-Tschangos mit S und die Székler Tschangos<br />
schließlich mit Sz abgekürzt.<br />
3
II. Geschichte der Moldauer Tschangos<br />
Die finnische Abgeordnete Tytti Isohookana-Asunmaa – Mitglied der politischen Gruppe der<br />
Liberalen, Demokraten und Reformer – legte am 4. Mai 2001 der Parlamentarischen<br />
Versammlung des Europarates einen Entwurf einer Empfehlung zur Bewahrung der Kultur<br />
der im Moldau-Gebiet Rumäniens lebenden Tschango-Minderheit vor, in dem sie hervorhebt,<br />
dass „die Tschangos eine heterogene Gruppe römisch-katholischer Konfession und<br />
ungarischer Herkunft bilden. (...) Die Tschangos zeichnen sich besonders durch ihre<br />
archaische Sprache, uralten Traditionen sowie variationsreiche Volkskunst und Kultur aus.<br />
Die Grundlage ihrer Identität besteht seit Jahrhunderten aus ihrer römisch-katholischen<br />
Konfession und ihrer eigenen Sprache – einem Dialekt des Ungarischen, den sie innerhalb der<br />
Familie bzw. der Dorfgemeinschaft verwenden.<br />
Heute sprechen nur noch etwa 60-70.000 Tschangos ihre eigene Muttersprache. Zum Schutze<br />
dieses Beispiels der europäischen kulturellen Vielfalt, empfiehlt die Parlamentarische<br />
Versammlung der Ministeriellen Kommission, Rumänien zu einer Unterstützung der<br />
Tschangos zu ermutigen und es zur Einführung konkreter Maßnahmen – insbesondere, was<br />
den Bereich des ungarischsprachigen Unterrichts betrifft – zu bewegen.” (Isohookana-<br />
Asunmaa 2002: 105)<br />
Am 23. Mai 2001 wurde auf der Parlamentarischen Versammlung des Europarates die von<br />
der Abgeordneten Isohookana-Asunmaa unterbreitete Empfehlung Nr. 1521 (2001)<br />
angenommen und – mit drei rumänischen Gegenstimmen – verabschiedet.<br />
Die Tschangos [ungarisch csángó, rumänisch ceangăi (< ungar.)] leben in der östlichen<br />
Provinz Rumäniens, der Moldau, zwischen den Karpaten und dem Fluss Szeret (rum. Siret),<br />
in erster Linie an beiden Ufern des Flusses Szeret sowie in den Tälern der Nebenflüsse Ojtoz,<br />
(rum. Oituz), Tatros (rum. Trotuş), Tázló (rum. Tazlău), Beszterce (rum. BistriŃa) und Moldva<br />
(rum. Moldova).<br />
Das Ethnonym der oben erwähnten Gruppen – ung. csángó – stammt aus dem im Székler<br />
(eine Volksgruppe der Ungarn) Dialekt bekannten Verb csángál bzw. elcsángál<br />
’herumziehen’; ’sich abspalten’ und charakterisiert treffend diese vom Gros des Ungartums<br />
tatsächlich weit weggewanderten Gruppen.<br />
Die Ethnie der Moldauer Ungarn ist weder in historischer noch in sprachlichethnographischer<br />
Hinsicht einheitlich, weshalb viele Forscher die Anwendung der<br />
4
Sammelbezeichnung ’csángó’ auf diese Gruppe als falsch oder – im besseren Falle -<br />
oberflächig ansehen.<br />
„Die Mitglieder der genannten Volksgruppe halten sich selbst i.a. nicht für Tschangos; diese<br />
Bezeichnung betrachten sie als einen Spottnamen, den sie von einer ungarischen<br />
Volksgruppe, den benachbarten Széklern bekommen haben” (Pávai 2005: 163).<br />
So findet sich schon in Yrjö Wichmanns Wörterbuch beim Lemma ’sángó’/csángó folgende<br />
Erläuterung: „Benennung der Moldauer Csángó-Magyaren (wird von diesen als Spitzname<br />
aufgefasst; selbst nennen sie sich madjar, d.h. Magyaren)”.<br />
Die Ethnographie und Sprachwissenschaft unterscheiden innerhalb der Moldauer Tschangos 3<br />
Gruppen: die Gruppe der nördlichen, südlichen und Székler Tschangos.<br />
Die Moldauer Tschangos wurden im Verlauf ihrer wechselvollen Geschichte zu Bewahrern<br />
der archaischen Schichten des ungarischen Bildungsgutes, da ihre verschiedenen Gruppen seit<br />
Jahrhunderten durch die Karpaten isoliert in fremder sprachlicher, religiöser und ethnischer<br />
Umgebung leben. Die Grundlage ihrer Identität besteht seit Jahrhunderten aus ihrer römischkatholischen<br />
Konfession und ihrer eigenen Sprache – einem Dialekt des Ungarischen, den sie<br />
innerhalb der Familie bzw. der Dorfgemeinschaft verwenden.<br />
Man kann sagen, dass der Sprachwechsel bei einem Großteil der Tschangos schon eingetreten<br />
ist – der Sprachverlust trat bei einigen Gruppen sicherlich schon seit Jahrhunderten ein; die<br />
Mehrheit der Tschangos wiederum ist vom Sprachverlust erst seit den letzten 100-150 Jahren<br />
5
etroffen. Von den orthodoxen Rumänen unterscheidet sie nur noch ihr katholischer Glaube<br />
und zum Teil auch ihre Identität.<br />
Heute sprechen nur noch höchstens 60-70.000 in etwa 84 Dörfern wohnende Tschangos ihre<br />
einstige Muttersprache, der überwiegende Rest kann nur Rumänisch (siehe Futaky 2003: 23).<br />
Nach der heutigen offiziellen Statistik Rumäniens existieren – im Widerspruch zu den<br />
Angaben der Volkszählungen der Jahre 1901 und 1930 – kaum Moldauer Ungarn. Über ihre<br />
Größenordnung gibt es nur Vermutungen. Der Volkszählung von 1992 gemäß leben in der<br />
Moldau 243.133 Katholiken. Da die Rumänen fast ausschließlich der orthodoxen Konfession<br />
angehören, kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass in dieser<br />
Region diejenigen Personen mit katholischer Religion – eine geringe Zahl von assimilierten<br />
Deutschen, Italienern, Polen und Roma ausgenommen – Ungarn bzw. ungarischer<br />
Abstammung sind (siehe Tánczos 1999a: 229). Daher entstand auch die Eigenheit, dass nicht<br />
die gemeinsame Sprache, sondern vor allem die gemeinsame Konfession (bzw. zahlreiche<br />
gemeinsame Traditionen) die Zusammengehörigkeit bilden.<br />
„Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal aller – rumänischen und ungarischen – Csango ist<br />
ihre von der orthodoxen Mehrheitsbevölkerung abweichende römisch-katholische Religion.<br />
Nach der 1716 abgeschlossenen Beschreibung der Moldau von Dimitrie Cantemir war noch<br />
am Anfang des XVIII. Jahrhunderts „katholisch“ ein Synonym für „ungarisch“ (…)“ (Futaky<br />
2003: 23).<br />
Die oben erwähnte Besonderheit ist nicht nur bei den Moldauer Ungarn anzutreffen:<br />
„Die ethnische Identität setzt sich aus mehreren Faktoren [wie Sprache, Tradition oder<br />
Religion] zusammen, die [von Fall zu Fall abhängig] jeweils in unterschiedlichem Verhältnis<br />
zueinander stehen. Viele Völker konzentrieren sich nun in bedrohten Situationen nur auf eine<br />
dieser Faktoren, wobei sie diese zum Hauptbestandteil der zu bewahrenden Identität ausrufen.<br />
So bestimmten sich die Iren im 19. Jahrhundert als Katholiken; ihre keltische Sprache [ging]<br />
verloren” (Rein Taagepera 2000: 335-336).<br />
Der Moldauer Tschango-Dialekt der ungarischen Sprache ist äußerst heterogen; der<br />
gemeinsame Nenner der einzelnen dialektalen Gruppen liegt darin, dass sie archaische<br />
Schichten der ungarischen Sprache bewahrt haben, die nach der Spracherneuerung<br />
entstandenen ungarischen Wörter größtenteils nicht kennen sowie die mit der technischen<br />
Entwicklung und Urbanisierung verbundenen Begriffe gewöhnlich mit rumänischen Wörtern<br />
bezeichnen.<br />
Um die oben genannten Aspekte besser verstehen zu können, ist es nötig, sowohl die<br />
rumänische als auch die ungarische bzw. siebenbürgische Geschichte zu kennen.<br />
6
Im Folgenden werden wir die Geschichte beider Völker, deren Schicksale in den vergangenen<br />
Jahrhunderten oft miteinander verbunden waren, sich aber auch häufig gegenübergestanden<br />
haben, in ihren Grundzügen darstellen. Direkte Auswirkungen auf das Leben der Moldauer<br />
Ungarn hatte auch die Politik des Vatikans, die aus diesem Grund im historischen Überblick<br />
mitberücksichtigt wird.<br />
1068 wird im Osten des christlichen ungarischen Königreichs Kumanien der neue Nachbar.<br />
Die ungarischen Könige kämpften zwar gegen die immer wieder ins Land einfallenden<br />
kumanischen Heiden, schickten aber gleichzeitig, auf Drängen des Papstes, – da das<br />
vorrangige Ziel der Politik Roms die Bekehrung der Heiden war – Missionare nach<br />
Kumanien, dem späteren Fürstentum Moldau. Diese Missionare mitsamt den sich ihnen<br />
anschließendem Volk und Soldaten bildeten die erste dokumentierte ungarische Gruppe in der<br />
Moldau.<br />
Die Kumanen sahen sich einer großen Gefahr ausgesetzt, die ihnen in Gestalt der Tataren<br />
drohte. Um der immer bedrohlicher werdenden Gefahr des Mongoleneinfalles zu entgehen,<br />
suchten die Kumanen den Schutz des christlichen ungarischen Königreichs: 1227 nahm der<br />
Fürst der Kumanen, Barsz, die christliche Religion an und unterstellte somit sein Land und<br />
Volk unter die Oberhoheit Ungarns.<br />
Damit begann die Einströmung ungarischer, széklerischer und sächsischer<br />
[Sammelbezeichnung der vor allem aus den Gegenden um Rhein und Mosel auf Einladung<br />
der ungarischen Könige nach Siebenbürgen kommenden deutschsprachigen Siedler] Gruppen<br />
aus Siebenbürgen in das Gebiet jenseits der Karpaten. Im Tal der Flüsse bildeten sich<br />
ungarische Dörfer sowie ungarisch-sächsische Marktflecken, was durch die uns erhalten<br />
gebliebenen Urkunden und auch die Ortsnamen bezeugt wird (siehe Domokos 2001: 22-28).<br />
Der im Jahre 1241 erfolgende Tatarensturm dezimierte die Bevölkerung. Die Zahl der<br />
wenigen ungarischen, katholischen Überlebenden des tatarischen Massakers wurde vermehrt<br />
durch das Eintreffen immer neuerer ungarischer und anderer katholischer Gruppen jenseits<br />
der Karpaten.<br />
Im engen Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Tataren stand auch die Entstehung des<br />
Fürstentums Moldau. Mit ungarischer Hilfe gelang es, das tatarische Joch abzuschütteln, so<br />
dass um 1359 das Fürstentum Moldau gegründet werden konnte.<br />
„Über den Ursprung des Moldau genannten rumänischen Staates ist uns folgendes<br />
Sagenelement bekannt: ein Fürst namens Dragoş kam aus Máramaros, einem der Komitate<br />
des mittelalterlichen Ungarn hierher und eroberte das Land.(...) [Das Fürstentum] entstand<br />
7
irgendwann im Verlaufe des 14. Jahrhunderts; 1359 wird es vom Fürsten Bogdan von der<br />
ungarischen Oberhoheit befreit. Der ungarische Lehensanspruch bleibt zwar auch später<br />
bestehen, doch verstärkt sich aufgrund der geographischen Lage des Fürstentums der<br />
polnische Einfluss” (Niederhauser 2001: 47).<br />
Zu dieser Zeit war noch nicht entschieden, ob der östliche, orthodoxe oder der westliche,<br />
katholische Zweig des Christentums in der Moldau vorherrschen wird. Da einige unter den<br />
Fürsten der Moldau offen mit der katholischen Religion sympathisierten – mehrere hatten<br />
sogar ungarische Ehefrauen – bot dieser Umstand im 14./15. Jahrhundert ausreichenden<br />
Schutz für die hier lebenden, ungarischen, sächsischen und polnischen Katholiken. Dieser<br />
Zeitraum zeichnete sich durch religiöse Toleranz aus.<br />
Die Städte entwickeln sich, katholische Bistümer entstehen und in den Dörfern leben gut<br />
situierte Ungarn, wie die hier Durchreisenden berichten. Unterdessen erhöht sich die Anzahl<br />
der Moldauer Ungarn durch das Eintreffen immer neuerer Gruppen, die zum Teil als<br />
Grenzwächter, zum Teil als Flüchtlinge ins Land kamen und Siedlungen errichteten (siehe<br />
Halász 1999: 23-24). Es ist nicht uninteressant zu erwähnen, dass es eine Periode im<br />
Fürstentum Moldau gab, in der die aus Südungarn geflohenen Hussiten nicht nur Zuflucht<br />
fanden, sondern sich hier auch ansiedeln konnten, worüber bis zum heutigen Tage der Name<br />
der Moldauer Stadt Huszt/(rum.) Huşi Zeugnis ablegt.<br />
In diesem Zeitraum „spielten die Siebenbürger Ungarn und Sachsen eine wichtige Rolle bei<br />
der Entfaltung des Moldauer Stadtsystems, Handwerks sowie Handels. Eine anschauliche<br />
Tatsache ist hierbei, dass die rumänische Sprache aus dem Ungarischen die Bezeichnung für<br />
’Stadt’, d.h. oraş (< ung. város) entlehnt hat (...). In Jászvásár [rum. Iaşi] (der späteren<br />
Hauptstadt des Landes) konzentrierte sich der bedeutende Teil des Handels zu dieser Zeit in<br />
den Händen der Sachsen und Ungarn. Die im Norden des Fürstentums befindlichen Städte<br />
wie Moldvabánya [rum. Baia], Szucsáva [rum. Suceava], Kutnár [rum. Cotnari], Szeretvásár<br />
[rum. Siret], Románvásár [rum. Roman]und Nemc [rum. Târgu NeamŃ] wurden eher von den<br />
Sachsen beherrscht, während sich die Bevölkerung der südlicher liegenden Marktflecken wie<br />
Tatros [rum. Târgu Trotuş], Bákó [rum. Bacău], Barlód [rum. Bârlad]und Husz [rum. Huşi]<br />
größtenteils aus Ungarn zusammensetzte. Im Grunde genommen waren am Ende des 16.<br />
Jahrhunderts die administrativen Zentren der 20 Moldauer Bezirke (rum. Ńinut) Marktflecken<br />
mit sächsischer oder ungarischer Bevölkerungsmehrheit“ (Pozsony 2005: 27-28).<br />
Nach der verheerenden Schlacht von Mohács 1526 – dem Jahr des türkischen Sieges über die<br />
Ungarn – kommt es zur Dreiteilung des Königreichs Ungarn: königliches Ungarn im Westen,<br />
8
in der Mitte ein türkischer Vasallenstaat und schließlich Siebenbürgen, wo später das<br />
autonome Fürstentum Siebenbürgen entsteht.<br />
In der Moldau verringert sich damit naturgemäß der ungarische Einfluss.<br />
Die ungarischen Katholiken blieben ohne jeglichen politischen und religiösen Schutz.<br />
So vergingen nicht einmal 100 Jahre und die das Moldauer Gebiet besuchenden kirchlichen<br />
Würdenträger konnten in ihren Briefen an den Vatikan nur von den Ruinen des ehemals<br />
blühenden katholischen Lebens berichten.<br />
Nach den anfänglichen Schwankungen errang die orthodoxe Kirche im Moldauer Fürstentum<br />
die Oberhand.<br />
1622 rief der Vatikan die Organisation namens „de Propaganda Fide“ ins Leben, deren<br />
Aufgabe in der Ausbildung von Missionaren bestand, die in den Ländern mit<br />
nichtkatholischer Staatsreligion die freie Ausübung des katholischen Glaubens gewährleisten<br />
sollten. Auch die beiden rumänischen Fürstentümer (Moldau und Walachei) mit orthodoxer<br />
Staatsreligion wurden zum Missionsgebiet erklärt; die katholische Bevölkerung der Moldau,<br />
die mehrheitlich aus Ungarn bestand, erhielt so italienische Missionare (siehe Domokos 2001:<br />
62).<br />
Vom 16. bis zum 18. Jahrhunderts kamen aus dem durch Bürgerkriege und Hungersnöte<br />
geplagten Siebenbürgen immer wieder neue ungarische Gruppen – vor allem die wegen der<br />
ständigen Einschränkung ihrer uralten Rechte verbitterten Székler – in die Moldau.<br />
Die letzte große Flüchtlingswelle fand 1764 – dem Datum des berüchtigten Mádéfalver<br />
Massakers – statt.<br />
Maria Theresia verordnete 1763 die Aufstellung einer siebenbürgischen Grenzwache, womit sie die uralten<br />
Freiheitsrechte der Székler missachtete. Die gegen die Einberufung in das Grenzregiment protestierenden Csíker<br />
Székler versammelten sich in Madéfalva, das „in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 1764 von den Soldaten des<br />
Generalleutnants Siskowicz umzingelt wurde; die aus dem Schlaf gerissenen Székler wurden angegriffen.<br />
Tausende Székler fanden dort den Tod” (Domokos 2001: 83).<br />
Das Mádéfalver Massaker löst eine Massenauswanderung der Székler ins Moldau-Gebiet aus,<br />
die eine Reihe neuer Dörfer gründen, deren Bewohner sich auch heute noch ihrer Herkunft<br />
bewusst sind.<br />
Hiernach kommen immer seltener und weniger Leute aus Siebenbürgen in die Moldau.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Moldauer Ungartum gegen Ende des Mittelalters<br />
noch über die gesellschaftlichen Klassen der adligen Landbesitzer, der Freibauern (den sog.<br />
részes / (rum.) răzeş), die der Bergarbeiter sowie die Bevölkerung der Marktflecken und<br />
Städte verfügte. Diese gegliederte Gesellschaft verschwand nun stufenweise zwischen dem<br />
15. und 18. Jahrhundert: die städtische Bevölkerung wurde durch Kriege und Seuchen<br />
9
vernichtet, die ungarischen Adligen assimilierten sich, die gesellschaftliche Klasse der<br />
Freibauern schließlich wurde zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert von der fürstlichen<br />
Willkür aufgelöst. Das Moldauer Ungartum bildete daher eine fast homogene Gesellschaft<br />
von Leibeigenen und Bauern und verfügte – nach der Schlussfolgerung von Vincze (2004: 17-<br />
19) – so nicht mehr über solche gesellschaftliche Klassen, die sie – wie das städtische<br />
Bürgertum, die Kleinadligen oder die geistliche Intelligenz – mit den Elementen der sich im<br />
Reformzeitalter zu formieren beginnenden, modernen ungarischen Nationalkultur bekannt<br />
gemacht hätten.<br />
Die beiden rumänischen Fürstentümer (Moldau und Walachei) standen vom 15. Jahrhundert<br />
bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts unter der Oberhoheit des Osmanischen Reiches.<br />
Im 19. Jahrhundert trat der Großteil der rumänischen weltlichen und geistlichen Intelligenz<br />
immer eindringlicher für den Unionsgedanken ein: durch die Vereinigung der Walachei,<br />
Moldau und Siebenbürgens erhoffte man sich die Bildung eines starken und einheitlichen<br />
Nationalstaates.<br />
Zu dieser Zeit beginnt – im Interesse der Schaffung eines homogenen rumänischen Nationalstaates<br />
– die Assimilierung der Moldauer Katholiken<br />
„Die Entrechtung der Tschangos war dermaßen augenfällig und allgemein bekannt, dass auf<br />
der provisorischen parlamentarischen Versammlung im Jahre 1857, die der Vereinigung der<br />
rumänischen Fürstentümer vorausging, kein Geringerer als [der liberale rumänische Politiker]<br />
Mihail Kogălniceanu für die Moldauer Ungarn Wort einlegte. Er unterbreitete 52 Vorschläge<br />
zur „Anerkennung der Rechte der nichtorthodoxen christlichen Bürger“. In seiner Rede ging<br />
er mehrmals auf die Tschangos ein, und kam im Besonderen auf den Fall des [Moldauer<br />
Ungarn] János Rab aus Szabófalva zu sprechen, der einstimmig zum Abgeordneten gewählt<br />
worden war. Diese Wahl wurde jedoch unter Berufung auf dessen katholischer Konfession<br />
offiziell nicht anerkannt. „Lasst uns allen Söhnen Rumäniens gegenüber gerecht sein, da wir<br />
vor allen Dingen Andere wertschätzen müssen, um unsere Freiheit verdienen zu können” –<br />
betonte Kogălniceanu“ (Domokos 2001: 120).<br />
Durch die Vereinigung der beiden Fürstentümer Moldau und Walachei entsteht 1865<br />
Rumänien.<br />
Da eine detaillierte Analyse der politischen Interessen der damaligen europäischen<br />
Großmächte, die ohne Zweifel den Weg zur Geburt des heutigen, modernen Rumänien<br />
10
ebneten, nicht direkt zu unserem Thema gehört, begnügen wir uns damit, die damit<br />
zusammenhängenden wichtigeren Ereignisse in groben Zügen zu skizzieren.<br />
Der erste Schritt auf diesem Weg war die Gründung des auf der Pariser Konferenz am 19.<br />
<strong>August</strong> 1858 durch einen Kompromiss zustande gekommenen (wegen des Widerstands<br />
vonseiten Englands, Österreichs und der Türkei), unter türkischer Oberhoheit stehenden<br />
„Vereinigten Fürstentums der Moldau und Walachei“, das zwar getrennte Machtapparate<br />
aufwies, aber gleichzeitig schon über gemeinsame Ausschüsse, Gesetze, Gerichte sowie eine<br />
gemeinsame Armee verfügte.<br />
Der liberal eingestellte Befehlshaber der Armee, Alexandru Ion Cuza, der bojarischer<br />
Herkunft war, wurde am 5. Januar 1859 zum Fürsten der Moldau gewählt. Nicht viel später,<br />
am 24. Januar erfolgte in Bukarest die Wahl derselben Person zum Fürsten der Walachei. Mit<br />
diesem Schritt wurde die Vereinigung der beiden Fürstentümer in einer Personalunion<br />
erreicht.<br />
Die solchermaßen vor vollendete Tatsachen gestellten Großmächte erkannten 1861 –<br />
ungeachtet der Proteste vonseiten der Pforte – die in beiden Fürstentümern auf Lebenszeit<br />
geltende Herrschaft Cuzas an. Am Anfang des Jahres 1862 vereinigen sich die beiden<br />
Parlamente und eine gemeinsame Regierung wird gebildet.<br />
Den Angaben der ersten rumänischen Volkszählung aus dem Jahre 1859 gemäß lebten in der<br />
Moldau insgesamt 1.325.406 Seelen; unter ihnen 37.834 Ungarn bzw. 53.540 Katholiken<br />
(siehe Pál Péter Domokos – Miklós Beresztóczy 1964, in Vincze 2004: 274).<br />
Die Vereinigung der beiden Fürstentümer hob die türkische Oberhoheit nicht auf.<br />
Der Fürst A.I. Cuza wurde gestürzt. Mit seiner Entthronung endete praktisch der<br />
Vereinigungsprozess der rumänischen Fürstentümer.<br />
Das oberste Bestreben der politischen Elite war die Erlangung der vollkommenen<br />
Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich; sie glaubte, diese durch die Wahl eines Fürsten von<br />
fremder Herkunft erreichen zu können. Die Wahl fiel auf Karl aus dem Hause Hohenzollern-<br />
Sigmaringen, der unter dem Namen Carol I. 1866 zum Fürsten gewählt wurde.<br />
Unter der 48jährigen Herrschaft Carols I. (1866-1914) gelang es, aus den erst kürzlich<br />
vereinigten, in internationalen Kreisen für türkische Provinzen gehaltenen einstigen<br />
Fürstentümern einen einheitlichen, in politischer und militärischer Hinsicht – auch trotz seiner<br />
zahlreichen Mängel – bedeutenden, international anerkannten Staat zu schmieden (siehe Edda<br />
Binder-Ijima 2003: 13).<br />
Die erste demokratische Verfassung der vereinigten Fürstentümer, die die Prinzipien des<br />
1830er belgischen Grundgesetzes als maßgeblich betrachtete, wurde am 30. Juni 1866<br />
11
ekannt gegeben. Die Ereignisse beginnen sich fortan zu überschlagen: 1877 erlangen die<br />
vereinigten Fürstentümer ihre vollständige Unabhängigkeit, 1881 entsteht das Königreich<br />
Rumänien.<br />
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, d.h. dem Zeitpunkt, seitdem überhaupt Schulen in den<br />
Moldauer Dörfern existieren, wird den Moldauer Ungarn jeglicher muttersprachlicher<br />
Unterricht verwehrt. Auch die rumänischsprachige Ausbildung erfolgte – als sie landesweit<br />
obligatorisch wurde – auf niedrigstem Niveau. Die Moldauer Ungarn wurden so an der<br />
Grenze zum Analphabetismus gehalten und verfügten zudem über keine – von einzelnen<br />
Ausnahmen abgesehen – in ihrer Muttersprache predigenden Priester. Da in der Moldau kein<br />
ungarischsprachiger Klerus vorhanden war „konnte in der Moldauer römisch-katholischen<br />
Kirche die ungarische Sprache neben dem Lateinischen nicht allgemein gebräuchlich werden“<br />
(Vincze 2004: 19).<br />
Die oben genannten Faktoren führten zu der Situation, dass die Moldauer Tschangos heute –<br />
zu Beginn des 3. Jahrtausends – was ihre traditionelle Kultur betrifft, in der Mündlichkeit<br />
verblieben sind und in ihrer Muttersprache weder lesen noch schreiben können.<br />
Der Ausbau der staatlichen Administration sowie des Systems der Bevölkerungsregistratur ist<br />
in der Moldau auf das 19. Jahrhundert anzusetzen. Zu dieser Zeit begann auch die<br />
Rumänisierung der Namen der Moldauer Ungarn; in den ausschließlich in rumänischer<br />
Sprache geführten Registern finden sich – als Mittel der Rumänisierung – orthographische<br />
Transkriptionen, sog. Namenübersetzungen (bzw. einzelsprachlich tradierte parallele, dort<br />
jeweils codierte, als Namen bekannte Namenvarianten) oder Namenformen, die weder in<br />
lautlicher noch in semantischer Hinsicht einen Bezug zum ursprünglichen Eigennamen<br />
aufweisen (siehe Vincze 2004: 28).<br />
Die Moldauer Ungarn verwendeten zwar offiziell ihre neuen Namen; innerhalb ihrer Gemeinschaft<br />
aber gebrauchten sie – dem Gewohnheitsrecht entsprechend – auch weiterhin ihre überlieferten<br />
Familiennamen.<br />
1914 bricht der 1. Weltkrieg aus. 1916 verbündet sich Rumänien mit der Entente<br />
(Großbritannien, Frankreich, Russland). Als einer der Siegerstaaten des 1. Weltkrieges<br />
erhält Rumänien – nach der Unterschreibung des Pariser Minderheitenvertrages, in dem den<br />
in Rumänien lebenden Minderheiten eine sehr breite Palette von Rechten betreffend der<br />
Glaubensfreiheit, des Bildungs- und Wirtschaftswesens sowie eine aktive Teilnahme am<br />
politischen Leben des Landes zugesichert wurde – auf der Grundlage des Trianoner<br />
12
Friedensvertrages vom 4. Juni 1920 Siebenbürgen, das Partium, den östlichen Teil des Banats<br />
und die Marmarosch.<br />
Vincze (2004: 28) stellt fest, dass der Trianoner Friedensvertrag für das Moldauer Ungartum<br />
auch mit gewissen Vorteilen verbunden war; da die früheren Grenzen verschwanden,<br />
benötigten die Tschangos keinen Reisepass mehr, um die Märkte des Széklerlandes besuchen<br />
zu können; sie konnten an der Pfingstwallfahrt in Csíksomlyó (rum. Şumuleu-Ciuc)<br />
teilnehmen und engere Kontakte zu den Ungarn Siebenbürgens knüpfen. Auch die<br />
ungarischen Mönche und katholischen Seelsorger konnten nun eher die Moldau besuchen.<br />
Das aus der Vereinigung der beiden Fürstentümer Moldau und Walachei entstandene<br />
Rumänien, das sein Territorium später – nach dem 1. Weltkrieg – durch den Anschluss<br />
Siebenbürgens, der Dobrudscha und des Banats vergrößern konnte, begann – in schnellem<br />
Tempo – mit dem Ausbau des institutionellen Systems des Nationalstaates. In dieser „Periode<br />
des nationalen Aufbaues verhielt sich der „junge” Nationalstaat deshalb dermaßen ungeduldig<br />
gegenüber den Gruppen mit anderer Sprache und Konfession, weil die Bukarester Politiker im<br />
Grunde genommen ein ethnisch und kulturell homogenes Land erschaffen wollten” (Pozsony<br />
2005: 45; siehe auch Livezeanu 1998: 17-20 und Diaconescu 2005: 11-13).<br />
Der für den Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen charakteristische – viele Staaten<br />
Europas überschattende – Faschismus hat die rumänische Minderheitenpolitik gründlich<br />
bestimmt. 1942 nahm – zur Zeit der Diktatur Antonescus – diejenige Ideologie ihren Anfang,<br />
deren Vertreter die rumänische Herkunft der Tschangos beweisen wollen (siehe Diaconescu<br />
2005: 10, Vincze 2004: 53 und Arens/Bein 2003: 234-236).<br />
Am 22. Juni 1941 tritt Rumänien auf deutscher Seite in den Zweiten Weltkrieg ein.<br />
Am 23. <strong>August</strong> 1944 erfolgt der Seitenwechsel Rumäniens zu den Alliierten und kann somit<br />
den Zweiten Weltkrieg als Siegerstaat beenden.<br />
„Nach dem Zweiten Weltkrieg schien für die Moldau-Ungarn eine positive Wende für die<br />
Pflege ihrer Sprache und die Entfaltung ihrer nationalen Kultur einzusetzen. Die Regierung<br />
des (...) Ministerpräsidenten Petru Groza (...) ließ für die Csango-Dörfer im Rahmen einer<br />
allgemeinen Schulreform den muttersprachlichen Unterricht zu und veranlaßte die<br />
Verschickung siebenbürgisch-ungarischer Lehrer in zahlreiche Schulen. 1948 unterrichteten<br />
an 18 Schulen bereits 28 Lehrkräfte, bis 1950 kamen weitere 14 hinzu. In Lujzi Kalagor<br />
wurde ein Internat eingerichtet und 1952 an der Pädagogischen Hochschule in Bacau für die<br />
13
Ausbildung einheimischer Lehrer eine ungarische Abteilung eröffnet. Damit waren alle<br />
Voraussetzungen für das Weiterleben, ja Gedeihen der eigenständigen ungarischen Csango-<br />
Kultur in der Moldau geschaffen. Vermutlich waren diese Maßnahmen aber „zu erfolgreich”<br />
für die sich zunehmend verstärkende nationalkommunistisch-chauvinistische Gesinnung in<br />
führenden Kreisen des Landes, an deren Spitze der Parteiführer Nicolae Ceauşescu stand.<br />
Hinzu kam 1956 der ungarische Volksaufstand, der auch die Ungarn in Rumänien bewegte<br />
und in der Partei das Mißtrauen gegen alles Ungarische erhöhte. Das Zusammenwirken dieser<br />
Faktoren wurde für die ungarische Csango-Kultur ein Verhängnis: alle oben geschilderten<br />
proungarischen Maßnahmen wurden nach und nach abgeschafft. Nach 1960 gab es keinen<br />
Ungarischunterricht mehr in der Moldau (Csoma:28)“(Futaky 2002: 24).<br />
Die 1962 erfolgende Kollektivisierung des Grund und Bodens zerstörte jahrhundertealte, gut<br />
funktionierende Strukturen; die Bauern gerieten in Existenznot.<br />
Nach dem Abschluss der Kollektivisierung gaben die Tschango-Männer die<br />
landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf und suchten massenweise Arbeit in den Fabriken der<br />
näher bzw. auch weiter entfernt liegenden Städte. Zuhause blieben nur die Frauen und Alten.<br />
Die Assimilationsprozesse beschleunigten sich. Sobald der Tschango-Landwirt nämlich seine<br />
relativ geschlossene bzw. geschützte Umgebung verließ und zum Fabrikarbeiter wurde,<br />
dauerte es in dieser rumänischen Stadtumgebung nicht lange, bis nach dem Sprach- auch der<br />
Identitätswechsel eintrat.<br />
Es waren die zu Hause gebliebenen Frauen, die – die längste Zeit hindurch – die<br />
Muttersprache und die noch vorhandene archaische Volkskultur bewahrt und weitergegeben<br />
haben (siehe Vincze 2004: 52).<br />
Am 22. Dezember 1989 wird in Rumänien die Ceauşescu-Diktatur gestürzt.<br />
Das Mehrparteiensystem wird eingeführt; der Prozess der Demokratisierung beginnt.<br />
Am 25. Dezember wird der Demokratische Verband der Ungarn in Rumänien (Uniunea<br />
Democrată Maghiară din România/UDMR; A Romániai Magyar Demokrata Szövetség<br />
(RMDSZ) gegründet.<br />
Nach dem 1989er Wandel begannen die Tschangos ungarischer Identität immer<br />
ausdrücklicher den ungarischsprachigen Gottesdienst zu beanspruchen.<br />
Nach 1989 gab es von vielen Seiten Versuche zur Einführung des muttersprachlichen Unterrichtes.<br />
Entsprechend der Möglichkeiten und Ansprüche wurden muttersprachliche Vorbereitungslager<br />
organisiert bzw. Tschango-Kinder nach Siebenbürgen und Ungarn geschickt, wo<br />
14
sie an der ungarischsprachigen Lehre von der Grundschule bis zum Gymnasium, einige sogar<br />
bis zur <strong>Universität</strong> teilhaben konnten.<br />
Immer mehr Moldauer Ungarn forderten den im schulischen Rahmen organisierten<br />
muttersprachlichen Unterricht. Bei der Planung des muttersprachlichen Unterrichts der<br />
Tschango-Ungarn trat der Gedanke eines alternativen Unterricht außerhalb der Schule in den<br />
Vordergrund, wie z.B. der Sprachunterricht während der Ferien, in dessen Verlauf sich die<br />
Kinder in spielerischer Form (Gedichte, Lieder usw.) bestimmte muttersprachliche Kenntnisse<br />
aneignen können.<br />
Absatz 32.2. der 1991er – auch heute noch gültigen – Verfassung Rumäniens besagt, dass der<br />
Unterricht auf allen Stufen in rumänischer Sprache abgehalten wird.<br />
Die Modalitäten des muttersprachlichen Unterrichts für die Minderheiten wurden im<br />
Unterrichtsgesetz bestimmt. In Kenntnis dieser könnten die Bildungspolitiker der<br />
Minderheiten die zur Realisierung des muttersprachlichen Unterrichtes notwendigen,<br />
objektiven Bedingungen erschaffen.<br />
Im 1996 abgeschlossenen Grundlagenverlag zwischen der Republik Ungarn und Rumänien<br />
betonen beide Parteien gesondert das Recht des Einzelnen auf den Unterricht in seiner<br />
Muttersprache.<br />
Rumänien unterschrieb und ratifizierte desweiteren internationale Verträge bezüglich der auf<br />
seinem Territorium lebenden Minderheiten (UN-Deklaration 47/ 1354 über die Rechte der<br />
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten<br />
angehören; die Koppenhagener Konferenz des Europäischen Menschenrechtskomitees vom<br />
29. Juni 1990; Rahmenkonvention des Europarates über den Schutz der Nationalen<br />
Minderheiten), die alle das Recht der Minderheiten auf muttersprachlichen Unterricht<br />
hervorheben, wovon auch die Tschangos nicht ausgeschlossen werden dürfen (siehe<br />
Mesterházy 2003: 150-151).<br />
In Rumänien ist also ein rechtlicher Rahmen vorhanden, auf dessen Grundlage auch die<br />
Tschangos den muttersprachlichen Unterricht verwirklichen könnten.<br />
In dem Maße, wie sich die unterschiedlichen nationalen Minderheiten Rumäniens nach der<br />
1989-er Revolution zu organisieren begannen, begannen sich auch in der Moldau die<br />
wichtigsten Interessenvertretungen der Tschango-Ungarn zu formieren, die sich für den<br />
ungarischsprachigen Schulunterricht, die Einführung der ungarischsprachigen kirchlichen<br />
Liturgie sowie die Entfaltung und Ausübung des mit den muttersprachlichen Volksbräuchen<br />
verbundenen kulturellen Lebens einsetzten.<br />
15
In Ermangelung einer eigenen Intelligenz in der Moldau waren es vor allem die in<br />
Siebenbürgen lebenden Moldauer Ungarn, die eindringlich für den Schutz der Kultur und<br />
Sprache der Tschangos eintraten und die europäische Bedeutung bzw. die damit verbundene<br />
Notwendigkeit einer langfristigen Erhaltung dieser Kultur hervorhoben.<br />
Zur Verwirklichung der beiden wichtigsten Zielsetzungen – der Stärkung der Identität der<br />
Tschango-Jugendlichen und der Weitergabe der muttersprachlichen Kultur – organisisierte<br />
man zahlreiche Sprachlager, Seminare und Fachausflüge.<br />
Am 20. Oktober 1990 wurde im siebenbürgischen Sepsiszentgyörgy [rum. Sfântu Gheorghe]<br />
der Verband der Moldauer Tschango-Ungarn (Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége)<br />
gegründet, der 1995 dem Demokratischen Verband der Ungarn in Rumänien (A Romániai<br />
Magyar Demokrata Szövetség/RMDSZ), beitrat. Der Verband der Moldauer Tschango-<br />
Ungarn ist auch der Herausgeber der zweisprachigen (rumänisch-ungarischen) Zeitschrift<br />
’Moldauer Ungartum’ (Moldvai Magyarság).<br />
In letzter Zeit begannen diejenigen Tschangos in ihre Moldauer Dörfer zurückzukehren, die in<br />
den Jahren nach der 1989er Wende an Hochschulen und <strong>Universität</strong>en in Siebenbürgen und<br />
Ungarn studiert haben. Sie organisieren Programme (Festivals, Ferienlager), in deren Rahmen<br />
rumänische, ungarische und ausländische Jugendliche mit den archaischen Werten der<br />
Folklore der Tschangos bekannt gemacht werden.<br />
Seit November des Jahres 2003 beginnt der Ausbau einer Interessenvertretung politischer Art.<br />
Die Interessenvertretung der Ungarn Rumäniens, die RMDSZ verfügte schon von den<br />
Anfängen an über Mitglieder in 42 Moldauer Siedlungen; sie begann nun, in der Moldau<br />
unabhängige örtliche Organisationen zu gründen. Während der Kommunalwahlen 2004<br />
forderte die 24. Ortsorganisation der RMDSZ (Komitat Bákó/rum. Bacău), dass die Moldauer<br />
Tschango-Ungarn ihrem Anteil entsprechend in der rumänischen Verwaltung mitwirken<br />
sollen (siehe Pozsony 2005: 192-194).<br />
„Die ungarische Kultur in der Moldau, vor allem das Weiterleben der archaischen Csango-<br />
Mundart, hat trotz aller Behinderungen Zukunftschancen” (Futaky 2002: 26).<br />
Die Moldauer Ungarn stehen am Scheideweg. Sie haben die Möglichkeit, ihr Schicksal in ihre<br />
eigenen Hände zu nehmen – ihrem eigenen Willen gemäß, mit dem gehörigen<br />
Selbstbewusstsein, ohne jeglichen Einfluss, ohne jegliche Manipulation von Außen.<br />
Die inzwischen langsam herangewachsene, aus ihren eigenen Reihen stammende Intelligenz<br />
leistet ihnen dabei Hilfe. Die Tschangos sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie sich zur<br />
rumänischen oder ungarischen Nationalität bekennen oder sich gar im Ausland nicht nur<br />
16
vorübergehend Arbeit suchen, sondern sich dort niederlassen und assimilieren. Eine weitere<br />
Version wäre, in ihrem Geburtsland zu bleiben, wo sie ihre Identität und archaische Kultur<br />
bewahren und neben der rumänischen Sprache auch die ungarische Sprache frei gebrauchen<br />
können: in der Öffentlichkeit, der Kirche und der Schule – was das Selbstverständlichste auf<br />
der Welt wäre.<br />
Auch Europa kann nicht tatenlos zusehen, ist es doch – durch den Beitritt Rumäniens in die<br />
EU (1.1.2007) – durch eine äußerst vielfältige, kulturelle Region reicher geworden.<br />
Mit gezielten Programmen, die – statt der den sofortigen Profit bevorzugenden Investitionen –<br />
die natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt, könnten<br />
Arbeitsplätze für die Bewohner dieser Region – einschließlich der Moldauer Tschangos –<br />
geschaffen werden.<br />
Letztendlich muss auch Rumänien einsehen, dass es erst dann ein wahrhaftiger, in jeglicher<br />
Hinsicht moderner europäischer Staat sein wird, wenn es sich die Worte des Präsidenten der<br />
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Lord Russel-Johnston zu Herzen nimmt,<br />
der der Ansicht zustimmt, dass „sich der Entwicklungsstand eines Landes im Umgang mit<br />
seinen Minderheiten messen lässt” und seine Hoffnung ausdrückt, dass die betreffenden<br />
Länder die auf ihren Territorien lebenden Minderheiten in Ehren halten und schützen werden<br />
(siehe Klára Papp Farkas 2002: 5-6).<br />
17
III. Grundlegende Charakteristika des Moldauer Tschango-Dialektes<br />
Die Funktion des obigen Kapitels über die grundlegenden Charakteristika des Moldauer<br />
Tschango-Dialektes besteht darin, als Hilfskapitel die wichtigsten phonetischen,<br />
morphologischen und lexikalischen Besonderheiten des Moldauer Tschango-Dialektes zu<br />
skizzieren, die uns auch im Dokumentarroman Gazdas öfters begegnen. Ein besonderer<br />
Schwerpunkt dieses Kapitels besteht weiterhin in der Hervorhebung der Archaismen, was<br />
anhand von authentischen, tschango-ungarischen Äußerungen aus dem obigen<br />
Dokumentarroman und durch das Heranziehen von altungarischen Sprachdenkmälern erreicht<br />
werden soll. Gegebenenfalls werden auch Beispiele aus dem Wörterbuch von Yrjö Wichmann<br />
herangezogen. Damit soll dieses Kapitel III nur zur Ergänzung der beiden Hauptteile meiner<br />
Arbeit dienen, in denen folgende Sprachkorpora untersucht werden: das Nordtschango-<br />
Wörterbuch von Yrjö Wichmann (1936), der Sprachatlas der Moldauer Tschango Mundart<br />
(Szabó T. Attila – Gálffy Mózes – Márton Gyula (1991) bzw. der Dokumentarroman von<br />
József Gazda „Hát én hogyne síratnám” (1993).<br />
Die nachstehende Darstellung der herausragenden Merkmale des Sprachsystems des<br />
Moldauer Tschango-Dialektes verfolgt somit folgende Ziele:<br />
1.) Im „Dschungel” der akribisch genauen dialektologischen Beschreibungen, die auf jede<br />
einzelne phonetische, morphologische und lexikalische Besonderheit des Moldauer Tschango-<br />
Dialektes gesondert eingehen, besteht die Gefahr, dass eines der wichtigsten Charakteristika<br />
dieser Dialektregion verloren geht: der Archaismus. Der Dokumentarroman von József<br />
Gazda belegt, dass diese Besonderheit auch heute noch – in der freien und ungebundenen<br />
Rede der Moldauer Ungarn – äußerst lebendig ist. Anhand der authentischen, tschangoungarischen<br />
Äußerungen aus dem oben erwähnten Dokumentarroman sollen nun die<br />
Archaismen eindeutiger hervorgehoben und „zum Leben erweckt” werden.<br />
Die Hervorhebung der Archaismen soll durch ein weiteres Verfahren erreicht werden, dem<br />
Heranziehen von altungarischen Sprachdenkmälern.<br />
Innerhalb der Tschango-Forschungsliteratur hat bisher v.a. Mária D. Mátai die altungarischen<br />
Sprachdenkmäler in ihren sprachwissenschaftlichen Analysen mitberücksichtigt:<br />
Uns ist bekannt, dass die Tschangos das ungarische Alphabet nicht kennen; demzufolge<br />
verwenden sie für ihre ungarischsprachigen Aufzeichnungen, die meistens Gebete sind,<br />
rumänische Buchstaben. In ihrer Untersuchung über die Lautbezeichnung in Tschango-Texten<br />
geht nun Mária D. Mátai (1992: 56-72) der Frage nach, wie das rumänische<br />
Schriftzeichensystem an das Lautsystem des einer anderen Sprachfamilie angehörenden<br />
18
Tschango-Ungarischen angeglichen wird. So werden zum Beispiel die im rumänischen<br />
Lautsystem fehlenden Laute mit den Buchstaben der ihnen nahestehenden Laute bezeichnet.<br />
Mátai hebt hervor, dass auch die Verfasser der altungarischen Sprachdenkmäler dieselbe<br />
Problemlösungsstrategie angewandt haben; einziger Unterschied war nur, dass diese das<br />
lateinische Alphabet zur Wiedergabe der ungarischen Laute benutzen mussten.<br />
2.) Die Lektüre des Gazda-Dokumentarromans ist selbst für diejenigen mit Schwierigkeiten<br />
verbunden, die des Ungarischen mächtig sind.<br />
Nachstehende Darstellung des Moldauer Tschango-Dialektes soll sich auf die phonetischen,<br />
morphologischen und lexikalischen Besonderheiten stützen, die uns im Dokumentarroman<br />
Gazdas öfters begegnen. Anhand des Vergleichs dieser Charakteristika mit den Äquivalenten<br />
der ungarischen Standardsprache soll eine Art „Gebrauchsanweisung” für all diejenigen zur<br />
Verfügung gestellt werden, die Zugang zu diesem Dokumentarroman gewinnen wollen.<br />
Die folgende Darstellung der herausragenden Merkmale des Sprachsystems des Moldauer<br />
Tschango-Dialektes stützt sich auf die Zusammenfassungen von Mózes Gálffy (1964), Benkı<br />
Loránd (1989), Péter Domokos (2000), Krisztina Piro (2001), Dezsı Juhász (2003) sowie<br />
Ferenc Pozsony (2005). Diese Dialektregion der ungarischen Sprache gliedert sich in drei<br />
Gruppen: in die der nördlichen (nördlich der Stadt Roman/Románvásár) und südlichen<br />
Tschangos (südlich von Bacău/Bákó) – beide mittelalterlichen Ursprungs – sowie der Székler<br />
Tschangos (entlang der Flüsse Trotuş/ Tatros, Tazlău/Tázló und teilweise der Siret/Szeret),<br />
deren Einwanderung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte.<br />
Die nördlichen und südlichen Tschangos stammen aus der siebenbürgischen Region Mezıség;<br />
die Herkunftsregion der Székler Tschangos ist – wie ihr Name schon besagt – das<br />
Széklerland. Die ungarische Dialektologie grenzt den Székler Tschango-Dialekt zwar von den<br />
beiden anderen ab, behandelt aber den nördlichen und südlichen Tschango-Dialekt als eine<br />
Einheit, da – obwohl der südliche Tschango-Dialekt zwar etwas von dem der Székler<br />
Tschangos beeinflusst ist – die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Dialekten dennoch<br />
überwiegen.<br />
Bevor wir nun die wichtigsten phonetischen, morphologischen und lexikalischen Merkmale<br />
der Moldauer Tschango-Dialektregion skizzieren, soll der deutschsprachige Leser kurz mit<br />
der Lautbezeichnung des Ungarischen bekannt gemacht werden: „Die ungarische<br />
Rechtschreibung bezeichnet die Vokallänge mit [Akut], die der Konsonanten mittels<br />
Buchstabendopplung (...). Das ungarische a wird labial gesprochen (...), sein langes Pendant<br />
(á) dagegen illabial (...). Die Palatalisation der Konsonanten bezeichnet im Ungarischen das y<br />
19
(gy = ď, ty = ť, ny = ń), ly dagegen wird als j gesprochen. [Ungarisch cs wird wie dt.tsch in<br />
„Matsch“ gesprochen, ung.v entspricht dt. w] Der mit sz bezeichnete ungarische Konsonant ist<br />
identisch mit dem deutschen s-Laut, und sein stimmhaftes Pendant ist zs ( = ž); ung. s dagegen<br />
entspricht dt. sch ( = š), und sein stimmhaftes Pendant ist z (vgl. dt. lesen)“ (Hajdú/Domokos<br />
1987: 19).<br />
1. Die wichtigsten phonetischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion<br />
Der Vokalbestand dieser Dialektregion wird – im Vergleich zur ungarischen Standardsprache<br />
– erweitert durch die unterschiedlichen Realisierungen der Phoneme /e/ und /é/ und einer<br />
Vielzahl von Diphtongen. Im nördlichen Tschango-Dialekt finden sich – aufgrund<br />
rumänischen Einflusses - zusätzlich zwei neue Phoneme: die beiden velaren Laute î und ă<br />
erscheinen naturgemäß innerhalb rumänischer Lehnwörter, doch beginnt der Laut ă auch in<br />
den einheimischen Wortbestand einzudringen.<br />
Ein gemeinsames Kennzeichen des nördlichen und südlichen Tschango-Dialektes ist die<br />
offene a- und geschlossene í-Lautung, die auch für den Dialekttyp der Siebenbürger Heide<br />
(Mezıség) charakteristisch ist.<br />
Innerhalb der Assimilationserscheinungen ist besonders erwähnenswert, dass der bestimmte<br />
Artikel im nördlichen und südlichen Tschango-Dialekt sowohl über eine velare (a/az) als auch<br />
über eine palatale Variante (e/ez) verfügt (Wichmann-Beispiele für die palatale Variante: e<br />
viz, e kinyer, ez erdı, ez iszten usw.).<br />
„(...) Diese Art des Artikelgebrauches war im Zeitalter der Kodizes [Blütezeit: zweite Hälfte<br />
des 15. und erstes Viertel des 16. Jahrhunderts] noch allgemein gebräuchlich; die palatale<br />
Variante verschwand aber später bzw. wurde von der – auch früher schon dominierenden –<br />
velaren Variante vollständig verdrängt”(Benkı 1989: 402).<br />
Zahlreiche Konsonanten werden palatalisiert ausgesprochen.<br />
Statt standardsprachlichem s wird im nördlichen und südlichen Tschango-Dialekt sz<br />
gesprochen wie zum Beispiel moszt anstatt most ’jetzt’, szok anstatt sok ’viel’.<br />
Dieses Phänomen gilt als eine der wichtigsten phonetischen Besonderheiten dieser beiden<br />
Dialektgruppen und ist ein Relikt aus altungarischer Zeit (896-1526).<br />
Den Sprachhistorikern gemäß gab es in der altungarischen Zeit einen s- und den herrschenden<br />
sz-Dialekt, „aus deren beider Vermischung (wobei im allgemeinen der sz-Dialekt siegte) bis<br />
heute solche Formpaare erhalten bleiben wie szıni „weben” ~ sövény „Hecke”, szem „Auge”<br />
~ sömör „Flechte (am Auge)”, szenved „leiden” ~ senyved „sieden”, szır „(Körper)haar” ~<br />
20
sörény „Mähne”, ország „Land” ~ uraság „Herrschaft”, dialektal szıldisznó ~ sündisznó<br />
„Igel”, usw.” (Bárczi 2001: 222). Als sich die Vorfahren der nördlichen und südlichen<br />
Tschangos im Mittelalter in der Moldau niederließen, brachten sie den obigen sz-Dialekt mit<br />
sich.<br />
Eine weitere wichtige phonetische Besonderheit im nördlichen und südlichen Tschango-<br />
Dialekt ist das Vorhandensein des Phonems /dzs/: dzsermek anstatt gyermek ’Kind’.<br />
Dieser in urungarischer Zeit weit verbreitete Laut wurde gegen Ende der altungarischen Zeit<br />
zu gy.<br />
Der nördliche und südliche Tschango-Dialekt haben weiterhin archaische Laute wie das<br />
Phonem /ly/ (in der Rechtschreibung bezeichnet; heutige Aussprache: j), die bilabiale<br />
Variante ß des Phonems /v/ sowie den stimmlosen bilabialen Tremulanten ψ (Aussprache<br />
ähnlich wie: pr, br) bewahrt.<br />
Eine weitere Besonderheit der Moldauer Tschango-Dialektregion sind die sog. „erweiterten<br />
Formen”, die Ergebnis einer Sonderentwicklung sind. Ein häufiges Verfahren zur Formerweiterung<br />
findet sich in folgenden Beispielen, in denen das Element -z des bestimmten<br />
Artikels (az ~ ez) mit den Wörtern mit vokalischem Anlaut zu einer (Aussprache)einheit<br />
verschmilzt: zelszü ’der erste’, ziszten ’der Gott’, zember ’der Mensch’.<br />
2. Die wichtigsten morphologischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion<br />
Ein Charakteristikum der Moldauer Tschango-Dialektregion ist die hohe Gebrauchsfrequenz<br />
von Diminutivsuffixen. Die statistische Untersuchung des Wörterbuches von Yrjö Wichmann<br />
ergab übrigens, dass sich in diesem ganze 71 Diminutivbildungen als eigenständige<br />
Wortartikel finden. Nur 3 dieser 71 Diminutiva sind heute nicht mehr bekannt.<br />
Die folgenden Beispiele stammen aus dem Gazda-Korpus; die Diminutivsuffixe sind unterstrichen.<br />
Die Tschangos versehen nicht nur Personen, sondern auch Tiere und Objekte mit Diminutivsuffixen:<br />
tyuk ’Huhn’: tyukecska, juh ’Schaf’: juhecska, kancsó ’Krug’: kancsócska, tál<br />
’Schüssel’: tálacska, bor ’Wein’: borecska, pálinka ’Schnaps’: pálinkecska, kenyér ’Brot’:<br />
kenyérke, tyukmony ’(Hühner)Ei’: tyukmonyka, víz ’Wasser’: vizecske, élet ’Leben’: életke,<br />
nap ’Sonne’: napeszka, imádszág ’Gebet’: imádszágocska.<br />
21
Neben Substantiven werden auch Adjektive, Adverbien und Pronomen mit Diminutivsuffixen<br />
versehen: nagy ’groß’: nagyocska, meleg ’warm’ : melegeszke, készı ’spät’: készıcske, messze<br />
’entfernt, weit(ab)’: messzecske, több ’mehr’: többecske, gyakran ’häufig’: gyakracskán,<br />
mennyi ’wie viel’ mennyicske.<br />
Im Moldauer Tschango-Dialekt verfügt das Suffix -ka, -ke nicht nur über eine verkleinernde<br />
bzw. zärtliche Bedeutungskomponente, sondern dient auch zur Bildung von Feminina:<br />
Ott a szomszédságba (...) vót egy fehérnép, magyar, tiszta magyarka. (S; KA, geb. 1912)<br />
[„Dort, in der Nachbarschaft (...) gab es eine Frau, eine ungarische, eine richtige Ungarin.”]<br />
In diesem Fall liegt übrigens eine funktionelle Übereinstimmung zwischen dem (tschango)ungarischen Suffix -<br />
ka und dem (lautlich ähnlichen) rumänischen Suffix -că, das zur Bildung von Feminina dient, vor.<br />
Als weitere Besonderheit der Moldauer Tschango-Dialektregion ist erwähnenswert, dass die<br />
Lautform des Instrumental-Komitativ Suffixes -val/-vel erhalten bleibt: dass Element -v-<br />
assimiliert sich nicht an den konsonantischen Auslaut eines Nomens.<br />
Beispiele aus dem Gazda-Korpus: regvel anstatt reggel ’am Morgen’, katonákval anstatt<br />
katonákkal ’mit Soldaten’, katonaszágval anstatt katonaszággal ’mit dem Militär’; azval<br />
anstatt azzal ’mit diesem’, azokval anstatt azokkal ’mit diesen’, mellikvel anstatt mellikkel ’mit<br />
welchen’; magunkval anstatt magunkkal ’mit uns’, magadval anstatt magaddal ’mit dir’,<br />
másikval anstatt másikkal ’mit dem anderen’; egyvel anstatt eggyel ’mit einem’.<br />
Auch im ältesten ungarischen Textdenkmal, der um 1200 entstandenen Leichenrede liegt<br />
keine progressive Assimilation des Suffixes -val/-vel vor; vgl. zumtuchel [szümtükχel] (=<br />
szemetekkel):<br />
Originaltext: zumtuchel<br />
wahrscheinliche einstige Lautung: szümtükhel<br />
in heutiger Sprache: szemetekkel<br />
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc.<br />
Látjátuk feleim szümtükhel mic vogymuk.<br />
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk?<br />
in deutscher Übersetzung: „Seht ihr, meine Lieben, mit den Augen, was wir sind?”<br />
(siehe Bárczi 2001: 109)<br />
22
Das Element -v- des Instrumental-Komitativ Suffixes -val/-vel assimiliert sich auch nicht an<br />
den konsonantischen Auslaut von „moderneren” Wörtern – sogar rumänischen Lehnwörtern,<br />
was die Stärke dieses Phänomens im Sprachsystem der Moldauer Ungarn zeigt:<br />
repülıgípekvel ’mit Flugzeugen’, tüzérekvel ’mit Artilleristen’, igazolványokval ’mit<br />
Ausweisen’; rumänische Lehnwörter: mitraliervel ’mit dem Maschinengewehr’, trénvel ’mit<br />
dem Zug’, blendátval ’mit dem Panzer’, aeroplanval ’mit dem Flugzeug’.<br />
Weitere Archaismen sind zum Beispiel die Stammvariante u einiger v-Verbalstämme (zum<br />
Beispiel: riu / riutam, riunk etc.; hiu / hiusz, hiutt, hiunánk etc.), die grundlegende Erhaltung<br />
der ik-Konjugation im nördlichen und südlichen Tschango-Dialekt oder das j-lose<br />
Personalsuffix der 1.Pers. Pl. -uk/-ük innerhalb der objektiven Konjugation (látuk, tuduk,<br />
monduk, váruk) im nördlichen Tschango-Dialekt.<br />
Eine Auffälligkeit der Moldauer Tschango-Dialektregion ist die Frequentativierung der Verbformen,<br />
wobei auch reflexive und passive Verben mit Frequentativsuffixen versehen werden.<br />
Eine weitere Besonderheit des Moldauer Tschango-Dialektes ist der Reichtum an archaischen<br />
Vergangenheitsformen – im Gegensatz zur ungarischen Standardsprache, wo es nur eine<br />
Vergangenheitsform, das einfache Präteritum gibt.<br />
Erzählvergangenheit (Perfectum historicum)<br />
-á / -é<br />
Beispiele aus dem Gazda-Korpus:<br />
Adj egy sepp vizet! – mondá. (N; BKM, geb. 1913)<br />
Úgy kérdezé a zorosz, kérdem vala meg magyarokat, sz mondom vala meg neki oroszul. (N;<br />
MP, geb. 1919)<br />
Auch in der altungarischen Leichenrede findet sich diese Vergangenheitsform:<br />
Originaltext:<br />
Es mend paradisumben volov gimilcictul munda nekí elnie.<br />
Heon tilutoa wt ig fa gimilcetvl.<br />
Ge mundoa nekí meret num eneye.<br />
23
wahrscheinliche einstige Lautung:<br />
Ës mënd paradicsumben volou gyimilcsiktől mundá neki élnié,<br />
Héon tilutoá üüt igy fa gyimilcsetől,<br />
gye mundoá neki méret nüm ënëjk.<br />
in heutiger Sprache:<br />
És azt mondta neki, hogy a Paradicsomban való minden gyümölccsel éljen,<br />
csupán egy fa gyümölcsétıl tiltotta el ıt,<br />
de megmondta neki, mért ne egyék belıle.<br />
in deutscher Übersetzung:<br />
Und er [Gott] hat ihm [Adam] gesagt, er könne von jeder Frucht im Paradies essen,<br />
er hat ihm nur die Frucht eines Baumes verboten,<br />
hat ihm aber erklärt, warum er nicht von ihr essen solle.<br />
(siehe Bárczi 2001: 109)<br />
Auch die zusammengesetzten Vergangenheitstempora lassen sich bis in altungarische<br />
Zeiten zurückverfolgen:<br />
Imperfekt (Präsens imperfectum)<br />
Ø + vala<br />
Beispiele aus dem Gazda-Korpus:<br />
Az ösém még menen vala dologra, me kell vala para. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Küldik vala magyarokat, küldik vala szekujokat, azokat küldik vala ide, sz azok<br />
megharagudtak. (S; DJ, geb. 1911)<br />
Vala két ember ott, kommunisztok, mondja vala mennyi kóta marad itt. (Sz; MGy, geb. 1905)<br />
Münchner Kodex (1466):<br />
Vala ëgy néminemı bíró egy némëly városban, ki istent nëm féli vala ës embërëket nëm átall<br />
vala.<br />
[„Es gab in einer Stadt einen gewissen Richter, der Gott nicht fürchtete und auf die Menschen<br />
keine Rücksicht nahm.”]<br />
(siehe Bárczi 2001: 199)<br />
24
Präteritum Perfekt<br />
-t/-tt + vala<br />
Beispiele aus dem Gazda-Korpus:<br />
Nímet meszina. Hajt vala tüzet, ott nem maradt szemmi, égett vala el. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Boér még adott vala azoknak, melliknek nem vót fıdjük (...). (S; TM, geb. 1925)<br />
Mint hogy megérte, kégyót úgy ütte vala meg. (Sz; DBK, geb. 1928)<br />
Wiener Kodex (1450):<br />
Királnak parancsolatjára, kit a meddıknek parancsolt vala, jöttét mëgutálá.<br />
[„Auf Befehl des Königs, den er den Eunuchen befohlen hatte, verweigerte er sein<br />
Kommen.“]<br />
(siehe Bárczi 2001: 200-201)<br />
Plusquamperfekt<br />
-t/-tt + volt<br />
Beispiele aus dem Gazda-Korpus:<br />
Cuza adott vót helliet akkor, sz a boérok elokupálták. (N; SzP, geb. 1918)<br />
Sz eljöttek a zoroszok, mondta vót primár, ha vajegy orosz veri azablakot, ereszd bé! (N;<br />
KÁX, geb. 1933)<br />
Beléestem vót a kútba. (S; KA, geb. 1912)<br />
Egy sógorasszonyomnak elveszett vót a teje... (Sz; BGyA, geb. 1921)<br />
Döbrentei Kodex (1508): mondotta volt<br />
Als weiterer Archaismus des Moldauer Tschango-Dialektes gilt das häufige Fehlen bzw. die<br />
niedrigere Gebrauchsfrequenz des bestimmten Artikels (a/az bzw. e/ez ).<br />
„Der bestimmte Artikel ist den ältesten Sprachdenkmälern noch unbekannt; er fehlt in der<br />
Leichenrede [HB] und der Altungarischen Marienklage [ÓMS]. Das erste sichere Beispiel<br />
findet sich in den Karlsburger Zeilen vom Beginn des 14. Jahrhunderts. (...)<br />
[Aber auch nach der Verbreitung des Artikels] bestanden bis zum Ende der altungarischen<br />
Periode immer noch große Unterschiede zwischen dem damaligen und dem heutigen<br />
Gebrauch. Beispielsweise wurde vor Personen oder Gegenständen, von denen nur eine(r)<br />
existiert oder die in einem Land oder Landesteil singulär vorkommen, kein bestimmter Artikel<br />
gesetzt” (Bárczi 2001: 184).<br />
25
Beispiele aus dem Gazda-Korpus:<br />
Sz akkor, mikor adott vizet, kihúzta győrőt fejedelem a zujjából, aranygyőrőt, sz béeresztette<br />
kártyba, vizbe.<br />
(S; KA, geb. 1912)<br />
Pápa adott kétszázezer frankot, béfedte a templomot. (Sz; HP. geb. 1901)<br />
3. Die wichtigsten lexikalischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion<br />
Die wichtigsten lexikalischen Merkmale der Moldauer Tschango-Dialektregion sollen anhand<br />
folgender Oppositionspaare, die dem Wörterbuch Yrjö Wichmanns entnommen worden sind,<br />
deutlich gemacht werden:<br />
Das erste Element folgender Heteronymenpaare ist dem Dialekt der Burzenländer Tschangos<br />
(Hétfalu) – der im Großen und Ganzen mit der ungarischen Standardsprache übereinstimmt –<br />
zuzuordnen, das zweite dem Dialekt der Moldauer Tschangos, genauer gesagt dem der nördlichen<br />
Tschangos (Szabófalva):<br />
fáj sziérik ’schmerzen, weh tun’<br />
savanyú szebessz ’sauer’<br />
felesiég nép ’Frau, Gattin’<br />
Folgende Heteroseme aus dem Wörterbuch Wichmanns zeigen, dass die Bedeutungen der<br />
Wörter aus Hétfalu mit denen der ungarischen Standardsprache übereinstimmen:<br />
Hétfalu:<br />
íz<br />
iz ’Geschmack’<br />
remél<br />
remiél ’hoffen’<br />
táplál<br />
táplál ’ernähren, verpflegen’<br />
Szabófalva:<br />
iz ’Geruch’<br />
remiél ’beten (zu Gott)’<br />
taplál ’unterstützen, helfen, jmd. beistehen’<br />
26
Die obige Zusammenfassung der grundlegenden Charakteristika der Moldauer Tschango-<br />
Dialektregion erleichtert den Zugang zu der Aktualisierung des Wörterbuches von Yrjö<br />
Wichmann sowie zum Dokumentarroman von József Gazda, mit denen sich die folgenden<br />
Kapitel beschäftigen werden.<br />
Anhand der kontaktlingustischen Untersuchung der im Gazda-Dokumentarroman<br />
verschriftlichen Äußerungen zweisprachiger Moldauer Tschangos sollen die drei Tschango-<br />
Dialekte betreffs der Stärke des rumänischen Einflusses miteinander verglichen werden,<br />
wobei auch auf die Gründe für die Unterschiede im Stärkegrad des rumänischen Einflusses<br />
eingegangen wird.<br />
27
IV. Aktualisierung des Wörterbuches von Yrjö Wichmann<br />
1. Methodik<br />
Das 1936 erschienene Wörterbuch von Yrjö Wichmann spiegelt den Sprachzustand des nördlichen<br />
Tschango-Dorfes Szabófalva (rum. Săbăoani) von 1907 wider.<br />
100 Jahre nach der 1906/1907 erfolgenden Materialsammlung Wichmanns, führte auch ich<br />
- nun in den Jahren 2005 und 2006 – in Szabófalva Feldforschungsarbeiten durch, um herauszufinden<br />
, was vom damaligen Wortschatz noch erhalten geblieben bzw. bekannt ist, und von<br />
wie vielen dieser archaischste Dialekt des Ungarischen noch gesprochen wird.<br />
In der Person des ortskundigen, pensionierten Geschichtslehrers Mihály Perka fand ich einen<br />
hilfsbereiten, unvoreigenommenen Sprachmeister aus Berufung, ohne dessen Hilfe eine Materialsammlung<br />
vor Ort kaum möglich gewesen wäre.<br />
Bei der Durchführung der Feldforschung hat mich zudem die Ethnologin Margit Perka unterstützt,<br />
die neben der rumänischen Sprache den Nord-Tschangodialekt beherrscht; die<br />
ungarische Standardsprache ist ihr nicht bekannt.<br />
Die Zahl meiner Informanten lässt sich auf ungefähr 15-20 Personen beziffern, die allesamt<br />
aus dem unmittelbaren Verwandten-, Freundes- und Bekanntenkreis meines Sprachmeisters<br />
stammen. Auf mein mehrmaliges Nachfragen hin wurde mir versichert, dass die von mir<br />
durchgeführte Aktualisierung ihres Wortschatzes für sämtliche – ihren Tschangodialekt noch<br />
beherrschenden Szabófalver mehr oder weniger gültig sei; Differenzierungen bzw.<br />
Unterschiede in ihrer Sprachkompetenz – zumindest, was den Wortschatz betrifft – lägen<br />
kaum vor.<br />
In vielen Fällen befragten meine Informanten auch die aus ihrem Bekanntenkreis stammenden<br />
ältesten Sprecher des Szabófalver Tschango-Dialektes.<br />
Der Wortschatz der – ihres Tschango-Dialektes noch kundigen – Sprachgemeinschaft ist<br />
somit im Großen und Ganzen einheitlich.<br />
Unterschiede zwischen den Sprechern des Tschango-Dialektes liegen aber in einem anderen<br />
Bereich vor: der Großteil der Moldauer Tschangos ist – was seine traditionelle Kultur betrifft<br />
– in der Mündlichkeit verblieben und kann in seiner Muttersprache weder lesen noch<br />
schreiben.<br />
Infolge dieser Mündlichkeit bestehen nun aber zwischen den einzelnen Tschango-Familien<br />
– nach Aussage meines Sprachmeisters, Mihály Perka – geringfügige<br />
Ausspracheunterschiede.<br />
28
Nur noch ein Drittel (3000-3500) der ca. 10.000 Bewohner des Dorfes Szabófalva – der<br />
letzten Bastion der ältesten Tschango-Gruppe, die der Nord-Tschangos – sprechen bzw.<br />
verstehen gerade noch ihre Muttersprache.<br />
Den Angaben der 1992er Volkszählung gemäß leben in Szabófalva insgesamt 9879 Personen, unter ihnen 9806<br />
Katholiken. Den vor Ort geschätzten Angaben von Vilmos Tánczos (1999a: 250-251) gemäß, die die<br />
sprachlichen Verhältnisse der ersten Hälfte der neunziger Jahre widerspiegeln, beträgt der prozentuale Anteil der<br />
Ungarischsprachigen (innerhalb der Katholiken) 30%; die Zahl der ungarisch sprechenden Personen lässt sich<br />
also auf 3000 beziffern.<br />
Der nördliche Tschango-Dialekt wird von den über 35jährigen, d.h. der mittleren und älteren<br />
Generation gesprochen; die jüngste Altersgruppe wiederum spricht ihre Muttersprache schon<br />
nicht mehr. In den 1960er Jahren aber – zu der Zeit, als Mihály Perka in sein Dorf als junger<br />
Lehrer zurückkehrte – konnten die Schulkinder noch Ungarisch. Die ihren Tschango-Dialekt<br />
noch beherrschende Gemeinschaft spricht – dem Gewohnheitsrecht entsprechend – ihre<br />
Muttersprache nicht nur innerhalb der Familie und des Freundeskreises, sondern auch in der<br />
Öffentlichkeit: bei der Begegnung auf der Straße, ja sogar vor der Kirche. Sobald sich aber<br />
ein Fremder nähert, hört man sie plötzlich nur noch Rumänisch sprechen<br />
Das Wörterbuch Wichmanns enthält insgesamt 6905 Wörter. Davon stammen 898 Wörter nur<br />
aus Hétfalu (rum. Săcele), mit denen ich mich naturgemäß nicht beschäftigt habe, da der<br />
Wortschatz der Burzenländer Tschangos nicht im engeren Sinn zu unserem Thema gehört.<br />
6007 Wörter wiederum bilden den gemeinsamen Wortschatz der beiden Dörfer Szabófalva<br />
und Hétfalu, wovon 4858 Wörter nur aus Szabófalva stammen.<br />
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf die letzten beiden der oben genannten Kategorien<br />
näher eingegangen.<br />
Als ein Ergebnis meiner Untersuchung ist festzuhalten, dass 87, 52 % des aus 6007 Wörtern<br />
bestehenden Sprachkorpus erhalten geblieben sind; 12, 48 % des Wortschatzes sind nicht<br />
mehr bekannt bzw. können als verschwunden betrachtet werden.<br />
Die von mir angewandte Methodik ist möglichst einfach: der gesamte – im Wörterbuch<br />
Wichmanns enthaltene – Wortschatz aus Szabófalva wurde in rumänischer Sprache abgefragt.<br />
Die rumänische Sprache wurde deshalb als Vermittlersprache gewählt, um<br />
Missverständnissen, die sich wegen Ausspracheschwierigkeiten ergeben hätten, vorzubeugen.<br />
Während der alphabetisch erfolgten Abfrage des Wortschatzes wurden folgende<br />
Möglichkeiten in Betracht gezogen:<br />
29
j: ja der Informant nennt sofort das ungarischsprachige Äquivalent des<br />
rumänisch erfragten Wortes:<br />
er kennt das Wort für den betreffenden Begriff in beiden<br />
Sprachen<br />
u: ungarisch der Informant kennt die Bedeutung des rumänisch erfragten Wortes<br />
nicht; wird ihm aber nun das Wort im Tschango-Dialekt genannt, kann<br />
er sofort dessen Bedeutung bezeichnen:<br />
er kennt das Wort für den betreffenden Begriff nur auf<br />
Ungarisch<br />
Während der Befragung kam es übrigens kein einziges Mal vor, dass der Informant den<br />
betreffenden Begriff nur im Tschango-Dialekt benennen konnte.<br />
r: rumänisch der Informant kann das ungarischsprachige Äquivalent des rumänisch<br />
erfragten Wortes nicht nennen:<br />
er kennt das Wort für den betreffenden Begriff nur auf Rumänisch<br />
Im letzten Fall, dem Fall (r) kann man von einem passiven, im Verschwinden begriffenen<br />
oder schon verschwundenen Wortschatz reden; hier müssen 2 Möglichkeiten in Betracht<br />
gezogen werden:<br />
r/a:<br />
nach mehrmaligem – nun im Tschango-Dialekt bzw. in ungarischer<br />
Sprache erfolgten – Nachfragen und ausgedehnteren Gesprächen, fällt<br />
dem Informanten das erfragte Tschango-Wort wieder ein (im Zusammenhang<br />
mit früheren Erlebnissen, Kindheitserinnerungen etc.)<br />
r/b:<br />
sogar nach intensivsten Befragungen – wiederum in ungarischer<br />
Sprache – kann der Informant das Tschango-Wort nicht nennen und<br />
kann sich weiterhin auch nicht daran erinnern, jemals dieses Wort<br />
gehört zu haben; das Wort gilt als unbekannt<br />
die Kategorie r/b wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit unter den<br />
nicht bekannten Wörtern behandelt:<br />
r/b = nicht bekannt<br />
Schon während der Befragung wurde ersichtlich, dass die Zweisprachigkeit der Informanten<br />
– zumindest was den Bereich des Wortschatzes betrifft – mehr oder weniger ausgewogen ist.<br />
Musterbeispiele:<br />
Tschango/Ung. Rumänisch j u r r/a r/b<br />
adósz/adós dator x<br />
akátsz/akác salcâm x x<br />
ilvaszó/olvasó mătanie x x<br />
30
Schwund einzelner Wörter – Longitudinalstudie –<br />
Ist das (tschango)ungarische<br />
Äquivalent des rumänisch<br />
erfragten Wortes bekannt?<br />
Nein?<br />
Verlust<br />
Ja?<br />
kein Verlust<br />
Kategorie r/a passive Kenntnis<br />
Kategorie r/b verschwundene<br />
Wörter<br />
Auf die in die Kategorie r/a eingeordneten Wörter wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit<br />
ausführlicher eingegangen werden, lässt sich doch an diesen der Prozess des Verschwindens<br />
einzelner Wörter genau nachverfolgen, da die betreffenden ungarischen Wörter hier zwar<br />
noch bekannt sind bzw. noch erkannt werden, aber an ihre Stelle eher rumänische Wörter<br />
gebraucht werden, die langsam aber sicher beginnen, die ungarischen Wörter zu verdrängen –<br />
der erste Schritt auf dem Weg zum endgültigen Verschwinden der (tschango-) ungarischen<br />
Wörter.<br />
Zu dieser Kategorie r/a gehören auch die Wörter, die ebenso wie die obigen, auf den ersten<br />
Blick „verschwunden” zu sein scheinen; hier haben wir es aber statt eines rumänischen<br />
Einflusses mit einem natürlichen Sprachwandel zu tun: entweder liegt nur ein Bedeutungsbzw.<br />
Lautwandel vor, oder aber das betreffende Wort wurde durch ein anderes ungarisches<br />
Wort ersetzt. Auch auf diese Fälle werden wir im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher<br />
eingehen.<br />
Der untersuchte Wortschatz des Wichmann-Wörterbuches wurde thematisch geordnet.<br />
Die Einordnung in die entsprechenden Kategorien ist dabei naturgemäß mit einer gewissen<br />
Relativität verbunden, da sich einige Wörter mehreren Kategorien gleichzeitig zuordnen<br />
lassen oder gar „Grenzfälle” darstellen.<br />
Innerhalb jeder einzelnen Sachgruppe wird verbucht, welche (tschango)ungarischen Wörter<br />
– 100 Jahre nach der Bestandsaufnahme von Yrjö Wichmann – in Vergessenheit geraten sind.<br />
Dabei soll auch versucht werden, der Frage nachzugehen, inwieweit das Verschwinden eines<br />
Wortes vom Zufall bestimmt ist bzw. welche Gesetzmäßigkeiten einen derartigen Prozess<br />
31
auszeichnen. Zusätzlich wird – so weit möglich – mit Hilfe des „Sprachatlas der Moldauer<br />
Tschango Mundart” (Szabó T. – Gálffy – Márton 1991; Materialsammlung: 1949-1952;<br />
Kontrolluntersuchung: 1969) in einer Art Zwischenbilanz angegeben, welche Wörter ca. 50<br />
Jahre nach dem Aufenthalt Wichmanns in Szabófalva (1906/07) noch bekannt waren bzw.<br />
welche schon zum damaligen Zeitpunkt verschwunden sind.<br />
3 Bestandsaufnahmen im zeitlichen Verlauf<br />
1907 Wichmann<br />
1949-1952 Szabó et al.<br />
2005-2006 eigene Bestandsaufnahme<br />
In der folgenden Wortschatzuntersuchung – der Aktualisierung des Wörterbuches von Yrjö<br />
Wichmann – werden nach den kursiv gesetzten (tschango)ungarischen Belegen aus<br />
Szabófalva auch die jeweiligen standardsprachlichen Äquivalente angegeben.<br />
Die jeweiligen deutschen Bedeutungsangaben stammen von Yrjö Wichmann: die Originalübersetzungen<br />
wurden beibehalten.<br />
Diejenigen Wörter, bei denen entweder nur ein Bedeutungs- bzw. Lautwandel vorliegt, oder<br />
anstatt derer heute – nach den Angaben unseres Sprachmeisters Mihály Perka – andere Wörter<br />
– sowohl ungarische als auch rumänische – in Gebrauch sind, werden sowohl durch<br />
Kursivschrift als auch durch Fettdruck hervorgehoben.<br />
Nach jedem rumänischen Lehnwort wird das jeweilige Etymon in Klammern angegeben.<br />
32
1.1. Planung und Zusammenstellung des zur Aktualisierung des Wortschatzes<br />
notwendigen Arbeitsmaterials<br />
1.) Zusammenstellung der Fragebögen:<br />
a.) Erstellung einer Fotokopie vom Original-Wörterbuch Wichmanns<br />
b.) Da die Wortartikel im Wichmann-Wörterbuch in mehreren Spalten angeordnet<br />
sind, wurden die fotokopierten Seiten zunächst so zurechtgeschnitten, dass<br />
„Streifen” mit jeweils einer Wortartikelspalte entstehen<br />
c.) Diese Wortartikelspalten werden auf jeweils ein Blatt (DIN A 4, Querformat)<br />
geklebt<br />
d.) Zusammenstellung des Fragebogens (ein Fragebogen enthält circa 18-23 Wortartikel)<br />
e.) Bindung der auf diese Weise zusammengestellten 342 Fragebögen in 2 Ringbücher<br />
Legende:<br />
1. Original-Wortartikelspalte: tschango-ungarische Belege einschließlich der jeweiligen standardsprachlichen<br />
Äquivalente und deutschen Bedeutungsangaben<br />
2. jeweilige rumänische Entsprechungen<br />
j : ja: der Informant kennt das erfragte tschango-ungarische Wort<br />
u: der Informant kennt das Wort für den betreffenden Begriff (nur) in seinem Tschango-Dialekt<br />
r: der Informant kennt das Wort für den betreffenden Begriff in rumänischer Sprache<br />
r/a: der Informant erinnert sich an das tschango-ungarische Wort;benutzt dieses aber kaum<br />
r/b: der Informant kennt das tschango-ungarische Wort für den betreffenden Begriff nicht<br />
heutige Szabófalver Entsprechung: Was für ein Wort wird (heute) in Szabófalva anstelle des nicht<br />
mehr bekannten bzw. kaum noch verwendeten tschangoungarischen<br />
Wortes gebraucht?<br />
33
2.) Auswertung der Fragebögen:<br />
a.) Aufstellung einer Tabelle, die sowohl zur Zusammenfassung der Daten als auch zur<br />
Kontrolle dienen soll<br />
b.) auf ein DIN A 4 – Blatt konnten jeweils die Daten von 33 Fragebögen verzeichnet<br />
werden, so dass die zusammenfassende Tabelle mit den Daten sämtlicher Fragebögen<br />
schließlich 11 Seiten umfasste<br />
c.) Einteilung der gegebenen Wortartikel bzw. Wörter in einzelne Kategorien wie zum<br />
Beispiel die der Themenbereiche, Wortarten etc.<br />
Legende:<br />
1. Einordnung der Wörter nach ihrem Belegort (Hétfalu:H; Szabófalva und Hétfalu: Sz/H;<br />
Szabófalva: Sz) einschließlich ihrer Gesamtsumme<br />
2. Ergebnisse der Befragung: j, u, r, r/a, r/b<br />
3. Einteilung der Wörter in einzelne Kategorien (1-38) wie zum Beispiel die der Themenbereiche,<br />
Wortarten etc.<br />
- die innerhalb des grünen Balkens befindlichen Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen der Fragebögen<br />
34
3.) Tabellarisierung und Auswertung des in Themenbereiche eingeordneten Wortschatzes:<br />
Drei Beispielseiten:<br />
Auszug aus dem Themenbereich des Hauses und des Hausgewerbes<br />
Nord-Tschango Rumänisch Deutsch j n r/a r/b<br />
/Ungarisch<br />
ablak / ablak Fereastră Fenster x<br />
ablak-szem ablakszem Oblon Fensterglas x<br />
abrasz / abrosz faŃă de masă Tischtuch x<br />
ádj / ágy Pat Bett x<br />
ádj-vetész /ágyvetés Lengerie Bettwäsche x<br />
ágal, be-a./ ágal a face un gard provisorisch zusammenstellen (einen Zaun) x<br />
din crengi<br />
ágasz / ágas stâlp de casă gegabelter Wandpfeiler eines Wohnhauses x<br />
aito oder eito / ajtó Uşă Tür x<br />
allok / olló Foarfecă Schere x<br />
asztal / asztal Masă Tisch x<br />
asztal-filó /asztalfiók sertar Schublade x<br />
asztal-vetész / a da masă Festmahl x<br />
„asztalvetés”<br />
asztarha, eszterha / eresz Streaşină Vordach, Traufdach x<br />
ásztat / áztat a muia befeuchten (Lein, Hanf) x<br />
ásztatat / áztatott topit (pânză geröstet (Hanf, Lein)<br />
x<br />
topită )<br />
balerka / kicsi hordó Balercă kleines Fass x<br />
bordé /kunyhó, viskó Bordeiu Erdhütte x x<br />
bordo / borda coastă ( la Weberkamm<br />
x<br />
maşina de Ńesut<br />
boronno / borona Bârnă Wandbalken x<br />
borosz-hardo / butoi de vin Weinfass x<br />
boroshordó<br />
borosz-pahar / pahar de vin Weinglas x<br />
borospohár<br />
bor-vizesz eweg / sticlă de apă Sauerwasser (Mineralw.) Flasche<br />
x<br />
borvízes üveg<br />
minerală<br />
Bota / kis fahordó Botă kleine hölzerne Wasserbütte x<br />
botol bate cu bâta m. den Stock schlagen (Hanf, Lein) vor d. x<br />
eigtl.Brechen m. der Hanfbreche, Wäsche bleien<br />
bör / bır Piele Haut, Fell, Leder x<br />
budaska / fabödön, budaiu, bădău, mit 1-2 Henkeln versehener Kübel aus Holz f.das x<br />
faedény<br />
bidon Schmutzwasser in der Küche<br />
buidjin / bodon Budăi als Brunnengeländer angewandter ausgehöhlter x<br />
Baumklotz<br />
bukk (bukkat) / durvább buc, cîlŃi die beim Wollkămmen übriggebliebene zweite, x x<br />
gyapjúfajta<br />
gröbere Wollsorte<br />
buketerie / konyha Bucătărie Küche x<br />
burit / borít Acoperă Zudecken x<br />
diribal, el-d. / darabol Taie<br />
Zerstückeln<br />
x<br />
(în bucăŃi)<br />
dongo / donga Doagă Daube x<br />
[...]<br />
35
Auszug aus dem Themenbereich der Tiere und der Viehzucht<br />
Nord-Tschango Rumänisch Deutsch j n r/a r/b<br />
/Ungarisch<br />
abraas / abroncs bandaj Reif, Bogen am Pferdegeschirr x<br />
abrak / abrak furaj Getreide x<br />
abrakal / abrakol a furaja Füttern (die Pferde) x<br />
abrakasz, a.terisna / sac cu ovăz Sack mit Hafer gefüllt (für die Pferde) x<br />
abrakasz tarisznya<br />
alut-tej / aludt tej lapte prins, geronnene (nicht saure) Milch<br />
x<br />
închegat<br />
Béka / béka broască Frosch x<br />
bél, biél / bél maŃe Inneres, Eingeweide x<br />
bendı / bendı stomac Magen (bei den Tieren) x<br />
berbes / berbécs berbec Schafbock x<br />
berbeses / berbécses berbeceşte der viel Widder hat x<br />
berbeske / bárány berbecuŃ Hammellam x<br />
berreg / béget a mecăi meckern (vom Schaf) x<br />
bihalj/ bivaly bivoliŃă Büffel x<br />
bihaljassz / bivalyos omul cine are Büffeleigentümer<br />
x<br />
bivoliŃă<br />
bihalj-szekiér / căruŃă (tras de Büffelwagen<br />
x<br />
bivalyszekér bivoli)<br />
bika-szem /ökörszem ochiul boului Zaunkönig x<br />
bindár, földi-b./ bandar Hummel x<br />
dongó<br />
bogár / bogár insectă, gândac Käfer x<br />
bogáradzik / „nărăvaş” von Insekten verfolgt herumlaufen (vom Vieh) x<br />
„bogározik”<br />
bogárassz / bogaras viermos voll von Würmern (zB. ein Baum) x<br />
bogaratska s. gândecel Käferchen x<br />
bogorosko /<br />
bogaracska<br />
bogolj / bagoly bufniŃă Eule x<br />
burdu / tömlı burduf Schlauch x<br />
Buriu / borju viŃel Kalb x<br />
buriussz / borjas vacă cu viŃel Kuh mit Kalb x<br />
boriu-sordo / ciurdă de viŃei Kälberherde x<br />
borjúcsorda<br />
boriuzik / borjazik naşte viŃel Kalben x<br />
buriuzó , b. ünö / vacă gestantă trächtige Kuh x<br />
borjuzó tehén<br />
daráz / darázs viespe Wespe x<br />
darék-szeg / blândeŃe der eiserne Zapfen an der vorderen Wagenachse x<br />
derékszeg<br />
disznó / disznó porc Schwein x<br />
disznó-fel / disznózsír untură de porc Schweinefett x<br />
djek / gyík şopârlă Eidechse x<br />
[...]<br />
36
Auszug aus der Kategorie der rumänischen Lehnwörter<br />
Nord-Tschango Rumänisch Deutsch ja nein<br />
/Ungarisch<br />
alamar / rézmőves alămar Kupferschmied X<br />
alarma /riadó alarmă Alarm X<br />
april /április aprilie April X<br />
ardei / paprika ardei Paprika X<br />
ardjelan / erdélyi ardelean Ungar aus Siebenbürgen X<br />
arendal / haszonbérbe a da în arendă Verpachten X<br />
ad<br />
arest / letartóztatás arest Arrest X<br />
bal / bál<br />
bal, petrecere cu Ball<br />
X<br />
dans<br />
balan blond /szürke bălan, blond weissgrau (Pferd) x<br />
(ló)<br />
balsin / balzsam balsam Balsam x<br />
baltag / balta, fejsze topor, băltag Handbeil X<br />
balerka / kicsi hordó balercă kleines Fass X<br />
banta / banda bandă, fanfară Bande (von Musikern) X<br />
(zenészek)<br />
banka / iskolapad, bancă Schulbank, Geldinstitut X<br />
pénzintézet<br />
barnets / öv , mellyel bărneŃ<br />
ein Gürtel, womit die Weiber ihren Kittel X<br />
a kötényt megkötik<br />
festbinden<br />
bas / számadó juhász baciu Schäfer X<br />
baso / „bacsó” , öreg moş, bătrânel Greis, Väterchen X<br />
ember<br />
bekene / vegyesbolt băcănie Spezereiwaren (Gemischtwaren) X<br />
belezna / hiba, a beleznă Fehler, o. Lücke im Gewebe infolge x<br />
szövésben<br />
fehlerhaften Webens<br />
berbier / borbély bărbier Barbier X<br />
berbes / berbécs, kos berbec Schafbock, Widder X<br />
berbeses / berbécses berbeceşte der viel Widder hat X<br />
berbeske / kicsi kos, berbecuŃ Hammel lamm X<br />
berbécske<br />
biere / sör bere Bier X<br />
berza / bérkocsi birjă Fiaker X<br />
beske / nagy főrész beschie grosse Balkensäge X<br />
bes / borpince beciu, pivniŃă (de Weinkeller<br />
X<br />
vin)<br />
bets / pálcika beŃişor Stäbchen X<br />
bindar/ dongó bandar Hummel X<br />
bisuska / ostor biciuşcă Peitsche X<br />
bojer / földbirtokos boier Grossgrundbesitzer X<br />
bokiis / bakancs bocanci Schnürstiefel X<br />
bokkont / „bakkant”, a bocăni klopfen (die Wand) X<br />
„veri a falat”<br />
bolta /városi ház egy boltă Stadthaus an einer grossen Strasse x<br />
nagy utcában<br />
bombo / nagy bombă, clopot de grosse Kirchen glocke<br />
X<br />
(templom) harang biserică<br />
borbat / szorgalmas sîrguincios Fleissig X<br />
[...]<br />
37
Anhand der oben angeführten, nach Themenbereichen geordneten Tabellen konnte ich<br />
schließlich – als letzten Arbeitsschritt – weitere Unterklassifizierungen vornehmen. Der<br />
Themenbereich der Tiere und der Viehzucht wurde so zum Beispiel in die Sachgruppe der<br />
freilebenden Tiere und Parasiten, die Sachgruppe der Haus- und Nutztiere, die Sachgruppe<br />
der mit der Viehzucht verbundenen Geräte, die Sachgruppe der Bienenzucht, die Sachgruppe<br />
des Fischfanges sowie in die Sachgruppe der Jagd unterteilt.<br />
Nach der obigen „trockenen” Statistik und Darstellung der methodischen Vorgehensweise soll<br />
kurz auf einige Beobachtungen, die sich während dieser Arbeit ergaben, eingegangen werden,<br />
um so auch eine kleine Vorschau der im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher behandelten<br />
Wortschatzuntersuchung bieten zu können: infolge der wirtschaftlichen und<br />
gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 100 Jahre sind gewisse Begriffe endgültig aus<br />
der Erinnerung verschwunden, da sie funktionslos geworden sind; ihre Bezeichnungen<br />
werden weder in (tschango)ungarischer noch in rumänischer Sprache gekannt (wie z.B. die<br />
Benennungen der Bestandteile der bereits veralteten landwirtschaftlichen Geräte oder die<br />
Bezeichnungen der Funktionäre des alten Gesellschaftssystem). Es handelt sich hierbei um<br />
sogenannte Paläologismen, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit gesondert betrachtet<br />
werden. Dieses Phänomen sehen wir nicht als einen – durch die Rumänisierung<br />
hervorgerufenen – Sprachverlust an, sondern betrachten es als einen natürlichen<br />
Sprachwandel.<br />
Die im Wortschatz erhalten geblieben Wörter sind einschließlich ihrer zahlreichen Derivate<br />
bekannt. Dabei kam es auch vor, dass – obwohl das Basiswort selbst bzw. dessen Bedeutung<br />
nicht mehr bekannt ist, dieses in Derivatsform trotzdem weiter im Wortschatz erhalten bleibt.<br />
In den folgenden Kapiteln werden wir u.a. hybride Bildungen aus rumänischen Entlehnungen<br />
und einheimischen, ungarischen Wörtern sowie zahlreiche Synonymenpaare (Wortpaare<br />
gleicher oder ähnlicher Bedeutung, die auch aus 3 oder mehr Elementen bestehen können)<br />
bzw. die sogenannten Dubletten antreffen.<br />
1.2. Wörter und Kulturgeschichte<br />
Im Wörterbuch Yrjö Wichmanns finden sich wichtige kulturhistorische Angaben, da dieser<br />
die einzelnen Wörter nicht im „luftleeren Raum” stehen lässt, sondern – soweit es ihm<br />
möglich war – in den jeweiligen Wortartikeln auch volkskundliche Beschreibungen wie zum<br />
Beispiel die Art und Weise der Zubereitung der diversen Speisen einschließlich der Anlässe,<br />
38
zu denen sie gereicht werden oder aber den Ablauf der mit dem jeweiligen Themenkreis<br />
verbundenen Bräuche einarbeitet. Ohne diese Angaben würden uns wichtige<br />
Hintergrundinformationen verloren gehen.<br />
Obwohl das Grundthema dieser Arbeit nicht volkskundlicher Natur ist und deshalb auch kein<br />
gesondertes Kapitel näher auf diesen Bereich eingeht, soll innerhalb der einzelnen Themenbereiche<br />
der folgenden Wortschatzanalyse – dem Beispiel Wichmanns folgend – nicht auf die<br />
Angabe der betreffenden volkskundlichen Informationen, die entweder der Fachliteratur<br />
entnommen worden oder aber direkt vor Ort gewonnen werden konnten, verzichtet werden.<br />
Darüber hinaus soll auch auf einige Charakteristika der Wirtschaftsformen eingegangen<br />
werden, die sich bei den Tschangos finden, wobei sich unser besonderes Augenmerk auf die<br />
der Nord-Tschangos richten wird. Diese jahrhundertelang erhalten gebliebenen<br />
Wirtschaftsarten beginnen langsam aus der Erinnerung zu verschwinden und werden von<br />
moderneren Formen der Bewirtschaftung verdrängt, da sich auch die Tschangos den<br />
Entwicklungen der Moderne nicht entziehen können und wollen.<br />
Die Wirtschaftsform der Dörfer der Moldauer Ungarn war überwiegend eine<br />
selbstversorgende. Was bei ihnen – infolge der Bodenqualität, des Klimas oder aus anderen<br />
Gründen – nicht gedieh, verschaffte man sich anhand eines mit den umliegenden Dörfern<br />
geführten Tauschhandels. Der eigene Bedarf konnte so vollständig gedeckt werden. Einen<br />
wichtigen Beitrag zur hochgradigen Autarkie der Tschango-Dörfer leisteten darüber hinaus<br />
das Hausgewerbe und die Ausübung einiger Handwerksberufe.<br />
Innerhalb des Landwirtschaftszweiges des Ackerbaus spielte wohl der Maisanbau die<br />
wichtigste Rolle; lieferte dieser doch der Bevölkerung ihr Hauptnahrungsmittel. Im Laufe des<br />
17. und 18. Jahrhunderts verdrängte der Mais die bis dahin allseits beliebte Hirse. Weitere<br />
wichtige Nutzpflanzen waren die Kartoffel, die Bohne und der Kürbis, die jeweils zwischen<br />
den Maisreihen eingepflanzt wurden. Die Technik der Dreifelderwirtschaft wurde bis in<br />
jüngster Zeit nicht angewandt. Auch mit der Düngung der Felder hat man erst seit den 1940er<br />
Jahren begonnen.<br />
Eine große Bedeutung hat auch – bis zur heutigen Zeit – der Anbau und die Verarbeitung von<br />
Hanf gespielt, der das Grundmaterial für die Bekleidung der Tschangos lieferte.<br />
Die Lebensmittelpalette der Dorfbevölkerung wurde durch den Obstanbau ergänzt, wobei<br />
auch ihr zu Recht berühmter Weinanbau nicht unerwähnt bleiben soll.<br />
Neben dem Ackerbau spielte – besonders in der Nähe von Städten – auch der Gemüseanbau<br />
in den heimischen Gärten eine wichtige Rolle.<br />
39
Innerhalb des Landwirtschaftszweiges der Tierhaltung müssen die Rinder-, Schweine-,<br />
Geflügel- und Schafzucht erwähnt werden. In diesem Zusammenhang muss besonders die<br />
Schafzucht hervorgehoben werden, wenn man berücksichtigt, dass diese durch ihre Fleischund<br />
zahlreichen Milchprodukte nicht nur im Verpflegungsbereich, sondern anhand der<br />
zahlreichen Verarbeitungsmöglichkeiten der Wolle und des Fells auch im Bekleidungsbereich<br />
eine wichtige Rolle spielt. Übrigens stammt der Großteil des mit der Schafzucht verbundenen<br />
Tschango-Wortschatzes aus dem Rumänischen.<br />
Bedeutende Faktoren der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln waren – neben dem<br />
Ackerbau und der Tierhaltung – die Bienenzucht und der Fischfang, die vor allem für die über<br />
wenig Land und Vieh verfügende Bevölkerung lebenswichtig war, benötigte man doch zur<br />
Ausübung dieser beiden Tätigkeiten weder Grund und Boden noch Kapital.<br />
Als Möglichkeit zum Gelderwerb diente der Verkauf des eventuellen Produktüberschusses.<br />
Die Waren konnten dabei entweder dem Verbraucher direkt vor Ort – sozusagen vor dem<br />
Haus des Produzenten – verkauft werden oder aber durch einen vermittelnden Händler an den<br />
Mann gebracht werden. Eine weitere Möglichkeit zum Produktverkauf bildeten die<br />
Marktplätze der näher gelegenen Städte. Als weitere bedeutende Gelderwerbsmöglichkeit<br />
lässt sich noch das Transportwesen erwähnen. Die erworbenen Einnahmen wurden in den<br />
meisten Fällen für die Bezahlung der Steuern verwendet.<br />
Anhand der Wörter können wir uns ein Bild vom Alltag und Weltbild der Moldauer Ungarn<br />
machen sowie einen Einblick in das Institutionssystem der zeitgenössischen Moldau<br />
gewinnen<br />
2. Themenbereich der Pflanzen und des Pflanzenanbaues<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 372 Wörter machen 6, 19 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen – aus 6007 Wörtern bestehenden – Gesamtwortschatzes des<br />
nördlichen Tschango-Dialektes (Szabófalva) aus. 56 der 372 Wörter sind nicht mehr bekannt,<br />
was einen Verlust von 15, 05 % bedeutet.<br />
In diese Kategorie wurden sowohl die Benennungen der Wild- und Zuchtpflanzen als auch<br />
die mit dem Pflanzenanbau, den landwirtschaftlichen Tätigkeiten und Maschinen<br />
verbundenen Wörter und Ausdrücke eingeordnet.<br />
Bekannte ungarische Sammelbezeichnungen:<br />
bokor = Strauch, Busch, djérszég/gyérség = Lichtung im Walde, fa = Baum, Holz, fü/fő = Gras, gabana/<br />
gabona = Getreide, héi/héj = Schale, zölszég/zöldség = Grünzeug (nur nicht die Wurzeln).<br />
40
Bekannte rumänische Lehnwörter:<br />
liváda (rum.livadă)/gyümölcsös = Obstgarten, poiána (rum.poiană) /erdei tisztás = Waldwiese.<br />
Im folgenden Synonymenpaar, das aus einem einheimischen, (tschango)ungarischen Wort<br />
und einem rumänischen Lehnwort besteht, sind beide Elemente bekannt:<br />
djérszég/gyérség = Lichtung im Walde → bekannt<br />
poiána(rum.poiană) /erdei tisztás = Waldwiese → bekannt<br />
Die geringfügige Bedeutungsdifferenz zwischen den beiden Elementen dieses Wortpaares<br />
könnte zum Erhalt des ungarischen Wortes beigetragen haben.<br />
Nicht mehr bekannt sind die folgenden ungarischen Sammelbezeichnungen (und deren<br />
Derivate):<br />
djep/gyep = Rasen, djeppesz/gyepes = grasig, djeppeszül/gyepesül = mit Gras bewachsen, djepszeg/füves térség<br />
= rasige Stelle, djümöls/gyümölcs = Obst, Frucht, djümöls-fa/ gyümölcsfa = Obstbaum, pázint/pázsit = Rasen,<br />
Anger, pázintász/pázsitos = rasig, grasig, szirta = die auf dem Felde wachsende Saatgut im allg., vetemény =<br />
Saat, Saatfrucht (Getreide, Kartoffel, Erbsen,…).<br />
2.1. Zur Sachgruppe der Wildpflanzen wurden die verschiedenen Baum- , Strauch- und<br />
Unkrautarten sowie die Heilpflanzen gezählt.<br />
Die Tschangos sind gute Kenner der Pflanzenheilkunde und sammeln die verschiedenen<br />
Heilkräuter sowohl zum eigenen Gebrauch als auch zum Verkauf auf den Marktplätzen der<br />
näher gelegenen Städte.<br />
In diesem Zusammenhang macht uns der Tschango-Forscher Péter Halász auf ein wichtiges<br />
Forschungsziel aufmerksam, dass darin bestehen würde, „anhand soziologischer und medizinischer<br />
Methoden herauszufinden, welche (...) Heilverfahren von jeder einzelnen Tschango-<br />
Familie gekannt und angewandt werden, welche Heilverfahren (...) sich auszubreiten<br />
beginnen und bei welchen Krankheiten die Tschangos die Hilfe von berühmtem „weisen<br />
Frauen” (...) in Anspruch nehmen” (Halász 2002: 36).<br />
Die Tschangos kennen und sammeln weiterhin die verschiedenen Pilzarten und Waldfrüchte,<br />
womit sie ihre Nahrung ergänzen; das im Wald gesammelte Reisig verwenden sie als Brennmaterial.<br />
Die Pflanzennamen rumänischer Herkunft sind naturgemäß bekannt:<br />
brad (rum. brad) / fenyı = Fichte, brusztur (rum. brustur)/bojtorján = Klette, burján (rum. buruiană) = Unkraut,<br />
pipirig (rum. pipirig)/káka = Binse (Scirpus), plóp (rum. plop)/nyárfa = Pappel, sédru/cédrus = Zeder, süperke<br />
= Champignon.<br />
41
Im folgenden Synonymenpaar liegt keine Bedeutungsdifferenzierung zwischen den beiden<br />
Elementen unterschiedlicher Herkunft vor; das (tschango)ungarische Wort ist aus dem<br />
Gebrauch verschwunden, nur noch das rumänische Lehnwort ist bekannt:<br />
szálkim (rum. salcâm) / főz = Akazie → bekannt<br />
akátsz / akác = Akazie → nicht bekannt<br />
Das Lexem akátsz war in Szabófalva – wie der „Sprachatlas der Moldauer Tschango<br />
Mundart” (Szabó T. – Gálffy – Márton 1991) bezeugt – übrigens schon in den 50er Jahren<br />
nicht mehr bekannt.<br />
Bekannt sind die ungarischen Bezeichnungen folgender Pflanzen:<br />
djöndj/fagyöngy = Mistel,Vogelleimbeere, egier-fark/cickafark = Schafgarbe, fai-tapló = Baumschwamm,<br />
farkas-alma = Aristolochia clematitis, galagana/galagonya = Hagedorn, gane,gane-fa = eine Ebereschen-<br />
(Sorbus-) Art, rote, saurere Beeren, höhstens 3 m hoch, buschartig, harang-virág/harangvirág = Glockenblume,<br />
katjina-sipke = Cuscuta europaea, kidjó-nelv / kígyónyelv = eine Pflanze (Blüte weiss, wahrsch. eine Plantago-<br />
Art), kidjó-süperke = eine giftige Schwammart ( klein, gelb, weiss, giftig), kökén/kökény = Schlehe, kusa tei,<br />
„kutyatej” /büdös gınye = Aethusa, lóza/főz = Wasserweide, nád = Rohr, Schiff, Abl.: nádaz = mit Rohr<br />
bedecken; szász/sás = Riedgras, Abl.: szászszal = Riedgras einsammeln; szedere/szeder = Brombeere, szegvakaró<br />
/csipkebogyó = Hagedorn (Rosa canina), sere/csere= Eiche, sillan/csalán = Nessel, Brennessel, sipkebokor<br />
= Dornstrauch, vatszkar/vackor = Holzbirne.<br />
Nicht bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
akátsz/akác = Akazie, baba-belesz/mályva = Malve, djalag-bodzo/bodza = Holunder, dudo/dudva = dichtes<br />
Gebüsch, von allerlei gröberem Stengelgewächsen und Unkraut, hunar/hunyor = wahrsch. Niesswurz,<br />
hutjuró/hutyoró = biegsame Gerte, isztee-fa = ein Strauchgewächs mit weissen, wohlriechenden Blüten,<br />
konkol/konkoly = Rade (Agrostemma githago), kusa-fa = Vogelbeere, lilión/liliom = Lilie, madjaró / mogyoró<br />
= Haselnuss, málna,málno, málló, mállo = Himbeere, nadár/nadály = Symphytum, nádi-bika = Rohrdommel<br />
(Ardea stellaris), ruza/rózsa = im Volksl: Rose (veralt.); Róza, Rosa, (heute nur noch als Personenname<br />
bekannt), szil = Ulme, Abl.: szilasz = mit Ulmen bewachsen; tjuk-virág /gyermekláncfő = eine Taraxacum-Art,<br />
tszitsziie / cica = Palmkätzchen, utju-lewiél/útilevél, útilapu = Wegerich.<br />
Innerhalb der „erhalten gebliebenen” ungarischen Wörter treffen wir hybride Bildungen aus<br />
rumänischen Entlehnungen und einheimischen, (tschango)ungarischen Wörtern wie die<br />
folgenden an:<br />
katjina-sipke = Cuscuta europaea<br />
gebildet aus:<br />
katjina < (rum.) cătină = Cuscuta europaea + sipke/csipke = Dorn, Stachel<br />
42
kidjó-süperke = eine giftige Schwammart<br />
gebildet aus:<br />
kidjó/kígyó = Schlange + süperke < (rum.) ciupercă = Pilz<br />
Da nun sowohl sipke/csipke = Dorn, Stachel als auch kidjó/kígyó = Schlange auch nach 100<br />
Jahren noch bekannt sind, scheinen die hybriden Bildungen die ungarischen Wörter zu<br />
„schützen”<br />
Es kommt vor, dass die Bedeutung eines Wortes zwar nicht mehr bekannt ist, dieses aber als<br />
Eigenname im Sprachbestand erhalten geblieben ist:<br />
ruza/rózsa = Rose → bekannt als Personenname<br />
Übrigens war dieser Pflanzenname bereits zu Zeiten Wichmanns veraltet und verschwand<br />
somit schon damals aus dem aktiven Wortschatz; wie dieser bemerkt, kam dieses Wort nur in<br />
Volksliedern vor, in denen es höchstwahrscheinlich nur automatisch – ohne die Bedeutung zu<br />
kennen – verwendet wurde.<br />
Innerhalb des Themenbereiches der Kulturpflanzen werden die Getreide-, Gemüse- und<br />
Obstarten einschließlichlich der damit verbundenen Tätigkeiten behandelt.<br />
2.2. Sachgruppe der Getreidearten und des Getreideanbaues einschließlich der<br />
landwirtschaftlichen Maschinen und Tätigkeiten<br />
„In der Moldau (...) hatten – sowohl bei den Rumänen, als auch bei den Ungarn – die mit<br />
Maismehl zubereiteten Speisen schon immer die Oberhand im Vergleich zu denen, die mit<br />
Weizenmehl zubereitet wurden. (...) Es wurde auch kaum Weizen angebaut; mindestens 70-<br />
80 % der für die Getreidearten vorgesehene Anbaufläche wurden für den Maisanbau<br />
verwendet (...); diese Verhältnisse hielt sogar die Kollektivwirtschaft bei. Wir können ohne<br />
Übertreibung behaupten, dass der Mais für die Lebenserhaltung der Bevölkerung der Moldau<br />
– und so auch für die Tschangos – enorm wichtig war und es auch heute noch ist, da er nicht<br />
nur die Hauptnahrungsquelle der Moldauer Bevölkerung bildet, sondern mit ihm auch die<br />
Tiere gemästet werden” (Halász 2002: 257).<br />
43
Bekannt sind die Sammelbezeichnungen:<br />
gabana/gabona = Getreide, Feldfrucht ( auch Erbsen, Bohnen, Kartoffel, Melonen, usw.; fejjer-gabana = das<br />
eigl. Getreide)<br />
Weiterhin bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
arat = ernten, aratász = Ernten, borna/borona = Egge, boronna/boronál = eggen, buza/búza = Weizen, buzaliszt/búzaliszt<br />
= Weizenmehl, buzas/búzaföld / Weizenfeld, buza-szem/búzaszem = Weizenkorn, buzaska/<br />
buzácska = (Dim.) kleiner Weizen, sépel/csépel = dreschen, dertsze,derce/ korpa = Weizenkleie, eke-korman =<br />
Streichbrett (aus Eisen), eke/eke = Pflug, eke-szarv = Pflugsterz, eke-talp = Pflughaupt, eke-tjelaga = Pflugkarren,<br />
eke-wasz = Pflugschar, fuiodik/fújódik = durch den Wind troknen (z.B. das Heu), gabanas-zák/<br />
gabonászsák = Getreidesack, heszszu-uasz, hosszú vas/ekevas = Pflugmesser, hewertet, le-h./letapos (gabonát)<br />
= niedertreten, niederdrücken (z.B. den wachsenden Weizen), hewertetész/letaposott hely a búzaföldön =<br />
niedergetretene Stelle (z.B. im Weizenfeld), kalász = Granne an der Ähre, kasza-nél/kaszanyél = Sensenstiel,<br />
kaszál = mähen, kaszálász = gemähte Strecke auf der Wiese, kéwé/kéve = Garbe, kéwéz = Garben binden,<br />
korpo/korpa = Kleie, kotsán/kocsány = Maisstengel, nyomtot/nyomtat = treten, dreschen, nyomtotó/nyomtató =<br />
was zu treten, zu dreschen ist, nyomtotó-miészina = Dreschmaschine, pili/pehely = Maisblatt, die Hülle des<br />
Maiskolbens, poliua/polyva = Spreu, Spelze, roz/rozs = Roggen, szalma = Stroh, Halm, szalma-szál = Strohhalm,<br />
szalmáz, le-sz. = das Stroh nach dem Dreschen mit den Gabeln wegräumen, széna = Heu, széna-fü = zu<br />
mähendes Gras auf der Heuwiese, széna-füesz = Heuwiese, szérı/szérő = Dreschtenne, szánt = pflücken,<br />
ackern, szántó = Pflugland, tauaszi-búza = Frühlings-, Sommerweizen (wird im Frühling gesät), ugar =<br />
Ackerstrich, vet, bé-v. = einsäen (der Acker), zab = Hafer, zabasz/zabos = mit Hafer gemischt, Haferfeld.<br />
Unsere alten Bekannten, die hybriden Bildungen sind auch hier erneut anzutreffen:<br />
eke-tjelaga = Pflugkarren<br />
gebildet aus:<br />
eke/eke = Pflug +<br />
tjelaga < (rum.) teleagă = Karre<br />
nyomtotó-miészina = Dreschmaschine<br />
gebildet aus:<br />
nyomtotó/nyomtató = was zu treten, zu dreschen ist + miészina < (rum.) maşină<br />
Die ungarischen Bezeichnungen der Getreidearten sind erhalten geblieben. Einzig für den<br />
’Mais’ gibt es keine ungarische Benennung. Wie wir schon erwähnt haben, wurde der Mais in<br />
dieser Region erst im 17. Jahrhundert bekannt, um sich dann später – im 18. Jahrhundert – zu<br />
verbreiten. So ist es nur natürlich, dass die Tschangos diese Getreideart – zusammen mit der<br />
rumänischen Benennung pui – in der Moldau kennen lernten. Das rumänische Lehnwort hat<br />
sich mittlerweile dermaßen in den Tschango-Dialekt integriert, dass es auch als Bestandteil<br />
hybrider Bildungen wie der folgenden anzutreffen ist:<br />
44
pui-pili / kukoricapehely = Maisblatt, die Hülle des Maiskolbens<br />
gebildet aus:<br />
pui < (rum.) pui = Mais + pili/pehely = Flocken<br />
Weiterhin bekannt sind die mit den Aussaat-, Ernte- und Dreschtätigkeiten verbundenen<br />
Wörter einschließlich der Bezeichnungen der für diese Tätigkeiten notwendigen Maschinen.<br />
„(...) das Werkzeug der Ackerbestellung war bis zum Anfang des 20. Jahrhundert der<br />
Holzpflug, der von den Tschangos – in Abgrenzung zu den in den anderen Gebieten der<br />
Moldau verwendeten Pflugarten – als „ungarischer Pflug” bezeichnet wurde” (Károly Kós<br />
1976: 111).<br />
Nicht bekannt sind:<br />
eke-kabila = eine gabelige Baumstellung zum Transport des Pfluges, járam/járom = Joch, járam-fa/járomfa =<br />
Joch, járam-páltsza = Jochstecken, tjágató/ cságató = ein krummer Holzbogen am Pflug zum Richten des<br />
Pfluges, tjágató-szeg = ein Nagel am Steuerbogen des Pfluges<br />
Sogar den Dorfältesten sind die obigen Wörter unbekannt; diese Ausdrücke können als<br />
Paläologismen betrachtet werden.<br />
Die folgenden rumänischen Lehnwörter sind bekannt:<br />
hambar (rum.hambar)/hambár = Kornspeicher, hiriska (rum.hrişcă)/haricska = Buchweizen(Polygonum<br />
phagopyrum), kapitsza (rum. căpiŃă)/kapica = Heuschober, nyiristje (rum. mirişte)/tarló = Stoppel,Stoppelfeld,<br />
penusze(rum.pănuşă) /kukoricacsı borítólevele = Maishülle, die den Maiskolben umgehende Hülle, pui<br />
(rum.pui)/kukorica = Mais<br />
2.3. Sachgruppe des Gemüseanbaues<br />
Abweichend von den Ungarn des Karpatenbeckens, die die Tücken und Geheimnisse des<br />
Gemüseanbaues vor allem durch die Mönche der römisch-katholischen Klöster kennen<br />
lernten, kamen die Moldauer Ungarn mit ausgezeichneten bulgarischen Gärtnern in Kontakt<br />
– waren doch auch die Bulgaren bis einschließlich zum 19. Jahrhundert Untertanen des<br />
Osmanischen Reiches – von denen sie viele Kenntnisse übernehmen konnten.<br />
Den günstigen klimatischen und geographischen Bedingungen ist es zu verdanken, dass der<br />
Gemüseanbau in den Moldauer Dörfern dermaßen bedeutend ist, dass er nicht nur den Bedarf<br />
jeder einzelnen Familie deckt, sondern auch den Bestand der für den Verkauf auf den Marktplätzen<br />
vorgesehenen Waren sichert.<br />
45
In unserem speziellen Fall, in unserem höher gelegenen Untersuchungsdorf Szabófalva also,<br />
in dem ein kälteres Klima herrscht, ist vor allem der Kartoffelanbau bedeutend. Schon seit der<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts verfügen wir über Belege, dass die Szabófalver „Kartoffeln und<br />
andere Waren” (Jerney 1851: 30) in der Stadt Iaşi (ung. Jászvásár) zum Verkauf anboten,<br />
worüber auch Lahovari (1902: 161) und Lükı (1936: 14) berichten (siehe Halász 2002: 258).<br />
Margit Perka – die Frau unseres Sprachmeisters, Mihály Perka – erinnert sich noch daran,<br />
dass die Kartoffeln in den 1950er Jahren, einschließlich bis zur Kollektivisierung, sogar bis in<br />
die weit entfernte Stadt Temesvár (rum. Timişoara) transportiert wurden. Heutzutage wird<br />
sogar die Kartoffel nur noch in geringeren Mengen zu Verkaufszwecken produziert. Auch der<br />
Bohnenanbau nimmt – „zum einen als Nahrungsquelle, aber in größerem Maße eher als<br />
wettbewerbsfähiges Produkt, mit anderen Worten: als Geldquelle“ (Halász 2002: 258-259)<br />
eine wichtige Rolle ein.<br />
Die mit den Gemüsearten und dem Gemüseanbau verbundenen ungarischen Wörter und<br />
Ausdrücke sind auch heute noch bekannt:<br />
bob/ bab = Bohne, borszó/borsó = Erbsen, borsoszsz--ugar = Erbsenfeld, haima/hagyma = Zwiebel, fokhaima/fokhagyma<br />
= Knoblauch, kápuszta/ káposzta = Kraut, Kohl, kápuszta-fei/káposztafej = Kohlkopf,<br />
kereláb/karalábé = Kohlrübe, leese/lencse = Linse, murak/murok = Mohrrübe, peszternáp = Pastinake,<br />
petrezeljem,petrenzeljem /petrezselyem = Petersilie, pitjóka/pityóka = Kartoffel, pitjókász-föld =<br />
Kartoffelacker, pop-mon = blaue Tomate [d.h. Aubergine] (heute eher: pǎtlǎgicǎ vânǎtǎ (r/a), retek = Rettich,<br />
szaláta/ saláta = Salat (heute: száláta), szószka/sóska = Sauerampfer, tszékla/cékla = rote Rübe, ugarka/uborka<br />
= Gurke, ugarkász = Gurkenaker, Gurkenhändler.<br />
Es ist erwähnenswert, dass es für den Begriff ’Petersilie’ zwei Varianten gibt: während die<br />
eine, die Variante petrezeljem nur geringfügig von der Lautform der ungarischen<br />
Standardsprache petrezselyem abweicht, nähert sich die Variante petrenzeljem der<br />
rumänischen Lautform petrunjel an.<br />
Péter Halász (2002: 179) gemäß „bezeichnen die Tschangos die ’Tomate’ mit dem älterem<br />
rumänischen Wort patlagică; die neuere – von den Rumänen allgemein gebrauchte – Bezeichnung<br />
roşie haben sie nicht übernommen.”<br />
Die Bezeichnung für ’Tomate’ in Szabófalva lautet: pǎtlǎgicǎ roşie (wortwörtl.: „rote<br />
Tomate”).<br />
In Szabófalva ist die alte tschango-ungarische Bezeichnung für die ’Aubergine’: pop-mony/<br />
padlizsán = blaue Tomate [d.h. Aubergine] (wortwörtlich: „Priester-Hoden”) zwar noch<br />
bekannt, das rumänischsprachige Äquivalent pǎtlǎgicǎ vânǎtǎ (wortwörtl. „blaue Tomate”)<br />
wird aber eher gebraucht.<br />
46
Das rumänische Wort beginnt somit, die ungarische Entsprechung zu verdrängen, womit der<br />
Ausdruck pop-mony ein Wort aus der Kategorie r/a darstellt.<br />
Der Verlust des (tschango-) ungarischen Wortes ist somit nur noch eine Frage der Zeit.<br />
Die Moldauer Ungarn kennen aber noch eine weitere Bezeichnung für die ’Aubergine’:<br />
vinete. Dieses rumänische Lehnwort gilt als Bestandteil der regionalen ungarischen<br />
Umgangssprache Rumäniens und wird so zum Beispiel auch von den Ungarn Siebenbürgens<br />
verwendet – obwohl diese theoretisch auch dessen ungarischsprachigen Äquivalente wie<br />
törökparadicsom oder kékparadicsom kennen.<br />
Außerhalb der Moldau verbreitete sich der Konsum dieser Gemüseart – durch rumänische<br />
Vermittlung – im Grunde genommen erst nach dem 1. Weltkrieg.<br />
Folgende – Gemüsearten bezeichnende – rumänische Lehnwörter sind bekannt:<br />
ardei/zöldpaprika = Paprika, bosztán/tök = Kürbis, tszélina/zeller = Zellerie<br />
Weiterhin bekannt ist auch die folgende hybride Bildung:<br />
bosztám-mog = Kürbiskern<br />
gebildet aus:<br />
bosztán < (rum.) bostan = Kürbis + mog/mag = Kern<br />
Die aus Amerika stammende Paprika lernten die in der Moldau lebenden Ungarn erst relativ<br />
spät – zusammen mit der rumänischen Bezeichnung ardei – kennen und gebrauchen diese<br />
Benennung auch bis zum heutigen Tag, was vor allem bei den Nord-Tschangos der Fall ist.<br />
Die interethnischen Beziehungen zwischen Ungarn und Rumänen zeigen sich auch in der<br />
Sprache, was u.a. auch daran deutlich wird, dass ein und derselbe Begriff in der ungarischen<br />
Sprache durch ein Wort rumänischer Herkunft, in der rumänischen Sprache wiederum durch<br />
ein Wort ungarischer Herkunft bezeichnet wird. Um nun bei der Paprika zu bleiben:<br />
„Während in Gyímeslok (Komitat Csík) die ’gefüllte Paprika’ als tüötöt árdéj (< rum. ardei)<br />
bezeichnet wird, wird diese in einem rumänischen Dorf des Komitats Máramaros als popricǎ<br />
(
Als Bezeichnung für die Paprika ist übrigens auch bei den Ungarn Siebenbürgens das rumänische<br />
Lehnwort árdé allgemein gebräuchlich – obwohl ihnen auch das Äquivalent der ungarischen<br />
Standardsprache: paprika bekannt ist.<br />
Mit dem Gartenbau beschäftigen sich – den Regeln der klassischen Arbeitsteilung gemäß –<br />
vor allem die Frauen. Damit sind wir auch beim nächsten Themenbereich angekommen, der<br />
die mit dem Gartenbau und den Gartengeräten verbundenen sprachlichen Ausdrücke<br />
vereinigt.<br />
Bekannte ungarische Wörter:<br />
gané/ganéj,ganaj = Unrat,Müll (im Zimmer,auf dem Hof);Dünger, ganél/ganaloj = misten, ganez, heute:<br />
ganissz/ganéjos,trágyáz = gedüngt, gereble/gereblye = Rechen,Harke, gereblel/gereblyél = rechen,harken,<br />
gödör = Grube (auch Grab,Tal), kapa,ászó-k. = Hacke,Haue,Hacke zum Graben, kasza = Sense, kasza-kı/<br />
kaszakı = Sensenwetzstein, kasza-nyél/kaszanyél = Sensenstiel, kert = Umzäunung, Zaun, Garten, kertel =<br />
einen Zaun machen,umzäunen, mágla/máglya = Haufen,Stoss, termik/terem = wachsen, gedeihen, tüzel =<br />
heizen,feuern, niér/nyír = scheren,schneiden, ólt/olt = impfen (einen Baum), vet = säen, vizitı/öntözı =<br />
Bewässer, Gieskanne.<br />
Auch die Bezeichnungen der mit dem Gemüseanbau verbundenen Tätigkeiten sind erhalten<br />
geblieben:<br />
djomlál = jäten, fészkel = pflanzen, setzen (Kartoffeln, Bohnen, Melonen), haimaz/hagymáz = Zwiebeln<br />
einsammeln, kapál = hacken, kapáló = zu behackend, zu häufeln, karóz = pfählen, Pfähle in die Erde<br />
einschlagen, palánt/palánta = Pflänzling, palántál/plántál = pflanzen vái/váj = wühlen, graben (in der Erde).<br />
Bekannte rumänische Lehnwörter:<br />
galiba (rum.baligă)/trágya = Mist,Kot (des Viehs), szufla (rum.şuflă) /ásó = Schaufel<br />
Im folgenden – aus einem einheimischen, (tschango)ungarischen Wort und einem<br />
rumänischen Lehnwort bestehenden – Synonymenpaar sind beide Elemente bekannt:<br />
galiba (rum.baligă)/trágya = Mist,Kot (des Viehs)<br />
→ bekannt<br />
gané/ganéj,ganaj = Unrat,Müll(im Zimmer,auf dem Hof);Dünger → bekannt<br />
Zwischen den beiden Elementen unterschiedlicher Herkunft liegt eine Bedeutungsdifferenzierung<br />
vor, was zum Erhalt des (tschango)ungarischen Wortes beigetragen hat.<br />
Im folgenden Beleg hat ein Lautwandel stattgefunden:<br />
ganez/ganéjos,trágyáz = gedüngt → ganissz<br />
48
Der folgende Ausdruck ist nicht mehr bekannt:<br />
kasza-mankó = Handhabe (f.die rechte Hand)am Sensenstiel<br />
Die Gewürzpflanzen kommen in der Moldau häufig zur Anwendung, wobei das Pfefferkraut,<br />
der Dill sowie der Liebstöckel besonders beliebt sind.<br />
Die (auch) in Szabófalva gebräuchliche Bezeichnung leustyán ’Liebstöckel’ (< rum. leuştean)<br />
ist im Wörterbuch Wichmanns zwar nicht belegt, doch ist diese Gewürzpflanze auch hier<br />
gebräuchlich und ist besonders in den – als örtliche Spezialität geltenden – sauren<br />
Suppenarten wie zum Beispiel der tsibri, einer „sauren Suppe aus Mais- und Weizenkleie und<br />
Wasser” anzutreffen.<br />
Der Dill und das Pfefferkraut wachsen zwar wild in den Gärten, zusätzlich werden sie aber<br />
auch ausgesät. Im Sommer werden sie in frischer Form, im Winter in getrockneter Form<br />
verwendet und werden weiterhin auf den Marktplätzen der umliegenden Städte zum Verkauf<br />
angeboten.<br />
Bekannte ungarische Wörter:<br />
bors = Pfeffer, borsol/borsóz= pfeffern, borsos/borsós = gepfeffert, borso-örlö = Pfeffermühle, bors-szem =<br />
Pfefferkorn, buszujok/bazsalikom = Basilienkraut kapar/kapor = Dill, kömiény, kömién/kömény = Kümmel,<br />
ruzmálin/rozmarin = Rosmarin, sombor/csombor = Pfefferkraut.<br />
Bekanntes rumänisches Lehnwort:<br />
buszujok/bazsalikom (rum. busuioc) = Basilienkraut<br />
2.4. Sachgruppe der Obstarten und des Obstanbaues<br />
Fast in jedem Reisebericht über die Moldau findet die mannigfaltige landwirtschaftliche<br />
Kultur – und somit auch der Obstanbau – besondere Erwähnung. Mit Bewunderung berichtet<br />
man über die ertragreiche Ernte und hebt die zahlreichen Obstarten – ob diese nun<br />
wildwachsende oder kultivierte sind - hervor. Die natürlichen Verhältnisse dieser Gegend<br />
schufen die idealen Bedingungen für den Obstanbau. Das Obst war nicht nur ein gesundes<br />
Lebensmittel, sondern stellte für einige Dörfer eine wichtige Einnahmequelle dar.<br />
In den Dörfern um die Stadt Roman – so auch in Szabófalva – wird dagegen weniger Obst<br />
angebaut; dieses dient eher zur Bedarfsdeckung der einzelnen Familien und wird nicht zum<br />
Verkauf angeboten. Ein eventueller Überschuss wird gedörrt.<br />
49
Bekannt sind die folgenden ungarischen Wörter und Ausdrücke:<br />
alma = Apfel, almaska = Äpfelchen, ért alma = reifer Apfel, piraszka-alma = roter Sommerapfel; aszal/aszal =<br />
Dürren (Obst), asalvan/aszalvány = Dürrobst, bor-almo/”boralma” = Most von Apfeln, djinnye/dinnye =<br />
Zuckermelone, djiennies/dinnyés = Melonenfeld, djio/dió = Nuss, djio-biel/dióbél = Nusskern, djio-fa/diófa =<br />
Nussbaum, djio-hei/dióhéj = Nussschale, epere/eper = Erdbeere, eperes/epres = reich an Erdbeeren, eperiez/<br />
eprészik = Erdbeeren sammeln, ereget/éreget = reif werden, eretlen/éretlen = unreif, ierik/érik = reifen,<br />
erit/érlel = zur Reife bringen, foszóka/”fosóka” zöld, éretlen szilva, heute: fosika = eine Art Pflaume (soll ein<br />
gutes Abführmittel sein), füge = Feige, körte = Birne, mák = Mohn, medj/meggy = Weichsel, oltawán/oltovány<br />
= Pfröpfling, óltó/oltó = Labmagen, piépiészsz heute: pipéssz/pépes = reif u.weich,breiig,musig (z.B.von der<br />
Birne), seresnye/cseresznye = Kirsche, seresnye-fa/cseresznyefa = Kirschbaum, seresnye-mog/cseresznyemag =<br />
Kirschkern , hólagas seresnye/hólyagos cseresznye = eine Kirschenart (wahrsch. Cerasum Julianum),<br />
seresnyészsz- = Kirschen-, aus Kirschen verfertigt (z.B. eine Speise).<br />
Folgende rumänischen Lehnwörter sind bekannt:<br />
agud/fai eper (rum. agud) = Maulbeerbeum, zarzár/szilva (rum. zarzăr) = Prunus armenica , bungur/éretlen<br />
gyümölcs (rum. bungur) = unreife Frucht o. Beere .<br />
Das Phänomen des Lautwandels zeigen folgende Belege:<br />
foszóka/”fosóka”zöld, éretlen szilva = eine Art Pflaume → fosika<br />
(soll ein gutes Abführmittel sein)<br />
piépiészsz /pépes = reif u.weich, breiig, musig (z.B.von der Birne) → pipéssz<br />
Nicht mehr bekannt sind:<br />
mezge/mézga =Baumsaft, mezgiész/mézgás = saftig (vom Baum im Frühling), semetje/semete = Spross,<br />
Setzling, Wilding<br />
2.5. Sachgruppe des Weinanbaues<br />
Die Moldau gilt schon seit Jahrhunderten als berühmtes Weinanbaugebiet. Die edlen Weine<br />
galten als wichtiges Exportgut und wurden weltweit geschätzt.<br />
Die Anfänge des Moldauer Weinanbaues führen uns in die entferntere Vergangenheit.<br />
In diesem Zusammenhang können wir uns auf den Codex Bandinus (1646-1648) stützen, aus<br />
dem wir folgendes über die Gründung der Stadt Kuthnar (ung. Kotnár, rum. Cotnari) erfahren:<br />
„Es wird erzählt, dass die Stadt Kuthnar ihren Namen dem Anpflanzer der ersten Moldauer<br />
Weinstöcke verdanke. Einst musste diese Provinz nämlich Steuern an den König von Ungarn<br />
entrichten. Zu jener Zeit geschah es nun, dass der Woiwode der Moldau den ungarischen<br />
König in Buda besuchte, wo er – von den erlesenen Weinen kostend – sein Bedauern darüber<br />
ausdrückte, dass in der Moldau – trotz der Fruchtbarkeit des Bodens – kein Wein gedeihen<br />
würde. Deshalb bat er den König um einen Mann, der viel von der Kunst des Weinanbaues<br />
50
verstehen würde und bekam diesen auch in der Person eines Deutschen namens Gutnar.<br />
Dieser bereiste – im Auftrag des Woiwoden – die gesamte Moldau, um dort für den<br />
Weinanbau geeignete Berge und Hänge zu finden (…) In Erwartung einer ertragreichen Ernte<br />
wurden Weinreben eingepflanzt und Hütten gebaut (…)“ (zitiert in: Domokos 2002: 413).<br />
Auf jeden Fall waren es also sächsische und ungarische Winzer, die die Grundlagen für den<br />
Weinanbau in der Moldau schufen und im großen Maße auch an dessen Aufschwung beteiligt<br />
waren.<br />
Auch heute noch verfügt fast jeder Moldauer Landwirt über einen eigenen Weingarten.<br />
Mit der Weinlese beginnt man in der Moldau gewöhnlich Mitte Oktober, wobei der Brauch<br />
der gemeinsam geleisteten Traubenernte kaum bekannt ist (siehe Halász 2002: 197).<br />
Weiterhin ist dieses Ereignis hier nicht – wie bei den Ungarn des Karpatenbeckens – mit<br />
Weinlesefesten und -bällen verbunden.<br />
In dieser Sachgruppe finden sich – außer der Bezeichnung eines Pflanzenschädlings –<br />
keine rumänischen Lehnwörter. Der Internationalismus filokszera / filoxéra (rum. filoxeră)<br />
= Reblaus, Phylloxera geriet durch rumänische Vermittlung in den Tschango-Dialekt.<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts vernichtete die Phylloxera den gesamten unveredelten<br />
Traubenbestand der Moldau.<br />
Folgende ungarische Wörter sind bekannt:<br />
bor = Wein, borosz-hardó / boroshordó = Weinfass, borosz-pahar / borospohár = Weinglas, boroszko /<br />
borocska = ein Trunk Wein, boroz = Wein trinken, borozgot / borozgat = immerfort Wein trinken, szıllı =<br />
Weintraube, szıllı-gerezd = Traube, szıllı-in = Weinranke, szıllısz / szıllıs = Weingarten.<br />
Nicht mehr bekannt sind:<br />
boroszul, meg.-b. / borosul = vom Wein betrunken werden, szıllı-alla = Abhang des Weingartens, vinike /<br />
venyige = Wildrebe.<br />
2.6. Sachgruppe der Leinen-, Hanf- und Baumwollverarbeitung<br />
Sämtliche ungarische Wörter dieser Sachgruppe sind auch heute noch bekannt:<br />
djapat/gyapot = Baumwolle, kender = Hanf, kender-ásztató-tó = Hanfröste, kender-fei = Hanfgarbe, kendermog/kendermag<br />
= Hanfsamen, kender-oloi/kenderolaj = Hanföl, len-mog/lenmag = Flachssame, len = Flachs,<br />
Lein, tépül = gerissen o.gezupft werden (vom Hanf).<br />
51
Die Kolonialware Baumwolle erreichte die Tschangos auf demselben Wege wie der Kaffee:<br />
vom Hafen GalaŃi aus, durch kaufmännische Vermittlung.<br />
„Mit dem aus den Zeiten vor der Landnahme stammenden, ungarischen Wort kender<br />
– Lehnwort aus dem Alttürkischen – (...) wird praktisch auf dem gesamten ungarischen<br />
Sprachgebiet [der Moldau] die ’Cannabis sativa’ bezeichnet. (...) Das rumänischsprachige<br />
Äquivalent cînepa wurde nur – zumindest Anfang der 50er Jahre – in 3 der in den<br />
„Sprachatlas der Moldauer Tschango-Mundart” (Gálffy – Márton – Szabó T. 1991: 349)<br />
aufgenommenen 94 Tschango-Siedlungen verwendet, wobei sich diese übrigens schon in der<br />
Endphase des sprachlichen Assimilationsprozesses befanden (...)” (Halász 2002: 289).<br />
Auf die obige Sachgruppe wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit – innerhalb der<br />
Ausführungen zum Hausgewerbe – noch näher eingegangen werden.<br />
2.7. Zusammenfassug:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 372 Wörter machen 6, 19 % des<br />
Gesamtwortschatzes aus (6007 Wörter)<br />
- 56 der 372 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 15, 05 % bedeutet<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die aus zwei Elementen (tschango-ungarisches Wort und rumänisches Lehnwort)<br />
bestehenden Synonymenpaare/Dubletten mit bzw. ohne vorliegender Bedeutungsdifferenzierung:<br />
djérszég/gyérség = Lichtung im Walde - poiána(rum.poiană) /erdei tisztás = Waldwiese<br />
akátsz/akác = Akazie - szálkim (rum. salcâm) = Akazie<br />
gané/ganéj,ganaj = Unrat,Müll - galiba (rum.baligă)/trágya = Mist,Kot (des Viehs)<br />
Müll (im Zimmer,auf dem Hof);Dünger<br />
2.) die Paläologismen:<br />
eke-kabila = eine gabelige Baumstellung zum Transport des Pfluges, járam/járom = Joch, járam –<br />
fa/járomfa = Joch, járam-páltsza = Jochstecken, tjágató/ cságató = ein krummer Holzbogen am<br />
Pflug zum Richten des Pfluges, tjágató-szeg = ein Nagel am Steuerbogen des Pfluges<br />
3.) die hybriden Bildungen aus rumänischen Entlehnungen und einheimischen,<br />
(tschango)ungarischen Wörtern:<br />
katjina-sipke = Cuscuta europaea, kidjó-süperke = eine giftige Schwammart ( klein, gelb, weiss,<br />
giftig), eke-tjelaga = Pflugkarren, nyomtotó-miészina = Dreschmaschine, pui-pili = Maisblatt, die Hülle des Maiskolbens<br />
bosztám-mog = Kürbiskerrn<br />
4.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
ganez = gedüngt heute: → ganissz<br />
foszóka = eine Art Pflaume<br />
(soll ein gutes Abführmittel sein) heute: → fosika<br />
piépiészsz = reif u.weich, heute: → pipéssz<br />
breiig,musig (z.B.von der Birne)<br />
52
5.) das Phänomen der Bedeutungsverdunkelung:<br />
ruza/rózsa = Rose heute: → - nur als Personenname bekannt<br />
- kommt in Volksliedern vor<br />
Dieser Pflanzenname war bereits zu Zeiten Wichmanns (1906/1907) veraltet und verschwand somit schon<br />
damals aus dem aktiven Wortschatz; aus seinen Aufzeichnungen wird deutlich, dass dieses Wort nur in<br />
Volksliedern vorkam, in denen es höchstwahrscheinlich nur automatisch – ohne die Bedeutung zu kennen –<br />
verwendet wurde.<br />
Besonderheiten anderer Art:<br />
- Untersuchung der sprachlichen Aspekte der interethnischen Beziehungen zwischen<br />
Ungarn und Rumänen:<br />
ardei/zöldpaprika = Paprika<br />
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt<br />
Pop-mony/<br />
vinete= blaue<br />
Tomate [d.h.<br />
Aubergine]<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
Atlas<br />
(1949-1952)<br />
+<br />
kein Beleg<br />
vorhanden<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
0 ██∼▓▓<br />
Grafische Darstellung des<br />
Prozesses<br />
akátsz/akác<br />
=Akazie<br />
+ - - ██░░░░<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes ist<br />
nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
3. Themenbereich der Tiere und der Viehzucht<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 255 Wörter machen 4, 25 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
(Szabófalva) aus. 34 der 255 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 13, 33 %<br />
bedeutet.<br />
53
Im folgenden werden wir die zu diesem Themenbereich gehörenden Sammelbezeichnungen,<br />
die Sachgruppen der freilebenden Tiere und Parasiten, der Haus- und Zuchttiere bzw. die mit<br />
der Viehzucht verbundenen Wörter und Ausdrücke näher behandeln.<br />
Innerhalb dieses Themenbereiches sind folgende ungarische Sammelbezeichnungen<br />
bekannt:<br />
abrak = Getreide,Viehfutter, bogar/bogár = Käfer, etel/étel = Futter,Viehfutter, hal = Fisch, madár = Vogel,<br />
marha = Rindvieh,Vieh (auch die Pferde), vad = Wild.<br />
3.1. Sachgruppe der freilebenden Tiere und Parasiten<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
béka = Frosch, daraz/darázs = Wespe, djek/gyík, egier/egér = Maus, egier-fogo = Mausefalle, farkasz/farkas<br />
= Wolf, farkasz-gödör = Wolfsgrube, farkas-madár = ein Vogel, fereg/féreg , egér = Maus, feske/fecske =<br />
Schwalbe, feske-fések/fecske-fészek = Schwalbennest, filesz/füles,nyúl = Hase, filigomaso/fülbemászó, heute:<br />
filjokamászó = Forficula auricularia, für/fürj = Wachtel, galamb, heute: golomb = Taube, gadjáz-g = Trommeltaube,<br />
gören/görény = Iltis, handja/hangya = Ameise, lapasz-tetü/lapostető = Filzlaus, ledj/légy = Fliege,<br />
ló-tetü = Werre, menét/menyét = Wiesel, medve = Bär, mól/moly = Motte, ökör-szem = Bachstelze, palatszk,<br />
MTsz: palacka/poloska = Wanze, pánk/pók = Spinne, pánk-háló/pókháló = Spinnengewebe, pillangó =<br />
Schmetterling, szárnyaszsz-egiée/denevér = Fledermaus, szarvasz/szarvas = gehörnt, Hirsch, szarvasz-bogár =<br />
Hirschkäfer, szeregiér/ seregély = Star, siri-bogár/ cserebogár = Maikäfer, sóka/csóka = Dohle, stjuka/csuka<br />
Hecht, tetü = Laus, ülü/ölyü= Habicht, ψüseg/prüccsök = Grille.<br />
Interessant ist der Auslaut des Lexems pánk/pók = Spinne, in dem – im Gegensatz zur<br />
ungarischen Standardsprache – die finnougrische Lautverbindung -nk bewahrt wurde.<br />
Anstatt des standardsprachlichen nyúl finnougrischer Herkunft ist filesz/ füles,nyúl = Hase<br />
gebräuchlich, das von fil/fül = Ohr abgeleitet wurde. Gábor Lükı (2002: 69) gemäß „ist diese<br />
Bildung in psychologischer Hinsicht mit den Tierbezeichnungen farkas ’Wolf’ [wortwörtl.<br />
„(Tier) mit Schwanz”] und szarvas ’Hirsch’ [wortwörtl. „(Tier) mit Geweih”] identisch, und<br />
erklärt sich aus dem Aberglauben der Jäger, der besagt, dass der Name des Wildes nicht<br />
ausgesprochen werden dürfe, da dieses [die Absicht des Jägers erkennen] und dem Jäger<br />
ausweichen würde (Worttabu). Die Wildarten wurden deshalb immer nur nach ihren<br />
auffälligsten Eigenschaften benannt; ihre ursprünglichen bzw. ererbten Namen wurden<br />
vermieden und gerieten so in Vergessenheit.”<br />
Die Erscheinung des Lautwandels wird anhand folgender Belege deutlich:<br />
filigomaso/fülbemászó = Forficula auricularia → filjokamászó<br />
galamb = Taube → golomb<br />
54
Bekannte rumänische Lehnwörter:<br />
girgiritsza (rum. gărgăriŃă) = Kornwurm, kikiridza = ein Ungeziefer in der Schafwolle,momitsza/majmocska<br />
(rum. maimuŃă) = Affe, muszitsza/muslica (rum. muşiŃă) = Weinmücke, pitszigui (rum. piŃigoi), heute: picigoi =<br />
Meise, pupudza (rum. pupăză ) = Wiedehopf, sóra/varjú (rum. cioară ) = Krähe, tszintszár/szúnyog (rum.ŃînŃar)<br />
= Mücke, veweritsza, viviridza (rum.veveriŃă)/mókus = Eichhörnchen, vidra (rum. vidră) = Fischotter.<br />
Bekannt ist weiterhin folgende hybride Bildung:<br />
vag-guzgán/vakond = Maulwurf:<br />
gebildet aus:<br />
vag/vak = blind + guzgán < (rum.) guzgan = Maulwurf; Ratte<br />
Nicht bekannt sind die folgenden Tierbezeichnungen: bika-szem = Zaunkönig, bogol/bagoly =<br />
Eule, fitszik = Larve, holló = Rabe, kiliis/kullancs = Zecke, sziél-baszó MTsz: szélbaszó = eine kleine Falkenart,<br />
róka = Fuchs (laut Sprachmeister: heute als Familienname bekannt), szászka/sáska = Heuschrecke, szırdisznó/sőndisznó<br />
= Igel, szui/szú = Holzwurm, silláa-sóg = ein sehr kleines Vogel, simmasz/ csimasz = die<br />
Larve des Maikäfers, tarka-iézusz = Elster (scherzhaft: der” bunte Jesus”), vizi-boriu/víziborjú = Salamander.<br />
Die Lexeme róka = Fuchs, szui/szú = Holzwurm und szır-disznó/sőndisznó = Igel sind – wie<br />
anhand der Szabófalver Belege des „Sprachatlas der Moldauer Tschango Mundart” deutlich<br />
wird – schon seit den 1950er Jahren nicht mehr bekannt.<br />
Das Lexem róka = Fuchs ist ein Beispiel dafür, dass die Bedeutung eines Wortes zwar nicht<br />
mehr bekannt ist, das Wort selbst aber als Eigenname – in unserem Fall als Familienname –<br />
im Sprachbestand erhalten geblieben ist.<br />
Vergleicht man das Lexem szır-disznó/sőndisznó = Igel mit dessem rumänischsprachigen<br />
Äquivalent arici und zieht dabei die Wortlänge in Betracht, könnte beim Verlust des<br />
(tschango)ungarischen Wortes auch der Faktor der Sprachökonomie eine gewisse Rolle<br />
gespielt haben.<br />
3.2. Sachgruppe der Haus- und Nutztiere<br />
Wie anhand des Codex Bandinus (1646-1648) oder der 1771 erschienenen „Historischgeographische(n)<br />
und politische(n) Beschreibung der Moldau” von Dimitrie Cantemir<br />
deutlich wird, war die Moldau schon im 17. bzw. 18. Jahrhundert berühmt durch ihre Rinderund<br />
Pferdezucht, wobei auch die Schaf- und Schweinezucht von Bedeutung waren.<br />
55
Im 18. Jahrhundert wurden – als wichtigste Exportgüter – jährlich ungefähr 20.000 Rinder<br />
und 5-6.000 Pferde nach Schlesien, Mähren und Brandenburg transportiert (siehe Dorinel<br />
Ichim 1987: 28, zitiert in: Halász 2002: 206). Für den Transport der Rinder nach Nord- und<br />
Westeoropa waren zu jener Zeit armenische und sächsische Händler aus Kronstadt (ung.<br />
Brassó, rum. Braşov) zuständig. Übrigens zeugt auch das rumänische Wort für ’Ware’: marfǎ,<br />
das sich auf ung. marha ’Ware; Rind, Vieh’ zurückführen lässt (siehe: Lajos Tamás 1966,<br />
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen) von der<br />
großen Bedeutung, die der Rinderhandel im Mittelalter innehatte.<br />
Mit der Rinderzucht haben sich eher die Moldauer Ungarn, mit der Pferdezucht eher die<br />
Moldauer Rumänen beschäftigt (siehe Halász 2002:207). In denjenigen Tschango-Siedlungen<br />
wiederum, die in der Nähe der Städte und Handelswege lagen, gewann naturgemäß die<br />
Pferdezucht an Gewicht, um sich so am Geschäft des Gütertransportes zu beteiligen.<br />
Als Zugtier kam vorwiegend das Rindvieh zum Einsatz, wobei wir auch über solche Quellen<br />
verfügen, die zeigen, dass – wie zum Beispiel in unserem Untersuchungsdorf Szabófalva – in<br />
diesem Bereich eher das Pferd eingesetzt wurde.<br />
Péter Erdıs Szászka, der Chronist von Szabófalva, äußert sich folgendermaßen zu diesem<br />
Thema:<br />
„Zur Bodenbestellung haben die Leute aus Szabófalva schon immer Pferde eingesetzt, mit<br />
denen sie gepflügt haben, da hier bei uns nie Ochsen, nur Pferde gehalten wurden und wenn<br />
sich einmal trotzdem jemand fand, der ein Rind vor den Karren spannte, lachte das ganze<br />
Dorf über ihn.”<br />
[Hogy dolgozák a földet a szabófalvi emberek öröké egés tartat lovokot, amelyekvel<br />
szántotok, mert itt nálunk soha nem tartatak ökröket, csak lovokot, s ha valaki bekötte, betete<br />
járomba tején az szarvas marhát, hogy huzon a kocsinál, egész ıt kacagta.” ]<br />
(Erdıs Szászka 1994: 64, zitiert in: Halász 2002: 210)<br />
Gleichzeitig ist aber – gerade in Szabófalva – das Lexem ökrösz-szekiér’/ökrösszekér =<br />
Ochsenwagen auch heute noch bekannt.<br />
Bis heute werden in fast jedem landwirtschaftlichen Betrieb mindestens eine Kuh sowie 1-2<br />
Schweine gehalten, die vor allem den Milch- und Fleischbedarf der Familie decken sollen.<br />
Die Geflügelzucht ist die Aufgabe der Frauen. Auch sie sind es, die die Hühner und Eier zum<br />
Markt bringen, wobei „nicht der Überschuss, sondern das gerade noch Entbehrliche” zum<br />
Verkauf angeboten wird, da es vor allem die Geldnot ist, die sie in die Markthallen zwingt.<br />
Folgende ungarische Wörter sind bekannt:<br />
barány/bárány, heute: bárján, bárjánka = Lamm, bihal/bivaly = Büffel, bihalas/bivalyos = Büffeleigentümer,<br />
bihal-szekiér/bivalyszekér = Büffelwagen, buriu/borju = Kalb, burius/borjas = Kuh mit Kalb, boriu-sordo/<br />
56
orjúcsorda = Kälberherde, boriuzik/borjazik = kalben, buriuzo,b.ünı/borjuzó tehén = trächtige Kuh, diszno/<br />
disznó = Schwein, iedj/jegy = Zeichen (z.B. am Ohr des Schafes), iedjes/jegyes = mit einem Zeichen versehen,<br />
namhaft ausgezeichnet(ein Schaf), fei,mek-f./fej = melken, feiös,fejjös-ünö/fejıstehén = Melkkuh, göle/gıje =<br />
Sau, házi filesz(házifüles)/házinyúl = Kaninchen, hizdaló-disznó/hízlaló(disznó) = Mastschwein, hizdaló-ökör/<br />
hízómarha = Mastvieh, hoisos/”hajszos” = der linke Ochs o. das linke Pferd, itató = Tränke, joho/juh = Schaf,<br />
kakasz/kakas = Hahn, katló/kotló = Bruthenne, keske/kecske = Ziege,Ziegenbock, keske-tszáp/bakkecske =<br />
Ziegenbock, kon/kan = Eber, kotkodásál/ kotkodácsol = gakern, kotol = brüten, kukurigólkukurékol = krähen<br />
(vom Hahn), kusa/kutya = Hund, ló = Pferd, maska/macska = Katze, nyierit/nyerít = wichern, ógat/ugat =<br />
bellen, ökör,hizdaló-ö./ökör = Ochs, Mastvieh, pipe = junges Gänschen, junge Ente, piszlen MTsz.pislen/csibe<br />
= Hünhen, Küken, piszlenke/kicsi csirke = kleines Hühnhen, poloz-mog = Lockei (im Hühnernest), riétsze/réce<br />
= Ente, rugósz/rúgós(pl. a ló) = leicht ausschlagend,stossend (vom Pferde), sitkó/csikó = Füllen, sitkósz/sikós,<br />
kabala = Stute mit Füllen, taréi/taréj = Hahnenkamm, tik-mony,tjukmany/tojás = Ei, toiik/tojik = Eier legen,<br />
toiósz/tojós = eierlegend, tulok = junger Stier (bis 2 Jahre), tulu/toll = Feder, tulusz/tollas = gefiedert, voll<br />
Federn, tulutlany/tollatlan = unbefiedert, tjász, tj.ló,tj.ökör = unter zwei vorgespannten Pferden das linke<br />
Pferd,der linke Ochs, tjöldj/tıgy = Euter, tjuk/tyúk = Henne, tjuk-fészek = Hühnernest, tszenk/kicsi kutya =<br />
Hündchen, ünı/tehén, amelyik már borjadzott = Kuh (die schon gekalbt hat).<br />
Auch solche Wörter sind uns hier erhalten geblieben, die in der ungarischen Standardsprache<br />
entweder überhaupt nicht mehr oder kaum noch bekannt sind wie zum Beispiel:<br />
Das Lexem tszenk/kölyökkutya = Hündchen, das „schon 1211 als Personenname vorkommt<br />
[und] aus der ungarischen Standardsprache und den meisten der Dialekte verschwunden ist”<br />
(Lükö 2002: 74).<br />
Das Lexem piszlen’MTsz.pislen/csibe = Hühnchen, Küken war früher im gesamten ungarischen<br />
Sprachgebiet verbreitet und kam als Personenname schon 1371 vor – wie wir von Lükı<br />
(2002: 75) erfahren. Das Lexem ’piszlenke’/kicsi csirke = kleines Hühnchen zeigt die für den<br />
Moldauer Tschango-Dialekt typische Diminutivableitung.<br />
„Das Lexem ünı ist ein aus der Zeit vor der Landnahme stammendes türkisches Lehnwort<br />
(...); mit diesem wurde im gesamten ungarischen Sprachgebiet bis zum Ende des 15.<br />
Jahrhunderts der Begriff ’vache, Kuh’ bezeichnet. Zu dieser Zeit beginnt es vom Lexem<br />
tehén, dessen ursprüngliche Bedeutung ’Rind, Rindvieh’ war, verdrängt zu werden. (...)<br />
Die Moldauer Ungarn wiederum kennen diese Bezeichnung überhaupt nicht und bezeichnen<br />
den Begriff ’vache, Kuh’ auch heute noch mit dem Lexem ünı” (Lükı 2002: 73).<br />
Die Lexeme ünı/tehén, amelyik már borjadzott = Kuh (die schon gekalbt hat), buriuzo,<br />
b.ünö/borjuzó tehén = trächtige Kuh sowie feiös,fejjös-ünö/fejıstehén = Melkkuh sind in<br />
Szabófalva bis heute bekannt geblieben.<br />
Im Wörterbuch Wichmanns ist das Lexem tehén nur in Hétfalu belegt, in Szabófalva<br />
wiederum ist es – wie auch von unserem Sprachmeister, Mihály Perka, bestätigt wird – nicht<br />
bekannt.<br />
Am folgenden Beleg zeigt sich das Phänomen des Lautwandels:<br />
barány/bárány = Lamm → bárján<br />
57
Folgende rumänische Lehnwörter sind bekannt:<br />
berbes (rum.berbec)/ berbécs (rum. berbec) = Schafbock, berbéses (rum.berbeceşte)/berbécses = der viel<br />
Widder hat, berbeske (rum. berbecuŃ)/bárány = Hammellam, giszka (rum. gâscă)/liba = Gans, harmaszár<br />
(rum.armăsar)/mén = Hengst, hirgilje(rum. herghelie) /hergely, ménes = Herde von Pferden, kurka<br />
(rum.curcan)/pulyka = Truthahn, kuska (rum.cuşcă)/ketrec = Käfig, magár (rum.măgar)/ szamár = Esel<br />
ogár(rum.ogar)/agár = Windhund, pleketór(rum. plecător)/ juh, amelyiket fejnek = Milchschaf, retszui<br />
(rum.răŃoi)/réce = Enterich, sztina (rum stână) = Hürde (zum Melken der Schafe), sztrunga (rum.strungă) =<br />
eingezäunter Platz an der Hürde zum Melken der Schafe, ziér (rum.vier) = Schwein (masc.),Eber.<br />
Den Ausdrucksreichtum und die Variationsbreite des Tschango-Dialektes zeigen die<br />
zahlreichen Synoyme, die alle erhalten geblieben sind:<br />
katló/kotló = Bruthenne → bekannt<br />
tjuk/tyúk = Henne → bekannt<br />
pipe = junges Gänschen, junge Ente → bekannt<br />
piszlen MTsz.pislen/csibe = Hühnchen, Küken → bekannt<br />
piszlenke/kicsi csirke = kleines Hühnhen → bekannt<br />
kusa/kutya = Hund → bekannt<br />
tszenk/kicsi kutya = Hündchen → bekannt<br />
burius/borjas = Kuh mit Kalb → bekannt<br />
buriuzo,b.ünı/borjuzó tehén = trächtige Kuh → bekannt<br />
feiös,fejjös-ünö/fejıstehén = Melkkuh → bekannt<br />
ünı/tehén, amelyik már borjadzott = Kuh (die schon gekalbt hat) → bekannt<br />
In den folgenden Synonymenpaaren, die aus einem einheimischen, (tschango)ungarischen<br />
Wort und einem bzw. mehreren Elementen rumänischer Herkunft bestehen, sind alle<br />
Elemente bekannt geblieben, was durch die Bedeutungsdifferenzierung erklärt wird:<br />
retszui (rum.răŃoi)/réce = Enterich → bekannt<br />
riétsze/réce = Ente → bekannt<br />
joho/juh = Schaf → bekannt<br />
berbes (rum.berbec)/ berbécs (rum. berbec) = Schafbock → bekannt<br />
berbeske (rum. berbecuŃ)/bárány = Hammellamm → bekannt<br />
pleketór(rum. plecător)/ juh, amelyiket fejnek = Milchschaf → bekannt<br />
In den folgenden Synonymenpaaren liegt keine Bedeutungsdifferenzierung zwischen den<br />
beiden Elementen unterschiedlicher Herkunft vor. Das ungarische Element ist aber trotzdem<br />
erhalten geblieben:<br />
58
ziér (rum.vier)/kandisznó = Schwein (masc.), Eber → bekannt<br />
kon/kan = Eber → bekannt<br />
Meistens aber wird in solchen Fällen das ungarische Element durch das rumänische verdrängt,<br />
wie auch folgende Beispiele zeigen:<br />
harmaszár(rum.armăsar)/mén = Hengst → bekannt<br />
tökösz/ménló = Hengst → nicht bekannt<br />
magár (rum.măgar)/ szamár = Esel → bekannt<br />
szamár = Esel → nicht bekannt<br />
Nicht mehr bekannt ist weiterhin das ungarische Wort: kantsza/kanca = Stute.<br />
Interessant hierbei ist, dass es auch durchaus vorkommen kann, dass Lehnwörter aus<br />
dem Rumänischen wie in unserem Beispiel: gotszán/malac (rum.goŃană) = Ferkel<br />
einschließlich dessen Diminutivableitung gotszánka/malacka = Ferkelchen nicht mehr<br />
bekannt sind.<br />
Hybride Bildungen sind auch im Themenbereich der Tiere nicht unbekannt:<br />
keske-tszáp = Ziegenbock<br />
gebildet aus:<br />
keske/kecske = Ziege + tszáp < (rum) Ńap = Bock<br />
giszka-tjuk-man/libatojás = Gänseei<br />
gebildet aus:<br />
giszka < (rum.) gâscă = Gans + tjuk-many[/(tyúk)tojás] = Ei<br />
Im idiomatisierten Kompositum tik-mony,tyuk-many/(tyúk)tojás = [Hühner]Ei ist die alte<br />
Bezeichnung für ’Ei’ mony erhalten geblieben, das finnougrischer Herkunft ist.<br />
„Seit dem 16. Jahrhundert bekam [es] eine unziemliche Bedeutung [’Hoden’], so daß man den<br />
notwendigen, alltäglichen Begriff mit neuen Ausdrücken zu benennen suchte wie tyúkhaszna<br />
59
„Hühnernutzen” und tojás, von denen sich letzteres, die Ableitung von tojni < tolyni < tolni<br />
„schieben”, als lebensfähig erwies” (Bárczi 2001: 303).<br />
Auffällig ist die Differenzierung der Geschlechtsakte der einzelnen Tierarten, die heute nur<br />
noch teilweise bekannt sind:<br />
isztjilödik/párosul a koca = sich paaren (die Sau) → nicht bekannt<br />
kotirsilódik/párosul a macska = sich paaren (von der Katze) → nicht bekannt<br />
mirnilódik/párosul a juh = sich paaren (von dem Schaf) → bekannt<br />
motosilódik/párosul a macska = sich paaren(von den Katzen) → nicht bekannt<br />
(rum. motoc, motan = Kater)<br />
pirsilódik MTsz. percselıdik/párosodik (madarak) = sich paaren, → bekannt<br />
sich begatten(sowohl von<br />
Menschen als von Tieren)<br />
Laut Sprachmeister Perka: nur von Vögeln<br />
puiilódik/párosul a kutya = sich paaren(von der Hündin) → nicht bekannt<br />
(rum. puiesc)<br />
szök, mek-szök/a bika meghágja = der Ochse besteigt die Kuh → bekannt<br />
a tehenet<br />
szökıdik/ált.párosulás,nem = sich paaren (im allg.,nur nicht von → bekannt<br />
a madaraknál<br />
den Vögeln)<br />
tipadódik/párosul a tyúk,liba,stb. = sich paaren → bekannt<br />
(von den Hühnern, Gänsen,u.ä.)<br />
üzıdik/párosul a tehén = sich paaren (von den Kühen) → bekannt<br />
3.3. Sachgruppe der mit der Viehzucht verbundenen Geräte<br />
Die ungarischen Wörter dieser Sachgruppe sind bekannt geblieben:<br />
abraas/abroncs = Reif, Bogen am Pferdegeschirr, darek-szeg/derékszeg = der eiserne Zapfen an der vorderen<br />
Wagenachse), hám = Pferdegeschirr, Siele, hámal/hámol = aus-, anschirren, kinga = Bauchgurt (des Pferdes),<br />
Querholz(z.B. an der Tür), nyüg/nyőg = Fussfessel (der Pferde), nyügez/nyőgöz = Fussfesseln anlegen, ökröszszekiér/ökrösszekér<br />
= Ochsenwagen, satalász/csatolás = Anspannen des Fuhrstrickes, sauar/csavar = drehen,<br />
winden,schrauben, patkó = Hufeisen.<br />
3.4. Sachgruppe der Bienenzucht<br />
Die Bienenzucht war für die Tschangos stets von großer Bedeutung: deren Produkte, der<br />
Honig und der Bienenwachs deckten zum einen den Eigenbedarf, waren gleichzeitig aber<br />
auch beliebte Tausch- und Verkaufsprodukte. Die erfolgreiche Bienenzucht wurde durch die<br />
natürlichen Gegebenheiten der Moldauer Region begünstigt.<br />
Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts lebten viele Bienenvölker im Freien, die durch<br />
Räucherungen vertrieben wurden, um so den Honig einsammeln zu können. Dieser wurde<br />
60
meistens für medizinische Zwecke eingesetzt – als Heilmittel gegen Schwindsucht, Erkältung<br />
bzw. Halsweh – spielte aber auch als Nahrungsmittel eine wichtige Rolle.<br />
Ein Teil des Bienenwachses war für den Eigengebrauch der Tschangos bestimmt, „für die<br />
kirchlichen Zeremonien und für ihre abergläubischen Praktiken. (...) Die Kerze fertigt jeder<br />
gewöhnlich zu Hause an. (...) Das am Montag und Freitag bestehende Handelsverbot des<br />
Bienenwachses und Honigs könnte mit der kultisch-magischen Verwendung des Wachses<br />
zusammenhängen” (Kós 1976: 132).<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind noch bekannt:<br />
küpü/köpü = Bienenstock, miéz/méz = Honig, nyiérı, küpü-nyiérı/”nyerı” = Schneidewerkzeug zum<br />
Ausschneiden und Herausnehmen der Honigwaben, rai/raj = Schwarm, bes. Bienenschwarm, raiasz/rajos = mit<br />
einem Bienenschwarm versehen (von dem Bienenstock), raizik/rajzik = schwärmen (v. den Bienen)<br />
Nicht mehr bekannt sind:<br />
lép = Honigwabe, léppeszsz/ lépes = mit vielen Honigwaben versehen (vom Bienenstock), léppeszül = sich mit<br />
Honigwaben füllen (vom Bienenstock)<br />
3.5. Sachgruppe des Fischfanges<br />
Der Fischfang bot den Bewohnern dieser gewässerreichen Region – vor allem den Ärmeren –<br />
eine wichtige Ernährungs-, Tausch- und Verkaufsquelle an. Die Fische wurden mit selbst<br />
angefertigten Netzen und Fischreusen oder – von den Kindern – mit bloßen Händen gefangen.<br />
Folgende ungarische Wörter – unter ihnen auch die Sammelbezeichnung hal= Fisch – sind<br />
bekannt:<br />
háló = Fischnetz, hal-para/”halpénz”,halpikkely = Fischschuppe, hal-szárn/”halszárny”, uszony = Schwimmflosse,<br />
karász/kárász = Karausche, rigile MTsz.regelye = gesunkener Baum im Fluss o.See,wo sich die Fische<br />
gern aufhalten<br />
Weiterhin bekannt ist auch das Lehnwort aus dem Rumänischen: stjuka (rum.ştiucă)<br />
/csuka = Hecht.<br />
Nicht mehr bekannt sind die ungarischen Wörter halász = Fischer und hal-sont/halcsont =<br />
Fischbein sowie die rumänischen Lehnwörter siga (rum. cigă) = Stör und virsze (vîrsă) =<br />
Fischreuse.<br />
61
Im folgenden Synonymenpaar sind beide Elemente unterschiedlicher Herkunft bekannt<br />
geblieben:<br />
ikra/ ikra = Rogen, Laich → bekannt<br />
ikre (rum. icre) = Rogen, Laich → bekannt<br />
Das ungarische Element ist dabei trotz aller widrigen Umstände (Ähnlichkeit der beiden Lautformen,<br />
keine Bedeutungsdifferenzierung) erhalten geblieben.<br />
3.6. Sachgruppe der Jagd<br />
Abgesehen von den sich gelegentlich ergebenden Erlegungen kleinerer Tiere, die durch Fallen<br />
und Schlingen bewerkstelligt wurden, hat die Jagd für die Tschangos nie eine große Rolle<br />
gespielt (siehe: Halász 2002: 23). Dies zeigt sich übrigens auch darin, dass das zu Zeiten<br />
Wichmanns geläufige Lexem vadázó/vadász = Jäger mittlerweile nicht mehr bekannt ist.<br />
Das zu dieser Sachgruppe zählende ungarische Wort urak/hurok = Schleise, Schlinge ist<br />
bekannt geblieben.<br />
Das ungarische Wort csapda ’Falle’ ist im Wörterbuch Wichmanns nicht belegt und ist auch<br />
heute – wie von unserem Sprachmeister, Mihály Perka bezeugt wird – nicht bekannt.<br />
3.7. Zusammenfassung:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 255 Wörter machen 4,25 % des Gesamtwortschatzes<br />
(6007 Wörter) aus.<br />
- 34 der 255 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 13,33 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die aus zwei oder mehreren Elementen bestehenden Synonymenpaare mit bzw. ohne<br />
vorliegender Bedeutungsdifferenzierung:<br />
katló/kotló = Bruthenne - tjuk/tyúk = Henne<br />
pipe = junges Gänschen, junge Ente - piszlen MTsz.pislen/csibe = Hühnchen, Küken - piszlenke/kicsi csirke = kleines Hühnhen<br />
kusa/kutya = Hund - tszenk/kicsi kutya = Hündchen<br />
burius/borjas = Kuh mit Kalb - buriuzo,b.ünı/borjuzó tehén = trächtige Kuh - feiös,fejjös-ünö/fejıstehén = Melkkuh - ünı/tehén,<br />
amelyik már borjadzott = Kuh (die schon gekalbt hat)<br />
retszui (rum.răŃoi)/réce = Enterich - riétsze/réce = Ente<br />
joho/juh = Schaf - berbes (rum.berbec)/ berbécs (rum. berbec) = Schafbock - berbeske (rum. berbecuŃ) - barány/bárány = Hammellamm -<br />
pleketór(rum. plecător)/ juh, amelyiket fejnek = Milchschaf<br />
ikra/ ikra = Rogen, Laich - ikre (rum. icre) = Rogen, Laich<br />
ziér (rum.vier)/kandisznó = Schwein (masc.), Eber - kon/kan = Eber<br />
harmaszár(rum.armăsar)/mén = Hengst - tökösz/ménló = Hengst<br />
magár (rum.măgar)/ szamár = Esel - szamár = Esel<br />
62
2.) die hybriden Bildungen:<br />
vag-guzgán = Maulwurf, keske-tszáp/bakkecske = Ziegenbock, giszka-tjuk-man= Gǎnseei<br />
3.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
filigomaso/fülbemászó = Forficula auricularia heute: → filjokamászó<br />
galamb = Taube heute: → golomb<br />
barány/bárány = Lamm heute: → bárján<br />
4.) das Phänomen der Bedeutungsverdunkelung:<br />
róka = Fuchs heute: → nur als Familienname bekannt<br />
Besonderheiten anderer Art:<br />
- Im Gegensatz zur ungarischen Standardsprache ist im Auslaut des folgenden Lexems die<br />
finnougrische Lautverbindung –nk bewahrt worden:<br />
pánk/pók = Spinne, siehe auch: pánk-háló/pókháló = Spinnengewebe<br />
- Erhalt von Wörtern, die in der ungarischen Standardsprache entweder überhaupt nicht<br />
oder kaum noch bekannt sind:<br />
házi filesz(házifüles)/házinyúl = Kaninchen, piszlen MTsz.pislen/csibe = Hühnchen, Küken, piszlenke/kicsi csirke = kleines<br />
Hühnhen, tik-mony,tjukmany/tojás = Ei, tszenk/kicsi kutya = Hündchen, ünı/tehén, amelyik már borjadzott = Kuh (die schon<br />
gekalbt hat).<br />
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt:<br />
szui/szú =<br />
Holzwurm<br />
szır-disznó<br />
/sőndisznó =<br />
Igel<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
Atlas<br />
(1949-1952)<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
+ - - ██▒▒▒▒<br />
+ - - ██▒▒▒▒<br />
Grafische Darstellung des<br />
Prozesses<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes ist<br />
nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
63
4. Themenbereich des Hauses und des Hausgewerbes<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 573 Wörter machen 9, 54 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
(Szabófalva) aus. 92 der 573 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 16, 06 %<br />
bedeutet.<br />
Im Folgenden werden wir die Sachgruppen des Hauses und der häuslichen Umgebung, der<br />
häuslichen Einrichtung und des Hausgewerbes sowie die mit den häuslichen Tätigkeiten<br />
verbundenen Wörter und Ausdrücke näher behandeln.<br />
4.1. Sachgruppe des Hauses und der häuslichen Umgebung<br />
Dem heutigen Besucher Szabófalvas bietet sich – im Sommer des Jahres 2006 – das folgende<br />
Bild: neben den traditionellen bestimmen zahlreiche moderne Gebäude das Dorfbild, viele<br />
Häuser sind noch im Erbauungsstadium; Szabófalva scheint sich in einem Bauboom zu befinden.<br />
Die 1989er Revolution brachte es mit sich, dass viele im Ausland ihren Broterwerb<br />
suchten, so dass bis heute bereits mehr als 3000 Jugendliche bzw. junge Familien ihr Dorf<br />
verlassen haben, um vor allem in Italien als Gastarbeiter tätig zu sein. Viele dieser jungen<br />
Erwachsenen investieren einen Teil ihres Gehaltes in den Szabófalver Häuserbau.<br />
Infolgedessen finden sich zahlreiche Geschäfte, die eine reichhaltige Auswahl an modernen<br />
Baumaterialien anbieten. Durch den Häuserbau werden – vor allem im Sommer – für viele<br />
Dorfbewohner Arbeitsplätze geschaffen. Die Einrichtung der modernen Häuser entspricht<br />
meist dem Geschmack der heutigen Zeit. Ein ganz anderes – ausschließlich traditionelles –<br />
Dorfbild bot sich den Ethnologen Gábor Lükı und Károly Kós noch in den 30er bzw. 70er<br />
Jahren des 20. Jahrhunderts.<br />
Anhand ihrer Beschreibungen soll im Folgenden stichwortartig auf die auffälligsten Charakteristika<br />
des traditionellen Moldauer Tschango-Bauernhauses eingegangen werden.<br />
Dieser einfache Bautyp wird geprägt durch:<br />
1. keine Unterkellerung<br />
2. Isolierung durch töltész, eine Füllung von Erde oder Stein rings um den Grund des<br />
Hauses (siehe Wichmann 1936)<br />
3. niedrige Wände<br />
4. Rohr- bzw. Schilfdach<br />
5. Zwei – ineinander übergehende – Räume: Vorhalle und Wohnraum<br />
6. beheizt wird nur der Wohnraum, über den sich der Dachboden befindet<br />
64
Mit dem Häuserbau wurden früher keine Maurer beauftragt; die Häuser wurden gemeinschaftlich<br />
errichtet, wobei sich Nachbarn und Verwandte stets gegenseitig aushalfen.<br />
Die ältesten Häuser waren Holzhäuser, deren „Baumaterial vor 100-200 Jahren aus den bis in<br />
die Dörfer reichenden gewaltigen Wäldern beschafft wurde (…)“ (Kós 1976: 178).<br />
In dem Maße, wie der Waldbestand – vor allem infolge der Raubwirtschaft der Besitzer der<br />
nach 1918 errichteten Sägewerke – immer spärlicher und das Holz immer teurer wurde, gaben<br />
die Tschangos schrittweise den Holzbau auf und begannen, sich auf den Lehm-, später den<br />
Ziegelbau umzustellen.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind auch heute noch bekannt:<br />
ablak = Fenster, ablak-szem/ablakszem = Fensterglas, agasz/ágas = gegabelter Wandpfeiler eines Wohnhauses,<br />
aito,eito/ajtó = Tür, boronno/borona = Wandbalken, fal = Wand, Mauer, falaz,meg-f./falat épít = Wände<br />
errichten, mauern,felgen, fed,be-f./befıdi a tetıt = decken, zudecken (mit einem Dach versehen), fediél/fedél =<br />
Dach, Hausdach, fözö-hel = Kochstätte; Platz, wo man kocht, girinda/gerenda = Balken,Sparren,<br />
hákso/hágcsó,lépcsı = Treppe;Stiege(an der Umzäunung), hás-hiu/házhéj,padlás = Dachraum im Wohnraum,<br />
ház = Haus, házasz = der mehrere Häuser hat, házatlan = der kein Haus besitzt, házi- = zum Haus gehörig,<br />
Haus..., hiu,hijú/padlás = Dachboden, kamara = Kammer, kepu/kapu =Tor,Pforte, kepu-ágasz = Torpfosten,<br />
kert = Umzäunung, Zaun, Garten, kertel = einen Zaun machen,umzäunen, kós/kulcs = Schlüssel, kut/kút =<br />
Brunnen, kutágasz/kútágas = Brunnensäule, kürtü/kürt,kürtı = Horn, Trompete, langes Hirtenhorn(aus Holz);<br />
Schornstein, lakat = Vorhängeschloss, odvór/udvar = Herrenhof, pad = Bank, Brücke, padal,mek-p. = mit<br />
Dielen belegen, padlász/padlás = Dachboden, padló = Diele, Fussboden, petszek/”pecek” = Klinke,<br />
Türschnalle, Drücker, petszkel,bé-p.,ki-p./peckel = (vermittels der Klinke)zumachen o.aufmachen(die Tür),<br />
pintsze/pince = kleiner Keller, szin/tornác,folyosó = Hausflur,Vorhalle, torondj/torony = Turm, töltész/töltés =<br />
Füllung von Erde od. Stein rings um den Grund des Hauses, tüsz-hel/tőzhely = Feuestätte, Feuerherd (im allg.),<br />
udvar,utvar = Hof, zendel ,endel/ zsindely = Dachschindel.<br />
Bekannt sind auch folgende rumänische Lehnwörter:<br />
borde (rum. bordeiu)/kunyhó,viskó = Erdhütte, buketerie(rum. bucătărie)/konyha = Küche, huruba/pince =<br />
grosser unterirdischer Keller (f. Kartoffeln, Wein), karamida, heute: karmida (rum.cărămidă)/tégla = Ziegel,<br />
korda (rum.coardă)/mestergerenda = Tragbalken, kort (rum.cort)/sátor = Zelt, odáje (rum. odaie, cameră)/szoba<br />
= Zimmer, ográda (rum.ogradă)/udvar = Hof, Hofplatz, szaprón (rum. şopron)/fáskamra = Wetterdach,<br />
Schuppen, Stall, Viehstall (für Kühe), szátra (şatră)/sátor = Zelt, tábla (rum.tablă) = Blechplatte (zur Deckung<br />
des Hausdaches);Tafel (in der Schule);Ackerbeet, tjinyike(rum.tinichie)/bádoglemez = Blechplatte, vár<br />
(rum.var)/mész = Kalk.<br />
Das Phänomen des Lautwandels zeigt sich am folgenden Beleg:<br />
karamida (rum.cărămidă)/tégla = Ziegel → karmida<br />
Folgende ungarische Wörter sind nicht mehr bekannt:<br />
agal, be-a./ágal = provisorisch zusammenstellen (einen Zaun), asztarha,eszterha/eresz = Vordach, Traufdach,<br />
djakaz,meg-dj. = den Zaun mit Stützen f. das Zaundach versehen, gilinsz, killintsz /kilincs = (Tür)Klinke,<br />
istáló/istálló = Stall (f.die Haustiere), kösz-kert/közös kerítés = Zwischenraum, kunha/kunyhó = kleine Hütte<br />
(wird gew. an die äussere Wand eines Gebäudes gebaut; die im Sommer zur Aufbewahrung von allerlei<br />
kleineren Arbeitsgeräten, auch als Schlafplatz in der Sommerhitze; im Winter können die Gänse da wohnen),<br />
65
szutu/sut = Ofenwinkel, oi,tzuk-o./tyúkol = Hühnerstall, retjiédz/retesz = Schieber,Riegelschloss, szálló/<br />
lépcsı = die Ausgangstreppe.<br />
Innerhalb der unbekannten ungarischen Wörter lassen sich folgende als Paläologismen<br />
betrachten:<br />
agal, be-a./ágal = provisorisch zusammenstellen (einen Zaun),<br />
djakaz,meg-dj. = den Zaun mit Stützen f. das Zaundach versehen.<br />
Im folgenden Synonymenpaar ist nur noch das rumänische Element bekannt:<br />
borde / kunykó,viskó < (rum.)bordeiu = Erdhütte → bekannt<br />
kunha / kunyhó = kleine Hütte → nicht bekannt<br />
Dieser Fall ließe sich auch in die Kategorie r/a einordnen, da sich noch die Dorfältesten nach<br />
mehrmaligem Nachfragen an das ungarische Element des obigen Synonymenpaares erinnern<br />
können.<br />
Die folgenden Belege erbringen den Beweis dafür, dass bei vorliegender Bedeutungsdifferenzierung<br />
zwischen den Elementen von Synonymenpaaren die einzelnen Elemente –<br />
unabhängig von ihrer Herkunft – erhalten bleiben:<br />
boronno / borona = Wandbalken → bekannt<br />
girinda / gerenda < (rum) grindă = Balken,Sparren → bekannt<br />
korda < (rum.)coardă = Tragbalken → bekannt<br />
huruba / pince < (rum) hrubă, hurubă = grosser unterirdischer Keller → bekannt<br />
(für Kartoffeln, Wein)<br />
pintsze / pince = kleiner Keller → bekannt<br />
ográda / udvar < (rum.)ogradă = Hof, Hofplatz → bekannt<br />
odvór / udvar = Herrenhof → bekannt<br />
udvar,utvar / udvar = Hof → bekannt<br />
Im folgenden – aus zwei ungarischen Wörtern bestehendem – Synonymenpaar ist nur ein<br />
Element erhalten geblieben:<br />
66
gilints, killints /kilincs = Türklinke → nicht bekannt<br />
(schon seit den 1950er Jahren)<br />
petszek/”pecek” = Klinke, Türschnalle,Drücker → bekannt<br />
Erklärt werden könnte dieser Verdrängungsmechanismus damit, dass das polyseme Lexem<br />
petszek die Bedeutung des verdrängten Elementes mitbeinhaltet.<br />
4.2. Sachgruppe der Hauseinrichtung<br />
Im Folgenden sollen erneut die Ethnologen Gábor Lükı und Károly Kós zu Hilfe gerufen<br />
werden, um eine traditionelle Tschango-Zimmereinrichtung skizzieren zu können:<br />
Den eigentlichen Mittelpunkt des Zimmers bildete der Ofen. Die entlang der Wände fest<br />
angebrachten Lehm-, später Holzbänke dienten vor allem als Sitz-, aber auch als Schlafgelegenheit.<br />
Das breite Holzbett ist neueren Datums. Die Wände sind mit selbst gewebten<br />
Teppichen geschmückt. Die Heiligenbilder hängen an der östlichen Wand. Im traditionellen<br />
Tschango-Zimmer war im Grunde genommen kein Schrank vorhanden. Das Küchengeschirr<br />
wurde auf dem neben der Tür befindlichen Regal, die Kleidungsstücke in einer Truhe aus<br />
Buchenholz verwahrt. Auf diese Truhe wurde die Mitgift aufgetürmt.<br />
Hinter dem Ofen wurden die Stühle und der Tisch aufbewahrt, die nur zu den Mahlzeiten hervorgeholt<br />
wurden.<br />
Die Moldauer Ungarn richteten ihre Häuser auf die gleiche Art und Weise ein. Jedes Objekt<br />
hatte seinen bestimmten Platz mit einer bestimmten Signalfunktion.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
abrasz/abrosz = Tischtuch, ádj/ágy = Bett, ádj/vetész/ágyvetés = Bettwäsche, allok/olló = Schere, asztal = Tisch,<br />
bor-wizesz eweg/borvízes üveg = Sauerwasser (Mineralw.)Flasche, djugo/dugó = Stöpsel,Propfen, eweg/üveg =<br />
Glas,Flasche, fazak,fazék/fazék = Topf, fedelesz/kicsi vízhordó = kleines Fass(für Trinkwasser), fejjérrondjo/fehérnemő<br />
= Weisswäsche,Weisszeug, füsztelö-hardo/füstölıhordó = ein Fass, das beim Fleischselchen<br />
angewandt wird (das Fleisch wird in dem bodenlosen, auf Steine gestellten u. mit einem Leinentuch bedeckten<br />
Fass aufgehängt, der Rauch steigt von dem darunter befindlichenstillen Feuer ins Fass hinauf), füszü/féső =<br />
Kamm, gug,g.láb = Stützpfeiler (von Holz)an der Vorderseite des Ofens (zum Stützen des vordachartigen<br />
Rauchfangs), habaro/habaró,keverı = Rührstock; heute eher: făcăleŃ), hardó/hordó = Fass,Tonne, kaasó/kancsó<br />
= Weinkrug,Humpen, kád = Bottich, kádaska/kádacska = kleiner Bottich, kalán/kanál = Löffel, kártja/kártya<br />
= große, hölzerne Wasserkanne, kasz/kas = Korb, kerutsza-kasz/szekérkas = Wagenkorb, kendezı/törülközı =<br />
Handtuch, kép = Bild, Bildnis,Abbildung, kiész/kés = Messer, kiész-nél/késnyél = Messergriff, korszó/korsó =<br />
Krug, koszár/kosár =Korb, Wasserkrug, kötiél/kötél = Strick,Seil,Leine, kötı-kötiél = Bindestrick,<br />
kötılék/kötelék = Bund,Ballen,Gebinde, lábasz/lábos =mit Füssen versehen [d.h.: Topf], láda = Kiste, Lade,<br />
Kleiderkiste, lakat = Vorhängeschloss, lapitó/lapító = Walkbrett, Brett zum Plätten, lepedı = grosses<br />
Sackleinwandstück zu verschiedenen Zwecken:als Bettunterlage im Freien (im Sommer), als Pferdedecke<br />
u.a.m.), lug/lúg = Lauge,Laugenwasser, lugzó-seber = Laugenbottich, meritı/merítı = Schöpfgefäss, moszótekenı/mosóteknı<br />
= Waschtrog, mozár/mozsár = Mörser, ırlö,borsz-ö./borsörlı = Pfeffermühle, párna =<br />
67
Kissen,Polsten, pergelı = Kaffeeröste, póltsz/polc = Gestell,Pult,Stellage, rászpor/ráspoly = Raspel, Grobpfeile,<br />
reszelı = Reibeisen, szappan = Seife, szeprü/seprő = Besen, szepu/szapu = ein rundes Gefäss (mit Handgriff) aus<br />
Lindenrinde (der Boden, dessen Diagonale ca. 35 m ist, aus Holz; die Höhe des gefässes ca. 40 cm);wird zum<br />
Tragen von Kartoffeln, Mais,Spänen u.ä.) angewendet, sziék/szék = Stuhl, szita = Sieb, szita-káua/szitakáva =<br />
Einfassung des Siebes, szürı = Seihe,Filter, szütkı/szütykı = kleiner Quersack,Säckel, sap/csap =<br />
Zapfen,Hahn, seber/cseber = Zuber, sipar/csupor = Töpfchen,kleiner Tonkrug m.Henkel, tálaska/tálacska =<br />
kleine Schlüssel, tándjér/tányér = Teller, tartó = Behälter,Halter, teiesz-fazak/tejes fazék =Milchtopf,<br />
tekenyı/teknı = Trog, terisznya/tarisznya = Quersack,Ranzen, tı/tő = Nadal,Nähnadel, töltsiér/tölcsér =<br />
Trichter, tıltı:hurkatıltı = Wurstspritze, tırlı/törlı = Wischer,Wisch, tulusz párna = Federkissen,<br />
tszérna/cérna = Zwirn, üszt/üst,rézüst = Kupferkessel, vagdaló-doszko = Hackbrett (zum Fleischhacken),<br />
vakaró = Kratzer, Schäber,Schabeisen, válló/vályu = Trog,Wassertrog,Rinne, vetett-ádj/vetett ágy = Bett,mit<br />
Bettzeug beladener Schlafplatz, villa = Heu o.Mistgabel, vizesz-hardó/vízeshordó = Wasserfass, vizitı/öntözı =<br />
Bewässer,Gieskanne, zák/zsák = Sack.<br />
Bekannt sind auch folgende Lehnwörter aus dem Rumänischen:<br />
balerka (rum.balercă)/kicsi hordó = kleines Fass, bota (rum.botă)/kis fahordó = kleine hölzerne Wasserbütte,<br />
budaszka (rum. budaiu, bădău, bidon)/fabödön, faedény = mit 1-2 Henkeln versehener Kübel aus Holz für das<br />
Schmutzwasser in der Küche, buidjin (rum.budăi)/bödön = als Brunnengeländer angewandter ausgehöhlter<br />
Baumklotz, djivan (rum.divan)/divány = Diwan, dop (rum.dop)/dugó = gros.Holzpfropf am Fass, dulap, falidulap<br />
(rum.dulap)/szekrény = Schrank, Wandschrank, furkulitsza (rum.furculiŃă) = Gabel (zum Essen), ibrik<br />
(rum.ibric)/kicsi kávéskanna = kleines Töpchen für Kaffee-o.Teekochen, kintár (rum. cântar)/mérleg = Waage,<br />
kosorba (rum.cociorbă) = Ofenschaufel, lámba (rum. lampă cu petrol)/lámpa = Lampe (erst seit ca.30-40 Jahren<br />
- um die 1860-1870-er Jahre – bekannt), leesiér (rum.covor,lăicer) = Teppich (Wand-,Boden-,Bankteppich),<br />
pahár,borosz-p.(rum.pahar)/pohár = Trinkglass, Weinglass, piérie (rum.perie) /kefe = Bürste, punga<br />
(rum.pungă)/bırbıl készült pénzes-zacskó = lederner Geldbeutel, rám (rum.ramă)/keret = Rahmen, rászpa<br />
(rum.raspă)/reszelı = Raspel, Grobpfeile, risnitsze (rum.răşniŃă)/kézi daráló = Schrotmühle, Handmühle,<br />
rogozina (rum.rogojină) = Binsenmatte, róla, MTsz. rúra (rum.rolă) = Röhre (im Ofen), saun (rum.ceaun)/üst =<br />
Eisenkessel, serge (rum.cergă)/cserge = gewebte grobe Wolldecke, sutura (ciutură)/kútvödör = Brunneneimer,<br />
szóba (rum. sobă) = Ofen (im Wohnzimmer od. in der Küche; nicht: Backofen), tjelefón (rum.telefon)/telefon =<br />
Telephon, tjibrik (rum.chibrit)/gyufa = Zündhölzchen, tjigáie (rum.tigaie)/serpenyı = Pfanne, tjinyzire<br />
(rum.tingire) /rézserpenyı = Bratpfanne(aus Messing).<br />
Weiterhin bekannt sind auch folgende hybride Bildungen:<br />
fali-duláp = Wandschrank<br />
gebildet aus:<br />
fal + Adjektivbildungssuffix -i = Wand- + duláp < (rum.)dulap = Schrank<br />
boroszpahár = Weinglas<br />
gebildet aus:<br />
bor + Adjektivbildungssuffix –osz = mit Wein; Wein- + pahár < (rum.)pahar = Glas<br />
(standardspr. -os)<br />
68
kerutsza-kasz/szekérkas = Wagenkorb<br />
gebildet aus:<br />
kerutsza < (rum.căruŃă) = Wagen + kasz/kas = Korb<br />
In den folgenden Synonymenpaaren bestehen Bedeutungsdifferenzierungen zwischen den<br />
einzelnen Elementen, so dass alle Elemente unabhängig von ihrer Herkunft erhalten bleiben<br />
konnten:<br />
balerka / kicsi hordó < (rum.)balercă = kleines Fass → bekannt<br />
bota / kis fahordó < (rum.)botă = kleine hölzerne Wasserbütte → bekannt<br />
fedelesz /kicsi(víz)hordó = kleines Fass(für Wassertrinken) → bekannt<br />
hardó / hordó = Fass,Tonne → bekannt<br />
vizesz-hardó / vízeshordó = Wasserfass → bekannt<br />
ırlı,borsz-ı. / borsörlı = Pfeffermühle → bekannt<br />
risnitsze /kézi daráló < (rum.)răşniŃă = Schrotmühle,Handmühle → bekannt<br />
saun / üst < (rum.)ceaun = Eisenkessel → bekannt<br />
üszt / üst,rézüst = Kupferkessel → bekannt<br />
dop / dugó < (rum.)dop = gros.Holzpfropf am Fass → bekannt<br />
djugo / dugó = Stöpsel, Pfropfen → bekannt<br />
Im folgenden – aus einem rumänischen und zwei ungarischen Elementen bestehenden –<br />
Synonymenpaar blieb nur das eine ungarische Element erhalten:<br />
rászpa / reszelı < (rum.)raspă = Raspel,Grobfeile → bekannt<br />
rászpor / ráspoly = Raspel,Grobfeile → nicht bekannt<br />
reszelı = Reibeisen → bekannt<br />
Zwischen rászpa und reszelı liegt eine Bedeutungsdifferenzierung vor, so dass beide<br />
Elemente erhalten blieben; zwischen rászpa und rászpor wiederum liegt zum einen keine<br />
Bedeutungsdifferenzierung vor, zum anderen sind sich die beiden Elemente in ihrer Lautform<br />
sehr ähnlich. Beim Verschwinden des ungarischen Elementes ist auch der Faktor der Sprachökonomie<br />
nicht ganz auszuschließen.<br />
69
Folgende ungarische Wörter sind nicht mehr bekannt:<br />
asztal-filo/asztalfiók = Tischschublade, ediény, edién/edény = Geschirr, filo/fiók = Schublade, lap = Fläche,<br />
Platte(z.B.des Brettes), nyélbe-járó/bicska = schlechtes Taschenmesser (welches schlecht einschlägt)<br />
Die Lexeme asztal-filo/asztalfiók = Tischschublade und filo/fiók = Schublade waren übrigens<br />
schon in den 1950er Jahren nicht mehr bekannt.<br />
Nicht mehr bekannt sind weiterhin folgende rumänische Lehnwörter:<br />
pemeteg (pămătug)/pemete = Ofenwisch (ein Strohbund am Ende einer Stange), pilata (rum.pilotă)/paplan = mit<br />
Wolle gefüllte,genähte Bettdecke<br />
4.3. Sachgruppe des Hausgewerbes<br />
Wie wir bereits erwähnt haben, war die Gesellschaft der Tschangos lange Zeit hindurch eine<br />
selbstversorgende. Neben dem Ackerbau gehörten die Erledigung von kleineren Reparaturarbeiten<br />
rund um das Haus, die Anfertigung von für den häuslichen Bereich notwendigen<br />
kleineren Werkzeugen sowie die gelegentliche Sicherung des Warentransportes (Fuhrwerk)<br />
zum traditionellen Arbeitsbereich der Männer. Diese Aufgaben versah jeder seinen<br />
Fähigkeiten entsprechend. Das Hausgewerbe bildete den Ausgangspunkt, aus dem sich<br />
langsam die einzelnen handwerklichen Berufe zu entwickeln begannen.<br />
Wegen der in dieser Region herrschenden Armut konnte weder in den Ankauf von größeren<br />
Mengen der teuren Rohstoffe investiert, noch das mit dem Verkauf verbundene Risiko eingegangen<br />
werden. Produziert wurde daher nur auf gelegentlich erfolgende Bestellung; eine<br />
Warenproduktion größeren Ausmaßes war unter diesen Bedingungen nicht möglich.<br />
Einzige Ausnahme bildeten das Handwerk des Korbflechters und des Töpfers, die ihre<br />
Produkte auch in den weiter entfernten Dörfern und Städten anbieten konnten, da in diesen<br />
Fällen zum einen für den notwendigen Rohstoff – der sich sozusagen direkt vor der eigenen<br />
Haustür befand – nichts bezahlt werden musste, zum anderen die Beschaffenheit der Produkte<br />
selbst (geringes Gewicht, platzsparende Größe) die Transportkosten niedrig hielten.<br />
Diejenigen Dörfer, in denen die zur Ausübung der beiden obigen Handwerksberufe<br />
notwendigen Rohstoffe zur Verfügung standen, entwickelten sich zu wahrhaftigen<br />
Handelszentren, so dass der Lebensunterhalt der dortigen Bevölkerung fast vollständig<br />
gesichert werden konnte.<br />
Zum klassischen Aufgabenbereich der Frauen gehörten neben der Kindererziehung die Haushaltsführung<br />
(Kochen, Waschen, Haushaltsputz), Näh-, Spinn- und Webarbeiten, die Garten-<br />
70
arbeit sowie die Herstellung von Seife. Gelegentlich beschäftigten sie sich auch mit dem Verkauf<br />
der selbst angebauten und gesammelten Produkte (zum Beispiel Heilkräuter).<br />
Sofern die Familie ihren Unterhalt durch die Töpferei finanzierte, war auch in diesem Bereich<br />
die Mitwirkung der Frau gefragt.<br />
Innerhalb der Arbeitsteilung der Familie war auch die Stellung der Kinder klar geregelt, die<br />
– alters- und geschlechtsgemäß – behutsam an die betreffenden Tätigkeiten herangeführt wurden,<br />
um so – als Erwachsene – ihre jeweiligen Arbeitsfelder bewältigen zu können.<br />
4.3.1. Tätigkeiten innerhalb des Hauses und des häuslichen Umfeldes<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind auch heute noch bekannt:<br />
doszkál,be-d. =mit Brett beschlagen o.belegen, djug,be-djug/dug,bedug = zustopfen, djuit/gyújt = anzünden,<br />
djujtagat/gyujtogat =hier und da anzünden, djur/gyúr = geknetet werden, ebedez/ebédet készít = eine Mahlzeit<br />
zurichten, ebrit/öblít = spülen,élesit/élesít = schärfen,wetzen, erdöl = in den Wald gehen,um Holz zu holen,<br />
farag = schnitzen,hauen, faragsal/faragcsál = schnitzeln, fejjérit/fehérít = weiss machen,bleichen, fen =<br />
wetzen,schleifen, fenekel = mit einem Boden versehen(z.B.ein Fass), fetskend, heute: fecskent/fecskend =<br />
spritzen (z.B.mit einer Wasserspritze), föz/fız (ételt,sırt,pálinkát) = kochen,brauen (Bier),brennen (Branntwein),<br />
fureszel/fürészel = sägen, gazdal, megg./gazdálkodik = haushalten,bewirten, hasit/hasít = spalten,schlitzen<br />
hedjez,meg-h./hegyez,meghegyez = zuspitzen,schärfen, hordószkadik/hordózkodik,hurcolkodik = beim<br />
Übersiedeln seine Sachen und Hausgeräte hintragen, kénál/kinál= bieten,darbieten;jmd.etw.vorsetzen<br />
(Speise,Getränke), kénálkadik = sich bitten lassen (z.B.ein Gast), kiéz-vanol = mit dem Schnitzmesser<br />
schnitzen, kinerez/kenyeret sőt = Brot backen, kız/kövez = pflastern, lugaz/lúgoz = laugen,ablaugen (die<br />
Wäsche), talpal,mek-t. = besohlen;auf den Beinen sein,arbeiten, tokoz = den Maiskolben aushülsen (d.h. von<br />
seiner Hülle befreien),den Maiskolben (m.den Händen),auskörnen, tırzıl/dörzsöl = reiben (die Wäsche)<br />
,scheuern, tıskıl, tısököl, MTsz. töcsköl, heute:dösköl = zerknitternd reiben,scheuern, ólt = gerinnen machen<br />
(die Milch), ılt/ölt = Stich machen(beim Nähen), ırel/ıröl = mahlen, pergel = rösten, szegez = nageln,<br />
annageln, szikár/sikál = mit Lehm bestreichen(z,B, den Hausboden,die Wand,die Risse im Ofen), szikit =<br />
glätten,schleifen,streicheln, szitál = sieben, szóz/sóz = salzen,einsalzen, szüt/sőt = braten,backen, var = nähen,<br />
vaszal,meg-v./vasal = mit Eisen beschlagen(z.B.den Wagen);in Bande schlagen;in Fesseln legen(z.B.denDieb).<br />
Das Phänomen des Lautwandels zeigt sich an folgenden Belegen:<br />
fetskend /fecskend = spritzen (z.B.mit einer Wasserspritze) → fecskent<br />
tıskıl, tısököl, MTsz. töcsköl = zerknitternd reiben,scheuern → dösköl<br />
Nicht mehr bekannt sind:<br />
hemus,meg-h./hamvaz,meghamvaz = mit Asche bestreuen, ró = kerben,einschneiden, kiérgel, bé-k. = mit<br />
Baumrinde etw. zumachen, zustopfen, kiérgeszsz/ „kérges” = mit aus Rinde gemachten Leitern versehen (vom<br />
Wagen), záppaz = die Leiter m.Sprossen versehen<br />
Die obigen Wörter können als Paläologismen betrachtet werden, da sie solche Tätigkeiten<br />
bezeichnen, die nicht mehr ausgeübt werden.<br />
71
Anstatt des Lexems zár bzw. bé-zár = zusperren (die Tür), einsperren (z.B.den Dieb, selten)<br />
ist kusal bzw. bé-kusal gebräuchlich.<br />
4.3.2. Werkzeuge für den häuslichen Gebrauch<br />
Folgende ungarische Wörter sind bekannt:<br />
ek/ék = Keil, eset/ecset = Flachshechel, faragó-sziék/faragószék = Schnitzbank, fen-kö, heute: fenı-kö/ fenıkı<br />
= Schleifstein,Wetzstein, fese/fejsze = Axt, furu/furó = Bohrer, fürész = Säge, horog = Haken,Widerhaken,<br />
kalán-furu = grosser Bohrer(z.B.zum Bohren eines Nabenloches), kánkó/kampó = Haken,Widerhaken (allerlei<br />
Art, bes.von Holz;auch von Eisen), kaps/kapocs =Heftel, Schnalle, Haken u. dazu gehörige Öse,Klammer,<br />
kiéz-vanó/faragókés,vésı = Schnitzmesser, miérı/mérı = der Messer, tı/tő = Nadel,Nähnadel, sapazó-furu =<br />
Zapfenbohrer.<br />
Weiterhin bekannt sind folgende rumänische Lehnwörter:<br />
eszkaba, heute: szkoba (rum.scoabă)/eszkába = Eisenklammer, kliéstje (rum.cleşte)/harapófogó = Kneifzange,<br />
Zange, kordász (rum.cu coardă) = Säge, miészina (rum.maşină) = gép, tosila (rum.tocilă,ascuŃitoare)/élezı =<br />
Schleifrad, tjészla (rum.teslă) = Häuer,Meisselaxt, sokán,tsokán (rum.ciocan)/kalapács = Hammer.<br />
Nicht mehr bekannt ist das Lexem kakasz-szeg = Hakennagel.<br />
Bemerkenswert am folgenden Lautwandel ist die Annäherung an die ungarische Standardsprache:<br />
fen-kö/fenıkı = Schleifstein,Wetzstein →<br />
fenı-kö<br />
Hybride Bildungen sind auch in diesem Themenbereich belegt:<br />
harapó-kliestje/harapófogó = Kneifzange<br />
gebildet aus:<br />
harap = beissen + Adjektivbildungssuffix -ó<br />
+ kliestje < (rum.)cleşte = Zange<br />
kordász-fürész = Säge für eine Hand (eigtl.”Säge mit korda”).<br />
gebildet aus:<br />
kordász
4.3.3. Spinn- und Webarbeiten<br />
Ein aus der Behandlung des Themenbereiches der Kulturpflanzen gezogenes Fazit war, dass<br />
die ungarischen Bezeichnungen der für die Betreibung des bei den Tschangos noch<br />
lebendigen Hausgewerbes notwendigen Rohstoffe wie ’Lein’ bzw. ’Flachs’, ’Hanf’ und<br />
’Baumwolle’ auch heute noch bekannt sind. Was nur allzu natürlich ist, wenn man bedenkt,<br />
dass die Spinn- und Webarbeiten zum traditionellen Aufgabenbereich der Frauen gehörten,<br />
die untereinander Ungarisch sprachen.<br />
Folgende ungarische Wörter sind bekannt:<br />
asztat/áztat = befeuchten (Lein,Hanf), asztatat/áztatott = geröstet(Hanf,Lein), botol = mit dem Stock<br />
schlagen (Lein,Hanf)vor d.eigtl.Brechen m.der Hanfbreche, auch Wäsche bleien), eresztı = Drehstock am<br />
Weberbaum, fogdosz/ szövésnél a szálat áthúzni = die Fäden (des Gewebes) durch den Schaft und den<br />
Weberkamm ziehen, fonász/fonás = Spinnen,Flechten, fono, heute: funa/fona, visszája = Kehrseite,<br />
gomolo/gomolya = Knäuel, guzal/guzsaly = Spinnrocke, d.h.Stock,an dessen Ende das Hanfbündel zum<br />
Spinnen angebunden wird, kender-vászan/ kendervászon = Hanfleinwand, mazdag/madzag = Schnur<br />
(bes.von Hanf), mellék, heute: mellik bzw. mellik szál/matring = Garnsträhne, metula/motóla = Garnwinde;Haspel,<br />
metulál/motólál = haspeln, tekerı-láb = Fuss der Haspel, órszó/orsó = Spindel, szál =<br />
Faden, Kettenfaden (im Gewebe),Faser,Stengel, szényü,kiét-sz./színő, kétszínő = durchgewebt (vom<br />
Stoff),d.h. die rechte und die Kehrseite sind gleich, szeritı = Spindel zum Zwirnen, szı = weben, szösz =<br />
der Hanf,der beim erst-maligen Kämmen in der Hechel zurückbleibt;daraus grobes Garn, szöwész/szövés =<br />
Weben,was gewebt ist, Gewebe, szıvı = Weber,Webstuhl,was zu weben ist, satló/csatló = ein kurzes<br />
Holzstück,das parallel mit dem Fuhrstrick auf die Fuhre gelegt und und gegen das der Strick mit einem Stoff<br />
straff angespannt wird, siptetı/ csiptetı = der Spanner am Gewebe(beim Weben), sıl/csével = spulen,<br />
sıllı/csıllı = Spulrad, söngöl = aufrollen,aufwinden(z.B.einen Zwirnsfaden um den Finger), tjiló/tiló =<br />
Hanfbreche, tjilól/tilol = brechen(Hanf o.Lein), tjilóló/tiloló = was zu brechen ist, verı =<br />
Schläger,Einschlag(im Gewebe).<br />
Weiterhin bekannt sind auch folgende rumänische Lehnwörter:<br />
buk,bukkat (rum.buc)/durvább gyapjúfajta = die beim Wollkämmen übriggebliebene zweite,gröbere<br />
Wollsorte), moszór MTsz.măszar (rum.mosor)/fonalcsévelıcsı = Spule.<br />
Nicht mehr bekannt sind:<br />
tekerı-lewiél = das eine von den zwei sich drehenden horizontalen Querhölzern an der Haspel,<br />
páttszál/pácol = den Hanf zum zweitenmal hecheln.<br />
Der Ethnologe Károly Kós machte schon in den 1970er Jahren auf die Werte und das wirtschaftliche<br />
Potential des von den Tschangos betriebenen Hausgewerbes aufmerksam.<br />
Er berichtet darüber, dass hier „ein lebendiges Hausgewerbe zu finden ist, deren Betreiber in<br />
vielen Fällen Produkte in künstlerischer Ausführung herstellen, das heißt, dass ihre Produkte<br />
oft wertvolle Stücke der Volkskunst darstellen. Wenn wir in Betracht ziehen, dass sich die<br />
Hälfte der erwachsenen Bevölkerung (die Frauen) mit Spinn- und Webarbeiten beschäftigt<br />
73
und ein bedeutender Teil der Männer – zuweilen auch ganze Dörfer – diverse handwerkliche<br />
Berufe ausüben, werden wir mit der wirtschaftlichen Frage der Weiterentwicklung des<br />
Volksgewerbes der Tschangos konfrontiert” (Kós 1976: 144).<br />
Die mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Industrialisierung verbundenen Zivilisationserscheinungen<br />
tragen zum Verfall dieser Kultur bei. „In den Moldauer Tschango-Dörfern<br />
bewirkte die mit hohem Tempo vorangetriebene Moder-nisierung (...) samt ihren<br />
Begleiterscheinungen (Individualisierung, hochgradige Mobilität, usw.) den schnellen Zerfall<br />
der Dorfgemeinschaften (...). Sämtliche dieser Prozesse traten nun in der Moldau oft alle auf<br />
einmal und zur selben Zeit ein. (...) Das größte Problem bereitet dabei der Umstand, dass die<br />
Dorfgemeinschaften nicht im geringsten Maße auf die wachsende Rolle der Globalisierung,<br />
Modernisierung und der Marktwirtschaft vorbereitet sind. Die 1990 erfolgende Privatisierung<br />
der Landwirtschaft schuf für die junge Generation kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. Nach<br />
dem Systemwechsel und der Öffnung der Grenzen strömt die überschüssige Arbeitskraft aus<br />
den Tschango-Dörfern nunmehr regelmäßig nach Ungarn, Italien, Deutschland und Israel.<br />
Zuerst waren es nur die jungen Männer, die ihren Broterwerb im Ausland suchten; später<br />
waren es auch junge Mütter, die ihr Geld vor allem durch Tätigkeiten in den ausländischen<br />
Haushalten verdienten. (...) Das dort erworbene Geld wird Zuhause meist für Prestigeobjekte<br />
bzw. Luxusgüter (Farbfernseher, Videogeräte, Parabolantennen, westliche Autos usw.)<br />
ausgegeben. In ihren Familien sind auch heutzutage die Normen lebendig, die besagen, dass<br />
die jungen Männer noch vor ihrer Heirat Häuser errichten müssen. Viele der jungen<br />
Erwachsenen geben ihr im Ausland erworbenes Vermögen nicht mehr nur für Luxusgüter und<br />
Häuser aus, sondern investieren dieses auch in modernere landwirtschaftliche Geräte,<br />
Grundbesitz oder kleinere Betriebe (Autowerkstatt, Kneipe, Mühle, Bäckerei usw.). Viele<br />
versuchen auch den Einstieg in das Handelsgewerbe, doch ist das dafür nötige Geld in den auf<br />
Selbstversorgung spezialisierten Dörfern nicht vorhanden. (...) Dringend erforderlich wäre ein<br />
grundlegender Wandel. Eine Möglichkeit hierzu wäre vor allem die Intensivbewirtschaftung<br />
der Nutzflächen. Wünschenswert wäre auch die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung<br />
derjenigen handwerklichen Tätigkeiten, die in den Dörfern der Moldauer Tschangos schon<br />
vor der Kollektivisierung bekannt waren und in Zukunft zu einer effektiveren Entfaltung des<br />
Dorftourismus beitragen könnten. Hierzu müssen aber viele Voraussetzungen – wie zum<br />
Beispiel die Vermittlung des notwendigen „Know-how”-s,<br />
die Verbesserung der Unterrichtsqualität, die Erweiterung des Ausbildungsangebotes durch<br />
„rentablere” Berufe, eine engere regionale Zusammenarbeit bzw. die Ausarbeitung von durchdachten<br />
Strategien zur Wirtschaftsförderung – erfüllt werden” (Pozsony 2005: 169-170).<br />
74
Gegenwärtig sind in der Moldau kaum Arbeitsmöglichkeiten vorhanden. Unser Untersuchungsdorf,<br />
Szabófalva bildet dabei keine Ausnahme. Auch hier pendeln die jungen<br />
Erwachsenen in die nähergelegenen Städte oder verdienen sich ihren Lebensunterhalt als<br />
Gastarbeiter im Ausland. Einige bewirtschaften noch – eher um der Ehre willen – das vom<br />
Staat zurückbekommene Ackerland, immer mehr Tschangos lassen aber ihre Felder brach<br />
liegen. Auch die Frauen verrichten keine Web- und Spinnarbeiten mehr, da sie ihre Produkte<br />
nicht absetzen können. Sollte sich aber ein An- oder Aufkäufer finden, wäre es noch möglich<br />
– im Falle einer konkreten Bestellung – eine Arbeitsgruppe aus Mädchen und Frauen zur<br />
Herstellung dieser Produkte zu organisieren, da es noch solche Personen gibt, die sie in die<br />
Kunst des Webens und Spinnens einweihen könnten.<br />
In Szabófalva sind zwar mehrere Betriebe ansässig (Bäckereien, Schusterwerkstätten, Kachelöfenwerkstätten),<br />
doch diese reichen nicht aus, um für die Bevölkerung genug Arbeitsplätze<br />
zu schaffen.<br />
Die Buslinie „Valentino” ermöglicht den Pendelverkehr zwischen unserem Untersuchungsdorf<br />
Szabófalva und der – über einen Bahnhof verfügenden – Stadt Roman.<br />
4.4. Zusammenfassung:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 573 Wörter machen 9,54% des Gesamtwortschatzes<br />
(6007 Wörter) aus.<br />
- 92 der 573 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 16,06 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die aus zwei oder mehreren Elementen bestehenden Synonymenpaare mit bzw. ohne<br />
vorliegender Bedeutungsdifferenzierung:<br />
borde / kunykó,viskó = Erdhütte - kunha / kunyhó = kleine Hütte<br />
boronno / borona = Wandbalken - girinda / gerenda < (román) grindă = Balken,Sparren - korda (rum.)coardă = Tragbalken<br />
huruba / pince (rum.) hrubă, hurubă = grosser unterirdischer Keller(für Kartoffeln, Wein) - pintsze / pince = kleiner Keller<br />
ográda / udvar = Hof, Hofplatz - odvór / udvar = Herrenhof - udvar,utvar / udvar = Hof<br />
gilints, killints /kilincs = Türklinke - petszek/”pecek” = Klinke, Türschnalle,Drücker<br />
balerka / kicsi hordó = kleines Fass - bota / kis fahordó = kleine hölzerne Wasserbütte -fedelesz /kicsi(víz)hordó = kleines Fass(für<br />
Wassertrinken) - hardó / hordó = Fass,Tonne - vizesz-hardó / vízeshordó<br />
ırlı,borsz-ı. / borsörlı = Pfeffermühle - risnitsze /kézi daráló = Schrotmühle,Handmühle<br />
saun / üst = Eisenkessel - üszt / üst,rézüst = Kupferkessel<br />
dop / dugó = gros.Holzpfropf am Fass - djugo / dugó = Stöpsel, Pfropfen<br />
rászpa / reszelı = Raspel,Grobfeile - rászpor / ráspoly = Raspel,Grobpfeile -reszelı = Reibeisen<br />
2.) die Paläologismen:<br />
agal, be-a./ágal = provisorisch zusammenstellen (einen Zaun), djakaz,meg-dj. = den Zaun mit Stützen f. das Zaundach<br />
versehen,. hemus,meg-h./hamvaz,meghamvaz = mit Asche bestreuen, ró = kerben,einschneiden, kiérgel, bé-k. = mit<br />
Baumrinde etw. zumachen, zustopfen, kiérgeszsz/ „kérges” = mit aus Rinde gemachten Leitern versehen (vom Wagen), záppaz<br />
= die Leiter m.Sprossen versehen<br />
75
3.) die hybriden Bildungen:<br />
fali-duláp = Wandschrank, boroszpahár = Weinglas, kerutsza-kasz/szekérkas = Wagenkorb, harapó-kliestje/harapófogó<br />
=.Kneifzange, kordász-fürész = Säge für eine Hand<br />
4.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
karamida (rum.cărămidă)/tégla = Ziegel heute: → karmida<br />
fetskend /fecskend = spritzen (z.B.mit einer Wasserspritze) heute: → fecskent<br />
tıskıl, tısököl, MTsz. töcsköl = zerknitternd reiben,scheuern heute: → dösköl<br />
eszkaba,(rum.scoabă)/eszkába = Eisenklammer heute → szkoba<br />
fen-kö/fenıkı = Schleifstein,Wetzstein heute: → fenı-kö<br />
Besonderheiten anderer Art:<br />
- Erhalt von Wörtern, die in der ungarischen Standardsprache kaum noch bzw. nicht mehr<br />
bekannt sind:<br />
hákso/hágcsó,lépcsı = Treppe;Stiege(an der Umzäunung), hiu,hijú/padlás = Dachboden, petszek/”pecek” = Klinke,<br />
Türschnalle, Drücker, petszkel,bé-p.,ki-p./peckel = (vermittels der Klinke)zumachen o.aufmachen(die Tür),<br />
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt:<br />
asztalfilo/asztalfiók<br />
=<br />
Tischschublade<br />
filo/fiók =<br />
Schublade<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
Atlas<br />
(1949-1952)<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
+ - - ██░░░<br />
+ - - ██░░░<br />
Grafische Darstellung des<br />
Prozesses<br />
gilinsz, killintsz<br />
/kilincs =<br />
(Tür)Klinke<br />
+ - - ██░░░<br />
kunha/kunyhó =<br />
kleine Hütte<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
0 █∼▓▓<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes ist<br />
nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
76
5. Kurze Kulturgeschichte der Moldauer Tschango-Ungarn<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 301 Wörter machen 5, 01 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
(Szabófalva) aus. 37 der 301 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 12, 29 %<br />
bedeutet.<br />
Im Wörterbuch Wichmanns finden sich – wie wir bereits erwähnt haben – wichtige kulturhistorische<br />
Angaben über die Moldauer Ungarn. Yrjö Wichmann liefert uns detaillierte<br />
Beschreibungen über die Glaubenswelt, das religiöse Leben und die Bräuche der Tschangos<br />
– wobei er auch ihre Tänze, Bekleidung und Ernährungsgewohnheiten nicht unerwähnt lässt –<br />
auf die auch wir im Folgenden unser Augenmerk richten werden.<br />
5.1. Religiöser Wortschatz, Glaubensvorstellungen, Aberglauben, Gebräuche, Identität<br />
Die Tschangos stellen eine tiefgläubige Ethnie dar, deren wichtigster Identitätsindikator ihr<br />
katholischer Glaube ist, zu dem sie sich bewusst bekennen. Uns interessiert nun im<br />
Besonderen, welche Spuren das Zusammenleben mit den orthodoxen Rumänen, die die<br />
Mehrheitsgesellschaft bilden, im Wortschatz, in der Glaubenswelt und den Gebräuchen der<br />
Tschangos hinterlassen hat.<br />
Die Gemeinschaft der Tschangos ist mit jedem einzelnen Individuum in einer Art Symbiose<br />
verbunden und verfolgt den Lebensweg jedes Einzelnen – vom ersten Atemzug bis zum Tod –<br />
mit Aufmerksamkeit. Für die Tschango-Gemeinschaft, die sich nicht nur mit dem objektiv<br />
sichtbaren bzw. wahrnehmbaren Lebensweg begnügt, ist auch die Zeit vor der Geburt und<br />
nach dem Tod von Interesse, da ihr auch das weitere Schicksal der Seele nicht gleichgültig ist.<br />
Bereits die werdenden Mütter müssen sich – zum Schutze des noch ungeborenen Lebens –<br />
einer Menge von ungeschriebenen Gesetzen unterwerfen. Jeder einzelne Lebensabschnitt des<br />
Individuums wird von festen Regeln bestimmt. Befolgte jemand die Dorfgesetze nicht,<br />
standen der Dorfgemeinschaft und dem Priester diverse „Strafmaßnahmen” zur Verfügung;<br />
als schlimmste Bestrafungsform galt die Ächtung, deren Grad von der Schwere des jeweiligen<br />
Vergehens abhing. Die Bestrafung diente zur Läuterung; der Schuldige konnte so wieder in<br />
die Gemeinschaft aufgenommen werden. Diese „Selbstreinigung” der Dorfgemeinschaft hatte<br />
Erfolg, was sich an der niedrigen Kriminalitätsrate zeigt.<br />
„(...) In der Moldau war das Verhältnis zwischen den Priestern und ihren Gläubigen stets ein<br />
asymmetrisches – der Priester stand immer über seinen Gläubigen und konnte in deren Le-<br />
77
ensführung eingreifen (...). Der Priester spielt dabei nicht nur eine wichtige sakrale Rolle,<br />
sondern verfügt darüber hinaus über einen hohen gesellschaftlichen und rechtlichen Status; er<br />
gilt als irdischer Stellvertreter Gottes, dem höchster Respekt gezollt werden muss. Zu seinem<br />
Zuständigkeitsbereich gehört auch die Kontrolle aller Aspekte des moralischen Lebens (...)<br />
Man kann sagen, dass er diejenige Person in der kleinen Gemeinschaft ist, die über die<br />
absolute Macht verfügt” (Erika Benedek 1998: 12).<br />
Unter solchen Umständen wird es noch verständlicher, weshalb die Rolle des Priesters von<br />
dermaßen großer Bedeutung ist, weshalb es so wichtig ist, dass dieser eine solche Sprache<br />
versteht und spricht, mit der er wahrhaftig mit seinen – ihm anvertrauten – Gläubigen kommunizieren<br />
kann. Ein ihrer Sprache nicht mächtiger Priester – und sei er noch so guten<br />
Willens – ist nicht in der Lage, seinen Pflichten als Seelsorger nachzukommen bzw. für das<br />
Seelenheil seiner Gläubigen zu sorgen.<br />
Nur so lässt sich auch die Angst der Tschangonen vor dem plötzlichen Tod (hirtelen halál),<br />
vor dem sie – wie sie in vielen ihrer Gebete zum Ausdruck bringen – Gott beschützen möge,<br />
in ihrer gesamten Dimension verstehen:<br />
„Jézusz Krisztosz, Szépszőzmárja,/ Szent Antal, Szent Péter, Mindenszentek / jörözzetek meg<br />
ingemet / tüztül, viztül / nehesszigek, betegszigek, nyumuruszágok, rossz orák,/ sz hirtelen<br />
halálok!” (Tánczos 1999b: 31; Unterstreichung stammt vom Verfasser dieser Arbeit, A.K.)<br />
Auch heute noch erinnern sich die Tschangos mit großer Dankbarkeit an einen Priester<br />
deutscher Nationalität zurück, über den der Ethnologe Pál Péter Domokos (2001: 167-169)<br />
folgendermaßen schreibt: „Meine erste Reise zu den Tschangos des Szeret-Tales (1929) (...)<br />
führte mich zu Petrus Mathias Neumann (...), [der] seinen tschango-ungarischen Gläubigen<br />
durch seine vorbildliche Lebensführung, unermüdliche Arbeit, Sanftheit und Güte mit gutem<br />
Beispiel voranging (...).<br />
Es gab kein einziges Osterfest, zu dem Pater Neumann seinen Gläubigen die Beichte nicht<br />
ausnahmslos in ihrer Muttersprache abgenommen hätte, die er erfolgreich erlernt hat. Der alte<br />
Priester begann seine segensreiche Tätigkeit in Bogdánfalva. Während seiner Amtszeit und<br />
dem Kantorat Müllers erklangen die Gebete und Gesänge in ungarischer Sprache. Dies aber<br />
konnte von den rumänischen Behörden nicht geduldet werden (...), [die] ihn von einem Tag<br />
auf den anderen erbarmungslos seines Amtes enthoben. (...) Der alte Priester aber verzagte<br />
nicht. Zusammen mit seinem Kantor errichtete er in der Nähe des Dorfes Bogdánfalva eine<br />
kleine Holzkapelle, erbaute für sich und seinen Kantor je ein Häuschen, grub einen Brunnen<br />
(...), baute Wein an und führte sein bewundernswertes, einfaches, heiliges Leben weiter. (...)<br />
Die Gläubigen verließen ihren alten Priester Neumann nicht. Da sie ihre Beichte nur bei ihm<br />
78
ablegen konnten – die meisten Frauen konnten kein Rumänisch – kamen sie scharenweise zu<br />
ihm. Später verbot man ihm auch die Beichtabnahme. Seine bitteren Worte dringen an mein<br />
Ohr: „Es war der letzte Wunsch von todkranken Menschen, bei mir die Beichte ablegen zu<br />
können und man hat es uns nicht erlaubt.” Sein nach Rom gesandter Bericht über das traurige<br />
Schicksal der Moldauer Ungarn blieb unbeantwortet. Erst jetzt erkennt er, was in der Moldau<br />
unter dem Deckmantel der Kirche und des römisch-katholischen Glaubens wirklich geschieht.<br />
„Es bricht einem das Herz, wenn man von Tag zu Tag die Unterdrückung und Rumänisierung<br />
dieses durch und durch anständigen, ehrlichen Volkes sieht. Ich sage dies als ein unbeteiligter<br />
Deutscher, der sich nie in die Angelegenheiten der Politik eingemischt hat und dies auch in<br />
Zukunft keineswegs tun wird, für den aber das elementarste und heiligste Recht des Volkes<br />
darin besteht, in seiner Muttersprache Unterhaltungen führen zu können, in seiner<br />
Muttersprache Gott anbeten und huldigen zu können und in seiner Muttersprache Lieder<br />
singen zu können. Während meiner nunmehr 41-jährigen Tätigkeit bei den Moldauer<br />
Tschangos sah ich, dass dieses elementarste und heiligste Recht unaufhörlich missachtet und<br />
mit Füßen getreten wurde.”<br />
György Beke (1999: 7-10) berichtet in einer seiner dokumentarischen Erzählungen<br />
(„Beichtvater der Tschangos”) darüber, wie die alten Tschango-Frauen anlässlich der<br />
Pfingstwallfahrt von Csíksomlyó geduldig in den Schlangen vor den ihre Sprache<br />
verstehenden, „verehrten Beichtvätern” verharren, um nach erteilter Absolution beruhigt, mit<br />
geläuterter Seele nach Hause gehen zu können – darauf hoffend, das nächste Jahr noch<br />
erleben zu dürfen, um erneut ihre Sünden beichten zu können. Eine alte Tschangonin erzählt:<br />
„Unser verehrter Priester zuhause hat mich nicht richtig verstanden. Ich ihn auch nicht.”<br />
[„Nem értett meg jól a mi papocskánk. Én sem ıt.”]<br />
Im Grunde genommen begleiten ihre zahlreichen Bräuche und Riten – von der Geburt an bis<br />
zum Tod – gerade diesen Weg. Die Dorfgemeinschaft verfolgt den Lebensweg des Einzelnen<br />
mit liebevoller Empathie und sie ist es auch, die ihm schließlich die letzte Ehre erweist – der<br />
Kreis schließt sich.<br />
Hier liegt auch der Schlüssel zu ihrem Geheimnis – dazu, wie sie so lange ihre Identität<br />
bewahren konnten. Sie sind treu. Sie ehren ihre Bräuche, ihre Eltern, ihre Gemeinschaft und<br />
schließen dabei auch ihre zu Janitscharen gewordenen, sie verratenden Priester nicht aus.<br />
In der Fachliteratur wird immer wieder floskelhaft betont, dass die Tschangos über kein<br />
„Nationalbewusstsein” verfügen würden. Und in der Tat: die Tschangos blieben von den<br />
79
diversen „Ismen” abgeschnitten; das sich nach der Französischen Revolution<br />
herauszubildende Nationalbewusstsein im modernen Sinne ist bei ihnen nicht anzutreffen.<br />
Dies aber hat sie gleichzeitig vor den Entartungen des Nationalbewusstseins, dem<br />
Nationalismus und dem Chauvinismus bewahrt. Niemand wird bei ihnen wegen seiner<br />
Andersartigkeit gehasst...<br />
Sie selbst waren es, die zu Opfern dieser Gesinnungen und Affekte wurden...<br />
„(...) Die Wahrheit muss aus ihrem Versteck hervorkommen. Um auf der Mitte des Weges<br />
schreiten zu können. Das wünschen wir uns! Die Wahrheit soll hervorkommen! Wir wollen<br />
uns gegenseitig verstehen! Die Ungarn und Rumänen sollen nicht voneinander entzweit<br />
werden. Wir wollen weise sein! Sooft wir zusammenkommen, wollen wir Verständnis<br />
füreinander aufbringen. Und reden! Wir wollen miteinander in Eintracht leben!<br />
Die Wahrheit soll erhobenen Hauptes auf der Mitte des Weges schreiten, und die Lüge soll<br />
hinter den Gartenzäunen im Verborgenen bleiben!”<br />
[„Ki kell bujjék a folyó a víz tetejire, sz a zigaszság az út közepire. Hogy mennen az út<br />
közepin. Azt doriljuk mik! Legyen igazszág! Értıdjünk a zegészvel! Ne legyen kiválasztva<br />
magyar sz romántól, sz román a magyartól. Bölcseszek legyünk! Hányszor gyülünk ,<br />
kedveszek legyünk. Sz beszéllünk! Jó tanás leen közöttünk! Jöjjön a zigazszág ki a zút<br />
közepire, sz a hazugszág menjen a kert mellett lebújva!” ( BuP; N, geb. 1919)]<br />
5.1.1. Religiöses Leben, kirchliche Riten<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind auch heute noch bekannt:<br />
áld = segnen, andjal/angyal = Engel, bermál/biermál/bérmál = mit heil.Öl salben (vom Bischof), konfirmieren,<br />
firmeln, biblia = die Bibel, böt/böjt = Fasten, bötel/böjtöl = fasten, bıti/böjti = Fastenmahlzeit, bıt-nap/böjti<br />
nap = Fasttag, bulsu/búcsú = kirchliche Prozession, djertja/gyertya = Kerze, djonász/gyónás = Beichte, djonik/<br />
gyón = beichten, djontat/gyóntat = eine Beichte ablegen lassen, djordjo/ gyertya = Kerze, djordjo-tarto/két<br />
személy (férfi és nı),aki a gyertyát tartja az esküvın,esküvıi tanúk = Kerzenträger bei der Hochzeit, (es gibt<br />
deren zwei:einen Mann und ein Weib), el-látó = Weitseher, Wahrsagerin, Hellseher, hála,hála isztennek!/hála<br />
istennek! = Gott sei Dank!, hammasz-szarada/ hamvazószerda = Aschermittwoch, háramszág/szentháromság =<br />
die heil.Dreieinigkeit, harang = Glocke, Turmglocke, harangassz/harangos = mit Glocken versehen,<br />
harangaz/ harangoz = (m.Glocken)läuten, harang-láb = Glockenturm, husz-ét/húsvét = Ostern, huszhadjász/húsvét<br />
elötti 7 hetes böjtölési idıszak = die siebenwöchige Fastenzeit vor den Ostern, huszhadjásziked/húshagyókedd<br />
= Fastenabend, ilvaszó/olvasó,rózsafüzér = Rosenkranz, Perle (auch am Rosenkranz), imád<br />
= Gott anbeten, imátkazik, (auch: imádkozni, imádtszág) /imátkozik = beten, imátszág /imátság= Gebet,<br />
innap/ünnep (templomi) = kirchlicher Feiertag, iszten/isten = Gott, isztenessz/istenes = gottesfürchtig,fromm,<br />
itjilet/itélet = das jüngste Gericht, huszhadjászi-ked/húshagyókedd = Fastenabend, karásan/karácsony =<br />
Weihnachten, kereszt = Kreuz, keresztel = taufen, keresztelı szent jánasz = Johannes der Täufer,<br />
keresztelész/keresztelés = Taufe, koppon/koppan („udj koppan ez eitó: járnak e holtak,kel nekéiek práznék”) =<br />
knallen,die Tür pocht so (die Gestorbenen gehen umher,man muss sie bewirten), nyugit, meg-ny.;ez iszten<br />
nyugissza meg! = Gott gebe ihm (dem Verstorbenen) Ruhe!, lélek = Atem,Seele,Geist, kereszteletlen<br />
=ungetauft, krisztusz/Krisztus = Christus, mi-atjánk heute: mecsánk /miatyánk, = das Vaterunser, nodj-péntek<br />
heute: nadzspéntek/nagypéntek = Karfreitag, poronsolat, tíz-poronsolat/parancsolat, tíz p. = Befehl, Gebot, die<br />
zehn Gebote; szeewedıssz, szenwedıssz = Asket, szent = heilig,der Heilige, szentel,mek-szentel =<br />
heiligen,weilen, szentessz/szentes,istenfélı = gottesfürchtig, fromm;scheinheilig, szent-háramszág = die<br />
heil.Dreieinigkeit, szent-ördeg/(viccesen:pap) = Priester (scherzh.”der heilige Teufel”, szent-itjház, heute:<br />
szenticsász/ szentegyház = Kirche, szent-itjház fiu/egyházfi = Kirchendiener,Küster, szüz-márie/Szőzmária = die<br />
heilige Jungfrau , támad, fel-támad = auferstehen, támadász,felt./feltámadás = Auferstehung (der Toten),<br />
temény/tömjén = Weihrauh, vesernye/vecsernye = Abendgottesdienst,Vesper, virág-vaszárnap/virágvasárnap =<br />
80
Palmsonntag, virág-hiét/ virághét = die zweite Woche vor Ostern, zeng = tönen,klingeln(z.B.die Kirchenglocke).<br />
Die im standardsprachlichen Ungarischen gebräuchliche Bezeichnung für ’Fleisch’: hús ist<br />
hier nicht bekannt und auch im Wörterbuch Wichmanns nicht belegt; anstatt ihrer ist pisinnye<br />
gebräuchlich. Die standardsprachliche Bezeichnung für Fleisch findet sich aber in den idiomatisierten<br />
Komposita husz-hadjász/húsvét elötti 7 hetes böjtölési idıszak = die siebenwöchige<br />
Fastenzeit vor Ostern und huszhadjászi-ked/ húshagyókedd = Fastenabend.<br />
Das Phänomen des Lautwandels weisen folgende Belege auf:<br />
szent-itjház/szentegyház = Kirche → szenticsász<br />
mi-atjánk/miatyánk = das Vaterunser → mecsánk<br />
nodj-péntek/nagypéntek = Karfreitag → nadzspéntek<br />
Die Tschangos erleben das Leiden und den Tod Jesu Christi am Karfreitag nicht nur innerhalb<br />
der kirchlichen Zeremonien (Messe, Prozession,Verehrung der Heiligtümer), sondern<br />
verinnerlichen diese auch in ihrer traditionellen Volkskultur. Viele ihrer mündlich<br />
überlieferten archaischen Gebete lassen gerade die Ereignisse dieses, für einen an die<br />
Auferstehung glaubenden Menschen so wichtigen Tages wieder aufleben. Dem Ethnologen<br />
Vilmos Tánczos gemäß (1995: 151, zitiert in Halász 2002: 374) gehört der Großteil der in der<br />
Moldau bekannten Gebetstexte zum Typus der „Freitagsgebete“.<br />
Innerhalb dieses Themenbereiches findet sich folgende hybride Bildung:<br />
szüz-márie / Szőzmária = die heilige Jungfrau<br />
gebildet aus:<br />
szőz = Jungfrau + márie/Mária < rum. Marie<br />
Obwohl im Wörterbuch Wichmanns nur die obige – aus einem ungarischen und einem<br />
rumänischen Element bestehende – hybride Bildung szüz-márie belegt ist, beweisen die von<br />
den Ethnologen gesammelten heilenden Zaubersprüche und archaischen Gebete, dass in<br />
Szabófalva auch die, nun aus zwei ungarischen Elementen bestehende Zusammensetzung<br />
Szőz-Mária bekannt ist und gebraucht wird:<br />
81
„Szőz Mária meggyivissza e beteget, (...)”<br />
(Jáni Ferencz Nyica, geb. 1888, Szabófalva<br />
gesammelt von: Zoltán Kallós, 1956<br />
zitiert in Harangozó 2001: 191)<br />
„Leeresztve szent hajával,<br />
Odamenen e Szip Szőz Mária isz kérdi,<br />
Mért ülsz uljan szumurudon, Szent Fiam,...”<br />
(Szászka Erdıs Péter, geb. 1918, Szabófalva<br />
gesammelt von: Imre Harangozó, 24. Okt. 1992<br />
zitiert in Harangozó 2001: 203)<br />
Folgende ungarische Wörter sind nicht mehr bekannt:<br />
irgalmassz/irgalmas = barmherzig(kommt nur in den Kirchenliedern vor, wird aber meistens nicht verstanden),<br />
isztenke/istenke,kicsi szentkép, heute: szenteske = kleines Heiligenbild, kántar,kántarböjt = Frohnfastentag vor<br />
den Weihnachten Ostern,Pfingsten und dem Marienfest(zus.vier Tage), könörög/könyörög = zu Gott fehen, zu<br />
Gott beten, özöö-viz/özönvíz = Sinflut, szeewed:karásan-szeewedje, huszét-szeewedje/karácsony-,húsvét estje =<br />
Weihnachtsabend, Osterabend, szüket-hiét/sükethét = die dritte Woche vor den Ostern(in dieser Woche darf man<br />
sich nicht waschen:andernfalls wird man taub), tisztelendı = ehrwürdig (vom Priester).<br />
Anstatt des Lexems isztenke / istenke,kicsi szentkép = kleines Heiligenbild ist szenteske<br />
gebräuchlich.<br />
Das Lexem irgalmassz/irgalmas = barmherzig verschwand schon zu Zeiten Wichmanns aus<br />
dem aktiven Wortschatz; wie dieser bemerkt, wurde es nur automatisch in den Kirchenliedern<br />
verwendet, so dass es schon damals meistens nicht verstanden wurde.<br />
Die Assimilierung der Tschangos lässt sich zum ersten Mal im 19. Jahrhundert beobachten.<br />
In diese Zeit fällt der Beginn der Verbote des ungarischsprachigen Gottesdienstes, die sich<br />
zunächst nur gegen bestimmte Dörfer richten. Der Sprachwissenschaftler János Jerney und<br />
der Priester János Incze Petrás aus Pusztina (rum. Pustiana) berichten in den 40er Jahren des<br />
19. Jahrhunderts darüber, dass in Szabófalva (rum. Săbăoani), der größten Siedlung der Nordtschangos,<br />
der Gottesdienst jeden zweiten Sonntag in rumänischer Sprache abgehalten werden<br />
müsse. In einer weiteren Siedlung der Nordtschangos, in Ploszkucény (rum. PloscuŃeni)<br />
durfte der Kantor die Kirchenlieder nur jeden dritten Sonntag in ungarischer Sprache<br />
vortragen.<br />
Der Apostolische Visitator Giuseppe (Iosif) Salandari tauschte 1866 die bis dahin separat in<br />
ungarischer und rumänischer Sprache herausgegebenen Katechismen gegen zweisprachige<br />
Ausgaben aus. 1889 befiehlt der Bischof der Diözese Iaşi (ung. Jászvásár), Nicollo Josef<br />
Camilli in einem Hirtenbrief, dass „die in den päpstlichen Enzykliken vorgeschriebenen<br />
Gebete in den Kirchen der Pfarreien in keiner anderen Sprache als der rumänischen<br />
82
vorgetragen werden dürfen (...)” 1893 werden die zweisprachigen Katechismen endgültig<br />
gegen ausschließlich in rumänischer Sprache verfasste, einsprachige Glaubenslehrbücher<br />
ausgetauscht (siehe Vincze 2004: 20-21).<br />
Aufgrund der peripheren Lage bestand in der Moldau ein ständiger Mangel an Priestern<br />
– ungeachtet desssen, ob diese nun die ungarische Sprache beherrschten oder nicht.<br />
In dieser spezifischen Situation begannen die Kantoren (deák, diák) in der Moldau eine immer<br />
bedeutendere Rolle zu spielen. „(...) Die alltägliche Seelsorge und gewisse kirchliche<br />
Tätigkeiten (Läuten der Glocken, Abhalten von Beerdigungen usw.) gehörten zum<br />
Tätigkeitsbereich der Kantoren, die traditionell aus dem Széklerland berufen wurden. In<br />
denjenigen Siedlungen, in denen Priester dienten, die der ungarischen Sprache nicht mächtig<br />
waren, waren es die Kantoren, die während der Gottesdienste den Gläubigen die<br />
ungarischsprachigen kirchlichen Lieder vorsangen. (...) Neben der ungarischsprachigen<br />
Seelsorge waren sie auch für den Religionsunterricht zuständig. (...) Die Abhängigkeit des<br />
Kantors vom Priester begünstigte die oberste Kirchen- und Staatsführung in ihrem Bestreben,<br />
die ungarischsprachige Religiosität in den Hintergrund zu drängen” (Vincze 2004: 19).<br />
Die folgenden Entlehnungen aus dem Rumänischen sind bekannt:<br />
ivángéle (rum.evanghelie)/evangélium = Evangelium, kátikisz/katekizmus = Katechismus, manaszta<br />
(rum.mănăstire)/monostor = Kloster, matáne (rum.mătanie)/rózsafüzér = Rosenkranz, Paternoster, pomána<br />
(rum.pomană)/alamizsna,adakozás = Almosen,Gabe,Geschenk, toka (rum.toacă) = Trommelbrett (im Glockenturm),Brett<br />
zum Läuten (wird nur die drei letzten Tage vor den Ostern angewandt, wo man die gewıhnlichen<br />
Kirchenglocken nicht läuten darf), tokál = das Trommelbrett schlagen, vikár (rum.vicar) = Dechant,Senior<br />
(unter den kath.Pfarrern), vledjika (rum.vlădică) /püspök = Bischof.<br />
Im folgenden – aus einem einheimischen, (tschango)ungarischen Wort und einem rumänischen<br />
Lehnwort bestehenden – Synonymenpaar ist nur noch das rumänische Element bekannt:<br />
ilvaszó/olvasó,<br />
rózsafüzér<br />
= Rosenkranz, Perle (auch am Rosenkranz) → nicht bekannt<br />
matáne (rum.mătanie)/<br />
rózsafüzér = Rosenkranz → bekannt<br />
Das Lexem ilvaszó/olvasó,rózsafüzér = Rosenkranz, Perle (auch am Rosenkranz) ließe sich<br />
auch in die Kategorie r/a einordnen, da es von einigen Informanten – nach mehrmaligem<br />
Nachfragen – noch erkannt wird, obwohl es schon seit langer Zeit nicht mehr in Gebrauch ist.<br />
Unserer Informantin Margit Perka gemäß ist für den ’Rosenkranz’ – neben matáne – bis zum<br />
heutigen Tage die Bezeichnung rozáriu gebräuchlich geblieben, die im Wörterbuch<br />
Wichmanns nicht verbucht ist.<br />
83
Vor allem in den Dörfern gehört es zum allgemeinen Brauch, in die Särge der Verstorbenen<br />
Gegenstände zu legen, die für das Leben der Seele im Jenseits notwendig sein könnten.<br />
„Im Vergleich zu den anderen Regionen des ungarischen Sprachgebietes bestattet man den<br />
Verstorbenen bei den Moldauer Tschangos mit weniger Grabbeigaben, was sich auf zwei<br />
Gründe zurückführen lässt. Zum einen erschwerten viele Umstände bis in die 90er Jahre des<br />
20. Jahrhunderts die Beschaffung der für die Ausübung des römisch-katholischen Glaubens<br />
notwendigen sakralen Objekte (Gebetsbücher, Rosenkränze), (...) zum anderen war die Praxis<br />
der Übergabe der für den Toten bestimmten Dinge an andere Personen, die im Namen Gottes<br />
erfolgte [sog. pomána], geläufiger” (István Virt 2001: 65).<br />
„Eine der charakteristischen Bräuche der Moldauer Tschangos während der 40tägigen<br />
Trauerzeit besteht darin, für die Seele der Verstorbenen jeden Tag – bis zum Ablauf der<br />
6wöchigen Trauerzeit – im Namen Gottes Wasser zu holen und – gegebenenfalls – Essen an<br />
andere zu verteilen“ (Virt 2001: 85).<br />
Bei den Rumänen ist es gemäß den Riten des orthodoxen Glaubens gebräuchlich, zu<br />
bestimmten Gelegenheiten (Trauerzeit, Todestag, Allerseelen) – in Erinnerung an den<br />
Verstorbenen und für dessen Seelenheil – jemandem im Namen Gottes Almosen zu geben.<br />
So ist es nur allzu natürlich, dass die Tschangos mitsamt diesem Brauch auch dessen<br />
rumänische Bezeichnung übernommen haben:<br />
pomána (pomană)/alamizsna,adakozás = Almosen,Gabe,Geschenk<br />
Die Tschangos sind sich dabei über die Herkunft dieses Brauches bewusst und können auch<br />
die Unterschiede benennen:<br />
„Nach dem Begräbnis verteilen die Rumänen noch am Grab Hühner und fässerweise Wein.<br />
Beim Totenschmaus wurde für den Toten extra eine Scheibe Brot bereitgestellt – bei uns<br />
nicht.”<br />
[„A rományok a sírbatétel után tyúkot, vider bort adnak át a síron. A torban külön tettek a<br />
halottnak egy szelet kenyeret, de mi nem.” (Tatros, 1967; zitiert in: Halász 2005: 332)]<br />
„Wir gehen zum Friedhof, zu den Toten und verteilen Almosen. Wir bringen Schnaps, Wein<br />
und Geld mit. Das Geld ist für den Priester, den Alkohol teilen wir unter uns auf. Auch das ist<br />
für die Toten.”<br />
[„Menünk a cintoromba lá mort, sz adunk pománákat. Viszünk rákijut, bort, parát<br />
tarisznyában. A para a papé, az italt aggyuk egyik a másznak. Az isz a hótaké van.”<br />
(Szabófalva, 1994; zitiert in: Halász 2005: 332)]<br />
84
Sollten diverse Zeichen darauf hindeuten, dass die Seele des Verstorbenen unruhig ist,<br />
müssen erneut Almosen verteilt werden. Dieser Fall ist auch im Wörterbuch Wichmanns<br />
anzutreffen:<br />
koppon/koppan („udj koppan ez eitó: járnak e holtak,kel nekéiek práznék”) = knallen,die Tür<br />
pocht so (die Gestorbenen gehen umher,man muss sie bewirten),<br />
nyugit,meg-ny.;ez iszten nyugissza meg! = Gott gebe ihm (dem Verstorbenen) Ruhe!.<br />
Die Tschangos glauben auch heute noch, dass es Personen mit übernatürlichen Fähigkeiten<br />
gibt, die mit den Toten in Kontakt treten können und die übrigens auch im Wörterbuch<br />
Wichmanns belegt sind: siehe el-látó = Weitseher, Wahrsagerin, Hellseher.<br />
Im ungarischen Sprachgebiet werden diese besonderen Personen als látó, mondó, ellátó oder<br />
tudós bezeichnet. Vilmos Diószegi (1998: 295-300) führt den mit diesen Personen verbundenen<br />
Vorstellungsbereich bis zum Schamanismus der Landnahmezeit zurück.<br />
5.1.2. Negative Elemente, Flüche, Verwünschungen<br />
„Wenn jemand plötzlich wütend wird, [kann es im alltäglichen Leben durchaus vorkommen],<br />
dass er solche Sachen sagt, die er später bereut. Solche Verwünschungen aber erfüllen sich<br />
nicht.” [„Mikor az ember hirtelen megharagszik, mond olyat, amit aztán megbán. De az ilyen<br />
átok nem telik be.” (Lészped,1991; zitiert in: Halász 2005: 343)]<br />
Auf jeden Fall aber „... ist es eine Sünde, zu fluchen...” [„...vétek átkozódni...” (Pusztina,<br />
2004; zitiert in: Halász 2005: 342)]<br />
Bekannte ungarische Wörter:<br />
átak/átok = Fluch, átkaz/átkoz = verfluchen, átkazodik/átkozódik = fluchen, fene, mi e fenét? f. el-vedjen<br />
tégedet! = was zum Teufel? Hol dich der Teufel! kárhaszkadik/átkozódik = fluchen,wettern, lutsziper/Lucifer =<br />
Teufel,Satan, ırdeg/ördög = Teufel, ördegesz/ördöngös = Teufelskerl,diabolisch, ırdekszég/ördögség =<br />
Teufelei.<br />
5.1.3. Märchenmotive, Aberglauben, Spuren heidnischer Glaubensvorstellungen<br />
Heute lässt sich auch in der Moldau der Zerfall der traditionellen Dorfgemeinschaften sowie<br />
der archaischen bäuerlichen Lebensform beobachten, die zum langsamen, aber sicheren Verschwinden<br />
der Glaubenswelt der Tschangos beiträgt; noch im 20. Jahrhundert aber „traf der<br />
Besucher der Moldauer Dörfer auf solche Gemeinschaften archaischer Kultur, deren traditionelles<br />
Weltbild samt ihren Bräuchen sich bis in die Zeit vor der Annahme des Christentums<br />
85
zurückführen lässt. In diese Kultur haben sich auch einige Zivilisationselemente unserer Zeit<br />
fest integriert, ohne aber dabei das traditionelle System ins Wanken zu bringen” (Virt 2001:<br />
11).<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind noch bekannt:<br />
álmasz-lewiel/”álmoslevél”,álmoskönyv = Traumbuch, báil/bájol = durch Zaubermittel heilen, báilasz/bájolás =<br />
Heilung durch Zaubermittel, bobol/jósol (kukoricaszemekkel vagy játékkártyával) = wahrsagen (mit Maiskörnern<br />
od. Spielkarten); boboló/jós(nı) = Wahrsager(in); igiz/igéz = durch böse Blicke bezaubern, hemupepele/Hamupipıke<br />
= Aschenbrödel, Aschenputtel, riész-faszu-bogár= ein grosser gelber Käfer,der in der<br />
Nacht herumfliegt und mit dem man den Kindern einen Schrecken einjagt , szem-piéter-páltsza MTsz. szent<br />
Péter pálcája (egy három csillagból álló csillagzat) = eine Blume, ein Sternbild, Aronsstab, vasz-fü/vasfő = ein<br />
Zaubergewächs, vermittels dessen alles zerschlagen o. alles Zugeschlossene geöffnet werden kann. Nur der Igel<br />
kann das Gewächs herstellen.<br />
Anhand des noch bekannten Lexems álmasz-lewiel/ ”álmoslevél”, álmoskönyv = Traumbuch<br />
wird deutlich, dass der Glaube an die Träume einschließlich deren Symbolik auch heute noch<br />
lebendig ist. Die Tschangos sind bemüht, sich an ihre Träume zu erinnern, um genau<br />
beobachten zu können, ob diese sich tatsächlich auf ihr Leben auswirken würden. Sollte<br />
jemand von etwas Schlechtem geträumt haben, muss er beim Erwachen – spätestens aber bis<br />
zum Abend desselben Tages – Richtung Fenster schauen und – als Abwehrmaßnahme gegen<br />
die Erfüllung des Traumes – folgenden Spruch aufsagen:<br />
„éjvel jöttél, éjvel menj!” (Pusztina, 2005; zitiert in: Halász 2005: 343)<br />
Wie vielen Einflüssen die Kultur der Tschangos ausgesetzt ist, zeigt sich auch daran, dass in<br />
vielen Tschango-Dörfern – nach der Beobachtung des Ethnologen Péter Halász (2005: 25) –<br />
auch ein rumänischsprachiges Traumbuch, das übrigens von der Kirche herausgegeben<br />
wurde, sowie die rumänische Übersetzung von Maria Trebens Heilkräuterbuch von Hand zu<br />
Hand weitergereicht werden. Letzteres kennen sogar die des Rumänischen nicht mächtigen<br />
alten Tschango-Frauen. Péter Halász (2005: 22) macht weiterhin darauf aufmerksam, dass die<br />
Glaubenswelt der Tschangos durch eine Vermischung des heidnischen Weltbildes mit den<br />
christlichen Lehren, die sich oft gegenseitig ergänzen, gekennzeichnet ist. So bitten sie in<br />
ihren heilenden Zaubersprüchen oft die Mutter Gottes, Maria um Fürsprache und Hilfe beim<br />
Heilungsprozess, wie auch das folgende Zitat beweist:<br />
„Minden moldú orbánc,<br />
Kilenc moldú orbánc,<br />
Igízett orbánc,<br />
(...)<br />
Szőz Mária meggyivissza e beteget,(...)”<br />
(Jáni Ferencz Nyica, geb. 1888, Szabófalva<br />
gesammelt von Zoltán Kallós, 1956; zitiert in: Harangozó 2001: 191 )<br />
86
Die Bekanntheit der Lexeme bobol/jósol (kukoricaszemekkel vagy játékkártyával) =<br />
wahrsagen (mit Maiskörnern od. Spielkarten) sowie boboló/jós(nı) = Wahrsager(in) zeigen,<br />
wie wichtig das Wahrsagen in der Glaubenswelt der Moldauer Tschangos auch heute noch ist.<br />
Ein bekanntes Motiv der ungarischen Volksmärchen ist im Lexem vasz-fü/vasfő = ein<br />
Zaubergewächs, vermittels dessen alles zerschlagen o. alles Zugeschlossene geöffnet werden<br />
kann. (Nur der Igel kann das Gewächs herstellen.) erhalten geblieben.<br />
Ein anderes Märchenmotiv findet sich im Lexem hemu-pepele/Hamupipıke = Aschenbrödel,<br />
Aschenputtel.<br />
Das folgende ungarische Wort ist nicht mehr bekannt:<br />
konkol/konkoly (az ördög vetette be velük a gabonaföldeket) = Rade,soll vom Teufel in den Getreideacker gesät<br />
sein.<br />
Die Spuren der bis in die Zeit vor der Annahme des Christentums zurückführbaren<br />
Glaubenswelt finden sich in den bis heute bekannten Lexemen lelket vesz = atmen (=er<br />
nimmt die Seele auf), ki-menen e lélek = er stirbt (=die Seele verlässt ihn) und lélek = die<br />
Seele.<br />
Das Lexem lélek lässt sich auf fgr. * leßl3 ’Atem, Hauch, Seele’ zurückführen.<br />
„Gemäß den Vorstellungen der Ungarn [der Landnahmezeit] verfügt jeder Mensch über zwei<br />
Seelen. Die eine, die sogenannte Körper- oder Atemseele (...) verleiht dem menschlichen<br />
Körper die Lebenskraft (...) und verlässt diesen im Augenblick des Todes (...)” (Virt 2001:<br />
16).<br />
Die andere Seele, die Schattenseele verleiht dem Menschen seine geistigen Fähigkeiten und<br />
geistige Kraft. Im Körper des Menschen hält sie sich nur auf, wenn dieser bei vollem Bewusstsein<br />
ist; befindet sich dieser im Zustand des Schlafes bzw. der Ekstase oder wird von<br />
Fieberträumen geplagt, verlässt die Schattenseele ihren Besitzer, um sich auf eine lange<br />
Wanderschaft – ohne Beachtung von Zeit und Raum – zu begeben. Die dortigen Erlebnisse<br />
der Schattenseele erfährt der Mensch entweder hautnah in seinen Träumen oder aber<br />
durchlebt diese – im Wachzustand – vermittels Visionen. Auf diesen Glauben beruht auch der<br />
Schamanismus, dessen Priester, die Schamanen im Trancezustand eine „Reise ins Jenseits”<br />
unternehmen, um in Verbindung mit den dortigen Geistern zu treten, die sie um Rat und<br />
Beistand zur Lösung ihrer aktuellen Probleme bitten. Der Schamane fungiert so als Vermittler<br />
zwischen der Geister- und der Menschenwelt. „Ebenso wie die Atemseele verlässt auch die<br />
Schattenseele den menschlichen Körper im Augenblick des Todes. Die Schattenseele aber<br />
macht sich nicht sofort auf den Weg ins Jenseits, sondern hält sich noch eine Weile in der<br />
Umgebung der Lebenden auf” (Virt 2001: 18).<br />
87
Zur Besänftigung dieser Seele steht den Moldauer Ungarn ein reichhaltiges Repertoire von<br />
Bräuchen zur Verfügung. So wird zum Beispiel unmittelbar nach dem Todesfall das gesamte<br />
Haus gereinigt und getüncht, um das mit bloßem Auge nicht sichtbare Blut, das sich nach dem<br />
Eintritt des Todes im Hause verteilt hat, zu beseitigen.<br />
Ein anderer Brauch zur Gewährleistung des Seelenheils besteht – nach orthodoxem Beispiel –<br />
in der Verteilung von Almosen (pomána, práznik) in Form von Gebrauchsgegenständen oder<br />
Lebensmitteln, die nach festen – in diesem Kapitel bereits behandelten – Riten erfolgt.<br />
5.1.4. Gebräuche<br />
Bekannte ungarische Wörter:<br />
áldamász/áldomás = Kauftrunk,Verlobungstrunk, at,be-at/beavat = aussegnen (die Frauen nach d.Hochzeit<br />
o.nach d.Wochenbett), farsánk/farsang = Fasching(die Zeit zwischen Weihnachten u. dem Beginn der Fastenzeit),<br />
heiget/hejget = am Sylvesterabend mit Gesang und Musik(Glocken,Flöten) von Haus zu Haus herumgehen<br />
u. den Leuten Glück wünschen, heigetész/hejgetés = das Glückwünschen m.Gesang u.Musik am Sylvesterabend,<br />
hiuagat/hivogat = einladen(zur Hochzeit), hiuagató/hivogató = Hochzeitbitter (v.seiten der Braut), iének<br />
= Gesang, Lied (e tsigán iénekelt e tsinigiéböl i sziép éneket = der Zigeuner spielte auf seiner Geige ein<br />
schönes Lied), innapal/ünnepel = feiern, irt tjukman/írotttojás = bemaltes Osterei, kereszt/kereszt = Kreuz;<br />
Anredewort unter den Kindern, deren Eltern in Gevatterschaft zueinander sind; köszönöm keresztvel! Ich bin sehr<br />
dankbar! Gott lohne es dir!, kiérı/kérı = Bitter,Brautbewerber, korozmo/korozma = Taufgeschenk (ein<br />
Leinwandstück – soviel man zu einem Paar Hemdärmel braucht – mit schwarzem und rotem Strickgarn zu<br />
Strickereien, und darin hineingewickelt eine Kerze, die Kerze bekommt der Priester, das übrige die Wöchnerin,<br />
ládoiaz = das Trauerlied singen auf der Hochzeit im Hause der Braut während des weinens der Braut nd ihrer<br />
Freundinnen. (Das Lied wird von Frauen gesungen)., mátka = Freundin (einer Frau o.e eines Mädchens; mátkát<br />
vált = Freundschaft schliessen durch Wechseln von Ostereiern (dies geschieht einmal im Jahr binnen 3 Jahre),<br />
menekezı/mennyegzı = Hochzeit,Hochzeitsfest, mondjikál = singen (Lieder mit Worten,bes.auf der Hochzeit),<br />
mondjikáló = Săngerin(bes. auf der Hochzeit), ruház,meg-r. = mit Kleidern versehen, ausstatten,<br />
ausstaffieren(die Braut).<br />
Bekannte rumänische Lehnwörter:<br />
kaláka (rum.clacă) = freiwillige Arbeitshilfe leisten mit darauffolgender Tanzunterhaltung und Bewirtung seitens<br />
des unterstützten Hauswirts, kalákáz = freiwillige Arbeitshilfe leisten, korindál( a colinda) = zu Ostern von<br />
Haus zu Haus herumgehen und Glück wünschen (nur von Kindern,welche dann vom Hauswirt ein Osterei<br />
bekommen), von Haus zu Haus wandern(im allg.), kumetrie MTsz.komatria = Taufschmaus mit Musik und<br />
Tanz, lugódna (rum.logodnă)/eljegyzés = Verlobungsfeier,Verlobung, rudjina:rudjinába jár (rum.rodină)/radina<br />
= eine Wöchnerin besuchen und ihr dabei ein Brot als Geschenk geben, soknyil (a ciocni)/összekoccant:húsvéti<br />
tojást = zusammnenstossen (Eiern zu Ostern), zésztre/hozomány = Ausstaffierung,Morgengabe(hauptsächlich<br />
Kleider und Wäsche).<br />
Die folgende Entlehnung aus dem Rumänischen ist nicht mehr bekannt:<br />
hálka(rum.halcă)/fiatalok zajos összejövetele = ausgelassene Zusammenkunft junger Leute beiderlei Geschlechts<br />
Anhand einiger hervorgehobener Lexeme aus dem erhalten gebliebenen Wortschatz soll im<br />
folgenden eine kleine „Kostprobe” der auch heute noch lebendigen Gebräuche gegeben<br />
werden.<br />
88
Den Brauch der kaláka beschreibt der Szabófalver Péter Szeszka Erdıs folgendermaßen:<br />
„Die Menschen halfen einander – vor allem diejenigen, die in gevatterschaftlicher oder<br />
verwandtschaftlicher Beziehung zueinander standen – beim Hausbau, bei der Bearbeitung des<br />
Bodens, bei der Ernte der Kartoffeln und Zuckerrüben im Herbst, (...) bei der Ackerbestellung<br />
im Frühling. Auch im Falle eines Brandes eilte jeder dem Geschädigten sofort zu Hilfe;<br />
Verwandte und Nachbarn vergaßen zu diesem Zeitpunkt alle bestehenden Feindseligkeiten,<br />
legten das Kriegsbeil beiseite und halfen einander, ohne dabei jegliche Gegenleistung in<br />
Anspruch zu nehmen.”<br />
[„Az emberek segítették egymást – leginkább az atyafiság, rokonság – a házépítésben, a<br />
kapálásban, ısszel a pityóka és cukorrépa betakarításában, (...) a tavaszi szántásban.<br />
Hasonlóképpen tőz esetén mindenki segítségére sietett a károsultnak, rokonok, szomszédok<br />
akkor félretettek bárminı ellenségeskedést és segítettek minden igény nélkül.”]<br />
(zitiert in: István Imreh – Péter Szeszka Erdıs 1978)<br />
Das Lexem ruház,meg-r./hozomány = mit Kleidern versehen,ausstatten,ausstaffieren(die<br />
Braut) gehört in die Kategorie r/a : das Wort wird zwar noch erkannt, aber kaum mehr<br />
gebraucht und ist somit Bestandteil des passiven Wortschatzes; es wurde durch die Bildungen<br />
mit zésztre (rum.zestră)/hozomány = Ausstaffierung, Morgengabe (hauptsächlich Kleider und<br />
Wäsche) aus dem Sprachgebrauch verdrängt.<br />
Nichtsdestotrotz zeugen beide Lexeme von der großen Bedeutung, über die die Aussteuer in<br />
der traditionellen Dorfkultur verfügt. Jahrelang spannen, webten und stickten die Frauen des<br />
Hauses – nach traditionellen, vorwiegend geometrischen Mustern – an der Mitgift der<br />
Mädchen, die aus einer bestimmten Anzahl von Hemden, Rockschürzen (katrinca), Gürteln,<br />
Tüchern, Bettwäsche und Tischdecken bestand; darüber hinaus gehörten auch einige Beutel<br />
und Säcke zur Aussteuer.<br />
Weitere Bestandteile der Mitgift der heiratsfähigen Mädchen waren der Pelzmantel (kozsók),<br />
der nun schon vom Kürschner des Dorfes angefertigt wurde, sowie die Tuchjacke (veszton)<br />
bzw. der Tuchmantel, mit deren Herstellung wiederum der Dorfschneider beauftragt wurde.<br />
Verwahrt wurde die aus den oben erwähnten Textilien bestehende Mitgift der zukünftigen<br />
Braut in einer Truhe, die auf dem Marktplatz der nächstgelegenen Stadt erworben wurde.<br />
Bis 1949 blieb die Truhe das einzige Möbelstück, das das heiratsfähige Mädchen mit in die<br />
Ehe nahm (siehe Kós 1976: 201).<br />
Während die Frauen mit der Herstellung des Inhalts der obigen Truhe beschäftigt waren,<br />
sprachen die Männer über das „Geschäftliche“. „Gemäß altem Brauch bekam die Tochter des<br />
Hauses genausoviel Land und Boden wie der Sohn (...) Auch vom Viehbestand erhielten die<br />
Geschwister gleich große Anteile (...) Während sich die Vererbung des Hauses nach der<br />
väterlichen Linie, dem sogenannten Vaterrecht richtete, erfolgte die des Hanffeldes nach der<br />
mütterlichen Linie, dem sogenannten Mutterrecht” (Kós 1976: 200). Das elterliche Haus erbte<br />
89
der jüngste Sohn, der gegebenenfalls seinen Anteil für die Auszahlung seiner Schwester<br />
verwendete.<br />
„Verließ die Frau ihren Mann, verlor sie ihre Mitgift, da diese beim Ehemann verblieb, der<br />
die Rückgabe der Aussteuer an seine Frau verweigerte, falls diese das gemeinsame Haus<br />
ohne Angabe von triftigen Gründen verließ.”<br />
[„Amikor az asszony elhagyta férjét, hozományát vesztette, mert az a férjnél maradt, és az<br />
nem akarta visszaadni, ha az otthont alapos indok nélkül hagyta el.” ]<br />
(Péter Szeszka Erdıs, Szabófalva; zitiert in: Imreh – Szeszka Erdıs 1978: 195)<br />
Während die Größe der Mitgift – zumindest, was den Grund und Boden, den Viehbestand<br />
sowie die landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte betraf – die gesellschaftliche Gliederung des<br />
Dorfes widerspiegelte, galt dies nicht für den Teil der aus Textilien bestehenden Mitgift, den<br />
die Frauen des Hauses selbst herstellten und der somit nicht mit zusätzlichen Kosten<br />
verbunden war. Diese Aussteuer wurde meist aus denselben Stoffen und nach denselben<br />
Schnitt- und Stickmustern angefertigt; Unterschiede bestanden einzig in der Anzahl einiger<br />
Kleidungsstücke. Nach und nach begannen immer mehr Großbauern, die Mitgift ihrer Töchter<br />
durch die Angebote der Geschäfte zu bereichern, so dass der Besitz der industriell<br />
hergestellten Produkte (Tücher, Mäntel, Schuhe, Decken, usw.) allmählich zum Statussymbol<br />
wurde.<br />
„Es bestand zwar keine Verpflichtung, doch wenn die Mädchen des Hauses ihre Eltern<br />
verloren, war das Gefühl der geschwisterlichen Zuneigung dermaßen stark, dass sich die<br />
Brüder für die Bereitstellung der Mitgift ihrer Schwestern zuständig fühlten. Gewöhnlich war<br />
es der älteste Bruder, der die Kosten der Verheiratung der verwaisten Mädchen übernahm.<br />
[„A testvérek nem voltak kötelesek, de testvéries érzésbıl adtak kelengyét szülı nélkül maradt<br />
leánytestvéreiknek. Rendszerint a legidısebb testvér házasította ki az árván maradt<br />
leányokat.” ] (Péter Szeszka Erdıs, Szabófalva; zitiert in: Imreh – Szeszka Erdıs 1978: 195).<br />
Mittlerweile gehört die häusliche Herstellung der Aussteuer der Vergangenheit an; obwohl<br />
man sich zwar dem modernen, konsumorientierten Zeitalter angepasst hat und bei der Zusammenstellung<br />
der Mitgift das überreiche Warenangebot der Geschäfte nutzt, hat sich etwas<br />
Grundlegendes nicht verändert: auch heute noch wird die Ausstattung der heiratsfähigen<br />
Mädchen mit einer Mitgift als eine Frage der Ehre betrachtet...<br />
Der „aktualisierte” Wortschatz des Wichmann-Wörterbuches ist ein weiterer Beweis dafür,<br />
dass die mit den kirchlichen Festen verbundenen Bräuche der Tschangos auch heute noch<br />
90
– 100 Jahre nach ihrer Beschreibung – lebendig sind. Im Übrigen konnten sich auch bei den<br />
Tschangos viele Bräuche aus heidnischer Zeit in die christliche Kultur „hinüberretten” wie<br />
zum Beispiel die österlichen Bräuche als Symbole des ewigen Kreislaufes der Natur.<br />
Ostern ist das Fest des Lebens sowie der Auferstehung Jesu Christi, die durch das Ei symbolisiert<br />
werden. Der Brauch des Bemalens und Verzierens der Ostereier ist auch bei den<br />
Moldauer Ungarn bekannt. Erwähnenswert hierbei ist, dass bei den Tschangos vorwiegend<br />
die älteste Verziertechnik, die sogenannte Wachstechnik in Gebrauch ist, deren archaische<br />
Muster von Generation zu Generation weitergegeben wurden.<br />
Der folgende, auch im Wörterbuch Wichmanns innerhalb des Wortartikels mátka = Freundin<br />
(einer Frau o.eines Mädchens) beschriebene Brauch: mátkát vált = Freundschaft schliessen<br />
durch Wechseln von Ostereiern (dies geschieht einmal im Jahr binnen 3 Jahre) ist auch heute<br />
noch bekannt. „Die Moldauer Tschangos bezeichnen den ersten Sonntag nach Ostern (Weißer<br />
Sonntag) als mátkázó bzw. mátkaváltó vasárnap. (...) Der mit diesem Tag verbundene Brauch<br />
des Freundschaftsschließens ist weitverbreitet und in den meisten der Tschango-Dörfer<br />
anzutreffen“ (Halász 2002: 384-385). An diesem Tag beschenkten sich die 12-16jährigen<br />
Mädchen gegenseitig mit Ostereiern, die zum Pfand von lebenslang geltenden Freundschaften<br />
wurden. Dieser Brauch wird mittlerweile auch von den Jungen derselben Altersgruppe<br />
übernommen. „Die Freundschaftsschließung erfolgte gewöhnlich nach dem vormittäglichen<br />
Gottesdienst vor der Kirche oder an einem anderen Ort (…), [wobei] ein Spruch aufgesagt<br />
wurde, [der diesen Pakt besiegelte]. Betrachtet man die beachtliche Metamorphose dieses<br />
Spruches, ist es äußerst interessant, dass vor allem die nördlichen Tschangos in der<br />
Umgebung der Stadt Roman dessen gebundenere Form bewahrt haben, die traditioneller zu<br />
sein scheint. (...) Diese archaischere Form ist selbst in denjenigen Tschango-Dörfern<br />
anzutreffen, deren Bewohner ihre einstige Muttersprache schon längst nicht mehr kennen<br />
(...)” (Halász 2002: 385-386). Diese Grundform ist auch in unserem Untersuchungsdorf,<br />
Szabófalva gebräuchlich:<br />
Ezend e világon vagyunk mátkászok,<br />
mász világra hugosszak.<br />
(gesammelt von Pál Péter Domokos, zitiert in: Halász 2002: 386)<br />
Innerhalb der Frühlingsbräuche darf die Pfingstwallfahrt der Tschangos nach Csíksomlyó<br />
nicht unerwähnt bleiben.<br />
Aus der 1444 erlassenen Bulle Papst Eugens IV. wird ersichtlich, dass sich in der Ortschaft<br />
Somlyó häufig eine riesige Menge von Gläubigen zu Ehren der Mutter Jesu, Maria<br />
91
versammelte. Demzufolge war Csíksomlyó schon im 15. Jahrhundert ein bedeutender<br />
Wallfahrtsort. An der Stelle der früheren, 1448 geweihten gotischen Kirche steht seit dem 20.<br />
<strong>August</strong> 1876 die heute bekannte Csíksomlyóer Andachtskirche, die im Laufe ihrer Geschichte<br />
mehrmals renoviert wurde und von Neuem und Neuem wiederaufgebaut werden musste. Die<br />
sich hier befindliche Marienskulptur aus Lindenholz hat die zu ihr betenden Csíker<br />
Katholiken – ihrem Glauben gemäß – schon mehrmals vor den diese bedrohenden Gefahren<br />
beschützt.<br />
Die Moldauer Ungarn bringen Maria, der Mutter Gottes die höchste Ehrerbietung entgegen.<br />
Auf die Begegnung mit Maria in Csíksomlyó bereiten sich die Wallfahrer sowohl seelisch als<br />
auch körperlich vor, indem sie u.a. die Beichte ablegen, Bußübungen leisten, fasten, beten,<br />
den mehrtägigen Fußmarsch und den Kreuzweg zurücklegen. .„Durch die Wirkung der<br />
mehrere Tage andauernden ständigen Gebete, Gesänge, sich immerwährend erneuernden<br />
heiligen Handlungen geraten die unausgeschlafenen, körperlich erschöpften Wallfahrer in<br />
eine Art ekstatischen, emotional gespannten Zustand” (Tánczos 1999a: 50).<br />
Die Moldauer Tschangos versammeln sich am östlichen Abhang des Berges Kis-Somlyó, um<br />
betend auf den Sonnenaufgang zu warten, in dessen Strahlenflut ihnen die Mutter Gottes<br />
erscheint. Als archaischste ungarische Volksgruppe haben die Moldauer Tschangos dieses<br />
Element des uralten Sonnenkultes am Besten bewahrt, das sich in das christliche Weltbild<br />
integriert hat.<br />
Die Bräuche um Weihnachten und Neujahr weisen Elemente auf, die sich bis in die Urzeiten<br />
der menschlichen Kultur zurückverfolgen lassen, als man ausgiebig die auf den 21. Dezember<br />
fallende Wintersonnenwende feierte. Da sich die Zeitrechnung der Menschen im Altertum<br />
nach dem Sonnenjahr richtete, wurde dieses astronomische Ereignis auf den 25. Dezember<br />
datiert; dieser Zeitpunkt galt als Geburtstag der Sonne. Durch die päpstliche Verfügung aus<br />
dem Jahre 354 unserer Zeitrechnung wurde das Weihnachten genannte christliche Fest der<br />
Geburt Jesu Christi auf den obigen Tag, d.h. den 25. Dezember datiert (siehe János Xantus<br />
1972: 395-397).<br />
Die Bewohner unseres Untersuchungsdorfes Szabófalva – um nun zu den Moldauer Ungarn<br />
zurückzukehren – stellen zu Weihnachten keinen Christbaum auf. Am Heiligen Abend<br />
nehmen sie am nächtlichen Gottesdienst teil und sehen sich die in der Kirche ausgestellten<br />
Krippenfiguren an. Weitere Bräuche sind die Abhaltung von Weihnachts- und<br />
Krippenspielen, die Einhaltung der weihnachtlichen Speisenfolge und der Besuch der<br />
Verwandten.<br />
92
Eines der charakteristischsten Winterbräuche der Moldauer Ungarn ist auch im Wörterbuch<br />
Wichmanns belegt, der diese Begrüßung des neuen Jahres folgendermaßen beschreibt:<br />
heiget/hejget = am Sylvesterabend mit Gesang und Musik (Glocken, Flöten u.a.) von Haus zu<br />
Haus herumgehen u.den Leuten Glück wünschen, heigetész/hejgetés = das Glückwünschen<br />
mit Gesang und Musik am Sylvesterabend; am Sylvesterabend ausgeführter Gesang<br />
Obwohl die Sprüche, die die obigen Glückwünsche begleiten, mittlerweile nur noch in rumänischer<br />
Sprache bekannt sind, gibt es nach den Kenntnissen unseres Sprachmeisters Mihály<br />
Perka auch eine solche Variante, in der innerhalb des rumänischen Textes ungarische Wörter<br />
– sozusagen als „Streudenkmäler” – automatisch erhalten geblieben sind. Im Rumänischen ist<br />
die Begrüßung des neuen Jahres übrigens unter der Bezeichnung „Pluguşor” bekannt.<br />
5.2. Tänze<br />
Der französische Sekretär des Moldauer Woiwoden Alexandru Ipsilanti, Graf Hauterive<br />
erwähnt in seinem Werk „Die Lage der Moldau im Jahre 1787” die in der Moldau lebenden<br />
ungarischen „Siedler”, die zwar die Sprache und Sitten des sie aufnehmenden Landes<br />
übernommen, gleichzeitig aber auch ihre eigene weiterbewahrt hätten; besonders das<br />
Festhalten an ihre konfessionelle Zugehörigkeit sei für sie von enormer Wichtigkeit; ihre<br />
Priester aber würden ihre Sprache nicht verstehen. Hauterive hebt den „unermüdlichen Fleiß”<br />
der Moldauer Ungarn hervor, die aber – nach getaner Arbeit – auch die Kunst des Feierns<br />
verstehen würden. Nach der ausführlichen Beschreibung ihrer Tänze schließt der Bericht über<br />
die Moldauer Ungarn mit der Bemerkung, dass es kaum jemanden unter ihnen gäbe, der seine<br />
Zeit in der Kneipe verbringen würde (siehe Hegyeli 2004: 46).<br />
Graf Hauterive schrieb Hunderte solcher Berichte an Napoleon und war jahrelang der Direktor des französischen<br />
Nationalarchives.<br />
Der Ethnologe Péter Halász macht darauf aufmerksam, dass es noch zu wenige<br />
Beschreibungen und Analysen der Tänze der Moldauer Ungarn gäbe, obwohl es sich durchaus<br />
lohnen würde, sich eingehender mit diesem Themenkomplex zu beschäftigen, da „die<br />
unterschiedlichen Tänze, die teilweise archaische Elemente bewahrt haben und teilweise<br />
einen starken rumänischen Einfluss aufweisen, gute Indikatoren für die interethnischen<br />
Beziehungen” seien (siehe Halász 2002: 42).<br />
93
Von Pál Péter Domokos (2001: 219) erfahren wir, dass sich in unserem Untersuchungsdorf<br />
Szabófalva die Jugendlichen jeden Sonntagnachmittag zum Tanz zusammenfanden, wobei<br />
nur Mädchen mit Mädchen und Jungen mit Jungen tanzten.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
fiél-tántsz/féltánc = Name eines Tanzes, kereszel,kereszil/táncnév = ein Tanz(wird zu zweien getanzt), kereszelt<br />
jár = diesen Tanz tanzen, kiész-tántsz = Reigen, Rundtanz, tántsz/tánc = Tanz.<br />
Weiterhin bekannt sind folgende rumänische Lehnwörter:<br />
vatáv(rum.vătav) = der Besteller beim Tanz (er bestellt die Zigeunermusik,bewirtet die Musikanten und sammelt<br />
das Geld für die Musikanten.<br />
Nicht mehr bekannt sind das ungarische Lexem rop = die Füsse zusammenschlagend und<br />
stampfend tanzen sowie die Entlehnung aus dem Rumänischen veteuitsza (rum.vătăviŃă) =<br />
unter den Dorfmädchen die Bestellerin beim Tanz, bei der Ausstattung der Kirche.<br />
5.3. Bekleidung<br />
Das Tragen der Volkstracht ist bei den Moldauer Ungarn nicht mehr in Gebrauch; die traditionelle<br />
Bekleidung der Tschangos wird höchstens noch anlässlich gewisser Veranstaltungen im<br />
schulischen und kirchlichen Rahmen getragen oder ist im – von unserem Szabófalver Sprachmeister,<br />
Mihály Perka errichteten – Museum anzutreffen. Hier finden sich authentische<br />
Kleidungsstücke älteren und jüngeren Datums, die Mihály Perka in mühevoller Kleinarbeit<br />
gesammelt und zusammengestellt hat.<br />
In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hebt der Ethnologe Gábor Lükı hervor, dass die<br />
obige Bekleidung einst „bei den Völkern Südosteuropas allgemein gebräuchlich war.<br />
Mittlerweile ist diese Tracht nur bei einem Bruchteil der hier lebenden Völker anzutreffen. In<br />
der Moldau zum Beispiel wird sie von den Ungarn bewahrt. Aus diesem Grund gilt sie<br />
heutzutage in der Moldau – sowohl von Seiten der Ungarn als auch der Rumänen – als<br />
„ungarische Tracht”. Auch der rumänische Historiker Iorga [1912: 11, 16-17] bezeichnet<br />
diejenigen Bewohner der Moldau, die die obige Tracht tragen, als Ungarn – selbst dann, wenn<br />
ein Großteil von ihnen der ungarischen Sprache nicht mehr mächtig ist. In Siebenbürgen<br />
wiederum wurde diese Tracht bis zum heutigen Tage einzig von den Rumänen bewahrt, so<br />
dass sie in dieser Region als „rumänische Tracht” angesehen wird” (zitiert in Lükı 2002: 32).<br />
Die folgende, skizzenhafte Darstellung der Bekleidung der Moldauer Ungarn stützt sich auf<br />
die detaillierte Beschreibung von Károly Kós (1976: 199-210).<br />
94
Die Frauen besaßen – sowohl für den Alltags- als auch Festtagsgebrauch – mehrere, kunstvoll<br />
bestickte Leinenhemden. An beiden Rändern des charakteristischen Wickelrockes, der<br />
katrinca befanden sich Streifen, deren Farbzusammensetzung, Breite und Beschaffenheit von<br />
Dorf zu Dorf und nach Lebensalter variierten, womit diese eine bestimmte Signalfunktion<br />
erfüllten.<br />
Die Gürtel versahen die Frauen zusätzlich mit einem bunten Gürtelband.<br />
Kopfbedeckung trugen nur die verheirateten Frauen. Charakteristisch war die sogenannte<br />
Kerpa-Haartracht: ein Gertenreif wurde ins Haar geflochten, um auf diesen ein weißes<br />
Kopftuch zu befestigen. Einen weiteren wichtigen Bestandteil der Bekleidung der Frauen<br />
bildete der Halsschmuck in Form von Rosenkränzen, Perlen, oder alten Geldmünzen.<br />
Während der Feldarbeit im Sommer trugen die Frauen große Strohhüte und gingen barfuß; an<br />
Feiertagen, zu festlichen Gelegenheiten und im Winter trugen sie Lederpantoffeln oder<br />
Stiefel, die sie vom örtlichen Schuhmacher anfertigen ließen.<br />
Über ihre weißen Wollhosen (itszár) trugen die Männer knielange Hemden. Bestandteile ihrer<br />
Tracht waren weiterhin der breite Ledergürtel, die Lederweste (keptár), der Riemenschuh<br />
(boskor) und Stiefel. Im Sommer trugen die Männer schwarze Hüte, im Winter Pelzmützen<br />
(kusma); ihre Haare waren lang und nach hinten gekämmt.<br />
Die Stoff- und Pelzmäntel (kozsok) ließen die Moldauer Ungarn vom örtlichen Schneider<br />
bzw. Kürschner anfertigen.<br />
Die Tracht jedes einzelnen Dorfes wies spezifische und erkennbare Unterschiede in den<br />
Schnitt- und Stickmustern bzw. der Verzierungsart (sowohl in den Motiven als auch in der<br />
Farbauswahl der Verzierungselemente) auf. An der Bekleidungsart wurden das Lebensalter,<br />
der Familienstand und der gesellschaftliche Status des Trägers deutlich, worüber sich der<br />
tschango-ungarische Dichter, István András Duma folgendermaßen äußert:<br />
„Die Tschangos zeigen durch ihre Tracht, wer sie sind und woher sie stammen: aus welchem<br />
Dorf, aus welchem Dorfteil. Man kann sogar erkennen, ob der Betreffende verheiratet ist oder<br />
nicht. Ob er in Trauer ist, ob er sich vor kurzem mit jemandem verlobt hat und sich nun auf<br />
seine Hochzeit vorbereitet. Was er gerade macht: ob er die Menschen zur Hochzeit bittet oder<br />
nach Taufpaten sucht.”<br />
[„A csángók pedig mutatják a viseletükben, hogy ki és honnan származik, melyik faluból,<br />
melyik falurészbıl, sıt azt is lehet tudni, hogy házas-e az illetı vagy nem. Ha gyászban van,<br />
hogy éppen most jegyzett el valakit és készül a menyegzıre. Hogy mit csinál most, éppen<br />
hívogat a menyegzıbe, vagy keresztapákat keres.” ]<br />
Der Ethnologe Károly Kós (1976: 210) macht schon in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts<br />
auf die Einflüsse aufmerksam, die die traditionelle Tracht der Moldauer Ungarn umzuformen<br />
95
eginnen: „Ebenso wie in den anderen Bereichen der Volkskultur der Tschangos macht sich<br />
der Einfluss der unterschiedlichen städtischen Modeerscheinungen – die sich vor etwa 50-60<br />
Jahren zu verbreiten begannen – sowie der industriell hergestellten Produkte auch im<br />
Bekleidungs-bereich immer stärker bemerkbar. Diese Einflüsse sind natürlich und<br />
unaufhaltsam. Aus diesem Grund spielt in diesem Themenkreis eine um so vollständigere<br />
Sammlung des wahrhaften, authentischen Volkserbes, die dann späteren Untersuchungen zur<br />
Verfügung gestellt werden kann, eine dermaßen große Rolle.”<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
boskor/bocskor = niedriger, weicher Riemenschuh, bunda/bunda = kurze Pelzweste (aus Lammfeld, wird im<br />
Herbst, Winter u.Frühjahr getragen), bundaska/bundácska = kleine Pelzweste, burka/burok,takaró =<br />
langhaarige wollene Decke, Überdecke in verschiedenen Farben (bes.im Winter auf Reisen angewandt),<br />
djürü/győrő = Ring, aran-dj./aranygyőrő = Ring (aus Gold), feire-walo /”fejbevaló”, fejkendı =<br />
Kopfbedeckung, gadja/gatya = Unterhosen, galér/gallér = Kragen, horgosz, horgosz-borgosz = m. bunten<br />
Perlenstickereien versehene rote o. schwarze Stirn-o. Halsbinde, ebensolches Hutband der jungen Männer,<br />
ingeske = ingecske = kleines Hemd, Hemdchen, ing-vál/ingváll = ein viereckiges, m.Stickereien benähtes Stück<br />
am Oberärmel des Frauenhemdes, kalap = Hut, kaptsza/kapca = Fusslappen,Stiefelfetzen, kendı = Kopftuch<br />
der Frauen, keszkenı/mennyasszonyi fátyol = weisses, grosses Flortuch (Kopftuch) o. Schleier der Bräute (wird<br />
auch von den jungen Frauen zwei o. drei Jahre lang getragen), kestjü /kesztyő = Handschuh, lebegı = kleiner,<br />
glänzender, am Hemdärmel angenähter Metallfilter, kusma/kucsma = Pelzmütze, pendel/pendely =<br />
Hemdschoss,unterer Teil des Hemdes, ronydjo/ rongy = Kleid,Kleidungsstück, Gewand, Weisszeug,<br />
ruha/pelenka = Windel, ruhászsz/ruhás = der viel Kleider hat, szedész/szedés = Benennung eines über den<br />
oberen Ärmel (am Hemde der Frauen) gestickten Streifens o. Nähmusters, szeru/saru = Stiefel, szeruszsz/sarus<br />
= der Stiefel angezogen hat, silaszsz/aranyszálas hímzés = mit Goldfäden gestickt, m.Stickereien von<br />
Goldfäden, szoknyo heute eher: suman /szoknya = Überzieher (sowohl der Männer als der Frauen) aus grobem<br />
Wollstoff, ujaszsz,ing-u./ujjas = m.Fingern versehen (z.B.der Handschuh) m.Ärmel versehen(z.B. ein Pelzrock),<br />
varrászsz/varrás = Nähen, Naht.<br />
Weiterhin bekannt sind auch die folgenden rumänischen Lehnwörter:<br />
barnéts (rum. bârneŃ) = ein Gürtel, womit die Weiber ihren Kittel am Leib festbinden, bokiis (rum. bocanc)/<br />
bakancs = Schnürstiefel, Schnürschuh (wird jetzt im allg. nur von Weibern getragen; früher auch von Männern),<br />
ganáf (rum.canaf)/kanaf = der Pferdeschweif am Fez eines türkischen Pascha, geitán(rum.găitan) = farbige<br />
Wollenschnur am Hut, gitsa (rum.gãŃă, păr împletit)fonott haj,lányoknál = Haarflechte (der Mädchen),<br />
welche noch bisweilen auf einen Metalldraht in Form eines Reifs rings um den Kopf geflochten wird),<br />
gugle (rum.glugă) = Kapuze, Regenkappe (wird bei Regen bes. von den Schafhirten getragen),<br />
itszár (rum.iŃar) = weisse, wollene Bauernhosen (werden nur im Herbst und Frühjahr getragen), katrintsza<br />
(rum.catrinŃă)/kötény,szoknya = Weiberschürze (die um den ganzen Leib wie ein Kittel getragen wird), kirpa<br />
(rum. cârpă) = das untere Kopftuch der Frauen (das, welches unmittelbar um die Frisur umgebunden wird; das<br />
große weisse, obere Kopftuch wird kendı genannt, kazók (rum.cojoc)/(báránybunda) = Pelz aus Schaffell,<br />
keltszun (rum. colŃun)/harisnya = Strumpf, kimiér(rum.chimir) = breiter Doppelgürtel (von Leder)der Männer<br />
(in diesem wird gew.die Geldtasche, das Einschlagmesser, der Tabak u.ä. aufbewahrt), kóda (rum.cordea,<br />
panglică) = Streifen,Band; mit Perlen und Stickereien ausgenähte Bänder, die zu dem mit Blumen gezierten<br />
Festkopfputz der Mädchen,bes. der Braut, gehören, kódássz = mit einem Festkopfputz ausgestattet, nótjin<br />
(rum.noatină) = ganz schwarzer (nicht aber gefärbter) wollener Überzieher, pepus (rum.papuci)/papucs =<br />
Pantoffel (aus Leder), szirág (rum.şirag)/gyöngysor = Perlenschnur, tulpán (rum.tulpan)/színes fejkendı =<br />
buntes Kopftuch (bes. der Mädchen; immer gekauft), sápka (rum.şapcă)/ sapka = Schirmmütze, tszinta<br />
(rum.Ńintă) = Knopf als Beschlag, z.B. am Gürtel, am Geschirr, am Koffer, tszurka (rum.Ńurcă) = grosser<br />
wollener Mantel der rumänischen Schafhirten(die Wolle nach aussen, die hängende Wolle ist in den Stoff<br />
hineingewebt).<br />
96
Nicht mehr bekannt sind die folgenden ungarischen Wörter:<br />
aba = weisser, grober Flanell zu Hosen, guna/gúnya = Oberkleid, harisna/harisnya,férfi posztónadrág =<br />
Männerhosen von groben Loden , kontosz/köntös = Überzieher (der Herrenleute), Paletot, nyak-kötı/sál =<br />
Halstuch, páua/pálha = Zwickel (z.B.im Hemd), pentszik = Zwickel (an den Hosen), polka-roha/pelenka =<br />
Windel, Wickelzeug, prim/prém = Gebräme an der Pelzweste o.am Pelzrock, rokolo/rokolya = Weiberkittel,<br />
szárika = Hosenbein (Fussbekleidung aus Loden; wird im Herbst und Frühling über den Unterhosen, anstatt der<br />
Hosen,getragen, szerszám/szerszám = hängender Zierat (bes.Fransen u.ä.) am Frauenkleid, vállazó = Unterfutter<br />
am Winterhemd der Männer.<br />
Auch die folgenden Entlehnungen aus dem Rumänischen sind nicht mehr bekannt:<br />
katszavéka (rum.caŃaveică,scurteică) = kurzer Pelzrock der Frauen (wird nur von Zigeunerinnen und<br />
Rumäninnen getragen, tjike (rum.tichie) = Fez.<br />
Im folgenden Synonymenpaar, das aus einem einheimischen, (tschango)ungarischen Wort<br />
und einem rumänischen Lehnwort besteht, sind beide Elemente bekannt:<br />
bunda/bunda = kurze Pelzweste (aus Lammfell) → bekannt<br />
kazók (rum.cojoc)/(báránybunda) = Pelz aus Schaffell<br />
→ bekannt<br />
Zwischen den beiden Elementen unterschiedlicher Herkunft liegt eine Bedeutungsdifferenzierung<br />
vor, was zum Erhalt des ungarischen Wortes beiträgt<br />
Anstatt des Lexems szoknyo /szoknya = Überzieher (sowohl der Männer als der Frauen) aus<br />
grobem Wollstoff ist heute eher suman gebräuchlich.<br />
Im aktiven Wortschatz der Moldauer Tschangos finden sich nicht nur archaische ungarische<br />
Wörter, sondern auch rumänische; in unserem Fall das Lexem keltszun (rum. colŃun)/ harisnya<br />
= Strumpf, das in der rumänischen Standardsprache schon längst nicht mehr gebraucht wird.<br />
5.4. Ernährungsgewohnheiten<br />
Mit den spezifischen Ernährungsgewohnheiten der Moldauer Ungarn hat man sich bis in<br />
jüngster Zeit kaum beschäftigt. Diese Forschungslücke möchte nun eine aus ihren eigenen<br />
Reihen stammende Intellektuelle, Tinka Nyisztor schließen. In ihrer Doktorarbeit stellt sie die<br />
Ernährungsgewohnheiten der Tschangos vor, vergleicht diese mit denen der benachbarten<br />
Rumänen, um schließlich ihre gewonnenen Ergebnisse über die Ernährungskultur in der<br />
Moldauer Region innerhalb des gesamteuropäischen Kontextes darzustellen. Tinka Nyisztor<br />
unterscheidet in ihrer Untersuchung zwischen den Alltags-, Festtags- und Fastenspeisen.<br />
97
Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Festtagsspeisen, deren Quantität<br />
und Qualität einschließlich der Reihenfolge, in der sie gereicht werden, einen funktionellen<br />
Charakter bekommen: die Mahlzeiten erreichen eine „zeremonielle und rituelle” Sphäre, in<br />
der alles von ungeschriebenen Gesetzen bestimmt wird (siehe Nyisztor 2001: 5-6).<br />
Den Informationen unseres Sprachmeisters Mihály Perka gemäß werden – obwohl inzwischen<br />
auch in den Haushalten der Moldauer Ungarn die modernen Küchengeräte ihren Platz<br />
gefunden haben – die Gänge der festlichen Mittagsmahlzeiten (zu Ostern und Weihnachten)<br />
immer noch in traditionellen Tontöpfen zubereitet; diese Töpfe wurden nach den<br />
Schutzheiligen des betreffenden Dorfes benannt. Der Schutzpatron unseres<br />
Untersuchungsdorfes Szabófalva ist der Heilige Michael; der Festtagstopf wird somit als<br />
szentmihályi fazék bezeichnet.<br />
Die folgenden ungarischen Sammelbezeichnungen sind bekannt:<br />
édesszég/édesség = Süssigkeit,Naschwerk, pisinnye/pecsenye, ált.hús = Fleisch(im allg.)<br />
Weiterhin bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
alut-tei/aludttej = geronnene Milch(nicht Saure), biélesz/béles = Käsekuchen, Weizenmehlkuchen m. Füllung<br />
v.Quark u.Eiern, bor = Wein, diszno-fel/disznózsír = Schweinefett, djiosz-rétesz/diósrétes = Nussstrudel,<br />
etszet/ecet = Essig, fel/zsír = Schmalz, Fett, felessz/ feles = schmalzig,fettig, hab = Schaum, haimász/hagymás<br />
= m.Zwiebeln bereitet o. Gemischt, Zwiebel-, hurka = Wurst (Schweinsdarm, zur Aufnahme der Wurstmasse<br />
bereitet, kakasz-tei/kakastej = Grütze von zerstossenen und gekochten Hanfsamen, kakósz/kakas = gerösteter<br />
Mais, kalász/kalács = rundes Weizenbrot, karé/karéj = Brotkante, kásza,kölesz-k./köleskása = Hirsegries,<br />
Hirsebrei, keniér,kiniér/kenyér = Brot, kiner-biél/kenyérbél = Krumme des Brotes,Schmolle, lew,árpalew/lé,árpalé<br />
= Saft,Suppe,Gerstenwasser, liszt,búza-liszt = Mehl, mákkasz-rétesz/mákosrétes = Mohnstrudel,<br />
morzo/morzsa = Krumme,Krümchen (bes. von Brot), oltat/”oltott”,kocsonya = Sülze, pálinka,heute eher: rákjú<br />
= Branntwein, peretsz/perec = geflochtene Brezel (zu Hause gebacken), piratszka/tehéntúróval töltött<br />
fánkszerő tészta = mit Quark und Eiern gefüllte Maultasche, ein kleines pasteten o.krapfenartiges Gebäck;wird<br />
gekocht u.mit Sahne gegessen), rátat,tjukman-r./tojásrántotta = Rührei,gerührte Eier, rétesz = Strudel,eine<br />
Mehlspeise, szait/sajt = Käse, szallana/szalonna = Speck, szalannássz/szalonnás = speckig,mit Speck<br />
zubereitet, szauó/savó = Molke,Käsewasser, szauósz/savós = molkig , szó/só = Salz, szósz-kápuszta/<br />
savanyúkáposzta = Sauerkohl, szóssz-ugarka/sósuborka = Salzgurke, szültelék = der Braten, té-fel/tejfel =<br />
Sahne,Milchrahm, tei/tej = Milch, tészta = Teig, tórósz/túrós = käsig, töltelék = Füllsel,Fülle(von Speisen),<br />
ürmesz-bor/ürmös bor = Wermutwein, vai/vaj = Butter, vaiassz/vajas = butterig,butterhaltig, vajaz,megv./megvajaz<br />
= mit Butter bestreichen, velıszsz, v.-sont/velıscsont = Markknochen, zufa MTsz. zsufa = eine<br />
Speise aus gestossenen Hanfsamen und Milch o. Wasser.<br />
Im Wörterbuch Wichmanns ist die im standardsprachlichen Ungarischen gebräuchliche<br />
Bezeichnung für ’Fett’: zsír nur aus Hétfalu belegt; in Szabófalva wird stattdessen fel/zsír =<br />
Schmalz, Fett verwendet.<br />
Bekannte rumänische Lehnwörter:<br />
alivánka (rum.alivancă) = ein Kuchen aus Maismehl,Sauermilch,Eiern, Schmalz, Lauch u.Dill, botsz(rum.boŃ)<br />
/tészta,(más jelentése:csomó,gombolyag,összegyúr) = gefüllter Knödel aus Maisbrei (oder schollenförmiger<br />
Geschwülst im Leibe), buszka (rum.buşcă) = Grütze aus Käsewasser und Maismehl), eszentsza (rum.esenŃă)/<br />
98
eszenc = Essenz, geluszka (rum.găluşcă) = gefülltes Kraut, káfe(rum.cafea)/ kávé = Kaffee, korászta<br />
(rum.corastă)kurászta = die Milch in den ersten Tagen nach dem Kalben;die daraus nebst süsser Milch gekochte<br />
Milchspeise), kovrig (rum.covrig)/perec = Brezel, meliga (rum.mămăligă)/ puliszka = Polenta,Maisbrei, ordo<br />
(rum.urdă) = eine Art Quark aus Schafsmilch, peszmiétsz (rum.pesmet)/prézli,morzsa = Soldatenbiscuit<br />
(Paniermehl), pitán (rum.pitan,pită)/pite = Maisbrot, rákiu (rum.rachiu)/pálinka = Branntwein, szupa<br />
(rum.supă)/leves = Suppe, sigir(rum.ceghiriu)/drob = eine Speise aus feingehackten Lammeingeweiden,Eiern<br />
u.Schmalz, tokána (rum.tocană)/tokány = eine „gulasch”-artige Speise (aus Fleisch,Kartoffeln m.Gemüse,Salz<br />
u.Pfeffer), tjai (rum.ceai)/tea = Tee, zenytjitsze (rum.jintiŃă)/zsendice = Zieger,Molke.<br />
Der Kaffee „(...) gelangte als Kolonialware bis in den Hafen von GalaŃi, von wo er von den<br />
Fuhrleuten (...) aus dem Burzenland – unter ihnen auch die Tschangos aus Hétfalu – abgeholt<br />
und – im Auftrag von sächsischen und griechischen Händlern – in die Burzenländer Stadt<br />
Kronstadt (ung. Brassó, rum. Braşov) gebracht wurde” (Kós 1976: 92).<br />
Durch diese Händler kamen nun die Tschangos mit der Ware Kaffee in Kontakt.<br />
In den folgenden Synonymenpaaren, die jeweils aus einem einheimischen, (tschango)<br />
ungarischen Wort und einem Element rumänischer Herkunft bestehen, sind alle Elemente<br />
bekannt geblieben, was durch die Bedeutungsdifferenzierung erklärt wird:<br />
morzo / morzsa = Krumme,Krümchen (bes. von Brot) → bekannt<br />
peszmiétsz(rum.pesmet)/prézli,morzsa = Soldatenbiscuit(Paniermehl) → bekannt<br />
peretsz / perec = geflochtene Brezel (zu Hause gebacken) → bekannt<br />
kovrig (rum.covrig) / perec = Brezel → bekannt<br />
Mit dem rumänischen Lehnwort kovrig werden die in den Bäckereien und Geschäften erwerbbaren<br />
Fertigbrezeln bezeichnet. Das Verschwinden des ungarischsprachigen Elementes des<br />
obigen Synonymenpaares, peretsz scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, da die häusliche<br />
Anfertigung von Brezeln immer seltener wird.<br />
Im folgenden Synonymenpaar lässt sich das ungarische Element der Kategorie r/a zuordnen:<br />
pálinka, heute eher: rákjú = Branntwein → bekannt<br />
rákiu (rum.rachiu)/pálinka = Branntwein → bekannt<br />
Das ungarische Lexem pálinka ist zwar noch bekannt, das rumänischsprachige Äquivalent<br />
rákjú wird aber eher gebraucht.<br />
Die Frau unseres Sprachmeisters, Margit Perka erzählt, dass schon ihre Eltern und Großeltern<br />
den zu Hause gebrannten Schnaps als rákjú bezeichneten. Mit pálinka wiederum wurde der<br />
aus Siebenbürgen stammende, hochwertigere, mehrfach destillierte Schnaps bezeichnet.<br />
99
Nicht mehr bekannt sind die ungarischen Lexeme pulitszka/puliszka =Hirsegries und<br />
sügér/csigér = Tresterwein sowie die folgende Entlehnung aus dem Rumänischen:<br />
szerisika(sărăcică) = Zitronensalz, Zitronensäure.<br />
5.5. Zusammenfassug:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 301 Wörter machen 5,01 % des Gesamtwortschatzes<br />
(6007 Wörter) aus.<br />
- 37 der 301 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 12,29 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die aus zwei Elementen (tschango-ungarisches Wort und rumänisches Lehnwort)<br />
bestehenden Synonymenpaare/Dubletten mit bzw. ohne vorliegender Bedeutungsdifferenzierung:<br />
ilvaszó/olvasó, rózsafüzér = Rosenkranz, Perle (auch am Rosenkranz) - matáne (rum.mătanie)/ rózsafüzér = Rosenkranz<br />
bunda/bunda = kurze Pelzweste (aus Lammfell) - kazók (román cojoc)/ báránybunda = Pelz aus Schaffell<br />
morzo / morzsa = Krumme,Krümchen (bes. von Brot)- peszmiétsz (rum. pesmet)/prézli,morzsa = Soldatenbiscuit(Paniermehl)<br />
peretsz / perec = geflochtene Brezel (zu Hause gebacken) - kovrig (román covrig) / perec = Brezel<br />
pálinka = Branntwein- rákiu (rum. rachiu)/pálinka = Branntwein<br />
2.) die hybriden Bildungen:<br />
szüz-márie/Szőzmária = die heilige Jungfrau<br />
3.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
mi-atjánk = das Vaterunser heute: → mecsánk<br />
nodj-péntek = Karfreitag heute: → nadzspéntek<br />
szent-itjház = Kirche heute: → szenticsász<br />
4.) das Phänomen der Bedeutungsverdunkelung:<br />
huszhadjászi-ked/húshagyókedd = Fastenabend<br />
Die im standardsprachlichen Ungarischen gebräuchliche Bezeichnung für ’Fleisch’: hús ist hier nicht bekannt<br />
und auch im Wörterbuch Wichmanns nicht belegt; anstatt ihrer ist pisinnye gebräuchlich. Die standardsprachliche<br />
Bezeichnung für Fleisch findet sich aber in den idiomatisierten Komposita huszhadjász/húsvét elıtti 7<br />
hetes böjtölési idıszak = die siebenwöchige Fastenzeit vor Ostern und huszhadjászi-ked/húshagyókedd =<br />
Fastenabend.<br />
irgalmassz/irgalmas = barmherzig<br />
Das Lexem irgalmassz/irgalmas = barmherzig verschwand schon zu Zeiten Wichmanns aus dem aktiven<br />
Wortschatz; wie dieser bemerkt, wurde es nur automatisch in den Kirchenliedern verwendet, so dass es schon<br />
damals meistens nicht verstanden wurde.<br />
5.) neue Wortsammlung:<br />
- auch heute noch gebräuchliche Wörter, die im Wörterbuch Wichmanns aber nicht<br />
verbucht sind:<br />
rozáriu/rózsafőzér = Rosenkranz<br />
casînca/ kaszinka gyárilag készült, de finomabb szövéső, virágos mintázatú kendı=Kopftuch aus feinerem Material,<br />
industriell angefertigt (gemäß Margit Perka, 2006)<br />
szentmihályi fazék = Festtagstopf (gemäß Mihály Perka)<br />
100
- heute sind andere Wörter gebräuchlich, die beginnen, die Wörter der Kategorie r/a<br />
aus dem Sprachgebrauch zu verdrängen:<br />
anstatt szoknyo /szoknya = Überzieher (sowohl der Männer als der Frauen) aus grobem Wollstoff heute eher: → suman<br />
anstatt pálinka = Branntwein heute eher: → rákjú<br />
anstatt isztenke/istenke,kicsi szentkép = kleines Heiligenbild heute eher: → szenteske<br />
Besonderheiten anderer Art:<br />
- Erhalt von rumänischen - in der rumänischen Standardsprache schon längst nicht mehr<br />
gebräuchlichen Wörtern:<br />
keltszun (rum. colŃun)/harisnya = Strumpf<br />
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt:<br />
’ilvaszó’/olvasó,rózsafüzér<br />
= Perle (auch am<br />
Rosenkranz)<br />
ruház,meg-r. = mit<br />
Kleidern versehen,<br />
ausstatten,<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
Atlas<br />
(1949- 1952)<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
ausstaffieren(die Braut)<br />
pálinka = Branntwein + kein Beleg<br />
vorhanden<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
Grafische Darstellung<br />
des Prozesses<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
6. Berufsbezeichnungen<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 136 Wörter machen 2, 26 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
101
(Szabófalva) aus. 20 der 136 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 14, 71 %<br />
bedeutet.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
ablakassz/ablakos = Glaser, árassz/árus = Kaufmann, arató = Ernter,Schnitter, ászo/ásó = Totengräber, bajiló/<br />
bájoló = Quacksalber(in), bihalassz/”bihalyos” = Büffeleigentümer, bundássz/ ”bundás”, szőcs = der mit einer<br />
Pelzweste handelt, Pelzwestenschneider o. Pelzhändler, djalossz/gyalus = Hobler, H.-verkäufer, Hobelmacher,<br />
djiak/deák = Kantor, djürüssz/győrüs = m.einem Ring versehen,R.-verkäufer,Ringfabrikant, dolgozo,földi-d./<br />
munkás,földmüvelı = Arbeiter,Feldarbeiter, énekelı/éneklı(énekes) = Sänger,-in,auch Musikinstrument,<br />
erdıssz/erdıs,erdész = waldig;Waldwächter, ewegessz/üveges = Glasermeister, farago/faragó = Schnitzer,<br />
fa-wág/favégó = Holzhacker, fazakasz/fazekas = Töpfer, fono/fonó = Spinner, fürészessz/fürészes = Säger,<br />
füszüssz/fésüs = Kammacher (gew.ein Zigeuner), gazdá-né = Wirtin,Frau des Wirts, gazd-asszan/gazdasszony<br />
= Hausfrau,Wirtin, gödör-ászo = Totengräber, házi-gazda = Hauswirt,Hausherr, házi-szolgo/háziszolga =<br />
Hausknecht,Lohndiener, hohiér/hóhér = Hundehenker, hól-napassz/hónapos,bérmunkás = Monatsarbeiter,<br />
hurkássz/ hurkacsináló = Wurstmacher, iro / író , heute eher: notár = Dorfnotar,Landschreiber johossz/juhász =<br />
der viele Schafe hat (Schäfer), kanálassz/kanalas = Löffelmacher,Löffelverkäufer, kapagató/koldus Bettler,<br />
kapássz/kapás = Hauer, kapitán/kapitány = Hauptmann, kaszássz/kaszás = Mäher, kender-ásztató = Hanfröste,<br />
der Arbeiter, welcher röstet, kiéregetı/ koldus = Bettler, kerekessz/kerekes = Wagner,Radmacher, kóldussz<br />
heute: kuldussz/koldus = Bettler, kormánazó/kormányzó = Steuermann, korszóssz/ korsós = Töpfer,Hafner,<br />
Krugträger, korsimárassz/korcsmáros = Gastwirt,Schenkwirt, koszárkássz/kosaras = Korbhändler, kı-meszter/<br />
kıfaragó = Steinmetz, kötelessz/köteles = Seiler, küpüsz/méhész = der viele Bienenstöcke hat, lakatassz/lakatos<br />
= Schlösser, lopátassz/lapátos = der mit einer Schaufel arbeitet(o. mit einer Schaufel versehen), madjar-pop/<br />
magyarpap,katolikus pap = katholischer Priester, meszter/mester = Meister,Virtuos, muszka/katona = Soldat,<br />
muzikássz/muzsikás = Leiermann, Werklmann, nap-számassz/napszámos = Tagelöhner, nyuzó/nyúzó =<br />
Schinder, ırzı = Wächter,Hüter, pásztar,heute eher: csobán/pásztor = Wirt, Viehhüter, pop/pap = Priester,<br />
pósztász/ postás = Postbote, puszkász/puskás = Schütze, szabó = Schneider, szarlósz/sarlós = Schnitter,Ernter,<br />
szekeressz/szekeres = der m.einem Bauernwagen fährt,Fuhrmann, szirató/síratóasszony = Klageweib,Klagefrau,<br />
szolgo/szolga = Diener,Dienerin, szuró/ aki oltást ad = Vakzinateur,Impfer, szultüsz/furulyás = Flöter,<br />
szütı/sütı,pék = Bäcker, tálassz/tálas = Schüsselhändler, talmás/tolmács = Dolmetscher, tanito/tanító =<br />
Lehrer,Schulmeister, teneresz/tenyeres = Tagelöhner, tölsiéressz/tölcséres = m.einem Trichter versehen;<br />
Trichtermacher, törvényezı/bíró = Richter, tjukassz/tyúkos = Hühnerhändler, tjuk-manyassz/tojásos =<br />
Eierhändler, tszinigiész/hegedős = Violinspieler, uszó/úszó = schwimmend,Schwimmer, vágó,fa-wágó =<br />
Holzhacker, varga = Schuster, vetı = Säer (auch die Frau, die den Kettenfaden aufzieht;die grossse Winde, auf<br />
die der Kettenfaden aufgezogen wird).<br />
Weiterhin bekannt sind folgende Entlehnungen aus dem Rumänische<br />
alamár (rum.alămar)/rézmőves = Kupferschmied, bás (rum.baciu)/bács,számadó juhász = Schăfer, berbésessz<br />
(rum.berbeceşte) /berbécses = der viel Widder hat, berbier (rum.bărbier)/borbély = Barbier, butnár (rum.butnar)<br />
/bodnár = Fassbinder,Büttner, doftor/doktor,orvos = Arzt, fisor (rum.ficior)/munkafelügyelı = Arbeitsaufseher<br />
auf den grossen Gütern,Lakai, gárdján (rum. gardian)/börtönır = Gefangenenwärter, inziniér/mérnök =<br />
Ingenieur, ispiuón (spion)/kém = Spion, kaprár (rum.căprar,caporal)/ káplár = Korporal, kaszáp, MTsz.kaszáb<br />
(rum.căsap) = Metzger, Schlächter, maisztru (rum.maistru)/mester = Meister, Lehrmeister, mokán<br />
(rum.mocan)/kocsis = Fuhrmann,Hauderer, pahárassz = Trinkglasverkäufer, pátrula (rum.patrulă)/ırség =<br />
Patrouille, pekurássz, pekurár (rum.păcurar)/állatkereskedı = Viehverkäufer, Viehhändler, plutássz<br />
(rum.plutaş)/tutajos = Flösser, Flossarbeiter, prefesszur (rum.profesor), heute: profészor/ tanító,tanár =<br />
Lehrer,Volksschullehrer, sztráza (rum.strajă)/strázsa,ır = Nachtwächter,Wache, sobán (rum.cioban)/ juhász =<br />
Schafhirt, sobotár (rum.ciobotar)/ cipész = Schuhmacher, vakár (rum.văcar)/ tehénpásztor = Kuhhirt.<br />
Das Phänomen des Lautwandels wird an folgenden Belegen deutlich:<br />
kóldussz / koldus = Bettler → kuldussz<br />
prefesszur (rum.profesor)/ tanító,tanár = Lehrer,Volksschullehrer → profészor<br />
102
Die folgenden ungarischen Lexeme lassen sich der Kategorie r/a zuordnen, da sie noch<br />
bekannt sind, an ihrer Stelle aber eher die rumänischsprachigen Entsprechungen gebraucht<br />
werden:<br />
pásztar /pásztor, heute eher: csobán (rum. cioban) = Wirt,Viehhüter<br />
iro / író , heute eher: notár (rum. notar)<br />
= Dorfnotar,Landschreiber<br />
Diese ungarischen Wörter gehören somit zum passiven Wortschatz; ihr Verschwinden aus<br />
dem Sprachbestand ist nur noch eine Frage der Zeit...<br />
In den folgenden Synonymenpaaren liegen zwischen den Elementen unterschiedlicher<br />
Herkunft jeweils geringfügige Bedeutungsdifferenzen vor, so dass alle Elemente der<br />
Wortpaare bekannt geblieben sind:<br />
tanito/tanító = Lehrer,Schulmeister → bekannt<br />
profészor (rum.profesor)/ tanító,tanár = Lehrer,Volksschullehrer → bekannt<br />
varga = Schuster → bekannt<br />
sobotár (rum.ciobotar)/cipész = Schuhmacher → bekannt<br />
Die standardsprachliche Bedeutung des Lexems muszka ist ’Russe’. Die Tschangos aus<br />
Szabófalva wiederum bezeichnen mit diesem Volksnamen den Begriff ’Soldat’.<br />
Die standardsprachliche Bedeutung findet sich aber noch im Lexem muszka-ország/ Muszkaország = Russland,<br />
das heute aber nicht mehr bekannt ist.<br />
Diese „martialische” Bedeutung des Lexems muszka / katona = Soldat ist bei den Szabófalver<br />
Tschangos bis zum heutigen Tage erhalten geblieben und findet sich auch im Ausdruck<br />
muszka-hit / katonai törvény = Militärgesetz.<br />
Im Wörterbuch Wichmanns sind noch weitere Belege für die obige Bedeutung anzutreffen:<br />
Unter dem Stichwort ’fül’ ist folgender Beispielsatz verbucht: „le- fült e muszka = der Soldat<br />
ist von Schweiss wund geworden”<br />
103
Ein weiteres Beispiel findet sich im Brief des Szabófalver Sprachmeisters Anton Robu an<br />
Yrjö Wichmann (datiert auf den 18.5.1907), der in den Anhang des Wichmann-Wörterbuches<br />
aufgenommen wurde:<br />
„ nálunk e faluba sendesszég ült, nem rontottok szemmit ez emberek; de udj is e muszkák eljöttök<br />
szebufalára sze el-vertek...”<br />
„Bei uns im Dorfe war Ruhe,man hat nichts zerstört; dessenungeachtet kamen die Soldaten<br />
nach Szabófalva und prügelten...”<br />
(Sämtliche Unterstreichungen stammen vom Verfasser dieser Arbeit, A.K.)<br />
Versuchen wir nun anhand einer kleinen Zeitreise herauszufinden, wann und auf welche<br />
Weise die Tschangos mit dem russischen Militär in Berührung kamen, um so eine Erklärung<br />
für den oben dargestellten Bedeutungswandel (’Russe’ → ’Soldat’) geben zu können.<br />
Schon Anfang des 18. Jahrhunderts (1710/1711) versuchte der Woiwode der Moldau,<br />
Dimitrie Cantemir, sein Land mittels einer Vereinigung mit der Walachei und eines<br />
Bündnisses mit Russland vom türkischen Joch zu befreien. Sein Plan scheiterte; die Moldau<br />
wurde fortan von den sogenannten Fanarioten regiert, die beinah ein ganzes Jahrhundert<br />
hindurch die Interessen der Hohen Pforte vertraten. Zwischen 1735 und 1739 blieb auch die<br />
Moldau nicht von den Kriegen zwischen Österreich, Russland und dem Osmanischen Reich<br />
verschont; die Moldauer Bevölkerung kam somit erneut mit den Russen in Berührung.<br />
„Es ist bekannt, dass es in den Donaufürstentümern unter der Herrschaft der Fanarioten keine<br />
rumänische Armee gab. Nachdem mit russischer Hilfe die Türken 1831 aus der Moldau vertrieben<br />
wurden, (...) fasste man die Aufstellung einer 1400 Mann starken Fuß- und<br />
Reitertruppe ins Auge. Überall kam es zu Musterungen und Rekrutierungen. (...) Die Ungarn<br />
entlang des Flusses Szeret aber – vor allem die Bewohner Szabófalvas und Tamásfalvas –<br />
[verweigerten den Einberufungsbefehl]. [Als Strafmaßnahme] griff der russische General<br />
Bigidoff die Bewohner Szabófalvas an (...)” (Domokos 2001: 102).<br />
Nicht mehr bekannt sind die folgenden ungarischen Wörter:<br />
biró/bíró = Gemeidevorsteher, halászó/halász = Fischer, hegedüssz/hegedős = Zigeunermusikant, inasz/inas =<br />
Bursch,Jüngling, szent-itjházá-fiu/templomszolga, harangozó = Kirchendiener, Küster, kineressz/kenyeres,<br />
kenyérárus = Brothändler, kósássz/kulcsos = Schliesser, medje-biro/ (egyház) megyebíró = Kirchendiener,<br />
Küster, moszóka/mosónı = Wäscherin, palliér/pallér = Bauaufseher,Polier, sziposz/sipos = Dudelsackpfeifer,<br />
vadázó/vadász = Jäger, vezetı/kocsis = Kutscher:<br />
sowie folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
104
fesztyér (rum. forestier)/erdész = Oberförster, kránkeu (rum.crancău) = Bummler,Nichtstuer, mergitán<br />
(rum.mărghitan)/ vándorkereskedı = wandernder Kram-und Galanteriewarenhändler (gew.Ausländer, bes.<br />
Russen,Griechen), vetezel (rum.vătăşel)/szolga a faluelıljárónál = Diener beim Dorfschulzen, vikil (rum. vechil)<br />
/uradalmi intézı = Verwalter eines Landgutes<br />
Unter den unbekannten Wörtern lassen sich mergitán (rum.mărghitan)/ vándorkereskedı =<br />
wandernder Kram-und Galanteriewarenhändler (gew.Ausländer, bes. Russen,Griechen),<br />
vetezel (rum.vătăşel)/szolga a faluelıljárónál = Diener beim Dorfschulzen, vikil (rum. vechil)<br />
/uradalmi intézı = Verwalter eines Landgutes als Paläologismen auffassen.<br />
Im folgenden Beleg hat ein Bedeutungswandel stattgefunden:<br />
haitó,ökör-h.,/hajtó,ökörhajcsár = Treiber,Ochsentreiber → heutige Bedeutung:<br />
Gruppenleiter bei der CFR (Rumänische Bahn)<br />
6.1. Zusammenfassug:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 136 Wörter machen 2, 26 % des Gesamtwortschatzes<br />
(6007 Wörter) aus.<br />
- 20 der 136 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 14,71 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die aus zwei Elementen (tschango-ungarisches Wort und rumänisches Lehnwort)<br />
bestehenden Synonymenpaare/Dubletten mit bzw. ohne vorliegender Bedeutungsdifferenzierung:<br />
tanito/tanító = Lehrer,Schulmeister - profészor (rum.profesor)/ tanító,tanár = Lehrer,Volksschullehrer<br />
varga = Schuster - sobotár (rum.ciobotar)/cipész = Schuhmacher<br />
2.) die Paläologismen:<br />
mergitán (rum.mărghitan)/ vándorkereskedı = wandernder Kram-und Galanteriewaren- händler (gew.Ausländer, bes.<br />
Russen,Griechen), vetezel (rum.vătăşel)/szolga a faluelıljárónál = Diener beim Dorfschulzen, vikil (rum. vechil) /uradalmi<br />
intézı = Verwalter eines Landgutes<br />
3.) das Phänomen des Bedeutungswandels:<br />
haitó,ökör-h.,/hajtó,ökörhajcsár = Treiber,Ochsentreiber heute:<br />
→ Gruppenleiter bei der CFR (Rumänische Bahn)<br />
Volksname → Berufsbezeichnung<br />
muszka = Russe → muszka/katona = Soldat<br />
105
4.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
kóldussz / koldus = Bettler heute: → kuldussz<br />
prefesszur (román profesor)/ tanító,tanár = Lehrer,Volksschullehrer → profészor<br />
Besonderheiten anderer Art:<br />
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt:<br />
pásztar =<br />
Wirt,Viehhüter<br />
iro / író =<br />
Dorfnotar,Landschreiber<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
Atlas<br />
(1949-1952)<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
Grafische Darstellung<br />
des Prozesses<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
7. Verwandtschaftsterminologie<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 84 Wörter machen 1, 4 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
(Szabófalva) aus. 9 der 84 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 10, 71 %<br />
bedeutet.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
anya/anya = Mutter, anyátlan = ohne Mutter, ándjo/ángyó = die Frau des älteren Bruders, ándjoska/ángyócska<br />
= die jüngere Schwägerin, apa = Vater, árva = Waise, djerek/gyerek = Kind, djermek,árva-d./gyermek,<br />
árvagyermek = Kind,Waisenkind, djermekeske/kicsi gyermek = kleines Kind, djermeketlen/gyermektelen =<br />
kinderlos, ember = Mensch, Ehemann, embereske /emberecske = kleiner Mensch,lieber Ehemann, fiaska/<br />
fiucska =kleiner Sohn,Knäblein, hásit/házasít = verheiraten (einen jungen Mann), hasito = heiratsfähig<br />
106
(v.einem jungen Mann), hásul/házasul = sich verheiraten, hásult/házasember,férj = verheiratet,Ehemann,<br />
hug/húg = Schwester (sowohl die jüngere als die ältere), hugassz/akinek lánytestvére van = der eine Schwester<br />
hat; Pl. hugasszak = Geschwister (von Frauen), ikressz/ikres = einen Zwilling habend, ikresszek/ikrek = sie sind<br />
Zwillinge, ip/após = Schwiegervater, kereszt-anya/keresztanya = Taufpatin, kereszt-apa/keresztapa =Taufpate,<br />
kereszt-fiu/keresztfiú = Täufling, kereszt-lány/keresztlány = Patin, komásszany/ komaasszony = Gevatterin, die<br />
Mutter meines Täuflings od. meiner Patin; der Zeuge bei der Trauung meines Kindes,die Mutter der Braut od.des<br />
Bräutigams,bei deren Trauung ich Zeuge war, komo/koma = Gevatter,der Vater meines Täuflings od. meiner<br />
Patin; der Zeuge bei der Trauung meines Kindes, der Vater des Bräutigams od. der Braut, bei deren Trauung ich<br />
Zeuge war, legény/legény = Bursch,Junge, legénke/legényke = kleiner Bursch, lér, MTsz. rér/nagynéném vagy<br />
idısebb testvérem férje = der Mann meiner Tante (entw.väterlicher-o.mütterlicherseits) oder auch der Mann<br />
meiner älteren Schwester (laut Mihály Perka), likassz/lyukas (viccesen:feleség) = löcherig,durchlocht<br />
(scherzh.)Frau,Gattin, lány,árva-l. /leány,árvaleány = Mädchen,Tochter,Waisenmädchen, lányaska/leányocska,<br />
kislány = kleines Mädchen, Töchterchen, lány-kiérı/leánykérı = Freiwerber, meny/meny = Schwiegertochter,<br />
menyeske/menyecske = junge Frau, mogzot/magzat = Herkunft,Geschlecht, monyossz = Bursch (scherzh.”mit<br />
Eiern”), nap,napa = Schwiegermutter, nemzet = Geschlecht, nép = Weib, Frau, Gattin, Gemahlin, nodj-legén/<br />
agglegény = Hagestolz, nyemzetség/nemzetség = Geschlecht,Familie, örög/öreg = alt,bejahrt,Greis, örögbe<br />
vesz/örökbe vesz = adoptieren,an Kindesstatt annehmen, örökszég/öregség = Greisen-alter, öszi,öszi-legény =<br />
alter Jungesell, ösiéssz/ akinek fiútestvére van = der einen Bruder hat; ösiésszek = Geschwister (von Männern),<br />
ösö/öcs = Bruder, származik =entstehen,entspringen, erwachsen.hervorgehen, szógar/sógor = Schwager,<br />
szület/szül = gebären,zur Welt bringen,geboren werden (az e nép születet i bubát= dieses Weib hat ein Kindchen<br />
geboren;moszt né szület e buba =eben jetzt kommt das Kind zur Welt), társz/társ = Ehegefährte, der eine von<br />
einem Paare, vei/vı = Schwiegeersohn.<br />
Bekannt sind weiterhin folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
bába (rum.babă)/öregasszony = altes Weib, kruszka(rum.cuscră)/anyatárs =die Schwiegermutter meiner<br />
Tochter<br />
od.meines Sohnes, kruszkul (rum.cuscru)/apatárs = der Schwiegervater meines Sohnes od.meiner Tochter,<br />
máma (rum.mamă)/anya = Mutter, metusze (rum.mătuşă)/nagynéni = Tante, Mütterchen, nyám (rum.neam,rudă)/<br />
rokon = Verwandter, nyámaszzz(rum.neamuri, rudenie)/hozzátartozó,rokon = angehörig, nyipot (rum.nepot)/<br />
fiúunoka = Enkel, nyipóta (rum.nepoată)/ leányunoka = Enkelin, nyiriásza (rum.mireasă)/mennyasszony =<br />
Braut, nyiril (rum.mirele)/vılegény = Bräutigam, ruda (rum.rudă) = rokon, táta (rum.tată)/apa = Vater, vére<br />
(rum.văr)/fiúunkatestvér = Cousin, Vetter, vérieszsz ( rum.veri): ı viéllem v./ö az én unkatestvérem =wir sind<br />
Vetter, viriszára (rum.verişoară)/ leányunokatestvér = Cousine.<br />
Hybride Bildungen lassen sich auch innerhalb dieses Themenbereiches antreffen:<br />
nodj-máma /nagyanya = Großmutter<br />
gebildet aus:<br />
nodj = groß + máma < (rum.) mamă = Mutter<br />
not-táta /nagyapa = Großvater<br />
gebildet aus:<br />
nodj = groß + táta < (rum.) tată = Vater<br />
Aus dem heute noch bekannten, aktiven Wortschatz lassen sich folgende archaische<br />
Verwandtschaftsbezeichnungen wie ip /após = Schwiegervater, nap, napa /anyós =<br />
107
Schwiegermutter oder lér, MTsz. rér/nagynéném vagy idısebb testvérem férje = der Mann<br />
meiner Tante (entw.väterlicher-o.mütterlicherseits) [bzw. der Mann meiner älteren<br />
Schwester (laut Mihály Perka)] hervorheben.<br />
Nicht mehr bekannt sind die folgenden ungarischen Wörter:<br />
asszany/asszony = Weib, Frau (seltener als nép id., welches auch bei der Anrede angewandt werden kann),<br />
bátja/bátyja = älterer Bruder, Vatersbruder; älterer männlicher Verwandter im allg.; seltener als bedji (vgl. rum.<br />
bade, bădiŃă = Vetter; älterer männlicher Verwandter im allg.), welches bes. bei direkter Anrede (angewandt<br />
wird), fiatal-ember/fiatalember = Jüngling, Jungeselle, nién,niéne,néne = ältere Schwester (veraltet), özvödj/<br />
özvegy = Witwer,Witwe (Wichmann: „das Wort soll von einem ungarischen (Szekler)Kantor vor 40-50 Jahren<br />
eingeführt worden sein”, d.h. um 1850-1860), özvödj-ember/özvegyember = Witwer, özvödj-nép = özvegyasszony<br />
= Witwe, özvödjül,el-ö./özvegyül = verwitwen.<br />
sowie das Lexem doroszanka/feleség = (scherzh.) bessere Hälfte, Gattin, das höchstwahrscheinlich<br />
eine Entlehnung aus dem Rumänischen darstellt.<br />
Viele dieser heute unbekannten Lexeme wurden schon von Yrjö Wichmann als veraltet bzw.<br />
kaum gebräuchlich eingestuft. Wir wollen nun im Folgenden versuchen, den Prozess des<br />
Verschwindens der Wörter – der sich bereits zu Zeiten Wichmanns abzuzeichnen begann –<br />
anhand der uns zur Verfügung stehenden Quellen wie den „Sprachatlas der Moldauer<br />
Tschango Mundart“ (Szabó T. – Gálffy –Márton 1991) nachzuverfolgen.<br />
Das Lexem asszany/asszony = Weib, Frau wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
(1906/1907) – wie Yrjö Wichmann bemerkt – „seltener als nép id.” verwendet.<br />
Der „Sprachatlas der Moldauer Tschango Mundart“ (Szabó T. – Gálffy –Márton 1991)<br />
bezeugt, dass das Wort asszany bereits in den 50er Jahren endgültig von nép verdrängt<br />
worden ist.<br />
Im idiomatisierten Kompositum komásszany/ komaasszony = Gevatterin, die Mutter meines Täuflings od.<br />
meiner Patin; der Zeuge bei der Trauung meines Kindes,die Mutter der Braut od.des Bräutigams,bei deren<br />
Trauung ich Zeuge war ist asszany/asszony = Weib übrigens erhalten geblieben.<br />
Das Lexem özvödj/özvegy = Witwer,Witwe – ein iranisches Lehnwort aus urungarischer Zeit<br />
(Bárczi 2001: 60) – kann – zumindest in der Szabófalver Sprachgemeinschaft – als äußerst<br />
kurzlebiges „Modewort” betrachtet werden. Von Wichmann erfahren wir, dass dieses Wort<br />
erst in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts durch einen ungarischen (Szekler)<br />
Kantor in den Szabófalver Sprachgebrauch eingeführt wurde, wo es sich – wie wir im<br />
Weiteren sehen werden – nicht so recht einbürgern konnte.<br />
Der Ethnologe Pál Péter Domokos erinnert sich in einem seiner Reiseberichte an ein im Jahre<br />
1932 mit dem damals 80jährigen Szabófalver Ádám János Antos geführtes Gespräch:<br />
„Der alte Mann erzählt noch, dass er nun schon seit 12 Jahren ein Heiliger ist (szent); er steht<br />
in der Frühe auf, zieht sich an, küsst den Boden und bittet Gott, ihn bis zum Abend am Leben<br />
108
zu erhalten. Dass er seit 12 Jahren ein Heiliger ist, bedeutet, dass er seit 12 Jahren ein Witwer<br />
(özvegy) ist (...)” (zitiert in Domokos 2001: 218; die Unterstreichungen stammen von der<br />
Verfasserin dieser Arbeit, A.K.). Ádám János Antos war vielleicht einer der letzten, die noch<br />
das Vaterunser in ungarischer Sprache aufsagen konnten. Auf jeden Fall aber – um zur<br />
Geschichte unseres obigen Wortes zurückzukehren – scheint das Lexem özvödj in Szabófalva<br />
schon am Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht mehr gebräuchlich bzw. bekannt<br />
gewesen zu sein. So ist es nur allzu natürlich, dass sich für das Wort özvegy im „Sprachatlas<br />
der Moldauer Tschango Mundart“ (Szabó T. – Gálffy –Márton 1991), das den Sprachzustand<br />
der 50er Jahre widerspiegelt, kein Beleg aus Szabófalva findet.<br />
Das „Modewort” özvödj/özvegy = Witwer, Witwe ist somit nun schon seit mindestens einem<br />
halben Jahrhundert – einschließlich seiner zahlreichen Ableitungen wie özvödj-ember/<br />
özvegyember = Witwer, özvödj-nép = özvegy-asszony = Witwe und özvödjül,el-ö./özvegyül<br />
= verwitwen aus dem Wortschatz der Szabófalver Bevölkerung verschwunden.<br />
Ein Charakteristikum der ungarischen Verwandtschaftsbezeichnungen besteht in der<br />
Differenzierung der älteren Geschwister von den jüngeren Geschwistern: vgl. ung.<br />
standardspr.:<br />
húg = a fiatalabb nötestvér (= die jüngere Schwester)<br />
növér = idısebb leánytestvér (= die ältere Schwester)<br />
öcs = fialabb fiútestvér (= der jüngere Bruder)<br />
báty = idısebb fiútestvér (= der ältere Bruder)<br />
Die rumänische Sprache kennt diese Differenzierung nicht, so dass es wahrscheinlich auf<br />
ihren Einfluss zurückzuführen ist, dass dieses Charakteristikum im Szabófalver Tschango-<br />
Dialekt langsam zu schwinden begann. So galt das Lexem nién,niéne,néne = ältere Schwester<br />
bereits zu Zeiten Wichmanns (1906/1907!) als veraltet und ist mittlerweile aus dem<br />
Sprachbestand der Szabófalver verschwunden. Dasselbe Schicksal erlitt das Lexem<br />
bátja/bátyja = älterer Bruder.<br />
Mit hug/húg wird mittlerweile sowohl die jüngere als auch die ältere Schwester bezeichnet,<br />
mit ösö/öcs sowohl der ältere als auch der jüngere Bruder. Interessant hierbei ist, dass diese<br />
allgemeinen, zusammenfassenden Geschwisterbenennungen ursprünglich jeweils die jüngere<br />
Schwester bzw. den jüngeren Bruder bezeichneten. Dieser Umstand könnte damit zusammenhängen,<br />
dass die älteren Geschwister für die jüngeren verantwortlich waren und damit einen<br />
anderen Status einnahmen, der sich eher dem der Eltern annäherte.<br />
109
Die Wortbildungen mit ösö und húg weisen ebenfalls keine Differenzierungen auf: ösiéssz/<br />
akinek fiútestvére van = der einen Bruder hat; ösiésszek = Geschwister (von Männern),<br />
hugassz/akinek lánytestvére van = der eine Schwester hat; Pl. hugasszak = Geschwister (von<br />
Frauen).<br />
7.1. Zusammenfassug:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 84 Wörter machen 1, 4% des<br />
Gesamtwortschatzes (6007 Wörter) aus.<br />
- 9 der 84 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 10, 71 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die hybriden Bildungen:<br />
nodj-máma / nagyanya = Grossmutter, not-táta / nagyapa = Grossvater<br />
2.) das Phänomen der Bedeutungsverdunkelung:<br />
komásszany/ komaasszony = Gevatterin, die Mutter meines Täuflings od. meiner Patin; der Zeuge<br />
bei der Trauung meines Kindes,die Mutter der Braut od.des Bräutigams,bei deren Trauung ich Zeuge<br />
war; in diesem idiomatisierten Kompositum ist das Wort asszany/asszony = Weib erhalten geblieben.<br />
Besonderheiten anderer Art:<br />
- Wörter, die in der ungarischen Standardsprache kaum noch bzw. nicht mehr bekannt sind:<br />
ip /após = Schwiegervater, nap, napa /anyós = Schwiegermutter, lér, MTsz. rér/nagynéném vagy idısebb testvérem férje = der Mann<br />
meiner Tante (entw.väterlicher-o.mütterlicherseits)<br />
110
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt:<br />
aszszan/asszony<br />
= Weib,<br />
Hausfrau,Wirtin<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
+<br />
Wichmann-Kommentar:<br />
seltene Verwendung<br />
Atlas<br />
(1949- 1952)<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
Grafische<br />
Darstellung<br />
Prozesses<br />
- - ██▒▒▒▒<br />
des<br />
bátja/bátyja =<br />
älterer Bruder,<br />
Vatersbruder;<br />
älterer<br />
männlicher<br />
Verwandter im<br />
allg.<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
- ██∼▒▒<br />
nién,niéne,néne<br />
= ältere<br />
Schwester<br />
0<br />
Wichmann: das Wort ist<br />
veraltet<br />
kein<br />
vorhanden<br />
Beleg<br />
- ▓▓∼▒▒<br />
’özvödj’ /<br />
özvegy =<br />
Witwer,Witwe<br />
Wichmann:+<br />
Wichmann:<br />
das Wort<br />
wurde erst<br />
um 1850-<br />
1860 in den<br />
Sprachgebrauch<br />
eingeführt<br />
-<br />
in den<br />
30er<br />
Jahren<br />
(des<br />
20.Jahrhunderts);<br />
siehe<br />
Domokos<br />
2001:218<br />
- - ██▒▒▒▒▒▒<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes ist<br />
nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
8. Namengebung<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 245 Wörter machen 4, 08 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
(Szabófalva) aus. 15 der 245 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 6, 12 %<br />
bedeutet.<br />
111
„Die onomastische Forschung steckt – zumindest was die Personennamengebung der<br />
Tschangos betrifft – auch heute noch in den Kinderschuhen (...). Die Forschung in den<br />
Archiven (...) war selbst für Orts- und Sprachkundige mit ständigen Schwierigkeiten<br />
verbunden; es gab Perioden, wo es schier unmöglich war, Einsicht in die Register zu nehmen<br />
und selbst heute noch – nach der Wende 1989 – wird dem Forscher die Materialsammlung<br />
nicht einfach gemacht” (Mihály Hajdú 2004: 105).<br />
Im Folgenden werden wir nicht näher auf die Namengebung bei den Moldauer Ungarn<br />
eingehen, sondern begnügen uns damit, die im Wörterbuch Wichmanns befindlichen<br />
Eigennamen zu „aktualisieren”, sowie gegebenenfalls einige onomastische Besonderheiten<br />
hervorzuheben.<br />
Der Ausbau der staatlichen Administration sowie des Systems der Bevölkerungsregistratur ist<br />
in der Moldau auf das 19. Jahrhundert anzusetzen. In den in rumänischer Sprache geführten<br />
Registern finden sich orthographische Transkriptionen, sog. Namenübersetzungen (bzw.<br />
einzelsprachlich tradierte parallele, dort jeweils codierte, als Namen bekannte<br />
Namenvarianten) oder Namenformen, die weder in lautlicher noch in semantischer Hinsicht<br />
einen Bezug zu den ursprünglichen Eigennamen der Moldauer Ungarn aufweisen (siehe<br />
Vincze 2004: 28).<br />
Die Moldauer Ungarn verwendeten zwar offiziell ihre neuen Namen; innerhalb ihrer Gemeinschaft<br />
aber gebrauchten sie – dem Gewohnheitsrecht entsprechend – auch weiterhin ihre überlieferten<br />
Familiennamen.<br />
In gleicher Weise verwenden sie – wie schon ihre Balladen bezeugen – sowohl die ungarische<br />
als auch die rumänische Variante ihrer Vornamen:<br />
„Auf Rumänisch Marinka,<br />
Auf Ungarisch Margitka.”<br />
[„Románul Marinkát,<br />
Magyarul Margitkát.”]<br />
(Marinka, Bogdánfalva (S); zitiert in: Kallós 1971;<br />
Unterstreichungen stammen von der Verfasserin dieser Arbeit, A.K.)<br />
Bei den Tschangos finden sich somit komplizierte, aus mehreren Elementen bestehende<br />
Eigennamen: neben den beiden, eingangs erwähnten Varianten der Familien- und Vornamen<br />
kommt auch der Name des Vaters zur Geltung; ergänzt werden diese mehrteiligen Namen in<br />
vielen Fällen weiterhin durch diverse Spitznamen.<br />
112
Ein und dieselbe Person wird daher durch mehrere Namen identifiziert, was schon vielen, die<br />
mit den Moldauer Gepflogenheiten nicht vertraut waren, bei der Suche nach einer bestimmten<br />
Person so manche Probleme bereitet hat (siehe Imre Harangozó 2001: 17-19).<br />
„Bei uns gibt es eine Vielzahl von Namen. Solche Namen wie Csurár, Farkasz...<br />
Den Familiennamen Csuráru gibt es bei uns ungefähr fünfzigmal. Auch der Name des Vaters<br />
wird bei uns hinzugefügt: Csuráru Ádám Andrei. Es gibt Csurár Andrász, Andrika, Csurár<br />
Andrász Punki. Es gibt viele namens Andrika und Andrász, alle heißen nur noch Csuráru<br />
Andrász. Solche Csurárus gibt es! Weitere Familiennamen sind Farkasz,Barbóc,Duma...<br />
Den Familiennamen Duma gibt es auch in unserem Nachbardorf Klézse. Bei uns gibt es auch<br />
viele mit dem Namen Szél. Szél Jánosz, Szél Andrász. Auf Rumänisch Zsitár. Auf Ungarisch<br />
Szél... Bordélyosz gibt es auch noch... Offiziell nennt man sie Duma, aber auf Ungarisch<br />
heißen sie Bordélyosz, Bordélyosz Andrász, Bordélyosz Jánosz. Im Personalausweis steht<br />
Duma, aber wir nennen sie Bordélyosz.“<br />
[„Vannak minden módi nevek nálunk. Csurár,Farkasz... Csuráru vaion parca (mindegy)<br />
ötven. Tátinak nevit esz mondjuk: Csuráru Ádám Andrei. Csurár Andrász van Andrika, van<br />
Csurár Andrász Punki. Vannak Andrika Andrász, mind csak Csuráru Andrász. Vannak<br />
Csuráruk illienek! Van Farkasz,Barbóc,Duma... Duma az vagyon Klézsén esz. Szelek vannak.<br />
Szél Jánosz, Szél Andrász. Zsitár románul. Így magyarul Szél... Bordélyosz... Dumák, de<br />
magyarul Bordélyoszok, Bordélyosz Andrász, Bordélyosz Jánosz. A buletinben (=személyi<br />
igazolvány) Duma van, de Bordélyosznak mondjuk.”] (Nagypatak (S); BLX, geb. 1929)<br />
(Unterstreichungen stammen von der Verfasserin dieser Arbeit,<br />
A.K.)<br />
Im Folgenden werden die im Wörterbuch Wichmanns aus Szabófalva belegten Eigennamen<br />
aufgelistet. Zur Gewährleistung einer besseren Übersichtlichkeit sind die Personen-, Orts- und<br />
Gewässernamen durch Kursivschrift und Unterstreichungen markiert.<br />
Vornamen<br />
Männernamen: ádám /Ádám = Adam, heute: „zÁdám”; águstjin /Ágoston = <strong>August</strong>in, ( vgl.<br />
rum.<strong>August</strong>in); ambróz /Ambrus = Ambrosius; andré /Endre = Andreas (vgl. rum.Andrei); antal /Antal =<br />
Anton; antji /Anti = Anton; demeter /Demeter = Demetrius; djördj /György = <strong>Georg</strong>; djördjöske<br />
/Györgyöcske = <strong>Georg</strong>; ferentsz /Ferenc = Franz; gergel, gergis /Gergely = Gregor; ilész / Illyés = Elias;<br />
isztván /István = Stephan; jákabi /Jakab = Jakob; jánasz /János = Johannes; jánkuska /Jankócska = Johann;<br />
jószka /Jóska = Josef; józsi /Józsi = Josef; mártan /Márton = Martin; mártanka /Mártonka = Martin; mártjin<br />
/Márton = Martin; miál /Mihály = Michael; miklái /Miklós = Nikolaus; piéter (Sab.)/ Péter = Peter; piéterke<br />
(Sab.)/Péterke = Peter; vászili /László = Ladislaus, (vgl. rum.Vasile).<br />
Der folgende Männername ist im Wörterbuch Wichmanns sowohl in der ungarischen als auch<br />
der rumänischen Variante belegt:<br />
mártan (Sab.)/Márton = Martin - mártjin (Sab.)/ Márton = Martin<br />
Frauennamen: barbár /Borbála = Barbara; barbárka /Borbálka = Barbara; brizsida / Brigitta; éva /Éva<br />
= Eva; évaska /Évácska = Eva; gergina (rum.<strong>Georg</strong>ină) = <strong>Georg</strong>ine; ilanaska /Ilonácska = Helenchen;<br />
ilanka /Ilonka = Helenchen; katalin /Katalin = Katharine; katji /Kati = Kätchen; katjika /Katika = Kätchen;<br />
koosáta = Constantis, Konstanze; magdu /Magdu = Magdalena; margit /Margit = Margarete; margitka<br />
113
Margitka = Margarete; márie /Mária = Marie, vgl. rum. Marie; nitsza /Anna = Anna, vgl. rum. AniŃa;<br />
ruza/rózsa, im Volksl: Rose (veralt.); Róza, Rosa, heute – 2006 - als Frauenname bekannt; ruzaska /Rózácska =<br />
Rosa; ruzika /Rózika = Rosa; virón /Veron = Veronika; virónka /Verónka = Veronika.<br />
Familiennamen: albiért / Kr. Albert; antós / Kr.Antos; bákóska = vgl.bákó; bánku; benke / Kr. Benke;<br />
bezán; bláz, vgl. rum. Blasiu, Blaş, Blaj; borzosz (-szszok)/borzas = zerrauft, struppig; Familenn.; boskor/<br />
bocskor = niedriger, weicher Riemenschuh; Familienn., vgl. Kr.Bocskor; bulái; burián/burján = Unkraut,<br />
Wucherpflanze; auch Familienn.,vgl. Kr.Burján; demsze /vgl. Kr.Demes; dinka /vgl. Kr.Danka; dobos/dobos<br />
= Tromler,Paukenschläger; Familienn.,vgl. Kr.Dobos; dobri vgl. MTsz.dobri; dorku / Kr. Darkó; dumók ,<br />
vgl. Kr.Damokos, Domokos (letzteres als Taufn.); düme; dümüske; djédjul; djimi vgl. Kr. Dimén;<br />
djimiske; djödjike; djüki; erdısz vgl. Kr. Erdı; iéva; farkasz = Wolf; auch Familienn.vgl. Kr. Farkas;<br />
feijér/fejér,fehér = weiss; auch Familienn. vgl.Kr.Fejér; fekete = schwarz; auch Familienn. vgl. Kr. Fekete;<br />
fodor/göndörhajú = kraus, lockig; auch Familienn. vgl. Kr. Fodor; frinkul vgl. Kr.Frenkó; gábar Kr.Gábor;<br />
gál Kr. Gál; gege vgl. MTsz. gege; gintsz vgl.MTsz. ginc; gordjin vgl. MTsz. gordon; harangazó/<br />
harangozó = Glöckner; auch Familienname; ilinka = Wichmann: Familienname.(Die rumänischen Schreiber<br />
gaben diesen Namen in den fünfziger Jahren, der richtige Name, sószka, ist noch heute in Gebrauch); isztók,<br />
heute: „piszta”; iván heute: „ioan” ; jakab Kr.Jakab; kelemen Kr. Kelemen; kisi/kicsi = klein, auch<br />
Familienn.; kobzár vgl. rum.cobzar; kotjor; kozán; kozma Kr.Kozma; kriétszul vgl. rum. creŃ(ul), ’fodor’;<br />
kut = Brunnen, auch Familienn., vgl. Kr. Kúti; martinutsz vgl. rum. MartinuŃ; martjinás; mili; minutsz;<br />
minyika; mirtsz; mirtsziska; mitók Familienn. vgl. rum. Mitoc; mokán = Fuhrmann, Hauderer, auch<br />
Familienn., vgl. rum. mocan; nodj/nagy = gross, auch Familienn.; orgon ; pál vgl. Kr. Pálfi; piérke; piétji<br />
(Sab.)/Peti = Peter; piszta (Sab.)/ vgl. Kr. Pista (Taufn.),Famillienn.; pitjiske (Sab.) vgl. Kr. Peticske;<br />
poriékla , vgl. rum. poreclă; puszkás/puskás = Schütze, auch Familienn.; rob/rab = Kriegsgefangener, Sklave,<br />
auch Familienn.; róka = Fuchs, ist nur als Familienname bekannt; szándar Kr. Sándor; szánta/sánta =<br />
hinkend, auch Familienn., vgl. Kr. Sánta; szaszku vgl. MTsz. saskó; szélszı/szélsı = der sich am Rande od. an<br />
der Grenze befindet; äusserst,extrem, auch Familienn., szuka vgl.MTsz.szuka; szüket; sászár/császár =<br />
Kauser, auch als Familienn.; sibi Kr. Csibi; sikór; sobán = Schafhirt; auch Familienn. vgl. rum. cioban;<br />
sobánka; sonko/csonka = gebrochen, mangelhaft, nicht ganz (bez.vom Geschirr),verstümmelt (z.B. vom Mund,<br />
von der Hand); auch Familienn.;<br />
sószka = tölpisch u. Schmutzig (von Kühen, Frauen), auch Familienn.;<br />
sukin,swkin; surár vgl.? rum. ciurar; suri,swri vgl. MTsz. csuri; sutki,swtki vgl. Kr. Csutka; tamász /Tamás<br />
vgl. Kr. Tamási; török vgl. Kr. Török; tréfász/tréfás = spasshaft, humoristisch, auch Familienn., vgl. Kr.<br />
Tréfás; tjelága = Pflugkarren, auch Familienn., vgl. rum. teleagă; tsompol vgl. Kr. Czompó; varga Kr. Varga;<br />
zángar vgl. MTsz. zángor; zuhai vgl. MTsz. zuhaj.<br />
Auf die eingangs erwähnte Besonderheit von „parallel” verwendeten Familiennamen wurde<br />
schon Yrjö Wichmann aufmerksam, der den Familiennamen ilinka folgendermaßen<br />
kommentiert: „Die rumänischen Schreiber gaben diesen Namen in den fünfziger Jahren [d.h.<br />
1850!], der richtige Name, sószka, ist noch heute in Gebrauch”<br />
Tauf- und Familiennamen: antjika /Kr.Antika ; baláz Kr.Balázs, vgl. auch Balázsi, heute: „bláz”;<br />
bórko Kr.Borka; dávid / Kr.Dávid, auch Dorfname; djuri Kr.Gyuri; djurka Kr.Gyurka = <strong>Georg</strong>; imbre<br />
Kr.Imbre; imbriske vgl. Kr.Imbre, Imbrike; jánaszka /Jánoska = Johann, vgl. Kr.János; jani /Jani = Johann;<br />
jánsi vgl. Kr. Jancsó, vgl. auch Kr. Jancsi; kalári Kr. Kalári; szimón /Simon; szuszán vgl. Susánna.<br />
Nicht bekannt sind:<br />
bénye vgl. Kr.Bene, Familienn.; lüdertsz/lidérc, Familienn.; miklósz vgl. Kr.<br />
Miklósi, Familienn.; szipas/sípos = Dudelsackpfeiler, auch Familienn. vgl. Kr. Sipos.<br />
Geographische Namen (Städte, Dörfer, Länder, Gewässer, Flurnamen): bákó = die Stadt<br />
Bacău; balázak, vgl. Kr.Balázsi, Name eines (des oberen) Teiles des Dorfes sebufala, rum.Lecuşeni; bárgauán<br />
= Dorfname, rum. Bărgăvani, NeamŃ; bartjikak = Dorfn., rum. Barticeşti; beleszestj = Dorfn., rum. Băluşeşti;<br />
berenydjéstj/ rum. Berendeşti = Name eines Feldes und eines alten, jetzt nicht mehr existierenden Dorfes<br />
unweit Szabófalva, dessen Einwohner von berenydjéstj nach dem jetztigen, damals waldigen Platz übergesiedelt<br />
sein sollen, um vor den Türken besser geschützt zu sein, rum. Traian; besztretsze/Beszterce = der Fluss Bistritza.<br />
Vgl. rum. BistriŃă; bogdán-fala = Dorfn., rum.Valea Seacă,Bacău; briáza = Dorfn.,rum. Brează, NeamŃ; budapeszta/Budapest,<br />
vgl.rum. Budapesta; buhus = Dorfn.,rum.Bohociu,Bacău; bulgáre/Bulgária = Bulgarien (ién<br />
jártam e bulgáriébe=ich war in Bulgarien); burunyestj = Dorfn.,rum. Burueneşti; butje od. Miklószény = Dorfn.,<br />
rum.Miclăuşeni; dériiáró = Name eines Feldes; dókie = Dorfn.,rum. Dochia, NeamŃ; dumu-fala = Dorfname,<br />
rum. Răchiteni; duna/Duna = Donau; dunán túl = jenseits der Donau; dunán-tulli/ dunántuli = Transdanubier;<br />
114
foru-fala = Dorfn.,rum. Faraoani, Bacău; girestj = Dorfn., rum. Gherăeşti; heluséstj = Dorfn., rum. Hălăuceşti;<br />
horzéstj = Dorfn., rum. Horgeşti, Bacău; jakasz-fala = Name eines Feldes (früher war da ein Dorf); jászár<br />
(
Nicht bekannt sind: miskó vgl. Kr. Miska, Pferdenname; murga Kr. Murga, Pferdename.<br />
8.1. Zusammenfassug:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 245 Wörter machen 4, 08 % des<br />
Gesamtwortschatzes (6007 Wörter) aus.<br />
- 15 der 245 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 6, 12 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die Besonderheiten der Namengebung bei den Moldauer Ungarn<br />
2.) die Synonymenpaare:<br />
román = Rumäne<br />
- oláh = Rumäne<br />
9. Handel, Geldsorten und Administration<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 175 Wörter machen 2, 91 % des im Wörterbuch<br />
Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-Dialektes<br />
(Szabófalva) aus. 15 der 175 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 8, 57 %<br />
bedeutet.<br />
9.1. Handel<br />
„Der Ethnologe Péter Halász unterscheidet zwischen drei grundlegenden Formen des für die<br />
Moldauer Tschango-Gemeinschaften charakteristischen Warenverkehrs:<br />
1. einige Moldauer Ungarn verkaufen ihre Waren direkt vor Ort; den direkt angereisten<br />
Händlern bieten sie dabei ihre Produkte zu einem niedrigeren Preis an,<br />
2. viele fahren mit ihren Fuhrwerken von Dorf zu Dorf und bieten dort ihre Produkte an,<br />
3. andere wiederum bieten ihre Produkte auf den Marktplätzen der mehr oder weniger näher<br />
gelegenen Städte zum Verkauf an” (Pozsony 2005: 165).<br />
Bis in unsere Tage bevorzugten die Moldauer Ungarn dabei eher den Tauschhandel.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
adósszág/adósság = Schuld, alszo-ár/alacsony ár = der äusserste Preis, árasz/árus = Kaufmann, áraszkadik =<br />
Handel treiben, árul = verkaufen, büsü = Ehre, Kredit, büsül/becsül = schätzen, drága = teuer, drágál = für<br />
teuer halten, drágaszág = Teuerung, drágászkadik/drágáskodik = hohe Preise halten, drágít = verteuern,<br />
116
drágul = teuer werden, hágtat,meg-h.= erhöhen (den Preis, die Steuer), halaszt = überzahlen,(mehr als<br />
notwendig geben), jászári-zákkaska = 5 bis 10 kg Kartoffeln enthaltender Sack (solche veräusserte man früher<br />
bes. in Jassy) – die Stadt Jassy=rumänisch Iaşi, jöwöt,”jövet”/jövedelem = Ertrag,Erwerb,Einkünfte, káral, elk./károsul<br />
= Schaden o.Verlust erleiden, kila = Kilogramm, kila = ein altes Getreidemass: ugf. 400 kg (1 kila =<br />
2 miértsze = 24 sztámból ), költész/költés = Auslagen, Unkosten, Kosten, pénz = Geld (seltener als para),<br />
pénzessz/pénzes = reich an Geld költö-pénz,költö-para = Zehrgeld, nereszszég/nyereség = Gewinn,Verdienst,<br />
ólsit/olcsít = verbilligen, ólsu/olcsó = billig, szokol/sokal = für zu viel halten,f.zu teuer halten, váltó-pénz =<br />
eine Geldsumme, die gewechselt werden muss (z.B. 1oo Lei).<br />
Weiterhin bekannt sind auch die folgenden rumänischen Lehnwörter:<br />
garant (rum.garant) = Bürge,Einsteher, kámata (rum.camătă, dobândă)/kamat = Zinsen, Interessen, márfa<br />
(rum.marfă) = Ware, Kram, piátsza(rum.piaŃă) /piac = Marktplatz<br />
Nicht mehr bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
alkaszik/alkuszik = feilschen, alkuvász/alkuvás = handeln, állo-para/tıke = Kapital (stehendes Geld), hitel=<br />
Kredit, Glaubwürdigkeit, kölsen/kölcsön = Anleihe, Darlehen, kölsenez/kölcsönöz = eine Anleihe machen.<br />
9.2. Geldsorten<br />
Im Codex Bandinus (1646) wird der besondere Reichtum der Moldau an Bodenschätzen wie<br />
Gold oder Silber hervorgehoben; trotz dieser günstigen Umstände seien hier aber keinerlei<br />
Bergwerke zu finden, da es aus Angst vor dem türkischen Despotismus keiner wagen würde,<br />
die Möglichkeit des Abbaues dieser wertvollen Metalle allein zur Sprache zu bringen.<br />
„In dieser Gegend werden keine Münzen geprägt; (...) das Geld gelangt durch Handel in die<br />
Moldau. Besonders wertvoll sind die ungarischen Dukaten, Taler, (...) da diese aus Silber<br />
sind. Hoch angesehen sind auch der Lei, die deutschen Dukaten und Taler; der Kreuzer und<br />
der Groschen wiederum sind nicht gebräuchlich” (zitiert in: Domokos 2001: 414).<br />
Im Wörterbuch Wichmanns findet sich keine der von Bandinus erwähnten Geldsorten –<br />
einzige Ausnahme bildet der Kreuzer, der allerdings nur aus Hétfalu belegt ist.<br />
Bekannte Geldsorten:<br />
florint od.florin/ forint = österr.-ungarischer Gulden, der früher gangbar war, frank = Frank, gologán<br />
(rum.gologan) = 10 Bani, hatasz/hatos = ein 5-Banistück,welches nach alten Geldzählung gleich sechs para ist,<br />
huszszasz/huszas = 20 Kreuzerstück (Silbermünze, das österr.-ungar. Geld war, ebenso wie das türkische u.<br />
russische Geld, noch Anfang der siebziger Jahre (1870!!!) in Rumänien gangbar), lau (rum.leu)/lej = alte<br />
Geldsorte (1 lau = 4 para), órt = eine alte Geldsorte, jetzt schon unbekannt, von welchem Wert, pol (rum. pol)<br />
= eine alte Münzeinheit, para (rum. para) = türkische Münzeinheit, Geld im allg.(1 para = 5/6 rum.Bani;120<br />
para = 100 Bani,1 Lei), parássz heute:párássz/pénzes = reich an Geld, paráska/parácska = ein para-<br />
Stückchen; ein wenig Geld.<br />
Die Moldauer Ungarn bezeichnen die noch gültige Landeswährung Rumäniens, den Lei als<br />
para oder frank (siehe P.Jáki Sándor Teodóz 2003:60).<br />
117
Das Lexem karbóntsz = russischer Rubel ist nicht mehr bekannt.<br />
Es ist auffällig, dass viele Bezeichnungen für längst nicht mehr gebräuchliche Geldsorten<br />
auch heute noch bekannt sind. Diese Besonderheit könnte auch damit erklärt werden, dass<br />
„bei der Bekleidung der Tschangomädchen und –frauen der aus Perlen, (...) und alten<br />
Geldmünzen bestehende Halsschmuck eine wichtige Rolle spielt” (Halász 2002: 28;<br />
Unterstreichung stammt von der Verfasserin dieser Arbeit, A.K.).<br />
Im folgenden Beleg hat ein Lautwandel stattgefunden:<br />
parássz/pénzes = reich an Geld → párássz<br />
In den folgenden Synonymenpaaren sind alle Elemente erhalten geblieben. Obwohl zwischen<br />
den beiden Elementen unterschiedlicher Herkunft keine Bedeutungsdifferenzierung vorliegt<br />
bzw. das ungarische Element seltener als das rumänische Element vorkommt, ist es auch<br />
heute noch bekannt:<br />
pénz = Geld (seltener als para) → bekannt<br />
para = Geld im allg. → bekannt<br />
parássz heute: párássz/pénzes = reich an Geld → bekannt<br />
pénzessz/pénzes = reich an Geld → bekannt<br />
Hybride Bildungen finden sich auch innerhalb dieses Themenbereiches:<br />
apró-para/aprópénz = Kleingeld<br />
gebildet aus:<br />
apró = klein + para < (rum) para, parale (Pl.) = Geld<br />
költı-para/költıpénz = Zehrgeld<br />
költ = ausgeben + Adjektivbildungssuffix -ı + para < (rum.) para,parale = Geld<br />
arany-para/aranpyénz = Goldmünze<br />
gebildet aus:<br />
arany = Gold + para < (rum.) para, parale = Geld<br />
118
9.3. Administration, Verwaltung, militärische Fachtermini, Statussymbole, historische<br />
Kategorien<br />
Angesichts der Tatsache, dass in der Moldau die Staatssprache, das Rumänische auch stets die<br />
alleinige Amts- und Verwaltungssprache war, ist es bemerkenswert, dass sich im Wörterbuch<br />
Wichmanns relativ viele mit dem Themenbereich der Administration, Selbstverwaltung und<br />
dem politischen Leben verbundenen ungarischen Wörter wie zum Beispiel perel =<br />
denunzieren, jmd. angeben; választássz/választás = Wählen,Wahl, vám = Zoll,Abgabe(bes.<br />
die Abgabe an den Müller für gemahlenes Mehl), vámal,meg-v./megvámol = verzollen,<br />
vétkessz/vétkes = der gesündigt hat,schuldig f i n d e n, die allesamt bis zum heutigen Tage<br />
bekannt geblieben sind.<br />
Dieser Umstand lässt sich auch mit der relativen Selbständigkeit der Moldauer Dörfer<br />
erklären, die jeweils über eine eigene Selbstverwaltung verfügten: Streitigkeiten wurden so<br />
vom Rat der entsprechenden Dorfgemeinschaft geregelt; dieser setzte sich aus den<br />
Dorfältesten zusammen, die ihre Urteile in ungarischer Sprache fällten.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
djezma/dézsma = Zehent,der früher dem Grundbesitzer bezahlt wurde, felu/falu = Dorf, felui = Dorf-, felui<br />
primár = Dorfschulze, felui skola/falusi iskola = Dorfschule, feluszszi,f.ember/falusi,falusi ember = Dorfbewohner,<br />
földessz/földbirtkos = Grundbesitzer, földetlen/földnélküli,szegény = der ohne Land o.Acker ist,arm,<br />
helessz/helyes,földbirtokos = Grundbesitzer, iedjez/jegyez = bezeichnen, kennzeichnen, király, heute: kílár (r/a)<br />
= König, nemzet = Völkerschaft, Nation, zu ein und derselben Völkerschaft gehörende Bevölkerungsgruppe,<br />
Volk (e madjar n. el-jöt napkeletrıl = die magyarische Völkerschaft ist vom Osten her gekommen), nodj-út/nagy<br />
út,a falu fı utcája = Hauptsrasse des Dorfes,, ország = Land, Reich, országi-út/országút = grosse Landstrasse,<br />
Heerstrasse, perel = denunzieren, jmd. angeben; pogány=schmutzig,garstig,hässlich; Heide,heidnisch, pószta/<br />
posta = Post, porosol/parancsol = befehlen,kommandieren, puszka = Flinte,Gewehr, rakászsz/rakás = das<br />
Laden, Ladung (auch im Gewehr), reziész/részes = Bauer, der Besitzer eines erblichen (zur Zeit des Wojwoden<br />
Stephan erworbenen) Grundbesitzes ist, sászár/császár = Kaiser, sászár-né/császárné = Kaiserin, török-hit = die<br />
mohammedanische Religion, törvény = Gericht, Richteramt, törvényez = urteilen,Recht sprechen, törvénykedik<br />
= prozessieren, m.jmd. einen Prozess führen, ut/út = Weg, Dorfstrasse, Fahrt, várasz/ város = Stadt, vadjanassz/<br />
vagyonos = vermögend, bemittelt, vadjanszág = Vermögen,Habseligkeit, vaida/vajda /Wojwode (Sztjefán vaida<br />
= der Woiwode Stephan), választássz/választás = Wählen,Wahl, választó = Wähler, Wahlmann, vám = Zoll,<br />
Abgabe (bes. die Abgabe an den Müller für gemahlenes Mehl), vámal,meg-v./megvámol = verzollen, vasz-ut/<br />
vasút = Eisenbahn, vétkessz/vétkes = der gesündigt hat,schuldig, veziér/vezér = Anführer (bes.im Krieg).<br />
Weiterhin bekannt sind auch folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
gára (rum.gară)/állomás = Bahnhof, gülü (rum.ghiulea,glonŃ mare de tun)/golyó,ágyúgolyó = grosse Kugel,<br />
Kanonenkugel, haiduk (rum.haiduc)/hajdú = Räuber,Gauner (in alten Zeiten,unter der Türkenherrschaft), hotár<br />
(rum.hotar)/határ = Grenze(zw.grösseren Ländereien u.Dörfern), hotáratlan (rum.fără hotare)/határtalan = ohne<br />
Grenzen,grenzenlos,hotáraz,el-h./határt húz,elkerít = vermarken,abgrenzen,umgrenzen, hotár-kı/határkı =<br />
Grenzstein, kantjina (rum.cantină)/kantin = Kantine, komuna (rum.comună)/község = Gemeinde, Kommune;<br />
119
Gemeindehaus, márka (rum.marcă)/bélyeg,bélyegzı = Briefmarke,Stempel, navála (rum.năvală)/tömeg =<br />
Masse,Vielheit, Überfluss (v.Menschen,v.Arbeit,u.ä.), sztát/állam = Staat, sztátsze (rum.staŃie)/ megálló =<br />
Eisenbahnstation, szusze (rum.şosea)/országút = Chaussee rekut(rum.recrut)/rekruta = Rekrut, reziész (răzeş)/<br />
részes = Bauer, der Besitzer eines erblichen(zur Zeit des Wojwoden Stephan erworbenen) Grundbesitzes ist,<br />
szpitál (rum.spital)/ kórház = Krankenhaus, touárasz (rum.tovarăş)/elvtárs = Kamerad, tjérmin (rum.termin)/<br />
határidı = Termin,Frist, tjesztament (rum.testament)/ végrendelet = Testament, voluntár (rum.voluntar)/<br />
önkéntes = Volontär, Freiwilliger, zitsza (rum.de viŃă)/nemzetség = Geschlecht,Herkunft,Stamm (mük madjar<br />
zitszából vadjunk = wir sind magyarischer Herkunft).<br />
Hybride Bildungen sind auch hier anzutreffen:<br />
felui primár = Dorfschulze<br />
gebildet aus:<br />
felu/falu = Dorf + Adjektivbildungssuffix -i<br />
+ primár < (rum.) primar = Bürgermeister<br />
felui skola/falusi iskola = Dorfschule<br />
gebildet aus:<br />
felu/falu = Dorf + Adjektivbildungssuffix –i<br />
+ skola < (rum.) şcoală = Schule<br />
Im folgenden Synonymenpaar sind beide Elemente unterschiedlicher Herkunft erhalten<br />
geblieben, was durch die zwischen diesen vorliegende Bedeutungsdifferenzierung erklärt<br />
wird:<br />
országi-út/országút = grosse Landstrasse, Heerstrasse → bekannt<br />
szusze (rum.şosea)/országút = Chaussee → bekannt<br />
Nicht mehr bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
fö-úr/fıúr = Magnat, vornehmer Herr, had = grosse Soldatenmasse,Kriegsherr, hatalam/ hatalom =<br />
Macht,Gewalt,Überhand, huszár,madjar h/huszár magyarok. = die ungarischen Husaren (sollen einmal<br />
während eines Krieges auch in der Moldau gewesen sein), igasszág-lewiél = Zertifikat,Zeugnis, szilvász/szilvás<br />
= an Pflaumen reich;der Rumäne o.Magyare, welcher seiner Grundbesitz vom Woiwoden Stephan erhalten hat,<br />
urassz/uras = herrisch,der den Herrn spielt, uraszkadik/uraskodik = den Herrn spielen,vornehm tun.<br />
Als Paläologismen können hierbei folgende Lexeme gelten: fö-úr/fıúr = Magnat, vornehmer<br />
Herr; huszár,madjar h/huszár magyarok = die ungarischen Husaren (sollen einmal während<br />
eines Krieges auch in der Moldau gewesen sein).<br />
120
9.4. Zusammenfassug:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 175 Wörter machen 2, 91 % des Gesamtwortschatzes<br />
(6007 Wörter) aus.<br />
- 15 der 175 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 8, 57 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die Synonymenpaare:<br />
pénz = Geld (seltener als para) - para = Geld im allg.<br />
parássz heute: párássz/pénzes = reich an Geld - pénzessz/pénzes = reich an Geld<br />
országi-út/országú = grosse Landstrasse, Heerstrasse - szusze (rum.şosea)/országút = Chaussee<br />
2.) die hybriden Bildungen:<br />
apró-para / aprópénz =Kleingeld, költı-para / költıpénz = Zehrgeld, ,arany-para/aranypénz = Goldmünze, felui primár / falusi<br />
jegyzı= Dorfnotar, felui skola / falusi iskola= Dorfschule<br />
3.) die Paläologismen:<br />
fö-úr/fıúr = Magnat, vornehmer Herr; huszár,madjar h/ magyar huszár = die ungarischen Husaren (sollen einmal während<br />
eines Krieges auch in der Moldau gewesen sein )<br />
4.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
parássz/pénzes = reich an Geld → párássz<br />
5.) Wortgeschichte (Stagnierung):<br />
pénz = Geld<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
s<br />
Wichmann:[kommt]<br />
seltener [vor]als<br />
para<br />
Atlas<br />
(1949-1952)<br />
kein<br />
vorhanden<br />
Beleg<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
s<br />
Grafische Darstellung des<br />
Prozesses<br />
░░∼░░<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes ist<br />
nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
121
Besonderheiten anderer Art:<br />
- viele Bezeichnungen für längst nicht mehr gebräuchliche Geldsorten sind auch heute<br />
noch bekannt:<br />
gologán (rum.gologan) = 10 Bani, hatasz/hatos = ein 5-Banistück,welches nach alten Geldzählung gleich sechs<br />
para ist, huszszasz/huszas = 20 Kreuzerstück (Silbermünze, das österr.-ungar. Geld war, ebenso wie das<br />
türkische u. russische Geld, noch Anfang der siebziger Jahre (1870!!!) in Rumänien gangbar), órt = eine alte<br />
Geldsorte, jetzt schon unbekannt, von welchem Wert, pol (rum. pol) = eine alte Münzeinheit<br />
10. Grundwortschatz<br />
Die zum obigen Themenbereich gehörenden 3866 Wörter machen 64, 36 % des im<br />
Wörterbuch Wichmanns befindlichen Gesamtwortschatzes des nördlichen Tschango-<br />
Dialektes (Szabófalva) aus. 471 der 3866 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust<br />
von 12, 18 % bedeutet.<br />
10.1. Mensch und Tier<br />
10.1.1. Körperteile<br />
Folgende ungarische Wörter sind bekannt:<br />
ál/áll = Kinn, artsa/arca = Wange, bendö/bendı = Magen, boka/boka = Fussknöchel, buts/bonc (comb) =<br />
Schenkel, darak/derék = Rückgrat, fark/farok = Schwanz, fartjik/farcsík = Steissbein, fasz = das männliche<br />
Glied, fei/fej = Kopf,Haupt, fiél-kezü/félkező = einhändig, fil/fül = Ohr, fog = Zahn, haj = Haare, haisál/hajszál<br />
= ein Haar, hasz/has = Bauch, hasszasz/hasas = bauchig, dickleibig, hát = Rücken, hátasz =<br />
breitrückig, homlok = Stirn, horgoszsz-in/”horgasín” = die Fusssehne in der Kniebeuge, (b. vier- füssigen<br />
Tieren am hinteren Fuss), huddjóka/húgyhólyag = Harnblase, hun-al/hónalj = Achselhöhle, in/ín = Sehne,<br />
Ader, inasz/inas = flechsig, sehnig, horpots/„horpasz” = die Weichen (sowohl am Menschen als am Tierkörper),<br />
kulak MTsz. kujak = Faust, lapatszka/lapocka = Schulterblatt, mái - fekete mái/máj = Leber, fejjér<br />
mái/tüdı = Lunge, mel/mell = Brust, mizga MTsz mozga/sperma = Sperma, Samen, mon/mony = Hode<br />
(auch:Ei), mutjitó-ui/mutatóújj = der Zeigefinger, nyak = Hals, Nacken, nyakaszsz = dickhalsig, m.grossem<br />
Hals versehen, nyelv = Zunge,Sprache, or/orr = Nase, or-lik/orrlyuk = Nasenloch, ıl = Schoss, Klafter, pet =<br />
membrum virile, pinna/pina = membrum muliere, pisa/picsa = membrum muliere, szái/száj = Mund, szakál/<br />
szakál = Bart, szakállassz/szakállas = bärtig, szark/sark,sarok = Ferse (auch:Absatz, Türangel,Haspe), szárny =<br />
Flügel, szarv = Horn, szeg/segg = Arsch, szem = Auge, szemiérem-testj/általában nemiszerv = Schamglied<br />
(im allg.), szemüöldök,szüm-öldek heute: szumultükk/szemöldök = Augenbraue, szü/szív = Herz, ses-bong/<br />
csecsbimbó, mellbimbó = Brustwarze, ses/csecs = Brust, Zitze, (sestöl-való=Säugling), sont/csont = Bein,<br />
Knochen, sorbo-száiu/csorbaszájú = der einen fehlerhaften Mund hat (wenn z.B. die Zahnreihe od. die Lippen<br />
fehlerhaft sind, sugula/csigolya = das Grübchen im Genick, talp = Sohle, teniér/tenyér = Handfläche, testj/test<br />
= Körper,Leib, tiérdj,tjiérd/térd = Knie, testj/test = Körper,Leib, tompor/csipı = Hüftbein, tork/torok =<br />
Kehle,Gurgel,Schlund,Rachen, ui/újj = Finger, vál/váll = Schulter, valag = membrum muliere, velı = Mark,<br />
Gehirn, vér(alut-v.) = Blut (gestocktes Blut), záp/zápfog= Backenzahn.<br />
Weiterhin bekannt sind die folgenden Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
budza (rum. buză)/ajak = Lippe, budzat (buzat)/széles ajkú = dicklippig, fálka (rum.falcă)/állkapocs =<br />
Kinnbacken, gitléts (gâtlej)/Ádámcsutka = Adamsapfel, gustjur (gâtlej (W. guşter)/gége, gégecsı = Kehle,<br />
122
Speiseröhre, pula (pulă)/kisfiú nemi szerve = männliches Glied (der kleinen Knaben), putsza (puŃă)/puca =<br />
weibliches Glied (der kleinen Mädchen),.<br />
Die ungarischen Bezeichnungen sind fast in ihrer Gesamtheit bekannt geblieben.<br />
Einzige Ausnahmen bilden lediglich die beiden ungarischen Lexeme aiak/ajak = Lippe und<br />
poklo = Mutterkuchen der Kuh, die heute nicht mehr bekannt sind.<br />
Aus dem heute noch bekannten, aktiven Wortschatz lassen sich folgende Archaismen<br />
hervorheben:<br />
horpots /„horpasz”<br />
mái - fekete mái/máj<br />
fejjér mái/tüdı<br />
mizga MTsz mozga/sperma<br />
mony/mony<br />
tompor/csipı<br />
= die Weichen (sowohl am Menschen als am Tierkörper)<br />
= Leber<br />
= Lunge<br />
= Sperma, Samen<br />
= Hode (auch:Ei)<br />
= Hüftbein<br />
Das Phänomen des Lautwandels wird am folgenden Beleg deutlich:<br />
szemüöldök,szüm-öldek/szemöldök = Augenbraue → szumultükk<br />
Im folgenden Synonymenpaar liegt keine Bedeutungsdifferenzierung zwischen den beiden<br />
Elementen unterschiedlicher Herkunft vor; das (tschango)ungarische Wort ist somit aus dem<br />
Gebrauch verschwunden, nur noch das rumänische Lehnwort ist bekannt:<br />
aiak/ajak = Lippe → nicht bekannt<br />
budza (rum. buză)/ajak = Lippe → bekannt<br />
Das Lexem aiak ließe sich auch in die Kategorie r/a einordnen, da es von einigen Informanten<br />
– nach mehrmaligem Nachfragen – noch erkannt wird.<br />
In den 50er Jahren des 20.Jahrhunderts waren noch – wie der Sprachatlas der Moldauer<br />
Tschango Mundart (Szabó T. – Gálffy – Márton 1991) bezeugt – beide Elemente des obigen<br />
Wortpaares bekannt.<br />
10.1.2. Krankheiten<br />
In der Kultur der Tschangos – ebenso wie in allen anderen archaischen Kulturen – führt man<br />
die Ursachen der Krankheiten auf den Eingriff von höheren, schädlichen Mächten zurück.<br />
Vor dem Einfluss dieser bösartigen Mächte muss man nun den Körper durch diverse<br />
123
Praktiken befreien. Diese Kunst verstehen nur gewisse eingeweihte Personen wie zum<br />
Beispiel die weisen, alten Frauen, die bábasszonyok genannt werden. Diese kannten für fast<br />
jede Krankheit das betreffende Heilmittel; mit Bleigießen, Heilkräutern und heilenden<br />
Zaubersprüchen versuchten sie, den Kranken Linderung zu verschaffen.<br />
In den traditionellen Heilverfahren der Moldauer Ungarn verschmelzen die rationalen mit den<br />
irrationalen Elementen. So war es zum Beispiel wichtig, die Heilkräuter wortlos<br />
einzusammeln oder bei der Dosierung der einzelnen Kräuter die magischen Zahlen 7 und 9 zu<br />
beachten. Bedenkt man aber, welch eine große Rolle der Glauben bei der Heilung spielt, wird<br />
die Beurteilung dieser Elemente als irrational sofort relativiert. Diesen Glauben an eine<br />
Heilung nutzt übrigens auch die moderne Medizin; es reicht, wenn wir dabei nur an den<br />
Placebo-Effekt denken.<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
bienna/béna = Krüppel, betieg/beteg = Krank, bogarassz/pl. egy fa tele hernyókkal = voll v.Würmern(z.B.ein<br />
Baum), dühütszég/dühödtség,veszettség = Wasserscheu,Tollwut, djauit heute: dzsulit / javít,meg-dj./. gyógyít =<br />
heilen,gesund machen, djavithatatlan heute: dzsulithatatlan/javíthatatlan, gyógyíthatatlan = unheilbar, djauul<br />
,djaul/javul, meg-dj./megjavul heute: dzsull = genesen,gesund werden, egésszégessz/ egészséges = gesund,<br />
egészszegül/meggyógyult = genesen, foszik = Durchfall haben, fuladássz /tüdıbetegség = Lungenschwindsucht,<br />
fuladószsz/tüdıbeteg = lungenschwindsucht, gengit,el-g./gyengít = entkräften, schwächen, gengül,el-g./gyengül<br />
= sich entkräften,ermatten, gilisztászsz = der Eingeweidewürmer hat, göbörs/ göbörcsös,sovány:malac,kutya =<br />
mager u.elend (v.Ferkeln,Hunden), görs/görcs = Krampf, görsöszsz/görcsös = der am Krampf leidet, hálag/<br />
hályog = Star (Augenkrankheit), herkent/ köhög,krákog = sich räuspern o. schnarren (aus den Gurgel),um den<br />
Schleim auszuhusten, himlı= Blattern, Pocken, himlı-hel/ hímlıhely = Blatternarbe, himlıhelessz/hímlıhelyes<br />
= blatternarbig, hólag/hólyag(kiütés) = blasenartiger Ausschlag, hólagassz/hólyagos = blasig,voll blasenartiger<br />
Ausschläge, hurut/köhögés = husten, hurul/köhög = husten haben, hurulássz/a köhögés = Husten, hurutóssz/<br />
köhögıs = der Husten hat,hustend, jártat, ingemet j./ hasmenésem van = ich habe Diarrhöe, keheg,kehegéssz<br />
heute: hurrut/köhög,köhögés = Husten, naplik,meg-n/gyomorfájás(föleg gyermekeknél,ha éhgyomorra sok<br />
gyümölcsöt ettek) = Bauchweh bekommen (gew. v. Kindern,die m .nüchternem Magen viel Früchte gegessen<br />
haben),nyilal/nyilallik = stechen,durchzucken, nyouod/nyuvad,fullad = ersticken, nouot/megfuladt = ertrunken,<br />
okádász/okádás,hányás = Erbrechen, orbántsz heute eher: brâncă/orbánc = Rotlauf, száiu,sorbo-száiu/<br />
csorbaszájú = der einen fehlerhaften Mund hat, szánta/sánta = hinkend, szántul, le-sz./sántul = lahm o. hinkend<br />
werden, szaparátlan/ szaporátlan,meddı = unergiebig,unfruchtbar, szédjült,szédjülten jár = wirr im Kopfe sein,<br />
sziérik/fáj = wehtun (sziérik e feiem/fáj a fejem = ich habe Kopfschmerzen), szorulászsz/mellbetegség kicsi<br />
gyermekeknél = eine Brustkrankheit der kleinen Kinder, sepelészsz/karikás szemő = rinnäugig, sikkan/<br />
(ki)bicsaklik = verrenkt werden, sontotlon/ csontatlan, lábatlan, gerinctelen = beinlos,grätenlos, sorbo/csorba =<br />
Scharte,Lücke, töréssz/ törés = Schwiele an der Ferse, tjuk-szemereg/egy kiőtés = eine Art Hautausschlag,<br />
var/rőh = Räude, Krätze, varassz/rőhös = räudig,krätzig, viszketéssz/viszketegség = Jucken,Kitzeln.<br />
Weiterhin bekannt sind folgende rumänische Lehnwörter:<br />
brinka (rum.brincă)/állatbetegség = Drüsengeschwulst am Halse(v.Schweinen), fetjeleu (rum.fătărău)/fataró =<br />
sexuell unfähig,inkapabel (v.Mănnern), frents (rum. frenŃă)/vérbaj = Syphilis, gubáv (rum.gubav) = kraftlos,<br />
schwach, guse (rum.guşă) = Kropf, kápkiu (rum.chapchiu)/kergekór juhoknál = drehkrank werden(v.Schaf),<br />
kápkiul,mek-k./megkergült = drehkrank werden (v.Schaf), kor (rum. cor) = Röteln, Friesel, pozár (rum.pojar) =<br />
Grind,Schorf (auf dem Kopf), sontoróg = Krüppel,verstümmelt, suma(rum.ciumă)/pestis = Pest, udma<br />
(rum.udmă)/gennyzacskó = grosse Eiterbeule, zabále (rum.zăbală)/zabola = Zaum,Gebiss;Wolf (im Mundwinkel),<br />
zabáliéssz (cu zăbală)/ zabolás = der faule Winkel hat.<br />
124
In Szabófalva ist das ungarische Lexem orbántsz /orbánc = Rotlauf zwar noch bekannt, das<br />
rumänischsprachige Äquivalent brâncă ist aber eher gebräuchlich. Das rumänische Wort<br />
beginnt somit, die ungarische Entsprechung zu verdrängen, womit das Lexem orbántsz der<br />
Kategorie r/a zuzuordnen ist. Der Verlust dieses Wortes scheint nur noch eine Frage der Zeit<br />
zu sein.<br />
Das Phänomem des Lautwandels zeigt sich an folgenden Belegen:<br />
djauit / javít,meg-dj./gyógyít = heilen,gesund machen → dzsulit<br />
djavithatatlan /javíthatatlan, = unheilbar → dzsulithatatlan<br />
gyógyíthatatlan<br />
djauul,djaul/javul, meg-dj./megjavul = genesen,gesund werden → dzsull<br />
Anstatt keheg,kehegéssz/köhög,köhögés = Husten ist das Lexem hurrut gebräuchlich.<br />
Nicht mehr bekannt sind die ungarischen Lexeme goil,goiil/kicsit beteg = ein wenig krank<br />
sein und görbül = krumm werden sowie die folgende Entlehnung aus dem Rumänischen:<br />
tróna (rum.troahnă)/lázas betegség = langwierige Fieberkrankheit im all.,bes,Typhus.<br />
10.2. Natur<br />
10.2.1. Geographische Einheiten<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
erdı = Wald, foló/folyó (víz) = fliessend (fliessendes Wasser), forrász/forrás = Quelle, hedj/hegy = Berg,<br />
hedjessz/hegyes = gebirgig, hedj-szakadék = Abgrund, hel/hely = Ort,Platz,Raum,Stelle, Wohnort, Baugrund,<br />
Grundbesitz, lıtı/lejtı = Tal, mart = Ufer,Strand, nodj-viz/nagy víz,árvíz,folyam,tenger = Flut,Fluss,grosser<br />
Fluss,Meer, omlász,viz-o./vízesés = Wassersturz, öszvöny/ösvény = Pfad,Fussweg, patak = Flüsschen,Bach,<br />
puszta = öde,leer(z.B.Platz,Haus), wüst, pusztaszág/pusztaság = Steppe,Wüstenei, szakadék /szakadék,(de<br />
szakadt ruha is) = zerrissene Stelle(im Kleid),Schlucht,Kluft, szikszág/ síkság = Ebene, Glätte, Schlüpfrigkeit,<br />
sargó/csorgó = Quelle mit Ausflussröhre, tó = See,Teich, tószág/tócsás hely = m.Seen o.Teichen gefüllter<br />
Landstrich, hedj/hegy = Berg<br />
Weiterhin bekannt sind folgende rumänische Lehnwörter:<br />
grind (rum. grind)/sziget = Insel, lonko (rum.luncă)/lanka = niedriges,m.Gebüsch bewachsenes Flussufer,<br />
toplitszássz (cu topliŃă)/mocsaras = sumpfig<br />
125
Nicht mehr bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
lapál/lapály = kleiner Morast auf der Wiese o.im Wald, mosár/mocsár = Sumpf,Morast, ré/rév = Furt,Wate,<br />
rét = Schicht,Lage, tenger = Meer, tere,viz t./tér,víztér = Flussterrain,Flusstal<br />
10.2.2. Wetter<br />
Die folgenden ungarischen Lexeme sind bekannt:<br />
diér/dér = Frost (im Winter, derül = sich aufhellen(das Wetter), eszszegiél/esegél = still regnen,ein wenig<br />
regnen, eszszısz/essıs = regnerisch (eszszısz-üdı=Regenwetter), iég/jég =Eis,Hagel, iég-esszı/jégesö =<br />
Hagelregen, iék-sap/jégcsap = Eiszapfen, enged/enged,olvad a hó = schmelzen(der Schnee), engeszt,mege./olvad<br />
= schmelzt, fodj,bé-f./befagy = frieren,einfrieren, forgó-sziél/forgószél = Wirbelwind, hiéwszég/hıség<br />
= Wärme,Hitze, hidég/hideg = Kälte,Frost, hidegessz = kalt,kühl(immer), hó-pelenke/hópehely = Schneeflocke,<br />
hó-viz = Schneewasser, hovoszkál/havazkál = ein wenig schneien, hovoz/havazik = schneien, humalássz/felhıs<br />
= wolkig, humál-szakdászsz/ felhıszakadás = Wolkenbruch, hüessz,hüwessz/hővös = kühl, frisch, etwas kalt,<br />
hüeszszég/hővösség = Kühle,Kälte, hül.meg-h.hől = kühl werden, iszten-nyila, heute: zisztennyila/ istennyíla,<br />
villám = Blitz, men-kı /mennykı = Blitz , napkeleti sziél/keleti szél = Ostwind, nyirk/nedves = Feuchtigkeit<br />
(z.B.der Erde), nyirkassz/nyirkos = feucht,nass, pelenke,hó-p./pilinke, hópehely =Flocke,Daune, Schneeflocke,<br />
pelenkiél MTsz.pilingel/ hószállingózás = in Flocken schneien, szárasz/száraz = trocken, sziél/szél = Wind<br />
(alszó-sz.-=Südw.,felszı-sz.=Nordw.,forgó-sz.=Wirbelwind), szelessz/szeles = windig, üdız,meg-ü./rossz idı<br />
lesz = schlechtes Wetter werden, villámlászsz/villámlás = Blitz, villámlik = blitzen, es blitzt, zápar/zápor =<br />
Regenschauer,Gussregen.<br />
Weiterhin bekannt sind auch folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
furtuna (rum.furtună)/vihar = Sturmwind, sziésita (rum.secetă) = Trockenheit, zikal (mold.dial.vicol,<br />
rum.lit.spr. viscol)/vihar = Sturmwind,Sturm.<br />
Nicht mehr bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
aszál-üdö/aszály = Dürre, hovossz/havas = mit Schnee bedeckt, die Karpaten(Gebirge).<br />
Im folgenden Synonymenpaar liegt keine Bedeutungsdifferenzierung zwischen den beiden<br />
Elementen unterschiedlicher Herkunft vor, was zum Verlust des ungarischen Wortes<br />
beigetragen hat:<br />
aszál-üdö/aszály = Dürre → nicht bekannt<br />
sziésita (rum.secetă)/aszály = Trockenheit → bekannt<br />
10.2.3. Himmelsrichtungen, Himmelskörper, Jahreszeiten, Monatsbezeichnungen,<br />
Wochentage, Tageszeiten<br />
Folgende ungarische Wörter sind bekannt:<br />
dél ,dél-elöt/délelıtt, dél-utá/délután = Mittag,Vormittag,Nachmittag, éj = Nacht, éj-fili-kar/éjfélkor = Mitternacht,<br />
esztendı = Jahr, hainali-sillag/hajnalcsillag = Morgenstein, hiét-fü/hétfı = Montag, hiét-fün/ hétfın =<br />
am Montag, heti = wöchentlich, hód/hold = Mond; fiél- h.=Halbmond; ép-h.,teli-h.=Vollmond; ui-h. = Neumond;<br />
régi.h.=Altmond; hódvilág/holdvilág = Mondschein,hólnap/holnap = morgen,der morgige Tag, hól-nap/<br />
hónap = Monat, hólnapután/holnapután = übermorgen, idién/idén = in diesem Jahre, jıwı, j.esztendı/ jövı<br />
126
esztendı = künftig,das nächste Jahr, jöwöndı, j.esztendıre/ jövıre = zukünftig,fürs nächste Jahr, kauaradik/<br />
kavarodik,kering ( a Föld a Nap körül) = kreisen, umlaufen (z.B.die Erde um die Sonne), ked, kedden =<br />
Dienstag, am Dienstag, nap = Sonne,Tag, nap-fény,naf-fény/napfény = Sonnenschein, napkelet/napkelet =<br />
Sonnenaufgang,Osten, nyár = Sommer, ısz = Herbst, ıszi = herbstlich, ösztö/este = Abend,abends,<br />
ösztönykény/esténként = allabendlich, jeden Abend, ösztül = es wird Abend, es dämmert, péntek = Freitag,<br />
regvel/reggel = Morgen,morgens, szarada/szerda = Mittwoch, szombot/szombat = Samstag, setertek/csütörtök<br />
= Donnerstag, seterteken/csütörtökön = am Donnerstag ,sillag/csillag = Stern, sillagassz/csillagos = sternvoll,<br />
tannap,t.elıt/tegnap,tegnapelıtt = gestern, vorgestern, tannapi/tegnapi = gestrig, taual/tavaly = voriges Jahr,<br />
tauasz/tavasz = Frühling (tauaszval = im Frühling), tiél/tél = Winter, (tiéleny=im Winter), vaszár-nap/vasárnap<br />
= Sonntag, virrad = es wird Tag, virradba = bei Anbruch des Tages, virrattjig,virraddtig/virradatig = bis zum<br />
Anbruch des Tages.<br />
Die ungarischen Bezeichnungen sind allesamt bekannt geblieben.<br />
Entlehnungen aus dem Rumänischen sind in der obigen Sachgruppe einzig bei den Monatsnamen<br />
anzutreffen:<br />
juli,juliba(rum.iulie,în iulie)/július = Juli, im Juli, juni,juniba (rum.iunie,în iunie) = Juni, im Juni,<br />
noiembre(rum.noiembrie)/november = November, oktombre/október = Oktober.<br />
10.3. Numeralien und geometrische Bezeichnungen<br />
Auch in dieser Sachgruppe sind sämtliche ungarische Wörter bekannt geblieben:<br />
edj/egy = einer,eine, eddji-edj/egy-egy = einige, einiges, eddjuk/egyik = der eine, eddjü, kettü, három/ egy,<br />
kettı,három = eins, zwei, drei (beim Zählen), elsö/elsı =der erste, ezer = tausend, ezertser/ezerszer = tausendmal,<br />
fél, fiél/fél = Hälfte, halb, háram/három = drei, háramasz/hármas = dreier, harmadik = der dritte, hat =<br />
sechs, hatadik/hatodik = der sechste, hatassz/hatos = ein 5Banistück, welches nach der alten Geldzählung<br />
gleich sechs para ist, hatvan = sechzig hiét = sieben,Woche, hiétedik/hetedik = der siebente, hiétessz/hetes =<br />
Siebener, hetven = siebzig, keriék/kerek = rund, kerekedesz-kerekül/köröskörül = ringsherum,rundherum, kerika/<br />
karika = Ring,Reifen,Kreis,Zirkel, kilentsz/kilenc = neun, kilentszedik/ kilencedik = der neunte, kilentszven/<br />
kilencven = neunzig, kilentszvenedik/kilencvenedik = der neunzigste, közöp/közép = Mitte, leg-elsıb/legelsı =<br />
der allererste,der vorzüglichste, leg-utólszó/legutolsó = der allerletzte, niédj/négy = vier, viermal, nedjedik/<br />
negyedik = der vierte, nedjven/ negyven = vierzig, nedjvenedik/ negyvenedik = der vierzigste, nyóltsz/nyolc =<br />
acht, nyóltszadik/nyolcadik = der achte, nyóltszar/nyolcszor = acht mal, nyóltszvanadik/nyolcvanadik = der<br />
achtzigste, öt = fünf, ötödik = der fünfte, ötössz/ötös = Fünfter, öttször/ötször = fünfmal, ötvön/ötven =<br />
fünfzig, száz = hundert, századik = der hunderste, százasz/százas = hunderter,Hundert-frankennote, szokony/<br />
sokan = viele, eine Menge, tisz-szer/ tízszer = zehnmal, tiz/tíz = zehn, tizedik = der zehnte, tizee-háram/<br />
tizenhárom = dreizehn, tizee-hat/tizenhat = sechzehn, tizee-hiét/tizenhét = siebzehn, tizen-edj/tezenegy = elf,<br />
tizen-nédj/tizennégy = vierzehn, tizen-öt/ tizenöt = fünfzehn, tizen- nyóltsz/tizennyolc = achtzehn, tizen-kettü<br />
/tizenkettı = zwölf, tizen kilentsz /tizenkilenc = neunzehn, tizessz/tizes = Zehner, tisz-szer/tízszer = zehnmal,<br />
utólszó/utolsó = der letzte.<br />
Weiterhin bekannt sind folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
milión (milion)/millió = Million, numer/szám = Zahl, Nummer.<br />
10.4. Farbbezeichnungen<br />
Auch die im Wörterbuch Wichmanns befindlichen ungarischen Farbbezeichnungen sind<br />
auch heute noch ausnahmslos bekannt:<br />
fejjér/fehér = weiss, fekete = schwarz, veresz/vörös = rot, zıld = grün, zıldől/zöldül = grün werden,<br />
zıldjit,meg-z./zöldül = grün färben, kék = blau, kékkessz/kékes = bläulich, kékkit/kékít = blau farben,bläuen,<br />
kékkül/kékül = blauwerden, szényetleny/szinetlen = farblos,bleich,blass, szürkiész/szürkés = graulich.<br />
127
10.5. Kindersprache<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind noch bekannt:<br />
bibi/kicsi seb = kleine Wunde (in der Kindersprache), gurika,gurikám!kicsi gyerekem! = mein liebes Kind!(so<br />
reden die alten Weiber kleine Kinder an), kaka = Dreck,Kot, kakász/kakás,piszkos = schmutzig,garstig, kukul,<br />
le-k./lefekszik = sich niederlegen, papál = essen (in der Kindersprache), tjütjü = sitze still! (in der Kindersprache),<br />
tszitszi/cici = Mutterbrust.<br />
Nicht mehr bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
babo,bábó/ kicsi láb,lábacska = Füsschen (in der Kindersprache), hiéjeske! = Liebchen!liebes Kindchen!, ψütü!<br />
= sagt man zu en kleinen Kinern, wenn man ihnen zu trinken gibt, ψüψü/tütü = etwas zu trinken, Trunk (in der<br />
Kindersprache), ψüψül/tütül = trinken (in der Kindersprache).<br />
10.6. Alltagsvokabular<br />
Im folgenden sollen die mit dem „Alltagsleben” des Menschen verbundenen Wörter und Ausdrücke<br />
näher unter die Lupe genommen werden:<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
abaiag/abajog = sich über etw.beklagen, ad = geben, akad = stecken o.hängen bleiben, akaszt = hängen,<br />
aufhängen, ál/áll = stehen, álam/álom = Traum,Schlaf, alaszik/alszik = schlafen, alazgatik/szendít =<br />
schlummern, álmisz/álmos = schlafen, állitó = Hindernis, im allg.alles,was etw. zum stehen bringt, ámit =<br />
betören,blenden, apad = fallen,versiegen, aprit = brocken,zerstücken, aprózik heute: aprisszák / aprítsák,<br />
darabolják = sich zerkleinern, arány heute: irántam = mir gegenüber, arányit heute: íránit = in einer<br />
Richtung u.in gerader Linie ordnen, árnyék = Schatten, bánság,bántság/megbánás = Reue,Kummer, bai/baj =<br />
Übel,Mühe,Schwierigkeit, ázik = nass werden, bán/megbánás = bereuen, bántat/sérteget = beleidigen, barált<br />
/barát (sic!) (veralt.) = Frend; heute eher: précsin =Freund, basz = beischlafen, béke = Ruhe(lass mich in<br />
Ruhe!), békétleny/békétlen = zänkisch, biélez/belez (pl.a kenyér héját) = das innere aushöhlen (z.B.das Brot<br />
beim Essen), bengeredik(=hengeredik) = rollen, berzeszsz/dühös = hitzig, zornig, beszéd = Gespräch,Anrede,<br />
billeg = schwanken,wackeln, billent = kippen, bir/bír = können,imstande sein, birószsz/bírós,erıs = stark,<br />
kräftig, bizik/remél = hoffen, eine Hoffnung geben, bizzeg = sprudeln, bokkont/bakkant,kopog = klopfen,<br />
bolondoszkodik = Spass treiben, bolondjit,el-b./ elbolondít = den Kopf verdrehen,betören, bolgot/bolygat =<br />
stören, beunruhigen, bomlik = zerfallen, bongol/gombol / knöpfen, borotvál = rasieren, bosát/megbocsájt =<br />
vergeben,verzeichen, botlik = stolpern,straucheln, bıg = brüllen, heulen, bubádzik,meg-b./szől = entbinden,<br />
niederkommen, buffag/bufog,kopog = knallen,klopfen, buik/bújik = sich verstecken, bulsuzik/búcsúzik =<br />
Abschied nehmen, burit/borít = bedecken,zudecken, burul,bé-b./beborul = sich trüben,bewölken(v.Himmel),<br />
buszul/búsul = trauern, sich kümmern, butul,el-b./eltompul = stumpf werden, büdeszsz/bődös,lusta = übelriechend,faul,<br />
bün/bőn = Sünde,Schuld,Verbrechen, bünezıdik,el-b./bünızik = sündigen,sich versündigen,<br />
büntet = strafen, dábbag = langsam u. mühsam wandern,gehen, dagad = schwellen, daikál/dajkál = pflegen,<br />
warten(bes.Kinder,aber auch Erwachsene), büz/bőz = Geruch,Wohlgeruch, darab = Stück,Bruchstück,<br />
darabal,el-d./drabol = zerstücken, délez/ebédel,ebéd után pihen = zu Mittag essen,Mittagsruhe halten, derit,kid/kiderít,kideről<br />
= aufklären,aufhellen, dib-dábbag/sántít = hinkend und schwankend gehen, dob,el-d./őt =<br />
schlagen,hauen, dolgoz,meg-d./”megdolgoz”,megver = bearbeiten,prügeln, dolgozik = arbeiten, dolgozó =<br />
Arbeiter, dolog = Arbeit,Sache, dıl = sich neigen,umfallen, dız/gyız = vermögen,können,bestiegen, dubag/<br />
dobog = pochen,poltern, dühit,meg-d./dőhít = wütend machen, dülöl/győlöl = hassen, djak/gyak = immerfort<br />
etw.wiederholt sagen, dül/győjt = sammeln, djérül/gyérül = schlütter werden (z.B.das Haar), djisér/dicsér =<br />
loben, djug,bé-d./bedug = verstopfen, zustopfen, djuit/gyújt = anzünden, djül/győl = sich versammeln, ebéd =<br />
Mahlzeit, ébred = erwachen, éfiuszág/ifjúság = Jugend, éget = brennen, ehetı = essbar, eit,ki-e./ejt = fallen<br />
lassen, él = leben, élész/élés,élet = Leben, elewen/eleven = lebendig, emel = heben,erheben, énekel = singen,<br />
spielen, ereszkedik = sich herablassen,sich senken, ereszt = lassen,fortlassen, érez,meg-é.= empfinden, fühlen,<br />
verspüren, érkezész/érkezés = Anlagen,Ankunft, erı = Kraft,Stärke, ért,iért/ért = verstehen, esz/ész =<br />
Verstand, Vernunft, eszik = essen, eszkeszik/esküszik = einen Schwur abgeben,sich trauen lassen, ét,meg-<br />
128
ét/megétet,megmérgez = vergiften, ételezik/étkezik = speisen,essen, étlen = hungrig, ewész sze iwász/evés és<br />
ivás = Essen und Trinken, ezdjik/esd,kérlel = sich sehnen,begierig sein,verlangen, fárat/fáradt = müde, farkal =<br />
einem Weibe beiwohnen, farkalodik = sich dem Manne hingeben(von Weibern), faszal,mek-f.= einem Weibe<br />
beiwohnen, faszaszsz/faszos = m.grossem männlichem Glied versehen, fázik = frieren, fekit,le-f. / lefekszik<br />
(aludni) = schlafen gehen, fekszik = liegen, feküe,feküwe/fekve = liegend, feküész/fekvés = Liegen, fél,fiél/fél<br />
= fürchten, feleit,el-f./felejt = vergessen, fiélész/félés = Furcht, fiél-eszü/félesző,buta = nicht ganz klug,etwas<br />
verrückt, feletkezik,el-f. = etwas vergessen, félt,fiélt =besorgt sein,eifersüchtig sein, fiéltetısz/ féltékeny =<br />
eifersüchtig, feredik = baden,sich baden, feredı/fürdı =Bad,Badestube, fereszt/füröszt = baden, fing = Wind<br />
im Leibe, fingik = furzen, fodj/fogy = sich mindern,abnehmen, fodjoszt,el-f./fogyaszt,elfogyaszt = verzehren,<br />
verbrauchen, fogotszág/fogadás = Wette, fogul,mek-f./foglyul esik = gefangen werden, festgenommen w.,<br />
fol,bé-f./fal,befal = einen Bissen abbeisen, folász/falás = Bissen,ein Mundvoll, folodoz/ falatoz = bissenweise<br />
essen, fordul = sich drehen, fordjitász/fordítás = Wenden,Umdrehen,Übersetzen, forgódik/nagyon elfoglaltnak<br />
lenni = sich m.etw.eilends beschäftigen, sehr beschäftigt sein, fötlen/fıtelen = ungekocht, fut = laufen,rennen,<br />
füszt/füst = Rauch, füsztel/füstöl = rauchen,dampfen,räuchern, füszül/fésül = kämmen, fütjér/fütyöl = pfeifen,<br />
füttjentész/füttyentés = Pfiff, gibószkadik/gubbaszkodik = sich zusammenschrumpfen(vor Kälte) gondol =<br />
denken,meinen, gondolkozik = denken,nachdenken, gondolot/ gondolat = Gedanke,Meinung, gurtjant/kortyant<br />
= einen Schluck nehmen,hörbar schlucken, habaradik/ beavatkozik valamibe = sich in etw.einmischen,<br />
gümbülü/gömbölyő = kugelrund, hág =steigen,klettern, hajlik = sich biegen,sich krümmen, haithajt = treiben,<br />
hait/fel-h./hajt,felhajt = aufschlagen,krempeln, hal,el-h.,meg-h./meghal = sterben, hál/hál,alszik = übernachten,<br />
irgendwo schlafen, hal/hall = hören, halad = Fortschritte machen, haladó = überflüssig, halál = Tod,Sterben,<br />
halálaszsz/halálos = tödlich,todbringend, hálász/hálás = Übernachtung,schlafen, halat/halott = der Tote,<br />
Leichnam, halatkazik/igyekezik = wetteifer, halatszág/haladó = Sterblichkeit, halauán/halvány = träge, schlaff,<br />
faul, halgat/hallgat = hören,zuhören,schweigen, halgatkazik/ hallgatózik = lauschen,horchen, halgatósz/<br />
halgatag = schweigen, háló-hel/hálóhely = SchlafstättenNachtlager, han/hány,eldob = werfen, hánódik/<br />
hányódik = herumgetrieben werden,hin und her geworfen werden, harag = Zorn, Ärger, haragszik/haragszik =<br />
zürnen,zornig sein, harap = beisen, harapász = Beissen,Bissen, haszad/hasad = sich spalten,reissen, haszadék/<br />
hasadék = Riss,Sprung,Spalte, haszan/haszon = Nutzen, használ = nützen,nützlich sein, hasznaszsz/hasznos =<br />
nützlich,vorteilhaft, hempeleg/hömpölyög = sich herumwälzen, hempelget(egy hordót) = wälzen, herumwälzen<br />
(z.B.ein Fass), hemu/hamu = Asche, hengeredik,bengeredik = sich gleichformig rollen o.wälzen, hep/üt = stark<br />
zuschlagen,hauen(m.der Fuss,dem Stock), hersent/odaüt = zuschlagen, einenHieb versetzen, hertzelkedik/<br />
ellenáll = Wiederstand leisten,mutig gegen einen Stärkeren streiten, heweny,hewenen eszik/forrót eszik,iszik =<br />
heiss trinken,essen, hewer/hever,lustálkodik = müssig liegen,liegend faulenzen, hezud/hazudik = lügen,<br />
hezukszág/hazugság = Lüge,Unwahrheit, hibász/hibás = schadhaft,beschädigt,gebrechlich, hint/hínt = streuen,<br />
hint/int = zu sich winken, hirez,el-h./hírel, hírterjesztı,pletykál = ein Gerücht verbreiten (z.B.von Zeitungen),<br />
verkündigen,kundgeben, hirtetész/hírdetés = Kundmachung, hisz = glauben,meinen, hizik/hízik = fett werden,<br />
hól,le-h./hull,lehull = herabfallen,abfallen, hon/otthon = zu Hause, hord = tragen, horkog/horkol = schnarchen,<br />
schnauben, hoz = bringen,holen, hun/húny = blinzeln, huz/húz = ziehen,schleppen, iégget/ijeget = erschrecken,<br />
bedrohen, iha/szomjas = durstig, ihazik/ szomjas = durstig, ihazik/szomjazik =dürsten,dursten, iied,meg-i./<br />
megíjed = erschrecken, iieszt/ijeszt = abschrecken, iiesztı/ijesztı = Scheuche,Schreckgestalt, indul = bewegen,<br />
in Bewegung bringen, ió/ivó = Trinker, iszik = trinken, ital = Trank,Trunk,Getränk, jádzik/játszik = spielen,<br />
jár = gehen, járász/járás = gehen, jó,jót sán/jót csinál = gut, eine Wohltat erweisen, jó-akarat/jóakarat = Wohlwollen,<br />
job,jobra/ jobb,jobbra = besser,rechts,von den rechten Seite, jobbon/jobban = besser,mehr, jobboskáb/<br />
jóbbacskán = etw.besser, ein wenig besser, jobbul = besser werden, jó-fiéle/jóféle = von guter Art,gut, jó-lelkü<br />
= gut,gutmütig, jól-lakik/jóllakik = sich satt essen, jószág/jóság = Wohlbefinden,Wohlstand, jó-szüü/jószívő =<br />
gutherzig, kabdasz/kapdos = dies und das bekommen, hier u.da nach etw.greifen, kákkul heute: sakkul,mekk./elbóbiskol(ember),csipked<br />
(csırével a tyúk) = m.dem Kopfe nicken (vor schläfrigkeit),m.dem Schnabel<br />
picken (v.der Henne), kar,efiiukar/kor,ifjúkor = in der Jugendzeit, katszag/kacag = lachen, kauarag/kavarog =<br />
herumstreichen,bummeln, kazdag/gazdag = reich, kedv = Lust, kedvel = froh u.lustig sein (von Betrunkenen),<br />
kedveszül,mek-k./froh u.lustig werden (vom Trinken), kedvetlen = missmutig,verdriesslich,unlustig, kel,felk.,mek-k.,ki-kel<br />
= aufstehen,gären,aufsteigen, kel/kell = sollen,müssen, kellendı/szükéges = nötig, notwendig,<br />
erforderlich, kelletlen/nem szükséges = unnötig,überflüssig, kemén/kemény = stark,grossartig, ken,bé-k,mekk./=<br />
schmieren,salben,streichen,einschmieren,beschmieren,verstreichen, kenısz/kenıs,ragacsos = schmierig,<br />
salbig, pomadig, képesz,niis-k./képes lenni valamire,nem k. = fähig, unfähig, kiér/kér = bitten, kiérd/kérdez =<br />
fragen,anfragen, kiérdész/kérdés = Frage, kerekit,mek-k. = rund machen,abrunden, kereng = sich drehen,<br />
kiérész/kérés = Bitte, keresz/keres = suchen, kerget,el-k.,ki-k, = treiben,jagen, kerül,el-k. = vermeiden,<br />
ausweichen,einen Umweg machen, kerülész/kerülı = Umweg, készen,k.vadjak/készen vagyok = fertig, ich bin<br />
fertig, készér/kisér = begleiten, keszeredik,mek-k.,keszerül,mek-k./keseredeik, keszerül = bitter werden,<br />
készik,el-k./késik = sich verspäten, készit = bereiten,verfertigen,zubereiten, keszken/keskeny = schmal,eng,<br />
késztet/késtet = zurückhalten,aufhalten,verzögern, készül = in Vorbereitung sein, készület/ elıkészítés =<br />
Vorbereitung, kewél/kevély = hochmütig, kewélszég/kevélység = Hochmut, kezel,mek-k./kezet fog valakivel =<br />
jmd. die Hand geben, kezdj,mek-k. = beginnen, kiált,kiáit,káit/kiált = schreien,rufen, koponil/ bottal összetörni<br />
valamit,rombolni = m.einem Stock klopfend schlagen,anklopfen,so dass der geschlagene Gegenstand beschädigt<br />
129
wird, kormánaz/kormányoz = steuern,lenken,verwalten,regieren, kormosz/kormos = russig,russbeschmutzt,<br />
kormoz,mek-k. = russig machen,beschmutzen, korom = Russ, kósztál/kóstol = kosten,schmecken, kouod<br />
MTsz.guvad/kuvad,hámlík = sichablösen,sich abschälen,sich abschuppen, kıld,el-k./küld = schicken,senden,<br />
absenden, könv,künü/könny = Träne, könvöz/könnyez = Tränen vergiessen, körmösziél/karmol (a macska) =<br />
mehrmals kratzen,krallen (z.B.von der Katze), kısz/köves = steinig, köszön (köszönöm e jó-sánászt) = danke<br />
(ich danke f.die Gütigkeit), köt = binden,anbinden,stricken,flechten:die Frucht bilden(von Obstbäumen und<br />
allerlei Getreide-und Ackerfruchtarten), kötöz = (mehrere Gegenstände) binden, kötül (valakivel társulni,<br />
szövetséget kötni) = mit jmd.anbinden,Händel suchen, köwiér/kövér, heute eher: hízott = fett,dick,beleibt,<br />
köwösz,köwesz/kevés = wenig,gering,spärlich, köwöszöl/kevesel =für zu wenig halten o.gering zu halten,<br />
közé,közénk = zwieschen uns, in unsere Mitte, köziél/közel = nahe,in der Nähe, közölit/közelít = näher<br />
kommen, közölülnet/közelrıl = aus der Nähe, közöpösz/közepes = mittelmässig, mässig, kukusál/kukucsál =<br />
gucken,lugen, kulakal/kujakol = mit der Faust durchprügeln, kusmál (rum.ridică căciula)/ megemeli a<br />
sapkáját,köszön = dieMütze abnehmen, külenez,ki-k./”különöz”,válogat = absondern, kürtül/kürtöl = auf dem<br />
Horne blasen, ladzik/látszik = sichtbar sein, lebben = leicht hauchen(von Winde), lel = finden,treffen,<br />
lélekszik/lélegzik = hauchen,ziehen(von der Luft),atmen, lépész/lépés = Schritt,Tritt, libitzkel/sántít =<br />
hinken,hinkend gehen, lippent/(hirtelen pofon csap valakit) = unerwartet eine Ohrfeige geben, lobdosz/lopdos =<br />
wiederholt stehlen,stibitzen, lóg = sich bewegen, baumeln, lı = schiessen, ló-hátassz/lovas = Reiter,Mann zu<br />
Pferde, lök = schieben,stossen, lektsze/lecke = Lektion,Aufgabe, mahmurás/mámoros,másnapos = der<br />
Katzenjammer hat, maradék = überbleibsel,Rest, mászkál = herum-kriechen, máz = Glasur, mázal/mázol =<br />
glasieren, mehet = er kann gehen, menen/megy = gehen, miér/mér, kimér = abwiegen, mogosztol/magasztal,<br />
dicsér = für zu hoch halten, mond = sagen, markol = anfassen,m.der Hand fassen, mosz/mos = waschen,<br />
moskol/mocskol = beschmutzen, mosok/mocsok = Schmutz, mozog = sich bewegen, mul,el-m./elmúlik =<br />
verschwinden,sterben, mulat/idıt tölt = verweilen, die Zeit zubringen, néz = schauen,sehen, nyaggat = quälen,<br />
martern, nyal = lecken,schlecken, nı = wachsen, nıı,nıwı/növésben lévı...= Wachsender, nyaraltat = den<br />
Sommerr irgendwo zubringen lassen, nyargal = hin u.her laufen,rennen, nyer = gewinnen, nyirkit/nedvesít =<br />
feuchten,nässen, nyit,be-ny.,ki-ny.= öffenen,schliessen, nyom/(pl.lábnyom) = Spur,Fussstapfe, nyom/nyomni =<br />
drücken,pressen, nyuit/nyújt = dehnen,strecken,reichen, nyúl = anrühren, nach etw.greifen, nyuz/nyúz =<br />
schinden,häuten, schälen(einen Baum), olvoszt heute: oloszt/olvas,számol =lesen, zählen, omlik = zusammenstürzen,zusammenfallen,<br />
ordjit/ordít = heulen,schreien, oszt = teilen, osztó = teilend,der Teiler, öklöl/öklel =<br />
stechen,(z.B. m.dem Messer)?durchzucken(z.B.den Magen), öklölész/öklelés = Stechen,Seitenstechen, ölöl/ölel<br />
= umarmen,umhalsen, ömlik,ki-ö. = sich ergiessen,fliessen, önt,el-ö.,le-ö. = giessen,schütten, öröm heute eher:<br />
bukurje= Freude, örömösz/örül = freudvoll,erfreut, örömöszszön/szívesen = m.Freuden,gern, pártal/pártol =<br />
jmd.begünstigen,sich jmd.annehmen, pazilkadik,pezilkadik MTsz. posol/ siet = eilen,sich beeilen, petel=einem<br />
Weibe beiwohnen, pihel/piheg = keuchen,schwer atmen, prubál/próbál = versuchen,probieren, pusztit ,pusztjit,<br />
el-p. = verwüsten,vernichten,verheeren, pusztul,el-p. = zugrunde gehen, untergehen, rág,meg-r. = kauen, zerkauen,<br />
ragaszt = kleben,kleistern,leimen, ragasztó = kleister, rak = setzen, laden, ráksál/rágcsál = kauen,<br />
nagen,knabbern, ránt = reissen,zerren, ráz = schütteln,rütteln, rebeg/remeg = zittern,beben, regveli,r.ebéd =<br />
morgendlich,Frühstück, reked = stecken bleiben, heiser, reményszég/ kérés, könyörgés = flechentliche Bitte,<br />
rendelész/rendelés = Anordnung,Zeremonie, rendesz/rendes = artig,anständig, reped = spalten,einen Riss<br />
bekommen(z.B.die Haut), repül = fliegen, reszel = reiben,feilen, reszket = zittern, beben, rétel/ összehajt,<br />
hajtogat = aufschichten,zusammenlegen,falten, rezdül = erbeben,erzittern, rezeg = zittern,beben, vibrieren,<br />
rihad,el-r./riad = erschrecken u.davonlaufen, rihaszt,el-r./ elriaszt = abschrecken, verscheuchen, rikuit/rikolt =<br />
schreiend rufen, riu/rí = weinen, riuász/rívás = weinen, riuósz/,rívós,sírós = der leicht weint, ront = verderben,<br />
zerstören, rugdasz/rugdos = ein wenig m.den Füssen stossen (z.B. das Kind im Schlaf), szab = zuschneiden,<br />
szaiag/sajog = schmerzen,brennen, szakaszt,el-sz.= zerreissen,losreissen, szalad = laufen, szán/sajnál =<br />
bedauern,bemitleiden, szaparadik/szaporodik = sich vermährn, zunehmen,Zuwachs erhalten, szar = Dreck,Kot,<br />
szarik = scheissen, szed = sammeln,pflücken, szédjel/szégyel = sich schämen, szeewed heute: :szenved/<br />
szenved = leiden,ertragen, szegét/segít = helfen,Hilfe leisten, szegétszég/segítség = Hilfe,Beistand, szeit/<br />
(valamit)sejt = ahnen,mutmassen, szel heute: szeletel = schneiden (z.B.das Brot), szemel/kiválaszt = auswählen,<br />
szemiél/hasonlít valakihez = ähnlich sein,scheinen, szenderedik = schlummern, szeper/seper = kehren,fegen<br />
(mosz szeprek vala = eben jetzt fege ich), szépszég/szépség = Schönheit, szereese/ szerencse = Glück, Glücksfall,<br />
szerelem = Liebe, szeret = lieben, szerez = schaffen,verschaffen, szid = schimpfen, szeit/siet = eilen,sich<br />
beeilen, szikul/síkul,csúszik = gleiten,rutschen, szimatal/szimatol,szagol = riechen,wittern(z.B.der Hund),<br />
sziu/síkit = m.hoher,scharfer Stimme schreien, szóait/sóhajt = seufzen, szok/ szokik = gewöhnen, szól = sagen,<br />
sprechen,tönen,schallen, szóllász/szólás = Ton,Laut,Stimme (sziép szóllásza vadja annak e kakasznak = jener<br />
Hahn hat eine schöne Stimme), szopik = saugen, szór = schwingen, worfeln, szorul,be-sz. = sich eindrücken,<br />
sich einzwängen,eingezwängt werden, szuit/sújt = m.einer biegsame Rute schwippen o.schlagen, szur/szúr =<br />
stechen,beissen(z.B.die Mücke, die Nadel), szuszszan/szusszan = ein wenig rasten (z.B.die Pferde), szuttag/<br />
suttog = flüstern,wispern,munkeln, születész,születészem napja/születés, születésnap = Gebrt,mein Geburtstag,<br />
szür/szőr = seihen,filtrieren,keltern, sal/csal = betrügen,täuschen, sán/csinál = machen, sánász/csinálás = Tun,<br />
Machen,Verfertigung, sap/csap(pofon csap) = Ohrfeige, Maul-schelle, sap,el-s.,ki-s.,mek-s./üt,ver = fortjagen,<br />
hauen,schlagen, sattan/csattan = knallen,klapsen,knistern, sauarag/csavarog = umherstreichen, sauarit/csavarít<br />
130
= biegen,beugen,krümmern(z.B.einen Baum,ein Eisen,ein Finger), sauart/csavart,kapzsi = Sozialist; geizig,<br />
karg,knauserig, seppeg/csepeg = tröpfeln,tropfen,träufeln, sip/csíp = beissen,brennen,prikeln, sókal/csókol =<br />
küssen, sókalász/csókolás = Kuss, soronkól/csordogál = leise rieseln, fliessen, sudál/csodál = bewundern,<br />
anstaunen, sudálkazik/csodálkozik = bewundern,anstauen, sufalkadik/ csúfolkodik = Spott treiben mit jmd.,<br />
surdjit,el-s./csurdít,kirabol = entblössen,ausrauben, suszik/ csúszik = gleiten,schleissen, tagad,el-t.= verleugnen,<br />
takar=bedecke,,zudecken, talál = finden,treffen,geraten, találkazik mek-t./találkozik = jmd.begegnen,sich<br />
treffen, tanit = lehren,unterrichten, tanul = lernrn, taplál heute: táplál /táplál = unterstützen, helfen,<br />
jmd.beistehen, tápszil/tapsol = applaudieren,Beifall klatschen, tarkul,mek-t. = bunt, gesprengelt,scheckig<br />
werden, tart = halten, tekereg = sich winden,sich drehen, telel = überwintern, temet = begraben,einscharren,<br />
tenerel/tenyerel,pofoz = ohrfeigen, tép = reissen,zupfen, tiér,el-t./eltér = abweichen, ablenken, teremt =<br />
schaffen,schöpfen, terül =sich ausbreiten, tesz = setzen,stellen,legen, tetszik = sichtbar sein, tipad/tapod =<br />
treten,stampfen, tisztel,mek-t. = mit Wein(Bier,Branntwein),bewirten, tisztit/tisztít,hámoz = reinigen,schälen,<br />
tisztul (az idı)= rein werden, klar werden (auch v.Wetter), tol = schieben,stossen, told = anfügen,verlängern,<br />
toldász/toldás = Anstücken,Zusetzen, tolvoiszág/tolvajság = Dieberei,Gaunerei, toszit/ taszít = schieben,stossen,<br />
töbdösz/köpdös = immerfort speien u.spucken, tölt = füllen,voll machen, töp/köp = spucken,speien, töpész/<br />
köpés = Speichel, tör = zerstossen, zerbrechen, tördöl/tördel = zerbrechen, törik = zerbrechen, töröl =<br />
wischen,abwischen, törtjénész/történés = Ereignis, Vorfall, tud = wissen,können, tuluz,mek-t. = m. Federn<br />
bedecken o.bewerfen, tőr = dulden,ertragen, tőr, feltőr,le-t.= aufstreichen(z.B.die Ärmel), türelem = Geduld,<br />
türhetetlen = unerträglich, türül,le-t./tőr = sich herabbiegen (z.B.die Ärmel), tjiérdjül/térdel = niederknien,<br />
tjógat MTsz.sógat/kutyával előzni valakit = hetzen (jmd. durch Anhetzen der Hunde vertreiben), tszedula/<br />
cédula = Zettel, tjürrektet/fütyöl = pfeifen,flöten, tjürrektetı/fütyülı = Pfeife (zum Pfeifen), tjürrent/egyet<br />
füttyent = einmal scharf pfeifen,z.B.m.einer Pfeife, in welche eine Erbse eingelegt ist, tszomtszog/csámcsog =<br />
schmatzen (beim Essen), uit,el-u./olt,elolt = löschen, auslöschen, uiul,fel-u./újul,felújul = sich erneuern (auch<br />
vom Mond), ura,ura vadja = können, vermögen, imstande sein, uszik = schwimmen, utaa-járó/utas = Wanderer,<br />
Reisender, utál = verabscheuen, utálósz = abscheulich, utazász/utazás = Reisen, utazik ,el-u./elutazik = abreisen,<br />
utól-iér/utolér = einholen,erreichen,utra-ualó/útravaló = Reisevorrat, Reisegeld, üdjel/ügyel = achtgeben,<br />
auf etw.achten, ül = sitzen,wohnen, ürit/őrít = leeren, üszmiér/ismer = kennen,erkennen, üszmiéret/ ismeret,<br />
ismerıs = Bekannter, üszmiérısz/ismerıs,hálás = erkenntlich,dankbar, üt = schlagen,hauen, ütkezik/ ütközik,<br />
talál = übereinstimmen,ähnlich sein, üzen,izen = sagen lassen,melden, vadul,meg-v.= wild werden, vág =<br />
schneiden,hauen,hacken, vágász/vágás = Schnitt,Hieb, vakarász/vakarás = Kratzen,Gekritzel, válagatássz/<br />
válogatás = Auswählen,Wahlerei, valószit,meg-v./ valósít, megvalósít = verwirklichen,betätigen,ins Werk<br />
setzen, válság/váltság = Tausch,Umtausch, vált = wechseln, tauschen, váltagat/váltogat = oft wechseln,<br />
abwechseln, váltatlan = ohne gewechselt o.geändert zu werden, váltazász/ változás = Änderung,Wechsel,<br />
Abwechslung, vár = warten,harren, várakazik/várakozik = warten, harren, zuwarten, várhatatlan = worauf man<br />
nicht warten kann,ungeduldig, vedjit/vegyít = mischen,mengen, vedjül ,be-v./vegyül = sich in etw. einmischen,<br />
sich mengen, velegat/siránkozik = wehklagen,jammern, ver = schlagen, prügeln, verészsz/verés = Prügel, vesz =<br />
nehmen,kaufen, vesz,el-v./elvesz = umkommen,sinken,verloren, vét = fehlen,einen Fehler begehen, vidjáz/<br />
vigyáz = achtgeben, achten, vigad = fröhlich sein,sich belustigen, vigit/higít = verdünnen, auflassen, visz =<br />
tragen,bringen, viszel,el-v./visel = tragen,abtragen, vizgál/vizsgál = untersuchen,forschen, zakatar/zakatol =<br />
poltern,dröhnen, klappern, zauar/zavar = trüben(z.B.das Waser)?treiben, zökkön/zökken = stossen,holpern,<br />
zug/zúg = sausen,tosen,brausen,dröhnen, zupag = dröhnen (z.B.der Hausboden beim anzen), zengész/zengés =<br />
Tönen,Klang, ψüszeg/tüsszög = niesen, ψüszszent/prüsszent = einmal niesen, zengitész = Läuten,Klingeln.<br />
In vielen der folgenden Belege für die Erscheinung des Lautwandels lässt sich die<br />
Annäherung an die ungarische Standardsprache beobachten:<br />
arányit/ irányít = in einer Richtung u.in gerader Linie ordnen → íránit<br />
szeewed /szenved = leiden,ertragen<br />
→ szenved<br />
taplál /táplál = unterstützen,helfen,jmd.beistehen<br />
→ táplál<br />
(standardsprachliche Bedeutung von táplál= ételt ad,élelemmel ellát= jmd.ernähren)<br />
kákkul,mek-k./elbóbiskol(ember),csipked (csırével a tyúk) = m.dem Kopfe nicken (vor<br />
Schläfrigkeit),m.dem Schnabel picken(v.der Henne) → sakkul<br />
olvoszt/olvas,számol = lesen, zählen<br />
→ oloszt<br />
Letzterer Beleg ist auch deshalb von Bedeutung, da sich in ihm die alte, ursprüngliche<br />
Bedeutung ’zählen, rechnen’ des Lexems olvas wiederfindet.<br />
131
Im aktiven Wortschatz der Szabófalver sind Archaismen wie folgende erhalten geblieben:<br />
iha/szomjas = durstig, ihazik/szomjazik = dürsten,dursten, ezdjik/esd,kérlel = sich sehnen,<br />
begierig sein,verlangen, libitzkel/sántít = hinken,hinkend gehen oder djak/ gyak = immerfort<br />
etw.wiederholt sagen, zu wiederholten Malen von etw. reden.<br />
Die Variationsbreite und den Ausdrucksreichtum des Tschango-Dialektes zeigen die<br />
zahlreichen Synonyme, die alle erhalten geblieben sind:<br />
délez/ebédel,ebéd után pihen = zu Mittag essen,Mittagsruhe halten → bekannt<br />
déli-ebéd = Mittagsmahl → bekannt<br />
eszik = essen → bekannt<br />
ételezik/étkezik = speisen,essen → bekannt<br />
ebéd = Mahlzeit (im allg.) → bekannt<br />
ewész( sze iwász)/evés (és ivás) = Essen(und Trinken) → bekannt<br />
fodjoszt,el-f./fogyaszt,elf. = verzehren,verbrauchen → bekannt<br />
fol,bé-f./fal,befal = einen Bissen abbeisen → bekannt<br />
folodoz/ fal = bissenweise essen → bekannt<br />
ösztöli ebéd = Abendmahl → bekannt<br />
regveli,r.ebéd = morgendlich,Frühstück → bekannt<br />
Im Folgenden folgt eine Auflistung von weiteren, aus mehreren ungarischen Elementen<br />
bestehenden Synonymenpaaren, die auch heute noch – mit wenigen Ausnahmen - bekannt<br />
sind:<br />
fut = laufen,rennen → bekannt<br />
nyargal = hin u.her laufen,rennen → bekannt<br />
szalad = laufen → bekannt<br />
rohon,bé-r. = hineinstürzen,hineinrennen → nicht bekannt<br />
dábbag = langsam u. mühsam wandern → bekannt<br />
dib-dábbag/sántít = hinkend und schwankend gehen → bekannt<br />
jár = gehen → bekannt<br />
járász/járás = gehen → bekannt<br />
libitzkel/sántít = hinken,hinkend gehen → bekannt<br />
mehet = er kann gehen → bekannt<br />
menen/megy = gehen → bekannt<br />
alaszik/alszik = schlafen → bekannt<br />
alazgatik/szendít = schlummern → bekannt<br />
hál/hál,alszik = übernachten,irgendwo schlafen → bekannt<br />
szenderedik/szendereg = schlummern → bekannt<br />
132
dob,el-d./őt = schlagen,hauen → bekannt<br />
dolgoz,meg-d./”megdolgoz”,megver = bearbeiten,prügeln → bekannt<br />
hep/üt = stark zuschlagen,hauen(m.der Fuss,dem Stock) → bekannt<br />
hersent/odaüt = zuschlagen → bekannt<br />
koponil/ bottal összetörni valamit,rombolni → bekannt<br />
= m.einem Stock klopfend schlagen,<br />
anklopfen,so dass der geschlagene<br />
Gegenstand beschädigt wird<br />
kulakal/kujakol = mit der Faust durchprügeln → bekannt<br />
lippent/(hirtelen pofon csap valakit) = unerwartet eine Ohrfeige geben→ bekannt<br />
szuit/sújt = m.einer biegsame Rute schwippen o.schlagen → bekannt<br />
sap/csap(pofon csap) = Ohrfeige,Maulschelle → bekannt<br />
sap,el-s.,ki-s.,mek-s./üt,ver = fortjagen,hauen,schlagen → bekannt<br />
sap,el-s.,ki-s.,mek-s./üt,ver = fortjagen,hauen,schlagen → bekannt<br />
tenerel/tenyerel,pofoz = ohrfeigen → bekannt<br />
tszirmal,el-t. MTsz. elcirmol/megver valakit = prügeln → nicht bekannt<br />
tszirmalász = Prügeln,Prügel → nicht bekannt<br />
üt = schlagen,hauen → bekannt<br />
vág = schneiden,hauen,hacken → bekannt<br />
ver = schlagen,prügeln → bekannt<br />
veréssz/verés = Prügel → bekannt<br />
Im folgenden Synonymenpaar sind die ungarischen Elemente älteren Datums erhalten<br />
geblieben:<br />
abaiag/abajog = sich über etw.beklagen → bekannt<br />
panaszkodik = klagen,sich beklagen → nicht bekannt<br />
velegat/siránkozik = wehklagen,jammern → bekannt<br />
Die folgenden Lexeme lassen sich der Kategorie r/a zuordnen, da diese zwar noch bekannt<br />
sind bzw. noch erkannt werden, aber durch andere Wörter langsam aber sicher verdrängt<br />
werden. So ist statt barált = Freund heute eher précsin ( < rum. prieten) und statt öröm =<br />
Freude eher bukurje ( < rum. bucurie) gebräuchlich.<br />
In den folgenden Fällen, die ebenfalls zur Kategorie r/a zählen, werden die ungarischen<br />
Wörter nicht durch rumänische, sondern durch ungarische Wörter verdrängt: so ist anstatt des<br />
Lexems köwiér/kövér heute eher das – im Wörterbuch Wichmanns nicht belegte - ungarische<br />
Wort hízott gebräuchlich (gemäß unserer Informantin, Margit Perka).<br />
Das Lexem illatósz/illatos = wohlriechend, duftig (z.B. der Wein) wird allmählich durch<br />
szépbőző, das Lexem szumuru /szomorú = traurig,gramvoll,trüb durch buszult verdrängt.<br />
133
Die folgenden rumänischen Lehnwörter sind bekannt:<br />
bórie (rum.abur)/gız = Dampf,Dunst, dóppal,bé-d. heute :duppal = pfropfen,zustopfen(m.einem Holzpfropf),<br />
gidzigiél (rum.a gădila)csiklant = kitzeln, gudun(rum. gudlun)/búvóhely = Schlupfwinkel,Versteck, Schlupfloch,<br />
hárta (rum.hartă)/térkép = Landkarte, kalabalik (rum.calabalăc)/zőrzavar,veszekedés = Hader,Zänkerei,<br />
Wirrnis,Panik, kobzol (rum.joacă la cobză) = Zither spielen, korsima (rum.cărciumă) = Wirtshaus, kotszkár<br />
(„ullan ember,ki kotszkával jár”) (rum.coŃcar) = Schelm, Spitzbube, Gauner, Bösewicht, meligáz (rum.face<br />
mămăligă)/puliszkát fız = Maisbrei zubereiten, szokotál/számol = rechnen,berechnen, serkál (rum.încearcă)/<br />
próbál= versuchen,probieren, sutit,le-s.(rum. a ciunti)/ verstümmeln, vizita/látogatás = Besuch, vizitál/látogat =<br />
besuchen,einen Besuch abstatten.<br />
Das Phänomen des Lautwandels zeigt sich am folgenden Beleg:<br />
dóppal = pfropfen,zustopfen(m.einem Holzpfropf)<br />
→ heute: duppal<br />
Dieses Wort ist Bestandteil eines Synonymenpaares, in dem beide Elemente – unabhängig<br />
von ihrer Herkunft – bekannt sind, was durch die zwischen ihnen vorliegende Bedeutungsdifferenzierung<br />
erklärt wird:<br />
duppal = pfropfen,zustopfen(m.einem Holzpfropf) → bekannt<br />
djug,bé-d./bedug = verstopfen, zustopfen → bekannt<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind nicht mehr bekannt:<br />
ajándiék, jándjékj/ajándék= Geschenk; baial/bajol,bajlódik = allerlei Arbeit verrichten, barátszág/barátság =<br />
Freundschaft, barátszágassz/barátságos = freundschaftlich, bető = Buchstabe, bódaradik = schlendern<br />
umgehen, bódarag/bódorog,lassan megy = bummeln,faulenzen, boldogit = befriedigen, einen Wunsch<br />
erfüllen,burkal,be-b./beburkol = einhüllen,umhüllen, écselkedik/incselkedik = sich necken, elm/elme =<br />
Verstand,Geist, emlék = Andenken, felel = antwortet, fén/fény = Glanz,Schimmer,Licht, fertelmeszkedik/<br />
szégyentelenül viselkedik = sich unverschämt benehmen, gazal/káromkodik = schimpfen, göröntszöl/vakarózik<br />
=kratzen,kritzeln,reiben, guggad/gubbad,bólingat(az álmosságtól) = vor Schläfrigkeit mit dem Kopfe nicken,<br />
gübben,bé-g./vízbemerül(kacsák,stb.) = eintauchen(die Enten,der Kahn), gübbentı/víz mélysége = Wasserschlund,Tiefe<br />
im Wasser, gübe/göbe (pl. a kanál mélyedése) = Höhlung (des Löffels,der Mulde), hanitág/<br />
hanyatt = rücklings,auf d.Rücken, hatalmaszsz/hatalmas = mächtig,stark,gewaltig, hedegül/hegedül = einem<br />
Weibe beiwohnen, ándjékaz/ajándékoz = schenken, koldul = betteln, kuntszag/kuncog = kirch..,bettelnd<br />
bitten), kusálkadik/kutyálkodik,nık után futkos = den Weibern nachlaufen, lobontsz/labanc = so soll der<br />
Rumäne den Magyaren-zum Spott-nennen, örvend = sich freuen, panaszkodik = klagen,sich beklagen, permed/<br />
permet = besprengen,bespritzen(vom Regen): permedet i köwöszt =es hat ein bischen gespritzt), permedez/<br />
permetez = es nieselt, rohon,bé-r=hineinstürzen,hineinrennen, röhög = grunzen, szánydjék/szándék = Absicht,<br />
Vorsatz, szeewed:karásany-szeewedje,huszét-sz./karácsony-, húsvétestje = Weinachtsabend,Osterabend,<br />
szényel/símit fényesít = glätten,schleifen,polieren (z.B.ein Möbel), sziérelem/ sérelem = Schmerz,Leid,Weh,<br />
szerül/sirül,fordul = sich drehen, szikkad = trocknen,austrocknen, seriél,el-s./cserél,lop = stehlen,stibitzen, ,<br />
sestet/szoptat = stillen,die Brust geben, siag MTsz.csivag = lärmen (bes.von Kindern), teplel(=táplál)/segít =<br />
helfen, szouány/sovány = fein, dünn, zermalmt (z.B.Mehl, Staub, Schnee); titok =Geheimnis, tıked =<br />
jmd.reizen,m.jmd.Händel suchen, tréfa = Scherz,Spass, tréfál = scherzen,spassen, tszipókál = auf einer in den<br />
Mund gesteckten Fischschuppe o. einem Baumblatt spielen,pfeifen), tszirmal,el-t. MTsz. elcirmol/ megver<br />
valakit = prügeln, tszirmalász = Prügeln,Prügel, tsábit/csábít = verführen,verleiten, tszommog/cammog = um<br />
jmd.umherschlendern, nach etw.lungern, ugrik = springen,Sprünge machen, üpertet MTsz.iperkedik/ iparkodik<br />
= anstrengen,abmühen, vadáz/vadászik = jagen,auf die Jagd gehen, üz/őz = treiben (das Vieh), vaszarkadik<br />
MTsz.vaszarkodik/siet = eilen,sich beeilen, von = ziehen, zaklat = antreiben, plagen (z.B.das Pferd),<br />
zeleg/cseveg,pletykál = plaudern,plappern,schwatzen, zelegész/csevegés = Plauderei,Geplauder.<br />
134
Nicht mehr bekannt sind auch folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
sorszol,el-s(rum.cioace) =abnützen, abtragen (z.B.ein Kleid), tumpinál,el-t.(rum.cumpănesc)/kicsalni,elvenni =<br />
entwenden,ablisten<br />
10.7. Sonstiges<br />
10.7.1. Interjektionen<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
aha = ah,so, hatsz-i-de!/ addsza ide! = her damit! gib her!, hoisz /hajsz = links kehren(m. den Ochsen),<br />
hop!/hopp! = hopp! hui,hui ki!hui bé! heute eher: kuss/ amikor a disznókat ki- behajtják = husch hinaus!<br />
husch hinein!, ki! = hinaus!, né, ni! = sieh! sich da! schau mal!, no,nó = no,nun! kitsz ki!/sicc ki!(a<br />
macskához) = hinaus mit dir! fort! weg! husch! (zu der Katze).<br />
Weiterhin bekannt sind folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
háj!, hajdá! (rum.hai! haida, haide!) = nun! los! nur zu! dran!, veljeu!/(rum. valeu) /jaj! = ach!o weh!<br />
Nicht mehr bekannt ist der ungarische Ausruf lám! = sehen wir nach! lass mich nur sehen!<br />
10.7.2. Onomatopoetische Wörter<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
kirrent = einmal kurren, knurren (von dem Huhn), kirtszeg = knirschen,knistern, knarren (z,B. der Schnee, die<br />
Tür, die Wagenräder, kirtszektet MTsz.kercegtet = knirschen, knistern, knarren lassen, koák/oak!= weinender<br />
Laut eines ganz kleines Kindes, koákkal = weinen, schreien (von ganz kleinen Kindern), kolomponil/ kolompol<br />
= klopfen, pochen (bes. mit dem Hausgerät), kopog,kopogtat = klopfen, anklopfen (die Tür), kottjog/kotyog =<br />
glucken, glucksen (von der Bruthenne), krentszektet = mit den Zähnen knirschen, kappant = klapsen, schnappen<br />
o.schnellen machen (z.B. der Hund mit dem Maule, wenn er die Fliege fangen will), kárrag/károg = krächzen<br />
(v.der Krähe), kurrag = schreien (von Kranich), kutju = Lockwort für die Hunde, lefeg = labbern, schlürfen<br />
(z.B. von dem Hund o. der Katze), máuag =miauen, mekeg = meckern(von der Ziege), morrog = brummen<br />
(vom Bären), nyávag/nyávog = miauen, nyeg = ächzen,stöhnen, nyihag = wiehern (die Stute dem Füllen),<br />
nyikkan = mucken,muchsen, nyivog = winseln (z.B. der kleine Hund), nyörrög = plärren, knaufen, wimmern<br />
(von Kindern), pattag/pattog = knistern, knattern, knallen (z.B.das Feuer o.die Bäume in starker Kälte) pirtszent<br />
= furzen, .puffag/puffog = zornig brummen, pukkan = bersten, platzen, puttjag/puttyog = Blasenwerfer (vom<br />
Wein beim Gären), puttjan/puttyan = ausspritzen (z.B. das Wasser aus dem Gefäss,wenn man etw. hineinwirft),<br />
rotjog/rotyog = stark u. hörbar kochen, paffen, szuppan, le-sz.= mit einem Puff o. Klatsch niederfallen,<br />
szuppant = klatschend schlagen, szuszag = rauschen, sattant = einmal knallen (m.der Peitsche), serreg/csörög =<br />
vor Angst gurren (v.der Vögeln,wenn Sie eine Gefahr wahrnehmen), szt! pszt = pst! bst!, tjá/csá = Aufforderung<br />
an das linke Pferd o. den linken Stier nah rechts zu wenden bes. beim Pflügen., tsziba, tsziba ki! = hinaus mit<br />
dir!fort!weg!husch! (zum Hunde), tjürrent = einmal scharf pfeifen, z.B.mit einer Pfeife, in welche eine Erbse<br />
eingelegt ist, tszitszeg = quicken, quiksen, winseln (die Maus), usztir ki! = hinaus mit dir!(zum Hunde), vákkag<br />
= schnattern (von den Enten), zuppan = plumpsend (z.B.zur Erde) niederstürzen, zurrag = klirren, klappern,<br />
rasseln (z.B. die Nüsse im Sack), zengészsz/zengés = Tönen, Klang.<br />
Nicht mehr bekannt sind die ungarischen Wörter kurrant = einmal schreien und rekeg =<br />
quaken (vom Frosch).<br />
135
10.7.3. Partikel<br />
Die folgenden ungarischen Adverbien, Postpositionen und Konjunktionen sind bekannt:<br />
addig/addjig = bis dahin, akkor = damals,dann, al/al = der untere Teil, alat/alatt = unten,unter, alol/alól,alul =<br />
drunten, alolnat/alulról = von unteren Ende,von Süden, alszo/alsó = der untere, amarra = dorthin, amarrol/<br />
amarról,abból az írányból = davon,von dem, annya/annyi = so viel, arra/arra, arrafeli/arrafelé = auf den dorthin,<br />
arréb/ arrább = weiter dahin, arrol/arról = davon,von dem, arrolnat/ onnan = aus der Richtung, aszta heute:<br />
szásztá (
né/ azonnal = sofort, sogleich,augenblicklich, moszton,m.-tól m.-ig/mostantól mostanig = von jetzt bis jetzt,<br />
mult, e m.hiétbe, m.esztendıbe/múlt héten,tavaly = vergangen,in der Vorwoche,im vorigen Jahre, nélkül = ohne,<br />
nem = nein, nem-de/nemde = ja wohl, aber...,aber doch, niis/nincs = es gibt nicht, niisenek/nincsenek = es sind<br />
nicht,es gibt nicht, omonnot/onnan = dorther, omot/amott = da,sieh da, onnot/onnét = dorther gekommen, ot/ott<br />
= da,dort, pillantó/egy pillanat = Augenblick,Moment, sak/csak = nur,bloss,allein, sep/ csepp, kevés = wenig,<br />
suppa/csupa = ausschliesslich,nur,bloss, szahólnat/sehonnan = von nirgendsher, szahólt/sehol = nirgends,auf<br />
keinem Orte, szaouo/ sehova = nirgendshin, sze, sz.z.utá/ezután = und,und dann,und darauf, sze, sze nem...sze<br />
nem/se, se nem...se nem = weder...noch, szembe = entgegen,gegenüber, sziis,szis/sincs = ist auch nicht, szoho/<br />
soha = nie,niemals, szok/sok = viel,manch,oft, szokáig/sokáig =lang,bislang, szokára,nem sz./ sokára,<br />
nemsokára =in kurzem,in kurzer Zeit, tái:mise táiba? abba táiba/ mikor?,milyen idıben = um welche Zeit? um<br />
jene Zeit, zu dieser Zeit, tólszó/túlsó = jenseitig, touáb,toáb,toháb/tovább = weiter dahin,ferner, touábbat: i t./<br />
késıbb =später, touo,too/tova = dahin,dorthin, töptször/többször = öfter, túl = drüben,jenseits, túl-felül = jenseits,auf<br />
der andere Seite, túl-felülnet/túlról = von jenseits her,von der anderen Seite her, udj/úgy = so,<br />
dermassen, udj-isz/úgyis = ohnehin,dennoch,gleichwohl, uiból/újból = neu, aufs neue, az-utá,az-uta/azután =<br />
darauf, ez-utá,ze-uta/ezután =hierauf,hiernach;nunmehr, ullan/olyan = solcher,dergleichen, umullan/amolyan =<br />
solcher,eben solcher, utánn-,utá,uta/után,utánnam = nach,nach mir, utullán/utolján = zuletzt,schliesslich,<br />
utulláni/utolsó = der letzte, üdeiny,ez-ü./idején = beizeiten,zu gelegener Zeit, vai/vagy = oder,ungefähr, vaidjettszer/<br />
”vajegyszer” = irgendeinmal, valahány = einige,etliche, valahólt/valahol = irgendwo,wo immer, valahonnot/<br />
valahonnan = irgendwoher, vala-hadj (o.vala-hodj)/valahogy = irgendwie, valahou/valahova = irgendwohin,<br />
valameddig = bis irgendwohin,eine Zeitlang, valósz: valószszan/valóban = in der Tat, váratlany/váratlan<br />
= unvermutet,unerwartet, végig = bis zu Ende.<br />
Weiterhin bekannt sind auch folgende Entlehnungen aus dem Rumänischen:<br />
da (rum. da ) = igen , dji-fiel (rum.de fel,în nici)/semmi esetre sem = auf keine Weise, um keinen Preis, djiszto<br />
(rum.destul)/egészen = gänzlich,ganz und gar, pozji (rum.poate)/lehet = vielleicht,möglicherweise, párika<br />
(rum.parcă)/mintha = viellecht,etwa.<br />
Nicht mehr bekannt sind die ungarischen Wörter:<br />
héi,héija/...hiján(hiányzik = es fehlt, midı/midın = zur Zeit als, minap = neulich,unlängst, persze/persze =<br />
natürlich, freilich (das Wort soll erst vor einigen Jahren eingeführt sein und wird nur von einigen Leuten<br />
angewandt), szüküdılte/régóta = seit langem, talám,tám/talán,tán = vielleicht, möglicherweise.<br />
Das Lexem persze/persze = natürlich, freilich wurde – wie Yrjö Wichmann bemerkt, erst<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts in den Szabófalver Sprachgebrauch eingeführt. Schon zu<br />
Wichmanns Zeiten konnte sich dieses Wort nicht so recht einbürgern; es wurde nur von<br />
einigen Leuten verwendet und konnte somit schon damals als Modewort mit äußerst<br />
kurzlebigem „Eintagsfliegenstatus“ betrachtet werden.<br />
Im folgenden Synonymenpaar sind beide Elemente unterschiedlicher Herkunft erhalten<br />
geblieben, obwohl zwischen ihnen kaum eine Bedeutungsdifferenzierung vorliegt:<br />
lehet = es ist möglich → bekannt<br />
pozji (rum.poate)/lehet = vielleicht,möglicherweise → bekannt<br />
137
10.7.4. Pronomina<br />
Die folgenden ungarischen Wörter sind bekannt:<br />
ahaz/ahhoz = dazu,zu dem(der), amaz = jener, az = jener, emez = dieser, ez = dieser fiélé,fiéle,mi-f.?/ miféle? =<br />
was für ein?, ha-hodj?/hát hogy? = wie denn? hán?/hány? = Wieviel?, hánnál vadja ez óra?/hány az óra? =<br />
wieviel Uhr ist es?, hánan vannak?/hányan vannak? = wieviele sind ihrer? hántszar?/hányszor? = wie oft?<br />
hát,hát hodj sánnám?ha-hodj hát?/hát hogy csináljam?hogyan? = also,denn,wie soll ich es denn machen? Wie<br />
denn also? ho,hóa?/hová? = wohin? hóa-waló?/hovavaló? = von wo?, hodj?/ hogy? = wie? auf welche<br />
weise?, hól?/hol? = wo?, honnot?/honnan?/von wo?, irántam = mir gegenüber, ki? = wer? kihé?/kié? =<br />
wessen?wem gehört...?, kisida?/kocsoda? = wer?, kiszki/ki-ki = ein jeder, jedermann, mász/más = der andere,<br />
valaki = jemand, valami = etwas,irgendetwas, menye?/mennyi? = wieviel? menyem?/mennyi? = wieviele?<br />
menyere?menyére?/mennyire? = wie hoch?,wieviel?, merrülnet?/honnan? = woher?, mi?mi az?minek?<br />
mihénk/miénk = unser, mire?mit? = was?was ist das?wozu?warum?worauf?wozu?, mikar?/mikor? = wann?,<br />
millen?/milyen? = was für ein...?, millendji?/milyen?,hogy? = wie?, mi-siéli?/miféle?milyen? = was für ein?,<br />
misida?/micsoda?mi? = was?, mük heute: nük/mi = wir, nállam.../nálam = bei mir..., nállunk/nálunk = in<br />
unserer Gegend, ı = er,sie,es, nekem = für mich, öwé/övé = sein,ihr,der seinige, riám,riua/rám = auf mich, -<br />
rióll/-ról = von mir..., rua,riha/reá = an,auf,drüber,dran,drauf, ritt-,rajt-/rajtam = über,auf,drüber,dran,drauf,<br />
der deinige,derjenige, maga,magát = selbst, szenki/senki = niemand, szenkié/senké = niemandes, tihéd/tied =<br />
dein, tihétek/tietek = euer,der eurige, többi = die übrigen, tük (tükteket)/ti,titeket = ihr, szeszta? ( < sz.az utá és<br />
az után)/s aztán? = und dann?,und was weiter?, valla?/vajon? = ob?ob wohl? ob denn? viadj-edj / ”vajegy”,<br />
valaki = jemand (unter zweien o.mehreren bestimmten Personen), irgendeiner,einer(von ihnen).<br />
Nicht mehr bekannt sind folgende ungarische Wörter:<br />
mez? mez iránt?mez iránt e várasz?/melyik?melyik írányban (van a város)? = in welcher Richtung? In welcher<br />
Richtung liegt die Stadt?, mük-fiélé/”mifélénk”,olyanok mint mi = unsereiner,so wie wir, némel/némely =<br />
mancher,einige.<br />
10.8. Zusammenfassung:<br />
- die zum obigen Themenbereich gehörenden 3866 Wörter machen 64,36 % des Gesamtwortschatzes<br />
(6007 Wörter) aus.<br />
- 471 der 3866 Wörter sind nicht mehr bekannt, was einen Verlust von 12,18 % bedeutet.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden:<br />
1.) die aus zwei oder mehr Elementen bestehenden Synonymenpaare mit bzw. ohne<br />
vorliegender Bedeutungsdifferenzierung:<br />
aiak/ajak = Lippe - budza (rum. buză)/ajak = Lippe<br />
aszál-üdö/aszály = Dürre - sziésita (rum.secetă)/aszály = Trockenheit<br />
délez/ebédel,ebéd után pihen = zu Mittag essen,Mittagsruhe halten - déli-ebéd = Mittagsmahl - eszik = essen - ételezik/étkezik - ebéd =<br />
Mahlzeit (im allg.) - ewész( sze iwász)/evés (és ivás) = Essen(und Trinken) - fodjoszt,el-f./fogyaszt,elf. = verzehren,verbrauchen -<br />
fol,bé-f./fal,befal = einen Bissen abbeisen - folodoz/ fal = bissenweise essen - ösztöli ebéd = Abendmahl - regveli,r.ebéd =<br />
morgendlich,Frühstück<br />
fut = laufen,rennen - nyargal = hin u.her laufen,rennen -szalad = laufen - rohon,bé-r. = hineinstürzen,hineinrennen - dábbag =<br />
langsam u. mühsam wandern - dib-dábbag/sántít = hinkend und schwankend gehen - jár = gehen - járász/járás = gehen - libitzkel/<br />
sántít = hinken,hinkend gehen - mehet = er kann gehen - menen/megy = gehen<br />
138
alaszik/alszik = schlafen - alazgatik/szendít = schlummern -<br />
hál/hál,alszik = übernachten,irgendwo schlafen - szenderedik/szendereg = schlummern<br />
dob,el-d./őt = schlagen,hauen - dolgoz,meg-d./”megdolgoz”,megver = bearbeiten,prügeln - hep/üt = stark zuschlagen,hauen(m.der<br />
Fuss,dem Stock) - hersent/odaüt = zuschlagen - koponil/ bottal összetörni valamit,rombolni = m.einem Stock klopfend schlagen,<br />
anklopfen,so dass der geschlagene Gegenstand beschädigt wird - kulakal/kujakol = mit der Faust durchprügeln - lippent/(hirtelen<br />
pofon csap valakit) = unerwartet eine Ohrfeige geben - szuit/sújt = m.einer biegsame Rute schwippen o.schlagen - sap/csap(pofon<br />
csap) = Ohrfeige,Maulschelle- sap,el-s.,ki-s.,mek-s./üt,ver = fortjagen,hauen,schlagen - tenerel/tenyerel,pofoz = ohrfeigen<br />
- tszirmal,el-t. MTsz. elcirmol/megver valakit = prügeln - tszirmalász = Prügeln,Prügel – üt = schlagen,hauen - vág = schneiden,<br />
hauen,hacken – ver = schlagen,prügeln - veréssz/verés = Prügel<br />
abaiag/abajog = sich über etw.beklagen - panaszkodik = klagen,sich beklagen -velegat/siránkozik = wehklagen,jammern<br />
duppal = pfropfen,zustopfen(m.einem Holzpfropf) - djug,bé-d./bedug = verstopfen, zustopfen<br />
lehet = es ist möglich - pozji (rum.poate)/lehet = vielleicht,möglicherweise<br />
2.) das Phänomen des Lautwandels:<br />
szemüöldök,szüm-öldek/szemöldök = Augenbraue heute: → szumultükk<br />
djauit / javít,meg-dj./gyógyít = heilen,gesund machen heute: → dzsulit<br />
djavithatatlan /javíthatatlan, gyógyíthatatlan = unheilbar heute: → dzsulithatatlan<br />
djauul,djaul/javul, meg-dj./megjavul = genesen,gesund werden heute: → dzsull<br />
arányit/ irányít = in einer Richtung u.in gerader Linie ordnen heute: → íránit<br />
szeewed /szenved = leiden,ertragen heute: → szenved<br />
taplál /táplál = unterstützen,helfen,jmd.beistehen heute: → táplál<br />
kákkul,mek-k./elbóbiskol(ember),csipked (csırével a tyúk)= heute: → sakkul<br />
m.dem Kopfe nicken (vor Schläfrigkeit),<br />
m.dem Schnabel picken(v.der Henne)<br />
olvoszt/olvas,számol = lesen, zählen heute: → oloszt<br />
dóppal = pfropfen, zustopfen (m.einem Holzpfropf) heute: → duppal<br />
miat/ miatt = wegen heute → miánt<br />
mük / mi = wir heute: → nük<br />
3.) Neue Wortsammlung:<br />
- auch heute noch gebräuchliche Wörter, die aber im Wörterbuch Wichmanns nicht<br />
verbucht sind:<br />
buszult = traurig<br />
kuss = husch hinaus! husch hinein! [die Schweine]<br />
(gemäß Mihály Perka, 2006)<br />
hízott = dick<br />
(gemäß Margit Perka, 2006)<br />
- heute sind andere Wörter gebräuchlich, die beginnen, die Wörter der Kategorie r/a<br />
aus dem Sprachgebrauch zu verdrängen:<br />
prieten)<br />
bucurie).<br />
anstatt barált = Freund heute eher: → précsin ( < rum.<br />
anstatt öröm = Freude heute eher: → bukurje ( < rum.<br />
anstatt keheg,kehegéssz /köhög,köhögés = Husten heute eher: → hurrut<br />
anstatt illatósz/illatos = wohlriechend, duftig (z.B. der Wein) heute eher: → szépbőző,<br />
139
Besonderheiten anderer Art:<br />
- Erhalt solcher Wörter, die in der ungarischen Standardsprache nicht mehr bekannt sind:<br />
horpots /„horpasz” = die Weichen (sowohl am Menschen als am Tierkörper) mái - fekete mái/máj = Leber, fejjér mái/tüdı = Lunge,<br />
mizga MTsz mozga/sperma = Sperma, Samen, mony/mony = Hode (auch:Ei), tompor/csipı = Hüftbein, iha/szomjas = durstig,<br />
ihazik/szomjazik = dürsten,dursten, ezdjik/esd,kérlel = sich sehnen, begierig sein,verlangen, libitzkel/sántít = hinken,hinkend gehen, djak/<br />
gyak = immerfort etw.wiederholt sagen, zu wiederholten Malen von etw. reden.<br />
- der Prozess des Verschwindens der Wörter des obigen Themenbereiches wurde<br />
nachverfolgt:<br />
Wichmann-<br />
Wörterbuch<br />
(1906-1907)<br />
Atlas<br />
(1949-<br />
1952)<br />
Aktualisierung<br />
(2005– 2006)<br />
aiak/ajak = Lippe + + 0 ████▓▓<br />
Grafische Darstellung des<br />
Prozesses<br />
orbántsz /orbánc =<br />
Rotlauf<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
barált = Freund + kein Beleg<br />
vorhanden<br />
öröm = Freude + kein Beleg<br />
keheg,kehegéssz/<br />
köhög,köhögés =<br />
Husten<br />
köwiér/kövér =<br />
fett,dick,beleibt<br />
illatósz/illatos =<br />
wohlriechend, duftig<br />
(z.B. der Wein)<br />
szumuru /szomorú =<br />
traurig,gramvoll,trüb<br />
vorhanden<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
+ kein Beleg<br />
vorhanden<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
0 ██∼▓▓<br />
Legende:<br />
██<br />
▓▓<br />
: die Bedeutung des Wortes<br />
ist bekannt: +<br />
: das Wort wird noch<br />
erkannt, (r/a): 0<br />
∼ : kein Beleg vorhanden<br />
▒▒<br />
: die Bedeutung des Wortes ist<br />
nicht mehr bekannt: -<br />
░░ : selten gebrauchtes Wort: s<br />
140
11. Ergebnis der Untersuchung in Zahlen ausgedrückt<br />
Themenbereiche Wörter Bekannt Unbekannt Verlust<br />
Pflanzen-und Pflanzenanbau 372 316 56 15,05%<br />
Tiere und Viehzucht 255 221 34 13,33%<br />
Haus- und Hausgewerbe 573 481 92 16,06%<br />
Kulturgeschichte<br />
301 264 37 12,29%<br />
(ReligiöserWortschatz, Gebräuche, Tänze,<br />
Ernährung)<br />
Kleidung,<br />
Berufsbezeichnungen 136 116 20 14,71%<br />
Verwandtschaftsterminologie 84 75 9 10,71%<br />
Namengebung 245 230 15 6,12%<br />
Handel,Geldsorten,Administration 175 160 15 8,57%<br />
GRUNDWORTSCHATZ<br />
1.) Körperteile (Mensch und Tier) 84 82 2 2,38%<br />
2.) Krankheiten (Mensch und Tier) 71 68 3 4,23%<br />
3.) Geographische Einheiten 30 24 6 20,00%<br />
4.) Wetter 45 43 2 4,44%<br />
5.) Himmelsrichtungen,Himmelskörper,<br />
Jahreszeiten,Monatsbezeichnungen,<br />
Wochentage,Tageszeiten<br />
52 48 4 7,69%<br />
6.) Numeralien und geometrische Bez. 67 67 - 0,00%<br />
7.) Farbbezeichnungen 12 12 - 0,00%<br />
8.) Kindersprache 13 8 5 38,46%<br />
9.) Alltagswortschatz 3035 2602 433 14,30%<br />
10.) Interjektionen 12 11 1 8,33%<br />
11.) Onomatopoetische Wörter 47 45 2 4,26%<br />
12.) Partikel (Adverbien,Postpositionen,<br />
Konjunktionen)<br />
341 331 10 2,93%<br />
13.) Pronomina 57 54 3 5,26%<br />
Insgesamt 6007 5258 749 12,48%<br />
12. Sprichwörter, Phrasen; Rätsel<br />
Während seines beinah halbjährigen Aufenthaltes in Szabófalva (1906-1907) hat sich Yrjö<br />
Wichmann auch mit der Sammlung der hiesigen Sprichwörter, Phrasen und Rätsel<br />
beschäftigt. Uns interessiert nun im Folgenden, welche der sich im Anhang des Wichmann-<br />
Wörterbuches befindlichen 5 Rätsel und 179 Sprichwörter, auch heute noch – 100 Jahre<br />
später – bekannt sind. Unser Sprachmeister – Mihály Perka, der sich selbst mit der Sammlung<br />
von Sprichwörtern beschäftigt und u.a. die von Wichmann gesammelten Redewendungen ins<br />
Rumänische übersetzt hat, war uns auch hierbei eine große Hilfe.<br />
Die folgende „Aktualisierung” der Szabófalver Rätsel und Sprichwörter erfolgt nach der<br />
Originalnummerierung von Yrjö Wichmann.<br />
141
Nach den Informationen unseres Sprachmeisters Mihály Perka sind sämtliche Rätsel rumänischer<br />
Herkunft; Rätsel Nr. 3 ist nicht mehr bekannt.<br />
Innerhalb der Sprichwörtersammlung treffen wir auf 12 Redewendungen, die rumänische<br />
Lehnwörter mitbeinhalten. 6 dieser Sprichwörter mit „eingekeilten” Entlehnungen aus dem<br />
Rumänischen sind mittlerweile nicht mehr bekannt. Diese Verhältnisse (50% bekannt, 50%<br />
unbekannt) machen deutlich, dass sich die rumänischen Entlehnungen nicht auf den Erhalt der<br />
Sprichwörter auswirken.<br />
In der folgenden Auflistung werden die Ziffern der „Sprichwörter mit rumänischen Lehnwörtern“<br />
durch Fett- und Kursivdruck markiert.<br />
Nicht mehr bekannt sind die folgenden 92 Sprichwörter mit den Nummerierungen:<br />
6,9,10,11,17,18,19,21,22,26,29,31,33,34,35,36,37,39,40,42,43,46,47,48,50,53,57,58,59,60,62,<br />
63,66,68,69,70,71,74,75,76,77,83,84,85,91,92,94,96,97,99,100,101,104,105,106,109,115,116,<br />
119,121,125,128,129,130,132,133,135,136,138,140,141,142,143,145,146,147,149,150,153,<br />
155,157,159,164,167,168,169,171,172,173,174,177 – der Verlust beträgt somit 51,4 %.<br />
48,6 % (87) der Sprichwörter sind noch bekannt.<br />
Innerhalb der bekannten Sprichwörter lassen sich zwei Kategorien unterscheiden:<br />
Sprichwörter, die nur im Szabófalver Tschango-Dialekt bekannt (34) sowie Sprichwörter, die<br />
sowohl im Tschango-Dialekt als auch bei den benachbarten Rumänen bekannt sind (53).<br />
Folgende Sprichwörter sind nur im Tschango-Dialekt bekannt:<br />
14,16,20,23,25,27,28,32,44,51,52,64,72,73,88,89,103,110,120,124,127,131,137,144,151,152,<br />
158,161,162,165,175,176,178,179.<br />
Folgende Sprichwörter sind sowohl im Tschango-Dialekt als auch im Rumänischen<br />
bekannt:<br />
2,3,4,5,7,8,12,13,15,24,30,38,41,45,49,54,55,56,61,65,67,78,79,80,81,82,86,87,90,93,95,98,<br />
102,107,108,111,112,113,114,117,118,122,123,126,134,139,148,154,156,160,163,166,170.<br />
142
V. Sprachlicher Einfluss des Rumänischen anhand der Kontaktphänomene<br />
der im Dokumentarroman Gazdas verschriftlichten Äußerungen zwei-<br />
sprachiger Moldauer Tschangos<br />
1. Methodik/Terminologische Fragen<br />
Zielsetzungen dieses Kapitels:<br />
1.) Untersuchung der freien, ungebundenen Rede der zweisprachigen (Rumänisch und<br />
Tschango-Ungarisch) Moldauer Ungarn<br />
2.) Untersuchung des sprachlichen Einflusses der zur indogermanischen Sprachfamilie<br />
gehörenden rumänischen Sprache auf den Moldauer Tschango-Dialekt, den archaischsten<br />
Dialekt der zur finnougrischen Sprachfamilie gehörenden ungarischen Sprache anhand der<br />
folgenden Kontaktphänomene:<br />
a.) direkte bzw. mittelbare Entlehnungen<br />
b.) indirekte bzw. unmittelbare Entlehnungen<br />
c.) Kodewechsel<br />
3.) Untersuchung der Stärke bzw. des Stärkegrades der rumänischen Sprache in den<br />
drei Tschango-Dialektgruppen einschließlich der Darstellung von eventuellen Unterschieden<br />
mitsamt einer Herausarbeitung der Gründe für diese Unterschiede<br />
Zur Erreichung der oben festgelegten Ziele werden wir anhand des sprachlichen Materials des<br />
Dokumentarromans von József Gazda (1993) – einer Chronik der Erinnerungen von über 100<br />
Moldauer Ungarn – den sprachlichen Einfluss des Rumänischen in den Äußerungen zweisprachiger<br />
Moldauer Tschangos untersuchen, wobei wir unseres besonderes Augenmerk auf die<br />
Kontaktphänomene der 1. direkten bzw. mittelbaren Entlehnungen, der 2. indirekten bzw.<br />
unmittelbaren Entlehnungen und schließlich 3. des Kodewechsels legen werden.<br />
Innerhalb der direkten, d.h. lexikalischen Entlehnungen wird neben den „eigentlichen” Lehnwörtern<br />
gesondert auf die Rückentlehnungen, Internationalismen und Dubletten/Wortpaare<br />
eingegangen, um die Stärke des rumänischsprachigen Einflusses zu relativieren.<br />
Innerhalb der indirekten, d.h. semantischen Entlehnungen werden jeweils die<br />
Lehnbedeutungen und Lehnbildungen, die sich wiederum in Lehnübersetzungen und<br />
Lehnverbindungen manifestieren, untersucht.<br />
143
Methodik:<br />
Planung des zur Analyse der Kontaktphänomene notwendigen Arbeitsmaterials,<br />
Zusammenstellung des Gazda-Textkorpus:<br />
a.) Fotokopie des Gazda-Dokumentarromans, um so die zur Untersuchung der<br />
Kontaktphänomene notwendigen Arbeitsblätter, die nach Informanten geordnet werden,<br />
zusammenstellen zu können<br />
b.) Aus dem auf diese Weise gebildeten Textkorpus wurden – zur Untersuchung der<br />
freien, ungebundenen Rede der Moldauer Tschangos – diejenigen Äußerungen ausgelassen,<br />
die zum einem den Tschangos aus der Dobrudscha (insges. 4534 Wörter) zuzurechnen sind,<br />
zum anderen sakrale Texte wie Gebete bzw. Volksdichtung wie Balladen beinhalten<br />
Durch das so gewonnene Sprachmaterial kann ein unverfälschtes Bild von der wirklichen<br />
Stärke des rumänischen Einflusses zustande kommen, da – wie z.B. auch die Untersuchungen<br />
Mártons (1972) zum Lehnwortschatz der Moldauer Ungarn zeigen – in der durch Silbenanzahl,<br />
Rhythmus, Reime und Melodie gebundenen Volksdichtung weitaus weniger Lehnwörter<br />
vorkommen als in den prosaischen Gattungen (Anekdoten) und der alltäglichen<br />
Kommunikation. Des Weiteren hat die Volkslyrik solche ungarischen Wörter wie z.B. die<br />
Monatsnamen bewahrt, an deren Stelle in der gesprochenen, ungebundenen Sprache des<br />
alltäglichen Lebens ausschließlich die rumänischen Lehnwörter gebraucht werden.<br />
Originalauszug aus dem<br />
Dokumentarroman Gazdas:<br />
144
Beispiel eines Arbeitsblattes zur Ermittlung der Kontaktphänomene:<br />
145
Begründung für die Verwendung des Dokumentarromans „Hát én hogyne síratnam”<br />
(1993) von József Gazda als sprachliche Quelle:<br />
1.) In der Einleitung meiner Arbeit wurden die Belege für die Authentizität der Arbeit Gazdas<br />
bereits aufgeführt<br />
2.) Anhand des Gazda-Dokumentarromans konnte ich ein besonders umfangreiches, 100.122<br />
Wörter umfassendes Sprachkorpus zusammenstellen, das alle drei Dialektgruppen der<br />
Moldauer Ungarn – d.h. die nördlichen, südlichen und Székler Tschangos erfasst<br />
3.) Viele Ethnographen und Sprachwissenschaftler, die die Lebens- und Sprachwelt der<br />
Tschangos vor Ort erforschen wollen, verweisen immer wieder auf die Hindernisse, die ihnen<br />
seitens der Behörden – sowohl formell als auch informell – in den Weg gelegt werden.<br />
Berücksichtigt man diese äußerst ungünstigen Forschungsumstände im Moldau-Gebiet (siehe<br />
Sándor Klára 1996: 60-61; 72, 2005: 163), können solche Quellen wie der Dokumentarroman<br />
Gazdas nicht außer Acht gelassen werden<br />
4.) Die obigen Umstände behindern nicht nur die Materialsammlung, sondern verhindern auch<br />
eine teilnehmende Beobachtung – d.h. „die geplante Wahrnehmung des Verhaltens von<br />
Personen in ihrer natürlichen Umgebung durch einen Beobachter, der an der Interaktion<br />
teilnimmt und von den anderen Personen als Teil ihres Handlungsfeldes angesehen wird”<br />
(Friedrichs 1982: 288, zitiert in: Bechert/Wildgen 1991: 42).<br />
5.) Durch den Dokumentarroman Gazdas kann der Einfluss der rumänischen Sprache auf die<br />
freie, ungebundene Rede der Tschangos, über die kaum Untersuchungen vorliegen, analysiert<br />
werden.<br />
Über die Verteilung der Lehnwörter gibt es zwar zwei Untersuchungen (Márton 1972,<br />
Márton/ Péntek/Vöı 1977), deren Sprachmaterial aber – aufgrund des oben erwähnten<br />
Quellenmangels – nicht die authentische Sprache der Moldauer Ungarn widerspiegelt.<br />
a.) Márton/Péntek/Vöı (1977) untersuchten anhand des Sprachatlasses der ungarischen<br />
Mundarten Rumäniens, in welchem Prozentsatz die rumänischen Lehnwörter in diesen<br />
ungarischen Dialekten vorhanden sind und kamen dabei zu folgendem Ergebnis:<br />
„Der höchste Prozentsatz der rumänischen Lehnwörter befindet sich in den Moldauer Csángó-<br />
Mundarten: Székler-Csángó 400 Wörter (13,33%), Süd-Csángó 500 (16,66%), Nord-Csángó<br />
500 (16,66%).” (Márton/Péntek/Vöı 1977: 26)<br />
Wie auch Bodó/Eriş (2004: 82-83) bemerken, lassen sich aus den Daten der Sprachatlanten<br />
generell keine direkten Rückschlüsse auf die Gebrauchshäufigkeit der rumänischen Lehn-<br />
146
wörter ziehen, da es vorkommen kann, dass in diese einerseits auch solche Elemente aufgenommen<br />
werden, die die Sprecher nur vereinzelt gebrauchen, Lexeme mit hoher Gebrauchsfrequenz<br />
jedoch ausgelassen werden.<br />
b.) Das von Márton (1972: 36-38) untersuchte Korpus, das aus den von Hegedős (1952) und<br />
Faragó (1954) gesammelten – Volksmärchen, Anekdoten und Gesprächen über Glaubensvorstellungen<br />
und Volksbräuchen besteht, ist zur Repräsentanz der freien Rede eher geeignet.<br />
Aus ihm lassen sich aber – wie Márton übrigens selbst betont – keine Rückschlüsse auf das<br />
tatsächliche Sprachverhalten der Ungarn in der Moldau ziehen, da z.B. der Großteil der<br />
damaligen Informanten des Székler-Tschangodialekts schon seit Jahren ihre Sprachgemeinschaft<br />
verlassen hat, um sich in Ungarn niederzulassen.<br />
Da die 116 Informanten von József Gazda alle drei Dialektgruppen der Moldauer Ungarn<br />
vertreten, kann der tschango-ungarische Sprachzustand der gesamten Moldauer Region erfasst<br />
werden.<br />
Ortnamen:Ungarisch / Rumänisch<br />
Bákó<br />
Belcseszku<br />
Bogdánfalva<br />
Bukila<br />
Diószeg<br />
Diószén<br />
Forrófalva<br />
Gorzafalva<br />
Bacău<br />
Nicolae Bălcescu<br />
Valea Seacă<br />
Buchila<br />
Tuta<br />
Gioseni<br />
Faraoani<br />
Oituz<br />
Jugán<br />
Kelgyest<br />
Klézse<br />
Lészped<br />
Lujzikalagor<br />
Magyarfalu<br />
Onyest<br />
Pusztina<br />
Iugani<br />
Pildeşti<br />
Cleja<br />
Lespezi<br />
Luizi-Călugăra<br />
Arini<br />
Oneşti<br />
Pustiana<br />
Románvásár<br />
Somoska<br />
Szabófalva<br />
Szerbek<br />
Traján/Újfalu<br />
Fürészfalva<br />
Nagypatak<br />
Trunk<br />
Roman<br />
Şomuşca<br />
Săbăoani<br />
Floreşti<br />
Traian<br />
Ferestrău-Oituz<br />
Valea Mare<br />
Galbeni<br />
147
Der Soziograph József Gazda ordnet die Äußerungen seiner Informanten – unabhängig vom<br />
Herkunftsort, Geschlecht und Alter – nach thematischen Gesichtspunkten.<br />
Anhand der kodierten Buchstabenverbindungen am jeweiligen Seitenrand lässt sich aber im<br />
Namensverzeichnis des Anhanges zurückverfolgen, welcher konkreten Person und welchem<br />
Siedlungsgebiet der Beleg zuzuordnen ist.<br />
In der Forschungsliteratur über die Moldauer Ungarn erschwert ein uneinheitlicher Gebrauch<br />
der Ortsnamen die Lokalisierung der Tschango-Siedlungen. Der erste Vorschlag einer Kodifikation<br />
der Ortsnamen findet sich in Péntek (2004: 191-194), die auch in der hier vorliegenden<br />
Arbeit übernommen wird. Anhand der oben erwähnten Informanten-Kodierung Gazdas hat<br />
die Verfasserin dieser Arbeit, A.K. die einzelnen Äußerungen – nach Herkunftsdörfern und<br />
Siedlungsgebieten getrennt – zu einem geschlossenen Textkorpus zusammengestellt. Die<br />
Zuordnung der Dörfer zu den einzelnen Dialektgruppen richtete sich hierbei nach der<br />
Einteilung von János Péntek (2004: 191-194).<br />
Personen- und Ortsverzeichnis:<br />
I. Nördlicher Tschango-Dialekt:<br />
1.) Gerejest/Gherăeşti<br />
KJX Kelárka Juziné, geb. 1940<br />
2.) Jugán/Iugani<br />
GyAM Gyerkó Nyicáné Antaluc Marika, geb. 1913<br />
3.) Kelgyest/Pildeşti<br />
PoA Poulec Antal, geb. 1908<br />
DiJ Diniske János, geb. 1910<br />
MaGy Marci Györgyi, geb. 1912<br />
BKM Bulájka Györgyiné Kozsokár Mária, geb. 1913<br />
BuP Buláj Péter, geb. 1919<br />
MP Marczi Péter, geb. 1919<br />
DeA Deák Antal, geb. 1921<br />
DDR Deák Antiné Dinka Róza, geb. 1924<br />
KJ Kelárka Juzi, geb. 1932<br />
KÁX Kelár Ludovikné Ágota, geb. 1933<br />
DKM Dömök Juziné Kelár Mária, geb. 1934<br />
4.) Szabófalva/Săbăoani<br />
GM Gáll Mihály, geb. 1900<br />
SzP Szaszkó Péter, geb. 1918<br />
BM Burka Mihály, geb. 1930<br />
BVV Burka Mihályné Varga Veroni, geb. 1932<br />
5.) Traján (Újfalu)/Traian<br />
DGy Duma Gyuri, geb. 1907<br />
PBR Perkı Józsiné Buzojánosz Rusz, geb. 1907<br />
DGyX Duma Györgyné, geb. 1916<br />
148
II. Südlicher Tschango-Dialekt:<br />
1.) Belcseszku (Újfalu)/Nicolae Bălcescu<br />
BNM Buláj Jánosné Nagy Mari, geb. 1923<br />
2.) Bogdánfalva/Valea Seacă<br />
DJ Duma János, geb. 1911<br />
3.) Bukila<br />
TI Tankó Illyés, geb. 1905<br />
TG Tankó Gergely, geb. 1912<br />
TM Tankó Márton, geb. 1925<br />
TTV Tankó Mártonné Tankó Veroni, geb. 1929<br />
CsTA Csurár Péterné Tankó Anna, geb. 1960<br />
4.) Diószén/Gioseni<br />
RI Róka István, geb. 1903<br />
BBM Budau (Budó) Mária, geb. 1921<br />
5.) Nagypatak/Valea Mare<br />
PJ Porondi János, geb. 1892<br />
AA Antal Antal, geb. 1901<br />
ZsG Zsitár Gergely, geb. 1903<br />
FJ Farczádi János, geb. 1904<br />
KoÁ Kotyorka Ádám, geb. 1910<br />
KA Kósa Antal, geb. 1912<br />
PA Porondi Antal, geb. 1915<br />
CsBM Csurár Antiné Barbócz Madi, geb. 1919<br />
BLX Barbócz Luca, geb. 1929<br />
nax Nagypataker Frau, geb. 1940<br />
CsP Csurár Péter, geb. 1954<br />
IcsT Istvánkéná Csurár Teréz, geb. 1957<br />
fnn junge Frau, geb. 1966<br />
IVX Istvánka Virdzsinika, geb. 1979<br />
6.) Trunk/Galbeni<br />
BuM Budó Mihály, geb. 1910<br />
KFB Kósa Antiné Faraoán Bori, geb. 1921<br />
III. Székler Tschango-Dialekt:<br />
Dörfer entlang des Szeret:<br />
1.) Bergyila/Berdilă<br />
RBM Rotár Péterné Butnár Marika, geb. 1933<br />
SBK Simon Jánosné Butnár Kati, geb. 1938<br />
2.) Forrófalva/Faraoani<br />
BMX Bálint Mártonné, geb. 1908<br />
GyJ Gyurka János, geb. 1925<br />
FCsV Farczádi Mártonné Csicsó Virona, geb. 1953<br />
3.) Ketris/Chetriş<br />
SII Simonné Iker Ilona, geb. 1913<br />
GIK Gáspár Eugénné Iván Kati, geb. 1923<br />
BSM Bukurné Simon Marika, geb. 1925<br />
4.) Klézse/Cleja<br />
BeM Bencze Mihály, geb. 1904<br />
LA László Antal, geb. 1905<br />
HM Harangozó Márton, geb. 1910<br />
HHL Harangozó Mártonné Hadarók Luca, geb. 1910<br />
TBM Tamásné Buláj Magdó, geb. 1910<br />
BD Botezát Dávid, geb. 1914<br />
BPR Bartos Mihályné Petrás Ruzsa, geb. 1914<br />
KG Kotvor Gergely, geb. 1918<br />
DÁ Demse Ádám, geb. 1919<br />
LHL Lırincz Györgyné Hadaróg Luca, geb. 1920<br />
IHB Istók Mártonné Hobori Bori, geb. 1925<br />
DBK Demse Ádámné Benke Karolina, geb. 1928<br />
IM Istók Márton, geb. 1930<br />
SzVE Szálkáné Vastag Erzse, geb. 1930<br />
TaJ Tamás János, geb. 1941<br />
IGy Istók György, geb. 1948<br />
TDR Tamás Jánosné Demse Rózsa, geb. 1950<br />
5.) Lábnyik/Vladnic<br />
BSz Bákói Szilveszter, geb. 1938<br />
6.) Lészped/Lespezi<br />
SF Simon Ferenc, geb. 1915<br />
MF Miska Ferenc, geb. 1918<br />
SFA Simon Ferencné Anna, geb. 1918<br />
CsBK Csorba Péterné Bíró Kati, geb. 1930<br />
CsJ Csoma János, geb. 1931<br />
7.) Lujzikalagor/Luizi-Călugăra<br />
KM Kozsokár Mihály, geb. 1901<br />
HP Horváth Péter, geb. 1901<br />
KBN Kozsokár Mihályné Bogdán Nyica, geb. 1903<br />
FP Farczádi Péter, geb. 1908<br />
HPM Horváth Péterné, Mari, geb. 1928<br />
CsPX Csicsó Pityiné, geb. 1932<br />
8.) Magyarfalu/Arini<br />
TGy Tiklos György, geb. 1932<br />
GGy Gusa György, geb. 1934<br />
TGyX Tiklós Györgyné, geb. 1935<br />
9.) Somoska/Şomuşca<br />
IA Istók András, geb. 1911<br />
BA Benke András, geb. 1917<br />
DE Demse Emanuel, geb. 1930<br />
149
Dörfer entlang des Tázló:<br />
1.) Pusztina/Pustiana<br />
EJ Erıss Józsi, geb. 1922<br />
EKK Erıss Józsiné Keszák Katalin, geb. 1925<br />
2.) Szerbek/Floreşti<br />
AM Ambarus Mircea, geb. 1929<br />
AAK Ambarus Mirceáné Ambarus Klára, geb. 1934<br />
Dörfer entlang des Tatros:<br />
3.) Főrészfalva/Ferestrău-Oituz<br />
1.) Diószeg/Tuta<br />
PGy Pistoj György, geb. 1902<br />
MGy Mihály György, geb. 1905<br />
LGy Lukács György, geb. 1906<br />
MA Mihály András, geb. 1930<br />
BGy Bartos György, geb. 1935<br />
2.) Gorzafalva/Oituz<br />
4.) Kománfalva/Comăneşti<br />
RD Román Dénes, geb. 1891<br />
CsGy Csató György, geb. 1902<br />
BKB Bálint Mihályné Kösunean Bori, geb. 1908 FiI Fieraru Ion, geb. 1891<br />
CsAM Csató Györgyné Aszalós Mária, geb. 1908<br />
BGyA Butnáru G. Anika, geb. 1921<br />
BCsM Baróti Péterné Csüdör Mária, geb. 1923<br />
SzSzA Szıcs Györgyné Szarka Anika, geb. 1923<br />
5.)Onyest/Oneşti<br />
EIA Egyed Györgyné Istocsel Anika, geb. 1923 SJ Simon János, geb. 1903<br />
ESzL Egyed Paliné Szıcs Lina, geb. 1929 FS Fakini Sándor, geb. 1908<br />
BP Baróti Péter, geb. 1929 GoGy Gondos György, geb. 1913<br />
SzGy Sztiklár György, geb. 1929 KrJ Krismár János, geb. 1919<br />
BuA Butnár András, geb. 1931<br />
PP Prundoiu Pavel, geb. 1940<br />
SzıP Szıcs Pista, geb. 1946<br />
149
Im Dokumentarroman Gazdas, einer Chronik der Geschichte der Moldauer Tschangos im 20.<br />
Jahrhundert finden sich folgende Themenkreise:<br />
- Heimat/Volk, Kindheit/Jahrhundertanfang (1900/1916)<br />
- Erster Weltkrieg (1916-1918)<br />
- Jugendzeit/Leben zwischen den beiden Weltkriegen (1920-1941)<br />
- Zweiter Weltkrieg (1941-1945)<br />
- Erwachsenenalter/Nachkriegszeit (1945-1960)<br />
- endgültige Zerstörung der alten Lebensform/Kollektivisierung (1961-1962)<br />
- Alter/verschwindende Werte/verschwindende Sprache (1963-1989)<br />
- erwachende Hoffnung/Sturz der Ceauşescu-Diktatur (Dezember 1989-Juli 1990)<br />
- Vergänglichkeit/Tod<br />
Dank dieser Art der Redaktion und Themenwahl entspricht der Dokumentarroman Gazdas methodisch<br />
den Erfordernissen, die an die Erhebungsmethoden des gesteuerten, freien und sprachbiographischen<br />
Interviews gestellt werden. (Riehl 2004: 40-45, Bechert/Wildgen 1991: 38-47)<br />
Nach Riehl (2004: 41) liegt der Vorteil des gesteuerten Interviews, das „aus einer Art Abfragen<br />
eines vorbereiteten Leitfadens” besteht, in der Erzielung einer „möglichst objektiven Vergleichbarkeit<br />
der Sprachdaten”. Diese Vergleichbarkeit ist nun im Material Gazdas durch die oben genannten<br />
Themenbereiche gegeben, auf die die Informanten auch alle mehr oder weniger Bezug<br />
nehmen. József Gazda achtet darauf, dass die verschiedenen Lebensphasen der befragten<br />
Tschangos erfasst werden, womit deren Äußerungen im Grunde genommen auch den<br />
sprachbiographischen Interviews entsprechen (siehe Bechert/Wildgen 1991: 46) .<br />
Die Bedingungen des freien soziolinguistischen Interviews, „das sich frei entwickeln [kann], wodurch<br />
die Sprecher ein möglichst natürliches Gesprächsverhalten zeigen” (Riehl 2004: 41), sind<br />
durch die Themenwahl Gazdas erfüllt. Die Gesprächsmodule der Lebensabschnitte Kindheit,<br />
Jugend, Kollektivisierung, verlorene Werte, verlorene Sprache sowie die der Kriegserlebnisse<br />
eignen sich besonders dazu, eine unverkrampfte, gefühlsbeladene Atmosphäre zu schaffen, so<br />
dass es auch kein Wunder ist, dass sich die Informanten József Gazdas durch den „vernacular<br />
style” im Sinne von William Labov auszeichnen.<br />
Diese Grundsprache bestimmt Sándor (1996: 74) als diejenige „Sprachvariante, die der Sprecher<br />
mit der geringsten Aufmerksamkeit, am automatischsten spricht.”<br />
Gemäß des Begründers der modernen Soziolinguistik, William Labov kann die spontane Rede<br />
auch innerhalb des Interviews hervorgerufen werden. Um das „Paradoxon des Beobachters”, der<br />
– unter künstlich geschaffenen Befragungsbedingungen – authentisches Sprachmaterial gewinnen<br />
möchte, zu umgehen, muss die Aufmerksamkeit des Sprechers vom Umstand abgelenkt werden,<br />
150
dass er gerade beobachtet wird, was durch solche Themen wie Angst oder Todesgefahr erreicht<br />
wird. (Labov 1972: 209-210, zitiert in Anna Borbély 2001: 73)<br />
Gerade die Lebensberichte der Tschangos über ihre Erfahrungen während der beiden Weltkriege<br />
oder ihre existenzielle Bedrohung zur Zeit der Kollektivisierung spiegeln die spontane Rede<br />
wider, so dass sich auch Rückschlüsse auf ihr tatsächliches Sprachverhalten ziehen lassen.<br />
Von Attila Benı (2004a: 23-36) stammt der bisher einzige Aufsatz über die Kontaktphänomene<br />
in den Äußerungen zweisprachiger Moldauer Tschangos, in dem er anhand eines 10.472 Wörter<br />
zählenden Textkorpus aus 48 Interviews den Sprachzustand der Székler Tschangos erfasst.<br />
Unser Gazda-Textkorpus ist demgegenüber wesentlich umfangreicher und bezieht sich zudem<br />
auch auf die weiteren Dialekte der Moldauer Ungarn: es setzt sich aus insges. 100.122 Wörtern<br />
zusammen, wobei das Sprachkorpus des nördlichen Tschango-Dialektes aus 14.563 Wörtern, das<br />
des südlichen aus 30.036 Wörtern sowie schließlich das des Székler Tschango-Dialektes aus<br />
55.523 Wörtern besteht. Hierbei zeigt sich, dass im Gazda-Material die Székler Tschangos<br />
dominieren, deren Äußerungen 55, 46 % des Gesamtkorpus ausmachen. Der südliche Tschango-<br />
Dialekt ist mit 30 % vertreten, der des nördlichen mit 14, 54 %.<br />
Insgesamt wurden 116 Personen befragt, wovon sich 20 Personen (17, 24 %) dem nördlichen,<br />
25 Personen (21, 55 %) dem südlichen und schließlich 71 Personen (61, 21 %) dem Székler<br />
Tschango-Dialekt zuordnen lassen.<br />
Die Verteilung der Informanten nach Geschlechtern:<br />
Männer Frauen<br />
Nord-Tschangos 11 (55 %) 9 (45 %)<br />
Süd-Tschangos 14 (56 %) 11 (44 %)<br />
Székler Tschangos 41 (57,75 %) 30 (42,25 %)<br />
Insgesamt 66 (56,90 %) 50 (43,10 %)<br />
Der Anteil der Männer ist in den jeweiligen Dialekten um einiges größer als der der Frauen; im<br />
Gesamtkorpus Gazdas beträgt er 56, 9%.<br />
Die Verteilung der Informanten nach Generationen:<br />
1. Generation: vor 1930 geboren<br />
2. Generation: zwischen 1930 und 1960 geboren<br />
3. Generation: nach 1960 geboren<br />
151
Nord-Tschangos 1. Generation 2. Generation 3. Generation<br />
Männer 9 2 -<br />
Frauen 5 4 -<br />
Süd-Tschangos 1. Generation 2. Generation 3. Generation<br />
Männer 13 1 -<br />
Frauen 6 3 2<br />
Székler Tschangos 1. Generation 2. Generation 3. Generation<br />
Männer 28 13 -<br />
Frauen 21 9 -<br />
Im Textkorpus Gazdas sind – geschlechterübergreifend - überwiegend Personen aus der 1. Generation<br />
vertreten, die 70, 59 % des Gesamtkorpus ausmachen, wobei der Anteil der älteren Generation<br />
innerhalb der Männer 75, 76 %, der der Frauen 64 % beträgt.<br />
Wie wir oben gesehen haben, sind die Sprachkorpora der einzelnen Tschango-Dialekte von<br />
unterschiedlicher Größe. Um nun die Relevanz der Ergebnisse bei einem Vergleich sicherzustellen,<br />
wurde zusätzlich ein kleineres Gazda-Korpus gebildet, in dem die Nord-, Süd- und<br />
Székler Tschangos in annähernd gleicher Wortzahl vertreten sind. Die Auswertung dieser Kontrollgruppen<br />
– aus jeweils 5 Männern und Frauen bestehend – ergab, dass die Kontaktphänomene<br />
in gleicher bzw. ähnlicher Weise wie im großen Gesamtkorpus Gazdas verteilt waren.<br />
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit beziehen sich die zahlenmäßigen Angaben über die Verteilung<br />
der Kontaktphänomene in den Äußerungen zweisprachiger Moldauer Tschangos auf das große,<br />
oben ausführlich dargestellte Textkorpus. Ausführliche statistische Angaben zum kleinen Sprachkorpus,<br />
das zur Kontrolle herangezogen wurde, finden sich im Anhang dieser Arbeit.<br />
Hier sind weiterhin auch die Statistiken angeführt, die zeigen, dass sich bei der Verteilung der<br />
Kontaktphänome keine geschlechts- bzw. generationenbedingte Unterschiede ergaben.<br />
Lehngut- und Kodewechseltypolgie<br />
Unsere Lehnguttypologie erfolgt nach Benı (2004a: 24-26; eigentliches Lehnwort) und Lanstyák<br />
(2006: 15-56; direkte Entlehnung, Lautformentlehnung, indirekte Entlehnung).<br />
Die Kodewechseltypologie erfolgt nach Benı (2004a: 24; kontextueller und situativer Kodewechsel)<br />
und Lanstyák (2006: 105-146; Einteilung der Kodewechsel nach ihrem Integrationsgrad in<br />
„B-Typ”-, „N-Typ”- und „G-Typ”-Kodewechsel).<br />
152
István Lanstyák (2006) hat in seiner jüngst erschienenen Aufsatzsammlung die bisher ausführlichste<br />
Systematik der Entlehnungtypen und Kodewechselarten verfasst, deren besonderes Verdienst<br />
in der Einführung solcher Kategorien ist, die auf die Besonderheiten der Varietäten der<br />
ungarischen Sprache in den Nachbarstaaten Ungarns abgestimmt sind. Wir stützen uns daher<br />
– was die einzelnen Kontaktphänomene betrifft – vorwiegend auf die Terminologie Lanstyáks,<br />
womit auch eine Integration dieser Arbeit in das eingangs vorgestellte Forschungsprojekt<br />
„Die ungarische Sprache im Karpatenbecken am Ende des XX. Jahrhunderts” möglich wird.<br />
Der Terminus Lehnwort wird hier im weiteren Sinn, als Oberbegriff für alle lexikalischen Elemente<br />
fremden Ursprungs gebraucht, die sich entweder schon in das entlehnende Sprachsystem<br />
integriert haben, oder sich noch am Anfang des Integrationsprozesses befinden.<br />
Dabei ist aber das Lehnwort vom sogenannten 1-Wort Kodewechsel zu trennen, der von Benı<br />
(2004b: 7) als „Kommunikationsstrategie des bilingualen Sprechers, innerhalb derer er während<br />
des Gebrauchs des einen sprachlichen Codes auf der Ebene eines einzigen Lexems zum anderen<br />
sprachlichen Code wechselt” definiert wird.<br />
Benı sieht den 1-Wort Kodewechsel als gelegentliche und individuelle Bildung an und schließt<br />
sich somit János Péntek an, der diese Erscheinung anhand der Dichotomie Saussures als Parole-<br />
Entlehnung bezeichnet (Péntek 1996: 113).<br />
Obwohl sich der mit dem individuellen Sprachgebrauch verbundene 1-Wort Kodewechsel und<br />
das in der Sprachgemeinschaft verbreitete oder sich zu verbreiten beginnende Lehnwort schwer<br />
unterscheiden lassen – bilden sie doch die äußersten Pole ein und desselben Kontinuums – soll<br />
trotzdem eine Unterscheidung dieser Kategorien anhand der Kriterien der Gebrauchshäufigkeit,<br />
morphologischen Integration in das System der entlehnenden Sprache und der Sprecherattitüden<br />
versucht werden (siehe: Bartha 1992: 19-29, Riehl 2004: 20-21, 31 und Lanstyák 2006: 60-73).<br />
Wenn das gegebene lexikalische Element von mehreren Sprechern mehrmals gebraucht wird,<br />
lässt sich dies als Beginn eines Integrationsprozesses in die gegebene Sprachvariante und somit<br />
als Lehnwort deuten. Wenn sich aber dagegen beim betreffenden Wort die morphologischen<br />
Merkmale der rumänischen Sprache finden, ist es als 1-Wort Kodewechsel deutbar.<br />
Bei dieser Differenzierung müssen die oben genannten Kriterien in jedem Fall miteinander kombiniert<br />
werden. Dass man sich nicht nur auf ein Kriterium stützen kann, soll am Beispiel der<br />
Hapax Legomena gezeigt werden: Ist ein lexikalisches Element nur einmal belegt, muss es nicht<br />
automatisch als 1-Wort Kodewechsel bestimmt werden. So kommen auch im Material Gazdas<br />
153
nur einmal belegte Wörter fremden Ursprungs wie ápártáment (S) ’Appartement’, blokk (S)<br />
’Hochhaus’, buletin (S) ’Personalausweis’ vor, die sich aber anhand der Lehnwörterbücher von<br />
Márton (1972) und Márton/Péntek/Vöı (1977) als weit verbreitete Bestandteile der regionalen<br />
ungarischen Umgangssprache Rumäniens bestimmen lassen.<br />
Dass jeder sprachliche Wandel vom individuellen Sprachgebrauch ausgeht, zeigt sich auch darin,<br />
dass diejenigen rumänischen Entlehnungen, die – nach der Monographie Bakos (1982) über die<br />
Geschichte der rumänischen Elemente des ungarischen Wortschatzes – im 19. Jahrhundert selten<br />
bzw. nur als Hapax Legomena vorkamen, im 20. Jahrhundert – wie das etymologische Wörterbuch<br />
von Márton/Péntek/Vöı (1977) zeigt – in mehreren Mundarten belegt sind , so dass sie sich<br />
als Elemente der Volkssprache schlechthin erweisen; dieselben Lehnwörter sind im Material<br />
Gazdas entweder weit verbreitet oder gehören zum gemeinsamen Tschango-Wortschatz (N, S,<br />
Sz)<br />
Im folgenden wird der nördliche Tschango-Dialekt mit N, der südliche mit S und der Székler Tschango-<br />
Dialekt mit Sz abgekürzt.<br />
im 19. Jh.<br />
(Bakos)<br />
im 20. Jh.<br />
(Márton/Péntek/Vöı; Gazda-Material)<br />
pitán ’Maisbrot’ selten volkssprachlich; gemeinsamer Tschango-Wortschatz<br />
papusa ’Puppe’ selten volkssprachlich; S, Sz<br />
urál sehr selten mundartlich; S, Sz<br />
’gesegnete Feiertage wünschen’<br />
opril ’verbieten’ sehr selten mundartlich; S<br />
dubil ’gerben’ Hapax Legomenon mundartlich, Fachsprache; N, Sz<br />
vápor ’Dampfschiff’ Hapax Legomenon mundartlich; S, Sz<br />
Auf die Problematik der Unterscheidung zwischen Lehnwort und Kodewechsel wird im späteren<br />
Verlauf dieser Arbeit noch näher eingegangen werden.<br />
154
2. Direkte/Unmittelbare Entlehnungen<br />
2.1. Terminologische Fragen<br />
Die auffälligste Form der Entlehnung bilden die direkten bzw. unmittelbaren Entlehnungen, die<br />
von Lanstyák (2006: 21) als „Elemente fremder Herkunft, die ihre ursprüngliche Lautform mehr<br />
oder weniger beibehaltend in die Nehmersprache gelangt sind”, bestimmt werden.<br />
Innerhalb dieser lexikalischen Entlehnungen wird im Verlaufe dieses Kapitels gesondert auf die<br />
„eigentlichen” Lehnwörter, Rückentlehnungen und Internationalismen eingegangen.<br />
Als „eigentliche” Lehnwörter bestimmt Benı (2004: 24) diejenigen „aus einer anderen Sprache<br />
stammenden lexikalischen Elemente, die im Sprachsystem der Nehmersprache – was die Lautform<br />
betrifft – vollkommen neu und unbekannt sind.” Diese Kategorie zeigt im Grunde genommen<br />
die eigentliche Stärke der rumänischen Sprache auf die einzelnen Tschango-Dialekte.<br />
Die Kategorien der Rückentlehnungen und Internationalismen relativieren dagegen die Stärke des<br />
rumänischen Einflusses auf die Sprache der Moldauer Ungarn: bei den Internationalismen nimmt<br />
sie nur eine „Vermittlerrolle” ein, bei den Rückentlehnungen „gibt” sie die einst aus der ungarischen<br />
Sprache entlehnten Elemente in veränderter Form und Bedeutung an diese „wieder<br />
zurück”.<br />
Eine weitere Relativierung erfährt der rumänische Einfluss auch dadurch, dass viele rumänische<br />
Lehnwörter in den Äußerungen der Tschangos als Teil von bilingualen, rumänisch-ungarischen<br />
Synonymenpaaren, sog. Dubletten gebraucht werden; die Übernahme von rumänischen Lehnwörtern<br />
ist also nicht automatisch mit dem Verschwinden der muttersprachlichen Äquivalente<br />
verbunden.<br />
Gesondert muss in diesem Zusammenhang auch auf die rumänischen Lehnwörter eingegangen<br />
werden, die inzwischen zu festen und selbstverständlichen Bestandteilen der regionalen ungarischen<br />
Umgangssprache Rumäniens geworden sind.<br />
Die eigentliche Stärke des rumänischen Einflusses in den Äußerungen der Moldauer Tschangos<br />
wird daher erst nach Abzug der prozentualen Anteile der<br />
- Elemente der regionalen ungarischen Umgangssprache Rumäniens,<br />
- Rückentlehnungen,<br />
- Internationalismen u n d<br />
- Dubletten b e w u s s t .<br />
155
2.2. Rumänische Lehnwörter als Bestandteile der regionalen ungarischen Umgangssprache<br />
Rumäniens<br />
Die im Gazda-Korpus vorkommenden rumänischen Lehnwörter wurden anhand des Wörterbuchs<br />
der rumänischen Lehnwörter in den ungarischen Mundarten (Márton - Péntek - Vöı 1977) als<br />
Bestandteile der regionalen ungarischen Umgangssprache Rumäniens klassifiziert. Dabei wurden<br />
auch die Lehnwörter in diese Kategorie mit aufgenommen, die die oben genannten Wörterbuchautoren<br />
als „in der Sprache der Rumänienungarn verbreitet” oder „in Verbreitung begriffen” ansehen.<br />
Die zeitlichen Angaben zu den ersten Belegen wurden der Monographie von Ferenc Bakos über<br />
die „Geschichte der rumänischen Elemente des ungarischen Wortschatzes” (Bakos 1982)<br />
entnommen.<br />
Der gemeinsame Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte ist unterstrichen.<br />
belegt seit dem 15. Jahrhundert:<br />
berbécs (S, Sz) < r. berbec ’Schafbock, Hammel’, boér < r. boier ’Bojar, Gutsherr’, csobán<br />
< r. cioban ’Schafhirt’, kalagor (S) < r. călugăr ’Mönch der griechisch-orientalischen Kirche,<br />
Eremit’, katrinca < r. catrinŃă ’Rockschürze der Bäuerinnen’, koliba (Sz) < r. colibă ’Hütte’<br />
belegt seit dem 16. Jahrhundert:<br />
esztena (N) < r. stînă ’Hürde; Herde’, kozsok (S) < r. cojoc ’knielanger Bauernmantel aus Schafpelz’<br />
belegt seit dem 17. Jahrhundert:<br />
butuk (Sz) ’unterer Längsbalken am Gestell des Haspels’ < r. butuc ’Klotz’, csuma (S) < r. ciumă<br />
’Pest’, hájde (S) < r. haide ’los! komm!, köruca < r. căruŃă ’Wagen, Fuhrwerk’, lunka (Sz)<br />
< r. luncă ’ Hain; Flussau’, málé (S, Sz) < r. mălai ’Hirse, Mais; Kuchen aus Hirse- oder Maismehl,<br />
Maisbrot’, putyina (S, Sz) < r. putină ’Bottich, Holzzuber’, rezsnica (N, Sz) < r. rîşniŃă<br />
’Handmühle; Handmühle des Töpfers’, vátáv (N) < r. vătaf, vătav ’Vortänzer beim Bauerntanz’,<br />
vátra (Sz) < r. vatră ’Herd, Feuerstelle’, zésztre (S, Sz) < r. zestre ’Mitgift, Aussteuer’<br />
belegt seit dem 18. Jahrhundert:<br />
berszán (Sz) ’rum. Transhumanzsenne aus dem Burzenland; Besitzer von wenigstens hundert<br />
Schafen; Schafsorte’ < r. bîrsan ’Burzenländer; Schafsorte’, deszküntál (S) < r. a descînta ’<br />
jemanden mit Zaubersprüchen von seiner Krankheit heilen, behexen, berufen, drányic (S)<br />
156
. draniŃă ’große Dachschindel’, faszuj (S, Sz) < r. fasole, dial. făsui ’Bohne’, kolindál (N, S)<br />
< r. colinda ’von Haus zu Haus Weihnachtslieder singen, herumziehen, kukuruz (S) < r. cucuruz<br />
’Mais; Maiskolben’, kuptor (S) < r. cuptor ’Backofen’, liváda (S, Sz) < r. livadă ’Obstgarten’,<br />
maliga (N, S) < r. mămăliga, dial. măligă ’Maisbrei’, mosié (S) < r. moşie ’Gut’, pomána (S, Sz)<br />
< r. pomană ’anlässlich des Totenschmauses gereichte Speisen und Getränke’<br />
belegt seit dem 19. Jahrhundert:<br />
bosztán (S) < r. bostan ’Kürbis’, botezát (Sz) < r. a boteza ’taufen’, buza (Sz) < r. buză ’Lippe’,<br />
cinka (Sz) < r. Ńîncă ’junges Mädchen’; Ableitung von r. Ńinc, Ńînc ’Junges von Hunden und<br />
Raubtieren; Bürschchen’, duláp (Sz) < r. dulap ’Schrank’, galeáta (S) < r. găleată ’Eimer,<br />
Melkeimer aus Holz’, gránic (S, Sz) < r. graniŃă ’Grenze’, kort < r. cort ’Zelt’, kovrig (S)<br />
< r. covrig ’Bretzel; aus Teigresten gebackenes Brötchen’, kurtacska (S) < r. scurtă ’kurzer<br />
Mantel’, máj < r. mai ’noch’, mósuj (S) < r. moş ’Großvater, dial. Onkel’, mutál < r. a muta<br />
’etwas wegrücken’, a se muta ’übersiedeln’, nekezsál < r. a se necăji ’sich sorgen um etw.’,<br />
nunta (S, Sz) < r. nuntă ’Hochzeit’, nyám (S, Sz) < r. neam ’Verwandte, Verwandtschaft’, pacil<br />
(S, Sz) < r. a păŃi ’es geschieht, es passiert, durchleben, erleben, erleiden’, pluta (S, Sz)<br />
< r. plută ’Floß’, putrigályos (Sz) ’faul, schmutzig,dreckig’ < r. putregai, putrigai ’Fäulnis’,<br />
szköpál (S) < r. a se scăpa ’loskommen, entkommen’, a scăpa ’befreien’, tunel (N) < r. tunel<br />
’Tunnel’<br />
belegt seit dem 20. Jahrhundert:<br />
alimentára (Sz) < r. alimentară ’Lebensmittelladen’, ápártáment (S) < r. apartament ’Wohnung’,<br />
aprobál (Sz) < r. aproba ’genehmigen’, áprobáre (S) < r. aprobare ’Genehmigung’, bászka (S)<br />
< r. bască ’Baskenmütze’, bátálion (S, Sz) < r. batalion ’Batallion’, blokk ’Hochhaus’ (S)<br />
< r. bloc ’Block’, buletin (S) < r. buletin ’Personalausweis’, csubuk (Sz) < r. ciubuc ’Trinkgeld’,<br />
depózit (Sz) < r. depozit ’Depot’, ficujka (Sz) < r. fiŃuică ’Zettel’, fisa (Sz) < r. fişă ’Blankett,<br />
Evidenzzettel’, gáz (Sz) < r. gaz ’Petroleum’, kárnét (Sz) < r. carnet ’Mitgliedsbuch’, komplex<br />
(N) < r. complex ’Handelseinheit, Handelskomplex’, koncsentrál (S, Sz) < r. a concentra ’(zu<br />
Waffenübungen) einberufen’, koncsentráre (S, Sz) < r. concentrare ’Einberufung’, kondika (S)<br />
< r. condică ’Anwesenheitsjournal’, lokotinent < r. locotenent, locotinent ’Oberleutnant’, major<br />
(S, Sz) < r. maior ’Major’, milícia (Sz) < r. miliŃie ’Polizei, Miliz’, motorina (Sz) < r. motorină<br />
’Rohöl’, piláf (Sz) < r. pilaf ’Reisgericht mit Fleisch’, szantinel (N, Sz) < r. santinelă ’Wache,<br />
Schildwache’, szekretár (N) < r. secretar ’Sekretär’, szervics < r. serviciu ’Anstellung, Dienst’,<br />
szóra (S) < r. soră ’Pflegerin, Wärterin’<br />
Innerhalb der in den Äußerungen der Informanten Gazdas vorkommenden Lehnwörter beträgt der<br />
prozentuale Anteil der Elemente, die zur regionalen ungarischen Umgangssprache Rumäniens gehören,<br />
bei den Vertretern des nördlichen 8, 27 %, des südlichen 13, 90 % und schließlich des<br />
Székler Tschango-Dialekts 13, 21 %. Der geringste prozentuale Anteil der zur regionalen<br />
Umgangssprache der Rumänienungarn gehörenden Lehnwörter findet sich demnach bei den<br />
Nord-Tschangos; zwischen den Süd- und Székler Tschangos gibt es diesbezüglich nur<br />
geringfügige Unterschiede.<br />
157
2.3. Rückentlehnungen<br />
2, 06 % der in den Äußerungen der Nord-Tschangos vorkommenden rumänischen Lehnwörter<br />
lassen sich als sog. Rückentlehnungen klassifizieren, deren Anteil bei den Süd-Tschangos<br />
2, 36 %, bei den Székler Tschangos 2, 67 % beträgt. Unter Rückentlehnung versteht man in der<br />
kontaktlinguistischen Fachliteratur das „Phänomen, wenn aus einem Lexem [einer Sprache, in<br />
unserem Falle des Ungarischen] ein Lehnwort einer anderen Sprache [, in unserem Falle des<br />
Rumänischen] wird, das später – in den meisten Fällen in veränderter Lautform und Bedeutung –<br />
wieder in die ursprüngliche Sprache zurückgelangt” (Bakos 1989: 81). Dieser Prozess wird im<br />
folgenden anhand der im Gazda-Material vorhandenen Belege dargestellt werden, wobei zur<br />
Bestimmung der Rückentlehnungen das „Etymologisch-historische Wörterbuch der ungarischen<br />
Elemente im Rumänischen” von Lajos Tamás (1966) zu Rate gezogen wurde:<br />
ungarisch > rumänisch > (tschango)ungarisch<br />
bácsi ’Onkel, Herr, Vetter’ > baciu ’Vetter, alter Mann’ ><br />
bacsu ’id.’<br />
bokál<br />
’irdener oder gläserner<br />
Wasserkrug, Pokal’<br />
> borcan ’Einkochglas; irdenes Einkochgefäß’ > borkán ’id.’<br />
cenk > Ńinc, Ńînc > cinka ’junges Mädchen, Backfisch’<br />
’junger Hund, schlimmer ’Junges von Hunden und<br />
Knabe, Knecht’<br />
Raubtieren; Bürschchen’,<br />
Ableitung: Ńîncă ’junges Mädchen,<br />
Backfisch’<br />
dudva > dudău ’Unkraut’ > dudó ’id.’<br />
’Dornstrauch (veraltet),<br />
Unkraut’<br />
galuska ’Klößchen’ > găluşcă ’Krautklöße’ > geluszka, geluska ’id.’<br />
158
ungarisch > rumänisch > (tschango)ungarisch<br />
marha ’Vieh’ > marhă ’Besitz; Reichtum’ > márfa ’Ware’<br />
~ marfă ’Ware’<br />
nem<br />
’Geschlecht, Stamm,<br />
Art, Gattung’<br />
> neam ’Verwandte, Verwandtschaft’ > nyám ’id.’<br />
rúd > rudă (mold. rud) > rud ’Feldmaß’<br />
’Stange, Deichsel’<br />
’Stange, Deichsel;<br />
altes Ackermaß’<br />
szoba > sobă ’Ofen’ > szóba ’Ofen’<br />
’Ofen (noch im XVII. Jh.);<br />
Stube, Zimmer’<br />
zsandár ’Gendarm’ > jîndar ’id.’ > zsendár ’id.’<br />
Im Wörterbuch von Yrjö Wichmann (1936) finden sich weitere rumänische Lehnwörter, die<br />
sich den sog. Rückentlehnungen zuordnen lassen:<br />
Einige Kostproben:<br />
ungarisch > rumänisch > (tschango)ungarisch<br />
kopó > copoi ’Jagdhund’ > kapui ’Jagdhund’<br />
’Jagdhund, Spürhund’<br />
korlát > corlată > korláta<br />
’Geländer, Schranke, ’Futterbarren’ ’Raufe im Pferdestall<br />
Bretterplanke,<br />
über der Krippe’<br />
Viehzaun, Kesselstange’<br />
prém > prim > prim<br />
’Pelz’, mundartl. auch ’streifenförmiger Besatz aus ’Gebräme an der Pelz-’<br />
’Besatz, Borte’, feinerem Pelz an den äußeren weste oder am Pelzrock<br />
in der älteren Sprache<br />
Rändern des Bauernpelzes<br />
auch ’Binde, Band’<br />
(Moldauer Volkssprache)’<br />
retesz > rătez > retjiédz<br />
’Kette, Riegel’ ’Vorlegekette, Schubriegel, ’Schieber, Riegel-<br />
Querriegel, Riegel<br />
schloss’<br />
159
csutora > ciutură ’Brunneneimer (aus Holz)’ > sutura ’id.’<br />
’Mundstück der Pfeife;<br />
Eimer, hölzerne Feldflasche’<br />
tornác ’Hausflur, Gang, Vorplatz’ > tîrnaŃ ’id.’ > tirnátsz ’Speicherflur’<br />
2.4. Internationalismen<br />
Innerhalb der direkten Entlehnungen bilden die Internationalismen eine gesonderte Gruppe, die<br />
von Benı (2004: 24) und Lanstyák (2006: 20-21) als „Lautgestaltsentlehnungen” bezeichnet werden.<br />
Der Prozess dieser „Entlehnung der Lautgestalt” wird von Lanstyák (2006: 20) folgendermaßen<br />
beschrieben: „Tritt ein Lexem in der Geber- und Nehmersprache in ähnlicher, aber nicht gleicher<br />
Lautgestalt und gleicher bzw. ähnlicher Bedeutung auf, kommt es vor, dass sich die Lautgestalt<br />
des im Wortschatz der Nehmersprache auch vorher vorhandenen Lexems unter Einfluss des<br />
sprachlichen Modells der Gebersprache zu ändern beginnt. Dieser Wandel beginnt damit, dass<br />
neben der ursprünglichen Form eine neue Variante auftritt, die eher der Lautgestalt des sprachlichen<br />
Modells der Gebersprache entspricht bzw. dieser mehr oder weniger ähnelt.”<br />
Lanstyák (2002: 77) definiert den Terminus „Modell” als „dasjenige Sprachelement bzw. diejenige Struktureigenschaft<br />
der Gebersprache, das bzw. die auf das Sprachelement bzw. die Struktureigenschaft der Nehmersprache einen<br />
direkten oder indirekten Einfluss ausübt.”<br />
Die in den Varietäten des Ungarischen schon vorhandenen Internationalismen werden im allgemeinen<br />
durch diese Lautgestaltsentlehnungen verdrängt. Benı (2004: 26) und Bodó/Eriş (2004:<br />
80) verweisen nun im Falle des Tschango-Dialekts darauf hin, dass dessen Sprecher die ungarischsprachigen<br />
Äquivalente der meisten Internationalismen gar nicht kennen. Diesen Umstand<br />
erklären sie damit, dass die ungarische Spracherneuerung des 19. Jahrhunderts, die Standardisierung<br />
des Ungarischen fast ohne Einfluss auf diesen Dialekt war, was sie auf dessen Sprachinselstatus<br />
zurückführen. Bodó/Eriş (2004: 79-80) berufen sich auf das jahrhundertelange Fehlen von<br />
Sprachkontakten mit den ungarischen Sprachvarietäten im Karpatenbecken und unterziehen in<br />
ihrer Lehnworttypologie die Internationalismen keiner gesonderten Untersuchung.<br />
Im folgenden soll die oben genannte – in der Fachliteratur bereits zu einer Floskel gewordene –<br />
„Isolationstheorie” etwas differenziert und anhand einiger Argumente begründet werden,<br />
weshalb in dieser Arbeit innerhalb der direkten Entlehnungen auch auf die Internationalismen<br />
eingegangen wird.<br />
160
Aus einem Aufsatz von Ferenc Pozsony (2005) wird deutlich, dass sich die – übrigens auch heute<br />
noch bestehenden – Handelsbeziehungen der Moldauer Tschangos mit dem Ungartum Siebenbürgens<br />
bis in die Zeit des Moldauer Fürstentums zurückverfolgen lassen. Pozsony (2005: 166)<br />
verweist auf die wichtige Rolle, die das städtische Moldauer Ungartum zu dieser Zeit bei der<br />
Herstellung und Verbreitung von handwerklichen Produkten gespielt hat.<br />
In den von den Tschangos bewohnten Gebieten – so z.B. in Onyest – wurden regelmäßig Märkte<br />
veranstaltet, wo sie auch mit siebenbürgischen Händlern in Berührung kamen. Pozsony (2005:<br />
167) verweist darauf, dass die Moldauer Tschangos diese wirtschaftlichen Beziehungen mit dem<br />
Ungartum Siebenbürgens bis zur heutigen Zeit bewahrt haben. Als Beispiele führt er die<br />
intensiven Handelsbeziehungen der Tschangos zu den Székler Dörfern der Komitate Csík und<br />
Háromszék an, die in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg von den Moldauer Ungarn mit Trauben,<br />
Wein und Mais beliefert wurden; in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg wiederum halfen die<br />
Tschangos in den siebenbürgisch-ungarischen Dörfern bei der Kartoffelernte aus.<br />
Zwischen den Moldauer Tschangos und den Siebenbürger Ungarn kam es aber nicht nur zu wirtschaftlichen<br />
Kontakten: Vincze (2004: 28) führt an, dass die Moldauer Ungarn voraussichtlich<br />
schon seit dem 16. Jahrhundert an der Pfingstwallfahrt in Csíksomlyó teilnahmen. Meinolf Arens<br />
und Daniel Bein (2003: 227) bezeichnen diesen traditionellen Treffpunkt der Ungarn<br />
Siebenbürgens und der Moldauer Tschangos nicht ohne Grund als „Möglichkeit [für die<br />
Moldauer Ungarn], das moderne ungarische Selbstverständnis kennenzulernen”.<br />
Die oben erwähnten wirtschaftlichen und religiösen Kontakte führten natürlich auch zu Sprachkontakten<br />
zwischen den Moldauern Ungarn und Sprechern der ungarischen Standardsprache.<br />
Daher konnten auch während der beiden Weltkriege viele Tschangos – wie aus den Berichten der<br />
Gazda-Informanten deutlich wird – als Dolmetscher für Russisch und Ungarisch bzw. Rumänisch<br />
und Ungarisch fungieren:<br />
„Ich konnte Ungarisch und auch Ungarn gerieten in Gefangenschaft. Ungarische Soldaten.<br />
Sie brauchten jemanden, der Ungarisch kann, um mit ihnen zu reden. Einen alten Gefangenen.<br />
Sie schickten mich, um sie zu fragen, wie sie in Gefangenschaft geraten seien. Welche russischen<br />
Dörfer sie kennen würden. In welchen Einheiten sie gedient, wo und an welchen Frontstellungen<br />
sie gekämpft hätten. Ich habe die Ungarn gefragt und den Russen geantwortet. (...) Ich habe auf<br />
Ungarisch gefragt und die Antwort den Russen auf Russisch mitgeteilt.”<br />
[Ién tudtam magyarul beszélni, sz fogszágba béesztek magyarok. Magyar katonák. Kell vala egy,<br />
mellik tud vala magyarul, hogy beszéllien velük. Régi prizoner. Engemet béküldtek, hogy kérdezzem<br />
meg őket, hogy esztek bé fogszágba. Misa falukat iszmernek a zorosztól. Misa unitátéba,<br />
misa helliekbe, misa linékbe verekedett. Én kérdeztem vala magyarokat, sz mondom vala meg a<br />
zorosznak. (...) Kérdem vala meg magyarul, sz mondom vala meg oroszul a zorosznak.” (N; MP,<br />
geb. 1919)]<br />
161
„Die ungarischen Jungs kamen und konnten kein Wort Rumänisch. Ich fragte sie: Woher kommt<br />
ihr? Aus Csík – sagen sie. Aus Háromszék! Sie konnten kein Wort Rumänisch. Da ich Ungarisch<br />
konnte, sprach ich mit ihnen. (...) Das war in der Armee.”<br />
[„Jöttek a magyar fiúk, nem tudtak vala semmit románul. Kérdem vala: Honnat valók vattok?<br />
Csíkból – aszongyák. Háromszékból! Nem tudtak vala semmit románul. Én hogy tudtam<br />
magyarul isz, beszélek vala velik. (...) Ez vót a zármátéknál.” (S, AA, geb; 1901)]<br />
Der Anspruch der Moldauer Ungarn auf die Erweiterung ihrer ungarischen Sprachkenntnisse,<br />
wozu sie jede sich bietende Gelegenheit nutzen, zeigt sich auch im folgenden Zitat des Publizisten<br />
Lóránd Hegedős (1902 !, zitiert in: Vincze 2004: 149), der über das größte Dorf der Nord-<br />
Tschangos, Szabófalva folgendermaßen berichtet: „Es gibt weiterhin keine Schule, nur eine<br />
staatlich-rumänische. Die Kinder umringen dann einen neu eingewanderten Székler – oder wie<br />
sie sagen: »Széklerchen« - und lernen von diesem Ungarisch.”<br />
Von 1947 bis 1959 bestanden in einigen Tschango-Gemeinden des Komitats Bákó zeitweise<br />
ungarisch(sprachig)e Schulen verschiedenen Typs. Obwohl es nicht gelang, ungarische Schulen<br />
in den Siedlungsgebieten der nördlichen Tschangos ins Leben zu rufen, wurde das ungarischsprachige<br />
Lehrangebot trotzdem in Anspruch genommen: aus einem – auf den 10. Mai 1958<br />
datierten – Brief des Tschango-Schriftstellers Demeter Lakatos an den Ethnologen Pál Péter<br />
Domokos erfahren wir, dass schon im Herbst des vergangenen Jahres 10 Kinder aus Szabófalva<br />
die ungarischen Schulen besuchten (zitiert in: Vincze 2004: 45).<br />
Auch im Wortschatz der Tschangos wird deutlich, dass sie keineswegs vom „Rest der Welt”<br />
isoliert waren. Im Gazda-Material finden sich sogar Wörter wie fauszt-patron (N), feszt (Sz) oder<br />
nácsálnik ’Befehlshaber’(Sz), die deutschen bzw. russischen Ursprungs sind.<br />
Wörter aus dem Bereich des Gemeinschaftlichen Lebens wie repülıgép ’Flugzeug’ , tőzér<br />
’Artillerist’, igazolvány (S) ’Ausweis’, adó (S) ’Steuer’, néptanács (S) ’Volksrat’, községház (Sz)<br />
’Gemeindehaus’, nyugdíj (Sz) ’Rente’, kérvény (Sz) ’Gesuch, Antrag’, személyvonat (Sz)<br />
’Personenzug’, röpcédula (Sz) ’Flugblatt’zeigen den Kontakt mit der ungarischen Standardsprache.<br />
Um nun zu den Internationalismen zurückzukehren, fällt auf, dass in den Äußerungen der Gazda-<br />
Informanten neben den rumänischen Lehnwörtern dieser Art auch die ungarischsprachigen Äquivalente<br />
gebraucht werden:<br />
162
kátolik : kátolikusz ’katholisch’, kilometru (N) : kilométer ’Kilometer’, kollektivizáre (S) :<br />
kollektivizálás ’Kollektivisierung’, kommuniszt (N, Sz) : kommunista ’Kommunist’, kommunizm<br />
(Sz) : kommunizmus ’Kommunismus’, legionár (Sz) : legionárius ’Legionär [der Eisernen Garde]’,<br />
metru (N, S) : méter ’Meter’, misszionár (N) : misszionárius ’Missionar’, pártid (S, Sz) :<br />
párt ’Partei’, romün (N, Sz): román ’Rumäne’, rusz (S, Sz) : orosz ’Russe’<br />
Auf die oben genannten Wortpaare bzw. Dubletten wird im folgenden Unterkapitel dieser Arbeit<br />
noch näher eingegangen werden.<br />
Im folgenden werden einige der in den Äußerungen vorkommenden Internationalismen – der<br />
Typologie von István Lanstyák (2000: 195-196) folgend – vorgestellt, wobei neben der Lautgestaltsentlehnung<br />
aus dem Rumänischen auch das standardsprachliche ungarische Äquivalent<br />
angegeben wird. Dieses Verfahren der Gegenüberstellung der beiden Formen könnte auch im<br />
Bereich des muttersprachlichen Unterrichts der Tschangos eingesetzt werden:<br />
Lanstyák (2000: 195) verweist übrigens darauf, dass „man aus synchron-deskriptiver Sicht auch dann von Lautgestaltsentlehnungen<br />
(...) sprechen kann, wenn die Sprecher das standardsprachliche ungarische Wort nicht gekannt<br />
haben (...).”<br />
Die Unterschiede zwischen den beiden Formen zeigen sich ausschließlich auf phonemischer<br />
Ebene; Lanstyák (2000: 196) spricht in diesem Zusammenhang von „Lautgestaltsentlehnungen<br />
im engeren Sinn”.<br />
Lautgestaltsentlehnung<br />
aus dem Rumänischen<br />
standardsprachliches<br />
ungarisches Äquivalent<br />
boér < r. boier bojár ’Bojar’<br />
ciment (S) < r. ciment<br />
cement ’Zement’<br />
kazak (N) < r. cazac<br />
kozák ’Kosake’<br />
szofer < r. şofer sofır ’Chauffeur’<br />
Die Unterschiede zwischen den beiden Formen zeigen sich auch auf morphologischer Ebene:<br />
Ein Teil der Lautgestaltsentlehnungen entstand durch den „Austausch” der im standardsprachlichen<br />
Ungarisch gebrauchten Endungen durch die der rumänischen Sprache.<br />
163
„Austausch” der Suffixe für Abstrakta<br />
rumänisch: -ie<br />
ungarisch: -ió<br />
civilizácije (N) < r. civilizaŃie<br />
civilizáció ’Zivilisation’<br />
inzsekci (S) < r. injecŃie injekció ’Injektion’<br />
prédikácé (S) < r. predicaŃie<br />
predikáció ’Predigt’<br />
„Austausch” der Handlungsträgersuffixe<br />
rumänisch: -ant<br />
muzikánt (Sz) < r. muzicant<br />
rumänisch: -ist<br />
ungarisch: -us<br />
muzsikus ’Musiker’<br />
ungarisch: -ista<br />
adventiszt (N) < r. adventist<br />
adventista ’Adventist’<br />
aktiviszt (S, Sz) aktivista ’Aktivist’<br />
Der andere Teil der Lautgestaltsentlehnungen entstand durch das „Auslassen” der diversen<br />
ungarischen Suffixe.<br />
Lautgestaltsentlehnung<br />
aus dem Rumänischen<br />
standardsprachliches<br />
ungarisches Äquivalent<br />
liberál (S, Sz) < r. liberal liberális ’Liberale(r)’<br />
szeminár (Sz) < r. seminar<br />
szeminárium ’Seminar’<br />
diplomát (S) < r. diplomat diplomata ’Diplomat’<br />
Die gesonderte Betrachtung der Internationalismen innerhalb der in den Äußerungen der Moldauer<br />
Tschangos vorkommenden rumänischen Lehnwörter ermöglicht eine differenziertere Analyse<br />
der Stärke des rumänischsprachigen Einflusses, da die rumänische Sprache in diesen Fällen<br />
nur die Rolle des Vermittlers übernimmt<br />
Der Anteil der Internationalismen innerhalb der direkten/unmittelbaren Entlehnungen beträgt in<br />
den Äußerungen der Nord-Tschangos 25, 90 %, der Süd-Tschangos 27, 83 % und der Székler<br />
Tschangos 36, 95 %<br />
164
2.5. Dubletten/Wortpaare<br />
Bei der Analyse der Äußerungen der Gazda-Informanten fällt auf, dass viele neben den rumänischen<br />
Lehnwörtern im weiteren Gesprächsverlauf auch deren ungarischsprachige Äquivalente<br />
verwenden. Mit dieser Erscheinung beschäftigte sich vor allem Gyula Márton, der während der<br />
Materialsammlung für den „Sprachatlas der Moldauer Tschangos” bemerkte, dass „ein und derselbe<br />
Sprecher den betreffenden Begriff einmal durch das ungarische Wort, das andere Mal durch<br />
das rumänische Äquivalent bezeichnete” (Márton 1960a: 269). Márton (1956: 98, 1960a: 269-<br />
272, 1972: 33-34) bezeichnet diese Synonymenpaare gleicher oder ähnlicher Bedeutung, die auch<br />
aus 3 oder mehr Elementen bestehen können, als „Wortpaare” bzw. „Dubletten”.<br />
Die gesonderte Untersuchung dieser Wortpaare ermöglicht wiederum eine differenziertere Betrachtung<br />
der Stärke des rumänischsprachigen Einflusses: auffällig hierbei ist, dass sich über 70 %<br />
der im Gazda-Material vorkommenden Dubletten der Sachgruppe des „modernen Lebens” zuordnen<br />
lassen: 55 % der unter dem Oberbegriff „Gemeinschaftliches Leben” zusammengefassten<br />
Wortpaare stammen aus dem Bereich der öffentlichen Sphäre, des religiösen Lebens und des<br />
Militärwesens; 18, 33 % der Dubletten entstammen dem Bereich „Handel, Verkehr, Industrie”:<br />
1.) Dubletten aus der Sachgruppe des Gemeinschaftlichen Lebens<br />
a.) Verwaltung und Recht, Staat und Organisationen:<br />
adunáre : győlés (Sz) ’Versammlung’, áreszt : fogság (N) ’Gefangenschaft; Haft’, eszfát ~<br />
szfát : néptanács (Sz) ’Volksrat’, esztát ~ sztát : állam (Sz) ’Staat’, klásza : osztály (Sz)<br />
’Klasse’, kommuniszt : kommunista (S) ’Kommunist’, komunizm : kommunizmusz (N)<br />
’Kommunismus’, ledzsea : törvény (Sz) ’Gesetz’, licseu : gimnázium (Sz) ’Gymnasium’,<br />
orgánizácé : szervezet (Sz) ’Organisation’, partid : párt (S) ’Partei’, penszié : nyugdíj (Sz)<br />
’Rente’, plán : terv (Sz) ’Plan’, presedinte : elnök (S, Sz) ’Vorsitzender, Präsident’, primár :<br />
bíró (Sz) ’Dorfrichter’, primária : községháza (Sz) ’Gemeindehaus’, skoálá : iszkola (N)<br />
’Schule’, szálár : fizetés (Sz) ’Gehalt, Bezahlung’, szervics : szolgálat (auch: szolgálatság)<br />
(S, Sz) ’Anstellung, Dienst’, szpitál : kórház (S) ’Krankenhaus’, taksza : adó (S) ’Steuer’,<br />
zsandár : csendır (auch: csendırség) (Sz), ’Gendarm’, zsudéc : megye (Sz) ’Komitat’<br />
b.) Militär:<br />
ártiler : tőzér (S) ’’Artillerist, kazárma : kaszárnya (Sz) ’Kaserne’, mitralier : gépfegyvér<br />
(Sz) ’Maschinengewehr’, oficer : tiszt (Sz) ’Offizier’, prizonierek : foglyok (N) ’Gefangene’,<br />
rönil : sebesül (auch: sebesült) (Sz) ’verwunden’, szoldát : katona (auch: katonaszág) (N)<br />
’Soldat’, tún: ágyú (auch: ágyúszok) (S) ’Kanone’<br />
165
c.) Religion und Kirche:<br />
katolik : kátolikusz (N) ’Katholik’<br />
2.) Dubletten aus dem Bereich Handel, Verkehr, Industrie:<br />
avion : repülıgép (N) ’Flugzeug’, cseferist : vasutas (Sz) ’Eisenbahner’, depózit : raktár (Sz)<br />
’Depot, Lager’, fábrika : gyár (S) ’Fabrik’, gára : állomás (S, Sz) ’Bahnhof’, kilometru :<br />
kilométer (N) ’Kilometer’, masina : gép (N) ’Maschine’, metru : méter (S) ’Meter’, million :<br />
millió (S) ’Million’, sztráda : út (S) ’Straße’, trén : vonat (N) ’Zug’<br />
3.) Sonstige Dubletten:<br />
doftor, doktor (S) : orvosz ’Arzt’ , fotográfé : fénykép (Sz) ’Photographie’, grázsd (Sz) :<br />
istálló ’Stall’, harág (Sz) : karó ’Pfahl’, indraznec : szüves (N) ’mutig’, kollektivista :<br />
kollektiviszt (Sz) ’Kollektivist’, kollektor : begyőjtı (Sz)’Einsammler landwirtschaftlicher<br />
Vertragsprodukte’, libertáte : szabadság (N) ’Freiheit’, máme : anya ’Mutter’, nunta :<br />
menyekezı (S, Sz) ’Hochzeit’, Ruszé : Oroszország (S) ’Russland’, tárga : hordágy (Sz)<br />
’Trage’, táta : apa (N,Sz) ’Vater’, Ungáré : Magyarország (S) ’Ungarn<br />
Im folgenden – aus 3 Elementen bestehendem – Wortpaar steht 1 Element rumänischer Herkunft<br />
2 Elementen ungarischer Herkunft gegenüber, was die Stärke des rumänischen Einflusses auf den<br />
Tschango-Dialekt noch weiter relativiert:<br />
khiábur ~ tyhábur : nagygazda : kulák (Sz) ’Großbauer’<br />
In den folgenden Wortpaaren sind allerdings schon die rumänischen Elemente in der Überzahl.<br />
2 Elemente rumänischer Herkunft stehen nun einem Element ungarischer Herkunft gegenüber:<br />
drápel : szteág : zászló (Sz) ’Fahne’<br />
ziár (Sz) : zsurnál : újság ’Zeitung’<br />
In den Äußerungen der Sprachmeister Gazdas kommen auch nur aus rumänischen Elementen<br />
bestehende Wortpaare wie aeroplan (S, Sz) : avion ’Flugzeug’ vor, die wir naturgemäß nicht in<br />
unsere unten angeführte Statistik aufgenommen haben.<br />
Márton (1972: 35-36) verweist darauf, dass sich anhand der nur aus rumänischen Elementen bestehenden<br />
Wortpaare ermitteln lässt, inwieweit die Nehmersprache auf den unterdessen eingetretenen<br />
sprachlichen Wandel im Lexikon der Gebersprache reagiert.<br />
166
Im Wortpaar aeroplan (S, Sz) : avion ’Flugzeug’ gehören beide rumänische Elemente der Standardsprache<br />
an, wobei aber die erste Form die ältere ist.<br />
Im Wortpaar doktor : doftor ’Arzt’gehört das erste Element der standardsprachlichen, das zweite<br />
der dialektalen Varietät der rumänischen Sprache an.<br />
Voraussichtlich werden auch im Tschango-Dialekt diejenigen Bestandteile der Wortpaare im<br />
Sprachgebrauch erhalten bleiben, die der Standardsprache zugeordnet werden können.<br />
Gemäß Márton (1956: 98), der das Auftreten der Wortpaare im Zusammenhang mit der<br />
Zweisprachigkeit der Moldauer Ungarn betrachtet, gibt es, „wenn das Wort fremder Herkunft als<br />
Dublette eines schon vorhandenen, ursprünglichen Wortes auftritt (...) zwei Möglichkeiten”:<br />
Tritt zwischen den beiden Elementen eine Bedeutungsdifferenzierung ein, bleiben beide Wörter<br />
erhalten, wodurch der Wortschatz der entlehnenden Sprache eine Bereicherung erfährt.<br />
Liegt aber keine Bedeutungsdifferenzierung zwischen den beiden Elementen unterschiedlicher<br />
Herkunft vor, ist es zwar schwierig, sich in Prophezeiungen über das Schicksal der beiden Wörter<br />
einzulassen, doch zeigen die Erfahrungen der Sprachhistoriker, dass – im Falle eines starken und<br />
lang andauernden fremdsprachlichen Einflusses das fremdsprachliche Element gewöhnlich die<br />
Oberhand gewinnt.<br />
Anhand einiger Beispiele aus der vergleichenden Analyse des Wortschatzes des Wichmann-<br />
Wörterbuches mit dem des Tschango-Sprachatlas und dem heutigen Sprachzustand soll gezeigt<br />
werden, wie schwierig es ist, Voraussagen über das Schicksal der ungarischen Elemente zu<br />
treffen:<br />
Wortpaare, deren ungarische Elemente seit Wichmanns Zeiten bis heute erhalten geblieben sind:<br />
gustjur : körte ’Adamsapfel’<br />
szupa : levessz ’Suppe’<br />
Wortpaare, deren ungarische Elemente noch bekannt, aber nicht mehr gebraucht werden<br />
(Kategorie r/a); es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das rumänische Wort das ungarische<br />
Element endgültig verdrängt:<br />
budza : ajak ’Lippe’<br />
djümöls -> djümölcs : frupt -> frupt ’Obst’<br />
(Wichmann -> Tschango-Sprachatlas -> heutiger Sprachzustand)<br />
167
Wortpaare, deren ungarische Elemente endgültig verschwunden sind:<br />
szalkim : akáts ’Akazie’ (ungarisches Element schon seit den 50er Jahren verschwunden)<br />
itszár ’Bauernhosen aus weißem Wollgewebe’ : harisnya ’(Männer-)Hosen von grobem Loden’<br />
Die Dubletten lassen sich so zwar als zweischneidiges Schwert auffassen; eine Relativierung der<br />
Stärke des rumänischen Einflusses auf die Sprache der Moldauer Ungarn ist aber auf jeden Fall<br />
gegeben, weshalb auch auf die Angabe der prozentualen Anteile der Wortpaare in den Äußerungen<br />
der Tschangos nicht verzichtet werden soll.<br />
Im nördlichen Tschango-Dialekt kommen 7, 14 %, im südlichen Tschango-Dialekt 8, 02 % der<br />
rumänischen Lehnwörter als Bestandteile von rumänisch-ungarischen Wortpaaren vor; im Székler<br />
Tschango-Dialekt findet sich mit 12, 5 % der höchste Dubletten-Anteil.<br />
2.6. Integration der rumänischen Lehnwörter in das ungarische Sprachsystem der<br />
Moldauer Tschangos<br />
In diesem Kapitel soll die morphologische Integration der rumänischen Lehnwörter in das ungarische<br />
Sprachsystem des Moldauer Tschango-Dialekts vorgestellt werden, wobei auch auf die<br />
Produktivität der Lehnwörter eingegangen wird.<br />
2.6.1. Morphologische Integration der rumänischen Lehnwörter in das ungarische<br />
Sprachsystem der Moldauer Tschangos<br />
Die traditionelle Grammatik unterteilt die rumänischen Substantive in folgende drei<br />
Deklinations-klassen:<br />
- in die I. Deklination für Feminina sowie eine Reihe maskuliner Gattungs- und Eigennamen mit<br />
den Singularendungen -ă, -a, -ea<br />
- in die II. Deklination für Maskulina mit den Endungen Konsonant/palatalisierter Konsonant,<br />
Vokal -u, Halbvokal - u [w], Halbvokal -i [j] sowie für Neutra mit den Endungen Konsonant/<br />
palatalisierter Konsonant, Vokal -u, Halbvokal -u, Halb-vokal -i, Vokale -i und -o<br />
u n d s c h l i e ß l i c h<br />
- in die III.Deklination für Feminina, Maskulina und Neutra mit der Endung -e sowie für einige<br />
Feminina mit der Endung -i.<br />
(Beyrer – Bochmann – Bronsert 1987: 96)<br />
168
Im Ungarischen dagegen ist die Kategorie des Grammatischen Geschlechts unbekannt.<br />
Die aus dem Rumänischen entlehnten Substantive „verlieren – in [das System des] Tschango-<br />
Dialekts gelangend – vollkommen die morphologischen Kategorien der rumänischen Sprache wie<br />
z.B. das Grammatische Geschlecht oder die Zugehörigkeit zu einer [der drei]Deklinationen”<br />
(Márton 1972: 144).<br />
Die rumänischen Lehnwörter integrieren sich in die „für das morphologische System der<br />
ungarischen Sprache typischen Kategorien, den Nominalstamm-Typen unterschiedlicher<br />
Endungen“ (Márton 1972: ebd.).<br />
Die morphologische Einpassung der rumänischen Lehnwörter in das System der ungarischen<br />
Sprache zeigen folgende Substantive aus dem im Gazda-Material vorkommenden gemeinsamen<br />
Tschango-Lehnwortschatz, wobei die ungarischen Endungen bzw. grammatischen Suffixe jeweils<br />
unterstrichen werden:<br />
ármáta ’Armee’, ármátát (Akkusativ) , ármátába (Illativ), ármátájuk (Possessivsx.)<br />
boér ’Bojar’, boérok (Bindevokal + Pluralsx.), boérnak (Dativ), boérnál (Adessiv),<br />
boérjával (Possessivsx. + Komitativ-Instrumental)<br />
bránd ’Minenwerfer, Mine’, brándokval (Bindevokal + Pluralsx. + Komitativ-Instrumental)<br />
csobán ’Schafhirt’, csobánok (Bindevokal + Pluralsx.), csobánoknak (Bindevokal + Pluralsx. +<br />
Dativ)<br />
para ’Geld’, parát (Akkusativ), parával (Komitativ-Instrumental), parákval (Pluralsx. +<br />
Komitativ-Instrumental) , parám (Px., 1.Pers.), parád (Px., 2.Pers.), parája (Px., 3.Pers.)<br />
Bei den Adjektiven ergibt sich dasselbe Bild:<br />
falsz ’falsch, unecht’, falszok (Bindevokal + Pluralsx.), falszokot (Bindevokal + Pluralsx. +<br />
Akkusativ)<br />
indraznec ’verwegen, mutig’, indraznecek (Bindevokal + Pluralsx.)<br />
liber ’frei’, liberek (Bindevokal + Pluralsx.), liberabb (Komparativ)<br />
Die rumänischen Verben gliedern sich nach ihrem Infinitivmerkmal in folgende vier Klassen:<br />
den A-Verben, EA-Verben, E-Verben und I-/Î-Verben. (Beyrer – Bochmann – Bronsert 1987:<br />
147).<br />
Die Integration der rumänischen Lehnwörter in das morphologische System des Ungarischen<br />
erfolgt mit Hilfe des Suffixes –l, dessen Verwendung sich übrigens schon seit altungarischer Zeit<br />
in den unterschiedlichen Lehnwortschichten der ungarischen Sprache nachweisen lässt.<br />
Auch hier werden die Lehnwörter mit ungarischen Endungen versehen, wie einige Beispiele aus<br />
dem gemeinsamen Lehnwortschatz der Informanten Gazdas zeigen:<br />
169
foloszil ’benutzen’, folosziljuk (1.Pers.Pl. Präs., obj. Konj.), foloszilva (Verbaladverb)<br />
iszkölil ’unterschreiben’, iszkölild (2.Pers. Sg. Imp., obj. Konj.), iszkölilták (3.Pers.Pl. Prät.,<br />
obj. Konj.)<br />
csitilni ’lesen’(Infinitiv), kolindálni ’von Haus zu Haus Weihnachtslieder singen, herumziehen’,<br />
nekezsálni ’sich sorgen um etw.’, povesztilni ’erzáhlen’, urálni ’gesegnete Feiertage wünschen’,<br />
votálni ’Stimme abgeben’<br />
Obwohl die rumänische Sprache nicht zwischen der objektiven und subjektiven Konjugation<br />
unterscheidet, werden die aus dem Rumänischen entlehnten Verben mit Personalsuffixen der<br />
subjektiven (bombárdál ’mit Kanonen schießen’: megbombárdáltak (3.Pers.Pl.Prät.), mutál<br />
’(um)ziehen, übersiedeln’: átmutáltak) und objektiven (elbombárdálták (3.Pers.Pl.Prät.),<br />
elmutálták) Konjugation versehen.<br />
2.6.2. Rumänische Lehnwörter als produktive Wortbildungselemente<br />
Die Produktivität der rumänischen Lehnwörter zeigt sich darin, dass sie an der Wortbildung der<br />
Nehmersprache teilnehmen: sie kommen entweder als Derivate vor oder verbinden sich mit einheimischen<br />
Wörtern zu Komposita. Auf diese beiden Aspekte soll im folgenden näher eingegangen<br />
werden.<br />
Ableitung mit ungarischen Wortbildungsaffixen<br />
a.) Suffigierung zur Substantivbildung:<br />
sofer ’Chauffeur’, soferség<br />
b.) Suffigierung zur Adjektivbildung:<br />
Das Suffix -ség leitet von einem Substantiv oder Adjektiv ein Substantiv mit einer kollektiven oder<br />
verallgemeinernden Bedeutung ab.<br />
eszpitál ’Krankenhaus’, eszpitálosz<br />
katrinca ’Rockschürze der Bäuerinnen’, katrincás<br />
nunta ’Hochzeit’, nuntás<br />
pártid ’Partei’, pártidosz<br />
putrigály ’Moder, Fäulnis’, putrigályos<br />
fóta ’Schürze’, fotás<br />
Die Suffixe -s, -os leiten von einem Substantiv ein Adjektiv ab, das die Existenz einer Eigenschaft ausdrückt.<br />
170
c.) Präfigierung zur Verbbildung:<br />
akhitál ’begleichen, bezahlen’, kiakhitál (Präfix ki- zum Ausdruck der resultativen, perfektiven<br />
Handlung)<br />
bombárdál ’mit Kanonen schießen’: megbombárdál (Präfix meg- zum Ausdruck der inchoativen,<br />
beginnenden Aktionsart), elbombárdál (Präfix el- zum Ausdruck der resultativen, perfektiven Handlung)<br />
mutál ’(um)ziehen, übersiedeln’, átmutáltak, elmutálták, bemutálóztak<br />
(Präfixe át-, el-, be- zum Ausdruck der Richtung einer Bewegung)<br />
d.) Suffigierung zur Adverbbildung:<br />
fóta ’Schürze’, fotás, fotáson<br />
krud ’roh’, krudon<br />
Das Suffix -on leitet von Adjektiven Modaladverben ab.<br />
Als Bestandteile von Komposita kommen die rumänischen Lehnwörter sowohl als Grund- als<br />
auch Bestimmungswort vor.<br />
Im Gazda-Korpus finden sich folgende hybride Bildungen aus rumänischen Entlehnungen, die<br />
durch Fettdruck gekennzeichnet sind, und einheimischen, ungarischen Wörtern:<br />
párt-aktiviszt (S, DJ) ’Parteifunktionär’<br />
gebildet aus: ung. párt ’Partei’ + rum. activist ’Funktionär’<br />
kenyérfábrika (S, TM) ’Brotfabrik’<br />
gebildet aus ung. kenyér ’Brot’ + rum. fabrică ’Fabrik’<br />
fémszóba (S, CsBM) ’Erzofen’<br />
gebildet aus ung. fém ’Metall’ + rum. sobă ’Ofen’<br />
napraforgópitán (Sz, DBK) ’Brot mit Sonnenblumenkernen’<br />
gebildet aus ung. napraforgó ’Sonnenblume’ + rum. pitan ’Roggenbrot’<br />
bernicöv (Sz, DBK) ’buntes Gürtelband der Bäuerinnen’<br />
gebildet aus rum. bârneŃ ’buntes Gürtelband der Bäuerinnen’ + ung. öv ’Gürtel’<br />
brádzsendely (Sz, TGy) ’Tannenschindel’<br />
gebildet aus rum. brad ’Tanne’ + ung. zsindely ’Schindel’<br />
bojérház (N, MP) ’Bojarenhaus’<br />
gebildet aus r. boier ’Bojar, Gutsherr’ + ung. ház ’Haus’<br />
kótabegyőttı (Sz, IM) ’Einsammler landwirtschaftlicher Vertragsprodukte’<br />
gebildet aus rum. cotă ’Quote (bei Naturalien)’ + ung. begyőttı ’Einsammler’<br />
171
kukuruzliszt (S, BBM) ’Maismehl’<br />
gebildet aus rum. cucuruz ’Mais’ + ung. liszt ’Mehl’<br />
liliák-bokor (S, KA) ’Fliederbusch’<br />
gebildet aus rum. liliac ’ Flieder (Syringa vulgaris)’ + ung. bokor ’Busch’<br />
platformkocsi ’Verladewagen, Güterwagen’<br />
gebildet aus rum. platformă ’Rampe, Ladeplatz’ + ung. kocsi ’Wagen’<br />
pujszál (S, KA) ’Maiskolben’, pujszálacska (S, KA) ’Maiskölbchen’ , pujszemecske (Sz, BMX)<br />
’Maiskörnchen’<br />
puj < rum. pui ( de popuşoi) ’Mais’<br />
traktoriszt-iskola (Sz, TaJ) ’Traktoristenschule’<br />
gebildet aus rum. tractorist ’Traktorist, Traktorführer’ + ung. iskola ’Schule’<br />
2.7. Gemeinsamer Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte<br />
Die Angabe des gemeinsamen Lehnwortschatzes der Gazda-Informanten soll einen Beitrag zum<br />
Forschungsprogramm „Abbau der Grenzen (határtalanítás)” leisten, das 2001 von der Ungarischen<br />
Akademie der Wissenschaften ins Leben gerufen wurde<br />
Ziel dieses Programms ist es, „dass in denjenigen sprachwissenschaftlichen Werken, an dessen<br />
Neuauflage zur Zeit noch in Ungarn gearbeitet wird, auch die Varianten der ungarischen Sprache<br />
außerhalb Ungarns ihrer Bedeutung entsprechend aufgenommen werden sollen, d.h. also, dass<br />
diejenigen Werke, die sich mit der Vorstellung der ungarischen Sprache beschäftigen (wie einsprachige<br />
Bedeutungs- und Fremdwörterbücher, Rechtschreibwörterbücher und -Computerprogramme,<br />
Synonymen- und onomastische Wörterbücher, fach-oder sondersprachenspezifische<br />
Wörterbücher, zweisprachige Wörterbücher, Grammatiken sowie Handbücher zur Stilistik und<br />
Sprachrichtigkeit) – ihren jeweiligen Titeln entsprechend – nicht nur auf die ungarische Sprache<br />
in Ungarn, sondern auf die universelle ungarische Sprache eingehen, die außer den ungarischen<br />
Sprachvarianten in Ungarn auch die Sprachvarianten der ungarischen Sprachgemeinschaften<br />
außerhalb Ungarns umfasst” (Lansták 2006: 57).<br />
Unter der Redaktion von István Lanstyák entstand bislang eine Wortliste (ht-lista), die aus den<br />
in den ungarischen Sprachvarianten der Nachbarstaaten vorhandenen direkten Entlehnungen besteht.<br />
In naher Zukunft soll diese Liste durch ein Verzeichnis der indirekten Entlehnungen (Lehnbedeutungen,<br />
Lehnbildungen) ergänzt werden.<br />
172
Mit der ungarischen Sprachvariante in Rumänien haben sich innerhalb des oben erwähnten Forschungsprogrammes<br />
János Péntek und Attila Benı beschäftigt: ihr Wortverzeichnis enthält die<br />
rumänischen Entlehnungen aus der siebenbürgischen Region. Diese Liste soll nun durch den im<br />
Gazda-Korpus vorkommenden Lehnwortschatz ergänzt werden, der in allen 3 Tschango-<br />
Dialekten weit verbreitet ist.<br />
Die Gruppierung des gemeinsamen Lehnwortschatzes nach Sachgruppen ergibt folgendes Bild:<br />
1. Gemeinschaft 34, 67 %<br />
2. Der Mensch 20, 00 %<br />
3. Handel, Verkehr, Industrie 10, 67 %<br />
4. Landwirtschaft und Futterzubereitung 6, 67 %<br />
5. Haus und Umgebung 4, 00 %<br />
Kleidung, Tracht 4 ,00 %<br />
6. Nahrung 1, 33 %<br />
Viehzucht 1, 33 %<br />
Gemischtes: 17, 33%<br />
1. Gemeinschaft (Verwaltung und Recht, Staat und Organisationen, Religion und Kirche,<br />
Militär):<br />
ármáta < r. armată ’Armee’, bomberdál < r. a bombarda ’mit Kanonen schießen’, bránd<br />
< r. brand ’Minenwerfer; Mine’, grenicsér < r. grănicer ’Grenzsoldat’, iszkölil < r. iscăli<br />
’unterschreiben’, kártus < r. cartuş ’Patrone’, kátolik < r. catolic ’römisch-katholisch’, klásza<br />
< r. clasă ’Schulklasse’, kolonel < r. colonel ’Oberst’, komanda < r. comandă ’Befehl’,<br />
kommuniszt < r. comunist ’Kommunist’, komuna < r. comună ’Dorf, Gemeinde’, lokotinent<br />
< r. locotenent, locotinent ’Oberleutnant’, mitraliér < r. mitralieră ’Maschinengewehr’, obligál<br />
< r. obliga ’verpflichten, zwingen’, oficer < r. ofiŃer ’Offizier’, ordin < r. ordin ’Verordnung,<br />
Befehl’, presedinte < r. preşedinte ’Vorsitzender’, primár < r. primar ’Dorfrichter, Bürgermeister’,<br />
prizonier < r. prizonier ’Kriegsgefangener’, rezsiment, redzsiment < r. regiment<br />
’Regiment’, sintura, csintura, csentura < r. centură ’Leibgürtel’, szervics < r. serviciu<br />
’Anstellung, Dienst’, szpitál < r. spital ’Krankenhaus’, unitáte < r. unitate ’Einheit’, votál<br />
< r. a vota ’Stimme abgeben’<br />
2. Der Mensch (Verwandtschaftliche Beziehungen, Gesellschaftliche Stellung,<br />
Berufsbezeichnungen, Völkernamen, Tätigkeiten):<br />
basu < r. baciu ’Vetter, alter Mann’, boér < r. boier ’Bojar, Gutsherr’, foloszil < r. a folosi<br />
’benutzen’, italián < r. italian ’Italiener’, máme < r. mamă ’Mutter’, mutál < r. a muta ’etwas<br />
wegrücken’, a se muta ’über-siedeln’, nekezsál < r. a se necăji ’sich sorgen um etw.’, nyirásza<br />
173
. mireasă, moldv. n’ireasă ’Braut’, nyirel < r. mire, dial.: mold. n’ire, Ableitung mit<br />
Diminutivsuffix: mirel, mold. n’irel ’Bräutigam’, povesztil < r. a povesti ’erzählen’, primil<br />
< r. a primi ’bekommen, erhalten’, redzse, redzsuj < r. rege ’König’, serkál, cserkál < r. a cerca<br />
’probieren’, szofér < r. şofer ’Chauffeur’, táte < r. tată ’Vater’,<br />
3. Handel, Verkehr, Industrie:<br />
ávere < r. avere ’Vermögen’, avion < r. avion ’Flugzeug’, fábrika < r. fabrică ’Fabrik’, linia<br />
< r. linie ’Linie, Bahnlinie’, -a Definitartikel, masina < r. maşină ’Maschine’, para ’Geld,<br />
Kleingeld’ < r. para ’alte rumänische Münzeinheit, heute: Heller, Groschen’, susé, susáva < r.<br />
şosea ’Landstraße’, trén < r. tren ’Zug’<br />
4. Landwirtschaft und Futterzubereitung:<br />
cuál < r. nyj-i Ńuhal ’großer Getreidesack’, köruca < r. căruŃă ’Wagen, Fuhrwerk’, kóta < r. cotă<br />
’Quote (bei Naturalien)’, puj ’Mais’ < r. dial.: mold. pui (de popuşoi) ’Maisschößling (wortwörtl.<br />
„Schößling des Maises”, rúd ’Feldmaß’ < r. rudă, mold. rud ’Stange, Deichsel; altes Ackermaß’<br />
5. Haus und Umgebung:<br />
bukateria < r. bucătărie ’Küche’, ográda < r. ogradă ’Hof’, szóba < r. sobă ’Ofen’<br />
6. Kleidung, Tracht:<br />
icár < r. iŃar ’Bauernhosen aus weißem Wollgewebe’, katrinca < r. catrinŃă ’Rockschürze der<br />
Bäuerinnen’, pantallon < r. pantaloni pl. ’Hose’<br />
7. Nahrung:<br />
pitán ’Maisbrot (manchmal auch mit etw. Weizenmehl); Maiskuchen<br />
8. Viehzucht (Schafzucht):<br />
csobán < r. cioban ’Schafhirt’<br />
9. Gemischtes:<br />
bre < r. bre ’he!’, dor < r. doar ’nur, bloß’, gátá < r. gata ’fertig’, gye lok, delok < r. de loc<br />
’überhaupt nicht’, gyetot < r. de tot ’ganz, komplett’, háj < r. hai ’los! komm!’, khiár, tyjár<br />
< r. chiar ’eben, gerade’, komplekt, komplet < r. complect ’vollständig’, kort < r. cort ’Zelt’,<br />
máj < r. mai ’noch’, nekáz < r. necaz ’Verdruss, Sorge, Betrübnis, Krankheit’, revolucie<br />
< r. revoluŃie ’Revolution’<br />
174
2.8. Verteilung der rumänischen Lehnwörter nach Sachgruppen<br />
Die Verteilung der rumänischen Lehnwörter nach Sachgruppen zeigen folgende Tabellen:<br />
Nördlicher Tschango-Dialekt<br />
1. Gemeinschaft 31, 58 % (84)<br />
2. Der Mensch 20, 30 % (54)<br />
3. Handel, Verkehr, Industrie 8, 65 % (23)<br />
4. Kleidung, Tracht 4, 14 % (11)<br />
5. Landwirtschaft und Futterzubereitung 3, 76 % (10)<br />
Natur 3, 76 % (10)<br />
Geistiges Leben 3, 76 % (10)<br />
6. Haus und Umgebung 2, 63 % (7)<br />
7. Viehzucht 1, 88 % (5)<br />
8. Nahrung 1, 50 % (4)<br />
9. Volksarbeit 0, 75 % (2)<br />
10. Dorf/Stadt und Umgebung 0, 38 % (1)<br />
Südlicher Tschango-Dialekt<br />
Gemischtes: 16, 91 % (45)<br />
1. Gemeinschaft 30, 21 % (113)<br />
2. Der Mensch 16, 84 % (63)<br />
3. Handel, Verkehr, Industrie 7, 22 % (27)<br />
4. Nahrung 6, 95 % (26)<br />
5. Haus und Umgebung 6, 15 % (23)<br />
6. Kleidung, Tracht 4, 28 % (16)<br />
Landwirtschaft und Futterzubereitung 4, 28 % (16)<br />
7. Natur 3, 48 % (13)<br />
Geistiges Leben 3, 48 % (13)<br />
8. Viehzucht 1, 60 % (6)<br />
9. Volksarbeit 1, 34 % (5)<br />
10. Dorf/Stadt und Umgebung 0, 80 % (3)<br />
Székler Tschango-Dialekt<br />
Gemischtes: 13, 37 % (50)<br />
1. Gemeinschaft 32, 78 % (139)<br />
2. Der Mensch 16, 51 % (70)<br />
3. Handel, Verkehr, Industrie 7, 55 % (32)<br />
4. Haus und Umgebung 5, 90 % (25)<br />
5. Landwirtschaft und Futterzubereitung 5, 42 % (23)<br />
6. Nahrung 4, 25 % (18)<br />
7. Geistiges Leben 3, 77 % (16)<br />
8. Kleidung, Tracht 3, 30 % (14)<br />
Natur 3, 30 % (14)<br />
9. Volksarbeit 2, 36 % (10)<br />
10. Dorf/Stadt und Umgebung 1, 89 % (8)<br />
11. Viehzucht 0, 94 % (4)<br />
Gemischtes: 12, 03 % (51)<br />
175
Gemeinsamer Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte<br />
1. Gemeinschaft 34, 67 % (26)<br />
2. Der Mensch 20, 00 % (15)<br />
3. Handel, Verkehr, Industrie 10, 67 % (8)<br />
4. Landwirtschaft und Futterzubereitung 6, 67 % (5)<br />
5. Haus und Umgebung 4, 00 % (3)<br />
Kleidung, Tracht 4, 00 % (3)<br />
6. Nahrung 1, 33 % (1)<br />
Viehzucht 1, 33 % (1)<br />
Gemischtes: 17, 33% (13)<br />
Der überwiegende Teil – genauer gesagt über ein Drittel – der rumänischen Lehnwörter kann in<br />
allen 3 Tschango-Dialekten dem Themenbereich des „modernen Lebens” zugeordnet werden;<br />
dieser Anteil beträgt bei den Nord-Tschangos 40, 23 %, den Süd-Tschangos 37, 43 % und den<br />
Székler-Tschangos 40, 33 %; im gemeinsamen Tschango-Lehnwortschatz beträgt er 45, 34 %.<br />
Zum Themenbereich des „modernen Lebens” zählen die Sachgruppen der Öffentlichen Sphäre<br />
(Verwaltung und Recht bzw. Staat und Organisationen), des religiösen Lebens und des Militärwesens,<br />
die unter dem Oberbegriff „Gemeinschaftliches Leben” zusammengefasst worden sind,<br />
sowie die Sachgruppe „Handel, Verkehr, Industrie.<br />
Im gemeinsamen Tschango-Lehnwortschatz lassen sich innerhalb der wichtigsten Sachgruppe –<br />
der des gemeinschaftlichen Lebens – 38, 46 % dem Bereich der öffentlichen Sphäre zuordnen,<br />
wobei 15, 38 % den Teilbereich „Verwaltung und Recht”, 23, 08 % den Teilbereich „Staat und<br />
Organisationen” ausmachen; Auf die Sachguppe „Religion und Kirche” entfallen 3, 85 %, auf die<br />
Sachgruppe „Militär” 57, 69 %.<br />
Der Umstand, dass „sich im Tschango-Dialekt relativ viele Lehnwörter aus dem Bereich Technik,<br />
Administration, Soldatenleben finden, sagt relativ wenig über den Stärkegrad der rumänischen<br />
Sprache aus, [da] die Wörter dieser Art teilweise auch in der ungarischen Standardsprache<br />
entweder aus der Zeit der Spracherneuerung stammen, oder aber Internationalismen sind, d.h. zu<br />
solch einer relativ späten Wortschatzschicht gehören, die – aufgrund des fehlenden Kontaktes mit<br />
der ungarischen Standardsprache – nicht in den Tschango-Dialekt gelangen konnte. Gerade aus<br />
diesem Grund wurden und werden auch heute noch die entsprechenden standardsprachlichen<br />
rumänischen Wörter fast automatisch zu Bestandteilen des Wortschatzes des Tschango-Dialektes.”<br />
(Márton 1972: 27)<br />
Schon Aladár Ballagi (1888 ! : 27, zitiert in Márton 1972: 15) fiel auf, dass die Tschangos<br />
176
– beinah ausnahmslos – rumänische Wörter für die Sachgruppen der Technik und der öffentlichen<br />
Einrichtungen verwenden. „Das Moldauer Ungartum bezeichnet vasút als trinó ’Zug’,<br />
pályaudvar als gára ’Bahnhof’, gızös als vápor ’Dampfer’ ”.<br />
Benı bezeichnet es als „Gesetzmäßigkeit, dass die in der Minderheit lebenden ethnischen Gemeinschaften<br />
aus der Sprache der sich in der Mehrheit befindlichen, staatsbildenden Nation die<br />
Wörter entlehnt, die sich auf die Staatsorganisation, die Verwaltung beziehen. (…) diese Lehnwortschicht<br />
lässt sich im Sprachgebrauch der [in der Minderheit lebenden] ungarischen Gemeinschaften<br />
nachweisen. Da die alleinige Amtssprache die Sprache der Mehrheitsnation ist, sind<br />
zahlreiche Informationen für die ethnischen Minderheiten nur in dieser Sprache verfügbar<br />
(Benı 2003b: 55). So ist es auch kein Wunder, dass eine der wichtigsten Lehnwortschichten der<br />
regionalen ungarischen Umgangssprache Rumäniens aus der rumänischen Amts- und Verwaltungssprache<br />
stammt (siehe Benı 2003a: 169). Auf diese Schicht soll deshalb im folgenden näher<br />
eingegangen werden.<br />
Attila Benı (2003a: 169-172, 2003b: 53-70) macht auf die Rolle der Visualität bei Entlehnungen<br />
aufmerksam, die am deutlichsten gerade in der Sachgruppe „Verwaltung” zum Ausdruck kommt.<br />
Benı (2003b: 53) erklärt den Umstand, dass über 80 % der Informationen auf visuellem Wege erreichbar sind, nicht<br />
nur mit dem modernen Kommunikationszeitalter, sondern auch damit, dass das Auge bei der Informationsaufnahme<br />
im allgemeinen eine größere Rolle spielt als die anderen Sinnesorgane.<br />
„Das sichtbare sprachliche Zeichen (...) bleibt leichter im Gedächtnis haften und lässt sich auch leichter hervorrufen,<br />
da allgemein bekannt ist, dass die Information umso eher im Gedächtnis verbleibt, je mehr Sinnesorgane sie vermitteln”<br />
(Benı 2003a: 171)..<br />
Benı betrachtet die Visualität dabei als einen Faktor, der die Motivation zur Übernahme eines<br />
sprachlichen Elementes verstärkt. So ist er sich im Klaren, dass „die voneinander abweichenden<br />
Staats- und Verwaltungsstrukturen, die sprachlichen und kulturellen Unterschiede eine entscheidende<br />
Rolle dabei spielen, was entlehnt wird, und was nicht. Darüber hinaus legitimiert aber der<br />
starke manipulative Einfluss des visuellen sprachlichen Zeichens auch solche Bezeichnungstendenzen,<br />
(...) deren Gebrauch für den in einer einsprachigen Gemeinschaft lebenden Sprecher ansonsten<br />
keine Probleme bereitet. Die Verbindung des Objekts mit seiner Bezeichnung (wie im<br />
Falle von amtlichen Dokumenten) ruft fortwährend diesen Benennungszwang hervor” (Benı<br />
2003a: 172). Nach Benı (2003b: 54) bilden die Entlehnungen aus der Amts- und<br />
Verwaltungssprache die wichtigste Lehnwortgruppe, die mit dem Visualitätsfaktor in<br />
Verbindung gebracht werden kann. Im Wortschatz der Gazda-Informanten finden sich folgende<br />
Lehnwörter aus diesem Bereich:<br />
177
a.) Offizielle Benennungen der amtlichen Dokumente<br />
áprobáre (S) < r. aprobare ’Genehmigung; Billigung’, buletin (S) < r. buletin ’Personalausweis’,<br />
deklarácé (Sz) < r. declaraŃie ’Erklärung, Deklaration’, fisa (Sz) < r. fişă ’Blankett,<br />
Evidenzzettel’, komisszon (S) < r. comision ’Vollmacht’, kontrákt (S, Sz) < r. contract<br />
’Vertrag’, ledzsea (N, Sz) < r. lege ’Gesetz’, ordin (S) < r. ordin ’Verordnung’, pasaport (Sz)<br />
< r. paşaport ’Reise-pass’, serere (N) < r. cerere ’Gesuch’<br />
In diesen Fällen zeigt sich der Einfluss der Visualität darin, dass die Benennung der Gattung des<br />
amtlichen Dokumentes gewöhnlich an hervorgehobener Stelle und gesondert gekennzeichnet erscheint.<br />
b.) Benennungen, die sich auf die in den amtlichen Dokumenten genannten Verfahrensweisen<br />
beziehen<br />
akhitál (S) < r. a se achita ’begleichen, bezahlen’, anuncál (N, S) < r. a anunŃa ’(an)melden;<br />
benachrichtigen’, aprobál (Sz) < r. aproba ’billigen’, deklarál (N) < r. a declara ’(Daten)<br />
angeben, anmelden, deklarieren’, dekretál (Sz) < r. a decreta ’verordnen; verhängen’, detasál<br />
(Sz) < r. a detaşa ’versetzen; verlegen’, iszkölil < r. iscăli ’unterschreiben’, kompletál (N)<br />
< r. a completa ’ausfüllen’, kondemnál (Sz) < r. a condamna ’verurteilen’, konfiszkál (S)<br />
< r. a confisca ’beschlagnahmen’, ószengyil (S) < r. a osândi ’verurteilen’, szemnál (N)<br />
< r. a semna ’unterschreiben’, votál < r. a vota ’Stimme abgeben’, zsudekál (S) < r. a judeca<br />
’Recht sprechen’<br />
c.) Benennungen für Berufe des öffentlichen Dienstes<br />
direktor (S) < r. director ’Direktor’, notár (S, Sz) < r. notar ’Notar’, primár < r. primar<br />
’Dorfrichter, Bürgermeister’, presedinte < r. preşedinte ’Vorsitzender’, szekretár (N)<br />
< r. secretar ’Sekretär’<br />
Diese Titel erscheinen nicht nur in den Dokumenten selbst, sondern sind auch an den Bürotüren<br />
angebracht.<br />
2.9. Verteilung der rumänischen Lehnwörter nach Wortarten<br />
Die Verteilung der im Gazda-Material vorkommenden Lehnwörter nach Wortarten ergibt<br />
folgendes Bild:<br />
Nördlicher Tschango-Dialekt<br />
1. Substantiv 78, 2 % (208)<br />
2. Verb 12, 03 % (32)<br />
3. Adverb 5, 26 % (14)<br />
4. Adjektiv 1, 88 % (5)<br />
5. Konjunktion 1, 13 % (3)<br />
Interjektion 1, 13 % (3)<br />
6. Pronomen 0, 37 % (1)<br />
178
Südlicher Tschango-Dialekt<br />
1. Substantiv 80, 48 % (301)<br />
2. Verb 11, 76 % (44)<br />
3. Adverb 4, 55 % (17)<br />
4. Adjektiv 2, 41 % (9)<br />
5. Interjektion 0, 8 % (3)<br />
Székler Tschango-Dialekt<br />
1. Substantiv 84, 91 % (360)<br />
2. Verb 9, 91 % (42)<br />
3. Adjektiv 2, 12 % (9)<br />
4. Adverb 1, 89 % (8)<br />
5. Interjektion 0, 94 % (4)<br />
6. Konjunktion 0, 23 % (1)<br />
Gemeinsamer Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte<br />
1. Substantiv 74, 67 % (56)<br />
2. Verb 13, 33 % (10)<br />
3. Adverb 9, 33 % (7)<br />
4. Interjektion 2, 67 % (2)<br />
Das oben dargestellte Zahlenmaterial zeigt eines der Gesetzmäßigkeiten des Entlehnungsprozesses:<br />
„Aus der wichtigen Rolle, die das Motiv der sprachlichen Bedarfsdeckung (referentielle<br />
Funktion der Sprache) spielt, ergibt sich die Tatsache von selbst, daß überwiegend Substantive<br />
entlehnt werden: neue Namen für neue Sachen aller Art, einschließlich neuer Begriffsbildungen;<br />
und ferner, daß Inhaltswörter leichter entlehnt werden als Funktionswörter (...)” (Bechert/Wildgen<br />
1991: 77). Der prozentuale Anteil der in den Äußerungen der Gazda-Informanten vorkommenden<br />
Substantive rumänischen Ursprungs beträgt im nördlicher Tschango-Dialekt 78, 2 %, im<br />
südlichen Tschango-Dialekt 80, 48 % und im Székler Tschango-Dialekt 84, 91 %; im gemeinsamen<br />
Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte macht er 74, 67 % aus.<br />
Márton (1972: 28) verweist darauf, dass „Pronomen, Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen<br />
nur bei starkem und langandauerndem Sprachkontakt [in das System der entlehnenden Sprache]<br />
gelangen“. In den Äußerungen der Gazda-Informanten wird dieser Umstand insbesondere an<br />
dem relativ hohen Anteil der Adverbien deutlich, der im gemeinsamen Lehnwortschatz der 3<br />
Tschango-Dialekte 9, 33 %, im nördlichen Tschango-Dialekt 5, 26 % und im südlichen<br />
Tschango-Dialekt 4, 55 % beträgt; der geringste Anteil findet sich mit 1, 89 % im Székler<br />
Tschango-Dialekt. Auch Konjunktionen und Interjektionen lassen sich nachweisen.<br />
179
Unter den rumänischen Lehnwörtern der ungarischen Mundarten in Siebenbürgen dagegen finden<br />
sich kaum Funktionswörter. (vgl. Benı 2004: 26)<br />
Im Gazda-Korpus kommen folgende Funktionswörter vor:<br />
1.) Adverbien:<br />
adikö (N, S) < r. adică ’das heißt, also’, dor < r. doar ’nur, bloß’, gátá < r. gata ’fertig’, defel (S)<br />
< r. de fel ’überhaupt nicht’, delok, gye lok< r. de loc ’überhaupt nicht’, entüj (S) < r. întâi<br />
’zuerst’, gyetot < r. de tot ’ganz, komplett’, kám (N, Sz) < r. cam ’ein bisschen, etwa, zirka’,<br />
khiár, tyjár < r. chiar ’eben, gerade’, komplekt, komplet < r. complect ’vollständig’, kontra (N)<br />
< r. contra ’dagegen’, máj < r. mai ’noch’, mult (S) < r. mult ’viel’, párkö (S) < r. parcă ’als ob,<br />
vielleicht’, perfekt (Sz) < r. perfect ’perfekt, vollkommen’, permanent (S) < r. permanent<br />
’ständig’, poate (N, S) < r. poate ’vielleicht’, szigur (N, S) < r. sigur ’sicher, natürlich’<br />
2.) Konjunktionen:<br />
dákö (N) < r. dacă ’wenn; ob’, ke, kö (N, Sz) < r. că ’weil’, or (N) < r. ori ’oder’<br />
3.) Pronomen:<br />
fiekare (N) < r. fiecare Pronomen ’jede(r, -s)’<br />
4.) Interjektionen:<br />
bre < r. bre ’he!’, gye (Sz) < r. de ’eben; ja; allerdings’, háj < r. hai ’los! komm!’, hájde (S)<br />
< r. haide ’los! komm!, vaj, váj (N, Sz) < r. vai ’o weh!’<br />
3. Indirekte/Mittelbare Entlehnungen<br />
3.1. Terminologische Fragen<br />
Lanstyáks indirekte bzw. mittelbare Entlehnungen (siehe Lanstyák 2000: 195, 2006: 21-22) entsprechen<br />
terminologisch den semantischen Entlehnungen, deren unterschiedliche Ausprägungen<br />
unter dem Oberbegriff „Lehnprägung” zusammengefasst werden, der von Hadumod Bußmann<br />
(1990: 444) als „Vorgang und Ergebnis der Nachbildung eines fremdsprachlichen Inhalts mit den<br />
Mitteln der Muttersprache” definiert wird. Innerhalb der Lehnprägungen unterscheidet man<br />
zwischen den Lehnbedeutungen und Lehnbildungen. Bußmann (1990: 443) definiert ’Lehnbedeutung’<br />
als „Bedeutung, die ein Wort unter fremdsprachlichem Einfluß annimmt, wodurch<br />
eine Umdeutung der ursprünglichen Bedeutung bzw. eine Bedeutungserweiterung stattfindet”,<br />
180
’Lehnbildung’ als „Vorgang und Ergebnis der Neubildung von Wörtern unter fremdem Spracheinfluß,<br />
[wobei] im Hinblick auf die größere oder geringere formale Abhängigkeit der Lehnbildung<br />
von ihrem Vorbild zwischen Lehnübersetzung, -übertragung und -schöpfung unterschieden<br />
wird” (Bußmann 1990: ebd.). Im Material Gazdas finden sich neben Bedeutungsentlehnungen<br />
und Lehnübersetzungen auch sog. Lehnverbindungen, die „durch den unmittelbaren Transfer<br />
(Übernahme) eines Gliedes und die Lehnübersetzung eines anderen gekennzeichnet sind” (Csaba<br />
Földes 1996: 22).<br />
Lanstyák (2002: 80-81) unterscheidet in seiner kontaktlinguistischen Terminologie zwischen<br />
absoluten und relativen Kontaktphänomenen. ’Absolute Kontaktphänomene’ bestimmt er als<br />
„solche Kontaktphänonene, die in den Diskursen der einsprachigen Sprecher der Nehmersprache<br />
bzw. in den einsprachigen Varietäten der Nehmersprache [wie z.B. der Standardsprache] nicht<br />
vorkommen.“ (Lanstyák 2002: 81). Diese absoluten Kontaktphänome werden von Lanstyák<br />
(2002: 80) auch als „Kontaktphänomene im engeren Sinn“ bezeichnet.<br />
’Relative Kontaktphänomene’ bzw. ’Kontaktphänomene im weiteren Sinn’ definiert Lanstyák<br />
(2002: 80) dagegen als „dasjenige Element bzw. diejenige Reihe von sprachlichen Elementen in<br />
den Diskursen der Nehmersprache (...), die in ihrer Lautgestalt und/oder in ihrer Bedeutungsstruktur,<br />
und/oder ihrer Zusammensetzung eher den Äquivalenten der Gebersprache ähneln; auch<br />
dann, wenn diese Ähnlichkeit in den einsprachigen Varietäten [beider] betroffenen Sprachen<br />
vorhanden ist. Bei Kontaktphänomenen dieser Art manifestiert sich die Wirkung des Sprachkontakts<br />
in Häufigkeitsunterschieden und kommt nur dann zum Tragen, wenn (...) die Sprecher<br />
der Nehmersprache darüber hinaus über alternative Ausdrucksmittel verfügen.”<br />
Demzufolge kann man auch innerhalb der Lehnbedeutungen zwischen den ’absoluten Lehnbedeutungen<br />
bzw. Lehnbedeutungen im engeren Sinn’ und ’relativen Lehnbedeutungen bzw.<br />
Lehnbedeutungen im weiteren Sinn’ unterscheiden.<br />
- Die Bedeutungen der unter dem Kapitel ’Absolute Lehnbedeutungen’ angeführten Belege<br />
lassen sich ausschließlich auf den Einfluss der rumänischen Sprache zurückführen; sie sind weder<br />
in den einsprachigen Varietäten des Ungarischen – wie der Standardsprache – bekannt, noch kann<br />
man bei ihrer Analyse auf archaische Formen verweisen.<br />
- Die Bedeutungen der Belege im Kapitel ’Relative Lehnbedeutungen’ wiederum sind zwar in<br />
den einsprachigen Varietäten des Ungarischen bekannt, doch werden sie in diesen entweder<br />
weitaus seltener oder aber neben weiteren alternativen Ausdrucksmöglichkeiten gebraucht, die<br />
die zweisprachigen Sprecher der Kontaktvarietät kaum verwenden.<br />
181
Auf diese indirekten bzw. mittelbaren Entlehnungen, die in den Auflistungen jeweils durch Fettdruck<br />
erkenntlich gemacht worden sind, soll nun im folgenden näher eingegangen werden – u.a.<br />
auch deshalb, weil, wie Péntek (2001: 16, 22-23) betont, in der Forschungsliteratur über den<br />
rumänisch-ungarischen Sprachkontakt den Lehnübersetzungen und Bedeutungsentlehnungen<br />
kaum Beachtung geschenkt wurde.<br />
3.2. Lehnbedeutungen<br />
3.2.1. Absolute Lehnbedeutungen/Lehnbedeutungen im engeren Sinn<br />
Die im Gazda-Korpus vorkommenden absoluten Lehnbedeutungen werden alphabetisch – nach<br />
Wortarten getrennt – aufgelistet. Die sprachlichen Belege werden hierbei nach der Herkunftsregion<br />
und dem Geburtsdatum des jeweiligen Informanten geordnet:<br />
diák ’Kirchensänger’<br />
A páter latinul mondta a misét. (...) De a deák magyarul énekelt. (S; PJ, geb. 1892)<br />
Pedig ı kántor vót, diák, de úgysze vót pénze neki szem. (S; KA, geb. 1912)<br />
Édeszapám vót a kaszier, deák vót, ı vitte, kapta a pénzt! Új templomot építettek! (...) Édeszapám<br />
deák kántor vót, ı olvaszott tiszta magyarul. (S; KA, geb. 1912)<br />
A deák ott imádkozott az asztalnál, elıbb isz, utolján isz. İ búcsúztatta. Akkor eszte ment oda a<br />
deák, sz búcsúztatta el. (S; KA, geb. 1912)<br />
Visznek gyortyát oda, oda a keresztekhez. (...) A páter osztán elossza. Ad a harangazónak esz, a<br />
gyiáknak esz ad, sz neki esz kell kicsi. (S; KA, geb. 1912)<br />
Vót egy deák, Frünku, úgy hívták, azt elhívták deákot, elhívták, s az megtanitotta a papot<br />
imádkozni magyarul, misézzék es. (Sz; SF, geb. 1915)<br />
Akkor magyarul énekeltek mindent-mindent. Diák mondta magyarul, s plébános mondta latinul.<br />
(Sz; IA, geb. 1911)<br />
A diák énekel, mondikál a zúton, a népség mondikálja azt, hogy búcsúval menen. A diák vót a<br />
zelsı, a vezetı, a többiek utána. (Sz; BPR, geb. 1914)<br />
182
Die Bedeutung ’Kirchensänger’ des Wortes diák findet sich nicht in den einsprachigen Varietäten<br />
des Ungarischen, das „Etymologische Wörterbuch des Ungarischen” gibt ’Schüler’ als hochsprachliche,<br />
allgemein gebrauchte Bedeutung an. Diese Bedeutungsunterschiede finden sich auch<br />
im Wörterbuch Wichmanns: Der Beleg aus dem nördlichen Tschango-Dialekt dyiák weist die<br />
Bedeutungsangabe ’Vorsänger, Kantor’auf, die Bedeutungen des Beleges aus Hétfalu dagegen<br />
stimmen mit denen der ungarischen Standardsprache überein: dyák ’Schüler, Gymnasiast’<br />
Interessant ist auch, dass – während die Bedeutung ’Kirchensänger’ auf den Einfluss der<br />
rumänischen Sprache zurückzuführen ist (vgl. rum diac ’Kirchensänger’ (dial.); ’Schreiber,<br />
Schriftkundiger, Lateiner’ (veraltet);’Schüler, Student’) – , die zuletzt genannten Bedeutungen<br />
des rumänischen Wortes diac ungarischen Ursprungs sind (siehe Tamás, UngElRum.).<br />
verekedés ’Krieg’<br />
Eljöttek a magyarok, saptak egy verekedészt, háborút bulgárokval, sz úgy jöttek errefelé<br />
zÁrpádval, úgy jöttek errefelé, felfelé a Prut mentén. (N; SzP, geb. 1918)<br />
Járt tátá verekedészbe, gyet vót la Plevna, sz azután mász esztendıbe vót ez a mász verekedész.<br />
(N; DDR, geb. 1924)<br />
Az ipam nekem vót a fronton, verekedészbe, Odeszánál. (N; KJ, geb. 1932)<br />
Tátánk odamaradt verekedészbe, 16-ba. (...) Ottmaradt a verekedészbe. (S; FJ, geb. 1904)<br />
Nem mi csántuk a verekedészt, a háborút! (S; DJ, geb. 1911)<br />
Nagy verekedész vót, nagy! 13-ba vót egy verekedész Bulgáréba. (S; KFB, geb. 1921)<br />
Azok verekedészt nem csináltak, csak örökké futkároztak. (S; BLX, geb. 1929)<br />
Nem mentek az úton, még el se kezdıdött, még nem es tudtuk, hogy verekedés van.<br />
(Sz; CsGy, geb. 1902)<br />
Akkor mondta: Moszt jövök a verekedészbıl, ha megszeret úgy, ahogy vagyok, eljı utánam, e<br />
vagyok! (...) Met – asszongya – én verekedészbıl jövök. (Sz; GIK, geb. 1923)<br />
Csak három esztendıvel hamarább vót a verekedés. (Sz; CsBK, geb. 1930)<br />
Komán János áva vót, a zapja a verekedésbe meg vót halva, s tıle elvették mind.<br />
(Sz; IGy, geb. 1948)<br />
Édesapám akkor jött vót haza a verekedésbıl, Ruszébıl, ı három esztendıt vót prizonér.<br />
(Sz; TDR, geb. 1950)<br />
183
In den einsprachigen Varietäten des Ungarischen ist das Wort verekedés unter der Bedeutung<br />
’Schlägerei’ bekannt. Im Moldauer Tschango-Dialekt findet sich die Bedeutung ’Krieg’, die<br />
sich auf den Einfluss des rumänischen Wortes bătaie zurückführen lässt, das dialektal in den<br />
Bedeutungen ’Schlägerei’ bzw. ’Krieg, Kampf’ bekannt ist.<br />
világ ’Menge, Vielheit, Leute’<br />
Sz akkor a világ futott keresztül ide, si s-a stabilit. (N; MaGy, geb. 1912)<br />
A gorniszt a goárnával szedte a világot. (...) Világ kiment, hogy gyújtszák meg a zudvarokat.<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
Szok a világ Szabófalába. (N; BM, geb. 1930)<br />
Keresztekvel mennen elül, utánna mennek a popok, menen világ hátul, sz ínekelnek.<br />
(N; BVV, geb. 1932)<br />
Nagy, nagy tüzet csántak, rakták kereken, csuprokkal, egy-egy húsz csuprot raktak kereken,<br />
megebédelt világ akkor, szokan, szokan. (S; KA, geb. 1912)<br />
Annyi világ vót leesve, hogy mentél, mentem bé patakba, hol igyam, annyi világ vót, hogy<br />
vesztünk el. (S; KA, geb. 1912)<br />
Vót egy páter, prédikált. (...) Vót a feje felett egy madárka, az rebegett, rebegett, mind nézte a<br />
világ. (...) De szok világ vót! (S; KA, geb. 1912)<br />
Visszavittek la post primul ajutor. (...) Annyi világ, jaj, Isztenem! Annyi világ. (S; KA, geb. 1912)<br />
Ott sok világ vót, úgy jártak, a hintó mellett, mint a hangyaboly. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
Mikor szántani kezdték, nálunk kiállott egy, s rikoltotta: zegész világ menjen le a Fekete ágokba.<br />
(...) Akkor oda nálunk es kiállott egy a hegytetıre, s kiabált: A zegész világ menjen el Pojánába,<br />
met a kümpeniek foglalják el Pojánát. (Sz; EJ, geb. 1922)<br />
Biztatnak, hogy erıltessük mi es a világot, hogy íródjanak be. (Sz; TGy, geb. 1932)<br />
Mikor eltıtt a verekedés, kitemette világ, elvitték a templomba, s bétették a temetıbe (...) Jı a sok<br />
világ este, gyülnek essze, s imádkoznak. (Sz; AAK, geb. 1934)<br />
De akkor kicsi vót, kicsi ember, világ vót sok, de parát nem adtak. (Sz; TGyX, geb. 1935)<br />
Die standardsprachliche Bedeutung des Wortes világ ist ’Welt, Licht, Menschheit’.<br />
184
Die im Moldauer Tschango-Dialekt vorkommenden Bedeutungen ’Leute; Vielheit, Menge’ sind<br />
unter dem Einfluss der rumänischen Sprache entstanden, vgl. rum. lume ’Welt; Leute’.<br />
Auch im Wörterbuch von Yrjö Wichmann findet sich ein Beispielsatz, an dem die Bedeutungsentlehnung<br />
deutlich wird:<br />
szok világ ólt e misziébe „es war viel Publikum in der Kirche”<br />
elfogy ’enden’<br />
A háború elfogyott 18-ba, ıszvel. Megkezdıdött 16-ba, sz elfogyott 18-ba. (N; MP, geb. 1919)<br />
In der ungarischen Standardsprache ist elfogy unter der Bedeutung ’ausgehen, verbraucht werden’<br />
bekannt; die Bedeutung ’enden’ ergibt sich aus dem rum. a se termina ’ausgehen, verbraucht<br />
werden; enden’.<br />
húz ’schießen’<br />
Jı vala bukötára hozzánk, hoz vala ebédet a frontra. Sze nem lehet vala jöjjön bukötára oda, a<br />
zorosz húz vala oda, lı vala, tér vala meg bukötár, sz mik nem még eszünk vala.<br />
(N; PoA, geb. 1908)<br />
Met mük húztunk húsz kilometrut messze tüzérekvel. (N; BuP, geb. 1919)<br />
Regvel, mikor lássza a zobszervator a zoroszoknál a mozgászt, fogunk vala húzni a tüzérekvel.<br />
(N; BuP, geb. 1919)<br />
Húztak, húztak, sz verték ıköt, ne máj jöjjön már koloána sz erıszítszék meg.<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
Die Bedeutung von húz ist in der Literatursprache des Ungarischen ’ziehen’. Die Bedeutung<br />
’schießen’ stammt aus dem Rumänischen: vgl. rum. a trage ’ziehen; schießen’<br />
185
nı ’aufziehen, erziehen; züchten’<br />
Mük dolgoztunk, marhákat nıtettünk, lovakot adtunk vala. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Nıttem a gyermekeimet, s sak a zIsten tudja, hogy nıtettem. (N; BKM, geb. 1913)<br />
Felnıtettük az ötöt, nem vót nekáz velük. (N; BM, geb. 1930)<br />
Die hochsprachliche, allgemein gebrauchte Bedeutung von nı ist ’wachsen, zunehmen’.<br />
Die Bedeutung ’aufziehen, erziehen; züchten’ stammt aus rum. a creşte ’wachsen; aufziehen,<br />
großziehen, erziehen; züchten’.<br />
tisztel ’bewirten’<br />
Bévittünk egy fél galeáta vagy egy galeáta bort, fogtuk tisztelni a legényeket.<br />
(S; CsBM, geb. 1919)<br />
In den einsprachigen Varietäten des Ungarischen ist die Bedeutung ’bewirten’ des Wortes tisztel<br />
nicht bekannt; in der ungarischen Standardsprache ist die Bedeutung ’(ver)ehren’ gebräuchlich.<br />
Auch hier kann auf den Einfluss der rumänischen Sprache verwiesen werden: siehe rum. a cinsti<br />
’ehren; spendieren, eine Runde bezahlen; bewirten’. Schon im Wörterbuch Wichmanns ist<br />
diese Bedeutungsentlehnung belegt:<br />
mek-tisztel ’mit Wein, Bier oder Branntwein bewirten’<br />
tisztelıdik ’(Wein, Bier, Branntwein) trinken, pokulieren’<br />
ül ’wohnen’<br />
Ült itt szok esztendıt, de nem akart beszílni, nem akart beszílgetni. (N; BKM, geb. 1913)<br />
S hogy ne fogják meg, hogy megöljék, elment cigányokhoz Curtánba, sz ott ült.<br />
(N; KJ, geb. 1932)<br />
Csináltunk egy nagy házat, hogy mi üljünk ketten. (S; KA, geb. 1912)<br />
Mi szélte ültünk, falu szélire, sz oda járogattak a tolvajok. (S; CsBM, geb. 1919)<br />
Ahol ül az ember, a házat es meg kell fizesd. (Sz; SF, geb. 1915)<br />
186
Itt vót, itt ült Pleska a faluba, itt vót párók a faluba. (...) Ült Bukarestbe is, de többire itt ült.<br />
(Sz; BCsM, geb. 1923)<br />
Ül a városon, s jı ide falura vásárolni, hogy innét valamit kapjon. (Sz; EJ, geb. 1922)<br />
In den einsprachigen Varietäten des Ungarischen kommt das Wort ül in der Bedeutung ’sitzen’<br />
vor. Die Bedeutung ’wohnen’ wurde aus dem Rumänischen entlehnt; vgl. rum. a şedea ’sitzen;<br />
’wohnen’. Diese Bedeutungsentlehnung lässt sich auch im Wörterbuch Wichmanns und einem<br />
aus dem Jahre 1860 stammenden Brief der Székler Tschangos aus Gorzafalva nachweisen:<br />
Wichmann-Belege (in vereinfachter Transkription):<br />
ül sitzen; sich irgendwo aufhalten, weilen; wohnen;<br />
ı ül e városba er wohnt in der Stadt; hól ül e lány? Wo weilt das Mädchen?<br />
e farkas ül e gyakorságba der Wolf wohnt im Dickicht<br />
Auszug aus dem Brief der Gläubigen aus Gorzafalva an den Fürstprimas János Scizovszky<br />
(Gorzafalva, 16. März 1860, zitiert in: Vincze 2004: 63):<br />
„(...) utoljára is olasz papok 9, 10 esztendeig ülnek, nem keresik templomainkat ékesiteni, azt hit<br />
diszire elébb emelni; nézik csak maguknak pénzt szerezni, aval 1000, 2000 aranyokkal hazájukban<br />
menni.“<br />
(meg)vastagít ’vermehren’<br />
Zutánd jöttek a fráncsézok, sz a zorosz isz megvasztagitta a zármatát, sz akkor viszraverték.<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
In der ungarischen Standardsprache ist das Wort (meg)vastagít in der Bedeutung ’verfestigen;<br />
verdicken’ bekannt. Die Bedeutung ’vermehren’ lässt sich auf das rumänische Wort a îngroşa<br />
’verfestigen; verdicken; vermehren’ zurückführen.<br />
187
Im engen Zusammenhang mit der oben genannten Bedeutungsentlehnung des Verbes (meg)vastagít<br />
steht auch das Adjektiv vastag in der Bedeutung ’der Großteil von etwas’:<br />
Sz akkor abból a táborból a vasztagabbja elment. Elmentek, sz bémentek Pannóniába, Magyarországra.<br />
Vasztagabbja, több. (N; SzP, geb. 1918)<br />
Im standardsprachlichen Ungarischen weist vastag die Bedeutung ’dick’auf; die Bedeutung ’der<br />
Großteil von etwas’ im Moldauer Tschango-Dialekt zeigt den Einfluss von rum. gros ’dick; der<br />
Großteil von etwas’.<br />
ver ’schießen’<br />
Osztán sántunk kertet elıfelé, tüzérek elıtt. Hogy ne lássza a zurusz, vannak tüzérek, mellikek<br />
verik őt. (N; BuP, geb. 1919)<br />
Osztán vertek a tunelekvel, sz ezekvel a brándokval vertek a mieink, hogy ne máj jöjjön ármáta!<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
Nehezen vették be Odesszát, két hétig örökké verték, éjjel-nappal. (S; KoÁ, geb. 1910)<br />
Oroszországban a vasutakat verték a repülıgépekvel. Megállott a vonat, úgy elfutkostunk ide,<br />
oda, többet nem bomberdáltak. (Sz; SF, geb. 1915)<br />
A németek vertek. Akkor kimentek a Fekete hegyre, s vertek onnan a Fekete hegyrıl.<br />
(Sz; BGyA, geb. 1921)<br />
Die standardsprachliche Bedeutung des Wortes ver ist ’schlagen’. Die Bedeutung ’schießen’ ist<br />
unter Einfluss des Rumänischen entstanden: vgl. rum. a bate ’schlagen; schießen’<br />
visz ’leben, es geht ihm...’<br />
Nehezen vittük! (N; PoA, geb. 1908)<br />
Ién vittem nehezen hat hónapot ott a fogszágba. (N; MP, geb. 1919)<br />
Magyarok szokkal jobban vitték, mint itt nálunk. (N; MP, geb. 1919)<br />
188
De jól viszik, jól élnek. (S; KA, geb. 1912)<br />
Nekünk sánt ebédet örökké. Vót isz mibıl, vitték jól. (S; KA, geb. 1912)<br />
Jól vittük, jól éltünk, vót mindenünk. (S; KA, geb. 1912)<br />
Szigorú nagyságával erıst jól vitte. (S; BBM, geb. 1921)<br />
Nehéz életet viszünk, de ha a Jóiszten adta, úgy élünk, mint lehet, úgy van, ahogy van.<br />
(S; PA, geb. 1915)<br />
A zéfiú élet. (...) Aki rosszul viszi éfián, vaj meghal hamarabb, vaj kihordja, így ne!<br />
(S; CsBM, geb. 1919)<br />
Mik nem vittük rosszul, met édesapámnak jó köve vót, jó ırlıje, ırölt, nekie vittek egy kicsi lisztet,<br />
kenyeret mit, vitt, kinek vót. (Sz; LHL, geb. 1920)<br />
In der ungarischen Literatursprache ist die Bedeutung ’tragen; bringen; führen’ des Wortes visz<br />
bekannt. Die Bedeutung ’leben, es geht ihm gut, oder schlecht’ wurde aus rum. a duce ’bringen;<br />
es geht ihm...’ entlehnt. (vgl. rum. el o duce bine, o duce rău)<br />
3.2.2. Relative Lehnbedeutungen/Lehnbedeutungen im weiteren Sinn<br />
Die Bedeutungen der untenstehenden Belege sind zwar auch in den einsprachigen Varietäten<br />
der ungarischen Sprache bekannt, doch werden die weiteren Bedeutungen dieser polysemen<br />
Wörter im Moldauer Tschango-Dialekt weitaus seltener oder gar nicht gebraucht.<br />
Im Moldauer Tschango-Dialekt kommt das Wort bír ausschließlich in der Bedeutung ’können’<br />
vor; in der ungarischen Standardsprache sind die Bedeutungen ’besitzen; haben; ertragen’ bekannt.<br />
Des Weiteren existieren für den Ausdruck der Potentialität im Standardungarischen alternative<br />
Bezeichnungsmöglichkeiten wie der Gebrauch der Suffixe -hat, -het oder des Verbums tud, die<br />
im Moldauer Tschango-Dialekt kaum verwendet werden.<br />
Das Verb bír wird im Moldauer Tschango-Dialekt ausschließlich als modales Hilsverb gebraucht,<br />
was auf den Einfluss von rum. a putea ‘können’ zurückzuführen ist:<br />
189
ír ’können’<br />
Nem bírtuk kilelni – törvénykeztük itt -, hogy honnat jöttek ezek a magyar csángók, honnan<br />
maradtak itt. Könyvekbıl isz, nem bírtuk kilelni. (S; DJ, geb. 1911)<br />
Mik nem bírunk parancsolni szemmit. Csak kell tőrjünk! (S; TG, geb. 1912<br />
Nem bírunk tudni, azt csak az Atya tudja! (S; TG, geb. 1912)<br />
Úgy részegedtek meg, nem bírtak szemmit csinálni. (S; KA, geb. 1912)<br />
Akkor, mikor odaértek a németek, hogy menjenek átal Beszarábéba, aszonták, partizán felment<br />
oda templomtoronyba, osztán onnan bírtak telefonálni, bírtak beszélgetni, sz ott beszélgettek pe<br />
front. (S; KA, geb. 1912)<br />
Moszt ha csak nem resztelli ember, csak úgy nem bír kapni pénzt. Ha resztesz, akkor nem bír<br />
kapni. De ha nem resztesz, vagyon hova menni, bír menni dologra, csak egészség legyen.<br />
(S; PA, geb. 1915)<br />
Granicserek vótak ott, de bírtak menni átal abba a zesztendıbe, meddig megtért a front.<br />
(Sz; BA, geb. 1917)<br />
Müt ér ez a két frank. Eljı a zidı, ezerek lesznek, milliók, s nem véssz semmit (...) Nem bírsz venni<br />
szemmit. (Sz; HM, geb. 1910)<br />
Meg vót elégedve, ullian helyt vót, hogy még bírt lopni es, s akkor bírt megelégedni. Azok<br />
szerették, mellik bírt lopni. Met ha te dolgoztál egész nap, s nem bírtál hozni még egy csıt es, egy<br />
suskapujt! (Sz; IHB, geb. 1925)<br />
Nem bírok segitteni a gyermekeknek. (Sz; SzVE, geb. 1930)<br />
Auch im Wörterbuch von Yrjö Wichmann findet sich diese Verwendung:<br />
bír ’können, vermögen, imstande sein’<br />
ién biram aszt e zákkat vinni „ich bin imstande, diesen Sack hinzutragen”<br />
biragat ’mit grösserem od. geringerem Erfolg vermögen’<br />
Im Moldauer Tschango-Dialekt wird bár in der Bedeutung ’mindestens, wenigstens’ gebraucht.<br />
Im standardsprachlichen Ungarisch ist diese Bedeutung zwar bekannt, doch kommt hier bár<br />
weitaus häufiger in den Bedeutungen ’obwohl’ und ’wenn nur’ vor.<br />
Der ausschließliche Gebrauch von bár in der Bedeutung ’mindestens, wenigstens’ lässt sich auf<br />
rum. măcar ’obwohl; mindestens, wenigstens’ zurückführen:<br />
190
ár ’mindestens, wenigstens’<br />
Én kellett bár tiz kártya vizet hozzak. (S; KA, geb. 1912)<br />
Egy bika ullian vót, annak örökké kellett bár két köldárval. (S; KA, geb. 1912)<br />
S egyszer jınek nagy lóhátasok be szılıbe mezırıl. (...) Mondom testvéremnek: Gyere,<br />
menjünk be, bár legyünk anyám mellett, mondom, ezek ki tudja, mit csinálnak nekünk.<br />
(Sz; DBK, geb. 1928)<br />
Visszakapta a saját helyit, s osztán most úgy sírnak azok a zemberek, asszonyok, melliktıl elvette,<br />
s nincs egy bokor szıljük, hogy bár megkóstolják! (Sz; DBK, geb. 1928)<br />
S máccor, mikor nincs se liszt, se kenyér úgy es kell egyél, egy napba bár egyszer csak!<br />
(Sz; SzVE, geb. 1930)<br />
Odagyüttek a gyermekek, azt mondtam, aszontam nekiek, ha akartok, írtok, ha nem bár tük<br />
éljetek! (Sz; SzVE, geb. 1930)<br />
3.3. Lehnbildungen<br />
3.3.1. Lehnübersetzungen<br />
In diesem Unterkapitel werden die in den Äußerungen der Gazda-Informanten vorkommenden<br />
Lehnübersetzungen einschließlich ihrer rumänischen Modelle dargestellt. Zusätzlich werden ihre<br />
Bedeutungsäquivalente in der ungarischen Standardsprache angegeben.<br />
kettıdik ’zweite(r, -s)’<br />
Sz elmentem ezután. Vagy két esztendıre vót a gyerekem, azután a kettıdik...<br />
(N; BKM, geb. 1913)<br />
Nıttem a gyermekeimet, s sak a zIsten tudja, hogy nıtettem. Kellett menj, dolgozz, nekezódtam, ez<br />
a kettıdikem kitörte a lábát, nyáron ült honn... (N; BKM, geb. 1913)<br />
Tartott egy hónapig, mingyet ennek a hónapnak hetedikjétıl mászik nóap kettedikjéig.<br />
(N; BuP, geb. 1919)<br />
Megkapáltuk, osztán még kettedikszer vagy két hét múlva. (S; KA, geb. 1912)<br />
Ott vótunk akkor, tudom, ültünk a faluba, ültünk egy hetet, sz kettıdik hétbe jött egy ordin.<br />
(S; KA, geb. 1912)<br />
191
Úgy adta a zIszten, kettı-négy nap megnyertük Odesszát, kettedik atakra. (S; KA, geb. 1912)<br />
Mentek a zasszonyok elszı eszte. Aztán kettedik eszte mentek a zemberek esz. Mentek énekelni<br />
Szőzmáriát, osztán kettıdik eszte mentek Szent István énekivel, mellik akart, elment a<br />
zasszonyokhoz. Mellik akart, ment a zemberhez. (...) Mentem én isz kettedik sezte, mentem a<br />
zénekvel. (S; CsBM, geb. 1919)<br />
Jó anya vót, kettıdik mámája, úgy mondta. (S; BLX, geb. 1929)<br />
Osztán leghamarébb adtak sokat, kettıdik esztendıbe adtak még kicsibbet, akkor még kicsibbet, s<br />
nem kezdtek adni utána. (Sz; IA, geb. 1911)<br />
Beim Wort kettıdik handelt es sich um eine Lehnübersetzung aus dem Rumänischen:<br />
vgl. rum. al doilea ’zweite(r, -s)’, im standardsprachlichen Ungarisch ist stattdessen második<br />
gebräuchlich.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
al doilea<br />
kettedik / kettıdik<br />
második<br />
(nem) még<br />
İk tudják, magyar, de nem még mondják ezt. Nem éppeg monják. (N; SzP, geb. 1918)<br />
Mik akartuk lenne, menjünk a magyarokhoz, kimenünk a magyarokval, sz ott magyarok vagyunk.<br />
Akkor nem vagyunk összevegyülve a románokval. De nem csinálták meg. Mondták, megcsinálják,<br />
magyar leen magyar, román leen román. (...) Osztán úgy maradt, elmaradt, nem még csináltak<br />
szemmit. (S; TG, geb. 1912)<br />
Vót egy testvére, professzor, s az azt mondta, hogy: Vrei sa te faci ungur? Nem még mondok<br />
semmit... (Sz; BCsM, geb. 1923)<br />
Die Moldauer Tschangos verwenden még – von rum. mai ’noch;sogar, selbst; stets, immer;<br />
schon’ beeinflusst – als Steigerungspartikel, was vor allem in Verneinungen zum Ausdruck<br />
kommt (vgl. rum. nu mai); diese Konstruktion ist häufig unübersetzbar.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
nu mai<br />
(nem) még<br />
in vielen Fällen unübersetzbar<br />
192
Die Lehnübersetzungen aus dem Rumänischen bewirken aber auch Veränderungen im ungarischen<br />
Sprachsystem der Tschangos; anstatt der für das Ungarische charakteristischen synthetischen<br />
Konstruktionen werden nun analytische verwendet.<br />
An folgenden Beispielen aus dem Gazda-Material wird deutlich, dass – unter Einfluss des rumänischen<br />
Modells – Funktionsverbgefüge, sog. „Streckformen” der Prädikate anstelle der im standardsprachlichen<br />
Ungarischen gebräuchlichen Derivate zur Verwendung kommen:<br />
Ad egy telefont ’telefonieren; anrufen’<br />
Adott egy telfont a zén emberem, osztán visszacsapták! (Sz; IHB, geb. 1925 )<br />
Hogyha béérnek a faluba, te nekem adj telefont! (...) Ne, mit mondott a milicista, hogy álljak<br />
meg az országúton, s ha jön öt fiú – azt mondja – a biciklivel, hátizsákokval a hátán, Külsı-<br />
Rekecsinbıl, ne engedjem, adjak telefont nekik, hogy ne engedje bé a faluba.<br />
(Sz; IGy, geb. 1948)<br />
Avval az ürügyvel, avval, adjon telefont, lám, itt hogy vagyok felvéve itt nálunk, a községházán.<br />
(Sz; IGy, geb. 1948)<br />
Die Wendung ad egy telefont lässt sich auf rum. a da un telefon ’telefonieren; anrufen’ zurückführen;<br />
in der ungarischen Standardsprache wird telefonál verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a da un telefon<br />
ad egy telefont<br />
telefonál<br />
Weitere Bildungen mit ad ’geben’:<br />
csecset ad ’stillen’<br />
Adtuk a gyermeket egyiktıl a másikig! Szoptattam meg én es, adtam csecset neki, a sógorasszony<br />
es adott, mikor neki elment a teje. (Sz; BGyA, geb. 1921)<br />
Das Modell der Wendung csecset ad ist rum. a da piept ’stillen; jdm. die Brust geben’; in der<br />
ungarischen Standardsprache ist stattdessen szoptat gebräuchlich.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a da piept<br />
csecset ad<br />
szoptat<br />
193
törvénybe ad ’verklagen, gerichtlich belangen’<br />
Nem kell hogy béadjalak törvénybe. (S; KA, geb. 1912)<br />
István Jánosz leányának a fia – illien kölus vót -, az elment, megfogta a pödurár, s béadta<br />
törvénybe. (S; KA, geb. 1912)<br />
Egyszer csak béjött a törvény: erdıre nem lehet menni! Tettek pödurárokat ide,ebbe a darabba,<br />
túl másba, melliket megfogták, adták bé a törvénybe. Ingemet es béadtak törvénybe. (...)<br />
Megfogtak fáal, béadtak a törvényre. Béadtak a törvényre, s tizenháromszor jártam bé oda<br />
Ocnára, törvényszékre. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Jött a milicia, sz béadtak törvénybe. (Sz; IA, geb. 1911)<br />
Das Modell des im Tschango-Dialekt gebräuchlichen törvénybe ad ist rum. a da în judecată<br />
’verklagen, gerichtlich belangen’; im standardsprachlichen Ungarisch wird beperel verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a da în judecată<br />
törvénybe ad<br />
beperel<br />
Diese Lehnübersetzung ist auch unter dem Stichwort törvény ’Gericht, Richteramt’ im Wörterbuch<br />
Wichmanns verbucht: törvémbe bé-ad ’jmd vor den Richter stellen’<br />
tüzet ad ’anzünden’<br />
Nekifogtak, adtak tüzet a zudvaroknak, a bojérházaknak. Világ kiment, hogy gyújtszák meg a<br />
zudvarokot. (N; MP, geb. 1919)<br />
Anstatt des in der ungarischen Standardsprache verwendeten felgyújt bzw. meggyújt findet sich<br />
der Gebrauch der Wendung tüzet ad, die rum. a da foc ’anzünden’ (wortwörtlich: „Feuer geben”)<br />
zum Modell hat.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a da foc<br />
tüzet ad<br />
felgyújt bzw. meggyújt<br />
194
utat ad a puskának ’schießen’<br />
Mikor azt mondták, tragere, utat adtam a puskának, menjen. (S; PJ, geb. 1892)<br />
Bei der Wendung utat ad a puskának handelt es sich um eine Lehnübersetzung aus rum. a da<br />
drumul la puşcă ’schießen; wortwörtl. „das Gewehr in Gang setzen’; im standardsprachlichen<br />
Ungarisch findet sich stattdessen lı.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a da drumul la puşcă<br />
utat ad a puskának<br />
lı<br />
Sowohl in den Äußerungen der Gazda-Informanten als auch im Wörterbuch Wichmanns<br />
finden sich viele Wendungen mit csinál ’machen’:<br />
csinál<br />
adósságot csinál ’seine Pflicht erfüllen’<br />
Katona fiam vagy! - mondta. Ha a zország a fegyvert a kezedbe adta, csánd meg a<br />
zadósszágodot, a császárét, me szükszégesz. (...) Csánd meg az adósszágot, lıjj, de ne lıjj meg<br />
szenkit! (...)Csak sánd meg a zadósszágot, a császárét, met ha nem csálod meg, az esz bőn.<br />
(S; PJ, geb. 1892)<br />
Kákóván úgy gyúlt meg a falu, hogy elégett 35 ház, nem tudom, mitıl mondják, hogy<br />
meggyújtották. Szoszem felejtem el, kijött azval a szentelıvel, sz szentelt vízvel purizta azt<br />
kereken. (...) Na, csánta meg a zadósszágot ı isz. (S; KA, geb. 1912)<br />
Das Modell der Wendung adósságot csinál ist rum. a-şi face datoria ’seine Pflicht erfüllen’; im<br />
standardsprachlichen Ungarisch wird teljesíti a kötelességét verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a-şi face datoria<br />
adósságot csinál<br />
teljesíti a kötelességét<br />
bubát csinál ’gebären, zur Welt bringen’<br />
Osztán népe sánt egy bubát esz, hogy honn vót a zember. (N; SzP, geb. 1918)<br />
195
Die Wendung bubát csinál lässt sich auf rum. a face un copil ’gebären, zur Welt bringen’zurückführen;<br />
in der ungarischen Standardsprache wird gyereket szül verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face un copil<br />
bubát csinál<br />
gyereket szül<br />
Diese Lehnübersetzung findet sich auch im Wörterbuch Wichmanns:<br />
e népem sánt i bubát meine Frau ist mit einem Kinde niedergekommen<br />
iskolát csinál ’die Schule besuchen’<br />
Elment, hogy sánt iszkolát itt a faluba tíz esztendıt. (S; TM, geb. 1925)<br />
Das Modell der Wendung iskolát csinál ist rum. a face şcoală ’die Schule besuchen’; im<br />
standardsprachlichen Ungarisch wird iskolába jár verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face şcoală<br />
iskolát csinál<br />
iskolába jár<br />
kacagság(ot) csinál ’blamieren, lächerlich machen’<br />
Megtalálkoztam vele, írta leveleket nekem, s így s úgy. De becsületes ember vót, nem akart velem<br />
kacagságot, nem. (...) Emberem vót, de nem mentem el a temetésire. Én nem mentem oda, hogy<br />
kacagságot csináljak belıle. Pedig fájt! (Sz; BCsM, geb. 1923)<br />
Anstatt des in der ungarischen Standardsprache verwendeten csúfot őzni valakibıl findet sich der<br />
Gebrauch der Wendung kacagságot csinál, die rum. a face de rîs ’blamieren, lächerlich machen’<br />
zum Modell hat.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face de rîs<br />
kacagságot csinál<br />
csúfot őzni valakibıl<br />
196
kérést csinál ’ein Gesuch einreichen; ersuchen, beantragen’<br />
Lukács páter ferences vót, s a ferencesek csináltak egy kérést, a miniszter aprobálta (...).<br />
(Sz, HP, geb. 1901)<br />
Das Muster der Wendung kérést csinál ist rum. a face cerere ’ein Gesuch einreichen; ersuchen,<br />
beantragen’; in der ungarischen Standardsprache ist stattdessen kérvényez oder kérelmez<br />
gebräuchlich.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face cerere<br />
kérést csinál<br />
kérvényez oder kérelmez<br />
Die Bildungen mit csinál sind damit aber noch lange nicht ausgeschöpft. Weitere Wendungen<br />
dieser Art finden sich im Wörterbuch Wichmanns:<br />
barátságot sán ’sich mit jdm. befreunden’<br />
Bei der Wendung barátságot sán handelt es sich um eine Lehnübersetzung aus rum. a face<br />
prietenie ’sich befreunden; Freundschaft schließen’; im standardsprachlichen Ungarisch findet<br />
sich stattdessen valakivel barátkozik.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face prietenie<br />
barátságot sán<br />
valakivel barátkozik<br />
ı sánt i bünt ’er hat sich versündigt’<br />
Die Wendung ı sánt i bünt lässt sich auf rum. a face păcat ’sündigen, eine Sünde begehen’zurückführen;<br />
in der ungarischen Standardsprache wird bőnt követ el, bőnözik verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face păcat<br />
ı sánt i bünt<br />
bőnt követ el, bőnözik<br />
sántam i fogotyságat ’ich bin eine Wette eingegangen’<br />
Anstatt des in der ungarischen Standardsprache verwendeten valakivel fogad oder fogadást köt<br />
findet sich der Gebrauch der Wendung sántam i fogotyságat, die rum. a face un pariu ’eine Wette<br />
eingehen’ zum Modell hat.<br />
197
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face un pariu<br />
sántam i fogotyságat<br />
fogad oder fogadást köt<br />
sántam nekéje igaszszágat ’ich liess ihm Gerechtigkeit widerfahren’<br />
Das Modell der Wendung sántam nekéje igaszszágat ist rum. a face dreptate ’jdm. Gerechtigkeit<br />
widerfahren lassen’; im standardsprachlichen Ungarisch wird igazságot szolgáltat valakinek<br />
verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face dreptate<br />
sántam nekéje igaszszágat<br />
igazságot szolgáltat valakinek<br />
musztrát sán ’exerzieren’<br />
Die Wendung musztrát sán lässt sich auf rum. a face mustrare ’mustern’zurückführen; in der<br />
ungarischen Standardsprache wird mustrál verwendet.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face mustrare<br />
musztrát sán<br />
mustrál<br />
sántam i jó válságat ’ich habe einen vorteilhaften Tausch gemacht’<br />
Das Modell der Wendung sántam i jó válságat ist rum. a face schimb ’einen Tausch eingehen’; in<br />
der ungarischen Standardsprache ist stattdessen cserél gebräuchlich.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a face schimb<br />
sántam i jó válságat<br />
cserél<br />
fog vkivel ’zu jdm. halten/stehen’<br />
Vótak ullian jó gazdag, khiábur emberek, azok inkább fogtak a mieinkvel. (Sz; BA, geb. 1917)<br />
Bei der Wendung fog valakivel handelt es sich um eine Lehnübersetzung aus rum. a Ńine cu<br />
cineva ’zu jdm halten/stehen’; im standardsprachlichen Ungarisch findet sich stattdessen<br />
valakihez/valakivel tart.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a Ńine cu cineva<br />
fog valakivel<br />
valakihez/valakivel tart<br />
198
tart vkihez ’an jdm. hängen, jdn. gern/lieb haben’<br />
Moszt rossz világ van. Me kö nem tartanak egymászhoz. (N; KÁX, geb. 1933)<br />
Tartottak a gyermekeikhez. (S; KA, geb. 1912)<br />
Az a zember erıst tartott a mi falunkhoz, ez a presedinte. (Sz; GGy, geb. 1934)<br />
Anstatt des in der ungarischen Standardsprache verwendeten valakit pártol/szeret findet sich der<br />
Gebrauch der Wendung tart valakihez, die rum. Ńine la cineva ’an jdm. hängen, jdn. gern/lieb<br />
haben’zum Modell hat.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a Ńine la cineva<br />
tart valakihez<br />
valakit pártol/szeret<br />
ebédet vesz ’zu Mittag essen’<br />
Aszongya: az úr nem akar ebédet venni azét, hogy maga nem vót itt vele.<br />
(S; PJ, geb. 1892)<br />
Das Modell der Wendung ebédet vesz ist rum. a lua masa de prînz/prînzul ’zu Mittag essen’; in<br />
der ungarischen Standardsprache ist stattdessen ebédel gebräuchlich.<br />
Rumänisches Modell:<br />
Tschango- Dialekt:<br />
Ungarische Standardsprache:<br />
a lua masa de prînz/prînzu<br />
ebédet vesz<br />
ebédel<br />
Am Beleg „Nem vala honn ez a zember, a zenyim” (N; BuP, geb. 1919) wird erneut deutlich,<br />
dass die Lehnübersetzungen auch in die Struktur des Tschango-Dialekts eingreifen:<br />
Der Ausdruck ez a zember, a zenyim (wortwörtlich: „dieser Mann, der meinige”) stellt eine<br />
Lehnübersetzung aus rum. omul meu dar.<br />
Das Besitzverhältnis wird im Rumänischen durch die analytische Konstruktion Besitzwort mit<br />
Definitartikel + Possessivpronomen (omul meu) ausgedrückt, im Ungarischen dagegen mittels<br />
possessiver Personalsuffixe (emberem). Diese synthetische Konstruktionsweise wird durch die<br />
analytische des rumänischen Modells verdrängt, wie auch die weiteren Beispiele zeigen:<br />
199
Osztán jött a kolonel, a miénk, sz azt mondta: menjetek átal! (S; PJ, geb. 1892)<br />
Akkor a legények, a zéfiak el vótak verekedésbe, s eljött a zember, a zenyém, hozzánk, s én<br />
elmentem utána, met neki vót két gyermeke, ı kellett menjen a verekedésbe, a gyermekekre nem<br />
vót ki ügyeljen, s neki vót mindene, vót marhája, vüt háza, vót szekere, s én na, gondoltam, szegén<br />
leán vagyok, s menjek utánna. (S; BBM, geb. 1921)<br />
Osztán a püspököt ott meglıtték a ruszok, s a páter, a miénk elfutott egy korba, ide jött vissza<br />
misak. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Odament a páterhez, a miénkhez, s mondta: hagyja, engedje, hogy énekeljenek a templomban<br />
magyarul. (Sz; IHB, geb. 1925)<br />
Ez a zember, a zenyim, met elcsábíttották, béíródott. (Sz; DBK, geb. 1928)<br />
Az élet, az enyém, nekáz! (Sz; SzVE, geb. 1930)<br />
Az öreg beteg vót, a dédipapa, a miénk. (Sz; TDR, geb. 1950)<br />
Das folgende Beispiel zeigt die Beeinflussung der Wortfolge durch das rumänische Modell:<br />
Akkor, huszonegybe, huszonkettıbe júliba ott vótunk a piketnél (...) (N; SzP, geb. 1918)<br />
Die Zahlwörter stehen im Rumänischen vor, im Ungarischen nach den Monatsnamen.<br />
Im Material Gazdas lassen sich weiterhin viele Belege dafür finden, dass die rumänischen<br />
Präpositionen Einfluss auf den Gebrauch der Kasusendungen haben:<br />
Vútam Lakatosz Demeterhez [anstatt: -nél; wegen des Einflusses der rum. Präp. la]. (N; SzP, geb.<br />
1918)<br />
Eljöttünk Vászárhelyhez [anstatt: -re; wegen des Einflusses der rum. Präp. la]. (N SzP; geb. 1918)<br />
An den unten stehenden Belegen wird deutlich, dass die rumänische Präposition (după) auch<br />
Einfluss auf die Sprachstruktur nimmt: in der Wendung férjhez megy valaki után wird anstelle<br />
der im Standardungarischen gebräuchlichen synthetischen suffigierten Form (valakihez) die<br />
analytische Konstruktion mit der Postposition után (valaki után) verwendet.<br />
200
Férjhez megy valaki után<br />
Nem sukolt meg engemet. Nem sukolt meg, ke nem szerettem, úgy mentem utána.<br />
(N; BKM, geb. 1913)<br />
Mondtam mámának: Ha hajtasz, menek ezután, nem isz szeretem, de menek ezután, mondom, sz<br />
úgyszem menek, melik után hajt kend. (N; BKM, geb. 1913)<br />
Kell vala, hogy mondják meg, ne menjek utánna! (N; BKM, geb. 1913)<br />
Add a leánkát a gyermekem után! (N; MP, geb. 1919)<br />
Gye mondja a tátá, ne menj utána. (N; DDR, geb. 1924)<br />
Merikám román után adódott el, Kati mind csak román után adódott el. (S; KA, geb. 1912)<br />
Jobb, menj el ezután, mellik kicsinálta a katonaszágot, met ha odamarad esz, adnak egy kicsi<br />
penszét, nem mondja szenki, hogy öreg leány vagy! (S; CsBM, geb. 1919)<br />
Met én gondoltam, ha azután mehettem lenne el, tyjár ha meghalt lenne esz, elmentem ullian<br />
után, melleket én szerettem kicsi koromtól. (S; CsBM, geb. 1919)<br />
Patakiak vesznek kákovaiakat, kákovaiak vesznek pataki leányokot, osztán mellik ullian, még<br />
elmennek a zortodoxok után esz, kátolik esz talál, hogy elmenen ortodox hitre.<br />
(S; BLX, geb. 1929)<br />
Leghamarább én férjhez mentem egy romány után. (...) İ ingemet úgy vett el, azt mondtam, úgy<br />
menek utána, ha megesküszik nálunk. (Sz; BCsM, geb. 1923)<br />
Menen a katolikus a román után, eleget tiltsa a páter, de hiába. (Sz; TGy, geb. 1932)<br />
3.3.2. Lehnverbindungen<br />
Als eine besondere Form der Lehnübersetzungen lassen sich die untenstehenden hybriden Formen<br />
betrachten, die in der Fachliteratur als sog. Lehnverbindungen bezeichnet werden, die<br />
„durch den unmittelbaren Transfer (Übernahme) eines Gliedes und die Lehnübersetzung eines<br />
anderen gekennzeichnet sind” (Földes 1996: 22), d.h. im Grunde genommen Verbindungen aus<br />
direkten und indirekten Entlehnungen darstellen.<br />
201
Tette drágosztet néppel. (N; MP, geb. 1919)<br />
direkte Entlehnung: drágoszte < rum. dragoste ’Liebe’<br />
indirekte Entlehnung: tette drágosztet < rum. a face dragoste ’(mit jmd.) den Beischlaf ausüben’<br />
Én a fábrikánál dolgoztam, engem nem híttak be elsıbb. (S; PJ, geb. 1892)<br />
direkte Entlehnung: fábrika < rum. fabrică ’Fabrik’<br />
indirekte Entlehnung: a fábrikánál [anstatt -ban; wegen des Einflusses der rum Präp. la]dolgozik<br />
< rum. a lucra la fabrică ’in der Fabrik arbeiten’<br />
Nem húztunk mik egy nehánkán, nem húztunk foámetát nagyot. De húzott egy része, dudót<br />
fıztek, ették a dudót. (...) De húztak, szok része húzott. (...) Szemmi málészkájuk nem vót.<br />
(S; TG, geb. 1912)<br />
direkte Entlehnung: foameta < rum. foamete ’Hungersnot’<br />
indirekte Entlehnung: foámetát húz < rum. a trage de foamete ’Hungersnot erleiden’<br />
Csántak mobilizárét, hogy hajtszák ki a kommunisztákot magyar fıdrıl. (S; PJ, geb. 1892)<br />
direkte Entlehnung: mobilizare < rum. mobilizare ’Mobilisierung, Mobilmachung’<br />
indirekte Entlehnung: mobilizárét csán < rum. a face mobilizare ’mobilisieren’<br />
Adtak ordint, zegész pikét elgyütte katonáit, nem kellett menjen patrulába. (N; SzP, geb. 1918)<br />
direkte Entlehnung: ordin < rum. ordin ’Befehl’<br />
indirekte Entlehnung: ordint ad < rum. a da ordin ’Befehl erteilen’<br />
202
4. Zusammenfassung<br />
Die untenstehende Tabelle zeigt – als eine Art Zwischenbilanz – die prozentualen Anteile der in<br />
den Äußerungen der Gazda-Informanten vorkommenden Kontaktphänomene der direkten und<br />
indirekten Entlehnungen:<br />
Nord-Tschangos Süd-Tschangos Székler-Tschangos<br />
Direkte Entlehnungen<br />
(Lehnwörter)<br />
5, 33 % 3, 39 % 2, 36 %<br />
Indirekte<br />
Entlehnungen:<br />
Lehnbedeutungen 0, 57 % 0, 48 % 0, 20 %<br />
Lehnbildungen 0, 34 % 0, 09 % 0, 06 %<br />
Anhand dieses Zahlenmaterials wird deutlich, dass zwischen den einzelnen Tschango-Dialekten<br />
Unterschiede in der Stärke des Einflusses der rumänischen Sprache bestehen: Der höchste Anteil<br />
der direkten und indirekten Entlehnungen findet sich bei den Nord-, der niedrigste bei den Székler<br />
Tschangos.<br />
Als positive Bilanz ist zu vermerken, dass in allen 3 Tschango-Dialekten die direkten Entlehnungen<br />
überwiegen; die indirekten Entlehnungen, die schon in die Sprachstruktur des Ungarischen<br />
eingreifen können, sind nur geringfügig vertreten:<br />
Der prozentuale Anteil der Lehnbildungen, die – wie wir gesehen haben – dazu führen, dass<br />
analytische anstatt der für das ungarische Sprachsystem typischen synthetischen Konstruktionen<br />
gebraucht werden, beträgt im nördlichen Tschango-Dialekt nur 0, 34 %, im südlichen 0, 09 %<br />
und im Székler Tschango-Dialekt 0, 06 %.<br />
203
5. Kodewechsel<br />
5.1. Terminologische Fragen<br />
Lanstyák (2006: 107) bestimmt den Terminus Kodewechsel als „zweisprachige Kommunikationsart,<br />
in der die Sprecher innerhalb eines einzigen Diskurses zwei unterschiedliche Sprachen,<br />
genauer gesagt: zu zwei unterschiedlichen Sprachen gehörende Elemente gebrauchen (...)”.<br />
Unter ’Diskurs’ versteht Lanstyák die zusammenhängende Rede, genauer gesagt, sprachliche Äußerungen, die länger<br />
als ein Satz sind.<br />
Der Kodewechsel (ins Rumänische), der im folgenden jeweils durch Fettdruck hervorgehoben<br />
wird, kann der Form nach ein:<br />
- einziges Wort: Ott vagyon körülbelıl kétezer famili. (Sz; AM, geb. 1929),<br />
- einen Ausdruck: Akkor prima data [das erste Mal] potrivált vala. (N; PoA, geb. 1908),<br />
- einen Teilsatz : Sz akkor a világ futott keresztül ide, si s-a stabilit [und ließen sich nieder].<br />
(N; MaGy, geb. 1912),<br />
- einen Satz : Tátám meghótt, mikor én születtem. Tata mea a mers la razboi, si eu am ramas<br />
singur. [Mein Vater zog in den Krieg, und ich blieb allein] (N; DGyX, geb. 1916)<br />
bzw.<br />
- mehrere Sätze : Ha nem íródtál fel, szemmit, szemmit! Ai fost silit, să faci. Silit. Am fost silit.<br />
Silit ca sa pot trăi in tară. [Du wurdest gezwungen, es zu machen. Gezwungen. Ich wurde<br />
gezwungen [, in die LPG einzutreten]. Gezwungen, und nur so konnte ich in diesem Land<br />
leben.] (N; MP, geb. 1919) b e t r e f f e n.<br />
Der sogenannte 1-Wort Kodewechsel, der auf der Ebene eines einzigen Lexems zum Ausdruck<br />
kommt, sollte dabei nicht mit dem Lehnwort verwechselt werden.<br />
Obwohl sich der mit dem individuellen Sprachgebrauch verbundene 1-Wort Kodewechsel und<br />
das in der Sprachgemeinschaft verbreitete oder sich zu verbreiten beginnende Lehnwort schwer<br />
unterscheiden lassen – bilden sie doch die äußersten Pole ein und desselben Kontinuums – soll<br />
trotzdem eine Unterscheidung dieser Kategorien anhand einer Kombination der Kriterien der<br />
Gebrauchshäufigkeit, morphologischen Integration in das System der entlehnenden Sprache und<br />
der Sprecherattitüden versucht werden (siehe: Bartha 1992: 19-29, Riehl 2004: 20-21, 31 und<br />
Lanstyák 2006: 60-73).<br />
204
Wenn das gegebene lexikalische Element von mehreren Sprechern mehrmals gebraucht wird,<br />
lässt sich dies als Beginn eines Integrationsprozesses in die gegebene Sprachvariante und somit<br />
als Lehnwort deuten.<br />
Wenn sich aber dagegen beim betreffenden Wort die morphologischen Merkmale der rumänischen<br />
Sprache finden, ist es als 1-Wort Kodewechsel deutbar.<br />
Bei der Einschätzung eines betreffenden Lexems als 1-Wort Kodewechsel oder Lehnwort spielt<br />
auch die Sprechereinstellung eine wichtige Rolle:<br />
In den folgenden Belegen sind sich die Sprecher darüber bewusst, dass sie Elemente der rumänischen<br />
Sprache gebrauchen, was auch an den metasprachlichen Kommentaren wie „magyarul<br />
...nak mondják, nem?” [Auf Ungarisch sagt man..., oder?], hogy mondják ezt magyarul? – igen...<br />
[Wie sagt man dies auf Ungarisch?] deutlich wird. Die Sprecher empfinden den Gebrauch der<br />
rumänischen Elemente als nicht angemessen und versuchen deshalb die entsprechenden ungarischsprachigen<br />
Äquivalente, die hier jeweils unterstrichen sind, zu finden, wobei sie diese nach<br />
einer kurzen Pause auch anwenden:<br />
Tyáburok vótunk. Magyarul kuláknak mondják, nem? (...) S akkor ütte a nyakamot.<br />
(Sz; FP, geb. 1908)<br />
Havazott, furtunázott – hogy mondják ezt magyarul? – igen, viharzott [es stürmte], nagyon rossz<br />
idı vót. (Sz; IGy, geb. 1948)<br />
Bulgárokat elokupálták, elfoglalták [(mil.) besetzen]. (N; SzP, geb. 1918)<br />
Die oben angeführten Fälle lassen sich somit als 1-Wort Kodewechsel deuten.<br />
Die Bedeutsamkeit der Sprechereinstellung wird auch im umgekehrten Fall deutlich:<br />
Annak tejvel úgy mondtuk. Alivánka. Úgy mondtuk, há. Magyarul (!) mondtuk, met akkor<br />
magyarul beszéltünk. Alivánka. (S; BBM, geb. 1921)<br />
Das obige sprachliche Element alivánka ’Art kleine Fladen aus Maismehl und Käse, die<br />
nach dem Backen mit Sahne oder heißer Butter übergossen werden’ – Lehnwort aus dem<br />
Rumänischen – hat sich dermaßen in das Sprachsystem des Tschango-Dialektes integriert,<br />
dass es vom Sprecher mittlerweile als ungarisches Wort betrachtet wird.<br />
Es ist in der Sprachgemeinschaft der Tschangos sozial akzeptiert und somit Teil des allgemein<br />
gebräuchlichen (tschango)ungarischen Wortschatzes.<br />
205
In seiner kontaktlinguistischen Terminologie unterscheidet Lanstyák (2006: 109) zwischen der<br />
Basis- und Gastsprache: „Die ’Basissprache’ ist diejenige Sprache, die (...) in den zwei- bzw.<br />
mehrsprachigen Diskursen strukturell und/oder quantitativ dominant ist. Die ’Gastsprache’ ist<br />
demgegenüber die Sprache, deren Elemente (in Form von einzelnen Wörtern bzw. Wortverbindungen)<br />
okkasionell oder regelmäßig in den basissprachlichen Äußerungen auftauchen. Das in<br />
den basissprachlichen Äußerungen befindliche gastsprachliche Element bzw. die Reihe von<br />
gastsprachlichen Elementen werden ’gastsprachliche Einlagen’ genannt.“<br />
Unter der ’strukturellen Dominanz der Basissprache’ versteht Lanstyák (2006: 109-110) den Umstand,<br />
dass „die Basissprache die grammatischen Verhältnisse der Äußerung in ihrer Gesamtheit<br />
bzw. zum Großteil bestimmt. Am deutlichsten zeigt sich dies darin, dass die aus der Gastsprache<br />
stammenden Einlagen – falls nötig – mit Endungen aus der Basissprache versehen werden.“<br />
Auf diesen Aspekt der Integration wird im Kapitel über die grammatikalischen Typen des Kodewechsels<br />
näher eingegangen werden.<br />
„Unter der ’quantitativen Dominanz der Basissprache’ verstehen wir, dass die aus der Basissprache<br />
stammenden Sequenzen in größerer Anzahl vorkommen als die aus der Gastsprache stammenden<br />
Sequenzen“ (Lanstyák 2006: 110).<br />
Lanstyák (2006: 107) bestimmt ’Sequenz’ als „einen kürzeren Teil eines längeren Diskurses, eine Reihe aufeinander<br />
folgender sprachlicher Elemente”.<br />
In Analogie zur Basis- bzw. Gastsprache führt Lanstyák ein weiteres Begriffspaar in seine kontaktlinguistische<br />
Terminologie ein und unterscheidet zwischen der Primär- und Sekundärsprache<br />
des Diskurses:<br />
„Die ’Primärsprache des Diskurses’ ist die unmarkierte, d.h. „normale” Sprache des zwei- bzw.<br />
mehrsprachigen Diskurses, die keine Aufmerksamkeit erregt und die keiner Erklärung bedürftig<br />
ist (...). Die Primärsprache des Diskurses ist im gegebenen zwei- oder mehrsprachigen Diskurs<br />
gewöhnlich quantitativ und oft auch strukturell dominant.<br />
Die ’Sekundärsprache des Diskurses’ ist diejenige Sprache, deren Sequenzen (regulär) in den<br />
primärsprachlichen Diskursen erscheinen”(Lanstyák 2006: 110).<br />
Als Primärsprache der Diskurse der Gazda-Informanten lässt sich das Ungarische, genauer<br />
gesagt, der Moldauer Tschango-Dialekt, als Sekundärsprache das Rumänische bestimmen.<br />
Das Rumänische ist gegenüber dem Tschango-Ungarischen quantitativ unterlegen, was darin<br />
deutlich wird, dass der prozentuale Anteil der Kontaktphänomene im nördlichen Tschango-<br />
206
Dialekt 6, 69 %, im südlichen 4, 22 % und schließlich im Székler Tschango-Dialekt nur 2, 83 %<br />
ausmacht.<br />
Interessanterweise sind im Sprachmaterial des Dokumentarromans von József Gazda auch<br />
sprachliche Elemente aus dem Deutschen und Russischen vertreten:<br />
Magyarul isz tudok, olául isz tudok, még tudok egy-egy szót oroszul isz, németül isz, németül isz<br />
tudok. Gut, gut, já, já! (N; KÁX, geb. 1933)<br />
Eligecske vótam több, négy esztendısznél, jut eszembe, búttam bé a zágy alá záhár után. Vótak<br />
zsákok odabé, osztán húztak [a ruszok], pallták a szeggemet a kezikvel. Hej, Malinszki, malinszki,<br />
mensz zahar után, mensz zahar után. Ruszul nem értettem, kicsi vótam. [...] Malenki, egyél!<br />
(S; KA, geb. 1912)<br />
Azt mondták [a ruszok] a gyermekecskéknek: Málenki! (Kleine!) (Sz; BKB, geb. 1908)<br />
Én benn vótam a tüzelıbe - égettük a cserepet - avval a menyecskével, avval a fiatalval. S azt a<br />
fiatalt megfogta a rusz így ne, nem hagyta, kimenjen, s én így vótam, így ne, terhesen. Akkor<br />
aszonta: Pasjol! Pasjol! (Geh! Geh!) Mondta ruszul. (Sz; CsAM, geb. 1908)<br />
Egy délután jınek a zoroszok, jınek fel, hozzánk Szerbekbe. [...] Béjöttek az ográdába, s kellett<br />
étel. (...) Davaj kurká, davaj kurka! (Her mit dem Truthahn!) Kértek tyúkot. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
Jöttek lóháton, meg vótak a portól egészen, csak a szemeik látszottak, tetszettek, a fogaik<br />
fehérlettek. (...) Nemecki! Nemecki! Nemecki! [Deutsche! Deutsche! Deutsche!] Keresték a<br />
németet. (Sz; BCsM, geb. 1923)<br />
5.2. Grammatikalische Typen des Kodewechsels<br />
István Lanstyák (2006: 105-146) unterteilt die Kodewechsel nach ihrer Integrationsart in das<br />
sprachliche System der Basissprache. Nach den formalen sprachlichen Mitteln, die dem Sprecher<br />
zur Integration der gastsprachlichen Elemente zur Verfügung stehen, kann zwischen folgenden<br />
grammatikalischen Typen des Kodewechsels unterschieden werden:<br />
Beim „ N – T y p ” -Kodewechsel erfolgt die Integration durch N u l l m o r p h e m e, beim<br />
„ B – Typ ” -Kodewechsel unter Zuhilfenahme von Morphemen aus der B a s i s s p r a c h e,<br />
beim „ G – T y p ” -Kodewechsel wiederum anhand von Morphemen aus der G a s t s p r a c h e.<br />
In der Typologie Lanstyáks erscheinen des Weiteren der sog. „ F – T y p ” -Kodewechsel, bei<br />
dem die nötigen Endungen f e h l e n, sowie der sog. „ X – T y p ”-Kodewechsel, bei dem die<br />
207
Frage der Integration (das Vorhandensein oder Fehlen der Endungen) wegen der Bruchstückhaftigkeit<br />
der Äußerungen i r r e l e v a n t ist.<br />
5.2.1. „B-Typ”-Kodewechsel<br />
Die strukturelle Dominanz der Primärsprache kommt vor allem im „B-Typ”-Kodewechsel zum<br />
Ausdruck, der von Lanstyák (2006: 119) folgendermaßen bestimmt wird: „In diesem grammatikalischen<br />
Typ des Kodewechsels werden die gastsprachlichen Einlagen mit Hilfe basissprachlicher<br />
Morpheme in die basissprachlichen Äußerungen integriert.(...) Sollten die gastsprachlichen<br />
Einlagen trotzdem mit gastsprachlichen Morphemen versehen sein, ist dies entweder ihre „innere<br />
Angelegenheit”, die keinerlei Einfluss auf den Gesamtsatz hat, [d.h., dass] die gastsprachlichen<br />
Morpheme [nur] innerhalb der gastsprachlichen Einlagen das Verhältnis der einzelnen Satzteile<br />
zueinander ausdrücken, oder aber bloß „leblos” an den gastsprachlichen Einlagen „hängen”, [d.h.<br />
inaktiv sind]”.<br />
In den folgenden Belegen sind die rumänischen, gastsprachlichen Einlagen durch basissprachliche,<br />
(tschango)ungarische Endungen, die jeweils unterstrichen sind, in die basissprachlichen<br />
Äußerungen integriert:<br />
Aztán úgy ment a baj, hogy adtak két kárte postalt [zwei Postkarten] a hónapba, zétel<br />
megszaporodott vót, jobb lett. (S; TM, geb. 1925)<br />
(Akkusativendung -t drückt das direkte Objekt aus; das Bezugswort bleibt hier zusätzlich – im Gegensatz zum<br />
Rumänischen - nach dem Zahlwort im Singular)<br />
A guvern – mellik most van – engedett nekünk 5000 metru patrátot (Bindevokal + Akkusativsuffix)[Quadratmeter],<br />
abba van huszonöt rúd. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Ott összevegyült egy erdıvadászval éjen, s összeverekedett, az megcsapta a bicsikleta pompéval<br />
(Komitativ-Instrumental) [mit der Fahrradpumpe] a fejit. (Sz; IM, geb. 1930)<br />
Akkor mondták: Tessék? Húzzatok egy kocsit ki a linia moártéról (Delativ)! (...) Mentek a<br />
katonák, s kihoztak egy kocsit a linia moártéról [vom toten Gleis]. (Sz; MGy, geb. 1905)<br />
Négy leán felöltözve, kosztum nacionálba (Illativ)[in Volkstracht], olyan szép ruhába, harisnyába,<br />
virágos ingbe, van olyan bundicájuk, kivirágozva szépen, kalapval vaj kucsmába, s akkor<br />
kezdik el. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
208
Osztán 57-tıl nem vót kóta, megjelent a kontrakt. Addig vótak a kotele obligatoriek (Pluralsuffix)<br />
[Pflichtabgaben], osztán akkor elhagyták. (...) Ugyes csak megjavitta, met addig vótak a kóták, a<br />
kótele obligatoriek, attól osztán megszőnt, elhatták. (Sz; IM, geb. 1930)<br />
Eigennamen:<br />
Eljött a magyar, elfoglalta nordul Ardeáluluit (Akkusativ)[Nordsiebenbürgen].<br />
(N; BuP, geb. 1919)<br />
Nagy baj vót ott, nagy baj vót a Cotul Donuluinál (Adesseiv)[am Donbogen].<br />
(S; KoÁ, geb. 1910)<br />
Die oben beschriebene Vorgehensweise des Anhängens von basissprachlichen Morphemen an die<br />
gastsprachlichen Einlagen gilt als eine besonders starke Integrationsart, die auch relativ gute<br />
Kenntnisse in der Basissprache voraussetzt. So ist es auch kein Wunder, dass dieser grammatikalische<br />
Typ des Kodewechsels am häufigsten von den Székler Tschangos verwendet wird:<br />
der höchste prozentuale Anteil des „B-Typ”-Kodewechsels findet sich mit 33, 33 % im Székler<br />
Tschango-Dialekt; im südlichen Tschango-Dialekt macht er 21, 15 % aus, während er im nördlichen<br />
Tschango-Dialekt nur 7, 41 % beträgt.<br />
Süd<br />
21,15%<br />
Székler<br />
33,33%<br />
Nord<br />
7,41%<br />
5.2.2. „N-Typ”-Kodewechsel<br />
Im „N-Typ”-Kodewechsel „erfolgt die Integration der gastsprachlichen Elemente in syntaktischer<br />
Hinsicht automatisch, [d.h.] ohne dass es notwendig wäre, formelle Mittel anzuwenden”<br />
209
(Lanstyák 2006: 114). Die gastsprachlichen Elemente werden anhand von Nullmorphemen<br />
integriert, die sich weder der Gast- noch der Basissprache eindeutig zuordnen lassen.<br />
In den folgenden Belegen stehen die gastsprachlichen Einlagen in Subjektsfunktion im<br />
Nominativ, der sowohl in der Gast- als auch in der Basissprache unmarkiert ist:<br />
A sef de ferma [Chef der Staatsfarm/LPG], a zekonomiszt, a csoportfelelıs adott egy-egy ficukját:<br />
ennek s ennek adj – aszongya – tíz dinnyét! (Sz; GGy, geb. 1934)<br />
Stefan cel Mare [Stefan der Große] csinálta ezt a templomot. (S; KA, geb. 1912)<br />
Regele Ferdinánd [König Ferdinand] az siánt véllik kötészt, hogy jöjjenek, szegítszenek meg.<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
Lanstyák zählt auch die Fälle zum „N-Typ”-Kodewechsel, in denen von vornherein unflektierbare<br />
Wortarten wie Adverbien oder Präpositionen als gastsprachliche Elemente in den ungarischen<br />
basissprachlichen Äußerungen auftauchen.<br />
Nem benevol [freiwillig] mentem. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Krimé nagy, ott az öt kilometert a zorosz megerıszítti, úgy, hogy nu kumvá [damit nicht]<br />
bémenjen a román ott elé. (N; BuP, geb. 1919)<br />
Ku toate kö [obwohl] adtunk kótákat, úgyis szerettük, hogy leünk liberek. (N; BuP, geb. 1919)<br />
Mikor számát vettük, hogy eljött egy ullian dudogás, reszkettünk így, járni fogtunk, immá nem isz<br />
gondoltuk, hogy megáll, met csak en continuu [ununterbrochen] így jártunk, így!<br />
(S; CsTA, geb. 1960)<br />
Moszt meg van változva világ cu totul [vollkommen]. (S; KA, geb. 1912)<br />
Mikor mennek ki, mai ales [vorwiegend; insbesondere] vasárnaponként, ott csak világot látsz,<br />
gyermekeket, sokat, öregeket, ifjakat, nem bírsz menni a zúton. (Sz; BSM, geb. 1925)<br />
Diese Art des sog. „N-Typ”-Kodewechsels entspricht im Grunde genommen dem emblematischen<br />
Sprachwechsel nach Poplack (1980:596, zitiert in Bechert/Wildgen 1991:65), der in den Fällen<br />
vorliegt, in denen die eine Varietät im eigentlichen Satz, die andere Varietät „in eingeschobenen,<br />
vorangestellten oder angehängten Elementen wie Ausrufen, kurzen Fragen, Redewendungen, die<br />
210
nur locker in den Satz einbezogen sind”, gebraucht wird. Diese sprachlichen Elemente wirken<br />
hierbei als Emblem bzw. Symbol für die Zweisprachigkeit einer im übrigen einsprachigen<br />
Äußerung.<br />
Ausrufe:<br />
Mik köttük bé lábát, kezit, vajde mine [oh weh; weh(e) mir]! (S; PJ, geb. 1892)<br />
Még ott na, gyerekek, összeverekedtünk, vajde kapul nosztru [weh(e) uns!], hogy vót ott.<br />
(S; KA, geb. 1912)<br />
De mikor az elragadta, domnule [oh mein Gott!], ı tudja, hogy bírta szegén, de nem bírt lehelni.<br />
(S; KA, geb. 1912)<br />
Melliket meglıtték, mellikek meghóttak, vaj de kápul lor [weh(e) ihnen]! (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Tízen vótunk otthon. Vai de capul nostru[weh(e) uns]! Régen jó vót, vótak marhák, vótak<br />
disznók, vótak johok otthon. (Sz; KBN, geb. 1903)<br />
Drágaság van, nincs az embernek, ami kell. Erdı nincs, a mezı – vaj de capul lui [weh(e) ihm]!<br />
– egy botot nem bír levágni az erdırıl. (Sz; FP, geb. 1908)<br />
Hárman vótak. Vajde kapul [oh weh!], hogy éltek a gyermekek. (Dobrudschaer Tschango; KSR,<br />
geb. 1900)<br />
Akkor magyar leánok jöttek hozzánk, stii [weißt du], mondják vala, ez magyar, mondják vala ezek<br />
a katonák, hogy én beszélek vala magyar leányokval, de ık nem. (N; DGy, geb. 1907)<br />
Redewendungen:<br />
Presedinte Tamás, mellik vót tizennégy évig presedint, ku radasina, de la mama draculi [wo der<br />
Teufel gute Nacht sagt]. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Komunizmba az embernek nisen kamása pe piele [kein letztes Hemd mehr haben].<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
Kérték, amit akart mondani ı pe ultimul cuvînt [als letztes Wort]. (Sz; MGy, geb. 1905)<br />
211
Der Anteil des sog. „N-Typ“-Kodewechsels beträgt im nördlichen Tschango-Dialekt 25, 93 %,<br />
im südlichen 32, 70 % und im Székler Tschango-Dialekt 39, 08 %.<br />
Nord<br />
25,93%<br />
Süd<br />
32,7%<br />
Székler<br />
39,08%<br />
5.2.3. „G-Typ”-Kodewechsel<br />
Beim „G-Typ”-Kodewechsel „werden die gastsprachlichen Einlagen mit Hilfe von gastsprachlichen<br />
Morphemen in die entsprechenden Äußerungen integriert. Dies bedeutet, dass die<br />
basissprachlichen Wörter aktive basissprachliche Morpheme, die gastsprachlichen Wörter<br />
wiederum aktive gastsprachliche Morpheme enthalten, die zusammen eine zweisprachige<br />
Äußerung bilden.” (Lanstyák 2006: 124-125)<br />
Die der Integration dienlichen gastsprachlichen, rumänischen Morpheme sind unterstrichen.<br />
Bémentem a zállomásra, Bákóba, illien vagoane de platforme (Pluralsuffixe)[Güterwagen] vótak,<br />
mellikvel hordták a kavicsot. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
Ezek futtak,(...) s-au predat mind. (N; PoA, geb. 1908)<br />
(vgl. rum a se preda ’sich ergeben’; zusammengesetztes Perfekt: Reflexivpronomem se/s + Hilfsverb avea ’haben’<br />
in 3. Pers. Pl. + Partizip –t) .<br />
Szohaszem felejtem el, jöttek a katonaszágtól, eljöttek Bákóból, a înconjurat, elvittek a<br />
páterokval, mind. (S; KA, geb. 1912)<br />
(vgl. rum a înconjura ’umringen’; zusammengesetztes Perfekt: Hilfsverb avea ’haben’ in 3. Pers. Sg. + Partizip –t) .<br />
Akkor, mikor a cedat, akkor gyalog jöttünk Jásig. (Sz; BA, geb. 1917)<br />
(vgl. rum a ceda ’(dem Feind eine Stadt übergeben’; zusammengesetztes Perfekt: Hilfsverb avea ’haben’ in 3. Pers.<br />
Sg. + Partizip –t) .<br />
212
In den folgenden Beispielen werden die syntaktischen Verhältnisse anstatt der ungarischen<br />
Suffixe durch rumänische Präpositionen ausgedrückt:<br />
Gyet mentünk la apus [gen/Richtung Westen]. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Jártunk Románvároszba, la cenaclu [in den Literatenkreis]. (N; SzP, geb. 1918)<br />
Mikor valánk în clasa doi [in der zweiten Klasse], kellett beszéljünk románul.<br />
(N; DKM, geb. 1934)<br />
In luna august [im Monat <strong>August</strong>] kiszáradtak komplet. (S; TM, geb. 1925)<br />
In timpul lui Mihai [zur Zeit des Königs Michael] erıszen tiltottak, hogy ne beszéljünk úgy!<br />
(S; TM, geb. 1925)<br />
Megfogták tíz suskapujval,szedték a pujt, s az asszony tett bé a tarisznyába, megfogták, s csánt tíz<br />
hónapot la locul de munca [(die Strafe) am Arbeitsplatz (verbüßen)], kellett dolgozzék hiába.<br />
(Sz; HP, geb. 1901)<br />
Der höchste prozentuale Anteil des sog. „G-Typ”-Kodewechsels, der vor allem von Sprechern<br />
mit Rumänisch als dominanter Sprache verwendet wird, findet sich mit 65, 43 % im nördlichen<br />
Tschango-Dialekt; im südlichen Tschango-Dialekt beträgt er 46, 15 %, im Székler Tschango-<br />
Dialekt dagegen nur 27, 59 %.<br />
Nord<br />
65,43%<br />
Süd<br />
46,15%<br />
Székler<br />
27,59%<br />
5.2.4. „F-Typ”-Kodewechsel<br />
Lanstyák (2006: 134) bezeichnet denjenigen grammatikalischen Typ des Kodewechsels, bei dem<br />
die gastsprachlichen Einlagen nicht mit formellen Mitteln in die Basissprache integriert werden,<br />
213
obwohl diese strukturell erforderlich wären, als „F-Typ”-Kodewechsel, um darauf hin zu weisen,<br />
dass in den betreffenden Äußerungen die notwendigen formellen Mittel fehlen.<br />
Im Gazda-Material lässt sich nur ein Beleg für diesen Kodewechseltyp finden:<br />
Egy gülü 42 kilász vót. Mellik ment el, ment kárte de vizita [Visitenkarte] zoroszhoz. Ott robbant<br />
nálik. (N; BuP, geb. 1919)<br />
[„Eine Kanonenkugel wog 42 Kilo. Diejenigen, die erfolgreich abgeschossen wurden, flogen (als<br />
eine Art von) Visitenkarte zu den Russen. Dort – bei den Russen – explodierten sie auch.” ]<br />
Bei Verwendung von basissprachlichen Morphemen müsste die gastsprachliche Einlage kárte de<br />
vizita ’Visitenkarte’mit dem ungarischen Modalissuffix -ként versehen werden, um die adverbiale<br />
Bestimmung der Art und Weise als eine Art von Visitenkarte in die basissprachliche Äußerung zu<br />
integrieren; bei Verwendung von gastsprachlichen Mitteln müsste die rumänische Konjunktion ca<br />
’als’ angewandt werden.<br />
5.2.5. Der sog. „X-Typ”-Kodewechsel, bei dem die Frage der Integration (das Vorhandensein<br />
oder Fehlen der Endungen) wegen der Bruchstückhaftigkeit der Äußerungen irrelevant ist,<br />
kommt im Material Gazdas kein einziges Mal vor.<br />
5.3. Funktionen des Kodewechsels<br />
Oksaar (1980: 47) unterscheidet zwischen situativer (externer) und kontextueller (interner) Kodeumschaltung:<br />
„Situative Kodeumschaltung liegt vor, wenn die Konstituenten des kommunikativen<br />
Aktes, z.B. Gesprächspartner oder Thema sich ändern. Die Hauptfaktoren der kontextuellen<br />
Kodeumschaltung sind das linguistische Repertoire und die interaktionale Kompetenz des Sprechers.<br />
Die Bedingungen sind häufig Wortnot, aber auch sozio-psychologischer Art, wie z.B. emotionale<br />
Gründe, Prestige.”<br />
Während der kontextuelle Kodewechsel mit der sprachlichen Kompetenz des Sprechers verbunden<br />
ist und so zur sprachlichen Bedarfsdeckung dient, wird der situative Kodewechsel von den<br />
Gazda-Informanten eingesetzt, um z.B. die rumänischsprachigen Äußerungen anderer Personen<br />
zitieren zu können.<br />
Die eigentliche Stärke des rumänischsprachigen Einflusses wird deshalb auch am kontextuellen<br />
Kodewechsel deutlich.<br />
214
5.3.1. Kontextueller Kodewechsel<br />
5.3.1.1. Referentielle Funktion des Kodewechsels<br />
Der kontextuelle Kodewechsel kommt dann zur Anwendung, wenn dem Sprecher entweder die<br />
ungarische Bezeichnung eines Begriffes gar nicht bekannt ist, oder ihm aber im Augenblick nicht<br />
einfällt. Die Fachliteratur spricht in diesen Fällen von der „referentiellen Funktion” des Kodewechsels<br />
(siehe Appel/Muysken 1987: 118, zitiert in Banaz 2002: 71).<br />
Nur anhand metasprachlicher Kommentare lässt sich mit absoluter Sicherheit bestimmen, ob<br />
die Anwendung des Kodewechsels im konkreten Fall als Anzeichen einer Abschwächung der<br />
Sprachkompetenz und somit als Attrition bzw. Sprachverlust deutbar ist oder ob man es nur mit<br />
einem vorübergehenden Lapsus des Sprechers zu tun hat.<br />
Die metasprachlichen Kommentare folgender Belege wie z.B. „nem tudom hogy mondják<br />
magyarul” [„ich weiß nicht, wie man es auf Ungarisch sagt”] oder „hogy mondják annak...”<br />
[„wie sagt man auf Ungarisch...?”] machen deutlich, dass den Sprechern das jeweilige ungarische<br />
Wort tatsächlich unbekannt ist:<br />
Nem tudom hogy mondják magyarul annak a kolonelnak [Oberst]. (S; PA, geb. 1915)<br />
Zután jöttek mászik illien – hogy mondjam – barbarii. (S; DJ, geb. 1911)<br />
Azt es tyáburnak számíttották. Például kérdezték, hogy milyen eredményem van, hogy mondják<br />
annak, origina sociala [soziale Herkunft]. (Sz; IM, geb. 1930)<br />
Járnak azok az izék, szikrázik fennrıl, trámvájok [Straßenbahn]. (S; AA, geb. 1901)<br />
[„Es fahren diese Dingsdas, die oben Funken spüren, diese Straßenbahnen.”]<br />
Aus der Anwendung des kontextuellen Kodewechsels kann aber nicht automatisch der Schluss<br />
gezogen werden, dass der Sprecher das betreffende ungarische Wort nicht kennt. Vielmehr ist<br />
davon auszugehen, dass die dominante Sprache des Sprechers das Rumänische ist; ihm ist das<br />
rumänischsprachige Äquivalent geläufiger und fällt ihm deshalb auch schneller ein.<br />
Folgende Belege zeigen, dass die Sprecher den Gebrauch der rumänischsprachigen Elemente als<br />
fremd und unangebracht empfinden und nach den entsprechenden ungarischsprachigen Äquivalenten,<br />
die hier jeweils unterstrichen sind, suchen, wobei diese ihnen nach einer kurzen Pause<br />
auch wieder einfallen; Die metasprachlichen Kommentare wie „..., magiknál, magyarul ...nak<br />
215
mondják, nem?[„in Ungarn sagt man..., nicht wahr?”] „na, hogy is van magyarul?” [„Nun, wie<br />
heißt dies auf Ungarisch?”], „..., [a]hogy mondják magyarosan” [„um es auf Ungarisch zu<br />
sagen”], „hogy mondják ezt magyarul? – igen...” [„Wie sagt man dies auf Ungarisch? Ja,<br />
genau...”] zeugen von einem guten Sprachgefühl der Sprecher, die sich darüber bewusst sind,<br />
dass sie Elemente der rumänischen Sprache verwenden, was sie zu korrigieren versuchen.<br />
Hallta, hej, hallta, hogy imádkozik vala a zén bunikám, a zén nagymámám [meine Großmutter]?<br />
(N; GyAM, geb. 1913 )<br />
Bukure te Maria – ez Üdvözlégy Mária [Ave Maria (Gegrüßet seist Du, Maria)], malaszttal<br />
teljesz szül vagyon teveled. (N; GyAM, geb. 1913)<br />
Piac vót, sz ott vótak – mind mondták – prietyenok, jóbarátok [Freunde]. (S; KA, geb. 1912)<br />
Vót szok livádánk, sz gódán – szilva [Pflaume]. (S; KA, geb. 1912)<br />
De inkább fenn mentek, aeroplanokval. Repülıgépekvel [Flugzeug]. (S; KoÁ, geb. 1910)<br />
Elvitte a kotelécskéjét, hol a purkorécskák – hogy mondják, disznócskák [Schweinchen] – benne<br />
vótak, elvitte mindenestıl, ott le döröngıztek. (S; KA, geb. 1912)<br />
Elment, katonaságot kisánta, în Krájova, Krajovába [in Craiova] sánta, ott kellett tudjon olául<br />
jól, itthon kellett beszíljen magyarul. (S; TM, geb. 1925)<br />
S a gyermek elvette az ármenyikáját – harmonika, magiknál (...). (Sz; TDR, geb. 1950)<br />
Tyábur vótam, kulák, azét! (Sz; FP, geb. 1908)<br />
Mikor vót, hogy na, vasárnap leen a nuntám vagy menyekezım [meine Hochzeit], akkor<br />
felöltöztem pénteken szép koszorúvirágossan, kendı úgy hátrakötve, úgy kicsinálva kókával, hogy<br />
jártak abba zidıbe. (Sz; TDR, geb. 1950)<br />
Tizenötödikjén az agusztnak – 1916-ba – éjfélekor húzták a harangokat, meghúztak a harangokat<br />
minden templomba Românébe, s akkor dekretálták meg: razboiu contra Austro-Ungaria s contra<br />
Germanie. Regelui Carol. Károly király. [König Carol] (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Nálunk ugye megszervezték a magyar szövetséget, vót az a – hogy mondjam, - egy organizácé,<br />
egy szervezet – magyar szervezet, amellikbe iratkoztak többen. (Sz; LHL, geb. 1920)<br />
Nekem is a nepotjaim – na, hogy is van magyarul? -, az unokáim [meine Enkel] értnek magyarul,<br />
de románul tanissák a szüleik. (Sz; IM, geb. 1930)<br />
Holnap regvel jı a vapor – hajó [Schiff], hogy mondják magyarosan -, s béviszen a zországba.<br />
(Sz; HM, geb. 1910)<br />
216
Akkor bémentek oda a kommunisták, megölték cárul Nikoláét, s telepedtek rea Rusziára...<br />
Oroszországra. (Sz; MGy, geb. 1905)<br />
Legalább egy vödröt hoznának, met én akkorára maradtam, egy köldrárém maradt, egy vödröm,<br />
az es összetörött. (Sz; TDR, geb. 1950)<br />
Der zuletzt genannte Beleg ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man die Anwendung des Kodewechsels<br />
nicht nur damit erklären kann, dass dem Sprecher der betreffende sprachliche Ausdruck<br />
nicht bekannt ist: im obigen Beleg scheint v.a. ein gewisser Automatismus eine Rolle zu<br />
spielen, gebraucht hier der Sprecher das ungarische Wort vödör ’Eimer, Kübel’schon vor dem<br />
Kodewechsel ins Rumänische, den er später wieder korrigiert.<br />
Nach Bechert/Wildgen (1991:7) kann in den obigen Fällen der Wort- bzw. Äußerungswiederholung<br />
auch von einer Neutralitätsstrategie ausgegangen werden, die die Sprecher anwenden, um<br />
eine „Entscheidung für die eine oder die andere Sprache (...) überhaupt zu vermeiden”.<br />
In unserem Falle ist eher davon auszugehen, dass die Sprecher den Kodewechsel als unangebracht<br />
empfinden; sie versuchen diesen Wechsel ins Rumänische rückgängig zu machen, indem<br />
sie aktiv nach den ungarischsprachigen Äquivalenten suchen.<br />
Weiterhin kann - gemäß dem Autorenpaar Appel/Muysken (1987: 118, zitiert in: Banaz 2002:<br />
72) - die „referentielle Funktion” des Kodewechsels dann zum Ausdruck kommen, „wenn das<br />
gesuchte Wort in der Sprache nicht existiert, oder wenn eine Umschreibung viel zu kompliziert<br />
wäre”.<br />
Belege für dieses Phänomen des themenbezogenen Kodewechsels finden sich auch in unserem<br />
Korpus; so wird besonders bei fachspezifischen Ausdrücken aus der Sachgruppe des Gemeinschaftlichen<br />
Lebens (Militärwesen, öffentliche Sphäre und religiöses Leben) wie ’Kriegsgefangener’,<br />
’Wachposten’, ’Flammenwerfer’, ’Protokoll’ oder ’Vaterunser’ ins Rumänische<br />
gewechselt; dieser Sachgruppe entstammt übrigens auch der überwiegende Teil der rumänischen<br />
Lehnwörter im gemeinsamen Lehnwortschatz der 3 Tschango-Dialekte.<br />
217
Sachgruppe des Gemeinschaftlichen Lebens<br />
Militär:<br />
Vagyol prizonier de razboi. [Kriegsgefangener](N; MP, geb. 1919)<br />
Én komandant de pulton vótam. [Zugführer] (N; MP, geb. 1919)<br />
A zipam vót ott a poszt de paza. [Wachposten] (N; MP, geb. 1919)<br />
A garda de rositól. [Rote Garde] (S; PJ, geb. 1892)<br />
Odajött egy sef de poszttal. [Befehlshaber der Wache](S; KA, geb. 1912)<br />
Ullian sötét vót, hogy csak regvel tízkor, mikor csürgettek, hogy a sef de piket keressen<br />
szekereket, s tegyen fel mindent, mi van a pikétba, jöjjön el bé, ilyen s ilyen helyt összegyőlünk.<br />
Én vótam a sef de pikét. [Befehlshaber der Wache] (Sz; BA, geb. 1917)<br />
İk mikor mentek, a zármátá român [Rumänische Armee], mikor mentek, a magyarok egy része,<br />
mellikek pénzesebbek vótak, mellikek tehetségesek vótak, azok elfuttak, otthagyták a házaikat.<br />
(Sz; HP, geb. 1901)<br />
Mikor vót ez a Venczel Józsi, s énekeljük vala Garda capitanului si archangelii din cer<br />
[Die Eiserne Garde des Kapitäns und dessen Erzengel im Himmel], kicsike leánkák vótunk,<br />
regele Mihai itt vót Bukarestbe, s csak egyszer mondja keresztapa: Ne máj énekeljétek, me az<br />
éjjel leesett. Többet nem kellett énekelni ezt a Garda capitanului-t! (Sz; HPM, geb. 1928)<br />
Mentek így a faluba, így a Garda de Fiertıl [Eiserne Garde]. (...) De eljöttek más pártidok, s<br />
leütték a gárda de fiert. (Sz; FP, geb. 1908)<br />
Mikor értünk a hegyre, akkor látom, hogy levet mindent rivóla, felteszi a csinturát ide, a banda<br />
kartust [Patronenhalter] bétette a csinturába, úgy zıd ingesen megállott hellbe, sz lehánt mindent<br />
a fıdre. (S; TG, geb. 1912)<br />
Eljött egy proektil, ullian tun anticar [Panzergeschoss], leeszett a lábamhoz, lefeküdtem, a<br />
szarkamkoz ért egészen. (S; TG, geb. 1912)<br />
Ott elément eppen erántam, vót a sáncul de comunikát [Kommunikationsschanze], sz idefelé vót<br />
sánva gödröm. (S; KA, geb. 1912)<br />
A zoroszok akkor éjjel eljöttek a sanc antikárig [Panzersperre(nschanze)], s jöttek fel, hogy<br />
jöjjenek ki onnan, hogy a kazematákot hányassák el. (Sz; EJ, geb. 1922)<br />
Mind ottmaradtak. A zemberek es, a material de razboi [Kriegsmaterial], az ágyúk, az ökrök –<br />
ökrököt fogták bé a zágyúkhoz, tettek hat ökröt, nyolc ökröt egy ágyúhoz. (Sz; FP, geb. 1908)<br />
218
Verwaltung und Recht bzw. Staat und Organisationen:<br />
Mikor osztán a zoroszok bejöttek, béjött a kommuniszt pártid [Kommunistische Partei], akkor<br />
elvették a motort. (Sz; IM, geb. 1930)<br />
Elvette a gúnyát, s a percseptor adott egy procesz verbált [Protokoll], s ha tíz napig nem fizetted<br />
ki a pénzt, akkor azt a gúnyát eladták. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Meg vót minden csinálva, az öccse lett lenne a primár, és a consiliu de frontul salvariben<br />
[Komitee der Rettungsfront] mind csak az ı emberei legyenek. (Sz; IGy, geb. 1948)<br />
Kellett menni, me mikor s – a decretat – hogy mondják – a guvern a format sediul, starea de<br />
asediu [die Regierung hielt eine Sitzung ab und verkündete den Belagerungszustand], tudja mi<br />
az? Ha te nem indulsz oda, hova kell menjél, akkor téged meglınek. (...)<br />
Avval a stare de asediuval [Belagerungszustand] a világ megijedett. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Valami cukor eltőnt a ziskolánál, neki vót a kezin abba a zidıbe, az ötvenes évekbe, akkor nem<br />
éppeg kapódott cukor, s ingemet elvettek a Magyar Népi Szövetségtıl, menjünk, vizsgáljuk meg az<br />
iskolát, a Milícia Ekonomia [Wirtschaftsmiliz]. (Sz; EJ, geb. 1922)<br />
Gesundheitswesen:<br />
A zelıbbszerit megtalálta a dezinterie cu sînge [Enteritis]. Sz a kettıdiknek vót cseróza la fikát.<br />
[Leberzirrhose](S; CsBM, geb. 1919)<br />
Nekünk ullian szervicsunk vót, hogy mik kellett adjunk prim ajutor [erste Hilfe], ha ellıtték a<br />
másikot. (S; PJ, geb. 1892)<br />
Religion und Kirche:<br />
Mondtam egy Tatöl nosztrut [Vaterunser]. Há. Csak Tatöl nosztrut, sz azóta nem még szérött a<br />
feje. (N; PBR, geb. 1907)<br />
Háromszor elmondják a tatal nostrut, s a Bucure te Maria-t [Ave Maria (Gegrüßet seist Du,<br />
Maria)].(Sz; AAK, geb. 1934)<br />
Auch bei Berufsbezeichnungen jeglicher Art wird der Kodewechsel ins Rumänische angewandt:<br />
Bejött egy fekete, vala major de la szekuritáte [Major der Staatssicherheit]. (N; DGy, geb. 1907)<br />
219
Menek ki ide Szkurtöturába, nezzem meg, vala-e itt a sef de echipa [Brigadier, Leiter einer<br />
Arbeitsbrigade]. (N; BKM, geb. 1913)<br />
Én hazajöttem, mint lektor politik [Politagitator]. (N; MP, geb. 1919)<br />
Vót Ambrusz Péter sz Petri Mihály, ezek vótak a gárda trenului [Zugwächter].<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
A népje vót sef contábil [Oberbuchhalter] a kooperativánál, asszonyt fogadtak, ki ügyelte a<br />
gyermekecskéjét. (Sz; GGy, geb. 1934)<br />
Jól vót a director generállal [Generaldirektor], s most, hogy bajba került, segittette az es.<br />
(Sz; IGy, geb. 1948)<br />
Varga Demeter vót az ajutor de primar [Bürgermeistergehilfe]. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Die Personennamen einschließlich der damit verbundenen Titel werden in rumänischer Sprache<br />
ausgedrückt:<br />
Mikor vót ez a Venczel Józsi, s énekeljük vala Garda capitanului si archangelii din cer, kicsike<br />
leánkák vótunk, regele Mihai [König Michael] itt vót Bukarestbe (...). (Sz; HPM, geb. 1928)<br />
Rusziába cárul Nikolae [Zar Nikolaus] vót, melyik vót verekedésvel, a 16-i verekedésvel, ı<br />
segítette Romániát. Akkor bémentek oda a kommunisták, megölték cárul Nikoláét, s telepedtek<br />
rea Rusziára ... Oroszországra. (Sz; MGy, geb. 1905)<br />
Sz akkor mondták, hogy Stefan cel Mare [Stefan der Große] ment a zúton. (...) Győrőt tettek<br />
leánkának a kezire, sz akkor leánkát vitte Stefan cel Mare. (S; KA, geb. 1912)<br />
Sz akkor bejött general Tulea [General Tulea] a kavalerisztokval, sz megfogdoszta ıket mind. (...)<br />
Eljött general Tulea, sz végeztek. (...) kijött general Tulea, sz a zemberek isznak vala a sáncból.<br />
(N; MP, geb. 1919)<br />
S lejött parintele Hodin [Pater Hodin]. (Sz; HPM, geb. 1928)<br />
In den folgenden Kodewechsel-Belegen ist das jeweilige fachspezifische Wort Element einer<br />
Präpositionalphrase in Adverbialfunktion.<br />
Im untenstehenden Beispiel scheint der Gazda-Informant die ungarische Bezeichnung für<br />
’Kavallerie’: lovasság nicht zu kennen und gebraucht deshalb das rumänischsprachige<br />
Äquivalent: cavalerie; gleichzeitig bezeichnet er aber auch das damit verbundene Verhältnis der<br />
220
Lokalität durch die Anwendung der zur Ortsbestimmung dienenden Präposition la automatisch<br />
mit rumänischen grammatischen Mitteln:<br />
Martinen pop, a zolá pop, az öccse vót kolonel, la 12 cavaleri [sein Bruder war Oberst in der 12.<br />
Kavallerie], nyolcszázat meglıtt a pop. (N; MP, geb. 1919)<br />
Weitere Beispiele:<br />
Sz osztán zután felíródtak nyomorúk la diviza Tudor Vladimirescu, felíródtak, sz jöttek ide<br />
verekedészbe. [in die Division Tudor Vladimirescu eintreten](S; KFB, geb. 1921)<br />
Felvette német mind la armata germana. [in die Deutsche Armee aufnehmen]. (N; MP, geb.<br />
1919)<br />
Vitték oda, la baza. [zum Stützpunkt] (N; SzP, geb. 1918)<br />
Akkor, mikor odaértek a németek, hogy menjenek átal Beszarábéba, aszonták, partizán felment<br />
oda templomtoronyba, osztán onnan bírtak telefonálni, bírtak beszélgetni, sz ott beszélgettek pe<br />
front [an der Front]. (S; KA, geb. 1912)<br />
Elvitték Ruszéba, la linia întîia [zur Front], onnat elfutott haza, sz ott ült odabé.<br />
(S; BLX, geb. 1929)<br />
Mikor jı az azsent, kettıkor, na, gyere, menjünk, menjünk pe linia întîa [zur Front].<br />
(S; TG, geb. 1912)<br />
Jöttünk la komándá [auf Befehl], de vótak timpok, hogy fără comanda [ohne Befehl].<br />
(N; PoA, geb. 1908)<br />
Amikor lıni kezdtek cu aruncator de flacari [mit Flammenwerfern] – nekünk nem vót, az<br />
oláhoknak – mind béfogtuk a zegészet. (S; KA, geb. 1912)<br />
Onnat domnule kivájtak lapátval, oda kihúztak, sz elvittek osztán, visszavittek la post primul<br />
ajutor [zur Unfallstation]. (S; KA, geb. 1912)<br />
Mikor elmentem la propaganda kommuniszt [zur kommunistischen Propagandaarbeit übergehen],<br />
attól vótam liberabb. (N; MP, geb. 1919)<br />
Hogy kell sánjuk, mondták, kell hagyjuk a régit, menünk la komunizm. [zum Kommunismus<br />
übergehen] (N; MP, geb. 1919)<br />
Eljöttek ide, de la consilie [vom Ortsrat], eljöttek ide a házamhoz, megnézték, írtak fel, sz adták<br />
oda a zembernek! (Sz; HPM, geb. 1928)<br />
221
Akkor odavittek, s bényomtak oda az autóba, s elvittek. La szekuritáte. [Zur Staatssicherheit<br />
bringen] (Sz; FP, geb. 1908)<br />
Húszan béjöttek a házba, íródjam fel la kollektív [in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft<br />
eintreten]. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Elvettík a helyit, engemet bevettek la tyábur [als Großbauer], kóták nagyok. (N; PoA, geb. 1908)<br />
Sz a pe ziua florilor [am Palmsonntag] megint elvittek. (N; DGy, geb. 1907)<br />
Mik innen vótunk hozva de Alexandru cel Bun [von Alexander dem Guten], hogy legyünk<br />
goszpodárok, sz utánunk tanuljanak az oláok esz, leenek goszpodárok. (S; DJ, geb. 1911)<br />
Der untenstehende Kodewechsel dient wohl eher zur Betonung der rumänischen Identität:<br />
Nem isz tudjuk mi magyar... E roman satul. Români sîntem, nu sîntem maghiari.<br />
[Auch Ungarisch können wir nicht richtig... Dies ist ein rumänisches Dorf. Wir sind Rumänen,<br />
keine Ungarn] (N; GyAM, geb. 1913)<br />
5.3.1.2. Sprachliche Auslöseelemente des kontextuellen Kodewechsels<br />
Die Psycholinguistik stellt die Prozesse, die sich im Gedächtnis der Bilingualen abspielen, wenn<br />
sie verschiedene Sprachsysteme zueinander in Kontakt bringen, in den Vordergrund.<br />
Unter den psycholinguistischen Modellen zur Erklärung des Codewechsels ist das Konzept der<br />
Auslösefunktion („triggering”) nach Clyne (1987) erwähnenswert, das besagt, „dass Wörter, die<br />
beiden Systemen angehören oder mit Elementen beider Systeme syntaktisch verbunden werden,<br />
[Codeswitching auslösen. Da diese Auslöseelemente] beiden Sprachsystemen zuzuordnen sind,<br />
verliert der Bilinguale sein sprachliches Orientierungsvermögen und setzt somit seine Äußerung<br />
in der anderen Sprache fort” (Földes 1996: 42).<br />
„Die Auslösefunktion kann nach Clyne (1987: 744) durch a) lexikalische Transferenz<br />
[Lehnwörter], b) bilinguale Homophone, c) Eigennamen oder d) Kompromissformen zwischen<br />
beiden Sprachsystemen übernommen werden” (Banaz 2002: 87).<br />
222
a) lexikalische Transferenz (Lehnwörter)<br />
In Gazdas Material finden sich folgende Belege für als Auslösewörter fungierende<br />
Transferenzen, die einfache lexikalische Transfers oder auch morphosyntaktisch an das<br />
Paradigma des Ungarischen angepasste Formen sind.<br />
Die den Kodewechsel auslösenden rumänischen Lehnwörter sind jeweils unterstrichen.<br />
Hat kilo puj la zi de munka, három kiló búza. (N; PoA, geb. 1908)<br />
[„6 Kilo Mais pro Arbeitstag, 3 Kilo Weizen.”]<br />
Az a zember direktor vót la cala ferate pînă la Budapesta. (S; PJ, geb. 1892)<br />
[„Dieser Mann war Direktor bei der Eisenbahn, bis nach Budapest.”]<br />
Sz egy hat gülü a tunból a distrus mindent. (N; BuP, geb. 1919)<br />
[„(...) 6 Kugeln aus der Kanone haben alles zerstört.”]<br />
Grupával vótam, én vótam a komandat de grupa ott. (Sz; EJ, geb. 1922)<br />
[„Ich war bei der Gruppe, ich war dort der Gruppenkommandant.” ]<br />
(hierbei spielt auch die Suche nach dem geeigneten fachspezifischen Ausdruck aus dem<br />
Militärwesen eine wichtige Rolle)<br />
Meglátta a zorosz, hogy ullian nagy ereje van a románnak, nem még serkált pîna la 23 auguszt.<br />
(N; BuP, geb. 1919)<br />
[„Die Russen sahen, dass die Rumänen sehr stark waren, so dass sie gar nicht mehr versucht<br />
haben – bis zum 23. <strong>August</strong> [zumindest] – diese anzugreifen.” ]<br />
(in Betracht gezogen muss hier weiterhin die Lehnübersetzung nem még (vgl. rum. nu mai)<br />
Húgom embere sánja a szervicst la calea ferata [bei der Eisenbahn] (N; BVV, geb. 1932)<br />
(in Verbindung mit Lehnübersetzung sánja a szervicst < rum. a face servici ’arbeiten; Dienst<br />
leisten’; hier in hybrider Form)<br />
Sántam la Rîmnic [in Rîmnic] ármátá. (N; DGy, geb. 1907)<br />
(in Verbindung mit Lehnübersetzung sántam ármátá < rum. a face armată ’beim Militär dienen’;<br />
hier in hybrider Form)<br />
b) bilinguale Homophone<br />
Hier dient „ein in den beiden Sprachen ungefähr gleichlautendes und gleichbedeutendes Wort als<br />
„Gelenk”, als Überleitung von der einen zur anderen Sprache” (Bechert/Wildgen 1991: 67).<br />
Zután, de elıbb nem, sak szültü sz egy kisi muzsika, de gura [Blasmusik]. (N; MP, geb. 1919)<br />
(vgl. ung. muzsika, rum. muzică)<br />
223
A puska mitralier [Maschinengewehr] elıttem vót, mikor Beszarábiát visszavették!<br />
(Sz; MGy, geb. 1905)<br />
(vgl. ung. puska, rum. puşcă; auch: fachspezifischer Ausdruck)<br />
Mikor felértünk Szucseávához, mentünk vót vagy két napot vagy hármat, me nappal tettek be az<br />
iskolába, gyalog, a hátunkon 150 kártus, a puska, foaie de cort [Zeltplane], mantáva, lapát,<br />
helléc, minden. (Sz; EJ, geb. 1922)<br />
Vót itt egy bába (< rum. babă ’alte Frau’), Éva, a stiut a cînta, si a cîntat la toate lumea, care a<br />
venit. (N; GyAM, geb. 1913)<br />
in Verbindung mit lexikalischer Tranzferenz: „Es gab hier eine alte Frau; Éva konnte singen und<br />
sang auch jedem etwas vor, der zu ihr kam.“<br />
Die oben angeführten Beispiele dienen weiterhin als Belege für die konsekutive Auslösung des<br />
Sprachwechsels. „Nach Clyne (1987: 755) können Wörter sowohl konsekutiv als auch antizipatorisch<br />
einen Sprachwechsel auslösen” (Banaz 2002: 88).<br />
Beim konsekutiven Codeswitching erfolgt der Sprachwechsel nach dem Auslösewort.<br />
Den antizipatorischen Sprachwechsel, bei dem der Kodewechsel in Erwartung eines Auslösewortes,<br />
d.h. bereits vor der Artikulation desselben erfolgt, weisen untenstehende Beispiele auf,<br />
bei denen die Eigennamen Sprachwechsel für ganze Präpositionalphrasen auslösen:<br />
c) Eigennamen<br />
Németek mind rakták fel ıköt, mind, pîna la Sculeni [bis nach Sculeni]. (N; MP, geb. 1919)<br />
Járt tátá verekedészbe, gyet vót la Plevna [in Plevna], sz zután mász esztendıbe vót ez a mász<br />
verekedész.(N; DDR, geb. 1924)<br />
Mikor innét kiszabadult, ment la Tîrgu Ocna [in Tîrgu Ocna], sánt ott. (S; TM, geb. 1925)<br />
Visszahúzódtunk idefelé, osztán mentünk elé, elé, bejártunk messze, la muntii Caucaz [bis zum<br />
Kaukasus-Gebirge]. (S; KoÁ, geb. 1910)<br />
S ezeket la Sighetu Marmat [zur Insel Marmat], oda vitték el, s ott halt meg. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Den konsekutiven Sprachwechsel bei Eigennnamen zeigen folgende Beispiele:<br />
Pászkán, Jászár, Tîrgu Neámc, pînă mînastirea Neamtului [bis zum Kloster NeamŃ]mentünk. (N;<br />
BuP, geb. 1919)<br />
224
Jöttek Románéba, la Regatul vechi [in das alte Königreich, d.h. in das Rumänien vor dem ersten<br />
Weltkrieg]. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
d) Kompromissformen zwischen beiden Sprachsystemen<br />
In unserem Sprachkorpus finden sich keine zwischensprachlichen Kompromissformen unter den<br />
Auslösewörtern, was durch die hochgradige Unterschiedlichkeit der beiden Sprachen Ungarisch<br />
und Rumänisch erklärbar ist. So ist es auch kein Wunder, dass sich im Material Gazdas nur drei<br />
Beispiele für bilinguale Homophone finden lassen.<br />
5.3.2. Situativer Kodewechsel<br />
5.3.2.1. Zitierfunktion des Kodewechsels<br />
Die Zitierfunktion des situativen Kodewechsels kommt v.a. dann zur Geltung, wenn der Sprecher<br />
innerhalb des auf Ungarisch geführten Gespräches die rumänischsprachigen Äußerungen einer<br />
anderen Person wortwörtlich – sozusagen im Original-Ton – oder sinngemäß zitieren möchte.<br />
In den folgenden Belegen werden die Äußerungen anderer, rumänischsprachiger Personen nicht<br />
vollständig, sondern nur anhand der vernommenen Schlüsselwörter zitiert:<br />
Aszonta: bombáznak, pe kásza. Jön a bomba a házunkra. (Sz; BKB, geb. 1908)<br />
[„Er sagte: sie werfen mit Bomben, auf das Haus. Die Bombe fällt auf unser Haus.”]<br />
Béjött a házba: Bade Anton, fel kell íródjál! (N; PoA, geb. 1908)<br />
[„Er kam ins Haus: Onkel Anton, du musst dich einschreiben!”]<br />
Sétáltak a zurak ott el, a bojérok. Uite pe ala, mennél hamarabb teszünk istrángot a nyakukra, s<br />
felhúzzuk a fákra. (Sz; HM, geb. 1910)<br />
[„Die Gutsherren, die Bojaren gingen [an der Menschenmenge]vorbei. Seht euch die an;<br />
wir sollten ihnen so schnell wie möglich den Strick um den Hals legen und sie an die Bäume<br />
aufknüpfen.”]<br />
225
Im Gazda-Korpus werden nicht nur Äußerungen, sondern auch Inschriften oder Titel von<br />
Theaterstücken zitiert:<br />
Keresztfát tettek nekik, s felírták: Eroi necunoscuti. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
[„Man stellte für sie ein Kreuz auf und versahen es mit der Aufschrift: Unbekannte Helden.”]<br />
S olyan komikus darabokat csináltunk. (...) Ivan la teatru (...). (Sz; SJ, geb. 1903)<br />
[„Und wir haben solche Komödien aufgeführt. (...) Ivan im Theater (...)”]<br />
Die wörtliche Wiedergabe einer Äußerung kann – wie anhand des untenstehenden Belegs<br />
deutlich wird – unmarkiert erfolgen:<br />
Vótak bicsiklétászok. (...) Közelednek vala a zorosz liniára hallgatva bicsiklétával. Bicsiklétát<br />
hajítják vala el, szöknek vala le bicsiklétáról, ül vala páza bicsiklétákval, sz la atac!<br />
(N; BuP, geb. 1919)<br />
[„(...) [Die Soldaten der Fahrradeinheit] warfen ihre Fahrräder weg, die Wache blieb bei den<br />
Fahrrädern und Attacke!”]<br />
oder aber markiert werden durch Redeeinleitungen wie „...azt mondták...” [„...sie sagten...”],<br />
„kérdi” [„er fragt”], „rikoltotta” [„er schrie”] bzw. metasprachliche Kommentare wie:<br />
„...románul/olául mondják...” [„...sie sagen auf Rumänisch: ...”])<br />
Abba a kámerába három német ült, azt mondták, trupa de sacrificiu [die Truppe der Opfer].<br />
(Sz; MGy, geb. 1905)<br />
Kivették, s vitték valameddig, de ı el vót esve, met ıt dolgoztatták erıst, trădător de tară<br />
[Vaterlandsverräter], ahogy mondták, s ı nehéz munkán vót. (Sz; GGy, geb. 1934)<br />
Húsvétba járnak kolindálni. Christos s-a inviat [„Christus ist auferstanden”] – ennyit mondanak.<br />
(N; BM, geb. 1930)<br />
Kérdi a zanyját: mama, ce inseamnă cuvîntul asta [„Mama, was bedeutet dieses Wort?”].<br />
(N; KJ, geb. 1932)<br />
Románul mondják vala: Rumânilor! Odesa noastră, moartea voastră. [„Rumänen! Unser<br />
Odessa, euer Tod”] (N; PoA, geb. 1908)<br />
Hégetnek! Olául mondják: Jová ho, copii si frati, Dati puŃini si nu mînaŃi, Lîngă vou alăturati,<br />
Si cuvîntul ne ascultati! [„He, Kinder und Brüder, Gebt uns etwas und nehmt es uns nicht weg,<br />
Neben euch stellen wir uns auf und erhöret unser Wort.”] (N; BM, geb. 1930)<br />
Eleget rikoltotta, salvatii ma [Rettet mich!] , a patakon ott lehallatszott. (Sz; DBK, geb. 1928)<br />
226
Tizenötödikjén az agusztnak – 1916-ba – éjfélekor húzták a harangokat, meghúztak a harangokat<br />
minden templomba Românébe, s akkor dekretálták meg: razboiu contra Austro-Ungaria s contra<br />
Germanie. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
[„Am 15. <strong>August</strong> 1916 läuteten in allen Kirchen Rumäniens die Glocken; in dieser Nacht hat man<br />
folgendes verkündet: Krieg gegen Österreich-Ungarn und gegen Deutschland.” ]<br />
5.3.2.2. Expressive Funktion des Kodewechsels<br />
Der Sprecher wiederholt hier einen zuvor auf Ungarisch geäußerten sprachlichen Ausdruck, der<br />
jeweils durch Unterstreichung gekennzeichnet wird, in rumänischer Sprache, was vor allem<br />
stilistischen Zwecken, zur Ausdrucksbetonung dient:<br />
Mámá korháni vót, din Corhan [aus Corhan], románul beszélt. (N; BKM, geb. 1913)<br />
Felment a levegıbe! In aer! [In die Luft!](S; KoÁ, geb. 1910)<br />
İ a vezetı, ı a sef. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
Akkor én: Na, állítsd meg, állítsd meg, opreste, opreste! [Halte an, halte an!]<br />
(Sz; AM, geb. 1929)<br />
Megesküdtünk a templomba, keresztapával a leányokval hazajöttünk a zén házamhoz,<br />
a vılegényem, nyirejem [mein Bräutigam] hazament a zı házához, met külön vót a menyekezınk.<br />
(Sz; TDR, geb. 1950)<br />
S akkor éjen kibútt a zegész világ a templom elejibe, ott vót a bíróház, a primaria [Gemeindehaus],<br />
ahogy mondjuk mik rományul, ott vót a bíróház, s egy olyan öregember vót, úgy hívták<br />
- nem tudom hogy hívták azt a zembert, gornis vót a zármátába. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
5.3.2.3. Verdeutlichungsfunktion des Kodewechsels<br />
Der Sprecher bestimmt hier ein zuvor auf Ungarisch geäußertes Wort in rumänischer Sprache<br />
näher, um durch diese Ergänzung die Nachricht für den Empfänger eindeutiger und verständlicher<br />
zu gestalten:<br />
Kértek ruhát [Kleidung], haine civil [Zivilkleidung], ık adnak ilyent, s én adjak olyant.<br />
(Sz; AM, geb. 1929)<br />
227
S a miniszter [Minister], Kálcsikovnak hívták a minisztru de fináncot [Finanzminister], az es<br />
adott kétszázezeret. (Sz; HP, geb. 1901)<br />
Sz nem felejtem, akkor kiraktak ezek, tudták, hogy tudok magyarul, kiraktak, hogy mondjam:<br />
Szépen kérem – mondtam – primiljen bé három katonát vagy négyet az éjszakára.<br />
Há édes katona, csak egy szobánk van. Há én úgy tudtam, hogy az a szóba, akibe tüzelünk.<br />
Nekünk nem szükséges szóba, nekünk csak szállás az éjszakára! Aszonták: katona bácsi, csak egy<br />
szobánk van. Akkor láttam, ık a háznak [Haus] mondják, lokuincának [Wohnung] , szoba.<br />
(S; PJ, geb. 1892)<br />
Micsoda szép az etika, etika jobbra, etika balra [Ethik, Ethik rechts, Ethik links], etika szusz,<br />
etika zsosz [Ethik oben, Ethik unten]. (Sz; IGy, geb. 1948)<br />
5.3.2.4. Metalinguistische Funktion des Kodewechsels<br />
Die „metalinguistische Funktion” des Sprachwechsels wird von den Sprechern nach<br />
Appel/Muysken (1987:120) dann eingesetzt, wenn diese sich „direkt oder indirekt über die<br />
Sprachen äußern möchten” (zitiert in Banaz 2002: 73).<br />
De románul portar – ez kapus -, s porcar – disznópásztort jelent. S én mind úgy mondattam:<br />
porcar! S úgy kacagtak a népek, hogy nagyszerő vót. Három órát tartott az elıadás.<br />
(Sz; SJ, geb. 1903)<br />
[„[Ungarisch] kapus ’Pförtner’ heißt auf Rumänisch portar, und disznópásztor ’Schweinehirt’ –<br />
das heißt porcar auf Rumänisch”]<br />
Melik elmenen a templomba, elmenen a temetıbe es, s elmenen a práznikba. Nálunk úgy<br />
mondják, práznik, Pusztinába – ott magyarossabban beszélnek – mondják tor. Vótunk a torba,<br />
csinálunk tort. (Sz; AM, geb. 1929)<br />
[„(...) Bei uns in Szerbek wird der ’Totenschmaus’ práznik [< rum. praznic] genannt; in Pusztina<br />
– dort spricht man ungarischer – sagt man tor.“]<br />
Nem értesz meg, az anyád luminarikáját!? Luminare, mondják a gyertyának. Az anyád<br />
lumnarikáját, azt mondja, nézd meg, mit csinálok én neked! (Sz; AM, geb. 1929)<br />
[„[Ungarisch] gyertya ’Kerze’ heißt auf Rumänisch luminare”]<br />
weitere Beispiele:<br />
Elöljáró ember vót Jánó Anti községházánál. Mik úgy mondtuk, primariánál [Gemeindehaus].<br />
(Sz; SF, geb. 1915)<br />
S Nagypatak állomásnál van, mondtuk: gáránál [Bahnhof], úgy beszéltünk akkor.<br />
(Sz; EJ, geb. 1922)<br />
228
A zölibe vitt édesanyám, a vonaton, mikor mentek, met akkor vót ez a trenul foame [Zug des<br />
Hungers] – éhség vonat -, így mondták neki, met nem vót mit enni. (Sz; SzıP, geb. 1946)<br />
A magyarok a kavaléroknak úgy mondják vala: huszárok. (N; BuP, geb. 1919)<br />
A miniszter erre azt válaszolta: Hagyjon békémet, stiu carte! Ezét a szóét – stiu carte [ich kann<br />
lesen], tudok olvasni – elvitték Bákóba, hogy én kacagtam a minisztereket, hogy nem tudnak írni!<br />
(Sz; SJ, geb. 1903)<br />
Die beiden folgenden Beispiele zeigen, dass sich die Moldauer Tschangos über die Gründe des<br />
Sprachwechsels äußerst bewusst sind und dessen Verlauf auch ausführlich beschreiben können:<br />
A román a magyarval össze van vigyittve annyira, mán könnyebben jı, hogy a csésze helyett<br />
mondjam kána, akkor mán beléfordittottam a románba. Azét csángóltunk el, azét jı ki furcsán ez<br />
a csángó beszéd, me essze van vigyittvel annyira. S osztán van az, hogy vaj tizenöt-húsz évtıl<br />
errefelé ez a román beszéd annyira beszélıdik, hát ha buszba mész, ha gyalog, s a magyar szavak<br />
úgy messzire vevıdnek elé. S ez mind csak azért, hogy nem vót ez a magyar iskola, nincs magyar<br />
mise... (Sz; PP, geb. 1940)<br />
[„Das Rumänische übt mittlerweile einen dermaßen starken Einfluss auf das Ungarische aus,<br />
dass es einem leichter fällt, anstatt csécse ’Tasse’ kána (< rum. cană ’Blechtöpfchen zum<br />
Wassertrinken’) zu sagen; und schon hat man ins Rumänische gewechselt. Durch diesen starken<br />
Einfluss des Rumänischen, der unsere Sprache durchdringt, ist es auch zu erklären, dass unsere<br />
Tschango-Sprache zu verschwinden beginnt und sich so seltsam anhört. Die rumänische Sprache<br />
ist nun schon seit 15-20 Jahren dermaßen dominant geworden, dass man, ob man nun mit dem<br />
Bus reist oder zu Fuß geht, nur noch Rumänisch hört – und die ungarischen Wörter müssen aus<br />
den Tiefen der Erinnerung hervorgeholt werden... Und alles nur deshalb, weil es keine ungarische<br />
Schule gab, weil es keinen ungarischsprachigen Gottesdienst gibt.”]<br />
Itt a csángók elcsángósodtak. Ez a csángó beszéd es vesz ki. El van veszıdve annyira, hogy ritkán<br />
van, aki itt az utcán elémenen, s azt mondja, jónapot. Már azt mondják: Bunăziua!<br />
Mert ık az iskolát románul tanulják, s mán románra fordítsák... (Sz; PP, geb. 1940)<br />
[„Die Tschangos sind hier der Assimilation ausgesetzt. Auch diese Tschango-Sprache ist im<br />
Verschwinden begriffen. Der Sprachverlust ist dermaßen fortgeschritten, dass es nur noch selten<br />
vorkommt, dass dich jemand auf der Straße mit jónapot ’Guten Tag’ begrüßt. Stattdessen sagen<br />
sie nur noch: Bunăziua! Weil sie rumänische Schulen besucht haben und alles nur noch auf<br />
Rumänisch ausdrücken...”]<br />
229
5.4. Verteilung der Kontaktphänomene in den 3 Tschango-Dialekten<br />
In diesem Kapitel wird die Verteilung der Kontaktphänomene in den Äußerungen zweisprachiger<br />
Moldauer Tschangos zusammenfassend dargestellt und anschließlich auf die Gründe der – vor<br />
allem in der Stärke des rumänischen Einflusses deutlich werdenden – Unterschiede in den jeweiligen<br />
Tschango-Gruppen eingegangen.<br />
Verteilung der Kontaktphänomene in den Äußerungen zweisprachiger Moldauer Tschangos<br />
Nördlicher Tschango-Dialekt<br />
insges.: 14.563 Wörter<br />
Kontakt-<br />
Untersuchte<br />
phänomene<br />
Anzahl<br />
der Fälle<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb der<br />
Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des Textkorpus<br />
Eigentliche Lehnwörter<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Internationalismen<br />
559<br />
201<br />
57, 39<br />
20, 64<br />
559<br />
201<br />
3, 84<br />
1, 38<br />
Rückentlehnungen 16 1, 64<br />
16 0, 11<br />
insges. 776 79, 67 776 5, 33<br />
kontextuell 81 8, 32<br />
254 1, 75<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
24 2, 46<br />
73 0, 5<br />
insges. 105 10, 78 327 2, 25<br />
Lehnbedeutungen 83 8, 52<br />
83 0, 57<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Lehnbildungen 10 1, 03<br />
49 0, 34<br />
insges. 93 9, 55 132 0, 91<br />
Gesamtanzahl<br />
der<br />
Kontaktphänomene 974 1235 8, 49<br />
230
Südlicher Tschango-Dialekt<br />
insges.: 30.036 Wörter<br />
Untersuchte Kontakt-<br />
Phänomene<br />
eigentliche Lehnwörter<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Internationalismen<br />
Anzahl<br />
Fälle<br />
710<br />
283<br />
der<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb der<br />
Kontaktphänomene<br />
56, 13<br />
22, 37<br />
Anzahl der betroffenen<br />
Wörter<br />
710<br />
283<br />
Prozentualer<br />
Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
2, 36<br />
0, 94<br />
Rückentlehnungen<br />
24 1, 9<br />
24<br />
0, 09<br />
insges. 1017 80, 4 1017 3, 39<br />
kontextuell 52 4, 11<br />
150<br />
0, 5<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
41 3, 24<br />
65<br />
0, 22<br />
insges. 93 7, 35 215 0, 72<br />
Lehnbedeutungen 143 11, 3<br />
143<br />
0, 48<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
12<br />
0, 95<br />
27<br />
0, 09<br />
Lehnbildungen<br />
insges. 155 12, 25 170 0, 57<br />
Gesamtanzahl<br />
der<br />
Kontaktphänomene 1265 1402 4, 68<br />
Székler Tschango-Dialekt<br />
insges.: 55.523 Wörter<br />
Untersuchte<br />
phänomene<br />
eigentliche Lehnwörter<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Internationalismen<br />
Kontakt-<br />
Anzahl der<br />
Fälle<br />
791<br />
484<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb der<br />
Kontaktphänomene<br />
50, 31<br />
30, 79<br />
Anzahl der betroffenen<br />
Wörter<br />
791<br />
484<br />
Prozentualer<br />
Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1, 42<br />
0, 87<br />
Rückentlehnungen<br />
35 2, 23<br />
35<br />
0, 07<br />
insges. 1310 83, 33 1310 2, 36<br />
kontextuell<br />
87 5, 53<br />
214<br />
0, 39<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
49 3, 12<br />
119<br />
0, 21<br />
insges. 136 8, 65 333 0, 6<br />
Lehnbedeutungen 108 6, 87<br />
108<br />
0, 2<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Lehnbildungen<br />
18 1, 15<br />
35<br />
0, 06<br />
insges. 126 8, 02 143 0, 26<br />
Gesamtanzahl<br />
der<br />
Kontaktphänomene 1572 1786 3, 22<br />
231
Anhand der untenstehenden Tabelle, die die prozentualen Anteile der Kontaktphänomene in den<br />
Äußerungen der Gazda-Informanten zusammenfassend darstellt, wird deutlich, dass zwischen<br />
den einzelnen Tschango-Dialekten Unterschiede in der Stärke des Einflusses der rumänischen<br />
Sprache bestehen:<br />
Prozentualer Anteil der Kontaktphänomene in den einzelnen Tschango-Dialekten<br />
Kontakt-<br />
Untersuchte<br />
phänomene<br />
Nord-<br />
Tschangos<br />
Süd-<br />
Tschangos<br />
Székler-<br />
Tschangos<br />
1. Direkte Entlehnungen<br />
(Lehnwörter)<br />
Lehnbedeutungen<br />
2. Indirekte Entlehnungen<br />
Lehnbildungen<br />
Typ G<br />
3. Kodewechsel (kontext.)<br />
Typ N<br />
5, 33 % 3, 39 % 2, 36 %<br />
0, 57 % 0, 48 % 0, 2 %<br />
0, 34 % 0, 09 % 0, 06 %<br />
65, 43 % 45, 15 % 27, 59 %<br />
25, 93 % 32, 7 % 39, 08 %<br />
Typ B<br />
7, 41 %<br />
21, 15 %<br />
33, 33 %<br />
Der Einfluss der rumänischen Sprache ist im nördlichen Tschango-Dialekt am stärksten; hier<br />
findet sich der höchste Anteil der direkten Entlehnungen mit 5, 33 %, der indirekten Entlehnungen<br />
mit 0, 91 % sowie des mit der sprachlichen Kompetenz des Sprechers verbundenen<br />
kontextuellen Kodewechsels mit 1, 75 %. Innerhalb des kontextuellen Kodewechsels überwiegt<br />
mit 65, 43 % der „G-Typ”-Kodewechsel, der vor allem von Sprechern mit Rumänisch als<br />
dominanter Sprache verwendet wird.<br />
Im Székler Tschango-Dialekt ist der Einfluss der rumänischen Sprache am schwächsten: der<br />
prozentuale Anteil der direkten Entlehnungen beträgt hier 2, 36 %, der indirekten Entlehnungen<br />
0, 26 %; das Kontaktphänomen des kontextuellen Kodewechsels macht 0, 39 % aus. Hier findet<br />
sich mit 33, 33 % auch der höchste prozentuale Anteil des „B-Typ”-Kodewechsels, der relativ<br />
gute Kenntnisse in der (tschango)ungarischen Basissprache voraussetzt.<br />
Der Dialekt der südlichen Tschangos nimmt eine Zwischenposition ein.<br />
232
Im folgenden soll näher auf die Gründe eingegangen werden, die zu diesen Unterschieden geführt<br />
haben.<br />
In den vorherigen Kapiteln dieser Arbeit wurde schon die spezifische historische Situation der<br />
Tschangos erwähnt, die letztlich den Sprachverlust der Moldauer Ungarn bewirkte.<br />
Da es sich bei ihnen um heterogene Gruppen handelt, trat der Sprachverlust in den unterschiedlichen<br />
Gruppen auch zu unterschiedlicher Zeit und in unterschiedlicher Stärke ein.<br />
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll nun die Siedlungsgeschichte der Tschangos näher<br />
betrachtet werden.<br />
Aus der Siedlungsgeschichte der Moldauer Ungarn (siehe Pozsony 2005: 135-147) wird deutlich,<br />
dass die Vorfahren der Nord- und Süd-Tschangos – aus der Region Mezıség kommend – in das<br />
Moldau-Gebiet schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts eingewandert<br />
sind.<br />
Die Einwanderung der aus den Komitaten Csík, Kászon, Gyergyó und Háromszék des östlichen<br />
Széklerlandes (in Siebenbürgen) stammenden Vorfahren der Székler Tschangos erfolgte erst viel<br />
später, genauer gesagt, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des Madéfalver Massakers<br />
(1764).<br />
Zu Einwanderungswellen aus dem überbevölkerten und an landwirtschaftlichem Anbaugebiet<br />
begrenztem Széklerland (Siebenbürgen) in das benachbarte Moldau-Gebiet kam es noch bis zum<br />
19. Jahrhundert.<br />
Ferenc Pozsony verweist darauf (2005: 138), dass die Herkunftsregion dieser Siedler, das Széklerland,<br />
im 18. Jahrhundert schon über ein entwickelteres ungarischsprachiges Schulsystem verfügte<br />
und hier zudem eine intensive muttersprachliche Religionausübung vorhanden war.<br />
Aus diesem Grunde verfügten die Székler Tschangos über ein ausgeprägteres ethnisches und<br />
sprachliches Selbstbewusstsein, was sich u.a. auch darin manifestierte, dass sie am eindringlichsten<br />
die muttersprachliche Liturgie beanspruchten, ihre Kantoren meistens aus dem Széklerland<br />
beriefen, viele ungarischsprachige Gesangs- und Gebetsbücher bewahrt haben sowie intensive<br />
Beziehungen zum Franziskanerkloster in Csíksomlyó unterhielten.<br />
Tschango-Forscher wie z.B. Attila T. Szabó (1981), Vilmos Tánczos (1999a) oder Ferenc<br />
Pozsony (2005) gehen davon aus, dass solche Dörfer wie Forrófalva, Gorzafalva, Klézse oder<br />
Lujzikalagor über eine ältere ungarische Einwohnerschaft mittelalterlichen Ursprungs verfügten,<br />
233
die von der Ansiedlung durch die Székler überdeckt wurde, wodurch der ursprüngliche südliche<br />
Tschango-Dialekt beeinflusst wurde.<br />
Während es also zu Kontakten zwischen den südlichen und Székler Tschangos kam – auch ein<br />
Blick auf die Landkarte zeigt, dass die Süd-Tschangos von der Székler Tschango-Gruppe geradezu<br />
„umarmt” werden – vermischten sich, wie sprachgeographische Untersuchungen bezeugen,<br />
die nördlichen Tschangos nie mit den Széklern, „was damit zu erklären ist, daß die nördlichen<br />
Tschangosiedlungen dichter bevölkert waren, und für diese schneller wachsenden Dörfer selbst<br />
die Bevölkerungsabwanderung charakteristisch war” (Tánczos 1999a: 236)<br />
Untersuchungen über die Heiratsbräuche der Moldauer Tschangos (vgl. Halász 2002: 113-138)<br />
zeigen, dass es bis zur 1962er Kollektivisierung, die eine Massenmigration in die Städte bewirkte,<br />
zu keinerlei Paarbeziehungen zwischen den nördlichen Tschangos und den anderen Tschango-<br />
Gruppen kam.<br />
Die Nord-Tschangos nahmen nicht nur innerhalb der einzelnen Tschango-Gruppen bzw. –<br />
Dialekte eine isolierte Stellung ein:<br />
Unser Szabófalver Sprachmeister, Mihály Perka verweist in einem Interview darauf, dass – im<br />
Gegensatz zu den Székler Tschangos – die nördlichen Tschangos vollständig von der Region<br />
Siebenbürgen isoliert waren, was sich u.a. auch darin zeigt, dass sie über keine Kontakte zum<br />
Franziskanerkloster in Csíksomlyó verfügten:<br />
„Ott [Klézsén] más a helyzet. Mi teljesen el vagyunk zárva Erdélytıl. Ott a közelben letelepedtek<br />
a székelyek a XIX. és XX. században, s aztán megvolt az út Csíksomlyóra. A kapcsolat megvolt.<br />
Nálunk nem volt kapcsolat.” (In: Romániai Magyar Szó, 3. Juni 2004)<br />
Der sprachliche Assimilationsprozess begann bei der isoliertesten und ältesten Gruppe der<br />
Moldauer Ungarn, den nördlichen Tschangos viel früher und intensiver als in den anderen<br />
Tschango-Gruppen einzutreten, was anhand konkreter statistischer Angaben auch nachweisbar<br />
ist:<br />
Während 1859 – den Angaben der ersten Moldauer Volkszählung gemäß – noch 86,6% der<br />
katholischen Bevölkerung des Komitats Bacău/Bákó und 94,6% des Komitats Roman/Román<br />
Ungarisch als Muttersprache angab (vgl. Szabados 1990: 91-92, Vincze 2004: 15), betrug der<br />
Anteil der ungarischen Muttersprachler 1898 im Komitat Bacău/Bákó 78%; im Siedlungsgebiet<br />
234
der nördlichen Tschangos wiederum, im Komitat Roman/Román nur noch 61% ( vgl. Statistiken<br />
des Großen Geographischen Wörterbuches Rumäniens (Marele DicŃionar Geografic al României<br />
1898-1902, zitiert in: Szabados 1990: 93-95, Vincze 2004: 16)<br />
235
Der Ethnologe Vilmos Tánczos besuchte Mitte der 90er Jahre diejenigen Moldauer Dörfer, in<br />
denen er „auf der Grundlage der konfessionellen Angaben der Volkszählung aus dem Jahre 1992,<br />
der volkskundlichen Fachliteratur, sowie der Moldauer Mitteilungen vor Ort noch eine ungarischsprachige<br />
Bevölkerung annehmen konnte”(Tánczos 1999a: 246). Er kam zu dem Ergebnis, dass<br />
„43 % der Moldauer Katholiken (von 240. 038 Personen 103. 543) – deren Großteil man aufgrund<br />
fundierter Argumente als ungarischstämmig bezeichnen kann – in solchen Ortschaften<br />
[leben], in denen überhaupt noch ungarisch gesprochen wird. Der bedeutende Teil der ungefähr<br />
hunderttausend Personen ausmachenden katholischen Bevölkerung dieser Ortschaften ist sprachlich<br />
auch vollkommen rumänisiert, so daß die Zahl der in [der östlichen Provinz Rumäniens, der]<br />
Moldau lebenden, noch ungarisch sprechenden Tschangos auf ungefähr 62. 000 Personen<br />
festgelegt werden kann. Dies bedeutet etwa ein Viertel (25, 8 %) der Moldauer Katholiken”<br />
(Tánczos 1999a: 254).<br />
Ferenc Pozsony hat nun (2005: 144) die Angaben von Tánczos in folgender Tabelle zusammengefasst,<br />
die auf die sog. „inneren dialektalen Zonen” der Moldauer Ungarn eingeht:<br />
Name der Tschango-Gruppe Anzahl der Zahl der Anteil der Ungarischuntersuchten<br />
Dörfer<br />
ungarisch<br />
sprechenden<br />
Personen<br />
sprachigen<br />
(innerhalb<br />
der Katholiken)<br />
Nördliche Tschangos 7 8.180 38,77 %<br />
Südliche Tschangos 6 9.520 73,34 %<br />
entlang des Szeret<br />
Székler<br />
Tschangos entlang d. Tázló<br />
24<br />
19<br />
23.260<br />
6.095<br />
81,9 %<br />
68,14 %<br />
entlang des Tatros 29<br />
15.170<br />
47,21 %<br />
Insgesamt 85 62.225 60,09 %<br />
Aus der obigen Tabelle wird ersichtlich, dass sich das größte Ausmaß der sprachlichen Assimilation<br />
bei den nördlichen Tschangos findet, wo der Anteil der Ungarischsprachigen nur 38, 77 %<br />
beträgt. Über den höchsten Anteil der Ungarischsprachigen verfügen die – die südlichen<br />
Tschango-Siedlungen „umarmenden” – Székler Dörfer entlang des Flusses Szeret mit 81, 9 %.<br />
Aus eben diesen Dörfern stammt der überwiegende Teil der im Dokumentarroman befragten<br />
„Sprachmeister” des Székler Tschango-Dialektes; ihre Äußerungen machen mit 33. 190 Wörtern<br />
59, 78 % des Gesamtkorpus der Székler Tschangos aus.<br />
236
VI. Zusammenfassung<br />
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in einer zusammenfassenden Darstellung der<br />
Sprache, Kultur, Geschichte und allgemeinen Situation der Moldauer Tschangos.<br />
Die Moldauer Tschangos leben in der nord-östlichen Provinz Rumäniens, der Moldau.<br />
Sie zeichnen sich besonders durch ihre archaische Sprache, uralten Traditionen, variationsreiche<br />
Volkskunst und Kultur aus. Die Grundlage ihrer Identität besteht seit Jahrhunderten aus<br />
ihrer römisch-katholischen Konfession und ihrer eigenen Sprache – den archaischsten Dialekt des<br />
Ungarischen, den sie innerhalb der Familie bzw. der Dorfgemeinschaft sprechen.<br />
Auf die Geschichte der Moldauer Tschangos geht ein gesondertes Kapitel ein, die den Leser<br />
dieser Arbeit mit denjenigen Hintergrundinformationen versorgen soll, die zum Verständnis der<br />
spezifischen Situation der Tschangos (Heterogenität, Archaismen in Sprache und Kultur,<br />
muttersprachlicher Analphabetismus, Identitätskomponenten, etc.) unbedingt notwendig sind.<br />
Durch das Heranziehen von authentischen, tschango-ungarischen Äußerungen und altungarischen<br />
Sprachdenkmälern ist im Kapitel über die grundlegenden Charakteristika des Moldauer<br />
Tschango-Dialektes ein besonderer Schwerpunkt auf die Hervorhebung der Archaismen gelegt<br />
worden.<br />
Die vorliegende Arbeit besteht hauptsächlich aus der Untersuchung des gesamten Wortschatzes<br />
des Nordtschango-Wörterbuches von Yrjö Wichmann (1936) und der Untersuchung der freien,<br />
ungebundenen Rede der zweisprachigen (Rumänisch und Tschango-Ungarisch) Moldauer<br />
Ungarn anhand der Aufarbeitung des gesamten – 207 Seiten umfassenden – Sprachmaterials des<br />
Dokumentarromans „Hát én hogyne síratnám” von József Gazda (1993)<br />
Anhand des Nordtschango-Wörterbuches von Yrjö Wichmann, das den Sprachzustand unseres<br />
Untersuchungsdorfes Szabófalva (rum. Săbăoani) von 1907 widerspiegelt, wollte ich<br />
herausfinden, was vom damaligen Wortschatz – 100 Jahre nach der Bestandsaufnahme von<br />
Wichmann – noch erhalten geblieben bzw. bekannt ist und von wie vielen dieser archaischste<br />
Dialekt des Ungarischen noch gesprochen wird.<br />
Zu diesem Zweck habe ich in den Jahren 2005 und 2006 in Szabófalva mit der Hilfe meines<br />
Sprachmeisters, Mihály Perka Feldforschungsarbeiten durchgeführt. Bei der Aktualisierung des<br />
Wichmann-Wörterbuches wurden dabei - im Einklang mit den Forderungen der<br />
sprachwissenschaftlichen Schule „Wörter und Sachen” - die wichtigsten volkskundlichen<br />
Besonderheiten und Bräuche der Moldauer Ungarn mitberücksichtigt. In diesem Sinne sind die<br />
237
Erinnerungen der älteren Tschangos von großer Bedeutung, die uns noch von der traditionellen<br />
Lebensweise und den alten Bräuchen erzählen können.<br />
Soziolinguistisch lässt sich unser Untersuchungsdorf wie folgt charakterisieren: nur noch ein<br />
Drittel (3000-3500) der ca. 10.000 Bewohner des Dorfes sprechen bzw. verstehen gerade noch<br />
ihre Muttersprache; der Szabófalver Dialekt wird von den über 35jährigen gesprochen; die ihren<br />
Tschango-Dialekt sprechende Gemeinschaft spricht untereinander (innerhalb der Familie, im<br />
Freundes- und Bekanntenkreis) ihre Muttersprache, in allen anderen Domänen wird die<br />
rumänische Staatssprache verwendet; Differenzierungen im Wortschatzbereich liegen kaum vor;<br />
infolge der Mündlichkeit bestehen zwischen den einzelnen Familien geringfügige<br />
Ausspracheunterschiede.<br />
Weiterhin ist der Frage nachgegangen worden, inwieweit das Verschwinden eines Wortes vom<br />
Zufall bestimmt ist bzw. welche Gesetzmäßigkeiten einen derartigen Prozess auszeichnen.<br />
Unter Zuhilfenahme des in den 50-er Jahren gesammelten Datenmaterials des „Sprachatlas der<br />
Moldauer Tschango Mundart” (Szabó T. Attila - Gálffy Mózes - Márton Gyula 1991) haben wir –<br />
in einer Art „Halbwertszeit”-Analyse – eine Zwischenbilanz gezogen, um so - sofern möglich –<br />
die „dynamische” Geschichte der einzelnen Wörter besser nachverfolgen zu können: welche<br />
Wörter waren ca. 50 Jahre nach dem Aufenthalt Wichmanns in Szabófalva (1906/07) noch<br />
bekannt bzw. welche sind schon zum damaligen Zeitpunkt verschwunden?<br />
Der erste Schritt auf dem Weg zum endgültigen Verschwinden der (tschango-) ungarischen<br />
Wörter liegt dann vor, wenn die betreffenden ungarischen Wörter noch bekannt sind oder noch<br />
erkannt werden, aber an ihre Stelle eher rumänische Wörter gebraucht werden, die langsam aber<br />
sicher beginnen, die ungarischen Wörter zu verdrängen.<br />
Wir konnten auch solche Fälle verbuchen, in denen wir es statt eines rumänischen Einflusses mit<br />
einem natürlichen Sprachwandel zu tun haben: entweder liegt nur ein Bedeutungs- bzw.<br />
Lautwandel vor, oder das betreffende Wort wurde durch ein anderes ungarisches Wort ersetzt.<br />
In dieser Arbeit haben wir u.a. Paläologismen, Archaismen, hybride Bildungen aus rumänischen<br />
Entlehnungen und einheimischen, ungarischen Wörtern sowie zahlreiche Synonymenpaare<br />
(Wortpaare gleicher oder ähnlicher Bedeutung, die auch aus 3 oder mehr Elementen bestehen<br />
können) bzw. die sogenannten Dubletten einer näheren Untersuchung unterzogen.<br />
Als ein Ergebnis meiner Untersuchung ist festzuhalten, dass 87, 52 % des aus 6007 Wörtern<br />
bestehenden Sprachkorpus erhalten geblieben sind; 12, 48 % des Wortschatzes sind nicht mehr<br />
bekannt bzw. können als verschwunden betrachtet werden.<br />
238
Eine andere wichtige Zielsetzung meiner Arbeit bestand in der Untersuchung des sprachlichen<br />
Einflusses der zur indogermanischen Sprachfamilie gehörenden rumänischen Sprache auf den<br />
Moldauer Tschango-Dialekt, den archaischsten Dialekt der zur finnougrischen Sprachfamilie<br />
gehörenden ungarischen Sprache anhand der Kontaktphänomene der direkten und indirekten<br />
Entlehnungen sowie des Kodewechsels. Weitere Zielsetzungen bestanden in der Untersuchung<br />
der Stärke bzw. des Stärkegrades der rumänischen Sprache in allen drei Tschango-<br />
Dialektgruppen sowie der Darstellung von eventuellen Unterschieden in den einzelnen<br />
Dialektgruppen mitsamt einer Herausarbeitung der Gründe für diese Unterschiede in der Stärke<br />
des rumänischen Einflusses.<br />
Zur Erreichung der oben festgelegten Ziele benötigte ich eine authentische, sprachliche Quelle,<br />
anhand derer der Einfluss der rumänischen Sprache auf die freie, ungebundene Rede der<br />
Moldauer Tschangos untersucht werden konnte. Ein derartiges Sprachkorpus fand ich im<br />
Dokumentarroman „Hát én hogyne síratnam” (1993) von József Gazda.<br />
Anhand des Gazda-Dokumentarromans konnte ein besonders umfangreiches, 100.122 Wörter<br />
umfassendes Sprachkorpus zusammengestellt werden, das alle drei Dialektgruppen der Moldauer<br />
Ungarn – d.h. die nördlichen, südlichen und Székler Tschangos erfasst<br />
Da in diesem großen Gazda-Textkorpus überwiegend Personen aus der Dialektgruppe der Székler<br />
Tschangos vertreten sind bzw. der Anteil der Männer in den jeweiligen Dialekten um einiges<br />
größer als der der Frauen ist, wurde zusätzlich – um die Relevanz der Ergebnisse bei einem<br />
Vergleich sicherzustellen, ein kleineres Gazda-Korpus zusammengestellt, in dem die Nord-, Südund<br />
Székler Tschangos in annähernd gleicher Wortzahl vertreten sind. Die Auswertung dieser<br />
Kontrollgruppen – aus jeweils 5 Männern und Frauen bestehend – ergab, dass die<br />
Kontaktphänomene in gleicher bzw. ähnlicher Weise wie im großen Gesamtkorpus Gazdas<br />
verteilt waren.<br />
In unserer Untersuchung der einzelnen Kontaktphänomene haben wir uns vorwiegend auf die<br />
Terminologie von István Lanstyák gestützt, der in seiner jüngst (2006) erschienenen<br />
Aufsatzsammlung die bisher ausführlichste Systematik der Entlehnungstypen und<br />
Kodewechselarten verfasst hat, deren besonderes Verdienst in der Einführung solcher Kategorien<br />
ist, die auf die Besonderheiten der Varietäten der ungarischen Sprache abgestimmt sind.<br />
In dieser Arbeit wird der Einfluss der rumänischen Sprache auf den Moldauer Tschango- Dialekt<br />
anhand der Kontaktphänomene der direkten und indirekten Entlehnungen sowie des<br />
Kodewechsels untersucht. Innerhalb der direkten Entlehnungen ist es im Grunde genommen die<br />
239
Kategorie der „eigentlichen” Lehnwörter, die uns die wirkliche Stärke der rumänischen Sprache<br />
auf die einzelnen Tschango-Dialekte zeigt. Die eigentliche Stärke des rumänischen Einflusses in<br />
den Äußerungen der Moldauer Tschangos erhalten wir daher erst nach Abzug der prozentualen<br />
Anteile der Elemente der regionalen ungarischen Umgangssprache Rumäniens,<br />
Rückentlehnungen, Internationalismen und der rumänischen Lehnwörter, die als Teil von<br />
rumänisch-ungarischen Synonymenpaaren, den Dubletten gebraucht werden.<br />
Unsere kontaktlinguistische Analyse der in den Äußerungen der Gazda-Informanten<br />
vorkommenden direkten (lexikalischen) Entlehnungen kam zu dem Ergebniss, dass im nördlichen<br />
Tschango-Dialekt der prozentuale Anteil der Kategorien, die innerhalb der direkten Entlehnungen<br />
die Stärke des rumänischen Einflusses relativieren, am niedrigsten ist.<br />
Im Székler Tschango-Dialekt findet sich der höchste prozentuale Anteil dieser relativisierenden<br />
Kategorien; der südliche Tschango-Dialekt nimmt eine Zwischenposition ein.<br />
Einer Untersuchung unterzogen wurden in dieser Arbeit weiterhin: die morphologische<br />
Integration der rumänischen Lehnwörter in das ungarische Sprachsystem des Moldauer<br />
Tschango-Dialekts, die Produktivität der (an der Wortbildung der Nehmersprache teilnehmenden)<br />
rumänischen Lehnwörter, die Verteilung der rumänischen Lehnwörter nach Sachgruppen und<br />
Wortarten..<br />
In meiner Arbeit habe ich die in den Äußerungen der Gazda - Informanten vorkommenden<br />
Bedeutungsentlehnungen und Lehnübersetzungen aufgelistet und dieses Korpus durch die im<br />
Wörterbuch Wichmanns befindlichen semantischen Entlehnungen ergänzt. Anhand dieser<br />
Beispielsätze wird deutlich, das gewisse Bedeutungsentlehnungen schon vor 100 Jahren Teil des<br />
aktiven Sprachgebrauchs waren.<br />
Anhand zahlreicher Beispielsätze unseres Gazda-Materials konnte deutlich gemacht werden, dass<br />
die Lehnübersetzungen aus dem Rumänischen auch Veränderungen im ungarischen<br />
Sprachsystem der Tschangos bewirken: anstatt der für das Ungarische charakteristischen<br />
synthetischen Konstruktionen werden nun analytische verwendet.<br />
Unsere Zusammenfassung der prozentualen Anteile der in den Äußerungen der Gazda-<br />
Informanten vorkommenden Kontaktphänomene der direkten und indirekten Entlehnungen hat<br />
ergeben, dass zwischen den einzelnen Tschango-Dialekten Unterschiede in der Stärke des<br />
Einflusses der rumänischen Sprache bestehen: der höchste Anteil der direkten und indirekten<br />
Entlehnungen findet sich bei den Nord-, der niedrigste bei den Székler Tschangos. Als positive<br />
Bilanz ist zu vermerken, dass in allen 3 Tschango-Dialekten die direkten Entlehnungen<br />
240
überwiegen; die indirekten Entlehnungen, die schon in die Sprachstruktur des Ungarischen<br />
eingreifen können, sind nur geringfügig vertreten.<br />
In unserer Arbeit haben wir uns weiterhin ausführlich mit dem in den Äußerungen der Gazda-<br />
Informanten vorkommenden Kontaktphänomen des Kodewechsels beschäftigt und dieses durch<br />
ein reichhaltiges sprachliches Belegmaterial illustriert. Der Kodewechsel (ins Rumänische) kann<br />
der Form nach ein einziges Wort, einen Ausdruck, einen Teilsatz oder einen Satz bzw.mehrere<br />
Sätze betreffen<br />
Einer gesonderten Untersuchung unterzogen wurden die grammatikalischen Typen des<br />
Kodewechsels ( „B-Typ”-, „N-Typ”-,„G-Typ”- , „F-Typ”- und „X-Typ”- Kodewechsel ), wobei<br />
im Hinblick auf den Grad des Einflusses der rumänischen Sprache auf das Tschango-Ungarische<br />
der „B-Typ”- und „G-Typ”-Kodewechsel von besonderer Relevanz sind, da an diesen deutlich<br />
wird, welche Sprache der Informanten die dominante ist.<br />
Die Anwendung des „B-Typ”-Kodewechsels setzt relativ gute Kenntnisse in der Basissprache<br />
(Tschango-Ungarisch) voraus. Der höchste prozentuale Anteil des „B-Typ”-Kodewechsels findet<br />
sich im Székler Tschango-Dialekt, der niedrigste im nördlichen Tschango-Dialekt.<br />
Der höchste prozentuale Anteil des „G-Typ”-Kodewechsels, der vor allem von Sprechern mit<br />
Rumänisch als dominanter Sprache verwendet wird, findet sich im nördlichen Tschango-Dialekt<br />
In der vorliegenden Arbeit wurden auch die Funktionen des kontextuellen und situativen<br />
Kodewechsels behandelt. Während der kontextuelle Kodewechsel mit der sprachlichen<br />
Kompetenz des Sprechers verbunden ist und so zur sprachlichen Bedarfsdeckung dient, wird der<br />
von außersprachlichen Faktoren abhängige situative Kodewechsel von den Gazda-Informanten<br />
eingesetzt, um z.B. die rumänischsprachigen Äußerungen anderer Personen zitieren zu können.<br />
Die eigentliche Stärke des rumänischsprachigen Einflusses wird deshalb auch am kontextuellen<br />
Kodewechsel deutlich.<br />
Unsere Untersuchung der in den Äußerungen der Gazda-Informanten vorkommenden<br />
Kontaktphänomene hat ergeben, dass zwischen den einzelnen Tschango-Dialekten Unterschiede<br />
in der Stärke des Einflusses der rumänischen Sprache bestehen: der Einfluss der rumänischen<br />
Sprache ist im nördlichen Tschango-Dialekt am stärksten, im Székler Tschango-Dialekt ist der<br />
Einfluss der rumänischen Sprache am schwächsten. Der Dialekt der südlichen Tschangos nimmt<br />
eine Zwischenposition ein.<br />
Da es sich bei ihnen um heterogene Gruppen handelt, trat der Sprachverlust in den unterschiedlichen<br />
Gruppen auch zu unterschiedlicher Zeit und in unterschiedlicher Stärke ein. Aus der<br />
241
Siedlungsgeschichte der Moldauer Ungarn wird deutlich, dass die Vorfahren der Nord- und Süd-<br />
Tschangos – aus der Region Mezıség kommend – in das Moldau-Gebiet schon gegen Ende des<br />
13. Jahrhunderts bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts eingewandert sind. Die Einwanderung der aus<br />
dem östlichen Széklerland (Siebenbürgen) stammenden Vorfahren der Székler Tschangos<br />
erfolgte erst viel später, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zu Einwanderungswellen aus<br />
dem Széklerland in das benachbarte Moldau-Gebiet kam es noch bis zum 19. Jahrhundert. Die<br />
Székler Tschangos verfügten über ein ausgeprägteres ethnisches und sprachliches<br />
Selbstbewusstsein, was sich u.a. auch darin manifestierte, dass sie am eindringlichsten die<br />
muttersprachliche Liturgie beanspruchten, ihre Kantoren meistens aus dem Széklerland beriefen,<br />
viele ungarischsprachige Gesangs- und Gebetsbücher bewahrt haben sowie intensive<br />
Beziehungen zum Franziskanerkloster in Csíksomlyó unterhielten.<br />
Zwischen den südlichen und Székler Tschangos kam es zu Kontakten, wodurch der<br />
ursprüngliche südliche Tschango-Dialekt beeinflusst wurde.<br />
Zwischen den nördlichen Tschangos und den anderen Tschango-Gruppen wiederum gab es keine<br />
Kontakte; zudem waren die Nord-Tschangos vollständig von der Region Siebenbürgen isoliert.<br />
Der sprachliche Assimilationsprozess begann bei der isoliertesten und ältesten Gruppe der<br />
Moldauer Ungarn, den nördlichen Tschangos viel früher und intensiver als in den anderen<br />
Tschango-Gruppen einzutreten.<br />
Die Analyse des Wörterbuches von Yrjö Wichmann (1907) ergab, dass – 100 Jahre später –<br />
12, 48 % des damaligen Wortschatzes nicht mehr bekannt sind, was auch bei nicht bedrohten<br />
Sprachen durchaus vorkommt, vor allem wenn man bedenkt, dass gerade dieser Zeitraum – das<br />
20. Jahrhundert – durch solche explosionsartigen politischen, wirtschaftlichen und<br />
gesellschaftlichen Veränderungen geprägt war, die nicht ohne Grund auch im Wertesystem der<br />
Menschen tiefe Spuren hinterlassen haben.<br />
Die Sprache der Tschangos ist erhalten geblieben. Wenn wir uns nicht vom – auf dem ersten<br />
Blick als fremdartig erscheinenden Klang ihrer Sprache abschrecken lassen und beginnen, sich<br />
mit ihr vertiefend zu beschäftigen, werden wir uns ihrer Ausdrucksstärke und Variationsbreite,<br />
ihres für die ungarische Sprache typischen Sprachsystems bewusst.<br />
Ihr Wortschatz ist zwar von naturgemäß übernommenen rumänischen Lehnwörtern durchsetzt,<br />
die sich aber in den meisten Fällen nach den Gesetzmäßigkeiten der ungarischen Sprache in ihren<br />
Dialekt integrieren – wie auch die Ergebnisse der kontaktlinguistischen Untersuchungen zeigen -<br />
was für ein ausgeprägtes Sprachgefühl spricht.<br />
242
Wie schon vorhin erwähnt, war die Übernahme von rumänischen Wörtern in vielen Fällen<br />
naturgemäß, da im Wortschatz der Tschango-Dialekte für den gegebenen Begriff bzw. das<br />
betreffende Objekt tatsächlich kein ungarisches Wort vorhanden war.<br />
Die mit der industriellen Entwicklung, dem Fortschritt verbundene neue, moderne Lebensform<br />
gelangte durch rumänische Vermittlung zu den Moldauer Ungarn. So wurde auch vor allem von<br />
Seiten der Jugend die Anpassung an das Rumänentum immer öfters positiv bewertet und bald<br />
gehörte es auch immer mehr zum „guten Ton”, rumänisch zu sprechen.<br />
Vielleicht ist es auch mit diesem Umstand zu erklären, dass im Tschango-Wortschatz mehr und<br />
mehr rumänische Wörter Fuß fassen; diese Entwicklung nimmt dabei derartige Ausmaße an, dass<br />
nun sogar solche Wörter rumänischen Ursprungs Wurzeln schlagen, deren ungarische<br />
Entsprechungen sich noch im Wortschatz der Moldauer Ungarn finden lassen.<br />
Die ungarischen Wörter verschwinden graduell: zuerst werden sie gerade eben nicht gebraucht,<br />
später nur noch verstanden, um schließlich allmählich in Vergessenheit zu geraten.<br />
Unabhängig von jeglichem äußeren – rumänischen – Einfluss setzte sich ein solcher Prozess in<br />
Gang, in dem es „modisch” war, sich der rumänischen Sprache zu bedienen, der Sprache also,<br />
mit der man Orientierungsvermögen und Fortschrittlichkeit signalisieren konnte.<br />
Das Identitätsbewusstsein der Tschangos war sowieso eher durch ihre konfessionelle<br />
Zugehörigkeit geprägt.<br />
Wie wir gesehen haben, waren am Sprachwechsel der Moldauer Ungarn neben der offiziell<br />
betriebenen Rumänisierungspolitik des Landes noch weitere wichtige, psychosoziale Faktoren<br />
beteiligt: das natürliche Bedürfnis des Einzelnen nach Integration bzw. zur Teilnahme an den<br />
zivilisationsgegebenen Lebensmöglichkeiten, was auf bequemste Weise mittels der rumänischen<br />
Sprache erreicht werden konnte.<br />
Trotz aller widrigen Umstände behielt das Repertoire ihrer Sprache seine Möglichkeiten zur<br />
Ausdrucksdifferenzierung; es genügt, wenn wir hierbei nur an die aussagekräftige Lyrik des<br />
Szabófalver Dichters Demeter Lakatos oder István András Dumas denken.<br />
Die Basis der Sprache der Tschangos ist also erhalten geblieben; auch ihre Bräuche und<br />
Traditionen leben noch. Die Frage ist nur, ob es in der Zukunft noch solche Moldauer Ungarn<br />
geben wird, die diese Kultur fortführen und weitergeben, diese Sprache noch sprechen.<br />
Wir möchten uns zwar nicht in Prophezeiungen verwickeln, doch lassen sich aus der<br />
Kenntnis ihrer Vergangenheit und Gegenwart – wenn auch nur skizzenhaft – vorsichtige<br />
Schlussfolgerungen hinsichtlich ihrer Zukunft ziehen.<br />
243
Im Kapitel über die Geschichte der Moldauer Ungarn dieser Arbeit wurden die mit der<br />
Revolution von 1989 verbundenen Chancen und die Aussichten der Tschangos auf den Erhalt<br />
ihrer Sprache und Kultur bei der optimalsten Wahrnehmung dieser Bedingungen ausführlich<br />
dargestellt; die größte Aussicht auf die Bewahrung ihrer Identität haben dabei die Süd- und<br />
Székler Tschangos.Unter der Identitätsbewahrung verstehen wir vor allem den Umstand, dass sie<br />
sich aus freiem Willen, ohne Angst vor jeglichen negativen Konsequenzen, zu ihrer nationalen<br />
Zugehörigkeit bekennen, ihre Muttersprache gebrauchen und ihre Traditionen fortführen können.<br />
Die Möglichkeiten zur Identitätsbewahrung scheinen für die älteste und archaischste Gruppe der<br />
Tschangos zu spät zu kommen: der nördliche Tschango-Dialekt befindet sich in der Endphase des<br />
Sprachwechsels. Auch die Ergebnisse meiner kontaktlinguistischen Untersuchungen<br />
verdeutlichen, dass der Einfluss der rumänischen Sprache im nördlichen Tschango-Dialekt am<br />
stärksten ist.<br />
244
Bibliographie<br />
Appel, Rene - Muysken, Pieter 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward<br />
Arnold.<br />
Arens Meinolf - Bein Daniel 2003. Katholische Ungarn in der Moldau. Eine Minderheit im<br />
historischen Kontext einer ethnisch und konfessionell gemischten Region. Saeculum. Jahrbuch<br />
für Universalgeschichte. 54. Jahrgang/2, 213-269.<br />
Bakos Ferenc 1982. A magyar szókészlet román elemeinek története. Budapest: Akadémiai<br />
Kiadó.<br />
Bakos Ferenc 1984. Román jövevényszavaink legújabb rétegéhez. In Nagy Béla ed., Magyarromán<br />
filológiai tanulmányok, 231-239. Budapest: ELTE Román filológiai Tanszék.<br />
Bakos Ferenc 1989. A magyar szókészlet román elemei. In Balázs János ed., Nyelvünk a Dunatájon,<br />
47-94. Budapest: Tankönyvkiadó.<br />
Ballagi Aladár 1888. A magyarság Moldvában. Földrajzi Közlemények XVI, 1-27.<br />
Balogh László 2001. Románia története. Budapest: AULA Kiadó.<br />
Banaz, Halime 2002. Bilingualismus und Code-switching bei der zweiten türkischen Generation<br />
in der Bundesrepublik Deutschland. Sprachverhalten und Identitätsentwicklung. Redaktion<br />
LINSE (Linguistik-Server Essen).<br />
Bárczi Géza 2001. Geschichte der ungarischen Sprache. Innsbruck: Institut für Sprachen und<br />
Literaturen.<br />
Bartha Csilla 1992. A nyelvek közötti érintkezés univerzáléi. Néhány adalék a kódváltás<br />
kérdésköréhez. In Kozocsa Sándor Géza - Laczkó Krisztina ed., Emlékkönyv Rácz Endre<br />
hetvenedik születésnapjára, 22-26. Budapest.<br />
Bechert, J. - Wildgen, W. (unter Mitarbeit von Schroeder) 1991. Einführung in die Sprachkontaktforschung.<br />
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.<br />
Beke György 1999. Csángók gyóntatója. Elbeszélések, rajzok. Miskolc: Felsımagyarország<br />
Kiadó.<br />
Benedek H. Erika 1998. Út az életbe. Világképelemzés a csángó és a székely közösségek<br />
születéshez főzıdı hagyományai alapján. Kolozsvár.<br />
Benkı Loránd ed., A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (Historisch-etymologisches<br />
Wörterbuch der ungarischen Sprache). 4 Bände. 1967-1984.<br />
245
Benkı Loránd 1988. Yrjö Wichmanns Sammlung zur volkstümlichen Sprache der Tschangonen.<br />
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae<br />
Sectiolinguistica XIX, 65-72.<br />
Benkı Loránd 1989. A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögébıl. Magyar<br />
Nyelv LXXXV. 271-287, 385-405.<br />
Benkı Loránd ed., Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. 3 Bände. 1993-1997<br />
Benı Attila 2003a. Közigazgatás és anyanyelvhasználat. In Kozma István - Papp Richárd ed.,<br />
Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. Válogatás a Változások a Kárpátmedence<br />
etnikai tér- és identitásszerkezetében címő konferencia elıadásaiból, 169-172.<br />
Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.<br />
Benı Attila 2003b. A vizualitás szerepe a szókölcsönzésben. In Péntek János – Benı Attila ed.,<br />
Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban, 53-70. Kolozsvár: Szabó T. Attila<br />
Nyelvi Intézet.<br />
Benı Attila 2004a. Kölcsönszóhasználat, kódváltás a moldvai kétnyelvő beszélık<br />
megnyilatkozásaiban. In Kiss Jenı ed., Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében, 23-<br />
36. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Benı Attila 2004b. A kölcsönszó jelentésvilága. A román-magyar nyelvi érintkezés lexikaiszemantikai<br />
kérdései. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.<br />
Benz, Wolfgang 2001. Der „vergessene Holocaust”. Der Sonderfall Rumänien: Okkupation und<br />
Verfolgung von Minderheiten im Zweiten Weltkrieg. In Hausleitner, Mariana – Mihok, Brigitte –<br />
Wetzel, Julane ed., Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien<br />
1941-1944, 9-13. Berlin: Metropol Verlag.<br />
Beyrer, Arthur - Bochmann, Klaus - Bronsert, Siegfried 1987. Grammatik der rumänischen<br />
Sprache der Gegenwart. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.<br />
Binder-Iijima, Edda 2003.Die Institutionalisierung der rumänischen Monarchie unter Carol I.<br />
1866-1881. München: R. Oldenbourg Verlag.<br />
Bodó Csanád 2003. Nyelvek és közösségek vitalitása Moldvában. In Kozma István - Papp<br />
Richárd ed., Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. Válogatás a<br />
Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében címő konferencia<br />
elıadásaiból, 150-160. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.<br />
Bodó Csanád - Heltai János Imre - Tarsoly Eszter 2003. Nyelvi tervezés Moldvában. In Drescher<br />
J. Attila - Herr Judit ed., A MANYE XI. (pécsi) és XII. (szegedi) kongresszusa nemzetiségi és<br />
nyelvpolitikai tárgyú elıadásaiból, 67-72. Szekszárd - Pécs - Budapest.<br />
(Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek 2.)<br />
246
Bodó Csanád 2004. Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar-román kétnyelvő<br />
beszélıközösségekben. In Kiss Jenı ed., Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében, 37-<br />
66. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Bodó Csanád - Eriş Elvira 2004. A román kölcsönszók használata két moldvai beszélıközösségben.<br />
In Kiss Jenı ed., Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében, 67-96. Budapest:<br />
Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Bodó Csanád 2005. Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar-román kétnyelvő<br />
beszélıközösségek kutatásában. In Kinda István - Pozsony Ferenc ed., Adaptáció és<br />
modernizáció a moldvai csángó falvakban, 293-307. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.<br />
Borbély Anna 2001. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok<br />
közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élınyelvi Osztálya.<br />
Bosnyák Sándor 1980. A moldvai magyarok hitvilága. Budapest.<br />
Bußmann, Hadumod 1990. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.<br />
Cantemir, Dimitrie 1771. Historisch-geographische und politische Beschreibung der Moldau.<br />
Frankfurt – Leipzig. (Nachdruck 1973, Bukarest)<br />
Clyne, Michael 1987. Constraints on code-switching: how universal are they? Linguistics 25,<br />
739-764.<br />
Csernicskó István 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Damian István 1912: Adatok a magyar-román kölcsönhatáshoz. Budapest.<br />
Diaconescu, Marius 2005. A moldvai katolikusok identitáskrízise a politika és a histográfiai<br />
mítoszok között. In Kinda István – Pozsony Ferenc 2005. Adaptáció és modernizáció a moldvai<br />
csángó falvakban, 9-20. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.<br />
Diószegi László - R. Süle Andrea 1990: Hetven év. A romániai magyarság története 1919 1989.<br />
Budapest: Magyarságkutató Intézet.<br />
Diószegi László - Pozsony Ferenc 1996. A moldvai csángók identitásának összetevıirıl. In<br />
Diószegi László ed., Magyarságkutatás 1995-96, 105-111. Budapest.<br />
Diószegi László ed. 2002. Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of<br />
the Hungarian Csángós in Moldavia. Budapest: Teleki László Foundation - Pro Minoritate<br />
Foundation.<br />
Diószegi Vilmos 1998. A sámánhit emlékei a magyar népi mőveltségben. Budapest: Akadémiai<br />
Kiadó.<br />
Domokos Pál Péter 1979. „...édes Hazámnak akartam szolgálni...” Budapest.<br />
247
Domokos Pál Péter 2001. A moldvai magyarság, 6. Auflage (veränderte Neuauflage). Budapest:<br />
Fekete Sas Kiadó.<br />
Domokos Péter 2000. Lakatos Demeterrıl. Magyar Nyelvjárások. A Debreceni Egyetem Magyar<br />
Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve XXXVIII, 119-128.<br />
Duma István András 2005. Csángó mitológia. Kézdivásárhely: Havas.<br />
Faragó József 1954. Moldvai csángó népmesék és anekdoták. I-III. kötet. Kolozsvár<br />
Fodor Katalin 1995. A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. In<br />
Kassai Ilona ed. Kétnyelvőség és magyar nyelvhasználat: a 6. Élınyelvi Konferencia elıadásai,<br />
121-127. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézetének Élınyelvi Osztálya.<br />
Fodor Katalin 2001. Adalékok a csángók nyelvváltásának vizsgálatához. Moldvai Magyarság XI,<br />
5, (120) 18-19.<br />
Fodor Katalin 2004. Csángó nyelvföldrajzi kutatás. In Kiss Jenı ed., Nyelv és nyelvhasználat a<br />
moldvai csángók körében, 97-104. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Földes Csaba 1996. Mehrsprachigkeit, Sprachenkontakt und Sprachenmischung. Flensburg:<br />
Flensburger Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt im Unterricht.<br />
Friedrichs, Jürgen 1982. Methoden empirischer Sozialforschung. 10. Auflage (veränderte Neuauflage).<br />
Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Futaky, István 2002. Die Csango-Ungarn in der Moldau nach dem Zusammenbruch des<br />
Ceauşescu-Regimes. In Klumpp, Gerson – Knüppel, Michael (Hrsg.), Die ural-altaischen Völker.<br />
Identität im Wandel zwischen Tradition und Moderne, 23-27. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.<br />
Gálffy Mózes 1964a. A moldvai csángó nyelvjárás hangrendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi<br />
Közlemények VIII/1, 31-43.<br />
Gálffy Mózes 1964b. A moldvai csángó nyelvjárás mássalhangzó-rendszere. Nyelv- és<br />
Irodalomtudományi Közlemények VIII/2, 157-167.<br />
Gazda József 1993. Hát én hogyne síratnám. Csángók sodró idıben. Budapest: Szent István<br />
Társulat.<br />
Gazda József 1994. A nyelv és a magyarságtudat szintjei a moldvai csángóknál. Néprajzi<br />
Látóhatár 3/1-2, 269-281.<br />
Glatz Ferenc 2000. A magyarok krónikája. Budapest: Magyar Könyvklub.<br />
Göncz Lajos 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Gyırffy István 1916. Moldva. Földrajzi Közlemények, 479-503.<br />
248
Hajdú, Péter - Domokos, Péter 1987. Die uralischen Sprachen und Literaturen. Hamburg:<br />
Helmut Buske Verlag.<br />
Hajdú Mihály 2004. A csángó személynévkutatás. In Kiss Jenı ed., Nyelv és nyelvhasználat a<br />
moldvai csángók körében, 105-112. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Halász Péter 1999. A moldvai magyarság évszázadai. Tudósítás a külsı magyarokról. Rubicon<br />
1999/9-10, 23-25.<br />
Halász Péter 2002. Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Budapest:<br />
Európai Folklór Intézet.<br />
Halász Péter 2004. Nem lehet nyugtunk...! Esszék, gondolatok, útirajzok a moldvai magyarokról.<br />
Budapest: Magyar Napló.<br />
Halász Péter 2005. A moldvai csángó magyarok hiedelmei. Budapest: General Press Kiadó.<br />
Harangozó Imre 2001. „Ott hul éltek vala a magyarok...” Válogatás az észak-moldvai magyarság<br />
népi emlékezetének kincsestárából. Újkígyós: Ipolyi Arnold Népfıiskola.<br />
Hegedős Lajos 1952. Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai<br />
telepesektıl. Budapest: Közoktatásügyi Kiadóvállalat.<br />
Hegyeli Attila 2004. Din Arini la Săbăoani. Roman.<br />
Heltai János Imre 2004. A magyar-román nyelvcserével kapcsolatos vélekedések moldvai<br />
kétnyelvő beszélıközösségekben. In Kiss Jenı ed., Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók<br />
körében, 125-135. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Heltai János Imre - Tarsoly Eszter 2004. Lehetıségek a moldvai kétnyelvő katolikus közösségek<br />
nyelvcseréjének elemzésére. In P. Lakatos Ilona - T. Károlyi Margit ed., Nyelvvesztés,<br />
nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, 118-125. Budapest: Tinta Könyvkiadó.<br />
Hobsbawm, E.J. 1975. The age of capital 1848-1975. New York: Scribner’s Sons.<br />
Ichim, Dorinel 1987. Zona etnografica Bacău. Bucureşti.<br />
Imreh István – Szeszka Erdıs Péter 1978. A szabófalvi jogszokásokról. Népismereti Dolgozatok,<br />
195-207.<br />
Iorga, Nicolae 1912. Portul popular românesc. LecŃie Ńinută la cursurile de vară. Vălenii-de-<br />
Munte.<br />
Isohookana-Asunmaa Tytti 2002. Report - Csango minority culture in Romania. Doc. 9078. In<br />
Papp Farkas Klára ed., Endangered Minority Cultures in Europe, 109-133. Budapest.<br />
Jerney János 1851. Keleti utazás a magyarok ıshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845. I-II.<br />
Pest.<br />
249
Juhász Dezsı 2003. A moldvai nyelvjárási régió. In Kiss Jenı ed., Magyar dialektológia,<br />
307-314. Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Kallós Zoltán 1971. Balladák könyve. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.<br />
Kinda István – Pozsony Ferenc 2005. Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban.<br />
Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.<br />
Kiss Jenı 2003. A moldvai magyar nyelvjárásokról. In Kiss Jenı ed., Magyar dialektológia, 195-<br />
199. Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Kiss Jenı ed. 2004. Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. Budapest: Magyar<br />
Nyelvtudományi Társaság.<br />
Kós Károly 1976. Csángó néprajzi vázlat. In Kós Károly ed., Tájak, falvak, hagyományok, 103-<br />
217.<br />
Labov, William 1972. Sociolinguistic Pattern. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.<br />
Lahovari, G. I. – Brătianu, C. I. – Tocilescu, Gr. G. 1898-1904. Marele DicŃionar al Romîniei I-<br />
VI. Bucureşti.<br />
Lanstyák István 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest - Pozsony: Osiris Kiadó -<br />
Kalligram Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Mőhely.<br />
Lanstyák István 2002. A nyelvérintkezés szakszókincsérıl. Száz fogalom a kontaktológia<br />
tárgyköréból. In Gyurgyik László - Kocsis Aranka ed., Társadalom - Tudomány. Tanulmányok a<br />
Mercurius Kutatócsoport mőhelyébıl. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.<br />
Lanstyák István 2006. Nyelvbıl nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésrıl, kódváltásról és<br />
fordításról. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.<br />
László Mihály 1882. Keleti testvéreink. Budapest: Franklin Társulat.<br />
Lendvai, Paul 1999. Die Ungarn. Ein Jahrtausend. Sieger in Niederlagen. München: C.<br />
Bertelsmann.<br />
Livezeanu, Irina 1998. Cultură şi naŃionalism în România Mare 1918-1930. Bucureşti.<br />
Lükı Gábor 1936. A moldvai csángók I. In: Gyırffy István ed.: Néprajzi Füzetek 3. Budapest.<br />
Lükı Gábor 2002. A moldvai csángók. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal.<br />
3. Auflage (veränderte Neuauflage). Budapest: Táton.<br />
Márton Gyula 1956a. A moldvai csángó nyelvjárás szókincsét ért román nyelvi hatásról. Magyar<br />
Nyelv LII, 92-100.<br />
Márton Gyula 1956b. Adatok a moldvai csángó nyelvjárást ért román nyelvi nyelvtani hatáshoz.<br />
Magyar Nyelv LII, 522.<br />
250
Márton Gyula 1960a. Adalékok a bilingvizmus kérdéséhez. Nyelv- és Irodalomtudományi<br />
Közlemények IV/3-4, 269-295.<br />
Márton Gyula 1960b. Adatok a moldvai csángó nyelvjárás szókincsét ért román nyelvi hatáshoz.<br />
Magyar Nyelv XLVI/1, 119-121.<br />
Márton Gyula 1961. Adatok a moldvai csángó nyelvjárás szókincsét ért román hatáshoz. Magyar<br />
Nyelv XLVII/3, 363-366.<br />
Márton Gyula 1972. A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Bukarest: Kriterion<br />
Könyvkiadó.<br />
Márton Gyula - Péntek János - Vöı István 1977. A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai.<br />
Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.<br />
Mátai Mária, D. 1992. „A magyar nyelvet írni kezdik.” A hangjelölés nehézségei csángómagyar<br />
levelekben. Magyar Nyelv LXXXVIII, 1. 56-72.<br />
Mesterházy Szilvia 2003. A moldvai csángók nyelvi jogai, különös tekintettel az oktatási jogok<br />
érvényesülésére. In Nádor Orsolya - Szarka László ed., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika<br />
Kelet-Közép-Európában, 148-158. Budapest: Akadémiai Kiadó.<br />
Mikecs László 1941. Csángók. Budapest: Bolyai Akadémia.<br />
Murádin László 1958. A nyelvújítási szók csángó megfeleléseihez. Studia Univ. „Babeş-Bolyai”<br />
Tom. III. nr. 6. Series IV. Fasc. I., 197-199.<br />
Murádin László - Péntek János ed.1991. A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I-II. Budapest:<br />
Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Murádin László 1994. A kétnyelvőség sajátos megnyilvánulása a moldvai csángómagyarok<br />
nyelvi tudatában. Néprajzi Látóhatár 3/1-2, 307-310.<br />
Murádin László 1995. A magyar-román kétnyelvőség zavarai a közigazgatásban.<br />
Kétnyelvőség 2, 21-24.<br />
Murádin László 2000. Az összefoglaló fogalmak megnevezésének hiánya a moldvai csángó<br />
nyelvjárásban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLIV, 1-2, 125-127.<br />
Niederhauser Emil 2001. Kelet-Európa története. Budapest: História - MTA Történettudományi<br />
Intézete.<br />
Nyisztor Tinka 2001. A magyar táplálkozáskultúra változásai Moldvában. Moldvai Magyarság<br />
XI, 2 (117), 5-6.<br />
251
Oksaar, E. 1980. Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprachkonflikt. In Nelde, Peter Hans ed.,<br />
Sprachkontakt und Sprachkonflikt, 43-52. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.<br />
(Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft 32)<br />
Papp Farkas Klára ed. 2002. Endangered Minority Cultures in Europe. Budapest.<br />
P. Jáki Sándor Teodóz 2003. Csángókról, igaz tudósítások. 2. Auflage. Budapest: Való Világ<br />
Alapítvány.<br />
Pávai István 2005. Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Tanulmányok, Interjúk.<br />
Budapest: Hagyományok Háza.<br />
Péntek János 1992. Kísérlet a regionális szintő román nyelvi hatás mértékének kvantifikálására.<br />
In Kontra Miklós ed. Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben,<br />
159-164. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.<br />
Péntek János 1995. A kollektív kétnyelvőség három típusa. Kétnyelvőség III. Jahrgang/2, 1-8.<br />
Péntek János 1996. A magyar-román interetnikus kapcsolatok néhány nyelvi vonatkozása. In<br />
Katona Judit - Viga Gyula ed. Az interetnikus kapcsolatok újabb eredményei, 113-120. Miskolc:<br />
Herman Ottó Múzeum.<br />
Péntek János 1997. Kontaktusjelenségek és folyamatok a magyar nyelv kisebbségi<br />
változataiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI/1, 37- 49.<br />
Péntek János 2001. A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok. Kolozsvár:<br />
Komp-Press Korunk Baráti Társaság.<br />
Péntek János 2003. A kisebbségi magyar nyelv helyzete, állapota, esélyei. Kolozsvár.<br />
Péntek János - Benı Attila 2003a. Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban.<br />
Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége.<br />
(Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1)<br />
Péntek János - Benı Attila 2003b. Nyelvi jogok Romániában. In Nádor Orsolya - Szarka László<br />
ed., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, 123-145.<br />
Budapest: Akadémiai Kiadó.<br />
Péntek János 2004. A moldvai magyar nyelv szótára - elvek és problémák. In Kiss Jenı ed.,<br />
Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében, 180-196. Budapest: Magyar Nyelvtudományi<br />
Társaság.<br />
Piro Krisztina 2001. Az észak-moldvai magyar nyelvjárásról az archaikus imádságok<br />
szövegvizsgálatának tükrében. In Harangozó Imre ed., „Ott hul éltek vala a magyarok...”<br />
Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából, 89-110. Újkígyós:<br />
Ipolyi Arnold Népfıiskola.<br />
252
Poplack, Shana 1980. Sometimes I'll Start a Sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL:<br />
Toward a Typology of Code-Switching. Linguistics 18, 581-618.<br />
Pozsony Ferenc ed. 1999. Csángó sors. Moldvai csángók a változó idıkben. Budapest: Teleki<br />
László Alapítvány.<br />
Pozsony Ferenc 2005. A moldvai csángó magyarok. Budapest: Gondolat Kiadó - Európai Folklór<br />
Intézet.<br />
Riehl, Claudia Maria 2004. Sprachkontaktforschung: eine Einführung. Tübingen: Narr.<br />
Romsics Ignác 1999. Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Romsics Ignác 2005. A trianoni békeszerzıdés. Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Roth, Harald 1996. Kleine Geschichte Siebenbürgens. Köln - Weimar - Wien: Böhlau Verlag.<br />
Sándor Klára 1996a. Apró Ábécé - apró esély: A csángók „nyelvélesztésének” lehetıségei és<br />
esélyei. In Csernicskó István - Váradi Tamás ed., Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat,<br />
51- 67. Budapest: Tinta.<br />
Sándor Klára 1996b. A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. Korunk 1996/11,<br />
60-75.<br />
Sándor Klára 2003. Magyar nyelvélesztés? Megjegyzések a csángó beiskolázási kísérletrıl.<br />
In Osvát Anna - Szarka László ed., Anyanyelv, oktatás - közösségi nyelvhasználat. Újrataníthatóe<br />
a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzeti iskolákban?, 153-182.<br />
Budapest: Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet.<br />
Sándor Klára 2005. The Csángós of Romania. In Fenyvesi Anna ed., Hungarian Language<br />
Contact Outside Hungary. Studies on Hungarian as a minority language, 163-185.<br />
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.<br />
Schubert, Gabriella 1982. Ungarn und Rumänen. Zu den ungarisch-rumänischen<br />
Sprachbeziehungen. Ural-Altaische Jahrbücher N. F. Bd. 2, 63-89.<br />
Szabados Mihály 1990. A moldvai magyarok a román népszámlálások tükrében 1859-1977<br />
között. In Juhász Gyula - Kiss Gy. Csaba ed., Magyarságkutatás 1989. A Magyarságkutató<br />
Intézet Évkönyve, 89-102. Budapest<br />
Szabó T. Ádám 1993. A csángók nyelve és helyesírása Lakatos Demeter szövegeinek tükrében.<br />
In Halász Péter ed. „Megfog vala apóm szokcor kezemtül...” Budapest<br />
Szabó T. Ádám 1994. A moldvai csángómagyarság nyelvatlasza. Néprajzi Látóhatár 3/1-2, 311-<br />
317.<br />
Szabó T. Ádám 1995. A moldvai csángó értelmiség két- és félnyelvősége. In Kassai Ilona ed.,<br />
Kétnyelvőség és magyar nyelvhasználat, 111-120. Budapest.<br />
253
Szabó T. Attila 1980. Elavult, halódó és élı kicsinyítı-becézı képzık a moldvai csángó<br />
nyelvjárásban. In Szabó T. Attila, Nép és Nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek, 102-165, 652-<br />
655. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.<br />
Szabó T. Attila 1981. A moldvai csángó nyelvjárás kutatása. In Szabó T. Attila, Nyelv és<br />
irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek, 482-527, 599-609. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.<br />
Szabó T. Attila - Gálffy Mózes - Márton Gyula 1991. A moldvai csángó nyelvjárás atlasza.<br />
Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.<br />
Taagepera, Rein 2000. A finnugor népek az orosz államban. Budapest: Osiris Kiadó.<br />
Tamás Lajos 1966. Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im<br />
Rumänischen. (Unter Berücksichtigung der Mundartwörter). Budapest<br />
Tánczos Vilmos 1995. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok.<br />
Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.<br />
Tánczos Vilmos 1999a. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Csíkszereda: Pro-Print.<br />
Tánczos Vilmos 1999b. Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük.<br />
Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.<br />
Tánczos Vilmos 2004. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása (1945-2004). In Kiss Jenı ed.,<br />
Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében, 208-285.<br />
Urechia, V.A. 1893-1894. Codex Bandinus. Memorii asupra scrierii lui Bandinus de la 1646,<br />
urmatu de textu, însoŃitu de acte şi documente. Annale Academia Romana, Seria II. Tom. XVI.,<br />
1-335. Bucureşti.<br />
Venczel József 1942. Az erdélyi román földbirtokreform. Kolozsvár.<br />
Vincze Gábor 1999. Csángósors a II. világháború után. In Pozsony Ferenc ed., Csángó sors.<br />
Moldvai csángók a változó idıkben. Budapest: Teleki László Alapítvány, 203-249.<br />
Vincze Gábor ed. 2004. Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai<br />
csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860-1989). Budapest:<br />
Teleki László Alapítvány - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.<br />
Virt István 2001. Elszakasztottad a testemtıl én lelkemet. A moldvai és Baranya megyei csángók<br />
halottas szokásai és hiedelmei. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.<br />
Wagner, Ernst 1980. Ungarn (Csangonen) in der Moldau und Bukowina im Spiegel neuerer<br />
rumänischer Quelleneditionen. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 3 (74), 27-47.<br />
Wagner, Ernst 1981. Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Ein Überblick. Innsbruck: Wort und<br />
Welt Verlag.<br />
254
Weber, <strong>Georg</strong> – Weber-Schlenther, Renate – Nassehi, Armin – Sill, Oliver – Kneer, <strong>Georg</strong> 1995.<br />
Die Deportation von Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion 1945-1949. (3 Bände)<br />
Köln - Weimar - Wien: Böhlau Verlag.<br />
Wichmann Yrjö 1936. Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó und des Hétfaluer<br />
Csángódialektes nebst grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt.<br />
Hg. von Bálint Csőry und Artturi Kannisto. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.<br />
Xantus János 1972. A természet kalendáriuma. Bukarest: Kriterion.<br />
Zobel, Olga Valeria 1978. Szekler (Csangonen) in der Moldau und in der Bukowina. Zeitschrift<br />
für Siebenbürgische Landeskunde 1. (72.) Jahrgang, Heft 2, 155-165.<br />
Zsemlyei János 1995. Román tükörszavak, tükörkifejezések és hibridszavak a romániai<br />
magyarság nyelvhasználatában. In Kassai Ilona ed., Kétnyelvőség és magyar nyelvhasználat, 245-<br />
252. Budapest.<br />
255
Abbildungsverzeichnis<br />
S. 5 : Karte aus: Roth, Harald: Kleine Geschichte Siebenbürgens. Köln – Weimar -<br />
Wien: Böhlau Verlag 1996, Seite 120; überarbeitet von der Verfasserin dieser<br />
Arbeit, A.K.<br />
Skizze der im Gazda-Korpus untersuchten Tschango-Dörfer (S. 147) stammt von der Verfasserin<br />
dieser Arbeit, A.K.<br />
S. 235 : Karte der Herkunftsregionen und heutigen Siedlungsgebiete der Moldauer<br />
Tschangos in Rumänien wurde von der Verfasserin dieser Arbeit, A.K.<br />
auf der Grundlage von:<br />
- Roth, Harald 1996: 120 (Umriss Rumäniens)<br />
- Tánczos Vilmos 1999<br />
(Umriss der Moldau einschließlich der Tschango-Dörfer)<br />
und<br />
- Kiss Jenı 2003, Anhang; Beilage Nr. 5<br />
(Dialektregionen der ungarischen Sprache)<br />
a n g e f e r t i g t .<br />
256
Anhang<br />
Ergänzende Tabellen zur Gazda-Untersuchung...........................................................................315<br />
- Verteilung der Kontaktphänomene nach Geschlechtern................................................315<br />
- Verteilung der Kontaktphänomene nach Generationen.................................................317<br />
- Kontrollgruppen.............................................................................................................319<br />
257
Verteilung der Kontaktphänomene nach Geschlechtern<br />
Nördlicher Tschango-Dialekt<br />
Männer / Frauen<br />
insges.: 11.024 / 3.539 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
575 / 201 5, 22 / 5, 68<br />
kontextuell<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
178 / 76<br />
65 / 8<br />
1, 61 / 2, 14<br />
0, 59 / 0, 23<br />
insges. 243 / 84 2, 20 / 2, 37<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
94 / 38 0, 85 / 1, 07<br />
Südlicher Tschango-Dialekt<br />
Männer / Frauen<br />
insges.: 21.299 / 8. 737 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
760 / 257 3, 57 / 2, 94<br />
kontextuell<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
89 / 61<br />
29 / 36<br />
0, 42 / 0, 70<br />
0, 14 / 0, 41<br />
insges. 118 / 97 0, 56 / 1, 11<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
137 / 33 0, 64 / 0, 38<br />
258
Székler Tschango-Dialekt<br />
Untersuchte Kontakt-<br />
Phänomene<br />
Männer / Frauen<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
insges.: 36.308 / 19. 215 Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
840 / 470 2, 31 / 2, 45<br />
kontextuell<br />
2. Kodewechsel<br />
158 / 56 0, 44 / 0, 29<br />
situativ 112 / 7 0, 31 / 0, 04<br />
insges. 270 / 63 0, 74 / 0, 33<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
69 / 74 0, 19 / 0, 39<br />
259
Verteilung der Kontaktphänomene nach Generationen<br />
Nördlicher Tschango-Dialekt<br />
1. Generation / 2. Generation<br />
insges.: 12.722 / 1. 841 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1. Direkte/Unmittelbare 651 / 125 5, 12 / 6, 79<br />
Entlehnungen<br />
kontextuell<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
246 / 8<br />
42 / 31<br />
1, 93 / 0, 43<br />
0, 33 / 1, 69<br />
insges. 288 / 39 2, 26 / 2, 12<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
122 / 10 0, 96 / 0, 54<br />
Südlicher Tschango-Dialekt<br />
1. Generation / 2. Generation<br />
(3. Generation ist nur mit 73 Wörtern bzw. 1 kont. Codewechsel aus 3 Wörtern vertreten)<br />
insges.: 29.273 / 690 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
983 / 34 3, 36 / 4, 93<br />
kontextuell<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
143 / 4<br />
57 / 8<br />
0, 49 / 0, 58<br />
0, 19 / 1, 16<br />
insges. 200 / 12 0, 68 / 1, 74<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
166 / 4 0, 57 / 0, 58<br />
260
Székler Tschango-Dialekt<br />
1. Generation / 2. Generation<br />
insges.: 43.207 / 12.316 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
1024 / 286 2, 37 / 2, 32<br />
kontextuell<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
164 / 50<br />
83 / 36<br />
0, 38 / 0, 41<br />
0, 19 / 0, 29<br />
insges. 247 / 86 0, 57 / 0, 70<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
107 / 36 0, 25 / 0, 29<br />
261
Kontrollgruppen<br />
aus jeweils 5 Männern und 5 Frauen<br />
Nördlicher Tschango-Dialekt<br />
insges.: 12.781 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
Anzahl<br />
der Fälle<br />
Prozentualer<br />
Anteil innerhalb<br />
der Kontaktphänomene<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
Prozentualer<br />
Anteil innerhalb<br />
des Textkorpus<br />
Eigentliche Lehnwörter<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Internationalismen<br />
489<br />
183<br />
56, 60<br />
21, 18<br />
489<br />
183<br />
3, 83<br />
1, 43<br />
Rückentlehnungen 16 1, 85<br />
16 0, 12<br />
insges. 688 79, 63 688 5, 38<br />
kontextuell 74 8, 57<br />
225 1, 76<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ 18 2, 08<br />
52 0, 41<br />
insges. 92 10, 65 277 2, 17<br />
Lehnbedeutungen 57 6, 60<br />
57 0, 44<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Lehnbildungen 27 3, 13<br />
66 0, 52<br />
insges. 84 9, 72 123 0, 96<br />
Gesamtanzahl der<br />
Kontaktphänomene 864 1088 8, 51<br />
262
Südlicher Tschango-Dialekt<br />
insges.: 10.866 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
eigentliche Lehnwörter<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Internationalismen<br />
Anzahl<br />
der Fälle<br />
265<br />
95<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb der<br />
Kontaktphänomene<br />
57, 36<br />
20, 56<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
265<br />
95<br />
Prozentualer<br />
Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
2, 44<br />
0, 87<br />
Rückentlehnungen<br />
4 0, 87<br />
4<br />
0, 04<br />
insges. 364 78, 79 364 3, 35<br />
kontextuell 30 6, 49<br />
70<br />
0, 64<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ 14 3, 03<br />
43<br />
0, 40<br />
insges. 44 9, 52 113 1, 04<br />
Lehnbedeutungen 40 8, 66<br />
40<br />
0, 37<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Lehnbildungen 14 3, 03<br />
23<br />
0, 21<br />
insges. 54 11, 69 63 0, 58<br />
Gesamtanzahl der<br />
Kontaktphänomene 462 540 4, 97<br />
263
Székler Tschango-Dialekt<br />
insges.: 11.619 Wörter<br />
Untersuchte Kontaktphänomene<br />
eigentliche Lehnwörter<br />
1. Direkte/Unmittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Internationalismen<br />
Anzahl<br />
der Fälle<br />
201<br />
85<br />
Prozentualer Anteil<br />
innerhalb der<br />
Kontaktphänomene<br />
54, 32<br />
22, 97<br />
Anzahl der<br />
betroffenen<br />
Wörter<br />
201<br />
85<br />
Prozentualer<br />
Anteil<br />
innerhalb des<br />
Textkorpus<br />
1, 73<br />
0, 73<br />
Rückentlehnungen<br />
9 2, 44<br />
9<br />
0, 08<br />
insges. 295 79, 73 295 2, 54<br />
kontextuell 18 4, 86<br />
40<br />
0, 34<br />
2. Kodewechsel<br />
situativ<br />
5 1, 36<br />
13<br />
0, 12<br />
insges. 23 6, 22 53 0, 46<br />
Lehnbedeutungen 34 9, 19<br />
34<br />
0, 29<br />
3. Indirekte/Mittelbare<br />
Entlehnungen<br />
Lehnbildungen 18 4, 86<br />
18<br />
0, 16<br />
insges. 52 14, 05 52 0, 45<br />
Gesamtanzahl der<br />
Kontaktphänomene 370 400 3, 45<br />
264
Versicherung<br />
Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die eingereichte Dissertation Auf den Spuren<br />
von Yrjö Wichmann. Sprache, Geschichte und Kultur der Moldauer Tschangos selbständig<br />
und ohne unerlaubte Hilfe verfasst habe. Anderer als der von mir angegebenen Hilfsmittel<br />
und Schriften habe ich mich nicht bedient. Alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften<br />
anderer Autorinnen oder Autoren habe ich kenntlich gemacht. Die Abhandlung ist noch nicht<br />
veröffentlicht worden und noch nicht Gegenstand eines Promotionsverfahrens gewesen.<br />
.<br />
…………………<br />
(Andrea Kraus)<br />
<strong>Göttingen</strong>; Oktober 2008