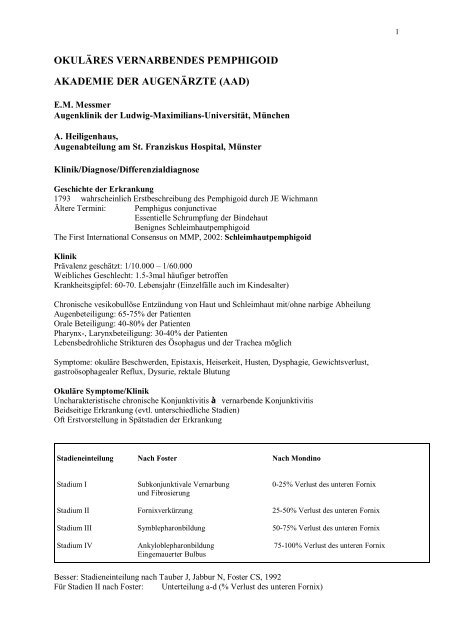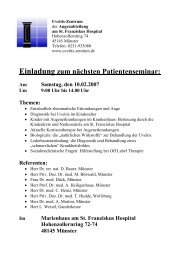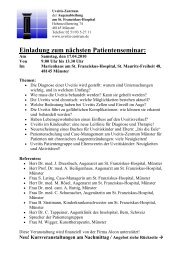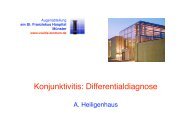Sektion DOG-Uveitis Anschreiben - Uveitis-Zentrum Muenster
Sektion DOG-Uveitis Anschreiben - Uveitis-Zentrum Muenster
Sektion DOG-Uveitis Anschreiben - Uveitis-Zentrum Muenster
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
OKULÄRES VERNARBENDES PEMPHIGOID<br />
AKADEMIE DER AUGENÄRZTE (AAD)<br />
E.M. Messmer<br />
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München<br />
A. Heiligenhaus,<br />
Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster<br />
Klinik/Diagnose/Differenzialdiagnose<br />
Geschichte der Erkrankung<br />
1793 wahrscheinlich Erstbeschreibung des Pemphigoid durch JE Wichmann<br />
Ältere Termini: Pemphigus conjunctivae<br />
Essentielle Schrumpfung der Bindehaut<br />
Benignes Schleimhautpemphigoid<br />
The First International Consensus on MMP, 2002: Schleimhautpemphigoid<br />
Klinik<br />
Prävalenz geschätzt: 1/10.000 –1/60.000<br />
Weibliches Geschlecht: 1.5-3mal häufiger betroffen<br />
Krankheitsgipfel: 60-70. Lebensjahr (Einzelfälle auch im Kindesalter)<br />
Chronische vesikobullöse Entzündung von Haut und Schleimhaut mit/ohne narbige Abheilung<br />
Augenbeteiligung: 65-75% der Patienten<br />
Orale Beteiligung: 40-80% der Patienten<br />
Pharynx-, Larynxbeteiligung: 30-40% der Patienten<br />
Lebensbedrohliche Strikturen des Ösophagus und der Trachea möglich<br />
Symptome: okuläre Beschwerden, Epistaxis, Heiserkeit, Husten, Dysphagie, Gewichtsverlust,<br />
gastroösophagealer Reflux, Dysurie, rektale Blutung<br />
Okuläre Symptome/Klinik<br />
Uncharakteristische chronische Konjunktivitis vernarbende Konjunktivitis<br />
Beidseitige Erkrankung (evtl. unterschiedliche Stadien)<br />
Oft Erstvorstellung in Spätstadien der Erkrankung<br />
Stadieneinteilung Nach Foster Nach Mondino<br />
Stadium I Subkonjunktivale Vernarbung 0-25% Verlust des unteren Fornix<br />
und Fibrosierung<br />
Stadium II Fornixverkürzung 25-50% Verlust des unteren Fornix<br />
Stadium III Symblepharonbildung 50-75% Verlust des unteren Fornix<br />
Stadium IV Ankyloblepharonbildung 75-100% Verlust des unteren Fornix<br />
Eingemauerter Bulbus<br />
Besser: Stadieneinteilung nach Tauber J, Jabbur N, Foster CS, 1992<br />
Für Stadien II nach Foster: Unterteilung a-d (% Verlust des unteren Fornix)
2<br />
Für Stadium III nach Foster: Unterteilung a-d (% horizontaler Symblephara)<br />
(n): Anzahl der Symblephara<br />
wobei: a : 0-25%<br />
b: 25-50%<br />
c: 50-75%<br />
d: 75-100%<br />
Noch besser: genaue photographische Befunddokumentation<br />
Komplikationen<br />
Schwerste Keratokonjunktivitis sicca<br />
Obstruktion der Meibomdrüsen<br />
Obstruktion der Tränendrüsenausführungsgänge<br />
Verlust der Becherzellen<br />
Lidfehlstellungen<br />
Ober- und Unterlidentropium<br />
Trichiasis<br />
Keratinisierung<br />
Lidkanten<br />
Gesamte Augenoberflächex<br />
Hornhautkomplikationen<br />
Persistierender Hornhautepitheldefekt<br />
Hornhautulzerationen Einschmelzung<br />
Bakterielle/virale Superinfektionen<br />
Hornhauteintrübung und Vaskularisation<br />
Glaukom (primär? sekundär?)<br />
Blindheit<br />
Differenzialdiagnose: Vernarbende Konjunktivitis<br />
· Z.n. Verätzung, Trauma, Operation, Bestrahlung<br />
· Z.n. Konjunktivitis<br />
Corynebacterium diphteriae<br />
Adenoviren<br />
Trachom<br />
· „Pseudopemphigoid“? (medikamenteninduziert)<br />
· Atopische Keratokonjunktivitis/Neurodermitis<br />
· Keratokonjunktivitis sicca (Sjögren Syndrom, GVHD)<br />
· Rosazea<br />
· Stevens-Johnson-Syndrom<br />
· Erythema multiforme/Toxische epidermale Nekrolyse<br />
· Schleimhautpemphigoid<br />
· Bullöses Pemphigoid<br />
· Epidermolysis bullosa aquisita<br />
· Lineare IgA-Dermatose<br />
· Pemphigus vulgaris/paraneoplastischer Pemphigus<br />
· Lichen planus<br />
· Systemischer Lupus erythematodes<br />
· Systemische progressive Sklerose
3<br />
Schlechtere Prognose<br />
- U.a. bei okulärer Beteiligung<br />
- IgG- und IgA-Auto-AK gegen Basalmembranzone<br />
- Hohe Titer der IgG-Anti-BMZ-AK<br />
Pathogenese des vernarbenden Pemphigoids<br />
•Epithel<br />
Gesteigerte mitotische Aktivität<br />
Differenzierungsstörung<br />
Verminderte Becherzell-Dichte<br />
Sqamöse Metaplasie<br />
Keratinisierung<br />
•Subepithelial<br />
Deposition von Kollagen I und III<br />
Schrumpfung<br />
•entzündliches Infiltrat<br />
T Lymphozyten<br />
Langerhans-Zellen<br />
Makrophagen<br />
•Zytokine<br />
Platelet-derived Growth Factor (PDGF)<br />
Transforming Growth Factor-Beta (TGF-b )<br />
Fibroblast Growth Factors (FGF)<br />
TNF-a<br />
IL-2 (B7:CD28/CTLA-4 costimulatory pathway)<br />
Vermutete pathogenetische Sequenz bei vernarbendem Pemphigoid:<br />
basiert im Wesentlichen auf klinischen Beobachtungen, in-vitro Modell, Hundemodell<br />
•genetische Prädisposition wahrscheinlich<br />
•zirkulierende Autoantikörper<br />
•Bindung an BMZ Antigen (besondere Bedeutung von humanem beta4 Integrin)<br />
•Aktivierung des Komplementsystems<br />
•Komplementablagerungen vorrangig an Lamina lucida<br />
•subepitheliale Entzündungsreaktion / Langerhans-Zellen<br />
•Invasion von Neutrophilen, Eosinophilen, Makrophagen, Lymphozyten, Plasmazellen, Mastzellen<br />
•Digestion der Lamina lucida durch hydrolytische Enzyme<br />
•subepitheliale Blasenbildung<br />
•Aktivierung und Hyperproliferation von Fibroblasten<br />
•Narbenbildung<br />
Diagnose des vernarbendem Pemphigoid:<br />
Vorausssetzung: klinischer Verdacht auf vernarbende Konjunktivitis und chronische<br />
rezidivierende blasenbildende Erkrankung oder erosive Prozesse der extraokulären<br />
Schleimhäute<br />
dann: Entnahme einer Biopsie:<br />
•aus der Bindehaut<br />
•aus der extraokulären Schleimhaut<br />
Biopsie der Bindehaut<br />
unbedingt indiziert wegen des sehr ähnlichen spaltlampenmikroskopischen Aspektes von<br />
verschiedenen Erkrankungen mit sehr unterschiedlicher Prognose und Therapie (z.B. OCP,<br />
Kollagenosen, M. Wegener)<br />
Anaesthesie
4<br />
subkonjunktival, Topfanaesthetika<br />
Region:<br />
im klinisch entzündeten Areal<br />
unterer Quadrant<br />
Limbus angrenzend<br />
Vermeiden:<br />
Quetschartefakte<br />
Epithelverlust (wenig tupfen)<br />
Die Gewebe müssen unmittelbar in flüssigen Stickstoff und Formalin gegeben werden.<br />
Formalin-fixiertes Gewebe wird für folgende Untersuchungen vorgesehen:<br />
HE (allgemeine Pathologie)<br />
PAS (Becherzellen)<br />
Giemsa (Mastzellen)<br />
OCT-eingebettetes Gewebe wird für folgende Untersuchungen vorgesehen:<br />
Komplement<br />
Immunglobuline<br />
Fibrin<br />
Ggf. mononukleäre Zellen<br />
Ggf. Zytokine<br />
Ggf. mikrobielle Antigene<br />
Hinweise für vernarbendes Pemphigoid:<br />
Charakteristisch, aber nicht spezifisch:<br />
•Immunfluoreszenz:<br />
lineare Ablagerungen von Immunglobulinen und/oder Komplement an der BMZ<br />
•Immunperoxidase (möglicherweise höhere Sensitivität):<br />
lineare Ablagerungen von Immunglobulinen und/oder Komplement an der BMZ<br />
Weitere immunologische Untersuchungen bei vernarbendem Pemphigoid:<br />
•zirkulierende Autoantikörper<br />
indirekte Immunfluoreszenz<br />
Patientenserum<br />
Bindehaut, Salt-split Haut und -Schleimhaut<br />
•Bestimmung der Targetantigene<br />
Immunblot-Analyse, Immunpräzipitation<br />
Lysate von kultivierten Keratozyten<br />
Behandlung des vernarbenden okulären Pemphigoids (medikamentös)<br />
Ziel der Behandlung ist der komplette Stillstand des Entzündungs- und Vernarbungsprozesses der<br />
Bindehaut und anderer Haut- und Schleimhautläsionen<br />
· antiinflammatorische Lokaltherapie nicht wirksam<br />
· Immunsuppression notwendig<br />
Pearson und Rodgers beschrieben erstmals die Wirksamkeit von Dapson in der Therapie des<br />
vernarbenden Pemphigoids. Foster und Mitarbeiter sahen einen Behandlungserfolg bei ca. 70% der<br />
mit Dapson behandelten Patienten mit okulärem vernarbendem Schleimhautpemphigoid. Dapson gilt<br />
heutzutage als Therapie erster Wahl bei milden bis mittelschweren Formen des vernarbenden<br />
Schleimhautpemphigoids.<br />
Bei unzureichendem Ansprechen oder bei Unverträglichkeit von Dapson werden Azathioprin oder<br />
Methotrexat empfohlen. Bei ausgeprägter Entzündungsaktivität des vernarbenden Pemphigoids ist<br />
Cyclophosphamid notwendig. Mycophenolat Mofetil (Cellcept®) wird derzeit in der Therapie des
5<br />
vernarbenden Schleimhautpemphigoids klinisch getestet. Die intravenöse Therapie mit<br />
Immunglobulinen sowie Plasmapherese wurde in Einzelfällen mit gutem therapeutischen Erfolg<br />
eingesetzt.<br />
Langzeit-Therapieerfolg bei okulärem vernarbendem Pemphigoid (Neumann et al, 1991):<br />
Remission 35% der Patienten<br />
Begrenzter Therapieerfolg (33% der Patienten)<br />
Kein Therapieerfolg (10%) v.a. in Spätstadien der Erkrankung<br />
1. Dapson (Diaminodiphenylsulfon)<br />
a. Wirkungsmechanismus<br />
Dapson, ein Sulfonamid bekannt aus der Therapie der Lepra und der Dermatitis herpetiformis,<br />
unterdrückt das Immunsystem auf noch nicht vollständig geklärte Weise. Es stabilisiert lysosomale<br />
Membranen, verringert die Ausschüttung lysosomaler Enzyme und unterdrückt die Myeloperoxidasevermittelte<br />
Zytotoxizität von neutrophilen Granulozyten.<br />
b. Dosierung<br />
Die Therapie wird mit 25mg 2x/die begonnen und bis auf 50mg 2x/die gesteigert.<br />
d. Nebenwirkungen<br />
Die häufigste Nebenwirkung ist die dosis-abhängige hämolytische Anämie. Die Anämie tritt beim<br />
Gesunden nicht vor 3-4 Wochen nach Therapiebeginn auf. Beim Patienten mit Glukose-6-P-<br />
Dehydrogenase-Mangel kommt es jedoch wesentlich früher bei niedrigeren Dosen zu einer<br />
ausgeprägten Hämolyse. Weitere Nebenwirkungen sind eine der Mononukleose-ähnliches<br />
Krankheitsbild, Methämoglobinämie, gastrointestinale Symptome, eine reversible periphere<br />
Neuropathie sowie eine Psychose.<br />
2. Methotrexat<br />
a. Wirkungsmechanismus<br />
Methotrexat gehört zu den Folsäureantagonisten. Es blockiert die Umwandlung von Dihydrofolsäure<br />
zu Tetrahydrofolsäure und damit den für die Biosynthese von Thymidin und Purin wichtigen C1-<br />
Stoffwechsel. B- und T-Zell-Funktionen werden unterdrückt.<br />
b. Dosierung<br />
Methotrexat kann oral, intravenös und intramuskulär verabreicht werden. Für ophthalmologische<br />
Indikationen ist nur eine Dosis von 10-25 mg/WOCHE erforderlich. Dadurch konnte die<br />
Hepatotoxizität des Medikaments erheblich verringert werden. Methotrexat wird zum größten Teil<br />
unmetabolisiert in den Urin abgegeben.<br />
c. Nebenwirkungen<br />
Methotrexat wirkt hepatotoxisch und kann vor allem bei vorgeschädigtem Organ zur Leberzirrhose<br />
führen. Häufiger sind eine ulzerative Stomatitis oder Diarrhöe. Eine Dosis-unabhängige Entwicklung<br />
einer interstitiellen Pneumonie und Lungenfibrose sind unter Methotrexat bekannt. Interessanterweise<br />
treten unter Methotrexat auch okuläre Nebenwirkungen in Form von Photophobie, Epiphora u.a. auf.<br />
3. Azathioprin<br />
a. Wirkungsmechanismus<br />
Azathioprin ist eine Derivat des 6-Mercaptourins, das als erstes Immunsuppressivum Eingang in die<br />
Behandlung ophthalmologischer Erkrankungen gefunden hat. Seine in der Leber aktivierten<br />
Metaboliten beeinflussen die Synthese von Purinbasen und werden in DNA und RNA eingebaut.<br />
Azathioprin supprimiert relativ selektiv T-Helfer-Zellen.<br />
b. Dosierung<br />
Azathioprin wird einer oralen Dosis von 1-2.5 mg/kg/die empfohlen. Bei zusätzlicher Therapie mit<br />
Allopurinol sollte diese Dosis um 25% gesenkt werden (44).<br />
c. Nebenwirkungen<br />
Azathioprin wird in der in der Ophthalmologie gebräuchlichen Dosis relativ gut vertragen.<br />
Gastrointestinale Beschwerden, Sekundärinfektionen, Stomatitis und Alopezie werden als typische<br />
Nebenwirkungen beschrieben. Da häufig im Verlauf der Behandlung eine Knochenmarksdepression<br />
auftritt, sind wie bei anderen Immunsuppressiva regelmäßige Blutbildkontrollen notwendig.
6<br />
4. Cyclophosphamid<br />
a. Wirkmechanismus<br />
Cyclophosphamid ist ein Derivat des ursprünglich als Kampfgas entwickelten Stickstoff-Lost. Es<br />
gehört zu den alkylierenden Substanzen, die mit vielen Zellbestandteilen und in jedem Stadium des<br />
Zellzyklus (phasenunspezifisch) reagieren können. Durch Vernetzung der DNA stört<br />
Cyclophosphamid sowohl Reduplikation als auch Transkription im Zellkern. Cyclophosphamid<br />
inhibiert sowohl die humorale als auch die zellvermittelte Immunantwort.<br />
b. Dosierung<br />
Die empfohlene Dosis von Cyclophosphamid für die Therapie okulärer Erkrankungen ist 1-2 mg/kg/d<br />
oral oder intravenös. Die Serumhalbwertszeit ist 7 Stunden. Metaboliten werden über Stuhl und Urin<br />
abgegeben.<br />
c. Nebenwirkungen<br />
Reversible Alopezie und Anämie mit relativer Thrombozytopenie sind die häufigsten<br />
Nebenwirkungen von Cyclophosphamid bei obengenannter Dosierung in der Therapie okulärer<br />
Erkrankungen. Die bestbekannte Nebenwirkung ist jedoch die hämorrhagische Zystitis, eine<br />
Komplikation, die bereits 24 Stunden nach Therapiebeginn auftreten kann. Sie ist Ausdruck einer<br />
Schädigung der Harnblasenschleimhaut durch das Medikament und darf nicht mit einer<br />
Mikrohämaturie z.B. im Rahmen einer Wegener’schen Granulomatose verwechselt werden. Bei<br />
unklarer Genese der Hämaturie muß eine Zystoskopie durchgeführt werden.<br />
Eine hämorrhagische Zystitis kann durch das Trinken großer Flüssigkeitsmengen (3-4 Liter/d),<br />
häufiges Urinieren und durch morgendliche Tabletteneinnahme verhindert werden. Alternativ kann<br />
Cyclophosphamid intravenös einmalig alle 3-4 Wochen appliziert werden.<br />
Nach 6-monatiger Therapie entwickelten 60% der Patienten eine Ovulationsstörung bzw. Störung der<br />
Spermatogenese, so daß bei männlichen Patienten eine Samenspende vor Therapiebeginn sinnvoll<br />
erscheint<br />
Die Entstehung von Zweittumoren und Leukämien unter Therapie mit Cyclophosphamid wurde<br />
beschrieben.<br />
5. Mycophenolat Mofetil<br />
a. Wirkmechanismus<br />
Mycophenolat Mofetil (MMF) ist ein reversibler Inhibitor der Inosin-Monophosphat-Dehydrogenas,<br />
eines Enzyms, das die Purin-Synthese an zentraler Stelle kontrolliert. Die Mycophenolsäure hemmt<br />
reversibel die de-novo Bildung von Guanin-Monophosphat. Da Lymphozyten im Gegensatz zu<br />
anderen Körperzellen überwiegend von dieser de-novo-Synthese abhängig sind, wird die Purin-<br />
Biosynthese dieser Zellen nahezu selektiv gehemmt. Dadurch werden verschiedene Immunreaktionen<br />
moduliert: Inhibition der T- und B-Zell Aktivierung und Proliferation, Inhibition der Glykosylierung<br />
von Adhäsionsmolekülen, Inhibition der Antikörperproduktion, und Inhibition der Produktion von<br />
Zytokinen wie IL-1 und IL-6.<br />
b. Dosierung<br />
MMF hat eine große therapeutische Breite. Es wird in einer Dosierung von 2x1 g/d verabreicht,<br />
unabhängig von Körpergewicht und Geschlecht. Blutspiegelmessungen werden diskutiert.<br />
c. Nebenwirkungen<br />
Am häufigsten werden gastrointestinale Nebenwirkungen unter MMF-Therapie berichtet. In seltenen<br />
Fällen traten schwere gastrointestinale Ereignisse in Form von Magenulzerationen, Gastritis, Magen-<br />
Darm-Blutungen und akuter Pankretitis auf<br />
6. Neue Therapieansätze<br />
Sulfasalazin<br />
1-4g/d<br />
zur medikamentösen Kontrolle bei leichter bis mittelschwerer Erkrankung<br />
Tetracyclin/Niacinamid<br />
Thalidomid<br />
Intravenöse Immunglobuline<br />
1-2g/Kg/Zyklus in 3 Dosen/d i.v. über 4-5 Stunden<br />
Monatliche Zyklen bis zur klinischen Besserung<br />
Dann Intervalle 6, 8, 10, 12, 14, 16 Wochen
7<br />
Mitomycin C subkonjunktival<br />
Plasmapherese<br />
7. Adjuvante Therapie<br />
Tränenersatz unkonserviert<br />
Serum-AT<br />
Operative Therapie bei vernarbendem Pemphighoid:<br />
Kombinierte Benetzungsstörung:<br />
•Tränenpünktchen-Verschluß<br />
Kollagen-Plug<br />
Silikon-Plug<br />
Koagulation<br />
•Tarsorrhaphie<br />
•Botulinus-Toxin oft unwirksam<br />
Wimpernentfernung:<br />
Kryotherapie<br />
•Infiltrations- oder Parabulbär-Anaesthesie<br />
•Kryospatel auf Haut aufsetzen<br />
•2 x durchfrieren, 45 Sekunden (Weißeffekt)<br />
Elektrolyse<br />
•Nadel: Oberlid: 2,4mm, Unterlid 1,4 mm<br />
•2-3,5 mA, 10 Sekunden<br />
Argon Laser Thermo-Ablation<br />
50-200 µm, 10-12 Applikationen<br />
Entropiumkorrektur:<br />
Unterlid<br />
•Kauterisations-, Resektionsverfahren<br />
•laterale Tarsorrhaphie, ektropionierende Nähte<br />
•Lidrotationsverfahren (Jones, Wies)<br />
•Schleimhaut-Transplantation<br />
•Amnionmembran-Transplantation<br />
Oberlid<br />
•Splitting der grauen Linie und Reposition der anterioren Lamelle<br />
•Schleimhauttransplantation<br />
•Amnionmembran-Transplantation<br />
Glaukomchirurgie:<br />
•Argon Laser-Trabekuloplastik<br />
•Dioden Laser Cyclophotokoagulation<br />
•Ahmed-Implantate technisch schwierig<br />
Kataraktchirurgie:<br />
•gute Erfolge, wenn:<br />
komplette Kontrolle der Entzündung<br />
perioperative Immunsuppression<br />
•korneale Tunnelinzision<br />
•Komplikationen<br />
Induktion von Rezidiven<br />
Keratopathien
8<br />
Therapie von Hornhautulzerationen und –perforation:<br />
•Cyan-Acrylat und therapeutische Kontaktlinse<br />
•Amnionmembran-Transplantation<br />
•Lamelläre Keratoplastik<br />
•Perforierende Keratoplastik<br />
+<br />
•Laterale Tarsorrhaphie<br />
•Tränenpünktchen-Verschluß<br />
Keratoplastik bei vernarbendem Pemphigoid:<br />
Zusammenfassend wurden nach Keratoplastiken bei vernarbendem Pemphigoid<br />
ausgesprochen schlechte Ergebnisse erzielt.<br />
Risikofaktoren:<br />
•totales Limbusstammzelldefizit<br />
•trockenes Auge<br />
•aktive Entzündung<br />
•Lidschlußdefekte<br />
Amnionmembran-Transplantation und "Stammzell"-Transplantation<br />
Indikationen:<br />
· Fornixrekonstruktion<br />
· Lidstellungskorrektur und Beseitigung von Trichiasis, Keratinisierung und Lidschlußdefekten<br />
· Limbus- und Stammzellrekonstruktion<br />
· Beseitigung von oberflächlichem Hornhautpannus<br />
ggf mit Verwendung von Serum-Augentropfen<br />
Langzeitresultate von AMT und "Stammzell"-Transplantaten noch unklar<br />
Allgemeine Prinzipien bei operativer Therapie bei Patienten mit vernarbendem Pemphigoid:<br />
•Bindehautmanipulationen vermeiden<br />
•Operation nur im entzündungsfreien Intervall und unter perioperativer Immunsuppression<br />
•Stabilisierung des Epithels:<br />
intensiver Tränenersatz (unkonserviert)<br />
ggf. Tränenpünktchen-Plugs oder Koagulation<br />
•Trichiasis und Entropium beseitigen<br />
•topische Infektionsprophylaxe<br />
•engmaschige postoperative Kontrollen<br />
Literatur:<br />
1. Heiligenhaus A, Steuhl KP, Schaller J. Das vernarbende Pemphigoid und andere chronische<br />
blasenbildende Erkrankungen von Haut und Auge. Der Augenspiegel 1998; 1: 33-38<br />
2. Messmer EM. Steroid- und immunsuppressive Therapie in der Ophthalmologie - Nutzen und<br />
Risiko.In: Nutzen und Risiken augenärztlicher Therapie, Hrsg. Kampik A, Grehn F, Enke<br />
Verlag, Stuttgart, 1998, S. 59-74<br />
3. Messmer EM, Hintschich C R, Partscht K, Messer G, Kampik A. Okuläres vernarbendes<br />
Schleimhautpemphigoid –Retrospektive Analyse von Risikofaktoren und Komplikationen<br />
Ophthalmologe 2000; 97: 113-120<br />
4. Neumann R, Tauber J, Foster CS. Remission and recurrence after withdrawal of therapy for<br />
ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1991; 98: 858-862<br />
5. Tauber J, Jabbur N, Foster CS. Improved detection of disease progesssion in ocular cicatricial<br />
pemphigoid. Cornea 1992; 11: 446-451.<br />
6. Foster CS, Ahmed AR: Intravenous immunoglobulin therapy for ocular cicatricial<br />
pemphigoid: a preliminary study. Ophthalmology 1999; 106:2136-2143.<br />
8. Letko T, Bhol K, Foster CS, Ahmed RA. Influence of intravenous immunoglobulin therapy on<br />
serum levels of anti-beta 4 antibodies in ocular cicatricial pemphigoid. A correlation with<br />
disease activitis. A preliminary study. Curr Eye Res 2000, 21: 646-54.
9. Megahed M, Schmiedeberg S, Becker J, Ruzicka T: Treatment of cicatricial pemphigoid with<br />
mycophenolate mofetil as steroid-sparing agent. J Am Acad Dermatol 2001; 45:256-259.<br />
10. Doan S, Lerouic JF, Robin G et al: Treatment of ocular cicatricial pemphigoid with<br />
sulfasalazine. Ophthalmology 2001; 108: 1565-8.<br />
11. Sami N, Bhol KC, Ahmed RA: Intravenous immunoglobulin therapy in patients with multiple<br />
mucosal involvement in mucous membrane pemphigoid. Clin Immunol 2002; 102: 59-67.<br />
12. Miserocchi E, Waheed NK, Baltatzis S, Foster CS. Chronic cicatrizing conjunctivitis in a<br />
patient with ocular cicatricial pemphigoid and fatal Wegener granulomatosis.Am J<br />
Ophthalmol 2001;132:923-4.<br />
13. Koizumi N, Inatomi T, Suzuki T, Sotozono C, Kinoshita S. Cultivated corneal epithelial stem<br />
cell transplantation in ocular surface disorders. Ophthalmology 2001;108:1569-74<br />
14. Colon JE, Bhol KC, Razzaque MS, Ahmed AR. In vitro organ culture model for mucous<br />
membrane pemphigoid. Clin Immunol 2001;98:229-34<br />
15. Kumari S, Bhol KC, Simmons RK, Razzaque MS, Letko E, Foster CS, Ahmed AR.<br />
Identification of ocular cicatricial pemphigoid antibody binding site(s) in human beta4<br />
integrin. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001;42:379-85<br />
16. Carrozzo M, Fasano ME, Broccoletti R, Carbone M, Cozzani E, Rendine S, Roggero S, Parodi<br />
A, Gandolfo S. HLA-DQB1 alleles in Italian patients with mucous membrane pemphigoid<br />
predominantly affecting the oral cavity. Br J Dermatol 2001 ;145:805-8<br />
17. Tsubota K, Satake Y, Ohyama M, Toda I, Takano Y, Ono M, Shinozaki N, Shimazaki J.<br />
Surgical reconstruction of the ocular surface in advanced ocular cicatricial pemphigoid and<br />
Stevens-Johnson syndrome. Am J Ophthalmol 1996;122:38-52<br />
18. Anderson DF, Ellies P, Pires RT, Tseng SC. Amniotic membrane transplantation for partial<br />
limbal stem cell deficiency. Br J Ophthalmol 2001;85:567-75<br />
19. Da Mata A, Burk SE, Netland PA, Baltatzis S, Christen W, Foster CS. Management of uveitic<br />
glaucoma with Ahmed glaucoma valve implantation. Ophthalmology 1999;106:2168-72<br />
20. Donnenfeld ED, Perry HD, Wallerstein A et al. Subconjunctival mitomycin C for the<br />
treatment of ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1999; 106: 72-79<br />
21. Chan LS et al. The First International Consensus on Mucous Membrane Pemphigoid. Arch<br />
Dermatol 2002 ; 138 : 370-379<br />
22. Olivry T, Dunston SM, Schachter M et al. A spontaneous canine model of mucous membrane<br />
(cicatricial) pemphigoid, an autoimmune blistering disease affecting mucosae and<br />
mucocutaneous junctions. J Autoimmun 2001; 16: 411-421<br />
9