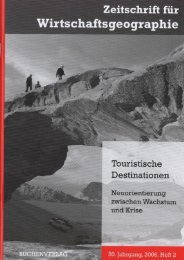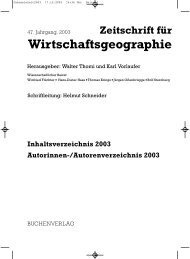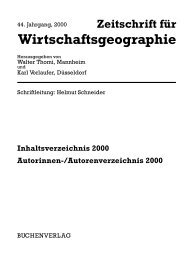ZfW 2013 1-2.indd - Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie
ZfW 2013 1-2.indd - Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie
ZfW 2013 1-2.indd - Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
96 <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> Heft 1-2 / <strong>2013</strong><br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> Jg. 57 (<strong>2013</strong>) Heft 1-2, S. 96–104<br />
Buchbesprechungen<br />
Buchbesprechungen<br />
Steinrücken, Thorsten: Wirtschaftsförderung<br />
und Standortpolitik. Eine Einführung in<br />
die Ökonomik unternehmensorientierter Wirtschaftspolitik.<br />
Norderstedt: Books on Demand<br />
2011, 328 S., 69,95 €. (Paperback).<br />
Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung, im<br />
Standortmarketing und in der Regionalentwicklung<br />
stellen <strong>für</strong> Geographen beliebte Arbeitsmärkte<br />
dar. Jedoch sind Lehrbücher zur Wirtschaftsförderung<br />
aus (rein) wirtschaftsgeographischer<br />
Perspektive in Deutschland Mangelware.<br />
Aus diesem Grund soll hier ein ökonomisches<br />
Werk vorgestellt werden, das die geographische<br />
Perspektive sinnvoll bereichert. Der Autor richtet<br />
das Buch an alle, die sich in Theorie und Praxis<br />
mit Wirtschaftsförderung und Standortpolitik<br />
beschäftigen. Das Ziel des Buches besteht darin,<br />
einen strukturierten Überblick über Zielsetzungen<br />
und Begründungen <strong>für</strong> staatlich initiierte<br />
Wirtschaftsförderung zu geben. Ein besonderer<br />
Fokus liegt dabei auf den Folgen und Wirkungen<br />
staatlicher Eingriffe. Die theoretische Denkweise<br />
ist in der neoklassischen Ökonomie angesiedelt.<br />
Das Buch gliedert sich in vier Kapitel.<br />
Im ersten Kapitel wird in die Thematik der Wirtschaftsförderung<br />
eingeführt. Neben Begriffsbestimmung,<br />
Begründungen <strong>für</strong> wirtschaftsfördernde<br />
Aktivitäten und deren Prinzipien wird gezeigt,<br />
dass es sich bei Wirtschaftsförderung um<br />
ein Phänomen handelt, dessen erste Ansätze weit<br />
in die Geschichte zurückreichen. Die aktuelle<br />
Notwendigkeit einer Wirtschaftsförderung wird<br />
vor allem mit Bürgerinteresse und Marktversagen<br />
begründet. Diese beiden Konzepte werden in<br />
der <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> nur selten so systematisch<br />
betrachtet wie in dem vorliegenden Band.<br />
Ergänzend werden strategische, soziale und verteilungspolitische<br />
Gründe vorgestellt. Darauf<br />
aufbauend werden Prinzipien der Wirtschaftsförderung<br />
erläutert. Auch dieser Themenkomplex<br />
ist bisher kaum Thema in gängigen Lehrbüchern<br />
zur <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> gewesen.<br />
Das zweite Kapitel widmet sich den Standortfaktoren<br />
und dem Standortwettbewerb. Durch<br />
die Beschreibung von Standortfaktoren und<br />
die Darstellung der Erklärungsmodelle <strong>für</strong> die<br />
räumliche Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten<br />
wird eine Brücke in die <strong>Wirtschaftsgeographie</strong><br />
geschlagen. Anhand der ökonomischen<br />
Ansätze wird gezeigt, dass Gebietskörperschaften<br />
einen gewissen Spielraum haben, um sich<br />
als Stand orte <strong>für</strong> Unternehmen attraktiver zu<br />
machen. Dabei wird dem Wettbewerb zwischen<br />
Standorten besondere Aufmerksamkeit gewidmet.<br />
Räume können in wettbewerblichen Beziehungen<br />
zu einander stehen, und entsprechend<br />
sind räumliche Disparitäten und ihre Erklärung<br />
häufig Untersuchungsgegenstand in der <strong>Wirtschaftsgeographie</strong>.<br />
Im dritten Kapitel geht der Autor auf einige Instrumente<br />
der Wirtschaftsförderung ein. Dazu wird<br />
eine Systematisierung der verschiedenen Instrumente<br />
vorangestellt und verdeutlicht, dass klare<br />
Abgrenzungen nicht immer möglich sind. Neben<br />
bekannten und populären Instrumenten der Wirtschaftsförderung,<br />
wie beispielsweise staatliche<br />
Bürgschaften, Technologie- und Gründerzentren<br />
oder die Förderung von Forschung und Entwicklung,<br />
werden aber auch weniger verbreitete Instrumente<br />
wie Mietfabriken vorgestellt. Das vierte<br />
Kapitel widmet sich den Wirkungen der Maßnahmen<br />
von Wirtschaftsförderung. Hier wird in<br />
ökonomischer Manier betrachtet, welche mikro-<br />
und makroökonomischen Anreizwirkungen<br />
und Effekte Wirtschaftsförderung theoretisch<br />
haben kann. Es werden aber auch die Gesamtwohlfahrt<br />
sowie die Wettbewerbswirkungen der<br />
Wirtschaftsförderung betrachtet.<br />
Das Buch ist logisch aufgebaut, die Inhalte sind<br />
dank vieler Beispiele leicht nachvollziehbar.<br />
Somit eignet sich diese Einführung auch gut<br />
<strong>für</strong> Studierende der <strong>Wirtschaftsgeographie</strong>, ohne<br />
dass sie über eine fundierte wirtschaftswissenschaftliche<br />
Ausbildung verfügen müssen.<br />
Die Verständlichkeit des Buches basiert allerdings<br />
vor allem auf dem neoklassischen theoretischen<br />
Rahmen. Die damit einhergehende<br />
Formalisierung ist <strong>für</strong> die Nachvollziehbarkeit<br />
der Inhalte aber nicht zwingend. Die verschiedenen<br />
Maßnahmen und Instrumente werden aus<br />
didaktischen Gründen isoliert voneinander betrachtet.<br />
Auf ihre komplementären Wirkungen<br />
wird häufig hingewiesen, aber es werden keine<br />
praktischen Strategien oder Maßnahmenbündel<br />
in ihrer regionalen Wirkung vorgestellt und untersucht.<br />
Damit dient das Buch vor allem dem<br />
theo retischen Verständnis und eröffnet dem Le-
Buchbesprechungen 97<br />
ser eine neue Perspektive auf Wirtschaftsförderung<br />
und Standortpolitik.<br />
Für Wirtschaftsgeographen spielen üblicherweise<br />
regionale Aspekte und Besonderheiten eine<br />
große Rolle. Auf sie wird in diesem Buch nur<br />
randlich eingegangen. Die Besonderheiten der<br />
ostdeutschen Bundesländer werden an verschiedenen<br />
Stellen thematisiert. Räumlich fokussiert<br />
das Buch auf Deutschland, wobei hier und da<br />
auch Beispiele aus den europäischen Nachbarländern<br />
herangezogen werden. Die Bedeutung<br />
der Europäischen Union <strong>für</strong> die Wirtschafts-,<br />
Regional- und Standortpolitik in Deutschland<br />
wird angerissen, allerdings nicht vertieft, was<br />
auch den Rahmen eines einführenden Lehrbuches<br />
sprengen würde. Zusammenfassend kann<br />
das Buch Wirtschaftsgeographen bzw. Studierenden<br />
der <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> nachdrücklich<br />
empfohlen werden. Es verdeutlicht wirtschaftliche<br />
Zusammenhänge und Effekte wirtschaftsfördernder<br />
Aktivitäten durch öffentliche Akteure.<br />
Geographen bietet es neue Einblicke und verlangt<br />
gewissenmaßen nach thematischer Ergänzung<br />
aus wirtschaftsgeographischer Perspektive.<br />
Christian Kluck, Bremen<br />
Fürst, Dietrich / Hirschfeld, Markus /<br />
Jung, Hans-Ulrich / Lammers, Konrad /<br />
Nischwitz, Guido / Salow, Sven-Olaf / Sempell,<br />
Guido / Skubowius, Alexander: Ausgestaltung<br />
der EU-Strukturpolitik der Förderperiode<br />
2007–<strong>2013</strong> in den nordwestdeutschen<br />
Bundesländern. Hannover: Akademie <strong>für</strong> Raumforschung<br />
und Landesplanung 2012, 260 S.,<br />
29,90 €. (ARL-Arbeitsmaterialien, Band 358).<br />
Die Neugestaltung der EU-Strukturpolitik <strong>für</strong> die<br />
Förderperiode 2014 bis 2020 tritt in die entscheidende<br />
Phase, und es ist zu hoffen, dass sich die<br />
Entscheidungen der Politiker an den Erfahrungen<br />
der aktuellen Periode orientieren, an Lerneffekten,<br />
an intendierten und an nichtintendierten<br />
Wirkungen. Die von einem aus Wissenschaftlern,<br />
Politikern und Verwaltungsmitarbeitern zusammengesetzten<br />
Autorenkollektiv vorgelegte<br />
Bilanz der Ausgestaltung der EU-Strukturpolitik<br />
in den nordwestdeutschen Ländern kommt daher<br />
zur rechten Zeit. Diese vier Bundesländer<br />
sind traditionell vergleichsweise stark von EU-<br />
Fördermitteln abhängig, weshalb die vor der<br />
laufenden Förderperiode erfolgte finanzielle, inhaltliche<br />
und räumliche Neuausrichtung der EU-<br />
Strukturpolitik (mehr Wettbewerb, weniger Ausgleichsorientierung)<br />
von erheblicher Relevanz<br />
auch <strong>für</strong> diese Re gion war. Zudem befand sich<br />
das größte der vier betroffenen Bundesländer<br />
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bandes<br />
bereits im Landtagswahlkampf, der die zwischen<br />
Regierungspartei und größter Oppositionspartei<br />
doch sehr verschiedenen Auffassungen zur regio<br />
nalen und sektoralen Schwerpunktsetzung<br />
der künftigen EU-Strukturpolitik offenbarte. Die<br />
divergierenden Grundpositionen der beiden großen<br />
Parteien ähneln jenen, die auch die bisherigen<br />
EU-Strukturpolitiken prägten: Lange Zeit<br />
dominierte das Ziel der Disparitätenreduzierung<br />
und die Stärkung der Schwachen (Regionen),<br />
zuletzt aber lag der Fokus auf der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der EU insgesamt mit einer Politik der<br />
„Stärken stärken“. Letztere Strategie wird, das<br />
ist bereits absehbar, auch das Credo der neuen<br />
Förderperiode sein, denn sie soll explizit der<br />
Erreichung der wachstumsorientierten Ziele der<br />
neuen EU-„Strategie Europa 2020“ dienen, was<br />
<strong>für</strong> Nordwestdeutschland unter anderem weniger<br />
Geld aus EU-Fördertöpfen bedeuten wird als<br />
bisher. Anlässe also genug, um zu analysieren,<br />
wie die Umsetzung in der aktuellen Förderperiode<br />
in Norddeutschland gelungen ist.<br />
Eine siebenköpfige AG der Landesarbeitsgemeinschaft<br />
Nordwest der ARL hat sich 2008 die<br />
Aufgabe gestellt, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede<br />
der Strategien, Ziele und Instrumente<br />
bei der Umsetzung der EU-Strukturpolitiken<br />
in Nordwestdeutschland zu beschreiben und<br />
zu bewerten. Der in sechs Kapiteln gegliederte<br />
Band beginnt mit einem Überblick über die EU-<br />
Strukturpolitik der auslaufenden Förderperiode,<br />
in dem Konrad Lammers insbesondere den <strong>für</strong><br />
Nordwestdeutschland relevanten institutionellen<br />
Rahmen skizziert, die theoretische Debatte<br />
zwischen Effizienz/Wachstum und Ausgleich<br />
schildert sowie die empirischen Erkenntnisse zu<br />
den bisherigen Effekten der EU-Strukturpolitik<br />
zusammenfasst. Anschließend präsentiert Hans-<br />
Ulrich Jung nach dem Muster der Regionalberichte<br />
des Niedersächsischen Instituts <strong>für</strong> Wirtschaftsforschung<br />
(NIW), dessen Interessen er<br />
zum Zeitpunkt der Manuskriptabfassung noch<br />
vertrat, die ökonomischen Stärken und Schwächen<br />
„Norddeutschlands“ (sic!). Das deutlich<br />
längste Kap. 3 enthält die konkrete Ausgestaltung<br />
der EU-Strukturpolitiken in Schleswig-<br />
Holstein (Markus Hirschfeld / Sven-Olaf Salow,<br />
Niedersachsen (Alexander Skubowius), Bremen<br />
(Guido Nischwitz) sowie Hamburg (Guido<br />
Sempell). Das perspektivisch interessanteste<br />
Kap. 5 erörtert drei neuere bzw. <strong>für</strong> die Unter-
98 <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> Heft 1-2 / <strong>2013</strong><br />
suchungsregion besonders relevante Aspekte<br />
des Gesamtthemas, nämlich Politiken <strong>für</strong> ländliche<br />
Räume (Guido Nischwitz), das junge Instrument<br />
der regionalisierten Teilbudgets (nur<br />
in Niedersachsen) (Alexander Skubowius) sowie<br />
Governance-Arrangements in den betreffenden<br />
Bundesländern (Dietrich Fürst). Schließlich<br />
fassen Jung, Nischwitz und Skubowius in einem<br />
Fazitkapitel die zentralen Ergebnisse und Empfehlungen<br />
zusammen.<br />
Die wesentlichen Ergebnisse sind zu interpretieren<br />
mit Blick auf die vergleichsweise großen<br />
intraregionalen Disparitäten in Norddeutschland<br />
mit wachstumsstarken Räumen im urbanen oder<br />
ländlichen Umfeld und zahlreichen wachstumsschwachen<br />
Regionen. Erhebliche Investitionen<br />
in der unternehmensorientierten Infrastruktur<br />
mittels räumlich selektiver Förderung seien Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> einen Abbau regionaler Disparitäten.<br />
Andererseits sei ein Aufholen gegenüber<br />
den süddeutschen Ländern nur möglich, wenn<br />
konsequent innovations- und qualifikationsorientierter<br />
Strukturwandel gefördert würde,<br />
was eine Fokussierung auf die wirtschaftlichen<br />
Zentren notwendig mache. Zudem sei die positive<br />
Korrelation zwischen Wirtschafts- und<br />
Bevölkerungswachstum in der Untersuchungsregion<br />
besonders stark, was bei regionalpolitischen<br />
Entscheidungen zu berücksichtigen sei.<br />
Natürlich mussten die Autoren ihre Empfehlungen<br />
Ende September 2011 unter erheblicher<br />
Unsicherheit formulieren, da die maßgeblichen<br />
Verordnungsvorschläge der EU-Kommission<br />
und die sich daran anschließende Debatte auf<br />
der europäischen (Rat, Parlament), der Bundesund<br />
der Länderebene noch in der Zukunft lagen.<br />
Die Autoren empfehlen insbesondere, neue<br />
Governance-Formen durch die Einbettung regio<br />
naler Entwicklungsstrategien stärker als bisher<br />
zu fördern, denn dies sei eine Schwachstelle<br />
beispielsweise in der niedersächsischen Regionalförderung.<br />
Eine zweite Empfehlung zielt<br />
auf die engere Verzahnung insbesondere der<br />
Wirtschafts- und Landwirtschaftsressorts in den<br />
beiden Flächenländern, auf regionaler Ebene<br />
aber auch auf die stärkere Kopplung von staatlichen<br />
Unterstützungsleistungen an inhaltliche<br />
und organisatorische Qualitätsanforderungen.<br />
Die dritte und wichtigste Empfehlung adressiert<br />
die mangelnde ländergrenzenübergreifende Koordinierung<br />
der Maßnahmen, wodurch erhebliche<br />
Effizienzverluste hervorgerufen worden<br />
seien. Schon in der aktuellen Förderperio de sei<br />
zu wenig voneinander gelernt worden, obwohl<br />
einzelne Bundesländer und Regionen wertvolle<br />
Erfahrungen gemacht hätten, die andere Teilräume<br />
gut hätten nutzen können (z. B. Etablierung<br />
revolvierender Finanzinstrumente, Scoring-Verfahren<br />
zur Verbesserung der Projektqualität, Zusammenbindung<br />
multisektoraler Förderin strumente).<br />
Der Band liefert einen guten Einblick in die<br />
Umsetzungsprobleme, aber auch die Potenziale<br />
eines komplexen und zumindest in Teilen des<br />
ökonomisch peripheren Nordwestdeutschlands<br />
sehr wirkungsmächtigen Politikbereichs wie<br />
der EU-Strukturpolitik. Der Autorenmix aus<br />
Vertretern von Politik, Verwaltung und Wissenschaft<br />
tut dem Band gut, macht er doch die<br />
bisweilen sehr unterschiedlichen Sichtweisen<br />
und Ziele deutlich. Der Berichterstatter hätte<br />
sich aber bisweilen eine etwas kritischere und<br />
pointiertere Bewertung und ebensolche Empfehlungen<br />
gewünscht, denn zumindest die Autoren<br />
der Wissenschaft besitzen doch die da<strong>für</strong><br />
notwendige Unabhängigkeit von politischen<br />
Vorgaben. Nachvollziehbar sind Resultate und<br />
Empfehlungen in ihrer Mehrzahl sehr wohl. Die<br />
Zielgruppe dieses Bandes dürfte eher in den Bereichen<br />
Raumordnungs- und Regionalpolitik,<br />
also in öffentlicher Verwaltung und in Teilen<br />
der politikorientierten Wissenschaft zu suchen<br />
sein als etwa unter Studierenden. Letzteren sei<br />
aber mindestens das Kapitel über die bisherige<br />
empirische Bilanz der EU-Regionalpolitik sowie<br />
– je nach regionalem Interesse – ein Kapitel<br />
zur Ausgestaltung der EU-Regionalpolitik in<br />
den vier Bundesländern zur Lektüre empfohlen,<br />
denn diese Aspekte fehlen leider in vielen (auch<br />
den vielen jüngeren) Lehrbüchern der <strong>Wirtschaftsgeographie</strong>.<br />
Dies kann auch ein notwendiger<br />
Schritt sein, um der vermeintlichen oder<br />
tatsächlichen Europamüdigkeit oder gar -feindschaft<br />
in Teilen auch der deutschen Gesellschaft<br />
entgegenzutreten. Über die inhaltliche, sektorale<br />
und finanzielle Ausgestaltung der EU-Strukturpolitik<br />
(Wettbewerb vs. Ausgleich) lässt sich<br />
trefflich streiten. Dass sie Wirkung in den Regionen<br />
(auch den nordwestdeutschen) zeigt, ist<br />
dagegen nicht umstritten – ebensowenig wie<br />
die Tatsache, dass diese Wirkungen zumindest<br />
partiell von der Umsetzung und Ausgestaltung<br />
entsprechender Programme und Instrumente abhängen,<br />
dem Gegenstand dieses Bandes. Es täte<br />
nicht nur Studierenden, sondern auch Politikern,<br />
Unternehmern und anderen gesellschaftlichen<br />
Gruppen gut, mehr über diese Themen zu lernen.<br />
Dazu kann der Band beitragen.<br />
Rolf Sternberg, Hannover
Buchbesprechungen 99<br />
Matanle, Peter / Anthony S. Rausch with<br />
the Shrinking Regions Research Group<br />
(Eds.): Ja pan’s shrinking regions in the 21st<br />
century. Contemporaray responses to depopulation<br />
and socioeconomic decline. Amherst / New<br />
York: Cambria Press 2011, 530 p., 130,– €.<br />
Dieses beeindruckende Werk ist weit mehr als<br />
das Resultat eines internationalen Symposiums<br />
vom Juli 2008 an der Universität Sheffield. Die<br />
Herausgeber haben es, in Zusammenarbeit mit<br />
16 weiteren Referenten der Forschungsgruppe<br />
Shrinking Regions, hervorragend verstanden,<br />
eine repräsentative Auswahl detaillierter<br />
Beiträge des Symposiums, die außer Japan<br />
auch Schrumpfungsregionen Schottlands und<br />
Deutschlands beinhalten, in 11 Kapiteln thematisch<br />
sinnvoll miteinander zu verknüpfen, daraus<br />
Ergebnisse zu extrahieren und Handlungsempfehlungen<br />
abzuleiten. Die Zusammenführung<br />
theoretisch und methodisch unterschiedlicher<br />
Präsentationen und Fallbeispiele in Kombination<br />
mit verschiedennen geographischen Maßstabsebenen<br />
(lokal, regional, national, global) mündet<br />
in eine umfassende Analyse der schrumpfenden<br />
Regionen Japans, wo der Grad der Schrumpfung<br />
besonders dramatisch ist und die Reaktion darauf<br />
erhellende Einsichten erwarten lässt. Eine<br />
gut strukturierte Gliederung, aufschlussreiche<br />
Karten, Graphiken und Tabellen sowie ein ausführliches<br />
Sachregister erleichtern dem Leser<br />
das Verständnis komplexer Zusammenhänge.<br />
Gezielte Fragestellungen führen jeweils am Ende<br />
eines Kapitels in die Thematik des folgenden ein.<br />
Der Band ist in zwei Hälften gegliedert. Teil 1<br />
fokussiert auf die Charakteristika, Wirkungen<br />
und Herausforderungen der Schrumpfungs- und<br />
Alterungsprozesse. Er beginnt mit den weltweiten<br />
Erfahrungen regionaler Schrumpfung<br />
in entwickelten Ländern. Eingebettet in diesen<br />
globalen Prozess finden sich in Japan zwei Typen<br />
regionaler Schrumpfung: erstens der beständige,<br />
allmähliche, kaum wahrnehmbare<br />
Niedergang ländlicher Regionen, bedingt durch<br />
zurückgehende Geburtenhäufigkeit und dauerhafte<br />
Abwanderung vor allem junger Menschen<br />
in die Großstädte und Metropolen als Folge ihrer<br />
Suche nach Beschäftigung, Weiterbildung<br />
und gesellschaftlichem Aufstieg und zweitens<br />
der eher abrupte Zusammenbruch peripherer,<br />
monostruktureller Städte nach Verlust ihrer<br />
wirtschaftlichen Basis (v. a. Schwerindustrie<br />
und Bergbau). Beide Prozesse sind zu einem<br />
gewissen Grad Folgen der auf Wachstum und<br />
Wohlstand – und damit auf die Wahrnehmung<br />
von Agglomerationsvorteilen – fixierten nationalen<br />
Wirtschaftspolitik, die einseitig den Metropolregionen<br />
zu Lasten der Peripherie zugute<br />
kam. Schrumpfung in der Peripherie Japans ist<br />
kein einheitlicher Prozess. Während regionale<br />
Zentren aus spezifischen Gründen teilweise ein<br />
kräftiges Wachstum aufweisen (z. B. durch die<br />
Anbindung an eine vorteilhafte Verkehrsinfrastruktur),<br />
hatten selbst benachbarte Gemeinden<br />
unter anhaltendem Bevölkerungsschwund und<br />
wirtschaftlichem Niedergang zu leiden. Für die<br />
Zukunft sehen die Autoren regionale Schrumpfung<br />
in Japan als einen eher uniformen Prozess,<br />
insofern nicht nur Regionalstädte, sondern sogar<br />
Metropolregionen einem langfristig anhaltenden<br />
Schrumpfungsprozess, der lange auf ländliche<br />
Schauplätze begrenzt war, unterliegen.<br />
Teil 2 liefert die Antworten auf die Herausforderungen<br />
durch Schrumpfung auf unterschiedlichen<br />
Maßstabsebenen. Seit den 1950er Jahren<br />
bis in die Gegenwart hat es nicht an Maßnahmen<br />
gefehlt, den anhaltenden Tendenzen unausgewogener<br />
Landesentwicklung durch eine<br />
Vielzahl von Revitalisierungsmaßnahmen entgegenzuwirken.<br />
Dies betrifft insbesondere die<br />
Entwicklung einer regionalen Infrastruktur auf<br />
der Grundlage eines komplexen Systems öffentlicher<br />
Subventionen der Zentralregierung.<br />
Dadurch jedoch verstärken sich die Probleme:<br />
die Abhängigkeit der Schrumpfungsregionen<br />
von der Zentrale sowie der fragwürdige Nutzen<br />
zentralstaatlicher Investitionen, die vor allem<br />
einer privilegierten Baulobby zugute kommen,<br />
einer nachhaltigen Regionalentwicklung jedoch<br />
abträglich sind. Inzwischen fließen staatliche<br />
Zuweisungen an die Regionen nicht mehr so<br />
üppig wie in den Jahrzehnten zuvor. Viele ländliche<br />
Gemeinden sehen daher ihre Lebensgrundlage<br />
im Tourismus, eine Strategie, die anhand<br />
von Fallbeispielen als problematisch diskutiert<br />
wird. Zuwanderungen von außen könnten den<br />
Schrumpfungsgrad erheblich mildern, gelten jedoch<br />
in einem Land, das auf seine Homogenität<br />
großen Wert legt, als zu risikoreich.<br />
Aus den Schlussfolgerungen ergeben sich vier<br />
Handlungsempfehlungen <strong>für</strong> schrumpfende Regionen<br />
(Kap. 11): erstens eine stärkere Vernetzung<br />
politischer und wirtschaftlicher Aktivitäten<br />
unter Einbeziehung lokaler Akteure von Nichtregierungsorganisationen<br />
in Entscheidungsprozesse,<br />
zweitens auf der Ebene der Gemeinden<br />
die Entwicklung professioneller Fähigkeiten hin<br />
zu einer nachhaltigen Vermarktung ihres kulturund<br />
naturlandschaftlichen Erbes (brand-crea-
100 <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> Heft 1-2 / <strong>2013</strong><br />
tion, brand-management), drittens die Schaffung<br />
einer internationalen Clearingstelle (eingebracht<br />
durch die UN oder besser die japanische<br />
Regierung), die den Akteuren schrumpfender<br />
Regionen Informationen, Forschungsergebnisse<br />
und Beratungskompetenz zur Verfügung stellt,<br />
viertens schließlich eine stärkere Fokussierung<br />
in der Forschung auf die positiven Potenziale<br />
der Schrumpfung, damit zusammenhängend<br />
das Plädoyer <strong>für</strong> einen Paradigmenwechsel weg<br />
von kontinuierlichem Wirtschaftswachstum hin<br />
zur Verbesserung des Lebensraumes im Sinne<br />
nachhaltiger Entwicklung. Kurz vor Erscheinen<br />
dieses Buches traf das schwere Erdbeben 2011<br />
die periphere Küstenregion Tōhokus und ihre<br />
stark schrumpfende und alternde Bevölkerung.<br />
In einem Epilog („Lessons from Tōhoku“) wird<br />
diese Katastrophe in das Thema Schrumpfungsstrategien<br />
einbezogen.<br />
Im Spannungsfeld zwischen dem Drama zunehmender<br />
Ortswüstungen einerseits und den<br />
Möglichkeiten aktiver Gestaltung regionaler<br />
Schrumpfung andererseits bietet dieser ambitionierte,<br />
problemorientierte Band durch die Verarbeitung<br />
typischer Fallbeispiele nicht nur den<br />
Japan-Experten, sondern all jenen, die an den<br />
Problemen des demographischen Wandels in<br />
seiner Raumwirksamkeit und gesellschaftspolitischen<br />
Brisanz interessiert sind, hervorragende<br />
Informationen und Anregungen. Ein sehr empfehlenswertes<br />
Buch.<br />
Winfried Flüchter, Duisburg-Essen<br />
Lohmann, Carsten: Außerlandwirtschaftliche<br />
Beschäftigung im ländlichen Thailand. Ursachen,<br />
Auswirkungen und Zugangsfaktoren. Baden-Baden:<br />
Nomos Verlag 2009, 268 S., € 39,–.<br />
(Weltwirtschaft und internationale Zusammenarbeit,<br />
Band 6).<br />
Die ländlichen Räume in den Entwicklungs- und<br />
Schwellenländern sind schon lange nicht mehr<br />
rein agrarisch geprägt. Außerlandwirtschaftliche<br />
Tätigkeiten haben in den vergangenen Jahrzehnten<br />
an Bedeutung gewonnen und rücken nun<br />
auch verstärkt in den Blickpunkt der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Insbesondere die Weltbank<br />
scheint in ihnen einen neuen Heilsbringer<br />
zu sehen. Hieraus erwächst ein Forschungsbedarf,<br />
dem sich anglophone Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaftler bereits angenommen haben,<br />
die geographische Entwicklungsforschung,<br />
insbesondere in Deutschland, bislang aber noch<br />
kaum. Von daher ist die vorliegende Studie<br />
grundsätzlich eine willkommene Bereicherung.<br />
Die als Diss. an der Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen im Kontext des DFG-Projekts „Impacts<br />
of shocks on regional economic development<br />
and local capacity building in Thailand and Vietnam“<br />
der an den Universitäten Gießen und Hannover<br />
beheimateten Forschergruppe 756 „The<br />
impacts of shocks on the vulnerability to poverty:<br />
consequences for development of emerging<br />
Southeastern Asian economies“ entstandene<br />
Arbeit beschäftigt sich mit dem Schwellenland<br />
Thailand und könnte noch aus einem weiteren<br />
Grund einen wichtigen Beitrag zur geographischen<br />
Entwicklungsforschung darstellen:<br />
Durch ihren Fokus auf die Provinzen Burinam,<br />
Ubon Ratchathani und Nakhom Phanom im<br />
armen Nordosten Thailands, der kaum vom<br />
Wirtschaftsboom der vergangenen Jahrzehnte<br />
profitiert hat, leistet sie einen Beitrag zur Frage<br />
nach den Entwicklungsprozessen in der „neuen<br />
Peripherie“, wie Fred Scholz in seiner Theorie<br />
der fragmentierenden Entwicklung die Weltregio<br />
nen bezeichnet hat, die nicht Gegenstand des<br />
Interesses internationaler Investoren sind.<br />
Diesen Erwartungen wird die Studie jedoch leider<br />
nicht gerecht, was primär ihrer Methodik<br />
geschuldet ist: Der Verf. arbeitet rein quantitativ<br />
und stützt sich im Wesentlichen auf die Daten<br />
einer im Rahmen des DFG-Projekts durchgeführten<br />
Befragung von 2 186 Haushalten in den<br />
222 Dörfern der drei genannten thailändischen<br />
Nordost-Provinzen. Hierzu ist kritisch anzumerken,<br />
dass lediglich die Haushaltsvorstände, nicht<br />
aber die übrigen erwachsenen Haushaltsmitglieder<br />
befragt wurden. Dadurch wurde die Chance<br />
vergeben, haushaltsinterne Unterschiede (und<br />
evtl. Spannungen) bzgl. der Strategien zur Generierung<br />
von Einkommen untersuchen zu können.<br />
Der verwendete (aber nicht abgedruckte)<br />
Fragebogen wurde nicht auf der Basis einer qualitativen<br />
Vorstudie entwickelt und war vollstandardisiert.<br />
Gegenüber einer Arbeitsweise, die<br />
den Forschungsgegenstand losgelöst von seinem<br />
spezifischen regionalen und kulturellen Kontext<br />
betrachtet, lassen sich erhebliche Bedenken<br />
vorbringen. Eine zeitgemäße wirtschafts- und<br />
sozialwissenschaftliche Entwicklungsforschung<br />
stellt dies jedenfalls nicht dar, und es führt zu unbefriedigenden<br />
Ergebnissen. Im Falle der vorliegenden<br />
Studie kommt erschwerend hinzu, dass<br />
sich dem Leser der Eindruck aufdrängt, dass der<br />
Autor über ungenügende Regionalkenntnisse<br />
verfügt.
Buchbesprechungen 101<br />
Abgesehen von diesen Einwänden ist die vorgelegte<br />
Studie aber ein vorbildliches Beispiel <strong>für</strong><br />
induktive Arbeitsweisen: Nach einer Definition<br />
der zentralen Begriffe (Kap. 2) diskutiert der<br />
Autor theoretische Ansätze zu Verwundbarkeit,<br />
Anreizen und Motiven außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigung, stufentheoretische Ansätze<br />
zur Entwicklung des ländlichen außerlandwirtschaftlichen<br />
Sektors sowie das Location-Opportunity-Konzept,<br />
um Interdependenzen zwischen<br />
Verwundbarkeit, außerlandwirtschaftlicher Beschäftigung,<br />
ländlicher Entwicklung und Regionalfaktoren<br />
auszuloten (Kap. 3). Ziel des<br />
Theoriekapitels ist die Identifizierung operationalisierbarer<br />
Bestimmungsfaktoren <strong>für</strong> die Entstehung<br />
und die Aufnahme außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigung im ländlichen Raum sowie<br />
die Höhe der Entlohnung der in diesem Sektor<br />
Beschäftigten. Der Verf. entwickelt schließlich<br />
Hypothesen und erkenntnisleitende Fragen<br />
(Kap. 3.5), die im Folgenden konsequent überprüft<br />
werden. In Kap. 4 werden dann die quantitativen<br />
Erhebungsmethoden umrissen, die Methoden<br />
der statistischen Datenanalyse erläutert<br />
sowie die Operationalisierung und Definition<br />
der Variablen vorgenommen.<br />
Kap. 5 widmet sich zunächst anhand von Sekundärliteratur<br />
und der Auswertung nationaler<br />
Statistiken der Wirtschafts- und Armutsentwicklung<br />
Thailands seit dem Zweiten Weltkrieg,<br />
wobei ein Schwerpunkt auf regionale Disparitäten<br />
gelegt wird. Anschließend werden die<br />
drei Untersuchungsprovinzen vorgestellt. Leider<br />
stützt sich der Autor hierbei wiederum nur auf<br />
nationale Statistiken und Weltbank-Studien. Andere<br />
Regionalliteratur wird nicht ausgewertet.<br />
Insgesamt beschränkt sich der Verf. bei seiner<br />
Darstellung des thailändischen Nordostens auf<br />
die sozioökonomischen Rahmenbedingungen<br />
<strong>für</strong> außerlandwirtschaftliche Beschäftigung. Der<br />
Leser erfährt nur sehr wenig über die Situation<br />
der Landwirtschaft in den Untersuchungsprovinzen.<br />
Eine Beschreibung der soziokulturellen<br />
Rahmenbedingungen fehlt völlig.<br />
Die Analyse der im Rahmen der Haushaltsbefragung<br />
erhobenen Daten erfolgt in Kap. 6 und 7.<br />
Dabei werden Schritt <strong>für</strong> Schritt die zuvor aufgestellten<br />
Hypothesen und erkenntnisleitenden<br />
Fragen überprüft. Der Autor stützt sich dabei<br />
auf eine konsequente statistische Datenanalyse,<br />
deren Ergebnisse sowohl textlich als auch<br />
mit Hilfe zahlreicher Tabellen und einzelner<br />
Graphiken dargestellt werden. Die beiden Kapitel<br />
sind solide ausgearbeitet. Störend ist allerdings,<br />
dass der Autor <strong>für</strong> seine Fachtermini<br />
eigene Abkürzungen verwendet (z. B. ALaRB<br />
<strong>für</strong> „Außerlandwirtschaftliche abhängige regionale<br />
Beschäftigung“). Dies erschwert streckenweise<br />
die Lektüre. Untersucht werden zunächst<br />
Bedeutung, Anreize und Auswirkungen außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigung. Der Autor<br />
konstatiert, dass alle Bevölkerungsschichten in<br />
Nordostthailand an der außerlandwirtschaftlichen<br />
Beschäftigung partizipieren, das durch sie<br />
erzielte Einkommen sei höher als das agrarische<br />
und stelle so einen wirkungsvollen Beitrag zur<br />
Armutsreduktion dar. Allerdings profitierten<br />
wohlhabendere Haushalte stärker als ärmere<br />
Familien. Insgesamt wiesen Haushalte, deren<br />
Mitglieder einer außerlandwirtschaftlichen Beschäftigung<br />
nachgingen, ein höheres Einkommen,<br />
eine geringe Armut und eine geringere<br />
Verwundbarkeit auf. Die Mehrheit der Bevölkerung<br />
sei zwar externen Schocks, insbesondere<br />
in der Landwirtschaft, ausgesetzt, diese seien<br />
aber nicht der Hauptgrund <strong>für</strong> die Aufnahme<br />
außerlandwirtschaftlicher Beschäftigung, sondern<br />
vielmehr der Wunsch der ländlichen Haushalte,<br />
zusätzliches Einkommen zu erzielen und<br />
durch Diversifizierung ihre Verwundbarkeit zu<br />
verringern. Letzteres gelinge insofern, als mit<br />
Hilfe des Zusatzeinkommens aus außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigung Verluste im Bereich<br />
der Landwirtschaft leichter kompensiert werden<br />
könnten.<br />
In Kap. 7 wird die Frage diskutiert, welchen Einfluss<br />
die Nähe zu den Provinzhauptstädten auf<br />
die regionale außerlandwirtschaftliche Beschäftigung<br />
hat. Dabei kommt der Autor zu dem Ergebnis,<br />
dass sich die Stadtnähe zwar positiv auf<br />
die Partizipation der ländlichen Bevölkerung an<br />
abhängiger außerlandwirtschaftlicher Beschäftigung<br />
auswirke, nicht jedoch auf die Beteiligung<br />
an selbstständiger Beschäftigung in diesem Sektor,<br />
da diese Tätigkeiten primär in den Dörfern<br />
selbst ausgeübt würden. Außerdem wirke sich<br />
die Stadtnähe nur in der Privatwirtschaft auf die<br />
Höhe der Entlohnung abhängiger außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigung aus. Im öffentlichen<br />
Sektor würden den Angestellten in den Städten<br />
die gleichen Löhne gezahlt wie in den Dörfern.<br />
Im Bereich der selbstständigen außerlandwirtschaftlichen<br />
Beschäftigung ergäben sich keine<br />
Einkommensunterschiede durch die räumliche<br />
Lage. Stadtnähe wirke sich aber positiv auf die<br />
Höhe des gesamten außerlandwirtschaftlichen<br />
regionalen Einkommens, auf das Pro-Kopf-Einkommen<br />
der Haushalte und auf die Armutsquote<br />
aus.
102 <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> Heft 1-2 / <strong>2013</strong><br />
Insgesamt muss der Erkenntnisgewinn der Studie<br />
als recht bescheiden eingeschätzt werden.<br />
Fragen wie die nach Disparitäten zwischen<br />
den einzelnen Haushalten in den Dörfern oder<br />
zwischen den einzelnen Haushaltsmitgliedern<br />
werden ebensowenig behandelt wie die Rückwirkungen<br />
der außerlandwirtschaftlichen Beschäftigung<br />
auf den Agrarsektor. Dies ist der<br />
sowohl inhaltlichen als auch methodischen<br />
Selbstbeschränkung des Autors geschuldet, das<br />
Thema isoliert und ausschließlich mit Hilfe<br />
quantitativer Erhebungs- und Analyseverfahren<br />
zu betrachten. So liest sich die Arbeit denn<br />
auch eher wie eine Weltbank-Studie als wie eine<br />
moderne entwicklungsgeographische Arbeit.<br />
Schade. Die Themen außerlandwirtschaftliche<br />
Beschäftigung und Entwicklungsprozesse in<br />
ländlich-peripheren Regionen im Zeitalter der<br />
Globalisierung bieten sicher mehr Erkenntnispotenzial<br />
<strong>für</strong> eine (wirtschafts-)geographische<br />
Entwicklungsforschung.<br />
Bernhard Martin, Halle (Saale)<br />
Lohmann, Dieter / Podbregar, Nadja: Im<br />
Fokus: Bodenschätze. Auf der Suche nach Rohstoffen.<br />
Berlin: Springer Verlag 2012, 172 S.,<br />
19,95 €. (Naturwissenschaften im Fokus).<br />
Nachdem die Frage des sicheren Zugangs zu<br />
Rohstoffen lange Zeit stiefmütterlich behandelt<br />
wurde, steht das Thema in den letzten Jahren,<br />
nicht zuletzt durch stark steigende Preise, wieder<br />
auf der Agenda von Politik, Wirtschaft und<br />
Wissenschaft. So begeben sich auch die Autoren<br />
des vorliegenden Bandes in der Mehrzahl der 17<br />
Kapitel ihres Werkes auf die Suche nach bisher<br />
unerschlossenen bzw. ungenutzten Rohstoffvorkommen.<br />
Hierbei fokussieren die beiden Autoren<br />
deutlich, jedoch nicht ausschließlich, auf<br />
Energierohstoffe und die Frage nach dem Zugang<br />
zu diesen Rohtoffen <strong>für</strong> die deutsche Wirtschaft.<br />
Als Hauptquellen dienen die Sichtweisen<br />
von deutschen Experten, die auch in zwei Kapiteln<br />
direkt in Interviews zu Wort kommen. Gelungene<br />
Illustrationen, Karten und Grafiken zu<br />
den behandelten Themen finden sich gebündelt,<br />
formal etwas unglücklich, in der Mitte des Werkes<br />
und sind nicht den einzelnen, in sich eigenständigen<br />
Kapiteln zugeordnet.<br />
Einleitend befasst sich das Werk mit der allgemeinen<br />
Verknappung von Rohstoffen auf den<br />
Weltmärkten in den letzten Jahren und stellt<br />
neben der Frage nach der physischen Verknappung<br />
(Stichwort: peak oil) auch die wesentlich<br />
bedeutendere nach der Verfügbarkeit. Harald<br />
Dill von der Bundesanstalt <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
und Rohstoffe (BGR) beantwortet in Kap. 4<br />
die wichtigsten Fragen zur heutigen und künftigen<br />
Rohstoffversorgung <strong>für</strong> Deutschland in<br />
einem Interview und geht dabei auch auf mögliche<br />
neue Quellen durch Recycling ein. Die Kap.<br />
2 und 3 behandeln mit den Seltenen Erden und<br />
dem Konfliktrohstoff Coltan zwei Rohstoffgruppen,<br />
die aufgrund ihrer Bedeutung <strong>für</strong> Hightech-<br />
Produkte in jüngster Zeit in den öffentlichen Fokus<br />
gelangt sind. Die schwierige Versorgungssituation<br />
bei Seltenen Erden durch die hohe<br />
Länderkonzentration der Lagerstätten, die Frage<br />
nach weiteren Vorkommen und die Möglichkeit<br />
des Recyclings werden hier thematisiert. Die<br />
Mitfinanzierung von Kriegsökonomien durch<br />
den Coltan-Bergbau in der DR Kongo wird im<br />
folgenden Kapitel behandelt.<br />
Der Mittelteil des Buches (Kap. 5 bis 11) befasst<br />
sich ausführlich mit Energierohstoffen und<br />
hierbei schwerpunktmäßig mit der Suche nach<br />
bisher nur wenig bzw. ungenutzten Vorkommen.<br />
Trotz der relativen Armut an Vorkommen von<br />
Energierohstoffen in Deutschland zeigen die Autoren<br />
das Potenzial bisher noch unerschlossener<br />
Quellen auf. Über die Suche nach ungenutzten<br />
klassischen Erdgaslagerstätten in Deutschland<br />
kommen die Autoren auf die Potenziale von<br />
Schiefergas und Grubengas, die insbesondere<br />
in den USA schon in größerem Maße gefördert<br />
werden, zu sprechen, und deren Abbau auch in<br />
Europa die Abhängigkeit von Exportländern<br />
verringern könnte. Gleiches gilt <strong>für</strong> Gashydrate,<br />
die unter hohem Druck und bei Kälte abseits<br />
menschlicher Besiedelungen in den Weltmeeren<br />
und in Permafrostböden vorkommen. Auch<br />
wenn Deutschland keinen direkten Zugang zu<br />
diesen Quellen hat, sind durch die Bundesregierung<br />
mitfinanzierte Projekte mit der Erkundung<br />
dieser Vorkommen beschäftigt. Bei aller<br />
Euphorie um mögliche neue Quellen vergessen<br />
die Autoren keineswegs, auch auf die direkten<br />
ökologischen Folgen der Gewinnung von Energierohstoffen<br />
hinzuweisen, wo<strong>für</strong> das Kapitel<br />
zur Katastrophe der Explorations-Ölplattform<br />
Deepwater Horizon im Golf von Mexiko exemplarisch<br />
steht. Die Grundsatzfrage nach der vollständigen<br />
Abkehr von fossilen Energieträgern<br />
wird jedoch nur am Rande gestellt.<br />
Anschließend an das Kapitel zum Potenzial von<br />
Gashydraten wird in Kap. 12 mit Manganknollen<br />
eine unangetastete Quelle <strong>für</strong> wichtige minera-
Buchbesprechungen 103<br />
lische Rohstoffe thematisiert, an deren Erforschung<br />
ebenfalls deutsche Wissenschaftler beteiligt<br />
sind. Diese Rohstoffvorkommen in der Tiefsee,<br />
welche unter anderem Mangan, Kobalt und<br />
Nickel enthalten, werden recht ausführlich auch<br />
im Hinblick auf die politischen und ökologischen<br />
Probleme eines Abbaus analysiert. Die abschließenden<br />
Kap. (13 bis 17) thematisieren in erster<br />
Linie die negativen Folgen durch den Abbau von<br />
Bodenschätzen. Über die bereits populärwissenschaftlich<br />
aufgearbeitete Problematik der afrikanischen<br />
„Blutdiamanten“ gelangen die Autoren<br />
zu den ökologischen Folgen des Abbaus von<br />
Stein- und Braunkohle insbesondere in Deutschland.<br />
Die Konsequenzen des Abbaus von mineralischen<br />
Massenrohstoffen werden am Beispiel<br />
des Kupferbergbaus in Chile kurz angesprochen.<br />
Resümierend lässt sich festhalten, dass die Autoren<br />
einen sehr guten Überblick über ein aktuelles<br />
Thema bieten. Globale geopolitische und<br />
gesellschaftliche Regulationsmechanismen im<br />
Rohstoffsektor zur Herstellung der Versorgungssicherheit<br />
blendet das Buch aber weitgehend<br />
aus, es konzentriert sich in erster Linie auf die<br />
Suche nach unangetasteten Rohstoffquellen aus<br />
eurozentrischer Sicht. Hier bietet das Werk interessante,<br />
gut recherchierte Einblicke und erweitert<br />
den Horizont des Lesers, ohne diesen mit<br />
Detailinformationen zu belasten. Ein deutlicher<br />
Schwerpunkt wird auf Energierohstoffe gelegt,<br />
wohingegen den klassischen mineralischen Massenrohstoffen<br />
wie Bauxit, Eisenerz oder Kupfer<br />
nur wenig Platz eingeräumt wird. Der Problematik<br />
der sogenannten Hightech-Rohstoffe,<br />
die insbesondere in den Industrieländern einen<br />
Bedeutungszuwachs erfahren werden, wird mit<br />
den Kapiteln zu den Seltenen Erden und Coltan<br />
Rechnung getragen. Die in sich geschlossenen,<br />
allerdings in der Zusammenstellung leicht heterogen<br />
angeordneten Kapitel sind logisch aufgebaut<br />
und gehen auf die wichtigsten Aspekte<br />
der einzelnen Bodenschätze wie Bedarf, Vorkommen,<br />
Geologie, Ökonomie und Ökologie<br />
ein. Insgesamt wird dem Leser auf ca. 160 gut<br />
zu lesenden Seiten ein umfassender Einblick<br />
in die Lagerstättenproblematik verschiedener<br />
Rohstoffe gegeben. Weitere wichtige Teilbereiche<br />
der weltweiten Rohstoffproblematik werden<br />
analysiert oder zumindest angesprochen. Das<br />
vorliegende Werk eignet sich daher insbesondere<br />
als Einführung in die Thematik und bietet<br />
da<strong>für</strong> einen exzellenten Überblick über aktuelle<br />
Problemstellungen und zukünftige Perspektiven.<br />
Mark Kruse, Halle (Saale)<br />
Schirmel, Henning: Sedimentierte Unsicherheitsdiskurse.<br />
Die diskursive Konstitution von<br />
Berliner Großwohnsiedlungen als unsichere<br />
Orte und Ziel von Sicherheitspolitiken. Erlangen:<br />
Selbstverlag 2011, 270 S., 14 Abb., 2 Tab.,<br />
29,50 € (Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderband<br />
39).<br />
Die Analyse von Verräumlichungen städtischer<br />
Unsicherheitsdiskurse und der darin eingelagerten<br />
Machtverhältnisse ist nicht nur gesellschaftlich<br />
höchst relevant, sondern in den letzten<br />
Jahren auch zu einem intensiv diskutierten Forschungsgegenstand<br />
der geographischen Stadtforschung<br />
avanciert. Daran sowie an die diskurstheoretische<br />
Wende im Kontext der ‚Neuen<br />
Kulturgeographie‘ anknüpfend untersucht der<br />
Autor in seiner Diss., wie erstens Großwohnsiedlungen<br />
in Printmedien als unsichere Orte<br />
entworfen werden und inwiefern sich dieser<br />
Diskurs zweitens in städtischen Organisationen<br />
sedimentiert. Auf die Diskurstheorie von Laclau<br />
und Mouffe zurückgreifend folgt der Autor dabei<br />
deren anti-essenzialistischen Perspektive, wonach<br />
alles Soziale diskursiv hergestellt wird und<br />
die gesellschaftliche Wirklichkeit als grundsätzlich<br />
kontingent zu betrachten ist.<br />
Bezogen auf die erste Fragestellung wird analysiert,<br />
welche hegemonialen Bedeutungszuschreibungen<br />
Großwohnsiedlungen in der Süddeutschen<br />
Zeitung (SZ) im Zeitraum von 1994<br />
bis 2006 erfahren. Methodisch greift er dazu auf<br />
lexikometrische Makroverfahren zurück, welche<br />
hier eindeutig ihre Vorteile entfalten, durch die<br />
quantitative Analyse großer Textkorpora methodisch<br />
abgesicherte Ergebnisse zu liefern und<br />
vorschnelle Fehleinschätzungen zu vermeiden.<br />
Als zentrales Resultat lässt sich festhalten, dass<br />
in der SZ Großwohnsiedlungen als unsichere<br />
und gefährliche Stadträume naturalisiert sowie<br />
als Bedrohung der „nationalen Kultur- und<br />
Wertegemeinschaft“ (241) konstituiert werden.<br />
Denn entlang der Grenzziehungen Arbeit, Demokratie,<br />
Sicherheit, Ethnizität und Nation werden<br />
sie stets als antagonistische Orte markiert,<br />
welche das gesellschaftlich Andere beherbergen<br />
– sei es in Gestalt von Arbeitslosen, Rechtsextremen,<br />
gefährlichen Migranten und bedrohlichen<br />
Jugendlichen. Während die ostdeutsche Großwohnsiedlung<br />
dabei als entleerter, antidemokratischer<br />
Hort des Rechtsextremismus erscheint,<br />
wird ihr westdeutsches Pendant dem Muster<br />
eines Ghetto-Diskurses folgend als Ort sozialer<br />
Marginalisierung und ethnisch-kultureller<br />
Fremdheit konstruiert. Insgesamt kann der Verf.
104 <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftsgeographie</strong> Heft 1-2 / <strong>2013</strong><br />
überzeugend aufzeigen, dass Großwohnsiedlungen<br />
diskursiv als negativer Gegenentwurf zum<br />
Ideal der „Europäischen Stadt“ fungieren und<br />
somit die Wir-Identität einer deutschen, sozialgemischten<br />
und demokratisch-pluralistischen<br />
Mehrheitsgesellschaft stützen. Bei der Interpretation<br />
der Ergebnisse hätte man sich jedoch<br />
etwas mehr Vorsicht gewünscht. Denn so plausibel<br />
und aufschlussreich die Auswertung der<br />
Repräsentation von Großwohnsiedlungen in<br />
der SZ auch ist, so lässt sich aus der Analyse<br />
nur einer liberal-bürger lichen Tageszeitung nur<br />
bedingt und nicht automatisch auf „die gesellschaftlich<br />
hegemonialen Bedeutungen“ (55) von<br />
Großwohnsiedlungen schließen. Als Kontrast<br />
wäre ein Vergleich mit Printmedien aufschlussreich<br />
gewesen, welche einer anderen politischen<br />
Ausrichtung folgen oder selbst über eine nennenswerte<br />
Leserschaft in Großwohnsiedlungen<br />
verfügen.<br />
Auf der Medienanalyse aufbauend widmet sich<br />
der zweite empirische Abschnitt am Beispiel der<br />
beiden Berliner Großwohnsiedlungen Gropiusstadt<br />
und Marzahn der Frage, inwiefern sich<br />
der Diskurs um Großwohnsiedlungen als unsichere<br />
Orte auch in Form von institutionellen<br />
Praktiken, Sicherheitspolitiken und lokalen Diskurskoalitionen<br />
sedimentiert und welche sozialen<br />
Effekte damit einhergehen. Qualitativ wurden<br />
dazu 27 Interviews mit SprecherInnen verschiedener<br />
städtischer Organisationen aus den<br />
Bereichen Wohnungswesen, Stadtpolitik, formeller<br />
Sicherheit und Jugendhilfe sowie diverse<br />
weitere Dokumente (u. a.Verordnungen, Protokolle)<br />
präzise ausgewertet. Bemerkenswert an<br />
den Ergebnissen ist hier, dass der Mediendiskurs<br />
auf städtischer Ebene zwar weitgehend reproduziert<br />
wird, so dass von einer stabilen Hegemonie<br />
auszugehen ist, sich aber im Fall von Marzahn<br />
auch Brüche identifizieren lassen, etwa wenn die<br />
Ostberliner Großwohnsiedlung in städtischen<br />
Organisationen weniger als Ort des Rechtsextremismus<br />
erscheint, sondern Unsicherheit überraschenderweise<br />
und in deutlichem Kontrast zur<br />
SZ vielmehr ethnisiert und kulturalisiert wird.<br />
Für beide Fallbeispiele kann der Autor zudem<br />
aufzeigen, dass die Verräumlichung von Unsicherheit<br />
als entpolitisierter „common sense“<br />
(242) auf einer stabilen Hegemonie basiert, sich<br />
in lokalen Diskurskoalitionen einschreibt und<br />
daher nahezu unhinterfragt als Legitimationsfolie<br />
<strong>für</strong> eine Vielzahl verschiedener Politiken<br />
und Maßnahmen dient, welche von Strategien<br />
der baulichen und technischen Prävention<br />
(z. B. Videoüberwachung) über eine repressive<br />
Formalisierung sozialer Kontrolle (z. B. private<br />
Sicherheitsdienste, Kiezstreifen) bis hin zu<br />
Techniken der sozialen und kulturellen Integration<br />
(z. B. Belegungspolitiken, Aktivierung<br />
bürgerschaftlichen Engagements) reichen. Das<br />
somit detailliert herausgearbeitete Verhältnis<br />
zwischen dem Unsicherheitsdiskurs einerseits<br />
und dessen Sedimentierung in institutionellen<br />
Praktiken, Strategien und Diskurskoalitionen<br />
andererseits hätte allerdings noch stärker als<br />
sich gegenseitig verstärkende Wechselbeziehung<br />
in den Blick genommen werden können.<br />
Denn umgekehrt zur Sedimentierungsmetapher<br />
wäre auch die Frage zu problematisieren,<br />
inwiefern sich der hegemoniale Diskurs über<br />
unsichere Großwohnsiedlungen auch aus einem<br />
Geflecht lokaler Praktiken speist. Zudem arbeitet<br />
der Autor zwar die Funktionsweise und<br />
Wirkung diskursiver Ausschlüsse plausibel und<br />
methodisch fundiert heraus, aufgrund der theoretisch-konzeptionellen<br />
Verortung der Studie<br />
bleiben jedoch andere Formen sozial exkludierender<br />
Praktiken unberücksichtigt. Notwendig<br />
wäre dazu eine kritischere Auseinandersetzung<br />
mit den Grundannahmen der Diskurs- und Hegemonietheorie<br />
von Laclau und Mouffe. Ohne<br />
die innovativen Leistungen (z. B. Begriffe wie<br />
Artikulation, Äquivalenzkette und Antagonismus)<br />
zu verkennen, erscheint die diskursive<br />
Ontologie des Sozialen, welche jegliche Form<br />
sozialer Praxis auf diskursive Praktiken reduziert,<br />
dem hier untersuchten Gegenstand<br />
nicht ganz angemessen. Denn polit-ökonomische<br />
Transformationsprozesse, gesellschaftliche<br />
Kräfteverhältnisse und staatstheoretische<br />
Überlegungen werden dadurch bereits im Vorhinein<br />
ausgeblendet, so dass sie nicht in ihrem<br />
spezifischen Wechselverhältnis zu hegemonialen<br />
Diskursen problematisiert werden können.<br />
Grund hier<strong>für</strong> ist sicherlich die pauschale Zurückweisung<br />
marxistischer Gesellschaftstheorie<br />
als klassenreduktionistisch und ökonomistisch.<br />
Statt materialistische Gesellschaftstheorie als<br />
Antagonisten aufzubauen, wären vielmehr die<br />
produktiv zu nutzenden Schnittstellen zu poststrukturalistischen<br />
Diskurstheorien hervorzuheben<br />
– zum Beispiel das gemeinsame Anliegen,<br />
verdinglichte Verhältnisse – wie etwa die Verräumlichung<br />
städtischer Unsicherheit – durch<br />
Kritik als sozial hergestellte Machtbeziehungen<br />
zu verflüssigen. Damit könnte ein Beitrag<br />
zu deren gesellschaftlicher Überwindung und<br />
damit zu einer besseren Einrichtung der Welt<br />
geliefert werden.<br />
Sebastian Schipper, Frankfurt am Main