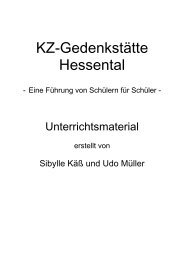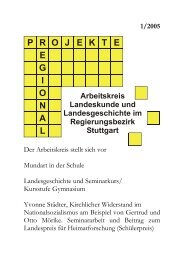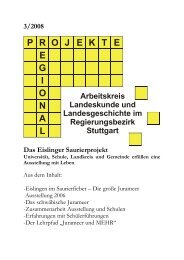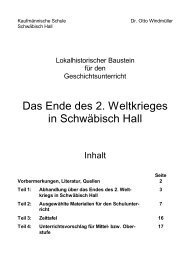Download als pdf (18000 kb) - Projekte-regional.de
Download als pdf (18000 kb) - Projekte-regional.de
Download als pdf (18000 kb) - Projekte-regional.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lebendiges Mittelalter 7/ 2012<br />
P<br />
R O J E K T E<br />
E<br />
G<br />
I<br />
O Arbeitskreis<br />
N Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> und<br />
Lan<strong>de</strong>sgeschichte im<br />
A Regierungsbezirk<br />
L<br />
Stuttgart<br />
Handlungsorientierter Projektunterricht in <strong>de</strong>n Städtischen<br />
Museen Heilbronn<br />
Das Kloster: Ort <strong>de</strong>s Wissens, Ort <strong>de</strong>r Hilfe<br />
Burg Weibertreu – eine Burg zum Erkun<strong>de</strong>n<br />
Historischer Lerngang durch Herrenberg<br />
„Versteinerte Geschichte – Grünsfeld“<br />
Markgröningen – eine Stadt im Mittelalter
Inhalt<br />
Martin Heigold, Ulrich Maier<br />
Lebendiges Mittelalter – handlungsorientierter<br />
Projektunterricht in <strong>de</strong>n Städtischen Museen Heilbronn 3<br />
Eva Maria Lienert, Wilhelm Lienert<br />
Das Kloster – Ort <strong>de</strong>s Wissens, Ort <strong>de</strong>r Hilfe 12<br />
Steffen Gassert<br />
Burg Weibertreu – eine Burg zum Erkun<strong>de</strong>n 24<br />
Wolfgang Wulz<br />
Herrenberg - von <strong>de</strong>r mittelalterlichen Grün<strong>de</strong>rstadt<br />
zur württembergischen Amtsstadt <strong>de</strong>r frühen Neuzeit 32<br />
Hubert Segeritz<br />
„Versteinerte“ Geschichte am Beispiel <strong>de</strong>r Stadt Grünsfeld 44<br />
Sandra Vöhringer<br />
Markgröningen – eine Stadt im Mittelalter 62<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragte <strong>de</strong>s Ministeriums für Kultus,<br />
Jugend und Sport Ba<strong>de</strong>n-Württemberg im<br />
Regierungsbezirk Stuttgart, Schuljahr 2011/2012 77<br />
Bisherige Ausgaben von PROJEKTE REGIONAL 79<br />
Impressum:<br />
© PROJEKTE REGIONAL, Schriftenreihe <strong>de</strong>s Arbeitskreises Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong><br />
und Lan<strong>de</strong>sgeschichte im Regierungsbezirk Stuttgart, 7/2012<br />
Redaktion, Satz und Layout: Ulrich Maier<br />
Für die Inhalte <strong>de</strong>r einzelnen Beiträge sind die jeweiligen Autoren verantwortlich.<br />
Herstellung: Fleiner Druck, Obersulm-Sülzbach 2011<br />
2
Martin Heigold<br />
Ulrich Maier<br />
Lebendiges Mittelalter -<br />
handlungsorientierter Projektunterricht in <strong>de</strong>n<br />
Städtischen Museen Heilbronn<br />
Die Archäologische Sammlung <strong>de</strong>r Städtischen Museen Heilbronn<br />
glie<strong>de</strong>rt sich in die Bereiche Steinzeit, Römerzeit und Mittelalter.<br />
Großen Wert wird auf Anschaulichkeit gelegt.<br />
Bereits im Vorraum wer<strong>de</strong>n die Besucher von lebensechten<br />
Kopfmo<strong>de</strong>llen <strong>de</strong>s Homo erectcus, Nean<strong>de</strong>rtaler und Cro-<br />
Magnon-Menschen begrüßt. Schwerpunkt <strong>de</strong>r Steinzeitausstellung<br />
ist <strong>de</strong>r „Talheimer Überfall“, die archäologische Erfassung einer<br />
kompletten jungsteinzeitlichen Dorfgesellschaft nach <strong>de</strong>n Fun<strong>de</strong>n<br />
aus einem Massengrab bei Talheim, südlich von Heilbronn.<br />
3
Kopfmo<strong>de</strong>ll eines Opfers aus <strong>de</strong>m „Talheimer Überfall“ vor 7000<br />
Jahren<br />
Was für die Betroffenen vor 7000 Jahren eine Katastrophe war,<br />
entwickelte sich für die Archäologen zur Sensation. Die Menschen,<br />
ihre Lebensweise und die tragischen Umstän<strong>de</strong> ihres To<strong>de</strong>s wer<strong>de</strong>n<br />
in dieser Abteilung unmittelbar vermittelt.<br />
Die Römerausstellung zeigt die Fun<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Region, so <strong>de</strong>n<br />
„Götterhimmel“ aus <strong>de</strong>r Römerstadt Wimpfen, Fun<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>n<br />
Römerkastellen und römischen Landhäusern.<br />
Die Mittelalterabteilung legt einen Schwerpunkt auf die Zeit <strong>de</strong>r<br />
Alamannen und Franken und die Stadtarchäologie. Damit leistet<br />
sie <strong>de</strong>n Anschluss an die Ausstellung <strong>de</strong>s Stadtarchivs zur Stadtgeschichte<br />
Heilbronns.<br />
Reichhaltig sind die museumspädagogischen Angebote, Führungen<br />
und Workshops für Schulklassen aller Altersstufen: Von Steinzeitjägern<br />
und Eiszeittieren, Steinzeit, Die Römer im Überblick, Mo<strong>de</strong>nschau<br />
antik, Römisches Essen, Römische Spiele, Römisch Ba<strong>de</strong>n und Alltagsleben<br />
im Mittelalter.<br />
4
Ein Krieger wie Aragorn aus Tolkiens Welt - Der Horkheimer<br />
Reiter<br />
Alltagsleben im Mittelalter<br />
Handlungsorientiert erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass<br />
das frühe Mittelalter durch Migration geprägt war. Eine Vielzahl<br />
von Bo<strong>de</strong>nfun<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Region machen <strong>de</strong>utlich, dass die Alamannen<br />
bereits auf <strong>de</strong>m heutigen Stadtgebiet sie<strong>de</strong>lten, die Fran-<br />
5
ken seit <strong>de</strong>m 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt eine Vielzahl von Siedlungen in <strong>de</strong>r<br />
Region anlegten und in Heilbronn einen fränkischen Königshof<br />
grün<strong>de</strong>ten, aus <strong>de</strong>m sich später die Stadt entwickelte.<br />
Gezeigt wer<strong>de</strong>n Schmuck und Waffen, die aus <strong>de</strong>n reichhaltigen<br />
Grabbeigaben stammen, aber auch Alltagsgegenstän<strong>de</strong>.<br />
Alamannischer Schmuck <strong>als</strong> Grabbeigabe<br />
Im Workshop haben die Schüler Gelegenheit, alamannische<br />
Schmuckfibeln herzustellen, sie setzen Fliesen mit mittelalterlichen<br />
Motiven zu einem Ornament zusammen, gießen eine alamannische<br />
Reiterfibel, probieren mittelalterliche Gewän<strong>de</strong>r aus o<strong>de</strong>r schreiben<br />
mit Gänsefe<strong>de</strong>rn.<br />
Das Projekt „Museumskoffer – Öffnen, Mitmachen, Begreifen“<br />
bietet vier Module zum Thema „Ein Streifzug durch die Geschichte<br />
<strong>de</strong>s Wohnens in Heilbronn.“ Die Schülerinnen und Schüler erfahren<br />
etwas über die Bauweise im Mittelalter und können sich an<br />
einer Stadtrallye beteiligen, die unter an<strong>de</strong>rem zu Resten <strong>de</strong>r spätmittelalterliche<br />
Stadtbefestigung sowie zu Brunnen und historischen<br />
Gebäu<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m Mittelalter führt.<br />
6
Mittelalterliche Mo<strong>de</strong><br />
7
Mittelalter erleben – Bericht über einen Besuch im<br />
Museum<br />
Klasse 6b <strong>de</strong>r Helene-Lange-Re<strong>als</strong>chule erkun<strong>de</strong>t die Mittelalter-Ausstellung<br />
<strong>de</strong>r Städtischen Museen Heilbronn.<br />
Nachbildung eines Eimers aus <strong>de</strong>r Alamannenzeit<br />
Nach einer Einführung durch Birgit Hummler, die eine zeitliche<br />
Einordnung <strong>de</strong>r Exponate ermöglichte, erkun<strong>de</strong>ten die Schüler die<br />
Ausstellung. Beson<strong>de</strong>rs spannend fan<strong>de</strong>n sie <strong>de</strong>n Horkheimer Rei-<br />
8
ter, <strong>de</strong>ssen Geschichte und Be<strong>de</strong>utung Birgit Hummler anhand <strong>de</strong>s<br />
ausgestellten Skeletts und ergänzen<strong>de</strong>r Informationen lebendig<br />
wer<strong>de</strong>n ließ. Auffallend sind ein prächtiger Kamm von einem langobardischen<br />
Beinschnitzer, eine Lanzenspitze und eine Trense,<br />
ein Teil <strong>de</strong>s Zaumzeugs, aus Italien. Die Fun<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n 1969 ent<strong>de</strong>ckt<br />
und belegen, dass <strong>de</strong>r Reiter En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sechsten Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
in Italien war.<br />
Eiserne Beschläge, nach <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Eimer rekonstruiert wer<strong>de</strong>n<br />
konnte.<br />
Immer wie<strong>de</strong>r konnten die Schüler Geschichte selbst erfahren,<br />
zum Beispiel beim Heben eines unerwartet schweren Wassereimers,<br />
<strong>de</strong>n ihre Altersgenossen im Mittelalter tragen mussten. Begeistert<br />
schlüpften sie in mittelalterliche Gewän<strong>de</strong>r und legten Fliesen,<br />
in<strong>de</strong>m sie die Muster passend kombinierten. Das didaktische<br />
Konzept <strong>de</strong>s Heilbronner Museums ermöglicht die Verzahnung<br />
von Theorie und Praxis: Nach<strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r Ausstellung Fibeln <strong>als</strong><br />
funktionales Schmuckstück erfahren wur<strong>de</strong>n, stellte je<strong>de</strong>r Schüler<br />
9
zum Abschluss selbst solch eine Fibel her, um sie <strong>als</strong> Erinnerung<br />
an <strong>de</strong>n Museumsbesuch mit nach Hause nehmen zu können.<br />
In <strong>de</strong>r Museumswerkstatt: Nachempfin<strong>de</strong>n einer Alamannenfibel<br />
Fliesen mit mittelalterlichen Ornamente zusammenfügen<br />
10
Literatur:<br />
Museumsführer für Kin<strong>de</strong>r<br />
Christina Jacob, Joachim Wahl, Aaka und ihre Steinzeitfamilie o<strong>de</strong>r<br />
wie Knochen erzählen können, Städtische Museen Heilbronn 2008<br />
Christina Jacob, Lucinus und sein Römisches Reich o<strong>de</strong>r weshalb<br />
Radiergummis aus Eisen sind, Städtische Museen Heilbronn 2004<br />
Zur Orientierung:<br />
Christoph Unz (Redaktion), Heilbronn und das mittlere Neckarland,<br />
Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, 22,<br />
Stuttgart 1991<br />
Lan<strong>de</strong>samt für Denkmalpflege Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Denkmaltopographie<br />
Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Stadtkreis Heilbronn, Stuttgart<br />
2007<br />
Kontakt:<br />
Städtische Museen Heilbronn/ Archäologische Sammlung<br />
Deutschhofstr. 6, 74072 Heilbronn<br />
Tel.: 07131 – 564542<br />
Fax: 07131 – 563194<br />
aktuelle Angebote unter: www.museum-heilbronn.<strong>de</strong><br />
Pädagogische Beratung: Birgit Hummler, 07131 – 56 31 54,<br />
birgit.hummler@stadt-heilbronn.<strong>de</strong><br />
Öffnungszeiten:<br />
Di – Fr 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr<br />
Sa – So 11-17 Uhr<br />
11
Eva Maria Lienert, Wilhelm Lienert<br />
Das Kloster – Ort <strong>de</strong>s Wissens, Ort <strong>de</strong>r Hilfe<br />
Klöster waren zur Zeit ihrer Gründung im Mittelalter mächtige<br />
Institutionen. In wirtschaftlichen Belangen waren sie autark: sie<br />
versorgten sich selbst mit Nahrung und Brü<strong>de</strong>r, die sich <strong>als</strong> Handwerker<br />
betätigten, o<strong>de</strong>r Laienbrü<strong>de</strong>r erledigten alle anfallen<strong>de</strong>n<br />
Arbeiten von <strong>de</strong>r Fruchtverwertung bis zur Reparatur <strong>de</strong>r<br />
Gebrauchsgegenstän<strong>de</strong>. Die Abschottung <strong>de</strong>r Klöster von <strong>de</strong>r bürgerlichen<br />
Welt durch die Klostermauern lässt <strong>de</strong>n Vergleich mit<br />
<strong>de</strong>r befestigten Burg zu.<br />
In Regel 66 bestimmt Benedikt: „Das Kloster soll … so angelegt<br />
wer<strong>de</strong>n, dass sich alles Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und<br />
Garten, innerhalb <strong>de</strong>s Klosters befin<strong>de</strong>t und die verschie<strong>de</strong>nen<br />
Arten <strong>de</strong>s Handwerks dort ausgeübt wer<strong>de</strong>n können.“<br />
Der Zugang zum Kloster war nur über die Pforte möglich, so dass<br />
jeglicher Besucher erfasst wer<strong>de</strong>n konnte und die totale Kontrolle<br />
über <strong>de</strong>n Umgang <strong>de</strong>r Mönche mit Frem<strong>de</strong>n gegeben war.<br />
Die Aufgabenverteilung innerhalb <strong>de</strong>s Klosters erlaubte vielen<br />
Mönchen ein Leben frei von <strong>de</strong>n Pflichten <strong>de</strong>s Alltags. So konnten<br />
sie sich <strong>de</strong>r Forschung und Lehre widmen, mit Kräutern experimentieren<br />
o<strong>de</strong>r Bücher kopieren. Dieses Wissen wur<strong>de</strong> zum einen<br />
in <strong>de</strong>r Klosterschule verbreitet, zum an<strong>de</strong>ren hatten die Klöster<br />
vor allem bei landwirtschaftlichen Arbeiten eine Vorbildfunktion<br />
für die umliegen<strong>de</strong>n Dörfer.<br />
Ora et labora<br />
Die im Mittelalter typische Volksfrömmigkeit und Jenseitsorientierung<br />
führten <strong>de</strong>n Klöstern viele Stiftungen und Legate zu, die ihre<br />
wirtschaftliche Grundsicherung festigten. So wur<strong>de</strong>n viele Klöster<br />
zu reichen Großgrundbesitzern, was sich wie<strong>de</strong>rum auf die geistigen<br />
Möglichkeiten auswirkte: es konnten teure Schreibutensilien<br />
angeschafft wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Mönchen blieb Muße zur Forschung.<br />
12
Klosteranlage Lorch © Staatliche Schlösser und Gärten Ba<strong>de</strong>n-<br />
Württemberg<br />
Klostergarten Lorch<br />
13
So wur<strong>de</strong>n die alltäglichen Arbeitsgeräte immer wie<strong>de</strong>r verbessert<br />
und auch durch <strong>de</strong>n Anbau neuer Pflanzen gaben die Klöster <strong>de</strong>n<br />
Bauern <strong>de</strong>r Umgebung wichtige Perspektiven.<br />
Neben <strong>de</strong>m Gebet für das Seelenheil war auch die tatkräftige Hilfe<br />
für <strong>de</strong>n Nächsten, beson<strong>de</strong>rs wenn er lei<strong>de</strong>nd war, eine elementare<br />
Pflicht für je<strong>de</strong>n Klosterbewohner.<br />
„Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen, damit<br />
man ihnen wirklich wie Christus diene“, heißt es im 36. Kapitel<br />
<strong>de</strong>r benediktinischen Regeln. Schon Karl <strong>de</strong>r Große hatte angeordnet,<br />
dass in allen Klöstern seines Reiches Kräutergärten anzulegen<br />
wären und Hil<strong>de</strong>gard von Bingen ist wegen ihrer Rezepte zur<br />
Herstellung von Medikamenten aus Kräutern bis heute bekannt.<br />
Dieses Wissen wur<strong>de</strong> schriftlich festgehalten und mit an<strong>de</strong>ren<br />
Klöstern ausgetauscht. Dazu war es nötig, diese Lehrbücher <strong>de</strong>r<br />
Heilkun<strong>de</strong> zu kopieren.<br />
Das Kloster im Unterricht<br />
Diesen Mikrokosmos gilt es, <strong>de</strong>n Schülern und Schülerinnen möglichst<br />
lebendig nahe zu bringen. Da Klöster landauf landab überall<br />
anzutreffen sind und auch häufig nach <strong>de</strong>m gleichen Bauschema<br />
angelegt wur<strong>de</strong>n, bietet sich ein Besuch in einem noch erhaltenen<br />
Kloster an. Hier lässt sich ein erster Eindruck von <strong>de</strong>r Klosteranlage<br />
gewinnen, hier fallen einzelne Gebäu<strong>de</strong> ins Auge und werfen<br />
die Frage nach ihrer einstigen Verwendung auf.<br />
Gibt es einen Grundriss vom Kloster, so kann dieser unbeschriftet<br />
ausgeteilt wer<strong>de</strong>n und die Schüler tragen die Gebäu<strong>de</strong>namen ein.<br />
Dies kann durch Mutmaßungen geschehen o<strong>de</strong>r während einer<br />
Klosterführung. Bei Gymnasialklassen können auch die lateinischen<br />
Begriffe eingetragen wer<strong>de</strong>n (Dormitorium, Refektorium,<br />
Skriptorium) und die Schüler und Schülerinnen versuchen sich mit<br />
Übersetzungen.<br />
Sind die Kin<strong>de</strong>r über die Gebäu<strong>de</strong> im Kloster und <strong>de</strong>ren Zweck<br />
informiert, wobei zwangsläufig in das Leben <strong>de</strong>r Mönche eingeführt<br />
wird, können sie mit Hilfe <strong>de</strong>s Dominos das Erfahrene wie-<br />
14
Bru<strong>de</strong>r Ulrich ist zum Morgengebet zu spät gekommen, weil er im Spital<br />
durch einen Schwerkranken aufgehalten wor<strong>de</strong>n ist. Im Kloster legt man<br />
großen Wert auf Pünktlichkeit.<br />
Grüß Gott, lieber Reisen<strong>de</strong>r<br />
---------------------------------<br />
tritt ein durch die Klosterpforte.<br />
Wir haben uns zwar durch eine<br />
Ringmauer und die Zugbrücke<br />
vor <strong>de</strong>r Außenwelt abgeschirmt,<br />
aber Reisen<strong>de</strong> wie du<br />
und Pilger sind bei uns je<strong>de</strong>rzeit<br />
willkommen, <strong>de</strong>nn nach <strong>de</strong>n Regeln<br />
unseres Or<strong>de</strong>nsgrün<strong>de</strong>rs<br />
Benedikt sollen alle Frem<strong>de</strong>n wie<br />
Christus aufgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
----------------------------------<br />
Wir selbst verlassen das Kloster<br />
nur selten,<br />
15<br />
Kloster Zwiefalten
<strong>de</strong>rholen. Mit <strong>de</strong>r ersten Karte, welche <strong>de</strong>r Lehrer verliest, wer<strong>de</strong>n<br />
die Schüler und Schülerinnen <strong>als</strong> Gäste <strong>de</strong>s Klosters begrüßt und<br />
mit einem ersten Halbsatz weitergeleitet. Nun muss <strong>de</strong>r erste Schüler<br />
das richtige Kärtchen fin<strong>de</strong>n, mit <strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n Satz vervollständigen<br />
kann und gibt <strong>de</strong>n nächsten Satzanfang vor.<br />
So geht es reihum, bis alle Domino-Kärtchen aufgebraucht sind<br />
und <strong>de</strong>r „Rundgang“ durch das Kloster abgeschlossen ist.<br />
Der Kräutergarten<br />
Zentraler Punkt eines Benediktinerklosters ist sein Kräutergarten.<br />
Auch heute wird dieser in vielen Klöstern wie<strong>de</strong>r liebevoll gepflegt<br />
und hergerichtet. Er bietet einen guten Zugang zu zwei Themenbereichen:<br />
die Krankenpflege und damit verbun<strong>de</strong>n die Heilkunst<br />
<strong>de</strong>r Mönche sowie die Wissensweitergabe durch Bücher und Abbildungen.<br />
Zunächst können die Kräuter und ihre Heilwirkung<br />
einen Blick in das mittelalterliche Leben geben. Da sind typische<br />
Beschwer<strong>de</strong>n wie Blähungen o<strong>de</strong>r Ekzeme, Husten o<strong>de</strong>r Glie<strong>de</strong>rschmerzen,<br />
wegen welcher die Kranken o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ren Familienangehörige<br />
im Kloster Rat und Hilfe suchen. Für die Schüler und Schülerinnen<br />
wur<strong>de</strong> hier ein personifizieren<strong>de</strong>r Ansatz geschaffen, <strong>de</strong>r<br />
sie in die Rolle eines mittelalterlichen Ratsuchen<strong>de</strong>n versetzt. Dazu<br />
wur<strong>de</strong>n Karten vorbereitet, die sowohl eine gezeichnete Abbildung<br />
<strong>de</strong>r Pflanze enthalten sowie auch <strong>de</strong>ren heilen<strong>de</strong> Wirkung erläutern.<br />
Mit Hilfe dieser Karten gilt es nun, das für die Krankheit<br />
geeignete Kraut zu ermitteln und wenn möglich anschließend im<br />
Kräutergarten selbst zu fin<strong>de</strong>n.<br />
Wenn sich hier eine Diskussion anschließt, welche die Naturmedizin<br />
<strong>de</strong>n pharmazeutischen Produkten gegenüberstellt, sollten aber<br />
auch die beschränkten Möglichkeiten <strong>de</strong>r damaligen Zeit (Operationen,<br />
Röntgen, …) thematisiert wer<strong>de</strong>n. Tabellen zur Lebenserwartung<br />
und Kin<strong>de</strong>rsterblichkeit sind im Internet zu fin<strong>de</strong>n.<br />
16
Kräutergarten Lorch<br />
Kräutergarten Blaubeuren<br />
17
Der Rosmarin<br />
wird zur<br />
Behandlung von<br />
niedrigem<br />
Blutdruck<br />
eingesetzt – er<br />
stärkt dabei Herz<br />
und Kreislauf.<br />
Der Name<br />
Rosmarin ist<br />
lateinisch und<br />
be<strong>de</strong>utet „Tau <strong>de</strong>s<br />
Meeres“.<br />
In mittelalterlichen<br />
Kräuterbüchern spielt er eine wichtige<br />
Rolle. Er wird gegen allerlei Beschwer<strong>de</strong>n<br />
empfohlen. In Ziegenmilch gekocht, soll<br />
<strong>de</strong>r Rosmarin gegen Tuberkulose helfen<br />
und äußerlich wird die Milch gegen<br />
Hautkrebs verwen<strong>de</strong>t.<br />
Du bist Rosina Pfeffer, Bäuerin aus Alfdorf. Dein ältester Sohn<br />
(12 Jahre) hat seit drei Tagen Fieber und von Tag zu Tag steigt es.<br />
Du hast schon viel probiert und weißt nicht, was du noch tun<br />
könntest, damit das Fieber sinkt. Der Junge glüht förmlich und du<br />
machst dir große Sorgen.<br />
18
Der Salbei<br />
wird einerseits <strong>als</strong><br />
Küchengewürz<br />
und an<strong>de</strong>rerseits<br />
auch in <strong>de</strong>r<br />
Heilkun<strong>de</strong> verwen<strong>de</strong>t.<br />
Die Ärzte und<br />
Heilkundigen<br />
verwen<strong>de</strong>n ihn<br />
bei akutem<br />
Fieber, Harnwegslei<strong>de</strong>n,<br />
Koliken,<br />
Erkältungen und<br />
Zahnschmerzen.<br />
Dem Salbei sagt<br />
man eine<br />
<strong>de</strong>sinfizieren<strong>de</strong><br />
und<br />
konservieren<strong>de</strong><br />
Wirkung nach.<br />
So haben sich<br />
Spülungen mit<br />
Salbeitee bei Entzündungen im Mund- und Rachenbereich (<strong>als</strong>o bei<br />
H<strong>als</strong>schmerzen) bewährt. Salbeitee soll auch bei Magen- und Darmschmerzen<br />
eine Lin<strong>de</strong>rung bewirken.<br />
Zimmer, in <strong>de</strong>nen sich Schwerkranke aufhalten, wer<strong>de</strong>n dadurch gereinigt,<br />
dass man Salbeiblätter auf Kohle verbrennt.<br />
Der lateinische Name „Salvia“ kommt von „salvare“, was soviel wie<br />
‚heilen’ be<strong>de</strong>utet.<br />
19
Das Skriptorium<br />
Neben <strong>de</strong>r direkten Verwendung <strong>de</strong>r Kräuter ist die Verbreitung<br />
<strong>de</strong>s Wissens interessant. Wenn vorhan<strong>de</strong>n, kann nun das Skriptorium<br />
besucht wer<strong>de</strong>n. Der Film „Der Name <strong>de</strong>r Rose“ vermittelt<br />
eindrucksvoll die Stimmung und Arbeit in solch einem beson<strong>de</strong>ren<br />
Raum.<br />
Für die Schüler und Schülerinnen ist es sicher interessant zu erfahren,<br />
wie wertvoll solch ein Buch war, wie viel Zeit man brauchte,<br />
ein Buch zu kopieren, woraus Tinte und Farben gemacht wur<strong>de</strong>n<br />
und dass schon zu dieser frühen Zeit die Bücher arbeitsteilig hergestellt<br />
wur<strong>de</strong>n. Spezialisten illustrierten die Seiten, legten Gold<br />
auf, trugen Noten für Liedtexte ein. Das Kloster Lorch verfügt mit<br />
seinen Chorbüchern über beson<strong>de</strong>rs eindrucksvolle Beispiele mittelalterlicher<br />
Buchgestaltung.<br />
Die Schüler und Schülerinnen sind in <strong>de</strong>r Regel von <strong>de</strong>r Größe <strong>de</strong>r<br />
Chorbücher überrascht. Diese lässt sich leicht an einem konkreten<br />
Beispiel begrün<strong>de</strong>n. Abt Sitterich hatte 1511 die Chorbücher anfertigen<br />
lassen und gleichzeitig festgelegt, welche Liedtexte <strong>de</strong>r Messlie<strong>de</strong>r<br />
sie enthalten sollten. Sie dienten <strong>als</strong>o <strong>de</strong>m täglichen<br />
Gebrauch während <strong>de</strong>r heiligen Messe. Damit nun mehrere Mönche<br />
gleichzeitig aus <strong>de</strong>m Buch lesen konnten, musste es eine bestimmte<br />
Größe haben.<br />
Die Or<strong>de</strong>nsregeln<br />
Damit <strong>de</strong>n Mönchen Zeit und Muße für die Gestaltung <strong>de</strong>r Bücher,<br />
aber auch für das Experimentieren mit Kräutern blieb, mussten<br />
die Aufgaben im Kloster gut verteilt und genau geregelt sein.<br />
Die benediktinischen Or<strong>de</strong>nsregeln sind verlässlich überliefert und<br />
können <strong>de</strong>n Schülern und Schülerinnen bei einem Klosterbesuch<br />
vermittelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Das gesamte Leben im Kloster steht unter <strong>de</strong>m Motto „ora et labora“<br />
– <strong>als</strong>o „bete und arbeite“. Das Gebet wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Klosterkirche<br />
verrichtet, die logischer Weise im Zentrum <strong>de</strong>r Anlage steht.<br />
Wie oft sich die Mönche dort zum Gebet trafen, lässt sich an <strong>de</strong>n<br />
Stun<strong>de</strong>ngebeten zeigen, von <strong>de</strong>n Vigilien bis zum Komplet. Hier<br />
ist auch die Rolle <strong>de</strong>s Abtes zu thematisieren, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m<br />
20
Lorcher Chorbuch © Staatliche Schlösser und Gärten Ba<strong>de</strong>n-<br />
Württemberg<br />
21
Kloster vorsteht, es verwaltet und „Vorgesetzter“ <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>r ist.<br />
Ihm sind alle Gehorsam schuldig, er achtet auf die Einhaltung <strong>de</strong>r<br />
Or<strong>de</strong>nsregeln Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und <strong>de</strong>r Abt hat<br />
auch die Strafen für ein Fehlverhalten zu verhängen – trotz aller<br />
Vergebung und christlicher Nächstenliebe.<br />
An einigen ausgewählten Beispielen sollen Situationen, wie sie im<br />
Kloster alltäglich vorkommen können, geschil<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Für die<br />
Schüler und Schülerinnen gilt es, mögliche Regelverstöße zu erkennen<br />
und in einem zweiten Schritt auch <strong>de</strong>ren Ahndung festzusetzen.<br />
Dies lässt sich <strong>als</strong> Simulationsspiel im Kapitelsaal ortsgetreu<br />
nachspielen, wenn einer die Rolle <strong>de</strong>s Abtes übernimmt und<br />
anhand <strong>de</strong>r Regeln <strong>de</strong>s Hl. Benedikt über das Fehlverhalten richtet.<br />
Hier offenbaren sich auch die Überschneidungen, z. B. zwischen<br />
Gehorsam und Dienst am Nächsten: ist die Teilnahme am Gebet<br />
wichtiger <strong>als</strong> die Versorgung eines Kranken? Steht die Forschung<br />
im Dienste <strong>de</strong>r Wissenschaft über <strong>de</strong>m Gehorsam gegenüber <strong>de</strong>m<br />
Abt? Da dies vor allem für jüngere Schüler eine schwierige Aufgabe<br />
ist, bietet es sich an, diese Entscheidungen in Gruppen treffen<br />
zu lassen.<br />
DIE REGEL DES HEILIGEN BENEDIKT:<br />
Kapitel 36: Die kranken Brü<strong>de</strong>r<br />
1. Die Sorge für die Kranken muss vor und<br />
über allem stehen: man soll ihnen so<br />
dienen, <strong>als</strong> wären sie wirklich Christus;<br />
2. hat er doch gesagt: "Ich war krank, und<br />
ihr habt mich besucht",<br />
3. und: "Was ihr einem dieser Geringsten<br />
getan habt, das habt ihr mir getan." …<br />
7. Die kranken Brü<strong>de</strong>r sollen einen eigenen<br />
Raum haben und einen eigenen Pfleger,<br />
<strong>de</strong>r Gott fürchtet und ihnen sorgfältig<br />
und eifrig dient.<br />
22
Kloster Lorch, historische Ansicht ©Staatliche Schlösser und Gärten<br />
Ba<strong>de</strong>n-Württemberg<br />
Auf <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong>sbildungsserver www.lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>-bw.<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t<br />
sich von <strong>de</strong>nselben Autoren ein Unterrichtsmodul zum Kloster<br />
Lorch, welches die vier hier vorgestellten Zugangswege ausführlich<br />
erläutert und das komplette Material enthält.<br />
Dieses Modul ist so angelegt, dass das gesamte Thema „Das mittelalterliche<br />
Kloster“ beim Unterrichtsbesuch in <strong>de</strong>r Klosteranlage<br />
aufgearbeitet wer<strong>de</strong>n kann und eine Nacharbeit in <strong>de</strong>r Schule nicht<br />
mehr nötig ist.<br />
23
Steffen Gassert<br />
Burg Weibertreu – eine Burg zum Erkun<strong>de</strong>n<br />
Was fällt Euch zum Wort „Mittelalter“ ein? Stellt man diese Frage<br />
einer Schulklasse, wird sicher neben „Ritter“ o<strong>de</strong>r „Kreuzzüge"<br />
auch <strong>de</strong>r Begriff „Burg“ genannt. Zweifellos sind Burgen ein fester<br />
Bestandteil unserer Vorstellung vom Mittelalter. Die Burg ist zusammen<br />
mit <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt und <strong>de</strong>m Kloster einer <strong>de</strong>r<br />
Schauplätze, an <strong>de</strong>nen das Leben mittelalterlicher Menschen erfahrbar<br />
wird. Anhand einer Burg kann einer Klasse gezeigt wer<strong>de</strong>n,<br />
unter welchen Bedingungen viele Menschen <strong>de</strong>s Mittelalters lebten<br />
und welche Lösungswege sie für die Probleme ihrer Zeit wählten.<br />
Denn auch heute noch sind die Reste dicker Mauern und die<br />
wehrhaften Türme einer Burg ein Zeichen für <strong>de</strong>n mangeln<strong>de</strong>n<br />
Rechtsfrie<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Zeit und geben einer Schulkasse <strong>de</strong>utliche Hinweise<br />
auf das Ausmaß <strong>de</strong>r Gewaltausübung im Mittelalter.<br />
Ein bekanntes <strong>regional</strong>es Beispiel einer Höhenburg, an <strong>de</strong>r sich<br />
auch diese Aspekte mittelalterlicher Lebensbedingungen exemplarisch<br />
aufzeigen lassen, ist die Burg Weibertreu bei Weinsberg. Im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Bildungspläne für die Re<strong>als</strong>chule und das Gymnasium<br />
bietet sich insbeson<strong>de</strong>re ein Besuch mit einer 7. Klasse an. Die<br />
folgen<strong>de</strong>n Anregungen sind jedoch auch für die Hauptschule gedacht.<br />
Bereits die sagenumwobene Namensgebung <strong>de</strong>r Burg ist für Schüler<br />
in diesem Alter ein spannen<strong>de</strong>r Ausgangspunkt.<br />
Die Sage von <strong>de</strong>n treuen Weibern<br />
Weit über die Grenzen <strong>de</strong>r Region wur<strong>de</strong> die Burg Weibertreu<br />
durch die Ereignisse bekannt, die sich im Winter 1140 zugetragen<br />
haben sollen. Die im Besitz <strong>de</strong>r Welfen befindliche Burg musste<br />
nach mehrwöchiger Belagerung durch <strong>de</strong>n Stauferkönig Konrad<br />
III. kapitulieren. Den Frauen <strong>de</strong>r Burgbesatzung wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sage<br />
nach von Konrad die Freiheit und die Mitnahme ihrer Habseligkeiten,<br />
die sie selbst auf <strong>de</strong>n Schultern tragen konnten, gewährt. Die<br />
„treuen Weiber“ trugen statt ihres Besitzes ihre Männer auf <strong>de</strong>n<br />
Schultern und retteten sie so vor <strong>de</strong>r Hinrichtung – Konrad III.<br />
24
Hier wer<strong>de</strong>n die Grundrisse ergänzt.<br />
Die Inschriften aus <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt können entziffert wer<strong>de</strong>n.<br />
25
durfte sein königliches Versprechen nicht brechen und <strong>de</strong>monstrierte<br />
royale Großzügigkeit.<br />
Wie anstrengend es für die Frauen gewesen sein musste, ihre Männer<br />
in die Freiheit zu tragen, wird für eine Klasse bereits durch <strong>de</strong>n<br />
steilen und engen Weg zur Burg erlebbar. Doch nicht nur <strong>de</strong>shalb<br />
lohnt sich ein Besuch <strong>de</strong>r Burg Weibertreu. Hier kann ein Lernort<br />
entwe<strong>de</strong>r selbstständig erkun<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r nach vorheriger Anmeldung<br />
über eine Führung kennen gelernt wer<strong>de</strong>n.<br />
Erkundung <strong>de</strong>r Burganlage<br />
Nach <strong>de</strong>m Aufstieg zur Burg lädt <strong>de</strong>r großzügige Raum zwischen<br />
Gebäu<strong>de</strong>- und Mauerresten sowie <strong>de</strong>n immer noch eindrucksvollen<br />
Türmen zum Ent<strong>de</strong>cken ein. Die Erkundung kann nun – je<br />
nach Lerngruppe – über verschie<strong>de</strong>ne Möglichkeiten erfolgen.<br />
Dabei bietet es sich an, <strong>de</strong>r Klasse eine einfache Skizze <strong>de</strong>s Grundrisses<br />
<strong>de</strong>r Burgruine zu geben, die von <strong>de</strong>n Schülerinnen und Schülern<br />
ergänzt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Dann könnte eine weitgehend selbstständige Erkundung <strong>de</strong>r Burganlage,<br />
beispielsweise über eine „Ruinenralley“, in kleinen Gruppen<br />
stattfin<strong>de</strong>n. Je<strong>de</strong> Gruppe erhält unterschiedlich gestaltete Erkundungsaufträge,<br />
so dass die einzelnen Schülergruppen unabhängig<br />
voneinan<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r recht weitläufigen Anlage die verschie<strong>de</strong>nen<br />
Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Burg suchen und wesentliche Informationen zusammentragen<br />
können. Kleine Beschreibungen und Schautafeln an<br />
<strong>de</strong>n jeweiligen Bauwerken o<strong>de</strong>r ihren Überresten geben Auskunft<br />
über ihre Entstehungszeit, ihre Entwicklungsgeschichte und ihre<br />
Funktion.<br />
Die erhaltenen Informationen könnten dann von je<strong>de</strong>r Gruppe an<br />
„ihrem“ Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Klasse in einer kurzen Zusammenfassung<br />
vorgetragen wer<strong>de</strong>n. Über <strong>de</strong>n damit erfolgten gemeinsamen<br />
Rundgang erfasst die Lerngruppe <strong>de</strong>n Aufbau <strong>de</strong>r Burg und <strong>de</strong>n<br />
funktionalen Zusammenhang <strong>de</strong>r einzelnen Gebäu<strong>de</strong>.<br />
26
Schautafeln zeigen die Entwicklungsgeschichte <strong>de</strong>r Burg.<br />
Der Turm wur<strong>de</strong> gera<strong>de</strong> von dieser Gruppe vorgestellt.<br />
27
Mögliche Aufgabe <strong>als</strong> Beispiel einer arbeitsteiligen Gruppenaufgabe:<br />
Sucht folgen<strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong> und tragt es in euren Grundrissplan ein: Äolsharfenturm.<br />
Fasst die Informationen zur Entstehung <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s, zu seinem<br />
Zweck und zu seiner Geschichte zusammen, so dass ihr das Bauwerk vorstellen<br />
könnt.<br />
Um die relative Enge <strong>de</strong>r einstigen Bebauung nachzuempfin<strong>de</strong>n,<br />
die das Leben auf einer Burg auch geprägt hat, könnten sich mit<br />
Hilfe <strong>de</strong>r vervollständigten Grundrisse die Schülerinnen und Schüler<br />
im Innenbereich <strong>de</strong>r Anlage an die Stellen <strong>de</strong>r nicht mehr vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Gebäu<strong>de</strong> aufstellen. Die Klasse wird auf diese Weise<br />
besser erkennen können, dass <strong>de</strong>r heutige Eindruck eines großzügigen<br />
und freien Platzes ein f<strong>als</strong>ches Bild über die wirklichen Lebensbedingungen<br />
auf einer Burg im Mittelalter liefert.<br />
Als weitere Möglichkeit, die insbeson<strong>de</strong>re in Betracht kommen<br />
kann, wenn im Unterricht bereits eine i<strong>de</strong>altypische Burg besprochen<br />
wor<strong>de</strong>n ist, wäre folgen<strong>de</strong> Aufgabenstellung <strong>de</strong>n<strong>kb</strong>ar:<br />
Mögliche Aufgabe:<br />
Suche typische Gebäu<strong>de</strong> einer Burg, die du im Unterricht kennen gelernt hast,<br />
und trage sie in <strong>de</strong>inen Grundrissplan ein. Notiere dabei auch die Entstehungszeit<br />
<strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>. Überlege dir, warum einige Gebäu<strong>de</strong> noch vorhan<strong>de</strong>n,<br />
an<strong>de</strong>re hingegen fast völlig verschwun<strong>de</strong>n sind.<br />
Die Klasse wird einige Bauwerke, z.B. die immer noch eindrucksvollen<br />
Reste <strong>de</strong>s Bergfrieds, einige Türme, Mauern o<strong>de</strong>r eine Zisterne<br />
ent<strong>de</strong>cken können. An<strong>de</strong>re Gebäu<strong>de</strong> sind hingegen weitgehend<br />
o<strong>de</strong>r völlig verschwun<strong>de</strong>n, beispielsweise <strong>de</strong>r Palas und die<br />
daran angeschlossenen Wirtschaftsgebäu<strong>de</strong>. Aber auch die fehlen<strong>de</strong>n<br />
Gebäu<strong>de</strong> können über die auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> verteilten Schautafeln<br />
lokalisiert wer<strong>de</strong>n. Die Lerngruppe kann erkennen, dass die<br />
massiv gebauten militärischen Anlagen eher erhalten geblieben<br />
sind, <strong>als</strong> die Fachwerk- und Holzbauten von Wohngebäu<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r<br />
Ställen.<br />
28
Abb.5: Schnell noch das fehlen<strong>de</strong> Bauwerk in <strong>de</strong>n Grundriss einzeichnen.<br />
Abb.6: Das Ausstellungsmo<strong>de</strong>ll zeigt die gesamte Burganlage.<br />
29
Die Aufgabenstellung ermöglicht es auch, die lange und komplexe<br />
Bauentwicklung zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler erkennen,<br />
dass eine solche Burg eigentlich niem<strong>als</strong> „fertig“ war und<br />
die Burg Weibertreu vom En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts bis ins 17.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein immer wie<strong>de</strong>r verän<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. Warum kam es<br />
zu diesen meist sehr aufwändigen und teuren Um- und Neubauten?<br />
Die Lerngruppe sieht die Versuche <strong>de</strong>r jeweiligen Burgherren,<br />
die Burg <strong>de</strong>n Bedürfnissen und Verän<strong>de</strong>rungen ihrer Zeit anzupassen.<br />
So zeigt <strong>de</strong>r <strong>als</strong> Äolsharfenturm bezeichnete Batterieturm, wie<br />
versucht wur<strong>de</strong>, die Burg <strong>als</strong> Verteidigungsanlage <strong>de</strong>r großen militärtechnischen<br />
Revolution, <strong>de</strong>m Aufkommen <strong>de</strong>s Schießpulvers,<br />
anzupassen.<br />
Abschließend kann mit <strong>de</strong>r Klasse <strong>de</strong>r kleine Ausstellungsraum in<br />
<strong>de</strong>r ehemaligen Burgkapelle besucht wer<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m die Entwicklung<br />
<strong>de</strong>r Burg graphisch dargestellt und ihr Aussehen über ein<br />
Mo<strong>de</strong>ll veranschaulicht wird. Die Schülerinnen und Schüler können<br />
hier ihre ergänzten Grundrisse mit <strong>de</strong>m Ausstellungsmo<strong>de</strong>ll<br />
vergleichen. Somit entsteht für die Klasse ein einprägsames räumliches<br />
Gesamtbild <strong>de</strong>r Burganlage.<br />
Ergänzen<strong>de</strong> und fächerverbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Alternativen<br />
Abhängig vom Unterrichtszusammenhang und <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
Klassenstufe erlaubt die Burg Weibertreu nicht nur Einblicke in<br />
die Lebensumstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Menschen <strong>de</strong>s Mittelalters. Über die Geschehnisse<br />
während <strong>de</strong>s Bauernkriegs 1525 bis hin zu <strong>de</strong>n Restaurationsversuchen<br />
<strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erlaubt die Burg ereignisund<br />
kulturgeschichtliche Bezüge für alle Schularten und Klassenstufen.<br />
Sie ermöglicht – beispielsweise im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m<br />
Deutschunterricht – die anschauliche Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>r<br />
Literaturepoche <strong>de</strong>r Romantik. Auf <strong>de</strong>n Spuren Justinus Kerners<br />
wer<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Burg das Mittelalteri<strong>de</strong>al und <strong>de</strong>r Mystizismus <strong>de</strong>r<br />
Romantik und die daraus resultieren<strong>de</strong>n ersten Restaurationsansätze<br />
<strong>de</strong>r zum Steinbruch verkommenen Ruine erfahrbar.<br />
30
Abb.7: Der Blick auf Weinsberg ist ebenfalls beeindruckend.<br />
Allgemeine Hinweise<br />
Öffnungszeiten:<br />
Täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr<br />
Eintrittspreise: Erwachsene: 1,50 € (ab 20 Personen 1,00 €)<br />
Kin<strong>de</strong>r (bis 13 Jahre): 0,50 €<br />
Schülergruppen: 0,80 €<br />
Burgführung (ca. 1 Stun<strong>de</strong>): 22,00 € (Führung<br />
im historischen Gewand: Aufpreis<br />
5,00 €)<br />
Schülergruppen aus Weinsberg haben freien Eintritt!<br />
Kontakt: Tel. 07134/6834<br />
www.weinsberg.<strong>de</strong><br />
www. kernerverein.weinsberg.<strong>de</strong><br />
Mail: stadt@weinsberg.<strong>de</strong><br />
31
Wolfgang Wulz<br />
Herrenberg - von <strong>de</strong>r mittelalterlichen Grün<strong>de</strong>rstadt<br />
zur württembergischen Amtsstadt <strong>de</strong>r frühen Neuzeit<br />
Die Stiftskirche von Herrenberg<br />
Be<strong>de</strong>utung<br />
Die Stadt Herrenberg ist eine Gründung <strong>de</strong>r Pfalzgrafen von Tübingen,<br />
die sich zu Beginn <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts mit einer Anzahl<br />
weiterer Siedlungen und befestigter Sitze wie Asperg, Böblingen,<br />
Sin<strong>de</strong>lfingen, Horb, Scheer und Blaubeuren ihr Territorium im<br />
mittleren Neckarraum sicherten.<br />
Ihren beson<strong>de</strong>ren Wert <strong>als</strong> historischer Lernort bezieht Herrenberg<br />
aus <strong>de</strong>m seit <strong>de</strong>r Stadtgründung unverän<strong>de</strong>rt gebliebenen<br />
Grundriss. Wegen zweier verheeren<strong>de</strong>r Stadtbrän<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Jahren<br />
1466 und 1635 blieben aus <strong>de</strong>r spätmittelalterlichen Zeit lei<strong>de</strong>r nur<br />
die am Fuß <strong>de</strong>s Schlossbergs <strong>als</strong> "Glucke vom Gäu" weithin sichtbare<br />
Stiftskirche St. Marien (Unserer Lieben Frau), das große<br />
Propsteigebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Stiftes (heute: evang Dekanat) und die zur<br />
32
Schlossruine hinaufführen<strong>de</strong>n, schenkelartigen Burghal<strong>de</strong>nmauern<br />
mit <strong>de</strong>m Hagtorturm erhalten.<br />
Doch durch <strong>de</strong>n seit <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt erfolgen<strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau<br />
<strong>de</strong>r Stadt mit <strong>de</strong>m von repräsentativen Fachwerkhäusern geprägten<br />
Marktplatz, <strong>de</strong>m Marktbrunnen, <strong>de</strong>n markanten Bauwerken<br />
wie <strong>de</strong>m Vogtei- und Oberamtsgebäu<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r Spitalkirche, <strong>de</strong>m<br />
Bebenhäuser Klosterhof, <strong>de</strong>m Fruchtkasten und <strong>de</strong>n weiteren<br />
Fachwer<strong>kb</strong>auten in <strong>de</strong>n Gassen wird die heutige Altstadt zu einem<br />
eindrucksvollen und anschaulichen Beispiel einer frühneuzeitlichen,<br />
württembergischen Amtsstadt. Nicht zuletzt <strong>de</strong>swegen wur<strong>de</strong><br />
die Altstadt 1983 <strong>als</strong> Gesamtanlage unter Denkm<strong>als</strong>chutz gestellt.<br />
Geschichte<br />
Am Fuße ihrer 1228 erstm<strong>als</strong> urkundlich genannten Burg Herrenberg<br />
legten Pfalzgraf Rudolf II. von Tübingen und seine Nachfahren<br />
in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts eine städtische Ansiedlung<br />
an, in<strong>de</strong>m sie die bei<strong>de</strong>n Dorfmarkungen Mühlhausen<br />
und Reistingen zusammenlegten. Bei<strong>de</strong> Orte wur<strong>de</strong>n schon 775<br />
genannt und haben römische Spuren, Reistingen auch Siedlungsspuren<br />
aus <strong>de</strong>r Hallstattzeit.<br />
Ab 1266 erscheint in Urkun<strong>de</strong>n ein "Dietrich, Schultheiß in Herrenberg",<br />
1276 ist Herrenberg <strong>als</strong> "oppidum" (Stadt) mit einem<br />
Markt erwähnt und 1278 wird das erste Herrenberger Siegel verwen<strong>de</strong>t.<br />
Die Stadt war nun Sitz und Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r "die Scherer"<br />
genannten Herrenberger Linie <strong>de</strong>r Tübinger Pfalzgrafen. Als <strong>de</strong>r<br />
letzte Graf Konrad II. (<strong>de</strong>r Scherer) Herrenberg im Jahr 1382 an<br />
<strong>de</strong>n Grafen Eberhard II. (<strong>de</strong>r Greiner) von Württemberg verkaufte,<br />
wur<strong>de</strong> es <strong>als</strong> württembergische Amtsstadt Verwaltungszentrale<br />
für die Dörfer <strong>de</strong>r Umgebung.<br />
Zeuge dieser ersten Epoche <strong>de</strong>r Stadtgeschichte ist außer <strong>de</strong>r noch<br />
teilweise erhaltenen Stadtbefestigung vor allem die Marienkirche<br />
(Stiftskirche), <strong>de</strong>r erste dreischiffige Hallenbau in Schwaben. Das<br />
Westwerk wur<strong>de</strong> um 1280 begonnen, das Langhaus Anfang <strong>de</strong>s 14.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts vollen<strong>de</strong>t. Nach<strong>de</strong>m die Grafen von Württemberg<br />
1439 ein Chorherrnstift an <strong>de</strong>r Stadtkirche angelegt hatten, in <strong>de</strong>m<br />
33
von 1481 bis1516 die Brü<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s gemeinsamen Lebens wirkten,<br />
wur<strong>de</strong>n Langhaus und Chor (von 1356) durch Hans Murer von<br />
Ulm ca. 1470-1490 zu <strong>de</strong>r heutigen spätgotischen Hallenkirche mit<br />
Netzgewölben umgebaut. Die Ausstattung <strong>de</strong>s Kircheninnern gipfelt<br />
in <strong>de</strong>m "großartigen Bildchoral" von Chorgestühl (1517, Heinrich<br />
Schickhardt d. Ä.) und Hochaltar (1519, Jörg Ratgeb).<br />
Die kulturelle Blüte <strong>de</strong>s mittelalterlichen Herrenberg leuchtet auf<br />
in <strong>de</strong>n Namen von<br />
• Heinrich Schickhardt (1558-1635), be<strong>de</strong>utendster württembergischer<br />
Baumeister,<br />
• Wilhelm Schickhardt (1592-1635), Orientalist, Mathematiker,<br />
Astronom und Kartograph in Tübingen, Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Rechenmaschine,<br />
• Johann Valentin Andreae (1586-1654), Theologe, Autor<br />
und Reorganisator <strong>de</strong>r evangelischen Lan<strong>de</strong>skirche in<br />
Württemberg.<br />
Nach<strong>de</strong>m Herrenberg 1466 von einem Brand heimgesucht und<br />
auch im Bauernkrieg (1525) umkämpft wur<strong>de</strong>, brachte <strong>de</strong>r 30-<br />
jährige Krieg das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt. Dem großen<br />
Stadtbrand von 1635 fielen fast alle Gebäu<strong>de</strong> zum Opfer. Auch<br />
durch Pest und Seuchen vermin<strong>de</strong>rte sich die Einwohnerzahl auf<br />
ca. 40 % ihres Vorkriegsstan<strong>de</strong>s.<br />
Durch <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau nach 1635 konnte sich Herrenberg seine<br />
Zentralfunktion bewahren. So stammt <strong>de</strong>r Kern <strong>de</strong>r heutigen Altstadt<br />
aus dieser Zeit mit <strong>de</strong>n Fachwerkhäusern am Marktplatz, <strong>de</strong>r<br />
Spitalkirche (1656) und <strong>de</strong>m Fruchtkasten von 1684.<br />
Herrenberg, ab 1806 Oberamtsstadt, blieb mit seinen Jahrmärkten<br />
und einem starken Handwerk seither wirtschaftlicher Mittelpunkt<br />
<strong>de</strong>s landwirtschaftlich orientierten Oberen Gäus. Die Industrialisierung<br />
begann trotz <strong>de</strong>s 1879 vollzogenen Anschlusses an die<br />
Gäubahn erst 1899 und setzte in stärkerem Maße nach <strong>de</strong>m Zweiten<br />
Weltkrieg ein.<br />
34
Einen Einschnitt brachte 1938 die Aufhebung <strong>de</strong>s Oberamts<br />
(Landkreises), wodurch Herrenberg zum Landkreis Böblingen<br />
kam, und <strong>de</strong>r Zweite Weltkrieg, <strong>de</strong>m ca. 30 Gebäu<strong>de</strong> zum Opfer<br />
fielen. Nach 1945 wuchs die Stadt wie viele an<strong>de</strong>re beson<strong>de</strong>rs<br />
durch <strong>de</strong>n starken Zuzug von Heimatvertriebenen und die neu<br />
angesie<strong>de</strong>lte Industrie. Zwischen 1965 wur<strong>de</strong>n die umliegen<strong>de</strong>n<br />
Dörfer Affstätt, Gültstein, Kayh, Kuppingen, Mönchberg und<br />
Oberjesingen eingemein<strong>de</strong>t. Seit 1974 ist Herrenberg Große Kreisstadt.<br />
Anlage<br />
Die Herrenberger Altstadt liegt bogenförmig am Abhang <strong>de</strong>s<br />
Schlossberges, <strong>de</strong>r sich spornartig in die Gäulandschaft vorschiebt.<br />
Die Umgrenzung <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt lässt sich im heutigen<br />
Stadtbild an <strong>de</strong>n Resten <strong>de</strong>r ehemaligen Wehrmauer noch gut ablesen.<br />
Anschaulich dokumentieren die in ihrer Anlage ins 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
zurückgehen<strong>de</strong>n Schenkelmauern die Verklammerung von<br />
Schloss und Stadt.<br />
Im halbmondförmigen Grundriss <strong>de</strong>r Altstadt folgen die wichtigsten<br />
Straßenzüge <strong>de</strong>n Höhenlinien <strong>de</strong>s Bergsporns. Deutlich tritt<br />
35
die alte Hauptdurchgangsstraße (Tübinger und Stuttgarter Straße)<br />
hervor. Als Bin<strong>de</strong>glied zwischen bei<strong>de</strong>n Straßen ist <strong>de</strong>r Marktplatz<br />
Zentrum <strong>de</strong>r Stadtanlage. An <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Marktplatz südöstlich<br />
schnei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Querachse <strong>de</strong>r Altstadt (Bronngasse - Kirchgasse)<br />
liegen auch die Hauptwahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt: Rathaus, Stiftskirche<br />
und evang. Dekanat (letzteres nach Osten gerückt). Den Endpunkt<br />
dieser Achse bil<strong>de</strong>t die Schlossruine auf <strong>de</strong>m Schlossberg.<br />
Stiftskirche<br />
Das Stadtwahrzeichen Herrenbergs ist die Stifts- und heutige<br />
Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau. Die unverwechselbare Silhouette<br />
<strong>de</strong>r Kirche mit <strong>de</strong>r breiten Westturmfassa<strong>de</strong> und <strong>de</strong>r<br />
Zwiebelhaube beherrscht kilometerweit die Gäulandschaft. Die<br />
Stiftskirche wur<strong>de</strong> in zwei Bauabschnitten zwischen 1276 und 1493<br />
erbaut und <strong>als</strong> erste spätgotische Hallenkirche in Süd<strong>de</strong>utschland<br />
vollen<strong>de</strong>t. Neben einem hölzernen Chorgestühl und einem Glockenmuseum<br />
befin<strong>de</strong>t sich in ihr auch die älteste Rosette Schwabens<br />
und die älteste Kirchenglocke Württembergs.<br />
Dekanat<br />
Die Propstei <strong>de</strong>s 1439 begrün<strong>de</strong>ten weltlichen Chorherrnstifts<br />
entstand seit Mitte <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Bis 1517 beherbergte sie<br />
dann die Brü<strong>de</strong>r vom gemeinsamen Leben, bis zur Reformation<br />
1534 wie<strong>de</strong>r weltliche Chorherren. 1534-1749 war es Sitz <strong>de</strong>r Vögte,<br />
anschließend Wohnung und Amtssitz <strong>de</strong>r Spezi<strong>als</strong>uperinten<strong>de</strong>nten<br />
und Dekane.<br />
Stadt- und Burghal<strong>de</strong>mauer mit Hagtorturm<br />
Die Stadtbefestigung entstand mit <strong>de</strong>r Stadtgründung im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
Von <strong>de</strong>r Stadtmauer mit einer Gesamtlänge von 1126 m<br />
sind heute noch 620 m an verschie<strong>de</strong>nen Stellen in <strong>de</strong>r Altstadt<br />
erhalten, davon 250 m in voller Höhe mit Wehrgängen, Zinnen,<br />
Schieß- und Beobachtungsscharten. Beson<strong>de</strong>rs gut ist die Stadtmauer<br />
(Burghal<strong>de</strong>mauer) im Bereich <strong>de</strong>s Schlossbergs zu erkennen.<br />
Das Hagtor oberhalb <strong>de</strong>r Stiftskirche ist das einzig erhaltene<br />
Tor <strong>de</strong>r Stadtmauer.<br />
36
Marktplatz mit Rathaus<br />
Schlossruine mit Aussichtsturm<br />
Von <strong>de</strong>r ehemaligen Burg- und Schlossanlage sind nur noch einige<br />
Ruinen übrig. Auf <strong>de</strong>m Stumpf <strong>de</strong>s ehemaligen Westturms (volkstümlich<br />
„Pulverturm“) wur<strong>de</strong> 1957 ein Aussichtsturm errichtet.<br />
Marktplatz<br />
Seit <strong>de</strong>r Stadtgründung fin<strong>de</strong>n an diesem Ort Märkte statt, bis 1504<br />
wur<strong>de</strong> hier auch unter freiem Himmel das Hochgericht gehalten.<br />
Die Fachwerkhäuser entstan<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m großen Stadtbrand von<br />
1635. Der Marktbrunnen wur<strong>de</strong> 1347 zum ersten Mal urkundlich<br />
erwähnt. Er versorgte die Stadt mit Wasser. Seine Säule zeigt einen<br />
Löwen und das Württemberger Wappen. Das klassizistische Rathaus<br />
mit <strong>de</strong>m Glocken- und Uhrentürmchen stammt aus <strong>de</strong>m Jahr<br />
1806.<br />
37
Lernorterkundung<br />
Die Herrenberger Stadterkundung bietet sich aufgrund <strong>de</strong>r Übersichtlichkeit<br />
<strong>de</strong>r Stadtanlage, wegen <strong>de</strong>r Überschaubarkeit <strong>de</strong>r einzelnen<br />
historischen Orte und auch wegen <strong>de</strong>r relativ kurzen Wege<br />
dazu an, sie <strong>als</strong> von <strong>de</strong>n Schülerinnen und Schülern (Kl. 7) eigenverantwortlich<br />
vorbereitete "Stadtführung" durchzuführen. Den<strong>kb</strong>ar<br />
sind folgen<strong>de</strong> Varianten:<br />
Für Klassen aus Herrenberg bzw. <strong>de</strong>r nahen Umgebung<br />
Die Schüler erhalten einige Zeit vor <strong>de</strong>r Exkursion in die Herrenberger<br />
Altstadt in Partnerarbeit <strong>als</strong> Hausaufgabe <strong>de</strong>n Auftrag, einen<br />
kurzen Vortrag (10 Minuten) über das jeweilige Objekt zu<br />
halten. Sie sollen vorher auch <strong>de</strong>n Ort eigenverantwortlich besichtigen<br />
und die für ihr Referat am besten geeignete Stelle bestimmen.<br />
Bei <strong>de</strong>r Exkursion im Klassenverband wer<strong>de</strong>n die Referate dann<br />
von <strong>de</strong>n Experten gehalten.<br />
Eine sehr motivieren<strong>de</strong> Untervariante, die auch schon erfolgreich<br />
von Herrenberger Kollegen erprobt wur<strong>de</strong>, ist die Einladung <strong>de</strong>r<br />
Eltern <strong>als</strong> Gruppe interessierter "Herrenberg-Touristen". Die Experten<br />
bleiben am jeweiligen historischen Ort und halten für die<br />
vorbeikommen<strong>de</strong> Touristengruppe (empfehlenswert ist die Bildung<br />
von zwei o<strong>de</strong>r mehr Teilgruppen) ihr Referat.<br />
Für Klassen aus <strong>de</strong>r weiteren Umgebung<br />
Die Schüler erhalten einige Zeit vor <strong>de</strong>r Exkursion in die Herrenberger<br />
Altstadt in Partnerarbeit <strong>de</strong>n Auftrag, einen kurzen Vortrag<br />
(5 Minuten) zu erarbeiten, Vorbereitung in einer Unterrichtsstun<strong>de</strong>,<br />
keine Vorbesichtigung vor Ort. Die Route <strong>de</strong>s Stadtrundgangs<br />
muss von <strong>de</strong>r Lehrkraft erkun<strong>de</strong>t und festgelegt wer<strong>de</strong>n, ebenso<br />
die geeignete Stelle <strong>de</strong>s Expertenreferats.<br />
Je<strong>de</strong>rzeit möglich ist freilich auch die Buchung einer Führung<br />
durch Beauftragte <strong>de</strong>r Stadtverwaltung Herrenberg. Beson<strong>de</strong>rs<br />
hinzuweisen ist auf die Führung durch die Stiftskirche mit <strong>de</strong>m<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Chorgestühl und durch das Glockenmuseum im<br />
Turm <strong>de</strong>r Stiftskirche.<br />
38
Glockenmuseum Stiftskirche Herrenberg<br />
Hoch über <strong>de</strong>n Dächern <strong>de</strong>r Stadt Herrenberg unter <strong>de</strong>r "welschen<br />
Haube", <strong>de</strong>r barocken "Zwiebel", im mächtigen Turm <strong>de</strong>r Stiftskirche<br />
befin<strong>de</strong>t sich das Glockenmuseum. In je<strong>de</strong>m Jahr scheuen<br />
sich etwa 10.000 Menschen nicht vor <strong>de</strong>m Aufstieg über die 146<br />
Stufen, um dann ohne "musealen" Abstand die einmalige Sammlung<br />
aus über einem Jahrtausend Glockengeschichte ansehen und<br />
anhören zu können.<br />
Man begegnet damit <strong>de</strong>m umfangreichsten Kirchengeläut<br />
Deutschlands. Glocken aus neun Jahrhun<strong>de</strong>rten und aus vielen<br />
Regionen <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschsprachigen Raums, Glocken, die eine abgestimmte<br />
Tonleiter über fast drei Oktaven bil<strong>de</strong>n, sind dort aufgehängt.<br />
Es sind keine Museumsstücke, die außer Gebrauch gekommen<br />
sind, son<strong>de</strong>rn Glocken, die ihren althergebrachten Dienst tun.<br />
Über 30 läutbare Glocken können aus <strong>de</strong>r Nähe besichtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Der viertelstündliche, <strong>de</strong>r stündliche Glockenschlag und das Läuten<br />
<strong>de</strong>r Glocken nach <strong>de</strong>r festgelegten Läuteordnung unterbricht<br />
unüberhörbar je<strong>de</strong> Besichtigung und wird zu einem unvergesslichen<br />
Klangerlebnis.<br />
Geschichte<br />
Das mächtige gotische Westwerk <strong>de</strong>r evangelischen Stiftskirche<br />
Herrenberg wird von einer barocken Haube mit Zwiebel gekrönt.<br />
Sie ersetzte 1749 die bei<strong>de</strong>n baufällig gewor<strong>de</strong>nen Fachwerktürme.<br />
Unter <strong>de</strong>m breiten Turmdach öffnet sich seit<strong>de</strong>m ein weiter, zweistöckiger<br />
Raum. Er bietet Platz für eine Glockenstube, wie sie in<br />
dieser Größe selten zu fin<strong>de</strong>n ist. Die großzügige Sanierung <strong>de</strong>r<br />
Herrenberger Stiftskirche in <strong>de</strong>n Jahren 1972 bis 1982 brachte<br />
überdies zu Stan<strong>de</strong>, was Jahrhun<strong>de</strong>rte lang unsicher war, nämlich<br />
die erfolgreiche und nachhaltige Festigung <strong>de</strong>r Statik <strong>de</strong>s Westwerks,<br />
auf <strong>de</strong>m diese Glockenstube gegrün<strong>de</strong>t ist.<br />
1986 kam Dieter Eisenhardt <strong>als</strong> Dekan nach Herrenberg. Ihn faszinierte<br />
<strong>de</strong>r große Glockenstubenraum. Zusammen mit <strong>de</strong>m kostbaren<br />
Inventar von fünf wertvollen Glocken aus acht Jahrhun<strong>de</strong>rten<br />
bot er sich <strong>als</strong> i<strong>de</strong>aler Platz für eine einzigartige Glockensammlung<br />
an. Auf <strong>de</strong>m Herrenberger Stiftskirchenturm sollten Glocken<br />
39
an ihrem Bestimmungsort, <strong>de</strong>m Kirchturm, in ihrer ursprünglichen<br />
Funktion <strong>als</strong> Rufer zu Gottesdienst und Gebet einer breiten Öffentlichkeit<br />
zugänglich gemacht wer<strong>de</strong>n.<br />
Die "Armsün<strong>de</strong>rglocke" (13. Jh.)<br />
Die beson<strong>de</strong>re Museumskonzeption besteht darin, dass <strong>de</strong>r Besucher<br />
die Glocken nicht nur anschauen, son<strong>de</strong>rn sie auch in Aktion<br />
sehen kann, dass er die Glocken nicht nur angeschlagen hört, son<strong>de</strong>rn<br />
sie in voller Klangentfaltung wahrnimmt, und dass er diese<br />
großen Instrumente nicht nur anfassen kann, son<strong>de</strong>rn ihre Klangwellen<br />
im Körper selbst spürt. Dieses ganzheitliche Erlebnis ist<br />
sonst in keinem Glockenmuseum möglich.<br />
1990 wur<strong>de</strong> das Museum mit zunächst elf Glocken eröffnet.<br />
Gleichzeitig kam es zur Gründung <strong>de</strong>r Herrenberger Bauhütte<br />
unter Leitung von Fritz Hanßmann. Diese besteht aus ehrenamtli-<br />
40
chen Mitarbeitern und betreibt wesentlich <strong>de</strong>n Auf- und Ausbau<br />
<strong>de</strong>s Museums. 1992 übergab die Evangelische Kirchengemein<strong>de</strong><br />
Herrenberg die Trägerschaft <strong>de</strong>m Verein zur Erhaltung <strong>de</strong>r Stiftskirche.<br />
Der Ausbau <strong>de</strong>s Herrenberger Stiftskirchenturms zu einem Glockenmuseum<br />
ist im Wesentlichen <strong>de</strong>r Bauhütte zu verdanken. Ein<br />
funktionales Glockenmuseum ist auch ein technisches Museum. Seine<br />
Einrichtung erfor<strong>de</strong>rt <strong>als</strong>o technischen Sachverstand. Wie ist die<br />
Statik <strong>de</strong>s Turms und <strong>de</strong>s Gebälks zu beurteilen? Wie kann eine<br />
tonnenschwere Glocke in <strong>de</strong>n Turm gehoben wer<strong>de</strong>n? usw. Zum<br />
Auf- und Ausbau <strong>de</strong>s Glockenmuseums mussten <strong>als</strong>o zunächst<br />
entsprechen<strong>de</strong> Fachleute hinzugezogen wer<strong>de</strong>n. Aber externe<br />
Fachleute allein hätten das Projekt Glockenmuseum nicht gelingen<br />
lassen können. Ausbau und Ausgestaltung <strong>de</strong>s Turms, Aufstellung<br />
und Wartung historischer Glocken erfor<strong>de</strong>rn ständige Planung und<br />
Pflege durch ein engagiertes Team vor Ort. Wenn im Mittelalter<br />
große Kirchenbauten projektiert waren, bil<strong>de</strong>te sich eine so genannte<br />
"Bauhütte", eine Gruppe von verschie<strong>de</strong>nen Handwerkern<br />
und Bauleuten sie<strong>de</strong>lte sich bei <strong>de</strong>r Kirche an und arbeitete über<br />
Jahrzehnte an einem solchen Projekt.<br />
Eine professionelle Bauhütte wie die am Kölner Dom konnte sich<br />
Herrenberg natürlich nicht leisten. Aber es fan<strong>de</strong>n sich sehr geschickte<br />
und engagierte Fachleute, die bereit waren, in ihrer Freizeit<br />
<strong>als</strong> ehrenamtliche Mitarbeiter für die Kirche zu arbeiten. Sie<br />
grün<strong>de</strong>ten im Jahr 1993 die Bauhütte Stiftskirche Herrenberg <strong>als</strong><br />
Einrichtung <strong>de</strong>r evangelischen Kirchengemein<strong>de</strong>. Im Untergeschoss<br />
<strong>de</strong>s Dekanats und im Turm <strong>de</strong>r Stiftskirche richtete sich die<br />
Bauhütte professionelle Werkstätten ein. In allen bau- und glockentechnischen<br />
Fragen sammelte sich dort ein erheblicher Sachverstand<br />
an, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Herrenberger Stiftskirche <strong>als</strong> Ganzem und<br />
<strong>de</strong>m Glockenmuseum im Beson<strong>de</strong>ren vielseitige Dienste leistete.<br />
Der Besuch <strong>de</strong>s Glockenmuseums kann anhand von Texten über<br />
die Entwicklungsgeschichte und Aufgaben <strong>de</strong>r Glocken sowie<br />
anhand von Abbildungen und Texten zur Läutetechnik und zur<br />
Glocke <strong>als</strong> Musikinstrument fächerübergreifend (Religion, Musik,<br />
41
Glockenstube<br />
Geschichte, Deutsch, NWT) im Unterricht vorbereitet wer<strong>de</strong>n.<br />
Zum Thema „Akustik“ im Fach Physik eignet sich ein Besuch <strong>de</strong>s<br />
Museums auch für Messungen und Klanganalysen.<br />
Im Museum ist jedoch auf Grund <strong>de</strong>r räumlichen Verhältnisse <strong>de</strong>s<br />
Glockenturms <strong>de</strong>r Herrenberger Stiftskirche sowie <strong>de</strong>r komplexen<br />
Thematik eine eigenverantwortliche Erschließung bzw. ent<strong>de</strong>cken<strong>de</strong>s<br />
Lernen eher schwierig. Daher wird eine Führung mit Experten<br />
<strong>de</strong>s Glockenmuseums empfohlen.<br />
Ein beson<strong>de</strong>res Erlebnis sind die Glockenkonzerte, die allerdings<br />
nur einmal monatlich am ersten Samstag von 17 - 18 Uhr stattfin<strong>de</strong>n.<br />
Dabei wird eindrucksvoll die Glocke <strong>als</strong> Musikinstrument<br />
vorgeführt.<br />
Informationen<br />
Glockenmuseum Stiftskirche Herrenberg<br />
Turm <strong>de</strong>r Stiftskirche Herrenberg<br />
71083 Herrenberg<br />
42
Internet: http://www.glockenmuseum-stiftskirche-herrenberg.<strong>de</strong><br />
Öffnungszeiten (Stand 2010)<br />
April - Okt.: Mittwoch 14.30 - 17.00, Samstag14.30 - 18.30, Sonntag/Feiertag:11.30<br />
- 17.00<br />
Nov. - März: Mittwoch 14.30 - 16.00, Samstag 17.00 - 18.30, Sonntag/Feiertag<br />
14.30 - 16.00<br />
Eintritt (Stand 2011)<br />
Erwachsene 2 Euro, Kind/Schüler/Stu<strong>de</strong>nt und Gruppenermäßigung<br />
je Person 1 Euro, Kin<strong>de</strong>r nur in Begleitung Erwachsener.<br />
Glockenkonzerte<br />
Glockenkonzerte fin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel je<strong>de</strong>n ersten Samstag im Monat<br />
von 17.00 - 18.10 Uhr statt. Treffpunkt ist zunächst das Kirchenschiff.<br />
Nach einer kurzen Einführung können sich die Besucher<br />
entschei<strong>de</strong>n, ob sie die Glocken im Kirchhof anhören wollen,<br />
o<strong>de</strong>r ob sie mit <strong>de</strong>m Leiter <strong>de</strong>s Konzertes <strong>de</strong>n Turm besteigen.<br />
Dort beginnt dann die eigentliche Vorführung. Neben <strong>de</strong>n einzelnen<br />
historischen Glocken wer<strong>de</strong>n auch unterschiedliche Zusammenstellungen<br />
<strong>de</strong>s Haupt- und Zimbelgeläuts erläutert und zu<br />
Gehör gebracht. Die Besucher können dabei die Glocken nicht<br />
nur sehen und hören, son<strong>de</strong>rn auch in ihrer vollen, schwingen<strong>de</strong>n<br />
Klangentfaltung erleben. Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag<br />
<strong>als</strong> Spen<strong>de</strong> für <strong>de</strong>n Ausbau <strong>de</strong>s Glockenmuseums wird dan<strong>kb</strong>ar<br />
angenommen (Richtsatz 3 Euro).<br />
Internetadressen<br />
Herrenberg:<br />
http://www.schulebw.<strong>de</strong>/unterricht/faecheruebergreifen<strong>de</strong>_themen/lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>/m<br />
o<strong>de</strong>lle/epochen/mittelalter/staedte/herrenberg/in<strong>de</strong>x.htm<br />
Glockenmuseum:<br />
http://www.schulebw.<strong>de</strong>/unterricht/faecheruebergreifen<strong>de</strong>_themen/lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>/m<br />
o<strong>de</strong>lle/epochen/mittelalter/staedte/herrenberg/in<strong>de</strong>x.htm<br />
43
Hubert Segeritz<br />
„Versteinerte“ Geschichte am Beispiel <strong>de</strong>r Stadt<br />
Grünsfeld<br />
Vom Aufstieg und Nie<strong>de</strong>rgang einer mittelalterlichen Stadt<br />
Beim Gang durch eine mittelalterliche Kleinstadt wie Grünsfeld<br />
fin<strong>de</strong>t man an vielen Stellen Zeugnisse aus vergangenen Jahrhun<strong>de</strong>rten.<br />
Um sie zu verstehen und richtig einzuordnen, lohnt es sich,<br />
einen Blick in das Geschichtsbuch zu werfen.<br />
Naturgemäß ist die aus Quellen vergangener Jahrhun<strong>de</strong>rte recherchierte<br />
Geschichte nur eine „einseitige“ Sichtweise. 1981 wur<strong>de</strong><br />
vom am 9.6.2011 verstorbenen Dr. Elmar Weis nach umfangreichen<br />
Recherchen im Stadtarchiv, in Lan<strong>de</strong>s- und Privatarchiven im<br />
Auftrag <strong>de</strong>r Stadt eine „Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Grünsfeld“ erstellt.<br />
Diese Recherchen dienten <strong>de</strong>m Autor <strong>als</strong> Basis für geschichtlichen<br />
Gang durch die mittelalterliche Stadt. Bei einem Rundgang durch<br />
Grünsfeld fin<strong>de</strong>t man an vielen markanten Stellen einen Bezug<br />
zum vorherrschen<strong>de</strong>n Baustein <strong>de</strong>r Gegend, <strong>de</strong>m Fränkischen<br />
Muschelkalk. Daher beginne ich meinen Beitrag mit <strong>de</strong>n ältesten<br />
Zeugen <strong>de</strong>r ehemaligen Amtsstadt.<br />
Ein Einblick in das Buch <strong>de</strong>r Erdgeschichte<br />
Fin<strong>de</strong>t man im Bereich <strong>de</strong>s Taubert<strong>als</strong> einen Stein, so liegt man in<br />
<strong>de</strong>n meisten Fällen nicht f<strong>als</strong>ch, wenn man sein Alter auf 200 bis<br />
250 Millionen Jahre schätzt. Warum das?<br />
Vor gut 250 Millionen Jahren befan<strong>de</strong>n sich weite Teile Süd<strong>de</strong>utschlands<br />
in einer flachen Mul<strong>de</strong>, von <strong>de</strong>n Geologen „Germanisches<br />
Becken“ genannt. Das Klima war dam<strong>als</strong> heiß und eher<br />
trocken, ähnlich wie heute in Nordafrika. Die Flüsse transportierten<br />
von <strong>de</strong>n umliegen<strong>de</strong>n Gebirgen San<strong>de</strong> und Tone, die sie in<br />
diesem Becken ablagerten. In <strong>de</strong>n nächsten Jahrmillionen wur<strong>de</strong><br />
die Landschaft abwechselnd von einem flachen Meer überschwemmt,<br />
gelegentlich trocknete sie auch wie<strong>de</strong>r aus und hinterließ<br />
Salzsedimente, wenn die Verbindung zum Weltmeer unterbrochen<br />
wur<strong>de</strong>. So bil<strong>de</strong>ten sich aus <strong>de</strong>n Ablagerungen <strong>de</strong>r Flüsse und<br />
<strong>de</strong>s Meeres teilweise mehr <strong>als</strong> 1000 Meter mächtige,<br />
44
Muschelkalksteinbruch im Ortsteil Krensheim<br />
durch <strong>de</strong>n Druck <strong>de</strong>r aufliegen<strong>de</strong>n Sedimente versteinerte Ablagerungen.<br />
Die Geologen nennen diese Phase <strong>de</strong>r Erdgeschichte Trias,<br />
weil sie aus drei <strong>de</strong>utlich unterscheidbaren Gesteinen besteht:<br />
Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper. Die blau-grauen Kalksteine<br />
<strong>de</strong>s Muschelkalks in Grünsfeld und Umgebung geben<br />
Zeugnis von einer großräumigen Meeresüberflutung, die rotbraunen<br />
Sand- und Tonsteine <strong>de</strong>s Buntsandsteins bei Wertheim wur<strong>de</strong>n<br />
dagegen ebenso wie <strong>de</strong>r Keupersandstein bei Maulbronn auf<br />
<strong>de</strong>m Festland abgelagert. Vor etwa 150 Millionen Jahren zog sich<br />
das Meer endgültig zurück, die versteinerten Schichten wur<strong>de</strong>n im<br />
Nordwesten stärker, im Südosten schwächer gehoben und durch<br />
die Flüsse in einem jetzt <strong>de</strong>utlich feuchteren Klima schrittweise<br />
abgetragen. Die Tauber hat sich heute mit etwa 150 m beson<strong>de</strong>rs<br />
tief in die umliegen<strong>de</strong>n Gesteinsschichten eingeschnitten. Sie legt<br />
heute unterhalb von Werbach die ältesten Gesteine <strong>de</strong>s Germanischen<br />
Beckens, <strong>de</strong>n sogenannten Buntsandstein wie<strong>de</strong>r frei. Das<br />
Taubertal oberhalb von Werbach gibt dagegen Zeugnis von einer<br />
weiträumigen Meeresüberflutung. In <strong>de</strong>n versteinerten Kalkschichten<br />
<strong>de</strong>s Muschelkalks fin<strong>de</strong>n sich neben allen Arten von Muscheln<br />
45
auch Schnecken, Seelilien und Ceratiten aus <strong>de</strong>r Familie <strong>de</strong>r Ammoniten.<br />
Fin<strong>de</strong>t man sie in Unmengen an einer Stelle, kann man<br />
sich gut vorstellen, wie dam<strong>als</strong> ein tropischer Wirbelsturm durch<br />
das Korallenriff fegte und eine Spur <strong>de</strong>r Verwüstung hinter sich<br />
her zog. Die Hänge <strong>de</strong>r tief eingeschnittenen Tauber und <strong>de</strong>ren<br />
Nebentäler boten schon vor 1000 Jahren zusammen mit <strong>de</strong>m<br />
Kalksteinbo<strong>de</strong>n gute Voraussetzungen für <strong>de</strong>n Weinbau, die<br />
Hochflächen boten dagegen für <strong>de</strong>n Getrei<strong>de</strong>- und später auch für<br />
<strong>de</strong>n Rübenanbau eine gute Grundlage.<br />
Die Frühgeschichte <strong>de</strong>r Besiedlung<br />
Der Mensch gehört sicher zu <strong>de</strong>n jüngsten Bewohnern <strong>de</strong>s Taubert<strong>als</strong>,<br />
unsere Vorfahren wan<strong>de</strong>rten vermutlich erst vor wenigen<br />
Hun<strong>de</strong>rttausend Jahren von Sü<strong>de</strong>n her ein, durchlebten in <strong>de</strong>n<br />
Eiszeiten ein Klima wie heute in Sibirien und in <strong>de</strong>n dazwischenliegen<strong>de</strong>n<br />
Warmzeiten Temperaturen ähnlich <strong>de</strong>r heutigen. In <strong>de</strong>n<br />
Eiszeiten waren die Sommer nur kurz und wur<strong>de</strong>n durch lang anhalten<strong>de</strong>,<br />
sehr kalte Winter abgelöst. An <strong>de</strong>n Hängen <strong>de</strong>r Tauber<br />
fin<strong>de</strong>n wir oft mehrere Meter mächtige Schichten aus feinem, gelblich-braunem<br />
Lößstaub, <strong>de</strong>r dam<strong>als</strong> aus <strong>de</strong>n fast vegetationslosen<br />
Flusstälern ausgeblasen wur<strong>de</strong>. Die Kiese und San<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Tauber<br />
stammen überwiegend von gewaltigen Hochwassern nach <strong>de</strong>r jährlichen<br />
Schneeschmelze im Frühsommer.<br />
Archäologische Fun<strong>de</strong> lassen vermuten, dass <strong>de</strong>r Mensch in dieser<br />
Region seit min<strong>de</strong>stens 6000 Jahren Fuß gefasst hat. Im Grünsfel<strong>de</strong>r<br />
Ortsteil Krensheim wur<strong>de</strong>n 2009 in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Wasserturms<br />
Siedlungen aus dieser Zeit nachgewiesen. Die genauen Auswertungen<br />
<strong>de</strong>r Fun<strong>de</strong> stehen <strong>de</strong>rzeit noch aus. Zur Zeit <strong>de</strong>r Römer<br />
war die Grünsfel<strong>de</strong>r Gemarkung wohl weitgehend bewal<strong>de</strong>t und<br />
kaum besie<strong>de</strong>lt, ab <strong>de</strong>m 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt n. Chr. durchbrachen die<br />
Alemannen in unserer Region <strong>de</strong>n römischen Limes zwischen Miltenberg,<br />
Walldürn und Osterburken. Dieser germanische Stamm<br />
wur<strong>de</strong> dann um 500 n. Chr. von <strong>de</strong>n Franken besiegt. Unter Karl<br />
<strong>de</strong>m Großen und <strong>de</strong>ssen Nachfolgern wur<strong>de</strong>, ausgehend vom<br />
Verwaltungssitz <strong>de</strong>s Taubergaus, <strong>de</strong>m heutigen Königshofen, <strong>de</strong>r<br />
Wald großflächig gero<strong>de</strong>t und Siedlungen gegrün<strong>de</strong>t. Die Ortsna-<br />
46
Kirchturm in Grünsfeld<br />
men auf -feld, -stadt, -brunn und -hausen stammen überwiegend<br />
aus dieser Zeit. Erstm<strong>als</strong> wer<strong>de</strong>n Orte <strong>de</strong>r Region in <strong>de</strong>n Urkun<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Klöster Lorsch und Fulda erwähnt. Der irische „Apostel<br />
<strong>de</strong>r Franken“, Bonifatius, und <strong>de</strong>ssen Verwandte Lioba aus <strong>de</strong>m<br />
nahen „Bischofsheim“ (die Grünsfel<strong>de</strong>r nennen Tauberbischofsheim<br />
heute noch „Bischeme“) betrieben massiv und mit Erfolg<br />
die Christianisierung <strong>de</strong>r Taubert<strong>als</strong> und <strong>de</strong>r Seitentäler.<br />
Erstm<strong>als</strong> erwähnt wird „Gruonfeld“ im 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Co<strong>de</strong>x<br />
<strong>de</strong>s Klosters Fulda. Um das 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt hatten vermutlich die<br />
Herren von Zimmern (heute ein Ortsteil von Grünsfeld) das Sagen.<br />
Auch im Ortsteil Krensheim herrschte wohl die Verwandtschaft<br />
in einer Burg, die 1525 im Bauernkrieg zerstört wur<strong>de</strong>.<br />
47
Die Rienecksche Herrschaft<br />
Um 1200 übernahmen die Grafen von Rieneck aus <strong>de</strong>m Spessart<br />
durch Einheirat die Herrschaft über Zimmern und Lauda. Sie<br />
zeichneten sich durch Schenkungen an das Kloster Bronnbach aus<br />
und wählten Grünsfeld <strong>als</strong> ihren Herrschaftssitz, eine geostrategisch<br />
nachvollziehbare Entscheidung, um die mittelalterliche Han<strong>de</strong>lsstraße<br />
von Nürnberg über Aub, (Tauber-)Bischofsheim und<br />
Miltenberg nach Frankfurt zu kontrollieren. Die Entscheidung für<br />
Grünsfeld <strong>als</strong> Hauptsitz hatte schwerwiegen<strong>de</strong> Folgen, da damit<br />
ein wichtiges Zentrum mit vielfältigen Verwaltungsfunktionen<br />
entstand: Die Rienecks hatten, wie aus Urkun<strong>de</strong>n belegt ist, viele<br />
lehenspflichtige Güter im Taubertal. Weinberge und Getreidanbau<br />
brachten ihnen reichliche Einnahmen.<br />
Unter Ludwig II. von Rieneck und <strong>de</strong>ssen Nachfolgern erhielt<br />
Grünsfeld eine mächtige Burg und eine Stadtmauer. Ein Wartturm<br />
auf <strong>de</strong>m Schalksberg stellte die Sichtverbindung zu <strong>de</strong>n Warttürmen<br />
benachbarter Gemein<strong>de</strong>n her. Als Baumaterial stand <strong>de</strong>r<br />
reichlich vorhan<strong>de</strong>ne Muschelkalk zur Verfügung. Lei<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong><br />
nach einem großen Brand im Jahre 1861, <strong>de</strong>m ein großer Teil <strong>de</strong>s<br />
mittelalterlichen „Klein-Rothenburg“ zum Opfer fiel, von <strong>de</strong>r<br />
großherzoglichen Regierung das Nie<strong>de</strong>rreißen eines großen Teils<br />
<strong>de</strong>r Stadtmauer angeordnet.<br />
Im Laufe <strong>de</strong>s 13.Jahrhun<strong>de</strong>rts erhielt Grünsfeld das Stadtrecht,<br />
noch 1247 <strong>als</strong> „villa“ erwähnt, wird Grünsfeld 1280 erstm<strong>als</strong> in<br />
einer Urkun<strong>de</strong> <strong>als</strong> „oppidum“ bezeichnet. Mit <strong>de</strong>n Burgen in <strong>de</strong>n<br />
heutigen Ortsteilen Krensheim und Zimmern und <strong>de</strong>ren Reisigen<br />
und Knechten verfügten die Rienecks über eine schlagkräftige<br />
Truppe zur Sicherung ihrer Liegenschaften.<br />
Die Stadt hatte dam<strong>als</strong> wohl etwa 600-700 Einwohner. Eine<br />
Stadtmauer mit einer mächtigen Burg, ein Rathaus, mehrere Mühlen,<br />
ein Markt, die Anwesenheit von A<strong>de</strong>ligen, Handwerkern und<br />
jüdischen Bürgern, die die Han<strong>de</strong>ls-und Kreditgeschäfte in <strong>de</strong>r<br />
Stadt abwickelten, zeigen, dass “Gruensvelth“ dam<strong>als</strong> nicht nur <strong>de</strong><br />
jure , son<strong>de</strong>rn auch funktional zu einer Stadt herangewachsen war.<br />
Mehrfach fin<strong>de</strong>n sich im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt Urkun<strong>de</strong>n (z.B.1336 von<br />
Kaiser Ludwig IV.), die <strong>de</strong>n Rienecks das mit Mauteinnahmen<br />
48
links: Grabmal <strong>de</strong>r Amalia von Rieneck ,Bronzeguss aus <strong>de</strong>m Jahr1483<br />
Grabmal <strong>de</strong>s Gerhard von Rieneck aus <strong>de</strong>m Jahr 1381<br />
versehene Geleitrecht an <strong>de</strong>r Fernstraße bestätigten. Eine mächtige<br />
Zehntscheune und die weiträumigen Keller <strong>de</strong>s Amtshauses (heutiges<br />
Heimatmuseum) im Bereich <strong>de</strong>r Schlosses zeugen von beträchtlichen<br />
Einnahmen aus Han<strong>de</strong>l, Weinbau und Landwirtschaft.<br />
Mit <strong>de</strong>n mächtigen Bischöfen aus Würzburg und Mainz gab es<br />
immer wie<strong>de</strong>r Feh<strong>de</strong>n, die meist zu Ungunsten <strong>de</strong>r Rienecks ausgingen<br />
und daraufhin zu Gebietsverlusten führten.<br />
Das Grabmal von Gerhard V., auf <strong>de</strong>m <strong>als</strong> To<strong>de</strong>stag <strong>de</strong>r 26. Juni<br />
1382 vermerkt ist, ist heute im Seitenschiff <strong>de</strong>r Grünsfel<strong>de</strong>r Stadtkirche<br />
zu besichtigen. Da er keine männlichen Nachkommen hatte,<br />
fiel sein Erbe an Graf Ludwig IV. von Rieneck, <strong>de</strong>r in Lohr am<br />
Main residierte. Dessen Sohn Michael ist wie sein Vater vor allem<br />
wegen vieler Feh<strong>de</strong>n urkundlich erwähnt. 1463 erhielt Philipp, <strong>de</strong>r<br />
älteste <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Söhne von Michael, nach einigen Erbauseinan<strong>de</strong>rsetzungen<br />
nach einem Teilungsvertrag u.a. Grünsfeld und gab<br />
„Grunßfelt“ 1479 eine neue Stadtverordnung, in die Rechte und<br />
Pflichten <strong>de</strong>r Bürger genau geregelt wur<strong>de</strong>n (nachzulesen in:<br />
Weiss, 1981, S.70/71). Der Grabstein Philipps und seiner Frau<br />
49
Amalie befin<strong>de</strong>t sich heute <strong>de</strong>r Grünsfel<strong>de</strong>r Stadtkirche. Philipp<br />
starb am 5.12.1488, Amalie am 15.5.1486.<br />
Kurz nach <strong>de</strong>m Tod von Amalie übergab Philipp die Stadt an seinen<br />
Schwiegersohn Friedrich von Leuchtenberg, <strong>de</strong>r mit seiner<br />
Tochter Dorothea verheiratet war. Nach <strong>de</strong>m Tod ihres Mannes<br />
heiratete Dorothea 1489 <strong>de</strong>n Grafen Asmus von Wertheim, <strong>de</strong>r<br />
sich <strong>als</strong> Geistlicher nachträglich mit <strong>de</strong>m Segen von Mutter Kirche<br />
wie<strong>de</strong>r laisieren ließ, was im Mittelalter bei A<strong>de</strong>ligen nicht selten<br />
vorkam. Nach gut 10 Jahren Ehe kam es <strong>de</strong>n Quellen zufolge<br />
zwischen bei<strong>de</strong>n zu immer mehr Spannungen, die - wie auch heute<br />
oft üblich - im Streit um Geld und Habe en<strong>de</strong>ten. Neben an<strong>de</strong>ren<br />
wur<strong>de</strong>n Pfalzgraf Philipp und zuletzt auch noch Kaiser Maximilian<br />
vergeblich <strong>als</strong> Schlichter o<strong>de</strong>r Richter bemüht.<br />
Dorothea von Rieneck wohnte bis zu ihrem Tod im Jahre 1503 in<br />
Grünsfeld. Der berühmte Würzburger Bildhauer Tilman Riemenschnei<strong>de</strong>r<br />
schuf aus Fränkischem Muschelkalk ihr Grabmal, das<br />
sich heute in <strong>de</strong>r Stadtkirche befin<strong>de</strong>t. Auch die Grünsfel<strong>de</strong>r Schule<br />
trägt seit einigen Jahren ihren Namen.<br />
Die Leuchtenberger Epoche<br />
Graf Asmus von Wertheim und die Grafen von Rieneck suchten<br />
um 1500 immer wie<strong>de</strong>r nach Wegen, die Grünsfel<strong>de</strong>r Liegenschaften<br />
an sich zu reißen. Daher verhan<strong>de</strong>lte <strong>de</strong>r Sohn Dorotheas aus<br />
erster Ehe, Landgraf Johann von Leuchtenberg, mit <strong>de</strong>n Mächtigen<br />
<strong>de</strong>r Region, <strong>de</strong>m Kurfürsten <strong>de</strong>r Pfalz und <strong>de</strong>m Würzburger<br />
Bischof um einen Schutzvertrag. Letztlich wur<strong>de</strong> die Stadt und das<br />
Amt Grünsfeld mit Vertrag vom 9. Mai 1502 dann <strong>de</strong>m Hochstift<br />
Würzburg lehenspflichtig und verlor damit <strong>als</strong> letzte Stadt <strong>de</strong>r<br />
Umgebung ihre Selbständigkeit. Allerdings wur<strong>de</strong>n Grünsfeld alle<br />
alten Rechte belassen.<br />
1504 verhängte Kaiser Maximilian über Landgraf Johann von<br />
Leuchtenberg Reichsacht und beauftragte <strong>de</strong>ssen Wi<strong>de</strong>rsacher und<br />
Stiefvater Graf Asmus von Wertheim, Stadt und Amt Grünsfeld in<br />
kaiserlichen Besitz zu nehmen. Dieser eroberte dann auch mit einer<br />
Streitmacht von 20 Reitern und 300 Fußknechten zunächst die<br />
zum Grünsfel<strong>de</strong>r Amt gehörigen Dörfer Dittigheim und Impfin-<br />
50
gen. Bereits einen Tag später eilte dann <strong>de</strong>r neue geistliche<br />
„Schutzherr“ aus Würzburg mit 20 Reitern und 200 Fußknechten<br />
zu Hilfe und eroberte das verlorene Terrain zurück.<br />
Bis 1513 hielt sich Landgraf Johann von Leuchtenberg überwiegend<br />
in Grünsfeld auf, danach verlegte er seinen Wohnsitz nach<br />
Amberg, was die Stellung <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>utlich schmälerte. Dennoch<br />
erreichte <strong>de</strong>ssen Sohn Georg bei Kaiser Karl V., dass mit Urkun<strong>de</strong><br />
vom 1. September 1523 Grünsfeld erneut H<strong>als</strong>gericht und Blutbann<br />
verliehen wur<strong>de</strong>.<br />
Im ausgehen<strong>de</strong>n 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> auch Grünsfeld von <strong>de</strong>n<br />
sozialen Unruhen erfasst: Zunächst brachte <strong>de</strong>r „Pfeiferhannes“ in<br />
Niklashausen die Bauern <strong>de</strong>r Umgebung durch seine aus heutiger<br />
Sicht mehr <strong>als</strong> berechtigten For<strong>de</strong>rungen an die vorwiegend geistliche<br />
Herrschaft hinter sich. Auch nach seinem Tod auf <strong>de</strong>m Scheiterhaufen<br />
in <strong>de</strong>r Würzburger Marienburg setzten sich die Unruhen<br />
fort, bis sie dann schließlich im sogenannten Bauernkrieg gewaltsam<br />
ausbrachen. Am 26.3.1525 am Sonntag Laetare trafen sich die<br />
Bauern <strong>de</strong>r Umgebung in Unterschüpf und vereinbarten,<br />
ein gemeinsames Heer aufzustellen, um sich <strong>de</strong>n Aufständischen<br />
anzuschließen.<br />
Die Grünsfel<strong>de</strong>r Burg wur<strong>de</strong> darauf hin zwar besetzt und teilweise<br />
geplün<strong>de</strong>rt, aber nicht zerstört wie manche Burgen in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft (z.B. in Krensheim, Oberlauda und in Messelhausen).<br />
In Grünsfeld schlossen sich neben <strong>de</strong>n Bauern auch die<br />
Bürger <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>r neuen Bewegung an.<br />
Am 2. Juni 1525 fand dann im etwa 10 km entfernten Königshofen<br />
die letzte entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Schlacht statt. Die Landsknechte <strong>de</strong>s<br />
Truchseß von Waldburg „schlachteten“ dabei wohl etwa 8000<br />
Bauern in einem furchtbaren Blutbad ab.<br />
Letzterer hielt auch anschließend in Königshofen, Lauda, Mergentheim,<br />
(Tauber-)Bischofsheim und Grünsfeld , das er am 3.<br />
Juni einnahm, sein blutiges Gericht. Die zeitgenössischen Berichte<br />
sind dabei wie nicht an<strong>de</strong>rs zu erwarten, aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r Sieger<br />
verfasst, zumal die Gegenseite meist <strong>de</strong>s Schreibens unkundig war.<br />
Immerhin scheint Landgraf Johann von Leuchtenberg im Vergleich<br />
glimpflich gehan<strong>de</strong>lt zu haben.<br />
51
Die Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen<br />
Von toten Bauern lassen sich nun mal keine Steuern einziehen!<br />
Die folgen<strong>de</strong>n Jahrzehnte waren durch Konflikte zwischen <strong>de</strong>m<br />
Haus Leuchtenberg und <strong>de</strong>m Bistum Würzburg geprägt. Bei<strong>de</strong><br />
bedienten sich reichlich an <strong>de</strong>n Ressourcen <strong>de</strong>r Stadt. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
die jüdische Bevölkerung wur<strong>de</strong> in Kriegszeiten durch Schatzungsgel<strong>de</strong>r<br />
und Ausweisung stark betroffen. Da die Leuchtenberger<br />
Landgrafen durch die häufigen Kriege, kostspielige Rechtsstreitigkeiten<br />
und aufwändigen Lebensstil meist finanziell klamm<br />
waren, konnte 1561 <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>n damaligen Landgrafen<br />
Ludwig Heinrich <strong>als</strong> Kompensation für Geldfor<strong>de</strong>rungen die Befreiung<br />
von <strong>de</strong>r Leibeigenschaft erwirken (Text siehe: Stadtarchiv<br />
Grünsfeld, U22/Weiss, 1981, S.109) .Letzterer wur<strong>de</strong> ebenso wie<br />
seine Nachfolger in Pfreimd (heutige Partnerstadt <strong>de</strong>r Grünsfel<strong>de</strong>r)<br />
begraben, was eine <strong>de</strong>utliche Schwerpunktverlagerung zuungunsten<br />
<strong>de</strong>r Stadt Grünsfeld zeigt.<br />
52
Interessanterweise bauten gera<strong>de</strong> in dieser Zeit im Jahre 1579 die<br />
Grünsfel<strong>de</strong>r trotz<strong>de</strong>m ihr neues Rathaus, ein heute noch sehenswertes<br />
Fachwerkgebäu<strong>de</strong> auf einem Steinsockel aus Muschelkalk.<br />
Der Grundriss ist i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>m früheren Rathaus aus <strong>de</strong>m 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt, in <strong>de</strong>r offenen Halle im unteren Stock waren die<br />
Marktstän<strong>de</strong> untergebracht.<br />
Mit <strong>de</strong>r Reformation wandten sich viele Bürger und Priester <strong>de</strong>n<br />
Protestanten zu. Daher blies <strong>de</strong>r Landgraf Georg Ludwig von<br />
Leuchtenberg 1583 im Zuge <strong>de</strong>r Gegenreformation zum Gegenangriff.<br />
Bei einem Besuch in Grünsfeld brachte er gleich eine neue<br />
„ordnung und mandata“ mit, in <strong>de</strong>r unter an<strong>de</strong>rem die katholische<br />
Religion auch für die Zuziehen<strong>de</strong>n festgelegt wur<strong>de</strong> (Vollständiger<br />
Text in: Weiss, 1981; S.116-123). So wur<strong>de</strong> das Amt Grünsfeld im<br />
Laufe <strong>de</strong>r nächsten Jahre wie<strong>de</strong>r rein katholisch. Es umfasste neben<br />
<strong>de</strong>r Stadt Grünsfeld die heutigen Ortsteile Grünsfeldhausen,<br />
Paimar, Zimmern, Krensheim, daneben noch Schönfeld, Gissigheim<br />
und die heutigen Tauberbischofsheimer Ortsteile Dittigheim,<br />
Hof Steinbach, Distelhausen und Dittwar und erhielt 1592 das<br />
Zentgericht und eine Zentordnung.<br />
Georg Ludwig war ein enger Vertrauer Kaiser Rudolf II., was auch<br />
dazu führte, dass manches Fass Wein aus Grünsfeld <strong>de</strong>n Weg zum<br />
kaiserlichen Hof fand. Dessen Sohn Wilhelm kann man wohl eher<br />
<strong>als</strong> „missraten“ bezeichnen, was sich schon darin zeigt, dass <strong>de</strong>r<br />
Vater einen kaiserlichen Haftbefehl gegen ihn erwirkte und ihn<br />
enterbte.<br />
Wilhelm trat nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Vaters <strong>de</strong>nnoch die Herrschaft an,<br />
pflegte einen aufwändigen Lebensstil und war maßlos verschul<strong>de</strong>t.<br />
Das Grünsfel<strong>de</strong>r Amt ächzte unter <strong>de</strong>r hohen Steuerlast. Wilhelm<br />
reiste nach <strong>de</strong>m Tod seiner Gattin 1616 zum Papst nach Rom, wo<br />
er nach wenigen Wochen Aufenthalt zum Priester geweiht wur<strong>de</strong>.<br />
Er sicherte sich dabei Einnahmen aus kirchlichen Pfrün<strong>de</strong>n, was<br />
wohl sein eigentliches Ziel war.<br />
Trotz seiner neuen Stellung <strong>als</strong> Geistlicher setzte er seinen bisherigen<br />
kostspieligen Lebenswan<strong>de</strong>l fort. Als er 1620 er wie<strong>de</strong>r einmal<br />
neue Steuern erhob, protestierten die Grünsfel<strong>de</strong>r vehement dagegen,<br />
worauf er 28 Bürger in <strong>de</strong>n Diebsturm einsperren ließ. Dar-<br />
53
aufhin nahm <strong>de</strong>r Lehensherr, <strong>de</strong>r Würzburger Bischof, sich <strong>de</strong>r<br />
Grünsfel<strong>de</strong>r an. 1621 wur<strong>de</strong> die Herrschaft Grünsfeld auf Betreiben<br />
<strong>de</strong>s Herzogs Maximilian von Bayern von Kaiser Ferdinand II.<br />
<strong>de</strong>m Bischof von Würzburg <strong>als</strong> Administrator übertragen.<br />
In die Würzburger Zeit fielen auch die unseligen Hexenverfolgungen<br />
im 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Basis war wohl <strong>de</strong>r damalige Magieglauben,<br />
<strong>de</strong>r unter Kaiser Karl V. 1532 in <strong>de</strong>r Gerichtsordnung<br />
„Carolina“ im Artikel 109 festlegte, dass schädliche „Zauberei“<br />
mit <strong>de</strong>m Verbrennungsto<strong>de</strong> zu bestrafen sei. Die Neidköpfe am<br />
Grünsfel<strong>de</strong>r Rathaus und an<strong>de</strong>rswo geben Zeugnis vom Denken<br />
dieser Zeit. Sie sollten vor bösen Mächten schützen.<br />
Nachweislich etwa 30 Frauen wur<strong>de</strong>n, oft nach Denunziation<br />
durch die Nachbarschaft, meist nach einer „peinlichen Frag“ auf<br />
<strong>de</strong>r Folterbank <strong>de</strong>r Hexerei „überführt“ und zum To<strong>de</strong> verurteilt.<br />
Der 30-jährige Krieg von 1618-1648 for<strong>de</strong>rte wie überall in<br />
Deutschland auch in <strong>de</strong>r Tauberregion einen hohen Blutzoll.<br />
Beim Durchzug <strong>de</strong>r Truppen <strong>de</strong>r Katholischen Liga o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Protestantischen<br />
Union mussten im günstigsten Fall Soldaten und<br />
Pfer<strong>de</strong> einquartiert und versorgt wer<strong>de</strong>n. Diese schleppten z.B.<br />
auch Krankheiten ein, 1633 waren in Grünsfeld 220 Pesttote zu<br />
beklagen. An<strong>de</strong>re Orte waren oft noch schlimmer betroffen. So<br />
wur<strong>de</strong> im gleichen Jahr das Dorf Schönfeld von <strong>de</strong>r schwedischen<br />
Soldateska abgebrannt. Als 1635 <strong>de</strong>r Krieg durch <strong>de</strong>n Prager Frie<strong>de</strong>nsschluss<br />
endlich been<strong>de</strong>t schien, griff dann auch noch <strong>de</strong>r französische<br />
König ein. 1645 quartierte sich ein französisches Regiment<br />
in das kriegsgeplagte Grünsfeld ein, am 5.Mai kam es in<br />
Herbsthausen bei Bad Mergentheim zur Schlacht gegen die kaiserlichen<br />
Truppen, in <strong>de</strong>r die Franzosen vernichtend geschlagen wur<strong>de</strong>n.<br />
Dennoch än<strong>de</strong>rte sich in <strong>de</strong>n letzten Kriegsjahren das Los <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung nicht: Dörfer wie z.B. Oberbalbach brannten völlig<br />
ab, die Bevölkerung floh vor <strong>de</strong>n marodieren<strong>de</strong>n Söldnern in die<br />
Wäl<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r in die befestigten Städte wie Grünsfeld.<br />
Grünsfeld <strong>als</strong> Würzburger Oberamtsstadt<br />
Als 1646 <strong>de</strong>r letzte Leuchtenberger Landgraf starb, fiel das ausgeblutete<br />
und verarmte Amt Grünsfeld endgültig an Würzburg. Das<br />
54
neue Oberamt umfasste insgesamt 15 Ortschaften und Weiler. So<br />
gehörten auch Gerchsheim, Ilmspan, Impfingen, Vilchband, Oberund<br />
Unterwittighausen und damit etwa 3000 Einwohner zum O-<br />
beramt Grünsfeld. Vor <strong>de</strong>m 30-jährigen Krieg dürften in diesem<br />
Bereich allerdings etwa 5000 Einwohner gelebt haben.<br />
Auch nach <strong>de</strong>m Westfälischen Frie<strong>de</strong>n im Jahr 1648 wur<strong>de</strong> die<br />
Herrschaft <strong>de</strong>s Oberamts Grünsfeld nicht von kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen<br />
verschont: 1673 plün<strong>de</strong>rten französische Truppen<br />
<strong>de</strong>s Marschall Turenne Bronnbach, wo <strong>de</strong>r Grünsfel<strong>de</strong>r Abt<br />
Wun<strong>de</strong>rt residierte, und quartierten sich in <strong>de</strong>r Tauberregion ein,<br />
im Herbst 1688 suchten im Zuge <strong>de</strong>s Pfälzischen Erbfolgekriegs<br />
französische Soldaten unter General Melac das Oberamt heim.<br />
Grünsfeld zahlte eine Brandschatzung, Zimmern, Deubach, Messelhausen,<br />
Ober- und Unterbalbach wur<strong>de</strong>n in Brand gesetzt.<br />
Grünsfel<strong>de</strong>r Rathaus<br />
55
Das 17.und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt führte durch Kriege und Einquartierungen<br />
von durchziehen<strong>de</strong>n Soldaten zur zunehmen<strong>de</strong>n Verarmung<br />
<strong>de</strong>r Bevölkerung.<br />
Grünsfeld im 19. und 20.Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r französischen Eroberungskriege unter Napoleon<br />
wur<strong>de</strong>n die Karten für das Oberamt Grünsfeld 1802/03 nochm<strong>als</strong><br />
neu gemischt. Nach einigem Hin und Her wur<strong>de</strong> das Oberamt mit<br />
seinen etwa 6000 Einwohnern <strong>de</strong>m Fürsten Salm-Reifferscheidt-<br />
Krautheim und schließlich 1806 <strong>de</strong>m Großherzogtum Ba<strong>de</strong>n zugeschlagen.<br />
1813 verlor Grünsfeld darüber hinaus auch noch seinen Amtssitz<br />
und damit seine Mittelpunktsfunktion, die es fast 600 Jahre innehatte,<br />
an das benachbarte Gerlachsheim. Im gesamten 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
litt Grünsfeld schwer unter Kriegen und Kriegsfolgen.<br />
Beim Russlandfeldzug Napoleons marschierten 1812 die Grünsfel<strong>de</strong>r<br />
mit <strong>de</strong>n badischen Truppen gen Moskau, nur wenige sahen<br />
ihre Heimat wie<strong>de</strong>r. Während <strong>de</strong>r 1848er Revolution begehrten die<br />
Bürger gegen ihre Stan<strong>de</strong>sherren auf. Der Großherzog von Ba<strong>de</strong>n<br />
floh und rief die preußischen Truppen zu Hilfe, die <strong>de</strong>n Aufstand<br />
blutig unterdrückten. Danach kam es zu einer Cholera-Epi<strong>de</strong>mie,<br />
die allein in Grünsfed 35 To<strong>de</strong>sopfer for<strong>de</strong>rte. 1866 lag das Taubertal<br />
im Krieg <strong>de</strong>s Deutschen Bun<strong>de</strong>s gegen Preußen im Zentrum<br />
<strong>de</strong>r verlustreichen Gefechte und 1870/71 marschierten die Grünsfel<strong>de</strong>r<br />
im <strong>de</strong>utsch-französischen Krieg mit <strong>de</strong>n badischen Verbän<strong>de</strong>n<br />
gen Westen.<br />
Das 18. und 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt war auch durch größere Auswan<strong>de</strong>rungswellen<br />
gekennzeichnet. Schwerpunkte waren dabei zunächst<br />
nach <strong>de</strong>m Abzug <strong>de</strong>r Türken das habsburgische Ungarn, später die<br />
USA. Mit <strong>de</strong>r beginnen<strong>de</strong>n Industrialisierung zog es die Auswan<strong>de</strong>rer<br />
im19. Jahrhun<strong>de</strong>rt aus <strong>de</strong>m verarmten Grünsfeld in die Industriestädte,<br />
vor allem nach Mannheim.<br />
In Grünsfeld entwickelte sich zu Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts nach<br />
<strong>de</strong>m Anschluss an die Bahnlinie Hei<strong>de</strong>lberg –Würzburg auf Grund<br />
<strong>de</strong>r Qua<strong>de</strong>rkalksteinvorkommen in <strong>de</strong>n Krensheimer Steinbrü-<br />
56
chen eine aufstreben<strong>de</strong> Steinindustrie. Der blaugraue, qualitativ<br />
hochwertige Muschelkalk war im Reichsgebiet sehr gefragt und<br />
die Steinmetze waren in <strong>de</strong>r Grünsfel<strong>de</strong>r Handwerkerschaft schon<br />
seit Jahrhun<strong>de</strong>rten stark vertreten. Investoren und Fachleute aus<br />
<strong>de</strong>m Reichsgebiet trugen zum Aufschwung bei. Die Grünsfel<strong>de</strong>r<br />
Steinhauer organisierten sich früh und streikten – allerdings ohne<br />
Erfolg - bereits 1906 im Verband <strong>de</strong>r “Freien Gewerkschaften<br />
Unterfranken“ um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.<br />
Der Muschelkalk aus Krensheim fin<strong>de</strong>t sich heute überall im<br />
Stadtgebiet, aber auch am Kölner Dom, Berliner Reichstag sowie<br />
in Grabmalen und Bauwerken im In- und Ausland. Während <strong>de</strong>r<br />
Zeit <strong>de</strong>s Nation<strong>als</strong>ozialismus war <strong>de</strong>r Muschelkalk aus Grünsfeld<br />
ein gesuchter Baustein. Ein Beispiel <strong>de</strong>r damaligen Kunstrichtung<br />
kann man heute noch am Grünsfel<strong>de</strong>r Sportplatz am Ortsausgang<br />
in Richtung Distelhausen besichtigen.<br />
Die erste Hälfte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts brachte durch die bei<strong>de</strong>n<br />
Weltkriege viel Leid über die Bevölkerung. Der jeweils zu Beginn<br />
<strong>de</strong>r Kriege vorhan<strong>de</strong>ne Hurra-Patriotismus eines Teils <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
wich schnell angesichts <strong>de</strong>r vielen toten Soldaten aus <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong>. Diese Zeit war darüber hinaus durch ein Klima <strong>de</strong>r<br />
Kontrolle und Intoleranz gegenüber An<strong>de</strong>rs<strong>de</strong>nken<strong>de</strong>n gekennzeichnet.<br />
Die bereits seit <strong>de</strong>m 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt in Grünsfeld ansässige jüdische<br />
Bevölkerung, die über die Jahrhun<strong>de</strong>rte immer wie<strong>de</strong>r Pogromen<br />
ausgesetzt war, wur<strong>de</strong>n auf Grund <strong>de</strong>r nation<strong>als</strong>ozialistischen<br />
Rassengesetze rechtlos und zwischen 1940 und 1942 in<br />
Konzentrationslager <strong>de</strong>portiert. Einem Teil gelang zuvor die Auswan<strong>de</strong>rung.<br />
Nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg galt es zunächst, die vielen Flüchtlinge und<br />
Vertriebenen zu integrieren. Die Steinindustrie befin<strong>de</strong>t sich nach<br />
einem Zwischenhoch seit <strong>de</strong>n 80er Jahren im Nie<strong>de</strong>rgang, da sie<br />
nicht mehr konkurrenzfähig ist.<br />
Heute ist die Stadt Grünsfeld ein Kleinzentrum mit etwa 3000<br />
Einwohnern. Gewerbegebiete in enger Kooperation mit <strong>de</strong>m benachbarten<br />
Unterzentrum Lauda-Königshofen wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n letz-<br />
57
ten Jahrzehnten neben neuen Baugebieten erschlossen und zeigen,<br />
dass sich die Stadt auf einem auf einem guten Weg befin<strong>de</strong>t.<br />
Empfehlenswert: Ein historischer Rundgang durch die Stadt<br />
Anfahrt:<br />
Der Grünsfel<strong>de</strong>r Bahnhof liegt an <strong>de</strong>r Bahnlinie Stuttgart-<br />
Würzburg. Mit <strong>de</strong>m PKW fahren sie auf <strong>de</strong>r A81 bis zur Ausfahrt<br />
Tauberbischofsheim, von dort weiter in Richtung Lauda-<br />
Königshofen. Nach einem Kilometer führt sie ein Hinweisschild<br />
über ein Gewerbegebiet in das 5 km entfernte Grünsfeld.<br />
In Grünsfeld beginnen Sie am besten ihren Rundgang am Parkplatz<br />
gegenüber <strong>de</strong>m Gasthaus „Zum Jägerhaus“ in <strong>de</strong>r Leuchtenberger<br />
Straße 19 am Ortsausgang in Richtung Zimmern.<br />
Vor sich sehen Sie jetzt die schräg gestellten, massigen Schichten<br />
<strong>de</strong>s unteren Muschelkalks und darüber die teilweise restaurierten<br />
Reste <strong>de</strong>s ehemaligen Schlosses. Wenn Sie näher an die Gesteinsschichten<br />
herangehen, können Sie im linken Teil <strong>de</strong>r Felswand<br />
mehrere „Störungen“ im Schichtverlauf erkennen. Hier kam es<br />
durch Erdbeben o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Ereignisse zu Rutschungen o<strong>de</strong>r Verschiebungen<br />
<strong>de</strong>r Gesteinsschichten.<br />
Auf <strong>de</strong>r linken Seite führt eine Steintreppe zum Schloss hinauf.<br />
Oben angekommen führt Sie <strong>de</strong>r Weg zunächst durch <strong>de</strong>n<br />
Schlosshof vorbei an <strong>de</strong>n ehemaligen Stallungen und <strong>de</strong>r Zehntscheune<br />
und danach über die Schlossstrasse zum früheren Amtshaus.<br />
Der Fachwer<strong>kb</strong>au beherbergt heute das städtische Museum.<br />
Über die Stadtverwaltung Grünsfeld (Info: 09346 92110 o<strong>de</strong>r:<br />
www.gruensfeld.<strong>de</strong>) können Sie die jeweiligen Öffnungszeiten <strong>de</strong>s<br />
Museums erfahren und ggf. auch eine separate Führung durch<br />
fachkundige Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Kulturvereins Grünsfeld organisieren.<br />
Im hinteren Teil <strong>de</strong>s Gelän<strong>de</strong>s befin<strong>de</strong>t sich eine Steinmetzwerkstatt.<br />
Pensionierte Steinmetze führen hier insbeson<strong>de</strong>re<br />
auch Schulklassen in die Kunst <strong>de</strong>s Steinhandwerks ein.<br />
Der 75 m hohe Kirchturm weist Ihnen <strong>de</strong>n Weg zur Stadtkirche,<br />
in <strong>de</strong>r sich neben an<strong>de</strong>ren mittelalterlichen Grabsteinen auch das<br />
Riemenschnei<strong>de</strong>r-Grabmal <strong>de</strong>r Dorothea von Rieneck befin<strong>de</strong>t.<br />
58
Eine Schülerin bearbeitet einen Rohling in <strong>de</strong>r Steinmetzwerkstatt<br />
<strong>de</strong>s Steinmetzmuseums<br />
59
Danach führt sie ihr Weg vom Hauptportal aus nach links zum<br />
renovierten mittelalterlichen Rathaus <strong>de</strong>r Stadt. Während <strong>de</strong>r normalen<br />
Öffnungszeiten können sie auch über die Steintreppe einen<br />
Blick in das Innere <strong>de</strong>s Rathauses werfen.<br />
Zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Gasthäusern gegenüber <strong>de</strong>m Rathaus führt<br />
<strong>de</strong>r „Schwibbogen“ hinab zur Stadtbrunnenanlage. Über die Bauerngasse<br />
erreichen Sie wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Parkplatz o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Bahnhof.<br />
….und weiter nach Hausen und Krensheim<br />
Mit <strong>de</strong>m Auto (o<strong>de</strong>r auch zu Fuß) können Sie dann über die<br />
Leuchtenbergstrasse und die Hauptstrasse am Rathaus vorbei in<br />
das zwei km entfernte Grünsfeldhausen fahren. Hier erwartet Sie<br />
die um 1200 vermutlich von Kreuzfahrern erbaute achteckige<br />
Achatius-Kapelle. Alte Chroniken erwähnen immer wie<strong>de</strong>r Hochwasser<br />
nach Starknie<strong>de</strong>rschlägen, die die Kapelle regelrecht im<br />
Schlamm versinken ließen, zuletzt 1911, wie eine Hochwassermarke<br />
im Innern <strong>de</strong>r Kirche anzeigt. Durch die starken Rodungen im<br />
Mittelalter und die Bewirtschaftung <strong>de</strong>r Hänge durch Weinbauflächen<br />
wur<strong>de</strong> die Erosion beson<strong>de</strong>rs begünstigt. Mehrm<strong>als</strong> wur<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Eingang nach oben verlegt, bis dann schließlich zu Beginn <strong>de</strong>s<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rts eine Mauer die Kirche schützte. Auf <strong>de</strong>r Westseite<br />
<strong>de</strong>r Ringmauer tritt <strong>de</strong>nnoch immer wie<strong>de</strong>r Wasser aus <strong>de</strong>n<br />
Mauerfugen aus. Hier stauen wasserundurchlässige Schichten <strong>de</strong>s<br />
mittleren Muschelkalks das Grundwasser auf. Die in <strong>de</strong>r Nähe<br />
gefassten Quellen versorgen die umliegen<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n mit<br />
Trinkwasser.<br />
Über Paimar führt <strong>de</strong>r Weg in das gut 100 m höher liegen<strong>de</strong><br />
Krensheim mit seinen zahlreichen, meist aufgelassenen Steinbrüchen<br />
im oberen Muschelkalk. Viele steinerne Häuser im Ort und<br />
viele Kirchen in <strong>de</strong>r Umgebung und im gesamten Taubertal sind<br />
aus <strong>de</strong>n Qua<strong>de</strong>rkalken dieser Steinbrüche erbaut. Mit etwas Glück<br />
fin<strong>de</strong>t man hier auch einige Fossilien aus <strong>de</strong>m ehemaligen Muschelkalkmeer.<br />
Über Grünsfeld und Distelhausen führt <strong>de</strong>r Weg<br />
wie<strong>de</strong>r zurück ins Taubertal.<br />
60
Literaturangaben/Quellen:<br />
-Archive: Stadtarchiv u. Pfarrarchiv Grünsfeld, Staatsarchive<br />
Würzburg und Wertheim.<br />
-Archäologische Denkmäler in Ba<strong>de</strong>n-Württemberg HG: Lan<strong>de</strong>svermessungsamt<br />
Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Stuttgart 1990<br />
-Geologische Karte von Ba<strong>de</strong>n-Württemberg 1:25 000, Blatt 6324<br />
mit Erläuterungen, Lan<strong>de</strong>samt für Geologie , Rohstoffe und Bergbau,<br />
Freiburg i.Br. 2005, Bezug über: www.lgrb.uni-freiburg.<strong>de</strong><br />
-Geotouristische Karte von Ba<strong>de</strong>n-Württemberg 1:200 000, Nordblatt<br />
mit ausführlichen Erläuterungen, Lan<strong>de</strong>samt für Geologie ,<br />
Rohstoffe und Bergbau, Freiburg i. Br. 2005, Bezug über:<br />
www.lgrb.uni-freiburg.<strong>de</strong><br />
-Müller-Beck, Hansjürgen u.a.: Urgeschichte in Ba<strong>de</strong>n-Württemberg;<br />
Theiss-Verlag Stuttgart 1983<br />
-Weiß, Elmar: Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Grünsfeld, HG: Stadtverwaltung<br />
Grünsfeld, Verlag Fränkische Nachrichten, Tauberbischofsheim<br />
1981<br />
-Weiß, Elmar: Das Rathaus in Grünsfeld ; Verlag Fränkische<br />
Nachrichten, Tauberbischofsheim 1979<br />
-Wohlfarth, Jürgen u.a.: Bauernkriegslandschaft Tauber-Franken;<br />
HG: Traum-a-Land e.V. , Tauberbischofsheim 1995<br />
Zimmermann, Wilhelm: Der große <strong>de</strong>utsche Bauernkrieg, Parkland-Verlag<br />
Köln 1999<br />
Internetadressen/Tipps für <strong>de</strong>n Unterricht:<br />
Speziell für <strong>de</strong>n Unterricht fin<strong>de</strong>n Sie unter http://www.projekte<strong>regional</strong>.<strong>de</strong><br />
pädagogische Materialien zu verschie<strong>de</strong>nen Themen<br />
<strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Ba<strong>de</strong>n-Württemberg. Im Herbst 2011 wird auch<br />
ein Modul zu Grünsfeld mit Arbeitsblättern und einer Stadtrallye<br />
für Schüler eingestellt.<br />
Zum gleichen Themenbereich fin<strong>de</strong>t im Schuljahr 2011/12 über<br />
das Schulamt Künzelsau folgen<strong>de</strong> halbtägige Fortbildungsexkursion<br />
statt.<br />
(Anmeldung für Lehrer o<strong>de</strong>r sonstige Interessenten unter<br />
segeritz@t-online.<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Tel: 09343 4535):<br />
61
Spuren <strong>de</strong>r Vergangenheit im Taubertal:<br />
„Versteinerte“ Geschichte am Beispiel von Grünsfeld<br />
Vorgesehenes Programm:<br />
Felshang am Grünsfel<strong>de</strong>r Schloss: Lesen im Buch <strong>de</strong>r<br />
Erdgeschichte<br />
(Muschelkalkmeer, Erdbeben, Korallenriffe, Sturmfluten..)<br />
Steinmetzwerkstatt : Lernwerkstatt für Schüler (Technik<br />
<strong>de</strong>r Steinbearbeitung)<br />
Die Oktogonkapelle in Grünsfeldhausen erzählt ihre<br />
wechselvolle Geschichte: Quellheiligtum <strong>de</strong>r Kelten,<br />
Kreuzzüge, mittelalterliche Rodungen, Hochwasserkatastophen,<br />
Flussumleitungen, Kaisermanöver<br />
Auf <strong>de</strong>r Homepage <strong>de</strong>r Stadt Grünsfeld<br />
http://www.gruensfeld.<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n Sie neben vielen Informationen<br />
einen Stadtplan und Bil<strong>de</strong>rgalerien zur Stadt Grünsfeld und ihren<br />
Stadtteilen.<br />
62
Sandra Vöhringer<br />
Markgröningen – eine Stadt im Mittelalter<br />
Didaktische Vorüberlegungen<br />
„Ritter“, „Burgen“, „Hexen“, das waren die ersten Antworten auf<br />
die Frage, was meinen Schülern zu <strong>de</strong>m Stichwort „Mittelalter“ in<br />
<strong>de</strong>n Sinn kommt. Ich habe natürlich nicht ernsthaft erwartet, dass<br />
hier die mittelalterliche Stadt genannt wer<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>. Das Mittelalter<br />
ist ein abstrakter Begriff, die zeitliche Einordnung fällt <strong>de</strong>n<br />
Schülern schwer. „Das ist sehr lange her“. Das Leben in einer<br />
Stän<strong>de</strong>gesellschaft? Schwer vorstellbar. Um <strong>de</strong>n Zugang zu erleichtern<br />
ist es wichtig, Verbindungen herzustellen zwischen dam<strong>als</strong><br />
und heute, vor allem aber auch, <strong>de</strong>n Ansatz im Erfahrungsbereich<br />
<strong>de</strong>r Schüler zu suchen. Und dieser wird - auch heute noch - von<br />
<strong>de</strong>r <strong>regional</strong>en Umgebung (mit-)geprägt. Eine geschichtsträchtige<br />
Ortschaft in <strong>de</strong>r Zeugnisse <strong>de</strong>s Mittelalters existieren, wirkt immer<br />
noch anschaulicher <strong>als</strong> eine Seite im Schulbuch o<strong>de</strong>r im Internet.<br />
Der Bildungsplan <strong>de</strong>r Re<strong>als</strong>chule for<strong>de</strong>rt zu<strong>de</strong>m, dass durch die<br />
Anleitung zum sachgerechten Umgang mit historischen Zeugnissen<br />
<strong>de</strong>r näheren Heimat auf allen Stufen das Interesse an <strong>de</strong>r Lokal-<br />
und Regionalgeschichte geweckt und die Verbun<strong>de</strong>nheit mit<br />
<strong>de</strong>m Heimatraum und seinen Menschen gefestigt wer<strong>de</strong>n sollen. 1<br />
Bei <strong>de</strong>r Beschäftigung mit <strong>de</strong>m Mittelalter sollen die Schüler anhand<br />
ausgewählter Beispiele das Leben und Arbeiten von Menschen<br />
im Mittelalter beschreiben und im Hinblick auf die damaligen<br />
Umstän<strong>de</strong> würdigen können und dabei natürlich auch die gesellschaftlichen<br />
und herrschaftsmäßigen Verän<strong>de</strong>rungen in Bezug<br />
auf die Gegenwart aufzeigen. 2<br />
Mögliche Umsetzung im Unterricht<br />
Einstieg:<br />
Impuls: „Stell Dir vor, du näherst dich <strong>als</strong> Reisen<strong>de</strong>/r im Mittelalter<br />
einer Stadt. Beschreibe <strong>de</strong>ine Eindrücke. Was siehst du? Was<br />
1 Bildungsplan Re<strong>als</strong>chule (2004), S. 105<br />
2 ebd., S. 106 f.<br />
63
iechst du? Wer begegnet dir? Wie fühlt es sich an, in die Stadt zu<br />
kommen?“<br />
Erarbeitung:<br />
Nach <strong>de</strong>n ersten Äußerungen <strong>de</strong>r Schüler (die an <strong>de</strong>r Tafel festgehalten<br />
wer<strong>de</strong>n), überlegen sich die Mädchen und Jungen Fragen<br />
zum Thema, die an einer Stellwand gesammelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Einige Schülerfragen<br />
- Wie hat es früher in einer Stadt ausgesehen?<br />
- Wie viele Menschen lebten dort?<br />
- Gab es Schulen?<br />
- Gingen alle Kin<strong>de</strong>r in die Schule?<br />
- Was waren das für Menschen, was haben sie gearbeitet?<br />
- Wer war „Chef“ <strong>de</strong>r Stadt?<br />
- Warum gab es in <strong>de</strong>r Stadt Mauern?<br />
- Sahen alle Städte gleich aus?<br />
- Welche Städte hier in <strong>de</strong>r Umgebung sind ganz alt?<br />
Erwartungsgemäß interessieren sich die Schüler in erster Linie für<br />
die Menschen und <strong>de</strong>ren Alltag in <strong>de</strong>r Vergangenheit. Von Lehrerseite<br />
wer<strong>de</strong>n Fragen ergänzt, die eher „technischer“ Natur sind.<br />
Einige Lehrerfragen<br />
- Warum sie<strong>de</strong>lten an manchen Orten Menschen an, an an<strong>de</strong>ren nicht?<br />
- Hatten diese Orte Gemeinsamkeiten?<br />
- Warum wur<strong>de</strong>n aus manchen Siedlungen Städte?<br />
- Welche Aufgaben haben die folgen<strong>de</strong>n Bestandteile erfüllt? Brunnen,<br />
Stadtmauer, Burg, Marktplatz, Stadttor, Kirche, Bürgerhäuser,<br />
Friedhof, Rathaus, Brücke<br />
Informationsbeschaffung:<br />
Wenn es um die Frage <strong>de</strong>r Informations- und Materialbeschaffung<br />
geht, wird meist an erster Stelle das Internet erwähnt. Auch die<br />
Bücherei taucht – bei Schülern <strong>de</strong>r sechsten Klasse - weit vorne<br />
auf. Viele Schüler haben in <strong>de</strong>r Grundschule o<strong>de</strong>r zu Beginn <strong>de</strong>r<br />
weiterführen<strong>de</strong>n Schulen bereits eine Stadtführung erlebt, ein Stadtmuseum<br />
o<strong>de</strong>r das Rathaus besucht. Diese außerschulischen Lernorte<br />
64
wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong>o auch genannt. Das (Stadt-)Archiv dagegen ist <strong>de</strong>n meisten<br />
Mädchen und Jungen in <strong>de</strong>r 6. Klasse noch fremd.<br />
Für <strong>de</strong>n Fall, dass die Schulstadt zu „jung“ ist, erhalten die Schüler<br />
<strong>de</strong>n Auftrag, nach <strong>de</strong>n Spuren einer mittelalterlichen Stadt in ihrer<br />
näheren Umgebung zu suchen. Obwohl sich die Kin<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r<br />
Grundschule intensiv mit ihrem Heimatraum auseinan<strong>de</strong>rsetzen 3<br />
ist ihnen übrigens oft nicht bewusst, dass sie in (<strong>de</strong>r Nähe) einer<br />
Gemein<strong>de</strong> leben, die durchaus <strong>als</strong> Beispiel einer mittelalterlichen<br />
Stadt in <strong>de</strong>n Geschichtsbüchern auftauchen könnte.<br />
In meinem Fall brachte sich ein Schüler mit einem Beitrag ein. Er<br />
berichtete darüber, dass sein Vater <strong>als</strong> Schüler En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1980er<br />
Jahre die Stadt Markgröningen intensiv unter die Lupe genommen<br />
hatte. Dam<strong>als</strong> erarbeitete eine siebte Schulklasse <strong>de</strong>r Re<strong>als</strong>chule<br />
Markgröningen über die Dauer eines Schuljahres mit ihrer Geschichtslehrerin<br />
Frau Schabet einen Beitrag („Markgröningen –<br />
eine Stadt im Mittelalter“) für eine Broschüre mit <strong>de</strong>m Titel „Meine<br />
Heimat, mein Kreis“. Meine Schüler wollten unbedingt etwas<br />
über diese Arbeit erfahren und herausfin<strong>de</strong>n, „ob die Schüler sich<br />
dam<strong>als</strong> genauso gut informieren konnten – die hatten doch noch<br />
gar kein Internet“. Obwohl Markgröningen nicht ihre Schulstadt<br />
ist, bestan<strong>de</strong>n die Mädchen und Jungen darauf, sich mit eben dieser<br />
Stadt zu beschäftigen. Mit Hilfe <strong>de</strong>r Arbeit von Frau Schabet<br />
und eines fünfzehn Jahre später erschienenen Stadtführers (siehe<br />
Literaturangabe) begaben sich die Schüler auf Spurensuche. Sie<br />
wollten möglichst selbständig Markgröningen erkun<strong>de</strong>n. Die Schüler<br />
gingen in Gruppen <strong>de</strong>n vorhan<strong>de</strong>nen Informationen nach. Dabei<br />
war auch ihnen Frau Schabet behilflich, die nach wie vor <strong>als</strong><br />
Lehrerin an einer Re<strong>als</strong>chule unterrichtet.<br />
Durchführung:<br />
Die Schüler bearbeiteten in Gruppen die folgen<strong>de</strong>n Themen:<br />
- Die Gründung von Markgröningen<br />
- Wer lebte in <strong>de</strong>r Stadt?<br />
- Verwaltung <strong>de</strong>r Stadt / Steuern<br />
3 Bildungsplan Grundschule (2004), S. 101 f.<br />
65
- Verschie<strong>de</strong>ne Gebäu<strong>de</strong> (hier teilte sich die Gruppe in mehrere Untergruppen<br />
auf)<br />
[Anmerkung: Ich zeige hier nur einen Teil <strong>de</strong>r Schülerarbeiten, da ihr ursprünglicher<br />
Umfang <strong>de</strong>n Rahmen dieses Beitrages sprengen wür<strong>de</strong>.]<br />
Ergebnisse:<br />
Die Gründung von Markgröningen<br />
Markgröningen wur<strong>de</strong> zum ersten Mal in einer Urkun<strong>de</strong> von 779<br />
unter <strong>de</strong>m Namen „Gruoninga“ erwähnt. Der amtliche Beiname<br />
„Mark“ <strong>de</strong>utet auf die nahe Markungsgrenze zwischen <strong>de</strong>m Alemannischen<br />
und <strong>de</strong>m Fränkischen hin. Markgröningen war schon<br />
immer Marktort und wur<strong>de</strong> im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt zur staufischen<br />
Königspfalz ausersehen. Damit bekam es militärische Be<strong>de</strong>utung.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> für <strong>de</strong>n König eine Reichsburg gebaut,<br />
die durch eine Mauer und einen Graben von <strong>de</strong>r Stadt getrennt<br />
war. Markgröningen wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Wahl zur Königspfalz zum Sitz<br />
eines staufischen Burgmanns, <strong>de</strong>r eine Rente bezog und damit die<br />
Pflicht hatte, das Königsgut zu verwalten. Im Krieg musste er <strong>de</strong>m<br />
König „Mannen stellen“. Die Aufsicht über die spätere Reichsstadt<br />
übernahm ein Landvogt, <strong>de</strong>ssen Aufgabe es war, mit <strong>de</strong>n einflussreichen<br />
Geschlechtern (Patrizier) die Jahressteuer zu verabre<strong>de</strong>n,<br />
die an <strong>de</strong>n König abgeführt wer<strong>de</strong>n musste.<br />
1240: Kaiser Friedrich II. erhebt Markgröningen zur freien Reichsstadt.<br />
1252: Graf Hermann von Grieningen wird mit Burg und Stadt<br />
belehnt.<br />
1336: Markgröningen wird an <strong>de</strong>n Grafen Ulrich von Württemberg<br />
verkauft und verliert <strong>de</strong>n Titel „Freie Reichsstadt“.<br />
Der Vorgang <strong>de</strong>r Stadtgründung lief folgen<strong>de</strong>rmaßen ab: Feldvermesser<br />
steckten im Auftrag <strong>de</strong>s Königs das Land ab, Bauern mussten<br />
das Land ro<strong>de</strong>n und die meisten <strong>de</strong>r aus Holz gebauten Häuser<br />
wur<strong>de</strong>n nach einer Vorbereitung durch Zimmerleute in Nachbarschaftshilfe<br />
aufgestellt. Oft brachte ein neuer Einwohner sein<br />
Haus, das er schon an<strong>de</strong>rswo besaß, in Teilen zerlegt mit, um es in<br />
<strong>de</strong>r neuen Stadt wie<strong>de</strong>r aufzubauen.<br />
66
Die Stadt war planmäßig angelegt und bestand aus Hofstätten,<br />
Marktplatz, Kirche und <strong>de</strong>r Stadtmauer, die von <strong>de</strong>r Burg aus die<br />
Stadt umschloss. Die Mauer bestand aus einem steinernen Mauerring<br />
mit vier Tortürmen: <strong>de</strong>m Oberen Tor, <strong>de</strong>m Unteren Tor, <strong>de</strong>m<br />
Esslinger Tor und <strong>de</strong>m Ostertor. Von <strong>de</strong>r Burg aus, neben <strong>de</strong>r sich<br />
die Zehntscheuer befin<strong>de</strong>t, führten zwei Gassen – die Kirchgasse<br />
und die Ostergasse – zum Marktplatz. Dort stehen noch heute das<br />
alte Rathaus, die ehemalige Schäferherberge „Zur Krone“ und am<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marktplatzes die Stadtkirche. Die Gassen sind eng und<br />
mit hohen stattlichen Häusern bebaut.<br />
Wer lebte in <strong>de</strong>r Stadt?<br />
Zu <strong>de</strong>n Bürgern Markgröningens gehörten Grundbesitzer, Gewerbetreiben<strong>de</strong><br />
und Bauern, die Betriebe wie Mühlen, Schmie<strong>de</strong>n,<br />
Küfereien, Wirtshäuser, Backöfen und Höfe bewirtschafteten. Sie<br />
alle bezahlten Steuern, während die Geistlichen und die Ritter, die<br />
im Gefolge <strong>de</strong>s Burggrafen in die Stadt kamen, um Waffendienst<br />
zu leisten, keine Steuern bezahlen mussten. Da Markgröningen<br />
einst <strong>als</strong> geschlossenes Bauerndorf zur Stadt wur<strong>de</strong>, ist es nicht<br />
verwun<strong>de</strong>rlich, dass innerhalb <strong>de</strong>r Stadt viele Bauern ihren landwirtschaftlichen<br />
Betrieb hatten. Auch viele Handwerker waren<br />
gezwungen, sich noch nebenbei selbst zu versorgen. Die Handwerker<br />
schlossen sich in Zünften zusammen und hatten innerhalb<br />
<strong>de</strong>r Stadt ihre Zunftrechte und Pflichten. Noch heute sind in<br />
Markgröningen Spuren <strong>de</strong>r Zünfte zu ent<strong>de</strong>cken. Zunftwappen<br />
befin<strong>de</strong>n sich neben <strong>de</strong>m Rathausgang und einige Namen <strong>de</strong>r Gassen<br />
weisen auf die Pflicht hin, sich in einer Gasse anzusie<strong>de</strong>ln (u.a.<br />
Gerbergasse, Küfergasse).<br />
Wie wur<strong>de</strong> die Stadt verwaltet?<br />
Es bil<strong>de</strong>ten sich bald zwei Schichten heraus: Die obere, die die<br />
Führung und Verwaltung <strong>de</strong>r Stadt übernahm und die untere: das<br />
waren die Handwerker, die sich in <strong>de</strong>n Zünften zusammenschlossen.<br />
Der königliche Beamte bestimmte die zur Stadtregierung befähigten<br />
Familien. Man nannte sie Patrizier. Aus ihrer Mitte wur-<br />
67
<strong>de</strong>n die zwölf Richter bestimmt. Diese bil<strong>de</strong>ten unter <strong>de</strong>m Vorsitz<br />
<strong>de</strong>s Schultheißen die Stadtverwaltung.<br />
Der wachsen<strong>de</strong> Bevölkerungszuzug in die Stadt führte zu intensiverer<br />
Bebauung und einer engeren Stellung <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>. Viele<br />
Häuser in Markgröningen weisen <strong>de</strong>shalb eine „Kragenbildung“<br />
auf, die zur Vergrößerung <strong>de</strong>r oberen Wohnfläche dient (siehe<br />
Abb. 5).<br />
Ein Lagerbuch <strong>de</strong>r Stadt, in <strong>de</strong>m auch Vorschriften für die Bürger<br />
nie<strong>de</strong>rgeschrieben wur<strong>de</strong>n, enthielt eine Bauvorschrift und eine<br />
Mistordnung. Die Mistordnung von 1618 mit einem Umfang von<br />
elf Seiten schrieb je<strong>de</strong>m Bürger vor, wie hoch und breit sein Misthaufen<br />
sein durfte. Die Bauordnung von eineinhalb Seiten lässt<br />
dagegen <strong>de</strong>n Schluss zu, dass zu diesem Zeitpunkt die Bebauung in<br />
<strong>de</strong>r Stadt weitgehend abgeschlossen sein musste.<br />
Wer zahlte Steuern?<br />
Die Jahressteuer an <strong>de</strong>n Stadtherrn – in Markgröningen war es <strong>de</strong>r<br />
König - wur<strong>de</strong> auf die Bürger umgelegt. Nach einer Urkun<strong>de</strong> von<br />
1448 zahlten <strong>de</strong>mnach 388 Einwohner und 81 Dienstboten Steuern.<br />
An die Stadt wur<strong>de</strong>n <strong>als</strong>o ähnliche Dienste und Abgaben geleistet<br />
wie vorher an die ehemaligen Herrschaften. Um z.B. <strong>de</strong>n<br />
Han<strong>de</strong>l- und Gewerbetreiben<strong>de</strong>n eine Barsteuer auferlegen zu<br />
können, wur<strong>de</strong>n sie zur Burggemeinschaft zusammengeschlossen<br />
(Bürgerschaft). Im Esslinger Stadtrecht von 1280 wur<strong>de</strong> festgelegt:<br />
„Bürger ist, wer Jahr und Tag in <strong>de</strong>r Stadt sitzt, Steuern zahlt und<br />
Wachdienst tut.“ [Anmerkung von Fr. Schabet: Markgröningen verband<br />
seit Beginn <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts mit Esslingen ein gegenseitiges Schutzbündnis.]<br />
Verschie<strong>de</strong>ne Gebäu<strong>de</strong><br />
Das Rathaus<br />
Das Markgröninger Rathaus gehört zu <strong>de</strong>n schönsten Fachwer<strong>kb</strong>auten<br />
Süd<strong>de</strong>utschlands. Es wur<strong>de</strong> 1440/41 errichtet und das<br />
Holz, das für das Fachwerk verbraucht wur<strong>de</strong>, hätte für 45 normale<br />
Fachwerkhäuser gereicht. In <strong>de</strong>n drei Stockwerken wur<strong>de</strong> Eichenholz,<br />
in <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Bühnenraumstockwerken wur<strong>de</strong> Na<strong>de</strong>l-<br />
68
holz verarbeitet. Die Verstrebungen zwischen <strong>de</strong>n Säulen sind so<br />
angebracht, dass sie aussehen wie ein Mann, <strong>de</strong>r eine Last stemmt.<br />
Deshalb nennt man diese Bauweise auch „<strong>de</strong>r Schwäbische<br />
Mann“. Das Haus ruht auf 54 eichenen Trägersäulen, die zu Anfang<br />
einen offenen Laubengang im Erdgeschoss bil<strong>de</strong>ten. Hier<br />
verkauften die Bäcker ihr Brot und die Metzger ihr Fleisch. Eine<br />
Freitreppe führte in die oberen Stockwerke. Im ersten Stockwerk<br />
befand sich eine große Halle, in <strong>de</strong>r Wolle und an<strong>de</strong>re Waren zum<br />
Kauf angeboten wur<strong>de</strong>n. Die große und die kleine Ratsstube befan<strong>de</strong>n<br />
sich im zweiten Stock. Sie dienten auch <strong>als</strong> Gerichtssaal.<br />
Vor <strong>de</strong>m heutigen Eingangstor befand sich das Waaghäusle, in<br />
<strong>de</strong>m Waren gewogen und Salz in Bechern vermessen wur<strong>de</strong>.<br />
Das Rathaus von Markgröningen<br />
Die Stadtkirche – Bartholomäuskirche<br />
Markgröningen hat eine Stadtkirche, die im Mittelalter auch an<strong>de</strong>re<br />
Aufgaben hatte. In manchen Städten wur<strong>de</strong>n die Kirchen zu Anfang<br />
noch <strong>als</strong> Versammlungshaus und Warenlager benutzt. Dies<br />
war wahrscheinlich auch in Markgröningen üblich. Später wur<strong>de</strong>n<br />
69
die Kirchen für die reichen Bürger zum Spiegel ihres Wohlstan<strong>de</strong>s:<br />
Man stiftete Altäre, wertvolle Glasfenster und an<strong>de</strong>re wertvolle<br />
Dinge. Die Zweiturmfassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Markgröninger Kirche hatte über<br />
die Jahrhun<strong>de</strong>rte eine beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung. Während <strong>de</strong>r rechte<br />
Turm <strong>de</strong>r Kirche <strong>als</strong> Glockenturm, später <strong>als</strong> Uhrturm diente, war<br />
<strong>de</strong>r linke Turm schon immer im Besitz <strong>de</strong>r Stadt. Er war <strong>de</strong>r<br />
Wach- und Signalturm und hatte eine große Be<strong>de</strong>utung im Alltagsleben<br />
<strong>de</strong>r Bürger. Der Türmer war eine <strong>de</strong>r wichtigsten Personen.<br />
Er musste im Kriege die Menschen rechtzeitig vor Soldaten warnen<br />
o<strong>de</strong>r einen Brandherd schnell bestimmen. Der Türmer hatte<br />
die Aufgabe, nach je<strong>de</strong>r Stun<strong>de</strong> die Kirchenglocken nachzuschlagen,<br />
d.h. mit einem Seilzug wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m Turmzimmer eine kleine<br />
Glocke nach je<strong>de</strong>m Schlag <strong>de</strong>r Kirchenglocke „nachgeschlagen“.<br />
Damit zeigte <strong>de</strong>r Türmer an, dass er Wache hielt und die<br />
Kirchenglocken richtig schlugen. Der geringe Lohn eines Türmers<br />
machte es notwendig, noch an<strong>de</strong>re bezahlte Tätigkeiten auszuüben.<br />
Die Familienmitglie<strong>de</strong>r mussten auch helfen, z.B. Wasser in<br />
<strong>de</strong>n Turm herauftragen. Bei Gewitter mussten die Kin<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m<br />
Turm mit Ausschau halten, um Blitzeinschläge und Feuerausbruch<br />
sofort <strong>de</strong>m Bürger weiterzumel<strong>de</strong>n. Wenn es <strong>als</strong>o in Markgröningen<br />
brannte, dann musste <strong>de</strong>r Türmer die Kirchenglocken läuten.<br />
War das Feuer außerhalb <strong>de</strong>r Stadt, so läutete er nur die Feuerglocke,<br />
die im Dachgiebel <strong>de</strong>s Wohnturms befestigt war. [Anmerkung<br />
von Fr. Schabet: Der so genannte Rote Hahn war neben <strong>de</strong>r Pest und <strong>de</strong>m<br />
Krieg die größte Angst <strong>de</strong>r Bürger, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Funkenflug <strong>de</strong>r offenen Herdfeuer<br />
konnte die Dächer aus Stroh und Schin<strong>de</strong>ln sofort entzün<strong>de</strong>n. Viele Städte<br />
wur<strong>de</strong>n auf diese Weise vernichtet.]<br />
Das Spital<br />
Das Heilig-Geist-Spital gehörte zu <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n zum Heilig-Geist, <strong>de</strong>ssen<br />
Haupthaus in Sassia zu Rom war. Das Spital war eine Stiftung<br />
eines Unbekannten und wur<strong>de</strong> 1297 eingeweiht. Die Bettelmönche<br />
<strong>de</strong>r Laienbru<strong>de</strong>rschaften lebten nach <strong>de</strong>n Regeln Augustins. Das<br />
Spital wur<strong>de</strong> von einem Spitalmeister verwaltet. Mit ihm waren<br />
zwischen 9 und 16 Spitalbrü<strong>de</strong>r ansässig. Die Brü<strong>de</strong>r lebten wie<br />
eine Familie zusammen, trugen schwarze Kleidung und eine<br />
70
Bartholomäuskirche; um 1260 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Kirche an<br />
Stelle eines romanischen Vorgängerbaus begonnen; <strong>de</strong>r Chor<br />
wur<strong>de</strong> 1472 von Aberlin Jörg gebaut.<br />
Tonsur. Die Aufgaben <strong>de</strong>r Mönche reichten vom Sammeln von<br />
Almosen – 1347 bekam das Spital die Diözese Konstanz <strong>als</strong> Almosenbezirk<br />
zugewiesen – über die Betreuung von Pfarreien in <strong>de</strong>r<br />
näheren Umgebung bis zum Spitaldienst. Das Spital war <strong>de</strong>r größte<br />
Arbeitgeber Markgröningens. Es beschäftigte Knechte, Mäg<strong>de</strong> und<br />
Tagelöhner im Stall, auf <strong>de</strong>m Feld und im Spitalgebäu<strong>de</strong>. Zur Erntezeit<br />
beschäftigte das Spital auch zusätzlich Frauen und Kin<strong>de</strong>r,<br />
die neben <strong>de</strong>n Männern <strong>als</strong> Tagelöhner mitarbeiteten. Die Haupteinnahmen<br />
<strong>de</strong>s Spit<strong>als</strong> kamen aus Zehntrechten von 34 Orten <strong>de</strong>r<br />
näheren und weiteren Umgebung, aus <strong>de</strong>m Eigenanbau, aus <strong>de</strong>n<br />
Zinsen <strong>de</strong>r Spitalmühle und aus <strong>de</strong>r Ziegelei. Hinzu kamen Erlöse<br />
aus <strong>de</strong>n Verkäufen von Vieh und Fleisch sowie <strong>de</strong>m Entgelt für<br />
Dienstleistungen z.B. für die Arbeit <strong>de</strong>r ausgeliehenen Pfer<strong>de</strong>.<br />
Auch die Schweine <strong>de</strong>s Spit<strong>als</strong> wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Bürgern gefüttert.<br />
71
Sie waren mit Glöckchen gekennzeichnet und liefen frei durch die<br />
Stadt. Der frühe Reichtum <strong>de</strong>s Spit<strong>als</strong> spiegelt sich auch darin wie<strong>de</strong>r,<br />
dass das Spital Glasfenster besaß zu einer Zeit, in <strong>de</strong>r es noch<br />
nicht üblich war. Der gesamte Besitz war nach einer päpstlichen<br />
Verfügung steuerfrei (1493). Erst 1572 wur<strong>de</strong> es zu einer angemessenen<br />
Beisteuer zu <strong>de</strong>n städtischen Baulasten an <strong>de</strong>r Stadtmauer,<br />
<strong>de</strong>m Stadtpflaster, <strong>de</strong>n Brücke, Brunnen, Stegen und Wegen herangezogen.<br />
1543 wur<strong>de</strong> die letzte heilige Messe gehalten, danach<br />
wur<strong>de</strong> das Spital von unbekannten Tätern zerstört.<br />
[Anmerkung von Fr. Schabet: In einer besiegelten Urkun<strong>de</strong> (Bulle) von 1295<br />
würdigte Bonifatius VIII. die hohen Verdienste <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns in Krankenpflege<br />
und Kin<strong>de</strong>rerziehung: „Ihr nehmt Arme und Kranke gütig auf, behan<strong>de</strong>lt sie<br />
menschlich, nehmt ausgesetzte Kin<strong>de</strong>r an, stellt aus eigenen Mitteln geeignete<br />
Personen zu ihrer Erziehung an und sorgt freigiebig für ihren Unterhalt.“]<br />
Das Heilig-Geist-Spital<br />
72
Das „Küchenbüchlin“<br />
Das Kochbuch <strong>de</strong>s Spit<strong>als</strong> von 1532 gibt einen Einblick in das<br />
Leben <strong>de</strong>r Mönche und <strong>de</strong>r Bürger. Danach gab es in <strong>de</strong>r Regel<br />
zwei Mahlzeiten am Tag. Dreimal in <strong>de</strong>r Woche gab es für die<br />
Mönche, die Kranken und für das Gesin<strong>de</strong> „Haberbrei“ <strong>als</strong> dritten<br />
Gang. Um neun Uhr gab es das „Frühessen“, das unserem Mittagessen<br />
entspricht (Brühe, Fleisch, Sauerkraut, Sulz, Kuchen und<br />
zweierlei Wein). Zum Aben<strong>de</strong>ssen gab es ebenso Brühe, Fleisch,<br />
Mus o<strong>de</strong>r Reis, Braten, Sulz und Wein. Das Gesin<strong>de</strong>, die Armen<br />
und Kranken bekamen im Wesentlichen die gleichen Mahlzeiten.<br />
Bemerkenswerte Gebäu<strong>de</strong><br />
Das älteste Fachwerkhaus Markgröningens wur<strong>de</strong> 1347 <strong>als</strong> giebelständiges<br />
Haus errichtet. Im Erdgeschoss befan<strong>de</strong>n sich Stall und<br />
Wirtschaftsflächen, im ersten Stock die Wohnräume. Der Anbau<br />
mit traufständigem Dach und die Verkürzung <strong>de</strong>s Giebels wur<strong>de</strong>n<br />
um 1670 vorgenommen.<br />
Ackerbürgerhaus<br />
73
Dieses Haus wur<strong>de</strong> 1427/1428 errichtet und ist das zweitälteste<br />
Haus am Markt. Seine Stockwerke konnten aufgrund <strong>de</strong>r freistehen<strong>de</strong>n<br />
Lage nach zwei Seiten auskragen. Bereits um 1700 wur<strong>de</strong><br />
hier nachweislich die Kronen-Wirtschaft betrieben.<br />
Gasthaus Krone<br />
Das Schriftband über <strong>de</strong>m gotischen Türeingang lautet: „0 GOT<br />
GNAd VNS“, die Jahreszahl 1476 ist teils in römischen (DD: 500<br />
+ 500 = 1000) teils in gotischen Ziffern (die Vier <strong>als</strong> halbe Acht,<br />
die Sieben liegend) geschrieben. Die Wappen sind wohl nicht ein<strong>de</strong>utig<br />
zu bestimmen.<br />
74
Bürgerhaus<br />
Abschließen<strong>de</strong> Bemerkungen<br />
Im Gegensatz zu <strong>de</strong>r Klasse aus <strong>de</strong>n 1980er Jahren haben wir kein<br />
ganzes Schuljahr an diesem Thema gearbeitet. Dennoch waren die<br />
Mädchen und Jungen einige Wochen mit <strong>de</strong>r Spurensuche beschäftigt.<br />
Natürlich kann man nun die Frage stellen, ob dieser<br />
Aufwand verhältnismäßig ist. Ich fin<strong>de</strong> ja. Schließlich geht es neben<br />
<strong>de</strong>m Erwerb von Fachkompetenz auch um das Erlangen von<br />
personaler, sozialer und methodischer Kompetenz. Die Schüler<br />
haben oft eigenverantwortlich geplant und gearbeitet und wür<strong>de</strong>n<br />
in <strong>de</strong>r Zukunft gerne einen historischen Stadtspaziergang anbieten.<br />
Die Organisation und Durchführung umfasst sicherlich alle Kompetenzbereiche.<br />
Am En<strong>de</strong> steht aber vor allem die Einsicht darin, dass das Internet<br />
<strong>de</strong>n Mädchen und Jungen heute keine neuen Erkenntnisse gebracht<br />
hat. Sie mussten anerkennen, dass ihre „Vorgänger“ durch<br />
die vielen Stun<strong>de</strong>n intensiver Forschungsarbeit im Archiv letztendlich<br />
in einigen Bereichen sogar einen <strong>de</strong>utlichen Informationsvorsprung<br />
hatten.<br />
Bleibt zu hoffen, dass diese Einsicht noch lange anhält!<br />
75
Verwen<strong>de</strong>te Literatur<br />
1) Markgröningen – Ein Stadtrundgang. Stadt Markgröningen.<br />
2) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba<strong>de</strong>n-<br />
Württemberg. Bildungsplan für die Grundschule, 2004.<br />
3) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba<strong>de</strong>n-<br />
Württemberg. Bildungsplan für die Re<strong>als</strong>chule, 2004.<br />
4) Schabet, Elke mit <strong>de</strong>r Klasse 7b <strong>de</strong>r Re<strong>als</strong>chule Markgröningen:<br />
Markgröningen – eine Stadt im Mittelalter, in: Meine<br />
Heimat – mein Kreis – Landkreis Ludwigsburg. Kreissparkasse<br />
Ludwigsburg (Hrsg.), 1988.<br />
5) Schad, Petra: Markgröningen – ein Stadtführer, 1. Auflage<br />
2003.<br />
Wimpelinhof, 1599 errichtet; daneben das Obere Tor, das jüngste<br />
und einzig erhaltene <strong>de</strong>r vier Stadttore<br />
76
Die Geschichte Markgröningens blieb spannend. Einen Eindruck<br />
davon kann man im Museum Wimpelinhof erhalten. In <strong>de</strong>r ständigen<br />
Ausstellung bil<strong>de</strong>t übrigens die Geschichte <strong>de</strong>s Markgröninger<br />
Schäferlaufs einen Schwerpunkt.<br />
Weitere Informationen fin<strong>de</strong>n sich auf <strong>de</strong>r Homepage von Markgröningen.<br />
www.markgroeningen.<strong>de</strong><br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragte <strong>de</strong>s Ministeriums für Kultus, Jugend<br />
und Sport Ba<strong>de</strong>n-Württemberg im Regierungsbezirk<br />
Stuttgart, Schuljahr 2011/2012:<br />
Dr. Kerstin Arnold, Gymnasium Unterrie<strong>de</strong>n, Rudolf-Harbig-Str.<br />
40, 71069 Sin<strong>de</strong>lfingen, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragte für <strong>de</strong>n Kreis<br />
Böblingen<br />
Ingrid Berger-Wagenh<strong>als</strong>, Johann-Philipp-Palm-Schule, Grabenstr.<br />
10, 73614 Schorndorf, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragte für <strong>de</strong>n Rems-<br />
Murr-Kreis<br />
Matthias Fellinghauer, Gymnasium Plochingen, Tannenstr. 47,<br />
73207 Plochingen, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n Kreis Esslingen<br />
Steffen Gassert, Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg, Rossäckerstr.<br />
11-13, 74189 Weinsberg, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n<br />
Kreis Heilbronn<br />
Mignon Geisinger, Rechberg-Gymnasium, Dr. Frey-Str. 38, 73072<br />
Donzdorf, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n Ostalbkreis<br />
77
Eva Lienert, Re<strong>als</strong>chule Mutlangen, Forststr. 6, 73557 Mutlangen,<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragte für <strong>de</strong>n Ostalbkreis<br />
Wilhelm Lienert, Uhlandschule, Wolf-Hirth-Str. 22, 73529 Schwäbisch<br />
Gmünd, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n Ostalbkreis<br />
Alok Sinha, Eschbachgymnasium Stuttgart-Freiberg, Adalbert-<br />
Stifter-Str. 40, 70437 Stuttgart<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n Kreis Stuttgart<br />
Hubert Segeritz, Martin-Schleyer-Gymnasium, Becksteinerstr. 80,<br />
97922 Lauda-Königshofen, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n<br />
Kreis Tauberbischofsheim<br />
Sandra Vöhringer, Re<strong>als</strong>chule Schwieberdingen, Herrenwiesenweg<br />
35, 71701 Schwieberdingen, Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragte für <strong>de</strong>n Kreis<br />
Ludwigsburg<br />
Dr. Otto Windmüller (Koordinator), Kaufmännische Schule<br />
Schwäbisch Hall, Max-Eyth-Str. 13-25, 74523 Schwäbisch Hall,<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>beauftragter für <strong>de</strong>n Kreis Schwäbisch Hall<br />
Dem Arbeitskreis gehören außer<strong>de</strong>m an:<br />
Ulrich Maier, Erlenäcker 1, 74245 Löwenstein<br />
Dr. Wolfgang Wulz, Goldberg-Gymnasium Sin<strong>de</strong>lfingen, Frankenstraße<br />
15, 71065 Sin<strong>de</strong>lfingen<br />
Maria Würfel, Warbeckweg 8, 73525 Schwäbisch Gmünd<br />
78
Bisherige Ausgaben von PROJEKTE REGIONAL<br />
1/2006:<br />
Lan<strong>de</strong>sgeschichte und Seminarkurs/Kursstufe Gymnasium<br />
2/2007:<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>/Lan<strong>de</strong>sgeschichte in <strong>de</strong>r Lehrerausbildung<br />
3/2008:<br />
Das Eislinger Saurierprojekt. Universität, Schule, Landkreis und<br />
Gemein<strong>de</strong> erfüllen eine Ausstellung mit Leben<br />
4/2009:<br />
Schule und Archiv<br />
5/2010:<br />
Schulgeschichte im Museum und Archiv<br />
6/2011:<br />
Die Römer vor <strong>de</strong>r Haustür<br />
7/2012:<br />
Lebendiges Mittelalter<br />
Thema <strong>de</strong>s nächsten Heftes:<br />
Industrie- und Technikgeschichte<br />
Alle bisherigen Ausgaben auch <strong>als</strong> <strong>Download</strong> unter<br />
www.projekte-<strong>regional</strong>.<strong>de</strong><br />
79