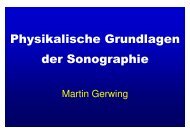Bestrahlung von Schädelbasistumoren mit Kohlenstoffionen bei der ...
Bestrahlung von Schädelbasistumoren mit Kohlenstoffionen bei der ...
Bestrahlung von Schädelbasistumoren mit Kohlenstoffionen bei der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Debus J, et al. <strong>Bestrahlung</strong> <strong>von</strong> <strong>Schädelbasistumoren</strong> <strong>bei</strong> <strong>der</strong> GSI<br />
führbarkeit dieses neuen Therapieverfahrens wurden eindeutig<br />
belegt. Die in <strong>der</strong> kurzen Phase des laufenden Projektes<br />
erzielten klinischen Ergebnisse sind als positiv zu werten.<br />
Dennoch sind die Nachsorgezeiten noch zu kurz, um die<br />
Langzeitkontrolle endgültig zu bewerten. Allerdings kann<br />
man bereits jetzt sagen, daß das schnelle radiologische und<br />
klinische Ansprechen dieser Tumoren bislang noch nicht in<br />
<strong>der</strong> Literatur beschrieben werden konnte. Wir erwarten daher,<br />
daß auch die lokale Langzeitkontrollrate höher als nach<br />
konventioneller Photonenbestrahlung ist. Eine Schwerionenbestrahlung<br />
kann so<strong>mit</strong> eine Dosiseskalation im Zielvolumen<br />
<strong>bei</strong> gleichzeitig optimierter Dosiskonformation <strong>bei</strong><br />
bestimmten Indikationen erreichen. In <strong>der</strong> Literatur wird<br />
ausführlich diskutiert, dass dies <strong>mit</strong> größter Wahrscheinlichkeit<br />
zu einer Erhöhung <strong>der</strong> Heilungsraten, zu einer Verlängerung<br />
<strong>der</strong> Überlebenszeiten und zu einer Verbesserung <strong>der</strong><br />
Lebensqualität <strong>der</strong> Patienten führt [3, 18]. Zwei medizinphysikalische<br />
Neuerungen konnten im Rahmen dieser Studie<br />
etabliert und ihre technische Durchführbarkeit und Effizienz<br />
bewiesen werden: das intensitätsmodulierte Rasterscan-<br />
Verfahren erlaubt eine Dosiskonformation an das Tumorvolumen<br />
in niemals zuvor erreichter räumlicher Präzision;<br />
durch die Online-Therapiekontrolle <strong>mit</strong>tels Positronenemissionstomographie<br />
können erstmals Lage und Intensität des<br />
Strahls im Körper des Patienten während <strong>der</strong> <strong>Bestrahlung</strong><br />
überwacht werden [5].<br />
Bei <strong>der</strong> GSI kommen <strong>Kohlenstoffionen</strong> zum Einsatz. Bei<br />
Schwerionen höherer Masse (Neon, Argon) nimmt die physikalische<br />
Selektivität kontinuierlich wie<strong>der</strong> ab. Aufgrund<br />
des steigenden linearen Energietransfers (LET) haben sie<br />
schon im Plateaubereich erhöhte RBE-Werte. Gleichzeitig<br />
tritt das Problem <strong>der</strong> Fragmentierung auf, und Bruchstücke<br />
<strong>mit</strong> größerer Reichweite erhöhen die Dosis hinter dem<br />
Bragg-Peak. Schwerionen, die die maximale biologische<br />
Wirksamkeit <strong>bei</strong> gleichzeitig höchstmöglicher physikalischer<br />
Selektivität gewährleisten, sind die <strong>Kohlenstoffionen</strong> [14,<br />
15]. Sie werden international als bester Kompromiss angesehen.<br />
Klinische Daten, die diese strahlenbiologischen Ergebnisse<br />
beweisen, fehlen allerdings bislang. Unsere klinischen<br />
Daten scheinen die strahlenbiologischen Vorhersagen zu unterstützen.<br />
Die Kapazität <strong>der</strong> Gesellschaft für Schwerionenforschung<br />
als weltweit kooperierendes Institut <strong>der</strong> physikalischen<br />
Grundlagenforschung ist für die Strahlentherapie auf etwa<br />
70 Patientenbestrahlungen pro Jahr begrenzt. Während <strong>der</strong><br />
auf fünf Jahre angelegten klinischen Studie sollen 250 bis<br />
350 Patienten am Teilchenbeschleuniger in Darmstadt bestrahlt<br />
werden. Darüber hinaus ist es notwendig, die klinische<br />
Forschung <strong>mit</strong> Ionenstrahlung intensiv voranzutreiben<br />
und in Deutschland zu etablieren. Erfor<strong>der</strong>lich ist die<br />
Durchführung klinischer Studien <strong>mit</strong> ausreichend großen<br />
Patientenzahlen, die statistisch belastbare Ergebnisse liefern.<br />
Prinzipiell sind all jene Tumoren eine potentielle Indikation<br />
für die Ionentherapie, <strong>bei</strong> denen <strong>mit</strong> <strong>der</strong> konventionellen<br />
Strahlentherapie keine befriedigenden Ergebnisse erzielt<br />
werden. Hier wären die Tumoren im Kopf-Hals-Bereich,<br />
darunter Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlentumoren,<br />
Speicheldrüsenkarzinome und Tumoren <strong>der</strong> Nasen-Rachen-<br />
Region, bestimmte Weichteilsarkome und Prostataadenokarzinome,<br />
etwa 30% <strong>der</strong> Hirn- und Rückenmarkstumoren<br />
sowie ausgewählte Bauchraumtumoren des Kindesalters zu<br />
nennen [1, 2, 7].<br />
Ein Projektvorschlag für den Bau einer klinisch genutzten<br />
Therapieanlage für Ionenstrahlung, die eng <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Radiologischen<br />
Universitätsklinik Heidelberg kooperiert und in ihrer<br />
direkten Nachbarschaft nahe dem Deutschen Krebsforschungszentrum<br />
gebaut werden soll, wurde ausgear<strong>bei</strong>tet. An<br />
ihr soll neben <strong>der</strong> <strong>Bestrahlung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Kohlenstoffionen</strong> auch die<br />
Therapie <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>er Teilchenstrahlung (Protonen, Heliumionen)<br />
möglich sein, um innerhalb <strong>der</strong> Teilchentherapie vergleichende<br />
klinische Studien durchzuführen. Die Kapazität<br />
<strong>der</strong> Anlage soll <strong>bei</strong> etwa 1 000 Patienten pro Jahr liegen.<br />
Die Investitions- und Betriebskosten einer solchen Anlage<br />
führen zu Behandlungskosten <strong>von</strong> etwa 40 000 DM pro Patient<br />
und sind <strong>mit</strong> den Kosten aufwendiger operativer und<br />
medikamentöser Therapieformen vergleichbar. Bis zum Abschluß<br />
des Baus <strong>der</strong> Anlage und den ersten Patientenbestrahlungen<br />
werden voraussichtlich fünf Jahre vergehen. Im<br />
Jahre 2004 könnte Deutschland so<strong>mit</strong> über eine Ionentherapieanlage<br />
verfügen, die eine medizinische Versorgungslücke<br />
schließen und international neue Maßstäbe setzen würde.<br />
Die Autoren möchten sich an dieser Stelle <strong>bei</strong> allen bedanken, die<br />
<strong>mit</strong> großem Engagement an <strong>der</strong> Realisierung dieses Projektes beteiligt<br />
waren. Insbeson<strong>der</strong>e den hier nicht genannten Personen und<br />
Ar<strong>bei</strong>tsgruppen <strong>der</strong> GSI, Darmstadt, des DKFZ, Heidelberg, des<br />
Forschungszentrums Rossendorf <strong>bei</strong> Dresden und <strong>der</strong> Universitätsklinik<br />
Heidelberg danken wir für die Hilfe und die gewährte institutionelle<br />
För<strong>der</strong>ung. Ermöglicht wurde das Gesamtprojekt erst durch<br />
die För<strong>der</strong>ung <strong>von</strong> Einzelforschungsvorhaben durch das Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung, die Deutsche Krebshilfe und<br />
die DFG sowie durch die Forschungsför<strong>der</strong>ung des Universitätsklinikums.<br />
Dr. Karin Henke-Wendt danken wir für die Hilfe <strong>bei</strong>m Editieren<br />
des Manuskripts.<br />
Literatur<br />
1. Castro JR, Linstadt DE, Bahary J-P, et al. Experience in charged particle<br />
irradiation of tumors of the skull base: 1977–1992. Int J Radiat Oncol Biol<br />
Phys 1994;29:647–55.<br />
2. Castro JR, Phillips TL, Prados M, et al. Neon heavy charged particle radiotherapy<br />
of glioblastoma of the brain. Int J Radiat Oncol Biol Phys<br />
1997;38:257–61.<br />
3. Catton C, O’Sullivan B, Bell R, et al. Chordoma: long-term follow-up after<br />
radical photon irradiation. Radiother Oncol 1996;41:67–70.<br />
4. Eickhoff H, Haberer T, Kraft G, et al. The GSI cancer therapy project.<br />
Strahlenther Onkol 1999;175:Suppl II:21–4.<br />
5. Enghardt W, Debus J, Haberer T, et al. The application of PET to quality<br />
assurance of heavy-ion tumor therapy. Strahlenther Onkol 1999;175:Suppl<br />
II:33–6.<br />
6. Gademann G, Schlegel W, Bürkelbach J, et al. Dreidimensionale <strong>Bestrahlung</strong>splanung<br />
– Untersuchungen zur klinischen Integration. Strahlenther<br />
Onkol 1993;169:159–67.<br />
Strahlenther Onkol 2000;176:211–6 (Nr. 5) 215