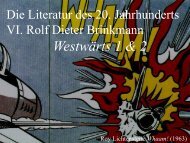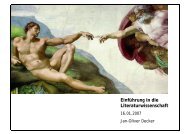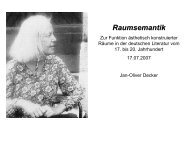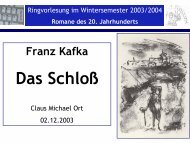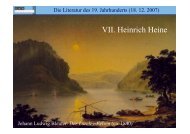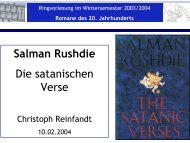IX. Editionsphilologie - Literaturwissenschaft-online
IX. Editionsphilologie - Literaturwissenschaft-online
IX. Editionsphilologie - Literaturwissenschaft-online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
1<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
0. Einleitende Bemerkungen<br />
Bedeutung der <strong>Editionsphilologie</strong>:<br />
Eine zuverlässige Ausgabe eines Textes, die in einem wissenschaftlich überprüfbaren Verfahren<br />
erstellt wurde und wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ist Voraussetzung für jede<br />
Form wissenschaftlicher Arbeit!<br />
Beispiel für Eingriffe der Herausgeber:<br />
Illustrieren lässt sich die Relevanz der <strong>Editionsphilologie</strong> am Beispiel der folgenden Passage<br />
aus dem IV. Akt von Goethes Faust II, in der Mephisto den Engelssturz beschreibt (V. 10075-<br />
10084):<br />
MEPHISTOPHELES:<br />
»Als Gott der Herr – ich weiß auch wohl, warum –<br />
Uns aus der Luft in tiefste Tiefen bannte,<br />
Da, wo, zentralisch glühend, um und um,<br />
Ein ewig Feuer flammend sich durchbrannte,<br />
Wir fanden uns bei allzu großer Hellung<br />
In sehr gedrängter, unbequemer Stellung.<br />
Die Teufel fingen sämtlich an zu husten,<br />
Von oben und von unten auszupusten;<br />
Die Hölle schwoll von Schwefelstank und -säure:<br />
Das gab ein Gas! [...]«<br />
So steht es in fast allen Ausgaben (hier in der 1949 bei Artemis besorgten Ausgabe) seit der<br />
Ausgabe letzter Hand von 1833, die von Friedrich Wilhelm Riemer und Johann Peter<br />
Eckermann besorgt wurde und lange Zeit als kanonisch galt.<br />
In Goethes Reinschrift des Faust II indes liest man die Stelle anders:<br />
»Die Teufel fingen sämtlich an zu husten,<br />
Von oben und von unten aus zu pusten.«<br />
Diese Version erscheint viel sinnvoller (die Teufel ›pusten‹ aus allen Körperöffnungen) als<br />
die bei Eckermann und Riemer dokumentierte (wie beispielsweise sollen die Teufel<br />
gleichzeitig husten und pusten?).<br />
Erklärung: Die Herausgeber haben die Stelle als anstößig empfunden und »die teuflische<br />
Unterleibsdrastik mit einem moralischen Feigenblatt« (FAZ-Rezension von Ernst Osterkamp)<br />
übermalt.<br />
Dieser Texteingriff in die Handschrift ist von fast allen späteren Herausgebern übernommen<br />
worden; nach dem Original gehen lediglich die Weimarer Ausgabe von 1888 und die von<br />
Albrecht Schöne 1994 für den Deutschen Klassiker-Verlag besorgte Ausgabe vor.<br />
Schöne greift für Faust I auf die Taschenausgabe letzter Hand von 1828, für Faust II auf<br />
Goethes Reinschrift zurück. Beide Texte passt er dezent an die moderne Orthografie an (z.B.<br />
> ; > ), belässt aber die ursprüngliche Groß- und Kleinschreibung, Getrenntund<br />
Zusammenschreibung sowie Interpunktion.<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
2<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
Wahl der Editionsmethode:<br />
Es gibt kein einheitliches Editionsverfahren; die Editionsmethode ist vielmehr abhängig vom<br />
Editionsziel und von den Editionsmöglichkeiten. Dabei dienen folgende Fragen als Leitlinie<br />
für die Wahl der Editionsmethode:<br />
Welches Ziel soll die Edition verfolgen? Was sind die Editionsmöglichkeiten? Unter welchen<br />
Bedingungen und in welcher Weise ist ein Text bezeugt? Gibt es einen einzigen Textzeugen<br />
oder mehrere? Gibt es eine einzige Fassung des Autors oder mehrere? Handelt es sich um eine<br />
autorisierte (= vom Autor gebilligte) Fassung? Oder handelt es sich um eine Abschrift eines<br />
Schreibers? In welcher Qualität ist der zu edierende Text bezeugt?<br />
Zentrales Distinktionsmerkmal: autorisiert/nicht-autorisiert<br />
Autorisierte Ausgaben = a) alle Autographen, d.h. alle vom Autor des Textes selbst<br />
angefertigten Niederschriften, b) die in seinem Auftrag und unter seiner Aufsicht hergestellten<br />
Abschriften, c) die von ihm gebilligten Drucke.<br />
Autorisierte Ausgaben sind erst seit dem 17./18. Jahrhundert die Regel. Daher hat man in der<br />
Altgermanistik und in der Neueren <strong>Literaturwissenschaft</strong> unterschiedliche Editionsmethoden<br />
entwickelt.<br />
1. Die Edition der neueren Literatur<br />
Anders als bei der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit liegen für das 18. bis<br />
20. Jahrhundert in der Regel autorisierte Fassungen vor. Es ergeben sich die folgenden<br />
Probleme:<br />
• Welche der Fassungen soll man edieren, falls mehrere Handschriften oder Drucke<br />
vorliegen?<br />
• Wie soll man die Entstehungs- und Bearbeitungsgeschichte eines Textes präsentieren und<br />
kommentieren?<br />
a) Ausgabe letzter Hand<br />
Die Ausgabe letzter Hand beruht auf dem Text, den der Autor zuletzt autorisiert hat.<br />
Dahinter verbirgt sich ein entwicklungsgeschichtlicher Ansatz, d.h. die Vorstellung, dass die<br />
letzte Textfassung zugleich die beste sei (trotzdem greifen Herausgeber zuweilen in den Text<br />
ein, siehe das obige Beispiel aus Faust II).<br />
Das Prinzip, sich auf die Ausgabe letzter Hand zu stützen, war vom 19. Jahrhundert an bis<br />
weit ins 20. Jahrhundert hinein das dominierende Editionsverfahren. Heute bevorzugt man<br />
eher:<br />
b) Ausgabe früher (erster) Hand<br />
Grundlage der Ausgabe früher (erster) Hand ist der Erstdruck oder – soweit vorhanden – die<br />
originale Druckvorlage.<br />
Beispiel: Goethes eigenhändige Reinschrift des Faust II (vgl. die Ausgabe von A. Schöne).<br />
Innerhalb dieses Ansatzes rückt man von der entwicklungsgeschichtlichen Vorstellung ab und<br />
behandelt die verschiedenen Fassungen als prinzipiell gleichwertig.<br />
c) Mischfassungen<br />
Mischfassungen sind in der deutschen Philologie selten, im angloamerikanischen Raum aber<br />
geläufig. Ziel hierbei: durch Kombination verschiedener Fassungen einen ›Idealtext‹ zu<br />
erstellen.<br />
Beispiel: Weimarer Goethe-Ausgabe<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
3<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
Entscheidender Einwand gegen diese Methode: Sie ist unhistorisch, weil sie einen Text<br />
konstituiert, den es so nie als Autortext gegeben hat.<br />
Grundsätzliches Problem: Umgang mit Fehlern<br />
Wie verfährt man mit autorisierten Fehlern, d.h. mit Fehlern, die der Autor gebilligt oder<br />
überhaupt nicht gemerkt hat? Soll man diese korrigieren oder nicht? Zwei theoretische<br />
Positionen stehen sich gegenüber: a) die Eingriffe werden auf die Korrektur offensichtlicher<br />
Druckfehler begrenzt oder b) stärkere Eingriffe werden vorgenommen.<br />
Alle Texteingriffe müssen im Apparat begründet werden.<br />
Art und Umfang der Textausgabe hängen maßgeblich vom Editionsziel ab. Daraus ergeben<br />
sich verschiedene Ausgabentypen:<br />
1) Historisch-kritische Ausgaben<br />
Historisch-kritische Ausgaben verfolgen zwei Ziele:<br />
• Bereitstellung eines zuverlässigen Textes<br />
• Darstellung der Textgenese (d.h. Textentstehung und -entwicklung)<br />
Dazu gilt es umfangreiche Aufgaben zu erledigen:<br />
1. einen kritischen Text erstellen (unter Umständen mehrere Fassungen berücksichtigen);<br />
2. alle Textzeugen (d.h. alle Handschriften und Drucke, auch die verschollenen) verzeichnen<br />
und beschreiben;<br />
3. alle Fassungen dokumentieren, sodass die Entwicklung eines Textes verständlich wird<br />
(von der Skizze zur Druckvorlage: Entstehungsstufen, Korrekturschichten etc.)<br />
= genetischer Apparat; meistens nicht in vollem Wortlaut, sondern: Variantenapparat;<br />
4. alle Dokumente wiedergeben, die für die Textentstehung und -geschichte einschlägig sind;<br />
5. die zeitgenössische Wirkungsgeschichte (d.h. zu Lebzeiten des Autors) wiedergeben;<br />
6. einen Sachkommentar liefern (d.h. historische, sprachhistorische, literarhistorische,<br />
biografische Informationen).<br />
Erstes Beispiel für eine in diesem Sinne historisch-kritische Ausgabe:<br />
die Schiller-Ausgabe von Karl Goedecke (1867ff.)<br />
Wichtig: Jeder Autor erfordert eigene Methoden!<br />
Beispiel: Hölderlin<br />
Hölderlins in den Jahren 1801-1806 entstandenes fragmentarisches Werk bildet eine<br />
besondere Herausforderung für Editoren. Vgl. hier das Gedicht Hälfte des Lebens.<br />
Das Gedicht ist erstmals in dem bei Friedrich Wilmans in Frankfurt/M. gedruckten<br />
Taschenbuch für das Jahr 1805 erschienen. Hölderlin hat es im Dezember 1803 für den<br />
Druck freigegeben. In der Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe von Friedrich Beißner (1943-1985)<br />
stellt sich das Gedicht wie folgt dar:<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
4<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
(In: Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe. Im Auftrag des Württembergischen Kultusministeriums<br />
herausgegeben von Friedrich Beißner. Bd. 2: Gedichte nach 1800. Stuttgart 1951, S. 117)<br />
Hölderlin hat das Gedicht nicht vom Anfang her geschrieben, sondern ›Spannungszustände‹<br />
zwischen verschiedenen Gedichtteilen, Satzfetzen etc. aufgebaut. So sind ›Wortlandschaften‹<br />
entstanden, deren einzelne Teile teilweise unverbunden nebeneinander stehen.<br />
Beißner hat Hölderlins Vorgehen im Kommentarteil seiner Ausgabe minutiös beschrieben<br />
und im Textteil lediglich das ›fertige‹ Gedicht abgedruckt. Demgegenüber verzichtet Dietrich<br />
Eberhardt Sattler in der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe (1975ff.) auf das vermutbar fertige<br />
Gedicht und gibt es nur im Faksimile und der Umschrift wieder (in: Friedrich Hölderlin.<br />
Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe. Historisch-kritische Ausgabe herausgegeben von D.<br />
E. Sattler. Bd. 7: Gesänge. Dokumentarischer Teil herausgegeben von D. E. Sattler.<br />
Frankfurt/M. – Basel 2000, S. 109 (Auszug)):<br />
Vorteil dieses Vorgehens: alle Schritte sind überprüfbar<br />
Nachteil: schwer lesbar<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
5<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
2) Studienausgaben<br />
Im akademischen Alltag benutzt man häufig Studienausgaben, die im Idealfall auf historischkritischen<br />
Ausgaben basieren, aber ohne die textgenetische Dokumentation auskommen.<br />
Auch die Studienausgaben bewahren die Historizität des Textes so genau wie möglich und<br />
behalten deshalb die Zeichensetzung und Rechtschreibung des Originals weitgehend bei.<br />
Auch diesen Ausgaben ist ein Kommentarteil beigefügt (in Schönes Goethe-Ausgabe allein<br />
rd. 1000 Seiten mit Erläuterungen zu Quellen, Anspielungen, Begriffen, Metrik etc.).<br />
3) Leseausgaben<br />
Leseausgaben richten sich an ein nicht-akademisches Publikum. Sie enthalten einen weniger<br />
umfangreichen Kommentar und sind in der Regel an die moderne Orthografie angepasst.<br />
2. Die Edition der älteren Literatur<br />
Die antike und mittelalterliche Literatur ist in der Regel in sehr viel späteren Abschriften<br />
überliefert, d.h., es gibt meistens keine autorisierten Fassungen!<br />
Eine der wenigen Ausnahmen ist Otfrids von Weißenburg Evangelienbuch (spätes 9. Jh.).<br />
Oftmals sind nicht nur die Originale, sondern auch die ersten Abschriften verloren gegangen,<br />
sodass uns bekannte erste Abschriften häufig erst Jahrzehnte nach dem Original entstanden<br />
sind.<br />
Beachte also: Der überlieferte Text ist in der Regel nicht der Autortext!<br />
Der vorliegende Text enthält vielmehr Abschreibefehler, vom Schreiber vorgenommene<br />
Veränderungen etc.<br />
Diese Problematik war den Autoren des Mittelalters bewusst, z.B. dem Theologen und<br />
Seelsorger Thomas Peuntner, der zu Beginn seiner Liebhabung Gottes die zukünftigen<br />
Schreiber zur Sorgfalt bei der Abschrift mahnt:<br />
»Item ist es gar kuntlichen und offenbar, das die abschreiber der pücher zu stunden ettlich<br />
wortter überhüpffen vnd nicht schreiben von eylens wegen oder von vbersehung wegen<br />
vnd besonder von vnfleißigkeit wegen. dorumb beger ich durch gots willen von den, die<br />
diß püchlein werden abschreiben, das sie es fleißiglichen allein oder mit ymant wöllen<br />
vberlesen noch dem vnd sie es haben abgeschriben, dorumb das es nicht gefelscht wird;<br />
vnd wo sie denn etwas zu vil haben geschriben, das sie das selb fein abtilgen, vnd wo sie<br />
etwas außgelassen oder vberhupft oder falsch geschrieben haben, das sie das selb erfüllen<br />
vnd rechtvertigen [...].«<br />
(neuhochdeutsch: »Es ist ganz offenkundig und bekannt, daß die Abschreiber der Bücher<br />
bisweilen das eine oder andere Wort überspringen und nicht schreiben, in der Eile oder<br />
weil sie es übersehen und vor allem weil sie faul sind. Deshalb verlange ich um Gottes<br />
Willen von denen, die dieses Büchlein abschreiben werden, daß sie es allein oder mit<br />
jemand [anderem] sorgfältig Korrektur lesen wollen, nachdem sie es abgeschrieben<br />
haben, [und zwar] darum, daß es nicht verfälscht werde. Und wo sie dann etwas zu viel<br />
geschrieben haben, mögen sie das fein ausradieren, und wo sie etwas ausgelassen oder<br />
übersprungen oder falsch geschrieben haben, mögen sie dieses ergänzen und<br />
richtigstellen.«)<br />
(Aus: Aspekte mittelhochdeutscher Literatur. Teil 1: Quellen. Auswahl und Zusammenstellung<br />
von Hannes Kästner [u.a.]. Freiburg im Breisgau 1980, S. 93)<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
6<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
Konservativ ediert werden in der Regel sakrosankte Texte (d.h. geistliche Texte). In<br />
Gebrauchsliteratur (z.B. Wörterbücher, Rechtstexte, medizinische Traktate, Kochbücher) und<br />
in die mittelalterliche deutsche Dichtung (Lieder, Heldenepen, Romane) wird hingegen oft<br />
eingegriffen. Dabei handelt es sich entweder um willentliche Änderungen durch den<br />
Redakteur oder Nachlässigkeit des Schreibers.<br />
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich häufig daraus, dass die Sprache des Schreibers nicht<br />
die Sprache des Autors ist.<br />
Beispiel: Das Ambraser Heldenbuch (eine Sammelhandschrift aus dem beginnenden<br />
16. Jahrhundert) enthält u.a. eine Erzählung des Mauricius von Craûn, die vermutlich im<br />
ersten Drittel des 13. Jahrhunderts entstanden ist.<br />
Zur Rekonstruktion des Originals muss der Text aus der frühneuhochdeutschen Fassung der<br />
Überlieferung ins Rheinfränkische (des Originals) rückübersetzt werden.<br />
! vgl. Abbildungen 7-9 in der Bilder-Galerie<br />
Frage: Wie schätzt man die Zuverlässigkeit der Abschrift ein?<br />
Im Falle des Ambraser Heldenbuchs galt dessen Schreiber Hans Ried lange Zeit als<br />
unzuverlässig, er wird heute aber als gewissenhaft eingeschätzt. Der Herausgeber Edward<br />
Schröder hält sich deshalb weitgehend an den überlieferten Text; der Herausgeber Ulrich<br />
Pretzel weicht jedoch davon ab.<br />
! vgl. Abbildungen 7-9 in der Bilder-Galerie<br />
Pretzels Editionsverfahren ist ein Beispiel für die klassische Textkritik:<br />
1) Klassische Textkritik<br />
Ziel: den verlorenen Autortext zu rekonstruieren<br />
Hauptvertreter: Karl Lachmann (1793-1851) (einer der Gründungsväter der Germanistik und<br />
Editionswissenschaft)<br />
Vorbild: Methoden der Altphilologie und Theologie<br />
Methode: aus verschiedenen Abschriften den Archetyp rekonstruieren, d.h. die gemeinsame<br />
Vorlage aller erhaltenen Handschriften<br />
Arbeitsschritte:<br />
1. Sammlung der Textzeugen (Heuristik)<br />
2. Beschreibung der Textzeugen (d.h.: Bestimmung des Alters, der Schreibsprache)<br />
3. Vergleich der Textzeugen, und zwar Wort für Wort (Kollation)<br />
4. Hierarchisierung der Textzeugen (Filiation)<br />
Gruppierung der Textzeugen: welche sind dem Archetyp näher als andere?<br />
unterscheide dabei: welches sind beweiskräftige Fehler, welches ›iterierende‹ Varianten,<br />
d.h. Varianten, die keiner gemeinsamen Quelle zu entstammen brauchen, sondern unabhängig<br />
voneinander auftreten können (z.B. die austauschbaren Varianten ›liebe‹/›minne‹)<br />
graphische Darstellung der Überlieferung: Stemma (= Stammbaum)<br />
Beispiel: Heinrich-von-München-Überlieferung<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
7<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
5. Texterstellung (Recensio)<br />
Herstellung des Archetyps = der ältesten Textstufe, die aus der Überlieferung erschließbar<br />
ist (Archetyp per definitionem nicht identisch mit Autortext, kommt diesem vermuteten<br />
Text nur am nächsten)<br />
Dabei wird auf der Basis der Leithandschrift vorgegangen, d.h. jener Handschrift, »die<br />
den Text bietet, der von allen überlieferten am ehesten und am weitestgehenden dem<br />
Dichter zuzutrauen ist« (Heinzle).<br />
Grundsatz dabei: die lectio difficilior: = die Lesart, die seltener ist und schwerer zu<br />
erklären ist, wird als die anspruchsvollere und damit als die ursprünglichere Lesart<br />
betrachtet (d.h.: dem Autor traut man die komplizierteste Lesart zu)<br />
Fehler der Leithandschrift werden mit Hilfe anderer Handschriften korrigiert<br />
(Emendation).<br />
Teilweise werden, um dem Autor noch näher zu kommen, ›Fehler‹ korrigiert, die bereits<br />
für den Archetyp anzusetzen sind, d.h. Fehler, die dem Autor nicht zugetraut werden (z.B.<br />
Metrik, Reimtechnik). Diese Eingriffe (Konjektur – von lat. coniectura: ›Mutmaßung‹,<br />
›Vermutung‹) richten sich gegen die gesamte Überlieferung (vs. Emendation: dort ist die<br />
Korrektur durch die Überlieferung gestützt).<br />
Prämissen dieses Verfahrens:<br />
• es habe einen einzigen, einheitlichen, fehlerfreien Ausgangstext gegeben<br />
• die Überlieferung verlaufe immer vertikal (d.h. immer nur aus einer Vorlage)<br />
• die Genealogie lasse sich zweifelsfrei bestimmen<br />
Kritik an diesem Verfahren:<br />
• diese idealen Voraussetzungen hat es selten gegeben<br />
• oft gibt es mehrere Vorlagen für eine Abschrift (Kontamination (= Textmischung))<br />
• die Hierarchisierung ist im Einzelnen sehr schwierig (die Fehler sind schwer<br />
einzuschätzen)<br />
• Autoren schreiben nicht fehlerfrei<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
8<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
• oft existiert keine verbindliche Originalfassung (bedenke: die Heldenepik ist ursprünglich<br />
mündlich tradiert und erst ab 1200 in verschiedenen Fassungen verschriftet worden)<br />
" Dieses Verfahren wird zunehmend als ›subjektiv‹ und der Entscheidungswillkür des<br />
Herausgebers ausgeliefert kritisiert.<br />
Heute richtet man sich eher nach folgendem Prinzip:<br />
2) Kritische Edition nach dem Leithandschriftenprinzip<br />
Das Vorgehen dieser Editionsmethode ist dasselbe, jedoch ist die Suche nach dem Autortext<br />
nicht das vorherrschende Ziel.<br />
Man vergleicht alle Textzeugen und wählt den ›besten‹ aus (nach der Qualität und dem Alter<br />
der Abschrift). Der Editionstext entsteht auf der Basis der Leithandschrift unter Einbeziehung<br />
der gesamten Überlieferung.<br />
Eingegriffen wird in der Regel nur bei sprachlich-sachlichen Unstimmigkeiten; diese<br />
Eingriffe werden deutlich markiert. Vgl. etwa die Edition Joachim Heinzles von Wolframs<br />
von Eschenbach Willehalm<br />
! vgl. Abbildungen 11 und 12 in der Bilder-Galerie<br />
3) Abdruck des relativ besten Textzeugen<br />
Hier wird der Textzeuge gewählt, der möglichst repräsentativ für die Entstehungszeit und<br />
Schreibsprache des Originals gelten kann.<br />
Editionsziel: keine partielle Rekonstruktion des Autortextes, sondern die Wiedergabe einer<br />
einzelnen historisch beglaubigten Gebrauchsfassung.<br />
Beispiel: viele Textausgaben der Reihe Deutsche Texte des Mittelalters<br />
Zuweilen liegt ein Text lediglich in unikaler Überlieferung vor. Dies betrifft die meisten<br />
frühmhd. und ahd. Texte, von denen man selten mehr als eine Abschrift besitzt.<br />
In diesem Fall bieten sich zwei andere Editionsverfahren an:<br />
4) Bereinigter Abdruck<br />
Beim bereinigten Abdruck wird auf den Anspruch einer Rekonstruktion des Originals<br />
verzichtet; stattdessen werden eine oder mehrere bezeugbare Fassungen repräsentiert, wobei<br />
nur ganz offensichtliche Fehler korrigiert werden.<br />
Beispiel: Walter Haug: Hildebrandlied (um 830-40)<br />
! vgl. Abbildungen 13 und 14 in der Bilder-Galerie<br />
5) Diplomatischer Abdruck<br />
Der diplomatische Abdruck bietet eine buchstaben- und zeichengetreue Umsetzung des<br />
Textes in moderne Buchstaben, einschließlich der Abbreviaturen, Superskripta und<br />
diakritischen Zeichen sowie der Fehler.<br />
Alle bisher vorgestellten Verfahren sind produktionsästhetisch ausgerichtet, d.h. sind auf die<br />
Wiedergewinnung des Autortextes oder zumindest einer Näherungsform gerichtet.<br />
Demgegenüber gibt es in jüngerer Zeit wirkungsästhetische Ansätze:<br />
6) Textgeschichtlich-überlieferungskritische Methode<br />
Diese Methode kombiniert die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte, d.h. gibt neben der<br />
Erstfassung die Veränderungen an, die im Laufe der Überlieferung entstanden sind.<br />
Innerhalb dieses Verfahrens werden die verschiedenen Bearbeitungsstufen nicht mehr als<br />
Hindernis, sondern als Wert an sich betrachtet.<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
9<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
Beispiel: das lateinisch-deutsche Wörterbuch (hier der Artikel »misericors – barmherzig«) der<br />
beiden Straßburger Geistlichen Fritsche Closener und Jakob Twinger von Königshofen:<br />
! vgl. Abbildung 15 in der Bilder-Galerie<br />
7) New Philology<br />
Die New Philology radikalisiert unter dem Einfluss der poststrukturalistischen Debatte über<br />
den Tod des Autors die textgeschichtlich-überlieferungskritische Methode. Sie behandelt alle<br />
Überlieferungszeugen als gleichwertig und lehnt eine Hierarchisierung der Textzeugen ab!<br />
Damit wird zugleich der Frage nach dem Autor(text) eine Absage erteilt.<br />
Prominenter Vertreter: Bernard Cerquiglini: Éloge de la variante: histoire critique de la<br />
philologie. Paris 1989.<br />
Editionstechnische Konsequenz: das gesamte Überlieferungsmaterial (im Computer)<br />
präsentieren<br />
3. Fazit<br />
• Es gibt keine verbindliche Editionsmethode.<br />
• Die Einsicht in die komplizierte Textgenese zwingt uns, den Text- und Werk-Begriff zu<br />
revidieren (sowohl in der Alt- als auch Neugermanistik): Der Text muss als dynamische<br />
Größe verstanden werden.<br />
• Jede Entstehungs- und Überlieferungsstufe hat ihre historische Legitimation. Das Werk ist<br />
die Summe dieser Textgeschichten, umfasst also alle Stufen vom Original bis zur letzten<br />
Abschrift bzw. – bei autorisierten Texten – von der Skizze zur Ausgabe letzter Hand.<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de
Einführung in die <strong>Literaturwissenschaft</strong><br />
10<br />
<strong>IX</strong>. <strong>Editionsphilologie</strong><br />
4. Literaturhinweise<br />
Grubmüller, Klaus: Edition. In: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Von<br />
Johannes Hoops, in Zusammenarbeit mit C. J. Becker [u.a.] herausgegeben von Heinrich<br />
Beck. Bd. 6. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage Berlin – New York<br />
1986, S. 447-452.<br />
Plachta, Bodo: Editionswissenschaft: eine Einführung in Methode und Praxis der Edition<br />
neuerer Texte. Stuttgart 1997.<br />
Weimar, Klaus: Edition. In: Reallexikon der deutschen <strong>Literaturwissenschaft</strong>. Neubearbeitung<br />
des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Gemeinsam mit Harald Fricke, Klaus<br />
Grubmüller und Jan-Dirk Müller herausgegeben von Klaus Weimar. Bd. 1: A-G. 3., neu<br />
bearbeitete Auflage Berlin – New York 1997, S. 414-418.<br />
http://www.literaturwissenschaft-<strong>online</strong>.de