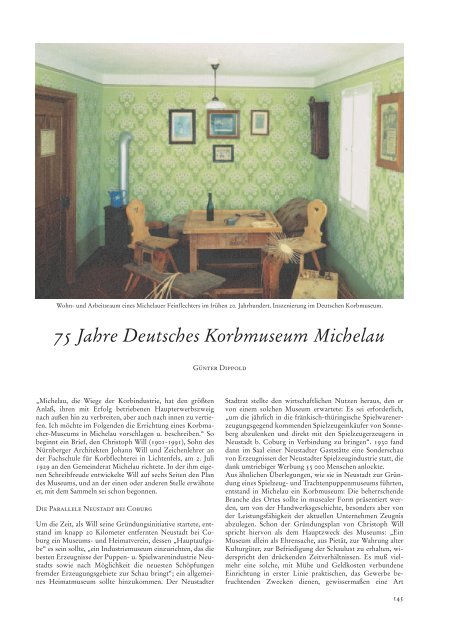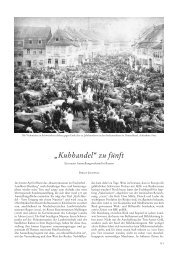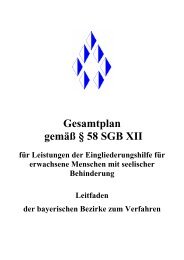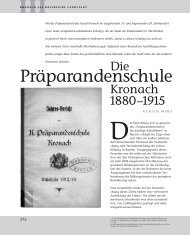75 Jahre Deutsches Korbmuseum Michelau - Bezirk Oberfranken
75 Jahre Deutsches Korbmuseum Michelau - Bezirk Oberfranken
75 Jahre Deutsches Korbmuseum Michelau - Bezirk Oberfranken
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wohn- und Arbeitsraum eines <strong>Michelau</strong>er Feinflechters im frühen 20. Jahrhundert. Inszenierung im Deutschen <strong>Korbmuseum</strong>.<br />
<strong>75</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Deutsches</strong> <strong>Korbmuseum</strong> <strong>Michelau</strong><br />
„<strong>Michelau</strong>, die Wiege der Korbindustrie, hat den größten<br />
Anlaß, ihren mit Erfolg betriebenen Haupterwerbszweig<br />
nach außen hin zu verbreiten, aber auch nach innen zu vertiefen.<br />
Ich möchte im Folgenden die Errichtung eines Korbmacher-Museums<br />
in <strong>Michelau</strong> vorschlagen u. beschreiben.“ So<br />
beginnt ein Brief, den Christoph Will (1901-1991), Sohn des<br />
Nürnberger Architekten Johann Will und Zeichenlehrer an<br />
der Fachschule für Korbflechterei in Lichtenfels, am 2. Juli<br />
1929 an den Gemeinderat <strong>Michelau</strong> richtete. In der ihm eigenen<br />
Schreibfreude entwickelte Will auf sechs Seiten den Plan<br />
des Museums, und an der einen oder anderen Stelle erwähnte<br />
er, mit dem Sammeln sei schon begonnen.<br />
Die Parallele Neustadt bei Coburg<br />
Um die Zeit, als Will seine Gründungsinitiative startete, entstand<br />
im knapp 20 Kilometer entfernten Neustadt bei Coburg<br />
ein Museums- und Heimatverein, dessen „Hauptaufgabe“<br />
es sein sollte, „ein Industriemuseum einzurichten, das die<br />
besten Erzeugnisse der Puppen- u. Spielwarenindustrie Neustadts<br />
sowie nach Möglichkeit die neuesten Schöpfungen<br />
fremder Erzeugungsgebiete zur Schau bringt“; ein allgemeines<br />
Heimatmuseum sollte hinzukommen. Der Neustadter<br />
Günter Dippold<br />
Stadtrat stellte den wirtschaftlichen Nutzen heraus, den er<br />
von einem solchen Museum erwartete: Es sei erforderlich,<br />
„um die jährlich in die fränkisch-thüringische Spielwarenerzeugungsgegend<br />
kommenden Spielzeugeinkäufer von Sonneberg<br />
abzulenken und direkt mit den Spielzeugerzeugern in<br />
Neustadt b. Coburg in Verbindung zu bringen“. 1930 fand<br />
dann im Saal einer Neustadter Gaststätte eine Sonderschau<br />
von Erzeugnissen der Neustadter Spielzeugindustrie statt, die<br />
dank umtriebiger Werbung 55 000 Menschen anlockte.<br />
Aus ähnlichen Überlegungen, wie sie in Neustadt zur Gründung<br />
eines Spielzeug- und Trachtenpuppenmuseums führten,<br />
entstand in <strong>Michelau</strong> ein <strong>Korbmuseum</strong>: Die beherrschende<br />
Branche des Ortes sollte in musealer Form präsentiert werden,<br />
um von der Handwerksgeschichte, besonders aber von<br />
der Leistungsfähigkeit der aktuellen Unternehmen Zeugnis<br />
abzulegen. Schon der Gründungsplan von Christoph Will<br />
spricht hiervon als dem Hauptzweck des Museums: „Ein<br />
Museum allein als Ehrensache, aus Pietät, zur Wahrung alter<br />
Kulturgüter, zur Befriedigung der Schaulust zu erhalten, widerspricht<br />
den drückenden Zeitverhältnissen. Es muß vielmehr<br />
eine solche, mit Mühe und Geldkosten verbundene<br />
Einrichtung in erster Linie praktischen, das Gewerbe befruchtenden<br />
Zwecken dienen, gewissermaßen eine Art<br />
145
Lehrsammlung sein. Es soll also zunächst der Korbmacher<br />
daraus Belehrung und Anregung in technischer und künstlerischer<br />
Hinsicht entnehmen können. Der fremde Einkäufer,<br />
sowie auch das verbrauchende Puplikum [!] aber soll ersehen,<br />
unter welchen Umständen ein Korbgegenstand entsteht, was<br />
... Qualität bedingt und was überhaupt an verschiedenen Verwendungsgebieten<br />
für die Korbmacherei in Frage kommt.<br />
Trotzdem soll der auch ideelle Wert eines solchen Museums<br />
nicht verleugnet werden.“<br />
Mit ihrer Zielsetzung, aber auch mit ihrer thematischen Ausrichtung<br />
waren diese beiden Museen, Neustadt und Miche-<br />
146<br />
Schauraum im Deutschen <strong>Korbmuseum</strong>, 1930er <strong>Jahre</strong>.<br />
lau, ein Novum in <strong>Oberfranken</strong>. Denn die älteren Museen<br />
waren entweder Kunstgalerien - so bestand eine staatliche<br />
Galerie in der Neuen Residenz Bamberg und eine städtische<br />
im einstigen Kloster Michelsberg zu Bamberg -, oder es handelte<br />
sich um naturhistorische bzw. naturkundliche Museen,<br />
wie sie in Bamberg, Bayreuth und Banz bestanden. Als neuer<br />
Typus waren die Heimatmuseen hinzugekommen, wie sie in<br />
<strong>Oberfranken</strong> ab 1903 entstanden: das erste im Dörfchen Hain<br />
bei Küps; es folgten 1907 Weismain, 1909 Lichtenfels, 1910<br />
Kulmbach, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch die Heimatmuseen<br />
waren primär rückwärtsgewandt, gegründet, um<br />
das, was die neue Zeit, was die Industrialisierung von der „alten“<br />
Stadt, vom „alten Dorf“ übrig gelassen hatten, zu konservieren:<br />
Zunfttruhen, Zeugnisse der Volksfrömmigkeit, alte<br />
Ortsansichten, Produkte des „alten“ Handwerks.<br />
Zunächst nahm auch manches Heimatmuseum noch ortstypische<br />
neue Produkte auf, selbst Industrieerzeugnisse, doch<br />
dies trat mehr und mehr in den Hintergrund. Insofern waren<br />
die beiden Museen in Neustadt und <strong>Michelau</strong>, die sich nicht<br />
zuletzt als Schaufenster und als Anregung für die Spielzeugmacher<br />
da, die Korbmacher hier verstanden, etwas Neues.<br />
Der Gedanke, Flechtarbeiten aus Vergangenheit und Gegenwart<br />
auszustellen, war gleichwohl nicht neu. 1896, als die <strong>Michelau</strong>er<br />
- 26 <strong>Jahre</strong> zu spät - das hundertjährige Jubiläum der<br />
Korbmacherzunft feierten, präsentierten die Organisatoren<br />
nicht nur zeitgenössische Arbeiten, sondern auch historische<br />
Körbe sowie schriftliche Zeugnisse, letztere zusammentragen<br />
von dem Korbmacher Fritz Aumüller (1849-1915), der eigene<br />
Fälschungen hinzufügte. Diese Ausstellung dauerte allerdings<br />
nur wenige Tage. Auch die Fachschule für Korbflechterei<br />
in Lichtenfels betrieb, seit sie 1910 ihr eigenes Gebäude in<br />
Christoph Will (1901-1991), Initiator des <strong>Korbmuseum</strong>s.
der Kronacher Straße bezogen hatte, eine Dauerausstellung<br />
historischer und ausländischer Vorbilder sowie aktueller<br />
Schülerarbeiten.<br />
Dass gerade in <strong>Michelau</strong> der Wunsch nach einem eigenen<br />
Museum laut wurde, liegt auf der Hand. Offiziellen Statistiken<br />
zufolge lebten 1906 in <strong>Michelau</strong> 886 Korbmacher, im<br />
Jahr 1928 sogar 1500; damit war das Dorf wohl der bedeutendste<br />
Korbmacherort in Deutschland. Innerhalb der<br />
Flechtindustrieregion im Städtedreieck Lichtenfels - Kronach<br />
- Coburg ragte <strong>Michelau</strong> nicht nur durch die Zahl der Korbmacher,<br />
sondern auch durch die Qualität der hier hergestellten<br />
Produkte heraus. Diese bewiesen, so 1931 Alfred Wilk,<br />
„besondere Feinheit der Ausführung, guten Geschmack und<br />
Phantasiereichtum der Formengebung“, und sie seien „oft<br />
wahre Musterstücke der Korbflechterei“.<br />
Die Unterbringung: vom Notbehelf zu modernen<br />
Schauräumen<br />
1929 mangelte es in <strong>Michelau</strong> an geeigneten Lokalitäten für<br />
ein <strong>Korbmuseum</strong>. Doch Christoph Will wusste Rat: „Nachdem<br />
eigentliche Museumsräume noch fehlen, kämen die<br />
Gänge des Schulhauses zur Anbringung von flachen<br />
Schaukästen vorläufig in Betracht.“ Tatsächlich wurde in einem<br />
Zimmer der <strong>Michelau</strong>er Schule für Unterrichtszwecke<br />
eine Korbausstellung eingerichtet. Das Gebäude war 1909/10<br />
errichtet worden, und in einer kurz darauf erschienenen Beschreibung<br />
heißt es, es sei „allen modernen Anforderungen<br />
entsprechend“ ausgebaut. Eine Dampfheizung sorgte für<br />
Wärme, und der mächtige Bau nahm sogar ein „Schul- und<br />
Volksbad“ auf. In den 1920er <strong>Jahre</strong>n war in einem Raum des<br />
Schulhauses auch die Gemeindeverwaltung untergebracht.<br />
Die Sammlung im Schulhaus bauten der 2. Bürgermeister und<br />
Korbindustrielle Dr. Klaus Stammberger (1889-1968), mehrere<br />
<strong>Michelau</strong>er Korbmachermeister, ferner die Lehrer der<br />
Lichtenfelser Fachschule, besonders Christoph Will, sowie<br />
der in Kulmbach lebende Grafiker Lorenz Reinhard Spitzenpfeil<br />
(1874-1945), ein gebürtiger <strong>Michelau</strong>er, im Folgenden<br />
zum Museum aus. „Unser <strong>Michelau</strong>, die Wiege der deutschen<br />
Korbwaren-Industrie, soll nun ... ein <strong>Korbmuseum</strong> erhalten“,<br />
kündigte am 6. Februar 1930 ein vom „<strong>Michelau</strong>er<br />
Volk“ unterzeichneter Artikel im Lichtenfelser Tagblatt an.<br />
Das Provisorium im Schulhaus währte nur wenige <strong>Jahre</strong>,<br />
dann entstanden Schauräume im neuen Rathaus. Dieses Gebäude<br />
war 1830 als Schulhaus errichtet worden. 1910 durch<br />
den neuen Schulbau überflüssig geworden, diente es erst als<br />
Korbmöbelfabrik, dann seit 1914 als Postamt und Dienstwohnung<br />
des Postverwalters. 1928 jedoch kündigte die Gemeinde<br />
als Eigentümerin den Mietvertrag mit der Post, um<br />
das zweistöckige Haus künftig als Rathaus zu nutzen. Nachdem<br />
1931 das neue Postamt fertiggestellt war, wurde der Plan<br />
in die Tat umgesetzt. 1934 wurde das nunmehrige Rathaus<br />
aufgestockt, um Platz für einen Sitzungssaal und Museumsräume<br />
zu gewinnen. Im neuen, zweiten Obergeschoss des<br />
Rathauses standen drei angemessene Schauräume zur Verfügung.<br />
Am 14. Oktober 1934 wurden das Rathaus und das<br />
„Oberfränkische <strong>Korbmuseum</strong>“ durch den Gauleiter des<br />
NSDAP-Gaus Bayerische Ostmark und bayerischen Kultus-<br />
Handköfferchen im Katalog eines Lichtenfelser Korbhändlers, frühes 20. Jahrhundert.<br />
147
minister Hans Schemm (1891-1935) eröffnet, der in <strong>Michelau</strong><br />
anschließend noch ein örtliches Unternehmen für Seidenbau<br />
und -verarbeitung besichtigte. Schon nach kurzem Bestehen<br />
wurde das Museum umbenannt: 1935 in „Ostmärkisches“<br />
<strong>Korbmuseum</strong> - die Bayerische Ostmark umfasste <strong>Oberfranken</strong>,<br />
die Oberpfalz und Niederbayern -, 1936 in „<strong>Deutsches</strong><br />
<strong>Korbmuseum</strong>“.<br />
Als Zweck des Museums betrachtete Christoph Will, der Spiritus<br />
Rector, nicht nur die „Bewahrung alten Kulturgutes“.<br />
Vielmehr sollte auch das unterschätzte „Korbmacherhandwerk<br />
als edles Kunsthandwerk“ bekannt gemacht werden;<br />
der Jugend sollte das Museum „Anschauungsmaterial“ bieten.<br />
Doch die eindeutige Zweckausrichtung von 1929 - Vorbildsammlung<br />
und Leistungsschau - verfocht er nun nicht<br />
mehr ausschließlich; der historische Aspekt war hinzugekommen.<br />
Seine Ziele versuchte das Museum durch die Präsentation<br />
einheimischer wie ausländischer Flechtarbeiten, von Werkzeugen<br />
und Belegen für den Korbhandel zu erreichen. Im<br />
ersten Museumsraum, dem größten, waren oberfränkische<br />
Körbe unterschiedlichsten Alters ausgestellt, im zweiten ausländische,<br />
vor allem japanische Flechtarbeiten, Leihgaben des<br />
Städtischen Völkermuseums in Frankfurt a. Main. Dessen<br />
Leiter, Professor Dr. Johannes Lehmann, hatte sich schon<br />
1932 an das „Oberfränkische <strong>Korbmuseum</strong>“ gewandt. Er<br />
verwies auf seine Forschungen über „die Schönheit der exotischen<br />
Flechtwerke“, die er als Assistent am Anthropologisch-Ethnographischen<br />
Museum Dresden begonnen habe.<br />
Das Völkermuseum Frankfurt sei „das einzige, das der<br />
Flechtkunst der aussereuropäischen Völker in einer Separat-<br />
Ausstellung zeigt“. Er empfahl dem <strong>Michelau</strong>er Museumsleiter<br />
einen Besuch, den ihm Christoph Will offenbar auch abstattete.<br />
Eine „bescheidene Werkstatt mit Werkzeug, Geräten<br />
und allerlei begonnenen und fertigen Körben“ rundete die<br />
1934 eröffnete Dauerausstellung in <strong>Michelau</strong> ab. Daneben<br />
gehörten Fotografien, Kataloge und handschriftliche Dokumente<br />
zur Sammlung.<br />
Rege Sammeltätigkeit<br />
Anfangs betreute die Gemeinde das Museum. 1935 legte sie<br />
diese Aufgabe in die Hände eines eigens gegründeten Vereins,<br />
dessen 1. Vorsitzender satzungsgemäß der Bürgermeister<br />
war; nicht die Gemeinde war also Träger, sondern der Verein.<br />
Geleitet wurde das Museum von Christoph Will und dem<br />
<strong>Michelau</strong>er Korbmöbelfabrikanten Paul Backert (1880-1964).<br />
Zumal Will pflegte den Kontakt zu diversen Institutionen,<br />
stets bemüht, Flechtwaren von historischem oder volkskundlichem<br />
Wert zu erwerben, was hin und wieder gelang. Andere<br />
Stücke versuchte er wenigstens auszuleihen, damit sie von<br />
einheimischen Korbmachern nachgebildet werden konnten.<br />
Ferner fahndete er nach wissenschaftlicher Literatur. Er korrespondierte<br />
mit dem Staatlichen Museum für Deutsche<br />
Volkskunde in Berlin, dem Botanischen Museum in Berlin-<br />
Dahlem, dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg,<br />
den Museen für Völkerkunde in Leipzig und München, dem<br />
Museum und Völkerkundlichen Institut J. F. G. Umlauff in<br />
Hamburg, dem Museo antiche Bozen, dem Heimat- und<br />
Hirtenmuseum der Stadt Hersbruck, dem Reichsbund für<br />
Deutsche Vorgeschichte, ferner mit Korbhandelsunternehmen,<br />
Korbmachern, Wirtschaftsverbänden und Antiquariaten.<br />
Noch im August des Kriegsjahres 1940 konnte sich Will über<br />
beträchtliche Zugänge freuen - dieses eine Beispiel mag genügen:<br />
afrikanische Flechtarbeiten aus dem Nachlass des Direktors<br />
der Porzellanfabrik Rosenthal in Selb, ein „Alt-Miche-<br />
148<br />
lauer Strickfäßchen“ aus Nürnberg, Wurzelgeflechte aus<br />
„entlegenen Gebirgstälern Südtirols“, eine Strohschale und<br />
ein Puppenwagen aus Wilhelmsthal im Frankenwald, eine<br />
Weidenschienenarbeit von 1790 aus Schönau bei Gotha. Da<br />
sich das Museum vorteilhaft entwickelte, erschien bereits vier<br />
<strong>Jahre</strong> nach der Eröffnung, im Herbst 1938, eine Neuaufstellung<br />
angebracht: „Schlechtere Stücke wurden durch neuerworbene,<br />
schönere und interessantere ersetzt. Die Beschriftung<br />
ist ergänzt und so gestaltet, daß nun jeder Laie ein klares<br />
Bild vom Willen der Ausstellung bekommt. ... Ein<br />
Schauschrank zeigt an Hand eines einfachen Beispiels, was es<br />
eigentlich an einem Korb alles zu sehen gibt.“ Ferner<br />
benötigte man neben den Schauräumen im Rathaus ein Depot,<br />
das 1938 in einem <strong>Michelau</strong>er Bauernhof eingerichtet<br />
wurde.<br />
Die „Zertrümmerung“ des <strong>Korbmuseum</strong>s<br />
Am 22. Juli 1943 drang der Bürgermeister darauf, dass das<br />
1938 angelegte Depot des Deutschen <strong>Korbmuseum</strong>s zugunsten<br />
einer neu zu schaffenden Wohnung geräumt werden<br />
müsse. Auch die Schauräume im Rathaus würden anderweitig<br />
benötigt. Innerhalb weniger Tage sollte der Trägerverein die<br />
Sammlung von den Ausstellungs- und Depoträumen in den<br />
angemieteten Saal eines Privatanwesens überführen. Der Protest<br />
des Museumsbetreuers Paul Backert half nicht. Der Bürgermeister<br />
berief sich auf Weisungen der Reichsregierung;<br />
überdies müssten „sehr viele Fliegergeschädigte innerhalb der<br />
Gemeinde <strong>Michelau</strong> untergebracht werden“. Er setzte die<br />
Räumung von Ausstellungszimmern und Depot durch.<br />
Backert blieb lediglich der Rücktritt von seinem Amt des<br />
stellvertretenden Vorsitzenden des Trägervereins: „Ihr<br />
Wunsch, die Zertrümerung [!] des <strong>Korbmuseum</strong>s, welches<br />
mit grosser Mühe und vielen Schwierigkeiten aufgebaut wurde,<br />
geht in Erfüllung“, beginnt sein Schreiben an den Bürgermeister.<br />
Es gilt zu bedenken, dass es seit Museumsgründung einen<br />
Wechsel im Amt des Bürgermeisters gegeben hatte: Jakob Fischer<br />
(1899-1956), ab 1929 für die NSDAP im Gemeinderat,<br />
seit 1933 dann Bürgermeister, war 1939 beurlaubt und 1940<br />
seines Amtes enthoben worden. Auf einem Betriebsausflug<br />
der Gemeinde in Volkach war es zum Streit mit Einheimischen<br />
gekommen, in dessen Verlauf der Bürgermeister den<br />
Gauleiter von Mainfranken und den Reichsführer SS beleidigt<br />
hatte. Ihm folgte 1940 Otto Fischer (1895-1967), der -<br />
wie Paul Backert durchblicken ließ - offenbar wenig Interesse<br />
am Museum hatte, der freilich auch aufgrund der einzuquartierenden<br />
Ausgebombten unter Druck stand. Das <strong>Korbmuseum</strong><br />
teilte das Schicksal zahlloser Museen, die während des<br />
Krieges geschlossen wurden. Mancherorts waren Schäden<br />
wegen ungeeigneter Lagerräume, Beschädigungen durch<br />
Menschen oder Diebstähle die Folge. Eine Wiedereröffnung<br />
ließ in den schweren Anfangsjahren nach 1945 oft jahrelang<br />
auf sich warten, manchmal sogar Jahrzehnte.<br />
Schwerer Neuanfang nach 1945<br />
Die schwierige Lage, in der sich die Kommunen als Museumsträger<br />
befanden, illustriert beispielhaft ein Schreiben des Bürgermeisters<br />
von <strong>Michelau</strong> vom 12. Mai 1948 an das Bayerische<br />
Landesamt für Denkmalpflege: „Das Deutsche <strong>Korbmuseum</strong><br />
in <strong>Michelau</strong> wurde bereits vor dem Zusammenbruch ... in einen<br />
Werkstattraum verbracht und eingepackt. Nach Kriegsende<br />
wurde es dann durch Beauftragte nochmals auf Vollständigkeit<br />
überprüft und über die einzelnen Gegenstände Listen<br />
angelegt, die zusammen mit den verpackten Kisten im Ge-
Hinweisschild auf das Deutsche <strong>Korbmuseum</strong> an der Straße Lichtenfels-Kronach, kurz nach 1935.<br />
meindelagerraum aufbewahrt werden ... Eine Unterbringung<br />
des <strong>Korbmuseum</strong>s ... in den früher hierfür zur Verfügung gestandenen<br />
Räumen des Rathauses in <strong>Michelau</strong> ist gegenwärtig<br />
noch nicht möglich, da infolge der Zwangsbewirtschaftung<br />
([Lebensmittel-]Kartenstelle, Bezugsscheinstelle, Brennstoffabteilung,<br />
Registratur) diese Räume dringend für die eigene<br />
Verwaltung (Gemeindebehörde) benötigt werden. Infolge der<br />
grossen Wohnungsnot war es bisher trotz grösster Anstrengungen<br />
nicht möglich, geeignete freie Räume irgendwoanders<br />
ausfindig zu machen. Ein Neubau scheiterte an Materialmangel<br />
und dessen Zuweisung.“<br />
Der Brief zeigt allerdings, dass die Gemeinde eine Wiederherstellung<br />
des Museums anstrebte. Die Eröffnung gelang<br />
denn auch relativ bald. In den angestammten Räumen im<br />
zweiten Obergeschoss des Rathauses wurde das Deutsche<br />
<strong>Korbmuseum</strong> am 26. November 1949 feierlich wiederbegründet.<br />
Prof. Dr. Josef Maria Ritz, der für Museen zuständige<br />
Abteilungsleiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege<br />
und nachmalige Generalkonservator, hielt den<br />
Festvortrag; der Regierungspräsident wohnte dem Festakt<br />
bei. Christoph Will hatte in enger Zusammenarbeit mit Ritz<br />
die erneute Aufstellung betreut. Er fungierte im Folgenden<br />
als nebenamtlicher Museumsleiter, auch während der Zeit<br />
von 1950 bis 1966, als er im Hauptberuf die Korbfachschule<br />
Lichtenfels leitete. Vor Ort übernahm der Korbmachermeister<br />
Konrad Schardt (1900-1985) die Betreuung, wobei das<br />
Verhältnis zwischen ihm und dem jeweiligen Museumsleiter<br />
nicht immer ungetrübt war.<br />
Das Museumsgebäude<br />
1967 zog das <strong>Korbmuseum</strong> um. Aus dem Rathaus übersiedelten<br />
die Schauräume in ein Gebäude in der nahe gelegenen<br />
Bismarckstraße. Seither nutzt das Museum ein industriegeschichtliches<br />
Denkmal ersten Ranges: das Anwesen eines<br />
Korbhändlers, dessen Bauteile zwischen dem frühen 19. Jahrhundert<br />
und den 1930er <strong>Jahre</strong>n entstanden sind.<br />
Den ältesten Trakt, das dreigeschossige Wohnhaus, errichtete<br />
1815 der Korbmachermeister Johann Georg Gagel (1767-<br />
1849), Sohn eines Häfners. Er wandte sich wie etliche seiner<br />
<strong>Michelau</strong>er Nachbarn dem Korbhandel zu, offenbar mit<br />
großem Erfolg.<br />
Sein einziger Sohn, Konrad Gagel (1819-1902), erweiterte das<br />
Haus wohl in den 1850er <strong>Jahre</strong>n um ein Lagerhaus mit Kontor<br />
und eine Waschküche. Der Gebäudekomplex legt Zeugnis<br />
ab von der Wohlhabenheit seines Besitzers: 1852 schätzte<br />
Konrad Gagel sein Vermögen auf 20 000 bis 30 000 Gulden -<br />
das Hundertfache dessen, was ein Lehrer oder ein Industriearbeiter<br />
im Jahr verdiente; über 300 Korbmacher belieferten<br />
ihn regelmäßig. 1865 gründete er, dem allgemeinen Trend folgend,<br />
eine Filiale in Coburg, wo er seit 1896 auch Rohrmöbel<br />
fabrizieren ließ. Das <strong>Michelau</strong>er Stammhaus führte von 1865<br />
an Konrads Sohn Leonhard Otto Gagel (1842-1912), der sich<br />
durch große Stiftungen und durch seinen Einsatz für die Einrichtung<br />
eines Bahnhofs dauerhaft um <strong>Michelau</strong> verdient<br />
machte. Unter ihm wurde der Geschäftstrakt seines Hauses<br />
1887 aufgestockt und erweitert.<br />
1906 verkaufte Gagel das Unternehmen an Max Christian<br />
Stölzel (1872-1939) aus Coburg, der als Großkaufmann in<br />
Südostasien gelebt hatte und aus gesundheitlichen Gründen<br />
in seine Heimat zurückgekehrt war. 1924 und 1937 ließ Stölzel<br />
zusätzliche Arbeits- und Lagerräume anbauen; sein Name<br />
steht bis heute an einer Front des Lagers. Seine Witwe führte<br />
das Unternehmen fort, bis 1952 ein Kinderwagenhersteller<br />
die Räume mietete. 1959 erwarb die Gemeinde <strong>Michelau</strong> das<br />
Anwesen von Irene Stölzel.<br />
Seit 1967 ist in den einst gewerblich genutzten Räumen das<br />
Deutsche <strong>Korbmuseum</strong> untergebracht, während der älteste<br />
Bauteil weiterhin als Wohnhaus diente. Von 1988 bis 1990<br />
ließ die Gemeinde auch diesen Trakt für museale Zwecke um-<br />
149
gestalten. Verbunden hiermit war eine grundlegende Neugestaltung<br />
des gesamten Museums. Das Konzept erarbeitete Alfred<br />
Schneider (geb. 1936), von 1973 bis 1999 Leiter der<br />
Korbfachschule Lichtenfels, der in den 1970er <strong>Jahre</strong>n nach<br />
und nach von Christoph Will die Aufgabe der Museumsleitung<br />
übernommen hatte, in engem Kontakt mit der Landesstelle<br />
für die Betreuung der nichtstaatlichen Museen in Bayern<br />
(zuständiger Referent: Dr. Walter Fuger).<br />
Seit 1990 umfasst das Museum rund 850 qm Ausstellungsfläche,<br />
verteilt auf 26 Zimmer (Bis September 1990 waren es<br />
zwölf Räume gewesen). Hinzu kommen ein Medienraum mit<br />
rund 45 Plätzen und vier Magazinräume im Dachgeschoss<br />
des Museums. Das gesamte Gebäude ist seit 1999 temperiert.<br />
Die Betreuung des Museums hatten nach dem Tod von Konrad<br />
Schardt die Eheleute Ilma und Heinrich Fischer übernommen.<br />
Angesichts der gewachsenen Bedeutung des Museums<br />
wurde zum 1. März 1990 Elisabeth Lorenz aus Hochstadt<br />
am Main, einer <strong>Michelau</strong>er Familie entstammend, als<br />
hauptamtliche Ansprechpartnerin für die Museumsbesucher<br />
angestellt. Im Februar 1992 wurde die Stelle eines hauptberuflichen<br />
Museumsleiters geschaffen; seit November 1994 bekleidet<br />
sie Dr. Bernd Wollner aus Küps bei Kronach.<br />
Ein Museumsrundgang<br />
Das <strong>Korbmuseum</strong> gliedert sich in zwei Bereiche: Das einstige<br />
Wohnhaus mit zwölf Zimmern ist vor allem den historischen<br />
Aspekten der Korbmacherei in Deutschland gewidmet; die<br />
13 ständig bestückten Räume des früheren Lager- und Werkstättentraktes<br />
befassen sich mit der Flechterei in den verschiedenen<br />
Erdteilen, mit besonderen Produkten wie Kinderwagen<br />
und Möbeln und - insbesondere- mit den wichtigsten<br />
Techniken und Erzeugnissen der Weidenflechterei.<br />
Im Erdgeschoss des Wohnhauses werden in Wort und Bild<br />
urgeschichtliche Zeugnisse für die Flechterei vorgestellt, die<br />
ja eines der ältesten Handwerke, vielleicht sogar das älteste<br />
ist, denn Werkzeug ist dafür nicht zwingend vonnöten. Freilich<br />
gibt es eine Reihe von Spezialwerkzeugen, die die Arbeit<br />
des Korbmachers erleichtern oder die für Sondertechniken<br />
erforderlich sind; sie sind in Raum 2 zu sehen. Im ersten<br />
Stock des einstigen Wohnhauses werden wichtige deutsche<br />
Flechtzentren mit ihren typischen Produkten vorgestellt: die<br />
150<br />
Museumsgebäude kurz nach<br />
der Eröffnung 1990.<br />
Küstenlandschaften mit einem groben Fischkorb und mit einem<br />
Schiffsfender, Emsdetten bei Münster mit einer Kornwanne,<br />
die Schwalm (Hessen) mit einem prächtigen Brautkorb,<br />
das Erzgebirge mit Spankörben und anderes mehr.<br />
Gesondert sind die Flechtwaren präsentiert, die die obermainische<br />
Korbmacherei im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert<br />
exportfähig gemacht und damit die Erstehung einer<br />
Korbindustrie ermöglicht haben: Feinkorbwaren. Zu deren<br />
Herstellung werden geschälte Weidenruten gespalten; durch<br />
Hobeln und Schmälern erhält man schmale, gleichmäßige<br />
Schienen als Flechtmaterial. Als jedoch die Korbmacher und<br />
die Korbhändler vom Obermain sich einen Markt erobert<br />
hatten, verlor die arbeitsaufwendige Feinflechterei an Bedeutung.<br />
Um immer wieder neue Artikel anbieten zu können,<br />
führten die Korbhändler neue Materialien ein: Rattan aus Südostasien<br />
schon um 1810, Palmblatt aus Kuba um 1850, später<br />
Esparto (ein Gras) aus Spanien und Nordafrika, Raffiabast<br />
aus Madagaskar, Sparterie (ein Holzfasergeflecht) aus<br />
Böhmen, Reisstrohzöpfe aus China, Flotten (gestärkte Textilbänder)<br />
aus verschiedenen Ländern Europas. Übrigens wurde<br />
auch die Weide zum größten Teil nicht am Obermain angebaut,<br />
sondern aus Frankreich, Schlesien, Großbritannien<br />
und Polen importiert. Es stand den Korbmachern Ende des<br />
19. und bis weit ins 20. Jahrhundert eine Vielzahl von Materialien<br />
zur Verfügung, die obendrein noch häufig miteinander<br />
kombiniert wurden. Ein Sortiment der Arbeiten aus dieser<br />
Zeit, der Blütezeit der Korbindustrie, wird im Museum ebenso<br />
gezeigt wie eine Auswahl von bebilderten Katalogen, mit<br />
deren Hilfe die Händler den Kunden ihre Ware vorstellten;<br />
größere Händler führten um 1900 bis zu 150 000 Artikel und<br />
belieferten, abgesehen von Ostasien, die ganze Welt. Den ältesten<br />
bekannten Katalog, bestehend aus großformatigen Lithographien,<br />
gab übrigens um 1850 die Firma Konrad Gagel<br />
heraus.<br />
Die Korbhändler lebten in Wohlstand; das zeigen einige Fotos<br />
von Korbhändlervillen, das demonstriert aber auch der<br />
Parkettfußboden, der sich im zweiten Stock des Museumsgebäudes<br />
erhalten hat. Ihm ist im Nachbarraum die Nachbildung<br />
der Wohn- und Arbeitsstube einer Korbmacherfamilie<br />
gegenübergestellt, die anhand von Fotografien aus dem<br />
frühen 20. Jahrhundert mit Möbeln aus <strong>Michelau</strong> und einigen<br />
Nachbardörfern inszeniert wurde. Diese Stube und die Auf-
Klopfermacher aus Neuensee<br />
beim Aufladen einer Lieferung,<br />
1950er <strong>Jahre</strong>.<br />
nahmen machen deutlich, in welch bescheidenen Verhältnissen<br />
die Korbmacher lebten. Dabei gab es aber innerhalb der<br />
Korbmacherschaft erhebliche Unterschiede. Wieviel ein<br />
Flechter verdiente, in der Regel mit seiner ganzen Familie als<br />
Hilfskräften, hing davon ab, was er herstellte. Und produziert<br />
wurde nicht überall dasselbe: Jede Familie hatte ihre<br />
Spezialitäten, und jedes Dorf hatte Schwerpunkte. So waren<br />
<strong>Michelau</strong> und Marktzeuln bekannt für ihre Feinflechterei, in<br />
Schney entstanden vor allem gröbere Ware und Handköfferchen,<br />
Neuensee war das Dorf der Klopfermacher, und in<br />
Mistelfeld bei Lichtenfels war seit 1885 die Spankorbmacherei<br />
zu Hause. Die Besonderheiten der einzelnen Orte werden<br />
im Museum an diesen und weiteren Beispielen dem Besucher<br />
vor Augen geführt. Ein kleiner Schauraum stellt die Organisationsformen<br />
und die Ausbildungsstätten der Korbmacher<br />
in Deutschland vor.<br />
Im früheren Lager-, Werkstätten- und Bürotrakt des Gebäudes<br />
erwartet den Besucher zunächst ein hoher Raum, in dem<br />
an alltäglichen Beispielen (an Papier-, Henkel- und Deckelkörben<br />
sowie an Sesseln) gezeigt wird, wie verschiedenartig<br />
sich ein und derselbe Gegenstand flechterisch gestalten lässt.<br />
Eine Bildwand macht deutlich, wie vielseitig Flechtwerk einsetzbar<br />
ist.<br />
Seit seiner Entstehung beschränkt sich das <strong>Korbmuseum</strong><br />
nicht darauf, deutsche Flechtarbeiten zu sammeln. In den<br />
einstigen Lagerräumen werden Körbe aus mehreren europäischen<br />
Ländern, aus Afrika, Amerika und Asien präsentiert,<br />
wie sie aus den unterschiedlichsten Materialien und zu den<br />
vielfältigsten Zwecken hergestellt werden.<br />
Nach dem Ausflug in die verschiedenen Erdteile kehrt der<br />
Besucher nach Deutschland zurück. Eine der bedeutendsten<br />
Branchen, in denen die Flechterei eine Rolle spielte, war im<br />
späten 19. und im 20. Jahrhundert der Kinderwagenbau.<br />
Während die Mehrzahl der Korbwaren von den Korbmachern<br />
zu Hause gefertigt wurde, entstanden Kinderwagen -<br />
wie auch Korbmöbel - in Fabriken. Zentren der Kinderwa-<br />
Titel des Katalogs des Korbhandelshauses Konrad Gagel,<br />
um 1850. Das dargestellte Gebäude dient seit 1967 teilweise,<br />
seit 1990 ganz als Museum.<br />
genindustrie bildeten die Städte Zeitz und Brandenburg; ein<br />
weiterer Schwerpunkt erwuchs nach 1945 im Raum Coburg<br />
aus der Korbindustrie. Die Entwicklungsgeschichte des Kinderwagens<br />
ist im Museum zu verfolgen: vom hochrädrigen<br />
Gefährt der Jahrhundertwende bis zum schnittigen Wagen<br />
der 1950er <strong>Jahre</strong>, der Anklänge an die damaligen Autokarosserien<br />
zeigt. Im selben Raum sind auch Spielkorbwaren ausgestellt,<br />
die vor allem um Mitwitz (Landkreis Kronach) geflochten<br />
und an Spielwarenfabrikanten in Sonneberg<br />
(Thüringen) geliefert wurden.<br />
Eine weitere wichtige Sparte der Flechterei war die Möbelfabrikation.<br />
Das Museum zeigt eine Palette von Sitzmöbeln,<br />
vom reich verzierten Sessel aus den 1860er <strong>Jahre</strong>n bis zum klar<br />
151
geschnittenen Ruhestuhl unserer Tage. Hervorzuheben sind<br />
von namhaften Architekten wie Bernhard Hoetger (1874-<br />
1949) und Egon Eiermann (1904-1970) gestaltete Sessel.<br />
Ein gesonderter Raum ist der Feinflechterei gewidmet, zumal<br />
diese Technik im späten 18. Jahrhundert die überregionale<br />
und schließlich weltweite Bedeutung der Korbmacherei am<br />
Obermain ermöglichte. Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert<br />
sind ausgestellt, aber auch moderne Körbchen, die durchweg<br />
von Lehrern der Lichtenfelser Korbfachschule stammen. Der<br />
bedeutendste Feinflechter unter ihnen war Adam Zasche<br />
(1902-1992), der bis in seine letzten Lebenstage ungemein filigrane<br />
Körbe aus Weidenschienchen flocht.<br />
Die wichtigste flechterische Technik in Franken (und in ganz<br />
Mitteleuropa) ist die geschlagene Arbeit. Dabei werden Weidenruten<br />
verarbeitet; um das Geflecht zu verdichten, benutzt<br />
der Korbmacher das Schlageisen - daher der Name „geschlagene<br />
Arbeit“. Diese Technik bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.<br />
Wäschekörbe und -truhen, Kartoffel- und<br />
Fischkörbe, die unterschiedlichsten Rückentragkörbe sind im<br />
Museum zu sehen, aber auch eine geflochtene Krankentrage.<br />
Dass die Korbmacherei kein „verstaubtes“ Handwerk ist,<br />
zeigt der letzte Raum des Museums, der einstige Packraum.<br />
Hier sind Flechtarbeiten ausgestellt, die in den letzten <strong>Jahre</strong>n,<br />
vornehmlich in der Obermainregion, entstanden sind: Stühle<br />
und Sessel, aber auch hochwertige Gebrauchskörbe. Dieser<br />
Raum demonstriert, dass die Korbmacherei in <strong>Oberfranken</strong><br />
Zukunft haben wird, sofern sie weiterhin auf gutes Material,<br />
auf solide Verarbeitung und auf modernes und zugleich traditionsbewusstes<br />
Design achtet.<br />
152<br />
Zugleich beherbergt der Packraum zusammen mit dem angrenzenden<br />
ehemaligen Kontor Sonderausstellungen, wie sie<br />
seit 1992 gezeigt werden. Verteilt über die Museumsräume<br />
führen überdies von Mai bis September ausgewählte Korbmacher<br />
samstags zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ihr Handwerk<br />
vor. Die Arbeit des Museums wird seit 1973 durch den<br />
Verein <strong>Deutsches</strong> <strong>Korbmuseum</strong> e. V. unterstützt, der über<br />
200 Mitglieder zählt.<br />
<strong>Deutsches</strong> <strong>Korbmuseum</strong> <strong>Michelau</strong><br />
Bismarckstraße 4<br />
96247 <strong>Michelau</strong> i. Ofr.<br />
Telefon: 09571 / 83548<br />
Telefax: 09571 / 9496608<br />
E-Mail: info@korbmuseum.de<br />
Homepage: www.korbmuseum.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
April bis Oktober:<br />
Dienstag bis Sonntag 10 - 16.30 Uhr<br />
November bis März:<br />
Montag bis Donnerstag 10 - 16.30 Uhr<br />
Freitag 10 - 12 Uhr<br />
Feinflechtraum im Deutschen<br />
<strong>Korbmuseum</strong>, gestaltet 1987.