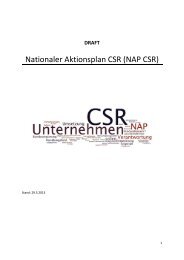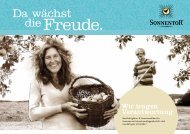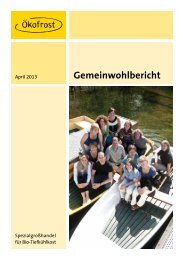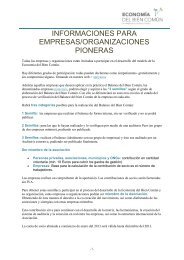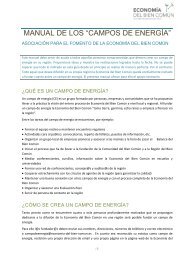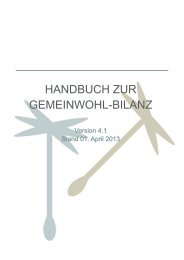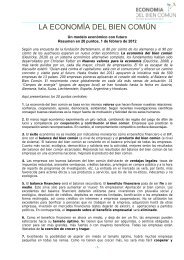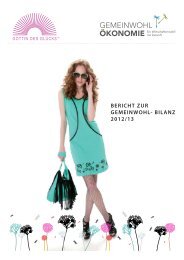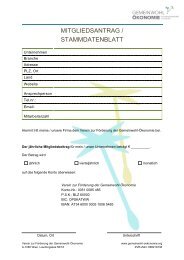Basisdokumentation - Gemeinwohl-Ökonomie
Basisdokumentation - Gemeinwohl-Ökonomie
Basisdokumentation - Gemeinwohl-Ökonomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BASISDOKUMENTE ZUR<br />
GEMEINWOHL-BILANZ<br />
Version 4.0.4<br />
vom 29. Oktober 2012<br />
(Aktualisierung der Daten für die Pressekonferenzen 2013, Gültigkeit der Matrix 4.0)
INHALT<br />
ERLÄUTERUNGEN ZUR GEMEINWOHL-MATRIX ............................................................................................... 3<br />
ERLÄUTERUNGEN DER 17 GEMEINWOHL-INDIKATOREN .............................................................................. 12<br />
A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSWESEN ..................................................................................................... 13<br />
B1 ETHISCHES FINANZMANAGEMENT ......................................................................................................... 16<br />
C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT & GLEICHSTELLUNG ..................................................................................... 18<br />
C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT ................................................................................. 21<br />
C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS DER MITARBEITERINNEN .......... 23<br />
C4 GERECHTE EINKOMMENSVERTEILUNG ................................................................................................. 25<br />
C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ ................................................................... 27<br />
D1 ETHISCHES VERKAUFEN.......................................................................................................................... 30<br />
D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN ................................................................................................... 33<br />
D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN...................................... 35<br />
D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN .................................................. 38<br />
D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN BRANCHENSTANDARDS ................................... 40<br />
E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN ..................... 42<br />
E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN ................................................................................................................ 45<br />
E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN.................................................................................... 47<br />
E4 MINIMIERUNG DER GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN EXTERNE .............................................................. 49<br />
E5 GESELLSCHAFTLICHE TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG .......................................................... 51<br />
NEGATIV-KRITERIEN ........................................................................................................................................... 54<br />
2
ERLÄUTERUNGEN ZUR<br />
GEMEINWOHL-MATRIX<br />
DIE GEMEINWOHLBILANZ – DAS HERZSTÜCK<br />
Die <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz ist das „Herzstück“ der <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong>. Sie stellt den<br />
Menschen und alle Lebewesen sowie das Gelingen der Beziehungen zwischen ihnen in den<br />
Mittelpunkt des Wirtschaftens. Sie überträgt die heute schon gültigen Beziehungs- und<br />
Verfassungswerte auf den Markt, indem sie die Wirtschaftsakteure dafür belohnt, dass sie<br />
sich human, wertschätzend, kooperativ, solidarisch, ökologisch und demokratisch verhalten<br />
und organisieren.<br />
Sie macht die Werte der Gesellschaft zu den Werten der Wirtschaft.<br />
FUNKTION DER GEMEINWOHLBILANZ<br />
Die <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz misst unternehmerischen Erfolg in der neuen Bedeutung. Die<br />
Wirtschaft soll dem <strong>Gemeinwohl</strong> dienen und auf der Unternehmensebene kann das durch<br />
die Bilanz (zusammen mit dem <strong>Gemeinwohl</strong>-Bericht) belegt werden. Der Finanzgewinn ist zu<br />
aussageschwach in Bezug auf die eigentlichen Ziele des Wirtschaftens: Schaffung von<br />
Nutzwerten, Bedürfnisbefriedigung, Sinnstiftung, Teilhabe aller, Mitbestimmung,<br />
Geschlechterdemokratie, ökologische Nachhaltigkeit, Lebensqualität.<br />
Der Finanzgewinn sagt nichts über die Mehrung des <strong>Gemeinwohl</strong>s aus. Er kann steigen,<br />
wenn die Lieferantenpreise gedrückt werden, MitarbeiterInnen trotz Gewinne entlassen<br />
werden, Steuern vermieden, Frauen diskriminiert werden oder die Umwelt ausgebeutet wird.<br />
Der Finanzgewinn wird nur in Geld gemessen und Geld kann nur Tauschwerte messen,<br />
jedoch keine Nutzwerte - deren Verfügbarmachung und Verteilung jedoch der eigentliche<br />
Zweck des Wirtschaftens ist.<br />
Finanzgewinn ist in der <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong> nur noch Mittel zum Zweck: der<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>mehrung. Finanzgewinn darf nicht mehr maximiert und nicht mehr um jeden<br />
Preis erhöht werden. Er muss dem neuen Zweck als Mittel dienen.<br />
Mit der <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz wird endlich das gemessen, was wirklich zählt. Die <strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
Matrix „schneidet“ mehrheitsfähige Grund- und Verfassungswerte – Menschenwürde,<br />
Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie – mit den<br />
Berührungsgruppen (Stakeholdern) des Unternehmens: Beschäftigte, Zulieferer, KundInnen,<br />
GeldgeberInnen, Souverän, zukünftige Generationen, Natur. Die an den Schnittstellen<br />
formulierten 17 <strong>Gemeinwohl</strong>indikatoren sollen eine Beurteilung von unternehmerischen<br />
Verhalten bzw. dessen Beitrag zum <strong>Gemeinwohl</strong> ermöglichen.<br />
Derzeit erfolgt die methodische Erfassung mittels <strong>Gemeinwohl</strong>punkte, welche für pro-aktives<br />
Verhalten bei den 17 Indikatoren vergeben werden. Mit exakten Punkten soll nicht suggeriert<br />
werden, dass eine millimetergenaue Messung des unternehmerischen <strong>Gemeinwohl</strong>beitrages<br />
möglich ist. Zielsetzung ist eine nachvollziehbare, plausible und konsistente Einschätzung,<br />
wo sich ein Unternehmen auf dem Weg zum <strong>Gemeinwohl</strong> befindet. Mit der derzeitigen Matrix<br />
stehen wir am Anfang der Entwicklung eines Messinstruments, welches regelmäßig zu<br />
evaluieren, zu präzisieren und an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen ist.<br />
3
GEMEINWOHLBERICHT, -MATRIX, -BILANZ UND -TESTAT<br />
Das Gesamtpaket des Bilanzierungsprozesses besteht aus drei Elementen: <strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
Bericht, -Bilanz und -Testat. Die „Matrix“ erfüllt pädagogische Zwecke und ist nicht<br />
Bestandteil des eigentlichen Bilanzerstellungsprozesses:<br />
Der <strong>Gemeinwohl</strong>bericht ist ein mehrseitiges Dokument eines Unternehmens, in dem es seine<br />
Aktivitäten zu jedem Indikator dokumentiert. Er gibt einen umfassenden Einblick in die<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-Aktivitäten des Unternehmens und bildet gemeinsam mit der <strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
Bilanz die Grundlage für die Auditierung.<br />
Die <strong>Gemeinwohl</strong>matrix bietet eine einseitige Übersicht über die 17 Bilanz-Indikatoren sowie<br />
die Negativkriterien und dient für die pädagogische, politische Arbeit sowie<br />
Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz ist das daraus abgeleitet Instrument, das die Unternehmen<br />
anwenden. Es handelt sich um eine Tabellenkalkulation, die mit Hilfe eines<br />
Rechenprogramms die Erstellung erleichtert und Gewichtungen automatisch vornimmt.<br />
Das Testat wird am Ende des Auditprozesses von den externen AuditorInnen ausgestellt und<br />
dokumentiert im Design der <strong>Gemeinwohl</strong>-Matrix die Punktevergabe auf einem Blick.<br />
VERGABE VON GEMEINWOHLPUNKTEN<br />
Die <strong>Gemeinwohl</strong>punkte werden für 17 messbare <strong>Gemeinwohl</strong>indikatoren vergeben, wobei<br />
Unternehmen freiwillig entscheiden, welche der Kriterien sie in welchem Maß verwirklichen.<br />
Das bedeutet, dass die Punkte nur für freiwillige Leistungen vergeben werden, die prinzipiell<br />
über den gesetzlichen Mindeststandards liegen. Die Absicht dahinter ist folgende: Heute sind<br />
die meisten Unternehmen sehr weit vom <strong>Gemeinwohl</strong>-Ideal (bestmöglicher Umwelt- und<br />
Klimaschutz, Mitbestimmung aller, Verteilungsgerechtigkeit, Geschlechtergleichheit,<br />
höchstmögliches Maß der Wahrung der Menschenwürde) entfernt. Theoretisch kann man<br />
von heute auf morgen durch die Formulierung entsprechender gesetzlicher Standards<br />
Unternehmen dazu zwingen, sich annährend „ideal“ zu verhalten. Doch genau das würde<br />
nicht gelingen, weil das Eigennutzstreben (der Egoismus) der Unternehmen so weit reicht,<br />
dass sie sich gegen höhere verbindliche Standards mit aller Macht zur Wehr setzen –<br />
zumindest im gegenwärtigen demokratischen System, in dem Profit das Ziel ist. Die<br />
Methode, höhere Standards unter Freiwilligkeit zu stellen, diese jedoch bei Erreichung<br />
rechtlich spürbar zu belohnen (über Steuern, Zölle, Zinsen, Aufträge etc.) könnte diese<br />
verfahrene Situation lösen. Zum Beispiel könnten fünf erreichbare Stufen definiert und<br />
farblich gekennzeichnet und belohnt werden, zum Beispiel durch fünf unterschiedliche<br />
Mehrwertsteuer-Klassen. z. B.:<br />
0 - 200 Punkte rot 50% MWSt<br />
201 - 400 Punkte orange 30% MWSt<br />
401 - 600 Punkte gelb 20% MWSt<br />
601 - 800 Punkte hellgrün 10% MWSt<br />
801 - 1000 Punkte grün 0% MWSt<br />
4
Durch diesen Anreiz würden sich immer mehr Unternehmen beteiligen und für diese<br />
schonende politische Umsteuerung des unternehmerischen Strebens in Richtung<br />
<strong>Gemeinwohl</strong> stark machen. Die <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz würde einen Prozess herbeiführen, der<br />
die Unternehmen beim heutigen Ist-Zustand abholt und ohne direkten Zwang „marktkonform“<br />
in Richtung Soll-Zustand lockt und lenkt.<br />
In diesem Prozess wirkt die <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz als Katalysator: Je mehr Unternehmen nach<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>kriterien wirtschaften und sich mehr und mehr den <strong>Gemeinwohl</strong>-Zielen annähern<br />
und diese erreichen, desto mehr Kriterien können aus der <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz in gesetzliche<br />
Mindeststandards umgewandelt werden und den Platz frei machen für neue oder feinere<br />
freiwillige <strong>Gemeinwohl</strong>kriterien. So bewegt sich die gesamte Unternehmenslandschaft auf<br />
dem Zeitvektor in Richtung <strong>Gemeinwohl</strong>. Das Zurückbleiben in der „alten Werte-Welt“ birgt<br />
steigende Konkursgefahr für Unternehmen, weil sie immer höhere Steuern, Zölle und Zinsen<br />
zahlen und keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen! Die PionierInnen-Unternehmen, die<br />
„<strong>Gemeinwohl</strong>maximierer“, haben es dagegen immer leichter, weil <strong>Gemeinwohl</strong>verhalten zum<br />
Erfolg führt.<br />
17 INDIKATOREN + ERLÄUTERUNGEN + HANDBUCH<br />
Nach einer anfänglichen Kriterienfülle setzt sich die Matrix/Bilanz 4.0 wie schon zuvor die<br />
Matrix/Bilanz 3.0 aus 17 Indikatoren zusammen, die auf die fünf universale Werte<br />
(Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit,<br />
demokratische Mitbestimmung & Transparenz) aufgeteilt werden.<br />
Zu jedem Kriterium gibt es eine ein- bis zweiseitige Erläuterung (ehemals „Factsheet“) mit<br />
allen wichtigen Informationen. Darüberhinaus gibt es ein umfassendes Handbuch mit vierbis<br />
zwölfseitigen Beiträgen, die umfassender die Indikatoren beleuchten.<br />
Alle Dokumente finden sich auf unserer Website unter der Rubrik Unternehmen/<br />
PionierInnen: www.gemeinwohl-oekonomie.org/unternehmen/pionier-unternehmen/<br />
MAXIMUM 1000 PUNKTE<br />
In Summe ergeben alle Kriterien maximal 1000 Punkte. Pro Kriterium können maximal 90<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>punkte erreicht werden. Die <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz wurde so entwickelt, dass sie<br />
für Unternehmen a) jeder Größe, b) jeder Branche und c) jeder Rechtsform anwendbar ist –<br />
vom EPU und gemeinnützigen Verein über den mittelständischen Familienbetrieb bis zum<br />
börsennotierten Konzern oder einer öffentlichen Universität.<br />
Das derzeit angewandte Punktbewertungsverfahren ist möglicherweise nicht die beste<br />
Methode zur Messung des <strong>Gemeinwohl</strong>s, u.a. weil es Kompensationseffekte (z.B.:<br />
Aufwiegen ökologischer Schäden durch zusätzliche soziale Maßnahmen) möglich macht,<br />
was in der Nachhaltigkeitsdiskussion kritisch hinterfragt wird. In Zukunft wollen wir diese<br />
Bedenken bei der Weiterentwicklung des Instruments berücksichtigen.<br />
Im ersten Bilanzjahr hatten die „besten“ Unternehmen zwischen 600 und 675 Punkte.<br />
In den ersten Jahren wollen wir nicht die Punktezahl in den Vordergrund stellen, weil<br />
• der Prozess und Bericht Vorrang haben vor der Bepunktung<br />
• sowohl die Indikatoren als auch die Punkteverteilung sich in den ersten Jahren noch<br />
signifikant verändern<br />
• auch der Auditprozess sich noch verfeinert und die AuditorInnen dazulernen.<br />
5
ZIELKRITERIEN: KREATIVITÄTS- UND BEWERTUNGSSPIELRAUM<br />
Die in der Matrix enthaltenen <strong>Gemeinwohl</strong>indikatoren sollen Unternehmen nicht davon<br />
abhalten, selbst Mittel und Wege zu suchen, dem <strong>Gemeinwohl</strong> zu dienen. Deshalb sollen sie<br />
sich neben der Erfüllung der einzelnen Indikatoren immer die „Globalfrage“ stellen: Wie kann<br />
ich den Wert X gegenüber der Berührungsgruppe Y am besten erfüllen und fördern? Durch<br />
das gemeinsame Suchen (lat. „com-petere“) werden laufend neue und präzisere Indikatoren,<br />
Kriterien und Beispiele gefunden. Die Matrix erleichtert diese Suche durch die Formulierung<br />
von 17 Zielindikatoren: Diese formulieren Ziele (z. B. „Innerbetriebliche Demokratie“) und<br />
geben für die konkrete Umsetzung nur Beispiele an (z. B. „Soziokratie“ in diversen<br />
Abstufungen), belassen aber die Möglichkeit, eigene, neue, gleichwertige<br />
Umsetzungsschritte zu finden. Dadurch wird den Unternehmen ein gewisser<br />
Kreativitätsspielraum belassen als auch den <strong>Gemeinwohl</strong>-AuditorInnen (s. u.) ein gewisser<br />
Bewertungsspielraum, um auf branchen- und unternehmensspezifische<br />
Rahmenbedingungen (z.B.: Umweltprobleme; unterschiedliche Produktionsstandorte und<br />
Beschaffungsmärkte) eingehen zu können. Die Bilanz gibt damit nicht „starre“ Kriterien vor,<br />
sondern erlaubt gewisses Maß an Flexibilität, damit die Unternehmen ihren Beitrag zur<br />
Weiterentwicklung der Idee leisten können. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt.<br />
ABSTUFUNGEN<br />
Die Bewertung eines Generalkriteriums erfolgt durch vier Abstufungen:<br />
Erste Schritte, Fortgeschritten, Erfahren, Vorbildlich.<br />
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(0-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Institutionalisierung<br />
„ich mache mir<br />
erste Gedanken“<br />
Erste Aktivitäten<br />
weden punktuell<br />
umgesetzt<br />
Wesentliche Aspekte<br />
werden durch<br />
institutionalisierte<br />
Prozesse geseteuert<br />
Strategie und<br />
Evaluierung<br />
Reichweite in der<br />
Unternehmensstruktur<br />
1 Standort<br />
Für einen Teil der<br />
MitarbeiterInnen gültig /<br />
sukzessive Ausweitung<br />
geplant<br />
Gültig für Großteil der<br />
MitarbeiterInnen und<br />
Standorte (besonders<br />
jene mit Risiken)<br />
Gültig für alle<br />
MitarbeiterInnen und<br />
Standorte<br />
Reichweite Produkte<br />
/ Dienstleistungen<br />
Trifft nur auf<br />
einzelne P/D zu<br />
(< 10%)<br />
Trifft auf einen<br />
signifikanten Teil der<br />
P/D zu (> 10%)<br />
Trifft auf den Großteil<br />
der P / D zu (> 50%)<br />
Trifft auf die gesamte<br />
Palette an P / D zu<br />
(> 90%)<br />
Relativer Fortschritt<br />
Leicht über<br />
Branchendurchschnitt<br />
Leicht über<br />
Branchendurch-schnitt<br />
+ positive Tendenz<br />
erkennbar<br />
klar über<br />
Branchendurchschnitt<br />
+ klare positive<br />
Tendenz<br />
Branchenführung bzw.<br />
wenn definierbar,<br />
GWÖ-Ziel erreicht<br />
Unternehmens-<br />
Kultur<br />
Erste thematische<br />
Meetings in der<br />
Geschäftsführung,<br />
erste<br />
bewusstseinsbilden<br />
de Maßnahmen<br />
Bestimmtes Verhalten<br />
wird nur dann<br />
gefordert, weil/wenn<br />
dadurch kein Nachteil<br />
für das Unternehmen<br />
etnsteht<br />
Umfassende<br />
Bemühungen und<br />
definierte Ziele,<br />
Geschäfstführung lebt<br />
Werte vor<br />
Integriert, GF lebt vor,<br />
regelmäßiger Umgang/<br />
Thematisierung des<br />
Verhaltens<br />
MESSUNG<br />
Damit jeder weitere Schritt stärker belohnt wird (10%, 30%, 60% und 100% der Punkte) und<br />
dennoch die erreichbaren Punkte einfach zu berechnen sind, ist allen Kriterien ein Vielfaches<br />
6
von 10 <strong>Gemeinwohl</strong>-Punkten zugeordnet, konkret von 20 bis 90 Punkten je Kriterium. Je<br />
zehn Punkte erzielt ein Unternehmen, das „erste Schritte“ unternimmt, somit ein Punkt<br />
(10%), ein „fortgeschrittenes“ Unternehmen drei Punkte (30%), ein „erfahrenes“ sechs<br />
Punkte (60%) und ein „vorbildliches“ Unternehmen zehn Punkte (100%).<br />
Auch dazwischen sind alle Abstufungen möglich. Die Bilanz bietet Spielraum.<br />
NEGATIV-KRITERIEN<br />
Das Problem, dass manche extrem gemeinwohlschädigenden Verhaltensweisen derzeit<br />
rechtlich legal sind, wird durch Negativ-Kriterien gelöst: Wer zum Beispiel die<br />
Menschenrechte oder ILO-Kernarbeitsnormen verletzt, feindliche Übernahmen durchführt,<br />
Atomstrom erzeugt, Gewinne in Steueroasen deklariert und dadurch Steuern minimiert,<br />
Saatgut gentechnisch manipuliert oder Großkraftwerke in ökologisch sensiblen Regionen<br />
baut, erhält zwischen 100 und 200 Minuspunkte.<br />
UNTERSCHIEDLICHE UNTERNEHMEN<br />
Um eine Versionen-Flut zu vermeiden, gibt es nur eine einzige Bilanz, die für alle<br />
Unternehmenstypen gilt: EPU, Bauernhof, Dienstleister, Familienbetrieb, Mittelständler,<br />
öffentliches Unternehmen oder Weltkonzern. Die branchenspezifischen Unterschiede und<br />
Spezifika finden sich in der jeweiligen Beschreibung und Beispielwahl für die Zielindikatoren.<br />
Das Handbuch wird Zug um Zug um branchen- und größenspezifische Beispiele und<br />
Erläuterungen erweitert werden.<br />
Nicht alle <strong>Gemeinwohl</strong>indikatoren sind für alle Unternehmen anwendbar. Dennoch können<br />
alle Unternehmen immer maximal 1000 Punkte erreichen. Unterschiede in der Zahl der<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>indikatoren werden von einem Rechenprogramm im Hintergrund ausgeglichen.<br />
Das hat den doppelten Vorteil, dass bei gleichen Indikatoren für alle Unternehmen dieselben<br />
Punktezahlen gelten und dennoch die <strong>Gemeinwohl</strong>zahl (Summenzahl aller erreichten<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>kriterien), also das Bilanzergebnis, aller Unternehmen vergleichbar bleibt.<br />
Bei der Weiterentwicklung der Matrix werden Unterschiede auf Branchenebene Zug um Zug<br />
spezifiziert, um die teilweise abstrakt formulierten Zieldindikatoren anschaulich auf<br />
wesentlichen Aspekte der einzelnen Branchen / Produkte / Dienstleistungen<br />
herunterzubrechen bzw. an deren Spezifika anzupassen. Auch regionale und<br />
größenspezifische Besonderheiten sollen in Zukunft systematisch im Handbuch<br />
dokumentiert werden, um bei einer einheitlichen Matrix und Bilanz die Berücksichtigung von<br />
Unterschieden zu gewährleisten.<br />
GEMEINWOHLFARBE FÜR KONSUMENTINNEN<br />
Um die Sichtbarkeit des <strong>Gemeinwohl</strong>erfolgs zu erhöhen, könnten fünf oder zehn<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>stufen mit ebenso vielen Farben kenntlich gemacht werden. Das hilft<br />
insbesondere den KonsumentInnen, denn die <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz scheint auf allen Produkten<br />
und Dienstleistungen auf (oder nahe) dem Strichcode. An der <strong>Gemeinwohl</strong>farbe erkennt die<br />
KonsumentIn sofort, in welcher „Liga“ das Erzeugerunternehmen spielt. In der Farbe könnte<br />
zusätzlich die <strong>Gemeinwohl</strong>zahl enthalten sein. Wer es genauer wissen will, kann mit dem<br />
Handy über den Strichcode fahren und erhält sofort die gesamte <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz online.<br />
Die <strong>Gemeinwohl</strong>bilanz ist öffentlich. Damit erfüllt die <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong> ein bisher<br />
7
uneingelöstes Versprechen der Marktwirtschaft: das nach vollständiger und symmetrischer<br />
Information aller Marktteilnehmenden.<br />
GEMEINWOHLAUDIT & GEMEINWOHLBILANZ-PRÜFERIN<br />
Wie wird die Bilanz kontrolliert? Ganz analog zur WirtschaftsprüferIn, die heute die<br />
Finanzbilanz prüft, von einer neuen freien Berufsgruppe: der <strong>Gemeinwohl</strong>-AuditorIn.<br />
Zunächst wird die Bilanz unternehmensintern erstellt und geprüft (Controlling, interne<br />
Revision) und dann zum – externen – Audit gebracht, wo die Bestätigung, das Testat, erfolgt.<br />
Erst wenn dieses vorliegt, „gilt“ die Bilanz. Im Gegensatz zur Finanzbilanz bietet die<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>bilanz zahlreiche Vorteile:<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Sie ist für alle verständlich, weil die Kriterien einfach und menschlich sind.<br />
Sie ist öffentlich und für alle einsehbar.<br />
Zahlreiche Berührungsgruppen haben ein handfestes Interesse an der Korrektheit der<br />
Bilanz, wodurch viele wachsame Augen auf der Bilanz gerichtet sind. Jeder<br />
Fälschungsversuch würde rasch auffliegen. Wenn der <strong>Gemeinwohl</strong>-AuditorIn im Falle<br />
einer (wiederholten) Bestätigung einer gefälschten Bilanz der Entzug der Berufslizenz<br />
droht, ist die Wahrscheinlichkeit von Betrug und Korruption minimal.<br />
−<br />
Unternehmen haben ein Eigeninteresse, eine möglichst hohe <strong>Gemeinwohl</strong>zahl zu<br />
erreichen, weil dadurch Vorteile locken. Dennoch ist alles „freiwillig“, weshalb es keine<br />
prüfende Behörde und keine Bürokratie benötigt: Die <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz steuert das<br />
Verhalten von Unternehmen marktkonform, ohne eine zusätzliche Regulierungsorgie<br />
auszulösen.<br />
Analog zur Trennung des Beratungsgeschäftes von der Prüfungstätigkeit bei der<br />
Finanzbilanz müssen auch das Audit und die Beratung von Unternehmen, welche die<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz erstellen, gesetzlich getrennt werden.<br />
Ferner ist denkbar, dass aufgrund der Komplexität der Materie zumindest bei größeren<br />
Unternehmen Audit-Teams Einzelpersonen ablösen. Das würde das Prüfergebnis weiter<br />
verbessern und noch unbestechlicher machen. Gegenwärtig arbeitet der sich bereits<br />
konsolidierende AkteurInnen-Kreis der AuditorInnen mit einem Doppelverfahren durch Erstund<br />
ZweitauditorIn. Außerdem gibt es periodisch Hausbesuche in den Unternehmen, analog<br />
zur periodischen Steuerprüfung von (größeren) Unternehmen.<br />
DAS REDAKTIONSTEAM<br />
Die bisherige Auswahl der Indikatoren sowie die aktuellen Versionen der Erläuterungen und<br />
des Handbuches sind der Beginn einer langen Arbeit, an der viele Menschen mit Erfahrung,<br />
Expertise und Kreativität mitwirken sollen. Das inzwischen auf acht Personen angewachsene<br />
Redaktionsteam arbeitet Anfang 2012 unverändert zu 100% ehrenamtlich, was bis auf<br />
weiteres auch so bleiben soll. Im Lauf des Jahres 2012 wollen wir das Team auf 17<br />
Personen erweitern: eine verantwortliche Redakteurin je Indikator, die wiederum ein kleines<br />
„Indikatorenteam“ um sich schart, das an den jeweiligen Indikator mit allen Unterlagen<br />
weiterentwickelt. Auf jeder Erläuterung ist diese RedakteurIn als Ansprechperson<br />
angegeben, die sich über Rückmeldungen für die weitere Bearbeitung und Verbesserung<br />
freut. Ziel des Gesamtprozesses ist nach Integration zahlreicher Meinungen und<br />
8
Erfahrungen die Mündung in einen urdemokratischen Prozess, einen Wirtschaftskonvent.<br />
Näheres dazu auch in der “Kleinen Geschichte der <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong>” auf der<br />
Webseite.<br />
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG UND WIE WEITER?<br />
Matrix 1.0: wurde von den Attac-UnternehmerInnen erstellt, sie ist in der Erstauflage des<br />
Buches „Die <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong>“ (Deuticke, 2010) veröffentlicht.<br />
Matrix 2.0: Weiterentwicklung der ersten Version bis Februar 2011 - vom Redaktionsteam<br />
nach einer ersten Feedbackwelle infolge des Symposiums „Unternehmen neu denken“ am 6.<br />
Oktober 2010. Sie war die Grundlage für die Entscheidung der ersten 60 Unternehmen, die<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz 2011 erstmals freiwillig zu erstellen. Die Kriterienanzahl betrug damals<br />
noch über 50.<br />
Matrix 3.0: wurde vom Redaktionsteam auf 18 Zielindikatoren (damals noch „Kriterien“)<br />
reduziert, nach der ersten „Berührung“ der Pionier-Unternehmen mit der Version 2.0, die<br />
versuchten, diese anzuwenden und zu rechnen. Sie war die für 2011 gültig und die erste<br />
angewandte <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz.<br />
Matrix 4.0: ist die vorliegende, die nach der Bilanzpressekonferenz am 5. Oktober 2011 auf<br />
Basis aller erfolgten Rückmeldungen erstellt wurde. Sie gilt für alle Bilanzen, die ab dem<br />
01.03.2012 für das zurückliegende Bilanzjahr eingereicht werden.<br />
Matrix 5.0 ff.: Ab sofort wird die Bilanz nur noch einmal jährlich angepasst – mehrere Jahre<br />
lang. Ziel ist, dass die Expertise und Meinungen von Tausenden von UnternehmerInnen,<br />
Privatpersonen, WissenschaftlerInnen, Organisationen und anderen AkteurInnen einfließt.<br />
Die Matrix 5.0. wird am 01. März 2013 erscheinen und ab dann gültig sein. Bis Ende Juni<br />
2013 gilt eine Übergangsfrist, in der auch auf Basis der Matrix 4.0. auditiert/ peer-evaluiert<br />
werden darf. Ab 01.07.2013 werden nur noch Bilanzen auf Basis der Matrix 5.0<br />
angenommen.<br />
Nach rund fünf Jahren soll ein demokratisch gewählter Wirtschaftskonvent aus unserer<br />
Vorarbeit ein Gesetz machen. Die dort formulierte Version wird die erste für alle<br />
Unternehmen rechtsverbindliche <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz.<br />
NEUERUNGEN DER MATRIX 4.0<br />
Bei der Verarbeitung der Rückmeldungen gab es einige wesentliche Veränderungen: Der<br />
Begriff ‚Kriterien’ wurde durch den Begriff ‚Indikatoren’ ersetzt, anstelle von ‚Kategorie’ heißt<br />
es nun ‚Kriterium’ und die im Raster verwendeten Abstufungsbezeichnungen bei den<br />
Kriterien wurden von Englisch auf Deutsch übersetzt. Statt Beginner, Improver, Achiever und<br />
Leader heisst es jetzt „erste Schritte“, „forgeschritten“, „erfahren“ und „vorbildlich“.<br />
Bei jedem Indikator ist eine Ansprechperson genannt, die ein kleines „Indikatorenteam“<br />
koordiniert, das nach bestem Wissen und Gewissen die inhaltliche Weiterentwicklung<br />
betreut. Ziel des Gesamtprozesses ist nach Integration zahlreicher Meinungen und<br />
Erfahrungen die Mündung in einen urdemokratischen Prozess in Form eines<br />
Wirtschaftskonvents.<br />
Weitere Veränderungen zur letzten Matrix sind:<br />
9
−<br />
−<br />
−<br />
Neue Punkteverteilung, je Indikator gibt es jetzt ein Vielfaches von zehn statt von bisher<br />
20 Punkten; der niedrigste Wert pro Indikator sind 30 Punkte, der höchste 90 Punkte.<br />
Erweiterung der Factsheets von einer auf bis zu zwei Seiten mit ergänzenden Fragen<br />
zur Selbsteinschätzung und ansatzweisen Erläuterungen zu unternehmensspezifischen<br />
Hintergründen – umfassender finden sich diese Ergänzungen im Handbuch.<br />
Handbuch für alle Indikatoren mit einem Umfang von vier bis zwölf Seiten und<br />
genaueren Erläuterungen und Hintergrundinformationen.<br />
− prozentuale Gewichtung der einzelnen Kriterien, damit die Selbst- und<br />
Fremdeinschätzung etwas genauer erfolgen kann.<br />
− Umfassendere <strong>Gemeinwohl</strong>-Bericht-Vorlage mit den ergänzenden Fragen zur<br />
Selbsteinschätzung und mehr Infos zur wirtschaftlichen Lage sowie dem Prozess der<br />
Erstellung.<br />
ÄNDERUNGEN IM PROZESS DER BILANZERSTELLUNG<br />
−<br />
Der Berichtszeitraum kann vom Unternehmen selbst bestimmt werden, entweder das<br />
Kalenderjahr oder davon abweichend das Geschäftsjahr.<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Stichtag für die Bilanzpressekonferenzen im März 2013 ist eine Woche vorher. Bis dahin<br />
vorliegende auditierte / peer-evaluierte Bilanzen können auf der jeweiligen regionalen<br />
Pressekonferenz öffentlich vorgestellt werden. Das externe Audit benötigt ca. 4-6<br />
Wochen, deshalb bitte die GWÖ-Berichte bis spätestens Ende Januar 2012 einreichen.<br />
Die Ausstellung der Peer-Testate dauert ca. 1-2 Wochen. Auch diese Fristen bitte<br />
berücksichtigen, wenn Sie Ihr Unternehmen auf den Pressekonferenzen präsentieren<br />
möchten. Genauere Infos zu den PKs bitte bei info[at]gemeinwohl-oekonomie.org<br />
Das Ausfüllen des Rechenprogramms zur Bilanzerstellung, die eigentliche „<strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
Bilanz“, ist freiwillig. Im <strong>Gemeinwohl</strong>-Bericht muss die Selbsteinschätzung in % bei<br />
jedem Indikator angegeben werden.<br />
Jedes Pionier-Unternehmen kann zwischen drei Formen der Bilanzerstellung wählen:<br />
1 Sämchen: Das Unternehmen erwirbt eine Mitgliedschaft beim Verein oder leistet eine<br />
Spende in mindestens gleicher Höhe; es ist berechtigt das Service der <strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
<strong>Ökonomie</strong> zu nutzen und erstellt eine hausinterne Bilanz, die nicht veröffentlicht wird.<br />
Logo/Web-Banner:„Unterstützer-Unternehmen der <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong>“<br />
2 Sämchen: Das Unternehmen erwirbt eine Mitgliedschaft beim Verein und erstellt in<br />
einer Peer-Gruppe mit anderen Unternehmen eine <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz. Nach der<br />
wechselseitigen Prüfung kann die Bilanz mit der Kennzeichnung „Peer-Evaluierung“<br />
veröffentlicht werden. Das Unternehmen kann an der Bilanz-Pressekonferenz am 7.<br />
November 2012 teilnehmen. Logo/Webbanner: „Pionierunternehmen der <strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
<strong>Ökonomie</strong> mit <strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz“<br />
3 Sämchen: Das Unternehmen wird Mitglied beim Verein und erstellt (idealerweise in<br />
einer Peer-Gruppe) eine Bilanz, die es extern auditieren lässt und verpflichtend<br />
veröffentlicht. Es kann an bei der Bilanz-Pressekonferenz teilnehmen.<br />
Logo/Webbanner: „Pionierunternehmen der <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong> mit auditierter<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz.“<br />
Mehr Infos dazu im „Weg zur Bilanz“ (Kurzfassung) und in der Broschüre: „Die<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong> für mein Unternehmen“ (Langfassung).<br />
10
−<br />
Für alle PionierInnen, die eine Bilanz und einen Bericht erstellen, fällt ein<br />
Mitgliedsbeitrag beim Förderverein GWÖ an. Der richtet sich nach der Mitarbeiterzahl<br />
und kann auf Wunsch auch ermäßigt werden.<br />
11
ERLÄUTERUNGEN DER 17<br />
GEMEINWOHL-INDIKATOREN<br />
A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSWESEN ......................................................................................................... 13<br />
B1 ETHISCHES FINANZMANAGEMENT ............................................................................................................. 16<br />
C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT & GLEICHSTELLUNG ......................................................................................... 18<br />
C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT ..................................................................................... 21<br />
C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS DER MITARBEITERINNEN .............. 23<br />
C4 GERECHTE EINKOMMENSVERTEILUNG ..................................................................................................... 25<br />
C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ ........................................................................ 27<br />
D1 ETHISCHES VERKAUFEN .............................................................................................................................. 30<br />
D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN ........................................................................................................ 33<br />
D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN .......................................... 35<br />
D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN ...................................................... 38<br />
D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN BRANCHENSTANDARDS ........................................ 40<br />
E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN .......................... 42<br />
E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN ..................................................................................................................... 45<br />
E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN ........................................................................................ 47<br />
E4 MINIMIERUNG DER GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN EXTERNE .................................................................. 49<br />
E5 GESELLSCHAFTLICHE TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG .............................................................. 51<br />
12
A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSWESEN<br />
HINTERGRUND<br />
Der Umgang mit und die Auswahl von seinen Lieferanten sowie deren Produkte und<br />
Dienstleistungen stellt für viele Unternehmen eine bedeutende Möglichkeit zur Steigerung<br />
des <strong>Gemeinwohl</strong>es in seiner Einflusssphäre dar. Die mit der Globalisierung und<br />
Spezialisierung einhergehende Arbeitsteilung hat komplexe Strukturen in den<br />
Wertschöpfungsketten der Weltwirtschaft zufolge. Jede/r ist für die gesamte Supply Chain<br />
mitverantwortlich. Deshalb ist es wichtig, dass jede AkteurIn die vorgelagerten<br />
WertschöpferInnen kennt, Informationen aktiv einholt um nach ethischen Prinzipien<br />
auswählen zu können. Derzeit wird diese Sichtweise nur bei bestimmten kritischen<br />
Produktsparten (Kaffee, Kakao) berücksichtigt. Zunehmend geraten spezifische Rohstoffe<br />
(z.B.: Coltan) und komplexere Produkte (z.B.: Elektronikprodukte) ins Blickfeld der<br />
wirtschaftsethischer Diskussionen. Derartige Risiken sind nicht, wie der erste Blick vermuten<br />
lässt, auf Länder mit niedrigen gesetzlichen bzw. gelebten Standards reduziert, sondern<br />
finden sich auch in westlichen Ländern (z.B.: prekäre Arbeitsbedingungen im Handel,<br />
Tourismus, Reinigungsdienstleistungen, produzierendes Gewerbe, Baubranche, etc.).<br />
ZIEL<br />
Zielsetzung dieses Indikators ist es, dass die Unternehmen ihre Verantwortung für die<br />
vorgelagerten Wertschöpfungsschritte voll wahrnehmen und nur gemeinwohl-orientierte<br />
Zulieferer auswählen. Ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen setzt sich aktiv mit den<br />
bezogenen Produkten bzw. Dienstleistungen auseinander und versucht durch aktive<br />
Maßnahmen soziale und ökologische Folgenwirkungen und Risiken „bis zur Wiege“ zurück<br />
zu minimieren. Mit seinen Lieferanten und Dienstleistungspartner strebt es eine langfristige<br />
Zusammenarbeit an, wobei das <strong>Gemeinwohl</strong> betreffende Aspekte in einem möglichst<br />
kooperativen Prozess aktiv adressiert werden. In diese Prozesse können auch<br />
MitwerberInnen und externe Stakeholder bzw. Berührungsgruppen (z.B.: NGOs)<br />
eingebunden werden ( siehe auch D2 und D5)<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Belohnt wird sowohl die aktive Auseinandersetzung als auch der tatsächliche Bezug sozial<br />
und ökologischer höherwertiger Produkte und Dienstleistungen (=P/D), wobei ersteres mit<br />
zunehmender Größe bzw. bei hohen Risiken von steigender Relevanz ist. Ökologische<br />
Aspekte sind tendenziell von höherer Bedeutung. Je höher der Bezug aus Ländern bzw.<br />
Branchen mit niedrigen sozialen Standards ist desto stärker sind soziale Aspekte zu<br />
gewichten. Zu berücksichtigende Aspekte können vielfältiger Natur sein:<br />
−<br />
−<br />
Arbeitsbedingungen: existenzsicherndes Einkommen, Gesundheit und Sicherheit,<br />
ArbeitnehmerInnenrechte, etc.<br />
Ökologische Aspekte: ökologische Qualität der eingesetzten Inputstoffe im Vergleich zu<br />
Alternativen, Einsatz der besten verfügbaren Technologie, in der Produktion eingesetzte<br />
Energieträger, Vermeidung von Risikostoffen, Emissionen in Luft / Boden / Wasser, etc.<br />
13
− Soziale Auswirkungen auf andere Berührungsgruppen: direkte Belastung der<br />
AnrainerInnen durch Schadstoffe, Konflikte um Rohstoffe, Korruption,<br />
Menschenrechtsverstöße, Verstöße gegen geltendes Recht, kontroverse<br />
Unternehmenspolitik, Ausnutzen der Marktmacht, etc.<br />
−<br />
Verfügbarkeit und Existenz von sozial oder ökologische höherwertigen, regionalen<br />
Alternativen<br />
Kriterien<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Berücksichtigung<br />
regionaler,<br />
ökologischer und<br />
sozialer Aspekte<br />
bzw. höherwertiger<br />
Alternativen<br />
(45%-65%)<br />
punktuell bei<br />
klassischen<br />
Risikoprodukten<br />
(Öko-Strom)<br />
bei einigen<br />
wesentlichen P/ D<br />
bei einem Großteil<br />
an wesentlichen<br />
P/D<br />
+ klare Reduktion<br />
bei kritischen Stoffe<br />
ohne höherwertige<br />
Alternative<br />
bei allen<br />
wesentlichen,<br />
zugekauften P/D<br />
+ Innovative<br />
Lösungen zur<br />
Vermeidung<br />
kritischen Stoffe<br />
ohne höherwertige<br />
Alternative<br />
Aktive<br />
Auseinandersetzung<br />
mit den<br />
Risiken zugekaufter<br />
P/D und Prozesse<br />
zur Sicherstellung<br />
(25%-45%)<br />
Interne<br />
Auseinandersetzung<br />
durch<br />
aktives Einholen<br />
von Informationen<br />
zu mit der Thematik<br />
Integration sozialer<br />
und ökologischer<br />
Aspekte in das<br />
Vertragswesen<br />
(Code of Conduct /<br />
Ethik-Kodex)<br />
Internes Audit bei<br />
Risiken und<br />
wichtigsten<br />
Lieferanten<br />
Schulungen<br />
(Seminare,<br />
Workshops,<br />
Zeitbudgets für<br />
ExpertInnengespräche)<br />
aller<br />
Mitarbeiter im<br />
Einkaufsprozess<br />
Regelmäßige<br />
Evaluierung von<br />
Risiken und<br />
Alternativen<br />
Sicherstellung<br />
durch<br />
unabhängiges Audit<br />
(z.B.: nach soz./<br />
ökol. Gütesiegeln<br />
zertifizierte P/D,<br />
Kooperation mit<br />
NGOs)<br />
Kooperation mit<br />
LieferantInnen und<br />
Mitunternehmer-<br />
Innen hinsichtlich<br />
sozialer und<br />
ökologischer<br />
Aspekte<br />
Strukturelle<br />
Rahmenbedingungen<br />
zur<br />
fairen Preisbildung<br />
(10%)<br />
Verzicht auf rein<br />
preisgetriebene<br />
Beschaffungsprozesse<br />
(u.a.<br />
Auktionen,<br />
Ausschreibungsverfahren)<br />
Kein vom<br />
Einkaufspreis<br />
abhängiges Bonussystem<br />
für<br />
Einkäufer<br />
Langfristige,<br />
kooperative<br />
Beziehung werden<br />
wechselnden,<br />
kostenorientierten<br />
vorgezogen<br />
Evaluierung des<br />
Verhaltens der<br />
Einkäufer durch<br />
regelmäßige<br />
Mitarbeitergespräche<br />
mit<br />
Fokus auf die<br />
Herausforderungen<br />
, die sich durch<br />
eine ethische<br />
Beschaffung<br />
ergeben<br />
Innovative<br />
Strukturen im<br />
Beschaffungswesen<br />
(z.B.:<br />
Partizipation an<br />
Alternativwährungs<br />
konzepten, etc.)<br />
14
UMSETZUNG<br />
Für die Auseinandersetzung mit dem ethischen Beschaffungswesen braucht es zuerst eine<br />
systematische Auflistung aller bezogenen Produkte und Dienstleistungen gemäß ihrem<br />
monetären Anteil am gesamten Beschaffungsvolumen sowie ihrer Herkunft nach Region und<br />
Unternehmen. Dann werden die sozialen und ökologischen Auswirkungen evaluiert und<br />
Handlungsalternativen ermittelt. Dabei hilft eine Einstufung der Produkte/Dienstleistungen<br />
nach ihren positiven/negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen und Risiken.<br />
BEST PRACTISE / LITERATUR / LINKS / EXPERTEN<br />
Einen übersichtlichen Einstieg in die Thematik bieten folgende Quellen:<br />
− Self-Assessment-Tool der Ethical Trading Initiative:<br />
http://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/resources/ETI%20Management%20bench<br />
marks.pdf<br />
−<br />
CSR in der Supply Chain. Herausforderungen und Ansatzpunkte für Unternehmen:<br />
http://www.4sustainability.org/downloads/Loew_2006_CSR_in_der_Supply-Chain.pdf<br />
RedakteurInnen: Christina Potocnik, Christian Loy: christian.loy@gmx.at<br />
15
B1 ETHISCHES FINANZMANAGEMENT<br />
HINTERGRUND<br />
Dem Finanzsystem kommt hinsichtlich des <strong>Gemeinwohl</strong>s eine besondere Bedeutung zu. Das<br />
Bewusstsein über den Beitrag der Finanzdienstleistungen, die im Rahmen der<br />
Unternehmensaktivitäten in Anspruch genommen werden – zu teils destruktiven<br />
Folgewirkungen des Finanzmarktes – ist nur gering ausgeprägt. Dies führt dazu, dass<br />
sowohl Angebot als auch Nachfrage ethisch-ökologischer Finanzdienstleistungen sehr gering<br />
sind.<br />
ZIEL<br />
Unternehmen können den Wandel der Finanzmärkte in Richtung <strong>Gemeinwohl</strong>orientierung<br />
mitgestalten. Der Wechsel zu einer nicht gewinn-orientierten Bank fördert<br />
Verteilungsgerechtigkeit sowie den sinnvollen Einsatz finanzieller Ressourcen. Die<br />
Inanspruchnahme ethisch-ökologisch Finanzdienstleistungen (z.B. bei Rückstellungen für<br />
Pensionen) wirken als Signal in Richtung Nachhaltigkeit. Überdies können finanzmarktferne<br />
Formen der Finanzierung ins Auge gefasst werden: Leihe, Schenkung, Erbschaft (im Sinne<br />
einer demokratischen Mitgift) oder die Gewährung eines (zinslosen) Darlehens zwischen<br />
Unternehmen.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Belohnt werden vorerst weiterhin drei unterschiedliche Aspekte des Finanzmanagements:<br />
1. <strong>Gemeinwohl</strong>-orientierte Veranlagung (u.a. Tagesgeldkonto, Veranlagung von<br />
Rückstellungen)<br />
2. Soziale und ökologische Qualität des Finanzdienstleisters.<br />
3. <strong>Gemeinwohl</strong>-orientierte Finanzierung (s. auch E4)<br />
16
Kriterien<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Ethischökologische<br />
Qualität des<br />
Finanzdienstleisters<br />
(15-30%)<br />
Konventionelle<br />
Bank mit eigenen<br />
ethisch-ökolog.<br />
Finanzprodukten<br />
(5% am Kredit<br />
bzw. Sparvolumen)<br />
Mehrheitlich auf<br />
ethisch-ökologische<br />
Finanzdienstleistun<br />
gen spezialisierte<br />
Bank<br />
Ausschließlich<br />
ethischökologischer<br />
Finanzdienstleister<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>orientierte<br />
Veranlagung<br />
(50-70%)<br />
Sicherstellung einer<br />
das <strong>Gemeinwohl</strong><br />
nicht verletzenden<br />
Veranlagung 2<br />
Mehrheitliche<br />
Veranlagung in<br />
ethisch-ökologische<br />
Projekte 3<br />
+ Verwendung von<br />
Kapitalerträgen für<br />
soziale /<br />
ökologische<br />
Investitionen<br />
Ausschließliche<br />
Veranlagung in<br />
ethisch-ökologische<br />
Projekte<br />
+ Teilweiser<br />
Zinsverzicht bei<br />
Veranlagungen<br />
+ Vollständiger<br />
Zinsverzicht im Fall<br />
von Veranlagungen<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>orientierte<br />
Finanzierung<br />
(15-30%)<br />
Keine<br />
Eigenkapitalfinanzi<br />
erung über<br />
Kapitalgeber ohne<br />
Mitarbeit im<br />
Unternehmen 4<br />
Verankerung des<br />
ethischen Finanz-<br />
Managements im<br />
Unternehmensleitbild<br />
Versuch der<br />
Finanzierung über<br />
Berührungsgruppen<br />
5 oder aus<br />
Bankkredit aus<br />
nicht Gewinn<br />
ausschüttender<br />
Bank<br />
Verankerung in<br />
Unternehmensaktivitäten<br />
6<br />
Erfolgreicher<br />
Beginn der<br />
Finanzierung über<br />
Berührungsgruppen<br />
oder aus<br />
Bankkrediten, die<br />
zu teilverzichteten<br />
Zinsen führen<br />
Zinsfreie<br />
Finanzierung<br />
überwiegend<br />
mithilfe von<br />
Berührungsgruppen<br />
oder Bankkrediten,<br />
die zu keinen<br />
Sparzinsen mehr<br />
führen<br />
RedakteurInnen: Christian Loy, Gisela Heindl: gisela.heindl@gemeinwohl-oekonomie.org<br />
1<br />
Als Quelle zur Recherche zu großen Finanzinstituten kann u.a. Banktrack ( www.banktrack.org )<br />
dienen<br />
2<br />
z.B. durch transparente Finanzierungspolitik der Bank, Definition klarer Ausschlusskriterien etwa an<br />
Hand des Frankfurt Hohenheimer Leitfadens, Mitunternehmen, KundInnnen, LieferantInnnen, etc.<br />
3<br />
z.B. Kredite für ethisch-ökologisch Projekte, Investition in erneuerbare Energien, thermische Sanierung,<br />
gemeinwohl-orientierte Forschung und Entwicklung,<br />
4<br />
z.B. Begebung von handelbaren Aktien; Beteiligung stiller GesellschafterIn mit Intention der<br />
Vorbereitung einer Aktienemission<br />
5<br />
Mitarbeiter- und Bürgerbeteiligung (z.B.: lokale Bürgerbeteiligungen im Bereich nachhaltiger Energie);<br />
die Partizipation an Regionalwährungskonzepten kann ebenfalls hierunter positiv berücksichtigt werden<br />
6<br />
z.B.: Ethik-Schulung der Mitarbeiter im Finanz-Controlling; themenbezogen Info-Veranstaltung für<br />
Mitarbeiter, etc.<br />
17
C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT & GLEICHSTELLUNG<br />
HINTERGRUND<br />
Menschenwürde am Arbeitsplatz (im Arbeitsverhältnis) zeigt sich durch die Gleichwertigkeit<br />
und Gleichstellung aller im Unternehmen vertretenen Personen und dem Ziel möglichst<br />
gesunder, freier und kooperativer Arbeitsbedingungen. Das Gegenteil sind Ausbeutung<br />
zugunsten des Gewinns Einzelner, Verweigerung von Mitbestimmung, Diskriminierung<br />
Benachteiligter oder Schädigung der Gesundheit z.B. durch Über- oder Unterforderung<br />
(Burn- und Bore-out-Syndrome). Der Einzelne wird tendenziell zum Objekt gemacht und<br />
verliert das Anrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Gleichstellung und Inklusion<br />
Benachteiligter sind zusätzliche Aspekte. Zahlreiche Studien zeigen, dass ein<br />
gesamtgesellschaftliches Ungleichgewicht in der Bezahlung und Behandlung von Frauen<br />
und Männern sowie benachteiligter Gruppen (MigrantInnen, Behinderte, Langzeitarbeitslose,<br />
Minderheiten, etc.) vorliegt. Auch wenn es Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern<br />
gibt, haben doch alle EU-Staaten der Statistik der EU-Kommission zufolge eines<br />
gemeinsam: Frauen haben einen geringeren Stundenlohn als Männer und geringere<br />
Karrierechancen.<br />
ZIEL<br />
Ziel ist, die Arbeitsplatzqualität so zu gestalten, dass es Menschen im Rahmen ihrer<br />
Fähigkeiten, (auch familiären) Möglichkeiten sowie aufgrund von unterschiedlichen<br />
Bedürfnissen gelingen kann, sich gleichermaßen als Individuum weiterzuentwickeln wie auch<br />
in der Gemeinschaft des Unternehmens gut aufgehoben zu sein, d.h. gesundheitserhaltend,<br />
sinnerfüllt, kompetent, selbstverantwortlich und in Abstimmung mit den Anderen einen aus<br />
der Sicht aller wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens leisten zu können.<br />
Weiters gilt es die geschlechterspezifischen Merkmale und Bedürfnisse von Benachteiligten<br />
zu beachten sowie für die Aufhebung von Ungleichbehandlung zu sorgen.<br />
Ungleichbehandlung sichtbar zu machen, eine Öffentlichkeit dafür herzustellen und<br />
Bedingungen zu schaffen, die zur Versachlichung und Konfliktfähigkeit beitragen. Diesen<br />
heute benachteiligten Menschen(gruppen) soll im Unternehmen eine faire Chance auf einen<br />
adäquaten Arbeitsplatz und eine faire Bezahlung geboten werden. Dazu benötigt es im<br />
Unternehmen eine Gesamtstrategie zum „Diversitymanagement“.<br />
DEFINITION<br />
Zur Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung zählen wir humane Arbeitsbedingungen inkl.<br />
Freiraum für Familie, physische und psychische Gesundheit, Zufriedenheit am<br />
Arbeitsplatz, Selbstorganisation, Lebenslanges Lernen und persönliche<br />
Weiterentwicklung, Work-Life-Balance und Sinnstiftung (d.h. Menschen im Unternehmen<br />
wollen wissen, wofür es sich lohnt, sich anzustrengen: Welchem unmittelbaren und<br />
tiefergehenden Zweck dient das Unternehmen und mein Beitrag?). Diversitätsfelder sind<br />
Generationenfragen, die Frau-Mann-Thematik, sexuelle Orientierung, ethnische<br />
Zugehörigkeit, Religion und Behinderung sowie Bildung, Sprache oder soziale Klasse.<br />
18
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Alle hier angeführten Kriterien können sowohl anhand interner Statistiken als auch durch<br />
MitarbeiterInnenbefragungen erhoben und eingestuft werden.<br />
Die + Zeichen in einem zusammengelegten Kästchen bedeuten, dass jede Erfüllung von<br />
einem Unterkriterium zu einer Hochstufung führt (additives Verfahren). Alle anderen Kriterien<br />
sind logisch aufbauend, d.h. erst die Erfüllung eines Unterkriteriums ermöglicht den<br />
„Aufstieg“ in die nächste Stufe.<br />
Für EPUs gelten folgende Kriterien nicht: Arbeitszeiten, Gleichstellung und Umgang für<br />
Benachteiligten, deshalb gibt für EPUs veränderte prozentuale Aufteilungen bei den<br />
Kriterien.<br />
Kriterien<br />
Erste Schritte<br />
(0-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Arbeitszeiten (20%)<br />
(Freiwillig und selbstbestimmt,<br />
nicht<br />
betrieblich verordnet)<br />
Flexible Arbeitszeiten<br />
und Teilzeitmodelle<br />
Flexible Arbeitszeiten<br />
und Teilzeitmodelle<br />
+ durch<br />
Mitbeinbeziehung<br />
der MA<br />
+ Aktive zeitliche<br />
Entlastung durch<br />
Kinderbetreuung<br />
(z.B. Betriebskindergarten,<br />
Tagesmütter-<br />
/väter)<br />
Völlige<br />
Selbstorganisation<br />
der Arbeitszeit<br />
(Arbeitseinteilung<br />
nach Ergebnisvereinbarung)<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
(10%)<br />
(für EPU 20%)<br />
Alle Arbeitsplätze<br />
ergonomisch (z.B.<br />
Beleuchtung,<br />
Raumklima, etc.);<br />
+ behindertengerecht (barrierefreier Zugang zu allen Räumen);<br />
+ Zusätzliche Möglichkeiten für die freie Wahl des eigenen<br />
Arbeitsortes (z.B. Homeoffice)<br />
+ zusätzliche Räume für Entspannung und Bewegung (z.B.<br />
Grünflächen, Ruheraum)<br />
Physische<br />
Gesundheit und<br />
Sicherheit (10%)<br />
(für EPU 20%)<br />
Gesundheitspräventionsprogramme<br />
und<br />
Sensibilisierungsmaßnahmen<br />
(Workshops und<br />
Vorträge; 2 T.p.a.)<br />
+ (beginnend) Aktive<br />
Förderung gesunde<br />
Ernährung;<br />
(z.B. keine<br />
Automaten mit Fast<br />
Food, sondern Bio-<br />
Körbchen)<br />
+ Individuelle<br />
Angebote durch<br />
Gesundheitsberat.,<br />
freiwillige<br />
Vorsorgeuntersuchung<br />
bzw.<br />
Sportprogramme<br />
+ (Erfahren) Bio-<br />
Küche bzw-<br />
Verpflegung (ev.<br />
durch<br />
Selbstversorgungsmöglichkeit<br />
o.<br />
Kochen mit „Profi“<br />
Psychische<br />
Gesundheit (15%)<br />
(für EPU 30%)<br />
Tageszahlen = pro<br />
Mitarbeiter, pro Jahr.<br />
Inhalten tw. austauschbar<br />
Ein Tag:<br />
MA-Veranstaltungen<br />
zur Entwicklung von<br />
Teamfähigkeit<br />
und fallweise<br />
Bearbeitung<br />
einzelner Anliegen<br />
(z.B. Supervision,<br />
Coaching)<br />
Zwei Tage:<br />
regelmäßige Workshops<br />
bzw. Schulungen<br />
für soziale<br />
Kompetenz (z.B.<br />
Konfliktmanagement,<br />
GFK) und zu<br />
Gesundheit (z.B.<br />
Stressabbau)<br />
Drei Tage:<br />
Workshops zur<br />
Weiterbildung (soziale<br />
Kompetenzen,<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
und<br />
Einrichtung von Konfliktlotsen<br />
und/oder<br />
MediatiorInnen<br />
Vier Tage:<br />
Weiterbildung für<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
und soziale<br />
Kompetenzen<br />
Selbstorganisat.,<br />
Zufriedenheit am<br />
Arbeitsplatz,<br />
Sinnstiftung (15%)<br />
(für EPU 30%)<br />
Mitbestimmung und<br />
Einbezug bei der<br />
Gestaltung der<br />
Aufgaben (im Team)<br />
+ Mitarbeiterbefragung<br />
(1x p.a.) zur<br />
Arbeitsplatz- und<br />
Vertrauenskultur +<br />
Maßnahmen zur<br />
Förderung der<br />
Enthierarchisierung<br />
(2-3 Hierar.ebenen)<br />
Mitbestimmung der<br />
Gestaltung von<br />
Aufgaben, Führung<br />
und Gehältern;<br />
Jobrotationen und<br />
Jobenrichment durch<br />
gezielte<br />
Weiterbildung<br />
Selbstorganisation<br />
Mitgestaltung d.<br />
Vision, Unternehmensstrategie,<br />
Ziele<br />
Arbeitsverteilung. (1<br />
Hierarchieebene,<br />
werteorientiert)<br />
19
Gleichstellung und<br />
Gleichbehandlung<br />
von Mann und Frau<br />
(20%)<br />
Benachteiligte (z.B.<br />
Menschen mit<br />
Behinderung,<br />
MigrantInnen,<br />
Langzeitarbeitslose)<br />
(10%)<br />
Gender- und Diversity-Schulungen;<br />
Installierung einer<br />
genderverantwortlichen<br />
Person (ab 5<br />
MA:). Jobangebote<br />
diskriminierungsfrei;<br />
Vielfalt am Arbeitspl.<br />
Verpflichtende Schulungen<br />
zu Thema<br />
Anti- Diskriminierung;<br />
Angepasste Personalsuche<br />
(Vielfalt);<br />
Teilerfüllung der<br />
gesetzlichen Quote<br />
(über 2%)<br />
+ Erstellung eines Gleichstellungs-berichts inkl. entsprechender<br />
Maßnahmen wie die gezielte Förderung von Frauen und<br />
Väterkarenz<br />
+ (F) Gender Budgeting (inkl. Offenlegung aller Gehälter/Löhne<br />
und Mitbestimmung aller MA bei den Gehältern);<br />
Gleichbehandlungs-Beauftragte (1 Pers. bis zu/auf 25 MA)<br />
+ 50 % Frauenanteil in Führungspositionen; Gezielte<br />
Weiterentwicklung und Weiterbildung der FK (2 Tage p.a./p.p.)<br />
+ Aufnahme von Personen o. Kooperationen zur Unterstützung;<br />
Erfüllung der gesetzlichen Quote (= keine Ausgleichszahlungen)<br />
+ Schulungen im Umgang mit spezifischen Bedürfnissen;<br />
Übererfüllung der gesetzlichen Quote; Kooperationen mit NGO’s<br />
mit aktiven Projekten.<br />
+ Schaffung von zusätzlichen Möglichkeiten der Aufnahme von<br />
MA, spez. Programme für benacht. Gruppen, inhärenter<br />
Bestandteil der Unternehmensstrategie<br />
Trifft die Ausprägung nicht auf die jeweilige Branche/Unternehmensgröße zu, bitte alle<br />
wesentlichen Maßnahmen sowie den Vergleich zur eigenen Branche im GWÖ-Bericht<br />
anführen.<br />
Bei der Erstellung des GWÖ-Berichtes sollte insbesondere bei diesem Indikator die Mit-<br />
Arbeiter mit-einbezogen werden (Selbsteinschätzung der Mitarbeiter zu diesen Kriterien).<br />
LITERATUR + LINKS<br />
Allgemein zum Thema<br />
Auslaufmodell Menschenwürde; Heiner Bielefeldt (Herder)<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Humanisierung_des_Arbeitslebens<br />
Gleichstellung<br />
http://personalwesen.univie.ac.at/frauenfoerderung-und-gleichstellung<br />
http://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/beispiele/budgeting.html<br />
Gesundheitsförderung<br />
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/<br />
Best-practises Gesundheitsförderung EU<br />
Inklusion Benachteiligter<br />
http://www.bik-online.info<br />
http://www.arbeitundbehinderung.at/de/best-practice/index.php<br />
Redakteurin: Christine Amon c.amon@green-field.at<br />
20
C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT<br />
HINTERGRUND<br />
Erwerbsarbeit ist ein wertvolles Gut und ein wichtiges Element gesellschaftlicher Teilhabe.<br />
Dennoch arbeiten derzeit die einen zu viel („leben um zu arbeiten“) und die anderen gar nicht<br />
(„arbeitslos“). In Österreich werden jährlich 330 Millionen Überstunden geleistet, das sind 8,2<br />
Überstunden pro Woche je Überstunden leistender Person. Würden die Überstunden in<br />
zusätzliche Arbeitsplätze umgewandelt, könnten dadurch 200.000 Vollzeitarbeitsplätze<br />
geschaffen werden. 7<br />
Laut Umfragen wünschen sich Menschen in ganz Europa für die Erwerbsarbeit pro Woche<br />
nur 26 - 39 Wochenstunden aufzuwenden. 8<br />
Aus ökologischer Sicht ist problematisch, dass die Nichtverkürzung der Arbeitszeit bei weiter<br />
steigender Produktivität zu weiterem Wirtschaftswachstum führt. Wächst die Wirtschaft<br />
einmal nicht mehr und steigt aber die Produktivität weiter an, muss logischerweise die<br />
Arbeitszeit verkürzt werden, damit die Arbeitslosigkeit nicht ansteigt. Gegenwärtig wird der<br />
„systemische Wachstumszwang“ unter anderem mit der Notwendigkeit von Wachstum zur<br />
Schaffung von Arbeitsplätzen gerechtfertigt.<br />
ZIEL<br />
Alle Unternehmen sorgen gemeinsam dafür, dass alle Menschen einen gerechten Anteil am<br />
Erwerbsarbeitskuchen bekommen – niemand zu wenig und niemand zu viel.<br />
DEFINITION<br />
Unternehmen bauen sukzessive Überstunden ab und danach sogar „Unterstunden“ auf: Sie<br />
nehmen eine weitere Verkürzung der gesetzlichen Regelarbeitszeit vorweg.<br />
7<br />
8<br />
Wolfgang Mazal/Institut für Familienforschung, Der Standard, 11. Juni 2011.<br />
Gleichstellung. Eltern in der Traditionalisierungsfalle. In: Böckler Impuls. 03/2011. Abrufbar im Internet.<br />
URL: http://www.boeckler.de/pdf/impuls_2011_03_4-5.pdf Stand:24.02.2012.<br />
21
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(0-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Senkung der<br />
Normalarbeitszeit<br />
(75%)<br />
Reduktion von<br />
Verträgen mit<br />
Überstundenpauschale<br />
um 50%;<br />
im Jahresschnitt<br />
maximal 10<br />
Überstunden pro<br />
BeschäftigteR/Monat<br />
Reduktion von<br />
Verträgen mit<br />
Überstundenpauscha<br />
le um 75%;<br />
im Jahresschnitt<br />
maximal 5<br />
Überstunden pro<br />
BeschäftigteR/Monat<br />
Keine Verträge mit<br />
Überstundenpauscha<br />
le mehr;<br />
keine Überstunden<br />
im Jahresschnitt je<br />
BeschäftigteR<br />
Die durchschnittliche<br />
Arbeitszeit ist um<br />
10% niedriger als die<br />
Branchenarbeitszeit<br />
oder maximal 38,5<br />
Stunden<br />
Erhöhung des<br />
Anteils der Teilzeit-<br />
Arbeitsmodelle (bei<br />
voller Bezahlung)<br />
Erste<br />
Neueinstellungen<br />
aufgrund des Abbaus<br />
von Überstunden;<br />
Neueinstellungen<br />
äquivalent zum<br />
Abbau von Abbau<br />
von Überstunden;<br />
Neueinstellungen<br />
äquivalent zum<br />
Abbau von Abbau<br />
von Überstunden;<br />
Neueinstellungen<br />
aufgrund allgemeiner<br />
Arbeitszeitverkürzung<br />
;<br />
(25%)<br />
bis 10% der MitarbeiterInnen<br />
können<br />
Teilzeit in Anspruch<br />
nehmen<br />
bis 25% der MitarbeiterInnen<br />
können<br />
Teilzeit in Anspruch<br />
nehmen<br />
bis 50% der MitarbeiterInnen<br />
können<br />
Teilzeit in Anspruch<br />
nehmen<br />
mehr als 50% der<br />
MitarbeiterInnen<br />
können Teilzeit in<br />
Anspruch nehmen<br />
HILFEN FÜR DIE UMSETZUNG<br />
Einbindung der Beschäftigten-VertreterInnen in die Organisation der Arbeitszeit.<br />
BEST PRACTISE / LITERATUR / LINKS / EXPTEREN<br />
Frigga Haug: Die Vier-in-einem-Perspektive: http://www.vier-in-einem.de/<br />
http://www.friggahaug.inkrit.de/documents/DA291_fh.pdf<br />
Wirt, Anna: Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten. Bundesanstalt<br />
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Dortmund 2010. Abrufbar im Internt. URL:<br />
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd59.pdf;jsessionid=B737F2202A66E0<br />
1C5616230FC8A861E7.1_cid253?__blob=publicationFile&v=4.<br />
Redakteur: Christian Felber (Mitarbeit: Dominik Sennes): info@christian-felber.at<br />
22
C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN<br />
VERHALTENS DER MITARBEITERINNEN<br />
HINTERGRUND<br />
Westlichen Staaten wird tendenziell ein hohes Umweltbewusstsein unterstellt. Das<br />
tatsächliche ökologische Verhalten europäischer Durchschnittsbürger 9 steht diesem<br />
diametral gegenüber. Für einen Paradigmenwechsel hin zu einer ökologisch nachhaltigen<br />
Gesellschaft sind neben einem fundierten Bewusstsein über wesentliche ökologische<br />
Einflussfaktoren (z.B.: Ernährungsgewohnheiten, Mobilität) auch berufliche<br />
Rahmenbedingungen notwendig, die ein tatsächliches ökologisches Verhalten ermöglichen.<br />
ZIEL<br />
Zielsetzung eines gemeinwohlorientierten Unternehmens ist es das ökologische Bewusstsein<br />
zu forcieren bzw. ökologisches Verhalten im Betrieb zu ermöglichen.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Die Beurteilung des Indikators erfolgt hinsichtlich mehrerer Aspekte. Neben spezifischen<br />
Themenfelder, welche durch einen hohen ökologischen Impact gekennzeichnet sind,<br />
(Ernährung am Arbeitsplatz 10 ; Wegstrecke zum Arbeitsplatz) soll auch der Umgang und<br />
Integration auf Organisationsebene (Weiterbildung & Awareness, Organisationskultur)<br />
beurteilt werden.<br />
9<br />
10<br />
gemessen am ökologischen Fußabdruck, siehe Plattform Footprint: http://www.footprint.at<br />
In etwa ein Drittel des durchschnittlichen ökologischen Fußabdruckes ist auf Nahrungsmittel<br />
zurückzuführen. Eine Vegetarische Ernährung (3x wöchentlich Milch und Milchprodukte) hat einen im Vergleich<br />
zu derzeitigen Ernährungsgewohnheiten (5 x wöchentlich Fleisch, Milch und Milchprodukte) um 2/3 niedrigeren<br />
ökologischen Fußabdruck, eine vegane Ernährung in etwa um ¾. Eine ökologische Wende ist ohne Veränderung<br />
der Ernährungsgewohnheiten äußerst unwahrscheinlich. Auch bei nicht vorhandener Betriebsküche können<br />
positive Anreizfaktoren gesetzt werden (z.B.: Kooperation mit bio-vegetarischen Lokalen, etc.).<br />
23
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Betriebsküche /<br />
Ernährung während<br />
der Arbeitszeit<br />
Erste Ansätze zur<br />
Förderung<br />
nachhaltiger<br />
Ernährungsmuster<br />
(z.B.: Angebot einer<br />
Vegetarische Option)<br />
Klares Bekenntnis im<br />
Unternehmen zu<br />
nachhaltige<br />
Ernährungsgewohnheiten<br />
(deutlich reduzierter<br />
Konsum tierischer<br />
Produkte)<br />
Ernährung<br />
mehrheitlich<br />
vegetarisch-vegan<br />
+ Lebensmittel<br />
vorwiegend lokal,<br />
saisonal und<br />
biologisch<br />
Ernährung großteils<br />
vegetarisch-vegan<br />
+ Lebensmittel<br />
vorwiegend lokal,<br />
saisonal und<br />
biologisch<br />
Mobilität zum<br />
Arbeitsplatz:<br />
Anreizsysteme /<br />
tatsächliches<br />
Verhalten<br />
Erste Ansätze zu<br />
einer nachhaltigen<br />
Mobilitätspolitik (z.B.:<br />
Finanzielle<br />
Anreizsysteme für<br />
die Benutzung<br />
ÖPNV; festgelegte<br />
Dienstwagenpolitik:<<br />
130 g CO² / km)<br />
Konsequente<br />
nachhaltige<br />
Mobilitätspolitik:<br />
(z.B.: wenn keine<br />
ÖPNV verfügbar:<br />
Aktives Car Sharing<br />
Angebot; Mitarbeiter-<br />
Parkplätze nur für<br />
Car Sharing)<br />
Mehrheit der<br />
MitarbeiterInnen<br />
benutzen ÖPNV /<br />
Bus / Zug / Rad / Car<br />
Sharing<br />
Nahezu alle<br />
MitarbeiterInnen<br />
benutzen ÖPNV /<br />
Rad / Car Sharing<br />
Organisationskultur,<br />
Awareness<br />
und<br />
unternehmensinter<br />
ne Prozesse<br />
Punktuelle<br />
Thematisierung<br />
ökologischer Aspekte<br />
(z.B.: Newsletter,<br />
etc.)<br />
Geschäftsführung<br />
„lebt“ ökologisches<br />
Verhalten vor (z.B.:<br />
kein<br />
prestigeträchtiger<br />
Dienstwagen)<br />
Punktuelle<br />
Integration<br />
ökologischer Aspekte<br />
in<br />
Weiterbildungsprogra<br />
mme<br />
Mitarbeiter werden in<br />
ökologische Belange<br />
einbezogen<br />
(regelmäßige<br />
Thematisierung, Info-<br />
Veranstaltungen,<br />
etc.)<br />
Regelmäßige<br />
Integration<br />
ökologischer Aspekte<br />
in<br />
Weiterbildungsprogra<br />
mme<br />
Mitarbeiter werden<br />
regelmäßig in ökol.<br />
Entscheidungsproze<br />
sse einbezogen<br />
Awarenessprogramme<br />
für jedeN<br />
MitarbeiterIn (z.B.:<br />
Regelmäßige<br />
Erhebung zum /<br />
Thematisierung des<br />
ökologischen<br />
Verhaltens;<br />
Footprint-<br />
Workshops)<br />
Innovative Ansätze:<br />
z.b.: „grüne<br />
Sozialleistungen“<br />
Ökologischer<br />
Fußabdruck der<br />
Mitarbeiter (EPU /<br />
< 5 ha / MitarbeiterIn < 4 ha / MitarbeiterIn < 3 ha / MitarbeiterIn<br />
KMU) 11<br />
< 1,8 ha /<br />
MitarbeiterIn<br />
UMSETZUNG<br />
Im Handbuch finden Sie einige für die Umsetzung hilfreiche Hintergrundinformationen.<br />
RedakteurIn: Christian Loy: christian.loy@gmx.at<br />
11<br />
Für EPU und KMU kann die Berechnung der Teilbereiche Ernährung und Mobilität des ökologischen<br />
Fußabdruckes, wenngleich dieser auf Privatpersonen ausgelegt ist, als Annäherung für das tatsächlich<br />
ökologische Verhalten in diesen Sparten dienen. Rechner für den ökologischen Fußabdruck: http://www.meinfussabdruck.at<br />
24
C4 GERECHTE EINKOMMENSVERTEILUNG<br />
HINTERGRUND<br />
Die Einkommensschere geht immer weiter auf. In Österreich beträgt die<br />
Einkommensspreizung zwischen dem Höchst- und Mindesteinkommen 1:800, in<br />
Deutschland 1: 5000 und in den USA das 350.000-fache des dortigen gesetzlichen<br />
Mindestlohnes. 12 Auch innerbetrieblich geht die Schere immer weiter auf: Im Jahr 2008<br />
betrug die durchschnittliche Vorstandsvergütung in einem ATX-Unternehmen das 48-fache<br />
des durchschnittlichen Bruttobezugs eines Beschäftigten dieser Unternehmen. 13 Mit Leistung<br />
oder Verantwortung haben diese Unterschiede nichts mehr zu tun.<br />
Zahlreiche sozialmedizinische Studien belegen, dass Gesellschaften umso kränker,<br />
unsicherer und krimineller werden, je größer die Ungleichheit ist. 14 Während Wertschöpfung<br />
und BIP kräftig gewachsen sind, stagnieren in Deutschland und Österreich die<br />
durchschnittlichen Nettoeinkommen. 15<br />
Außerdem gehen die gleiche politischen Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten aller<br />
verloren, wenn die einen das Vieltausendfache der anderen verdienen.<br />
Umfragen zufolge empfinden rund 90% der Menschen in Österreich, Deutschland oder<br />
Großbritannien die gegenwärtige soziale Ungleichheit als zu groß. 16<br />
ZIEL<br />
Eine gerechte Einkommensverteilung gemessen an Leistung (= gleiche Anstrengung pro<br />
Arbeitszeit), Verantwortung und Bedarf soll belohnt werden.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Belohnt wird a) die Absenkung der innerbetrieblichen Einkommensspreizung (50%), b) die<br />
Einhaltung eines Mindestlohnes von 1.250 Euro oder einem den regionalen<br />
Rahmenbedingungen entsprechenenden Äquivalent (25%) und c) eines Höchsteinkommens<br />
von 12.500 Euro: dem zehnfachen des vorgeschlagenen Mindestlohnes (25%).<br />
12<br />
13<br />
Felber, Christian: „<strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong>“, Neuausgabe, Deuticke, Wien 2012.<br />
Wieser, Christina, Oberrauter, Markus: Vorstandsvergütung und Ausschüttungspolitik der ATX<br />
Unternehmen 2008. Studie der AK Wien 2009, S. 1. Abrufbar im Internet:<br />
http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d96/StudieATX.pdf. Stand: 07. 2. 2012.<br />
14<br />
Wilkinson, Richard / Pickett, Kate: „Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser<br />
sind“, Tolkemitt Verlag, Berlin 2009.<br />
15<br />
Brenke, Karl, Grabka, Markus M.: Schwache Lohnentwicklung im letzten Jahrzehnt. In: DIW<br />
Wochenbericht. Reallöhne 2000–2010: Ein Jahrzehnt ohne Zuwachs. Bericht 45/2011, S. 3-15. Abrufbar im<br />
Internet. URL: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.388565.de/11-45.pdf. Stand:<br />
07.02.2012.<br />
16<br />
Hinz, Thomas / Liebig, Stefan, et al.: „Bericht zur Studie. Einkommensgerechtigkeit in Deutschland“,<br />
2010, S. 5. Abrufbar im Internet. URL: http://www.uni-bielefeld.de/soz/personen/liebig/pdf/Studie-<br />
Einkommensgerechtigkeit-2010.pdf. Stand:14.02.2012.<br />
25
Im Hinblick auf die Einkommensverteilung sind unter Einkommen nur jene Geld-und<br />
Sachwertflüsse zu verstehen, die zu einem endgültigen Abfluss beim Unternehmen und<br />
einem Zufluss in der Privatsphäre des Mitarbeiters führen.<br />
Gezählt werden dabei alle Einkommensbestandteile: fixe und variable Entlohnung, Zulagen,<br />
Boni, Gewinnausschüttungen. Die Einhaltung von Höchst- und Mindest-Nettoeinkommen<br />
werden zusätzlich in den Negativ-Kriterien berücksichtigt.<br />
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Innerbetriebliche<br />
Einkommensspreizung<br />
(40%)<br />
innerbetriebliche<br />
Einkommensspreizung<br />
beträgt<br />
max. 1:10<br />
innerbetriebliche<br />
Einkommensspreizung<br />
beträgt<br />
max. 1:7<br />
innerbetriebliche<br />
Einkommensspreizung<br />
beträgt<br />
max. 1:5<br />
innerbetriebliche<br />
Einkommensspreizung<br />
beträgt<br />
max. 1:3<br />
Institutionalisierung<br />
(10%)<br />
Transparenz der<br />
niedrigsten und<br />
höchsten<br />
Einkommen<br />
Living Wages 17 an<br />
allen Standorten<br />
Zielsetzung<br />
Maximalspreizung,<br />
Mindest- und<br />
Höchstlöhne<br />
Umsetzung aller<br />
Ziele inkl. GINI-<br />
Messung 18<br />
Mindsteinkommen<br />
(25%) Keine der Einkommen bei voller Arbeitszeit unterschreitet 1.250 Euro oder living wage<br />
Höchsteinkommen<br />
(25%)<br />
Kein Einkommen bei voller Arbeitszeit überschreitet das Zehnfache des landesüblichen<br />
Mindestlohnes<br />
HILFEN FÜR DIE UMSETZUNG<br />
Die Zahlen müssen nur in die Bilanz eingegeben werden sowie Ja/Nein bei den Fragen, ob<br />
Einkommen unter dem Mindesteinkommen oder über dem Höchsteinkommen liegen.<br />
FRAGEN<br />
Was ist der niedrigste bzw. höchste Lohn im Unternehmen?<br />
Gibt es ein transparentes Entgeltsystem?<br />
LITERATUR<br />
Richard Wilkinson / Kate Pickett: Gleichheit ist Glück: http://haffmanstolkemitt.de/programm/gleichheit-ist-gluck/<br />
und http://www.faz.net/artikel/C30405/richardwilkinson-und-kate-pickett-gleichheit-ist-glueck-es<br />
schwankt-das-fundament-des-gluecks-<br />
30083252.html<br />
Redakteure: Otto Galehr, Jan Hunnius, Dominik Sennes, Christian Felber:<br />
info@gemeinwohl-oekonomie.org;<br />
17<br />
Löhne/Gehälter, die einen menschenwürdigen Lebensstandard sichern, der alle wichtigen<br />
Grundbedüfnisse deckt: http://en.wikipedia.org/wiki/Living_wage<br />
18 Der Gini-Koeffizient ein statistisches Maß zur Darstellung von Ungleichverteilungen. Je höher der<br />
Gini-Koeffizient, desto ungleicher ist die Einkommensverteilung.<br />
26
C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND<br />
TRANSPARENZ<br />
HINTERGRUND<br />
Rechtlich gesehen leben wir in einer Demokratie, trotzdem sind die tatsächlichen<br />
Mitwirkungsmöglichkeiten der BürgerInnen über die Wahlentscheidungen hinaus entweder<br />
sehr begrenzt oder kaum bekannt. In der Wirtschaft kommen die demokratischen Prinzipien<br />
noch weniger zum Tragen. Die Führungskräfte entscheiden, während die MitarbeiterInnen<br />
nur sehr eingeschränkte Rechte zur betrieblichen Mitsprache und Mitbestimmung haben.<br />
Diese bestehen im Kern im Recht der ArbeitnehmerInnen sich gewerkschaftlich zu<br />
organisieren und einen Betriebsrat zu wählen, der die Interessen der Beschäftigten vor dem<br />
Arbeitgeber vertritt (repräsentative Mitbestimmung).<br />
Faktisch gleicht das System Wirtschaft einer Monarchie, in der jede Führungskraft<br />
unterschiedliche Formen der Mitbestimmung/Einflussnahme zulassen kann, aber nicht muss.<br />
Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren eines demokratisch<br />
orientierten Unternehmens, ein partnerschaftliches Miteinander und mündige<br />
MitarbeiterInnen.<br />
Studien belegen, dass in wirklich demokratisch organisierten Unternehmen die<br />
MitarbeiterInnen zufriedener, engagierter, innovativer und produktiver als in traditionellen<br />
Organisationsstrukturen sind.<br />
ZIEL<br />
Ideal ist eine möglichst hohe Form der direkten MitarbeiterInnen-Mitbestimmung bei allen<br />
wesentlichen Entscheidungen und eine Legitimation der Führungskräfte mittels Wahl durch<br />
MitarbeiterInnen. Voraussetzung dafür ist eine umfassende Transparenz interner Aktivitäten<br />
und eine verbindliche Verankerung der innerbetrieblichen Demokratie.<br />
DEFINITION, ASPEKTE, PROBLEMATISCHES<br />
MitarbeiterInnenbeteiligung bedeutet, dass die Mit-ArbeiterInnen mit-entscheiden können<br />
und nicht nur informiert oder gehört werden, sondern auch eine Möglichkeit zur<br />
Einflussnahme besitzen. Qualitativ zu unterscheiden sind unterschiedliche Formen der<br />
demokratischen Mitbestimmung. Diese reichen von Mehrheits- bis hin zu konsensualen<br />
Entscheidungen.<br />
Leider ist das Feld der Wirtschaftsdemokratie kaum bekannt und wenig erforscht. Oftmals<br />
wird Demokratie mit Basisdemokratie gleichgesetzt, bei der alle MitarbeiterInnen bei allen<br />
Entscheidungen mitwirken und die Organisation so lähmen. Es gibt aber Mittel und Wege die<br />
MitarbeiterInnen demokratisch mit einzubinden und gleichzeitig produktiv den Unternehmenszweck<br />
zu erfüllen.<br />
27
Wir glauben, dass es mehrfach positive Effekte einer starken MitarbeiterInnenbeteiligung<br />
gibt 19 :<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Empowerment und dadurch höhere Motivation der MitarbeiterInnen<br />
Mehr Identifikation mit dem Unternehmen und folglich geringere Fluktuation<br />
Menschliches Korrektiv zu dem Shareholder-Value Ansatz<br />
Wandel der Unternehmenskultur in Richtung partnerschaftliche Aufgabenteilung<br />
Kreativere Lösungen, weil die Sichtweise aller Beteiligten gehört wird<br />
Engagiertere Mitarbeiter und bessere Ergebnisse.<br />
Wolfgang Georg Weber hat im Forschungsprojekt ODEM mit anderen Kollegen mehrere<br />
demokratische Organisationen untersucht und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: „Je<br />
demokratischer die Organisationsstrukturen in einem Unternehmen sind,<br />
− umso bereiter sind die Mitarbeiter/innen, hilfsbereit, solidarisch und gesellschaftlich<br />
verantwortlich zu handeln,<br />
− umso stärker tendiert das Ethikbewusstsein der Mitarbeiter/innen in Richtung<br />
humanistischer Wertorientierungen,<br />
− umso stärker ist deren Bereitschaft zu demokratischem und gesellschaftlichem<br />
Engagement,<br />
− umso stärker ist die gefühlsmäßige Bindung der Mitarbeiter/innen an den Betrieb.“ 20<br />
ABSTUFUNGEN/ MESSUNGEN:<br />
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Grad der Transparenz<br />
(10%)<br />
Erste Maßnahmen zu<br />
mehr Transparenz<br />
Einige kritische<br />
Daten transparent<br />
Wesentliche kritische<br />
Daten transparent<br />
Alle Daten transparent,<br />
für jeden Mitarbeiter<br />
abrufbar<br />
Legitimierung der<br />
Führungskräfte (FK)<br />
(20%)<br />
Anhörung/<br />
Konsultation bei<br />
Bestellung neuer FK<br />
Vetorecht bei der Bestellung<br />
neuer FK,<br />
Test: – 25% gewählt<br />
Mehr als 75%<br />
regelmäßig gewählt<br />
100% regelmäßig<br />
gewählt<br />
Mitbestimmung bei<br />
Operativen<br />
Grundsatz/ Rahmen<br />
Entscheidungen<br />
(30%)<br />
Anhörung/ Konsultation<br />
+ Begründung,<br />
Konzept demokrat.<br />
Mitbestimmung<br />
vorhanden<br />
Testphase, - 25% der<br />
Entscheidungen<br />
demokratisch,<br />
teilweise konsensual<br />
25-75% der<br />
demokratisch, davon<br />
mind. 25%<br />
konsensual<br />
76-100%<br />
demokratisch, davon<br />
mind. 50%<br />
konsensual<br />
Mitbestimmung bei<br />
Gewinnbeteiligung<br />
der Mitarbeiter (MA)<br />
(10%)<br />
Konzept für<br />
Gewinnbeteiligung<br />
der MA vorhanden +<br />
Testphase<br />
25% des Gewinns<br />
wird konsensual<br />
verteilt<br />
26-75% des Gewinns<br />
wird konsensual<br />
verteilt<br />
Der gesamte Gewinn<br />
wird konsensual<br />
verteilt<br />
Mit-Eigentum der<br />
MA/ unabhängige<br />
Stiftungen<br />
(30%)<br />
1-24% des Betriebes<br />
Eigentum bei MA<br />
Sperrminorität (ab<br />
25%)<br />
Überwiegend d.h. ><br />
50%<br />
Ganz, z.B.<br />
MitarbeiterInnen-<br />
Stiftung<br />
* Kritische Daten sind z.B. die Protokolle der Führungsgremien, Gehälter, Interne Kostenrechnung,<br />
Entscheidungen über Einstellungen/ Entlassungen<br />
19<br />
20<br />
Vgl. Wegge, Jürgen [u.a.]: Work Motivation, 2010, S.162ff.<br />
Weber, Wolfgang G. [u.a.]: Handeln, 2007, S.34/5<br />
28
Je nachdem wir weit die Implementierung der Soziokratie ist, können die Abstufungen wie<br />
folgt bewertet werden:<br />
Kategorie<br />
Beginnend<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Bsp. Soziokratie<br />
Pilotkreis Soziokratie<br />
Bis 100% Kreisstruktur<br />
Vollständige Kreisstruktur<br />
Soziokratie<br />
seit 2-3 Jahren<br />
Soziokratie ist<br />
rechtlich veranktert,<br />
institutionalisiert<br />
WEITERE EINZEL-MAßNAHMEN (DEMOKRATISCHE MITBESTIMMUNG)<br />
−<br />
Team wählt/ entscheidet über Einstellung der eigenen Führungskraft<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Anonyme Führungskräfte-Beurteilung, alle Ergebnisse sind online lesbar (z.B. Semco)<br />
Großgruppenmeeting für Strategie-Entscheidungen, die dann auch in der Großgruppe<br />
entschieden werden (eher in Richtung Basisdemokratie).<br />
Einzelne Methoden für Meeting/ Treffen, die auf hohe Mitarbeit/ Gleichwertigkeit Wert<br />
legen wie z.B. World-Cafe, Openspace, Dynamic facilitation.<br />
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN<br />
Je kleiner das Unternehmen, desto leichter lassen sich innerbetriebliche Transparenz und<br />
Demokratie leben. Deshalb ist es relativ leicht, die innerbetriebliche Demokratie bei<br />
Kleinstunternehmen umzusetzen.<br />
Innerbetriebliche Demokratie ist wesentlich mehr als die Mitbestimmung über den<br />
Betriebsrat. Es umfasst vor allem die Entscheidungen konkret im eigenen Team und für die<br />
tägliche Arbeit entweder als Grundsatz- und Rahmenentscheidungen oder konkrete<br />
operativen Entscheidungen.<br />
Der GWÖ-Bericht kann umfassend genug ausgefüllt 60-100% des Transparenzanteiles<br />
abdecken.<br />
BEST PRACTISES<br />
Soziokratie, Semco, Wagner Solar<br />
LITERATUR<br />
Fenton, Traci: The democratic Company. Four Organizations Transforming our Workplace<br />
and our World, 2002 (PDF)<br />
Ungericht, Bernhard-Mark: [Wirtschaft, 2011] Wirtschaft und Demokratie – eine Illusion.<br />
Vorlesungsskript, als PDF downloadbar<br />
Weber, Wolfgang G.: [Demokratie, 1999] Organisationale Demokratie. Anregungen für<br />
innovative Arbeitsformen jenseits bloßer Partizipation, als PDF downloadbar<br />
Wolfgang Weber G.: Wirtschaftsdemokratie von Unten (PPT)<br />
Redakteur: Christian Rüther chrisruether@gmail.com<br />
29
D1 ETHISCHES VERKAUFEN<br />
HINTERGRUND<br />
Oftmals gibt es einen deutlichen Widerspruch zwischen der gezeigten Kundenorientierung<br />
nach dem Prinzip „Der Kunde ist König!“ und der wirklichen Einstellung zum Kunden nach<br />
dem Prinzip „Der Kunde ist eine Kuh und gehört gemolken“. Gerade in Großkonzernen<br />
besteht die Gefahr, dass der Kunde immer wieder mit der Brille des Shareholder-Values<br />
betrachtet wird und lediglich als Mittel zum Zweck dient (mehr Gewinne zu machen). Ein<br />
weiteres Problem ist die „Kultur“ der Massenwerbung, die auf Manipulation und Weckung<br />
von nicht nachhalitgen Kaufimpulsen und Aufrechterhaltung von diskriminierenden<br />
Stereotypen zurückgreift.<br />
ZIEL<br />
Das Ziel bei diesem Indikator ist es, die KundInnen als gleichwertige PartnerInnen zu sehen,<br />
einen Kontakt auf Augenhöhe zu gestalten und das Wohlergehen und die Bedürfniserfüllung<br />
der KundInnen im Blick zu haben (im Gegensatz zur Steigerung der eigenen Verkäufe). Die<br />
optimale Bedürfnisbefriedigung basiert für uns auf den Werten der Suffizienz 21 und<br />
Sinnhaftigkeit, d.h. eine erfolgreiche Beratung kann auch in die Empfehlung münden, kein<br />
Produkt zu kaufen oder das Bedürfnis anders zu erfüllen. Es geht also auch um die Frage<br />
des Wozu: Wozu brauche ich wirklich ein Produkt und gibt es nicht andere Möglichkeiten,<br />
sinnerfüllt zu leben?<br />
Idealerweise werden die KundInnen in alle Prozesse rund um die Produktgestaltung<br />
eingebunden.<br />
21<br />
Suffizienz ist das Bemühen, möglichst wenig Rohstoffe zu verbrauchen und bedeutet z.B. auf<br />
persönlicher Ebene Enthaltsamkeit, Genügsamkeit und nachhaltige Produktnutzung: Brauche ich ein neues<br />
Produkt? Brauche ich es wirklich? Reicht das alte oder ein gebrauchtes Produkt aus? Oder kann ich meine<br />
Bedürfnisse auch anders erfüllen? Dabei sind Bedürfnisse ident mit Werten wie z.B. Wertschätzung,<br />
Verlässlichkeit etc. (vgl. E1).<br />
30
ABSTUFUNGEN UND MESSUNGEN<br />
Für alle Unternehmen gültig:<br />
Kategorie (je 20%)<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Institutionalisierung<br />
(Verankerung im<br />
Unternehmen)<br />
Erstes<br />
Grundkonzept +<br />
Testphase<br />
Umfassende Strategie,<br />
Gesamtausrichtung,<br />
Richtlinien vorhanden<br />
Umsetzung der<br />
Strategie zu 100%,<br />
Richtlinien werden<br />
sanktioniert<br />
Mehrjährige Praxis<br />
und<br />
Weiterentwicklung<br />
Umfang Ethisch.<br />
Marketing<br />
Grundkonzept und<br />
Testphase<br />
Mehr als 10% des<br />
Marketing Budgets<br />
Mehr als 25% des<br />
Marketing Budgets<br />
Mehr als 50% des<br />
Marketing Budgets<br />
Schulungen für<br />
Ethisch. Verkauf/<br />
Marketing<br />
Info-Veranstaltung<br />
für alle<br />
MitarbeiterInnen<br />
Mind. 2 Tage für >50%<br />
der Beteiligten<br />
Jeder Verkäufer hat<br />
mind. 2 Tage<br />
Schulung<br />
Jeder Verkäufer > 2<br />
Tage Schulung, regelmäß.<br />
Supervision<br />
Alternative zu<br />
Provisionszahlg.<br />
Verkauf/Marketing<br />
Grundkonzept und<br />
Testphase<br />
Grundgehalt unabhängig<br />
vom Verkaufszahlen<br />
+ alternative Kennzahlen<br />
z.B. Kundenzufriedenheit<br />
Länger als drei Jahre<br />
praktiziert<br />
Umfang der<br />
KundInnen-Mitbestimmung,<br />
z.B.<br />
KundInnenbeirat/<br />
gemeinsame<br />
Produktentwicklg<br />
Erste Maßnahmen<br />
zum Beirat<br />
angedacht, +<br />
Pilotprojekte<br />
gemeinsame<br />
Produktentwicklg<br />
Beirat vorhanden,<br />
Transparenz der<br />
Ergebnisse + bis 25%<br />
der Produkte<br />
gemeinsame<br />
Produktentwicklung<br />
Beirat = Umsetzung<br />
der Empfehlungen bis<br />
50% + bis 50%<br />
gemeinsame<br />
Produktentwicklung<br />
Beirat Umsetzung bis<br />
75%, mind.<br />
monatliche Treffen +<br />
bis 75% gemeinsame<br />
Produktentwicklung<br />
Nur für Unternehmen mit Waren im Einzelhandel/ für Endverbraucher:<br />
Kategorie (je 10%) Erste Schritte Fortgeschritten Erfahren Vorbildlich<br />
Produkttransparenz<br />
*<br />
Produkttransparenz<br />
über dem<br />
Branchendurchschnitt<br />
Produkttransparenz weit<br />
über dem Branchendurchschnitt<br />
Umfassend, nach<br />
einheitlichen<br />
Branchen Standards<br />
+ Verknüpfung GWÖ-<br />
Bericht<br />
Über mehrere Jahre<br />
hinweg erfolgt<br />
Zusammenarbeit<br />
mit Verbraucherschutz<br />
Vereinzelte<br />
Gespräche<br />
Regelmäßige Gespräche,<br />
Beauftragter vorhanden<br />
+ aktive und konstruktive<br />
Zusammenarbeit<br />
Über mehrere Jahre<br />
hinweg erfolgt<br />
Reklamationswes<br />
en + unabhängige<br />
Beschwstelle +<br />
positive Service-<br />
Maßnahmen<br />
Passiv:<br />
Erste Konzepte +<br />
Testphase, mind.<br />
Hotline<br />
Aktiv:<br />
Beschwerdestelle<br />
vorhanden, einfaches<br />
Reklameprocedere,<br />
umfassende Servicemaß.<br />
Proaktiv:<br />
+ Sanktionsmaßnahmen<br />
bei<br />
Beschwerden + transparentes<br />
Reporting<br />
Über mehrere Jahre<br />
hinweg vorhanden<br />
* Damit sind Angaben über Inhaltstoffe, Schadstoffe, Gefahren und Benutzerhinweise nach den höchsten<br />
verfügbaren Standards gemeint.<br />
31
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN<br />
Die letzten drei Kriterien gelten nur für Unternehmen, die Produkte über den Einzelhandel an<br />
EndverbraucherInnen anbieten. Dann gelten die oberen fünf Kriterien jeweils 14% (5x14=<br />
70%), die andere drei jeweils 10%.<br />
Die ersten fünf Kriterien dürften für alle Angebote (Produkte/Dienstleistungen) und alle<br />
möglichen Kunden (Businesskunden/Endverbraucher) jeweils mit Modifikationen gültig sein.<br />
Der KundInnenbeirat gilt vor allem für Unternehmen mit Produkten für Endverbraucher,<br />
während die gemeinsame Produktgestaltung auch schon bei Kleinstunternehmen bedeutsam<br />
werden kann (und in der Regel zum Normalfall gehört).<br />
Werden mehr als 75% der Produkte gemeinsam entwickelt, gibt es hauptsächlich<br />
Empfehlungsmarketing und Werbung über Homepage, Infoveranstaltungen sowie geringen<br />
Printmedieneinsatz, dann können Kleinstunternehmen schon nah an die Stufe „Vorbildlich“<br />
herankommen.<br />
Die Kriterien, die für das eigene Unternehmen nicht zutreffen, einfach aus der Bewertung<br />
streichen.<br />
BEST PRACTISE<br />
Kundenorientierung: Zappos und Southwest Airlines (SWA)<br />
KundInnenmitbestimmung: SMUD<br />
LITERATUR<br />
Dietl, Claudia: [Ethisch, 2010] Ethisch handeln – Erfolgreich verkaufen. Mit Mut zu neuen<br />
Verkaufsstrategien, Acabus, 2010.<br />
Gaffney, Steven: [Honesty, 2009] Honesty sells. How to make more money and increase<br />
business profits, Ney Jersey: Hohn Wiley & Sons, 2009.<br />
Kotler, Philip/ Kartajaya, Haermanawan/ Setiwan, Iwan: [Dimension, 2010] Die neue<br />
Dimension des Marketings. Vom Kunden zum Menschen, Frankfurt a.M./ New York: Campus<br />
Verlg, 2010.<br />
Morgen, Sharon Drew: [Integrity, 1999] Selling with integrity. Reinventing Sales through<br />
collaboration, respect, and serving, Ney York: Berkley books, 1999.<br />
Prahalad, C.K.: [Zukunft, 2003] Die Zukunft des Wettbewerbs. Einzigartige Werte mit dem<br />
Kunden gemeinsam schaffen, Wien: Linde, 2003<br />
Rupprecht, Susanne/ Parlow, Georg: Ethisches Marketing. Nachhaltige Strategien für Kleinund<br />
Mikro-Unternehmen, Wien: Festland-Verlag, 2008.<br />
Redakteur: Christian Rüther: chrisruether@gmail.com<br />
32
D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN<br />
HINTERGRUND<br />
Konkurrenz führe zu mehr Leistung, Effizienz, Innovation und Wohlstand, so das<br />
herrschende Verständnis. Zahlreiche Studien bestätigen das Gegenteil: Das Gegeneinander<br />
ist weniger effizient als ein Miteinander. 87% von fast 500 ausgewerteten Studien belegen,<br />
Kooperation motiviert Menschen stärker und führt zu höheren Leistungen als Konkurrenz (s.<br />
Buchtipp 1).<br />
Die stärksten Motive im Rahmen der Kooperation sind Wertschätzung, Anerkennung und<br />
das Gelingen von Beziehungen; in Rahmen der Konkurrenz ist das stärkste Motiv die Angst<br />
(s. Buchtipp 1 und 2).<br />
ZIEL<br />
Unternehmen sollen für kooperatives und solidarisches Verhalten belohnt werden. Aus<br />
ruinöser Konkurrenz soll eine Lern- und Solidargemeinschaft der Unternehmen werden.<br />
ABSTUFUNGEN UND MESSUNGEN<br />
Belohnt werden:<br />
a) kooperatives Marketing, z. B. Aufbau eines gemeinsamen Produktinformationssystems<br />
b) die Offenlegung relevanter Information (z. B. Kostenkalkulation, Zulieferquellen)<br />
c) die Weitergabe von Know-How (Open Source-Prinzip)<br />
d) die Überlassung von Arbeitskräften bei schwacher Auftragslage<br />
e) die Weiterreichung von Aufträgen<br />
f) die Unterstützung mit kostenlosen Krediten<br />
g) die Beteiligung an einer kooperativen Krisenbewältigung (Branchentisch): Bricht der Markt<br />
ein (Nachfragerückgang) oder treten plötzlich mehrere neue AnbieterInnen auf<br />
(Angebotsschwemme), reagieren Unternehmen heute mit einer Verschärfung des<br />
Wettbewerbs; in Zukunft könnten sie sich am Branchentisch versammeln und gemeinsam<br />
nach Lösungen suchen wie zum Beispiel: a) Reduktion der Arbeitszeit aller, b) Abbau<br />
einzelner Arbeitsplätze bei allen, c) solidarische Umschulung eines Teils der Beschäftigten,<br />
d) solidarische Spezialisierung eines Betriebes, e) unterstützte Schließung eines Betriebes<br />
33
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Offenlegung von<br />
Informationen +<br />
Weitergabe von<br />
Technologie (25%)<br />
Offenlegung<br />
finanzieller und<br />
technischer<br />
Information<br />
Umfassende<br />
Offenlegung von<br />
Kostenkalkulation,<br />
Bezugsquellen<br />
und Technologie<br />
Zusätzlich:<br />
Kostenlose<br />
Weitergabe<br />
einzelner<br />
Technologien<br />
vollständige<br />
Transparenz und<br />
Open source-Prinzip<br />
Weitergabe von<br />
Arbeitskräften,<br />
Aufträgen, ...<br />
kooperative<br />
Marktteilnahme<br />
(50%)<br />
Kooperation nur<br />
auf Anfrage<br />
Kooperation in<br />
Randbereichen<br />
des Geschäfts<br />
Kooperation im<br />
gesamten<br />
Geschäftsbereich<br />
+ Beteiligung an<br />
kooperativer<br />
Marktteilnahme<br />
Kooperatives<br />
Marketing (25%)<br />
Verzicht auf<br />
Schlechtmachung<br />
der Konkurrenz<br />
Verzicht auf<br />
massenmediale<br />
Werbung (TV,<br />
Radio, Plakate)<br />
Mitaufbau eines<br />
gemeinsamen<br />
Produktinformation<br />
ssystem (PIS)<br />
Mittragen der<br />
Brancheninitiative für<br />
ethisch-kooperatives<br />
Marketing<br />
HILFE FÜR UMSETZUNG<br />
Kooperationsbeauftragter. SpezialistIn für Solidarische <strong>Ökonomie</strong>.<br />
BEST PRACTISE/LITERATUR/LINKS/EXPTEREN<br />
Buchtipp 1: Alfie Kohn: „No Contest. The Case against Competition. Why we lose in our race<br />
to win“, Houghton Mifflin Company, Boston/New York.<br />
Buchtipp 2: Joachim Bauer: “Das Prinzip Menschlichkeit”, Hoffmann und Campe, Hamburg.<br />
Solidarische <strong>Ökonomie</strong>: http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarische_%C3%96konomie<br />
Multi-Kooperative Mondragón: http://www.mondragon-corporation.com<br />
Redakteur: Christian Felber: info@christian-felber.at<br />
34
D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER<br />
PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN<br />
HINTERGRUND<br />
Die derzeit global angebotenen und nachgefragten Produkte und Dienstleistungen<br />
übersteigen die vorhandenen Ressourcen sowie die ökologische Tragkraft und<br />
Regenerierbarkeit der Erde. Bisher auf Effizienz und Teilaspekte (z.B.: Einsatz<br />
nachwachsender Rohstoffe) abzielende Maßnahmen zeigen bisher nur kosmetische Effekte,<br />
welche unter anderem auf den sogenannten Rebound-Effekt 22 zurückzuführen sind. Die<br />
notwendige Trendwende im Sinne einer massiven und absoluten Reduktion des<br />
Ressourcenverbrauchs, von Emissionen und Rückständen findet nicht statt. Eine reine<br />
„Ökologisierung“ des gegenwärtig konsumierten Ausmaßes an Gütern und Dienstleistungen<br />
alleine würde das Problem des globalen Überkonsums nicht lösen. Ein Wandel hin zu einer<br />
ökologisch tragfähigen Wirtschaft muss auch in der KundInnensphäre liegenden Aspekte im<br />
Sinne einer maß- und sinnvollen Nutzung (siehe auch E1) sowie eine absolute Reduktion der<br />
konsumierten Gütern mit einschließen.<br />
ZIEL<br />
„Es gibt zumindest ein Quartett von Bedingungen der ökologischen Nachhaltigkeit zu<br />
beachten: Konsistenz- Effizienz - Suffizienz und Resilienz. Unter Konsistenz-Bedingung<br />
wird die Notwendigkeit verstanden, alle (wirtschaftlichen) Tätigkeiten so zu gestalten, dass<br />
sie sich mittelfristig in natürliche Kreisläufe einfügen können, also ungiftig, erneuerbar,<br />
abbaubar,… sind. (Kreislaufwirtschaft, Cyclonomy oder das „cradle to cradle-Konzept“ (C2C)<br />
konzentrieren sich auf diese Aspekte.). Unter Effizienz-Bedingung wird die Notwendigkeit<br />
verstanden, Energie, Material, Flächen (und Geld-Mittel) effizient einzusetzen, d.h. möglichst<br />
viel Nutzung pro eingesetztem Gut zu erzielen, da diese begrenzt sind. Unter Suffizienz-<br />
Bedingung wird die Notwendigkeit verstanden, mit dem physisch Vorhandenen<br />
auszukommen. Dies kann pro Haushalt, pro Nationalstaat, aber am sinnvollsten natürlich pro<br />
Planet betrachtet werden. Unter Resilienz–Bedingung wird die Notwendigkeit verstanden,<br />
das Puffervermögen unserer Systeme (natürliche wie technische oder wirtschaftliche) soweit<br />
zu festigen, dass die Systeme auch bei Störungen halbwegs stabil bleiben können. Zur<br />
Resilienz der Ökosysteme tragen ganz entscheidend Artenvielfalt, Boden- und<br />
Wasserqualität bei. Auch bei technischen und wirtschaftlichen Systemen ist Vielfalt ein<br />
stabilisierender Faktor, ebenso wie Transparenz und der Grad der Beteiligung aller<br />
Betroffenen.“ (Plattform Footprint: Die vier Säulen - Zukunftsfähig statt nachhaltig!;<br />
http://www.footprint.at/index.php?id=8032)<br />
Das Produkt / Dienstleistungsportfolio eines Unternehmens sollte folglich diesen<br />
Anforderungen mit folgender grober Zielsetzung entsprechen: Unternehmen bieten im<br />
Branchenvergleich ökologisch hochwertige Produkte / Dienstleistungen an und ermöglichen<br />
22<br />
Madlener, R; Alcott, B. 2007: Steigerung der Effizienz: Problem oder Lösung; Energiewirtschaftliche<br />
Tagesfragen 57. Jg, Heft 10; http://www.blakealcott.org/pdf/et-problem-oder-loesung.pdf<br />
35
und fördern eine möglichst suffiziente, maßvolle Nutzung sowie sinnvolle Anwendung Ihrer<br />
Produkte und Dienstleistungen.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Belohnt wird eine aktive Herangehensweise in Bezug auf alle drei Kriterien, wobei<br />
Unternehmens- und Branchenspezifika große Bedeutung auf die Relevanz der einzelnen<br />
Aspekte haben (siehe weiter unten).<br />
Hinsichtlich ökologischer Aspekte überdurchschnittliche Produkte / Dienstleistungen im<br />
Vergleich mit zu anderer MitwerberInnen bzw. alternativen Möglichkeiten vergleichbarer<br />
Bedürfnisbefriedigung (Effizienz, Konsistenz und Resilienz). Zu berücksichtigende Aspekte<br />
reichen von Ressourcen- und Energieverbrauch, der Vermeidung kritischer Substanzen,<br />
Rezyklierbarkeit und Schließung von Produktions-Stoffkreisläufen, etc.<br />
aktive Gestaltung der Rahmenbedingungen für suffiziente Konsummuster (Suffizienz):<br />
Hierunter fallen Aspekte welche eine suffiziente Bedürfnisbefriedigung in den Vordergrund<br />
rücken (Verlängerung der Produktnutzung, Forcierung gemeinschaftliche Produktnutzung,<br />
Integration der Kunden in Re- und Upcycling-Prozesse, Vermeidung kritischer<br />
Einsatzgebiete der Produkte und Dienstleistungen). Produkte / Dienstleistungen, die in den<br />
Absatzmärkten des Unternehmens durch eine Übernutzung charakterisiert sind (z.B.: fossile<br />
Energieträger, tierische Produkte) können demnach nur eine sehr geringe Beurteilung<br />
bekommen. Umgekehrt sind Produkte und Dienstleistungen, denen eine suffiziente Nutzung<br />
inhärent sind positiv zu beurteilen (z.B.: Geschäftsmodelle, welche auf gemeinschaftlicher<br />
Nutzung, Re- und Upcycling und ähnlichem basieren)<br />
Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte: Bewusstsein über ökologische Aspekte von<br />
Produkten und Dienstleistungen den KundInnen gegenüber ist gegenwärtig schwach<br />
ausgeprägt. Eine aktive die KundInnen miteinbeziehende Kommunikationspolitik kann einen<br />
kulturellen Wandel zusätzlich stimulieren.<br />
Je nach Branche können hierbei unterschiedliche Aspekte in ihrer Gewichtung von<br />
Bedeutung sein: Bei Produkten beispielsweise die Reduktion der ökologischen<br />
Auswirkungen in der Herstellung und Nutzung (Energieverbrauch, Emissionen) oder die<br />
Erhöhung der Lebensdauer durch langlebige Konstruktionen sowie umfassende<br />
Reparaturdienstleistungen. Dienstleister verfügen, wenngleich durch einen geringeren<br />
direkten Ressourcenverbrauch gekennzeichnet, über ein großes ökologisches<br />
Gestaltungspotential. Bei einer Bank beispielsweise über das „was“ finanziert wird, bei einem<br />
Unternehmensberater darüber „wer“ in „welchen inhaltlichen Fragestellungen“ beraten wird,<br />
bei Weiterbildungsprogrammen und Veranstaltungen etwa über die Mobilitätsauswirkungen<br />
der TeilnehmerInnen oder die konkreten Bildungsinhalte. Zukünftig gilt es die relativ vage<br />
umschriebenen Messkriterien auf Branchen- und Produktebene näher zu definieren:<br />
36
Kriterien<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
EFFIZIENZ &<br />
KONSISTENZ:<br />
Produkte /<br />
Dienstleistungen<br />
sind im ökol.<br />
Vergleich zu<br />
MitwerberInnen<br />
bzw. Alternativen<br />
mit vergleichbarem<br />
Nutzen<br />
(40-70%)<br />
sind durch einen im<br />
Vergleich<br />
geringeren<br />
ökologischen<br />
Fußabdruck bzw.<br />
durch erste Ansätze<br />
einer überdurchschnittlichen,<br />
ökologische<br />
Gestaltung<br />
gekennzeichnet<br />
Das Unternehmen<br />
verfügt über eine<br />
klare,<br />
nachvollziehbare<br />
Strategie und<br />
erkennbare<br />
Maßnahmen zur<br />
Ökologisierung der<br />
Produkte /<br />
Dienstleistungen<br />
P / D weit über<br />
Branchendurchschnitt<br />
(z.B.:<br />
BAT = Best<br />
Available<br />
Technology; )<br />
P / D<br />
branchenführend<br />
(z.B.: Cradle-to-<br />
Cradle)<br />
SUFFIZIENZ: Aktive<br />
Gestaltung für eine<br />
ökol. Nutzung und<br />
suffizientem<br />
Konsum<br />
(20-40%)<br />
Das Unternehmen<br />
setzt sich mit nichtsuffizienten<br />
/<br />
potentiell<br />
schädlichen<br />
Anwendungsgebiete<br />
n seiner P / D 23 aktiv<br />
auseinander (z.B.:<br />
interne Analyse der<br />
eigenen Produkte /<br />
Dienstleistungen)<br />
Produkte sind nicht<br />
widersprüchlich zu<br />
einem suffizienten<br />
Lebensstil<br />
Erste Maßnahmen<br />
für suffiziente<br />
Lebensstile<br />
(Anwendung von<br />
Ausschlusskriterien,<br />
P/D für ökologisch<br />
orientierte<br />
Absatzmärkte)<br />
Das Unternehmen<br />
fördert eine<br />
nachhaltige Nutzung<br />
aktiv durch bessere<br />
Konditionen und<br />
Services (z.B.:<br />
(Preisvorteile,<br />
Anreizsysteme,<br />
längere<br />
Gewährleistung,<br />
kostengünstige<br />
Reparatur)<br />
Umfassende<br />
Förderung eines<br />
ökologisch<br />
suffizienten<br />
Kundenverhaltens:<br />
(Preisvorteile &<br />
Anreiz-systeme;<br />
Reparatur,<br />
Wiederverwendung<br />
und<br />
gemeinschaftliche<br />
Nutzung<br />
wesentlicher<br />
Bestandteil des<br />
Geschäftsmodells)<br />
KOMMUNIKATION<br />
Aktive<br />
Kommunikation<br />
ökologischer<br />
Aspekte den<br />
KundInnen<br />
gegenüber (10%-<br />
20%)<br />
Das Unternehmen<br />
weist aktiv auf<br />
höherwertige<br />
Alternativen (auch<br />
bei MitwerberInnen)<br />
hin<br />
Explizite und<br />
umfassende<br />
Informationen über<br />
die ökologischen<br />
und Lebensstil-<br />
Aspekte der P / D<br />
hin<br />
Von Kunden wird<br />
aktiv -Feedback zu<br />
ökologischen und<br />
Lebensstil-Aspekten<br />
eingeholt (z.B.:<br />
Nutzungsverhalten,<br />
Verbesserungspotentiale,<br />
etc. )<br />
Ökologische und<br />
Lebensstil-Aspekte<br />
wesentlicher Inhalt<br />
der KundInnenbeziehungen<br />
UMSETZUNG<br />
Siehe Handbuch<br />
Redakteur: Christian Loy: christian.loy@gmx.at<br />
23<br />
P / D = Produkte und Dienstleistungen<br />
37
D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND<br />
DIENSTLEISTUNGEN<br />
HINTERGRUND<br />
Dieser Indikator zielt in erster Linie auf die Wahrnehmung sozialer Verantwortung von in der<br />
KundInnensphäre liegenden Aspekten ab. Hierunter fällt sowohl die Herabsetzung von<br />
Hindernissen für benachteiligte VerbraucherInnen als auch die Verantwortungsübernahme<br />
für ethische / soziale Standards.<br />
ZIEL<br />
Unternehmen berücksichtigen bei der Gestaltung ihrer Produkte und Dienstleistungen die<br />
Bedürfnisse benachteiligter KundInnen. Dies kann über unterschiedliche Maßnahmen<br />
erfolgen: soziale Preisstaffelung, besondere Produktgestaltung, barrierefreien Zugang zu<br />
Produkten/Dienstleistungen/Information/Beratung, aber auch auf die Bedürfnisse<br />
benachteiligter KundInnen angepasste Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus setzt<br />
sich das Unternehmen aktiv mit potentiell kritischen, ethischen Aspekten in der<br />
KundInnensphäre auseinander und versucht diese effektive zu vermeiden.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Im Rahmen dieses Indikators werden mehrere Themenfelder getrennt voneinander bewertet:<br />
a) Die Berücksichtigung ökonomischer Barrieren in der Kundensphäre: Neben<br />
einkommensschwache Haushalte fallen hierunter auch ökonomischen Limitierungen<br />
unterworfenen Unternehmungen (z.B.: NGOs, Bildungseinrichtung, Universitäten,<br />
Gesundheits- und Sozialwesen, etc.). b) Der barrierefreier Zugang zu bzw. Gestaltung von<br />
Produkten und Dienstleistungen sowie c) Prozesse / Maßnahmen bezüglich ethischer<br />
Risiken und sozialer Aspekte in der Kundensphäre: Neben potentiell problematischen<br />
Geschäftsbeziehungen zu kritischen Branchen 24 und Unternehmen 25 bzw. den Umgang mit<br />
kritischen Anwendungsbereichen (Gesundheitsrisiken, Suchtpotential, Schuldenfalle,<br />
missbräuchliche Nutzung, etc.)<br />
24<br />
25<br />
z.B.: Rüstung, Atomkraft, Suchtmittel, Prostitution, Gentechnik, etc.<br />
Menschenrechtsverletzungen, Korruption, pol. Einflussnahme, massive Umweltverschmutzung, etc.<br />
38
Kriterium<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Berücksichtigung<br />
ökonomischer<br />
Barrieren in der<br />
Kundensphäre<br />
(B2C: 30-40%;<br />
B2B: 5-40%)<br />
Das Unternehmen<br />
bietet einkommensschwachen<br />
Kunden<br />
gelegentlich P/D zu<br />
günstigere<br />
Konditionen an<br />
(betrifft mind. 1%<br />
der Umsätze / des<br />
Produktionsoutput).<br />
Das Angebot ist<br />
transparent<br />
dargestellt (z.B.: auf<br />
der Webseite)<br />
Das Unternehmen<br />
bietet einkommensschwachen<br />
Kundinnengruppen<br />
gelegentlich P/D zu<br />
günstigere<br />
Konditionen an<br />
(betrifft 3-5% der<br />
Umsätze / des<br />
Produktionsoutputs)<br />
KundInnengruppen<br />
werden aktiv<br />
angesprochen<br />
Regelmäßige und<br />
umfangreiche<br />
soziale<br />
Preisstaffelung<br />
(betrifft 5-10% der<br />
Umsätze / des<br />
Produktionsoutputs)<br />
Etablierte,<br />
ausgeprägte soziale<br />
Preisstaffelung<br />
(betrifft >10% der<br />
Umsätze / des<br />
Produktionsoutput)><br />
Barrierefreier<br />
Zugang zu und<br />
Gestaltung von<br />
Produkten und<br />
Dienstleistungen;<br />
4 Dimensionen:<br />
physisch, visuell,<br />
sprachlich,<br />
intellektuell (B2C:<br />
40-60%; B2B: 5-<br />
40%)<br />
Barrierefreier<br />
Zugang in einer der<br />
vier Dimensionen<br />
sichergestellt (z.B.:<br />
Alle wesentlichen<br />
Standorte / Produkte<br />
/ Dienstleistungen<br />
physisch<br />
barrierefrei)<br />
Barrierefreier<br />
Zugang in zwei der<br />
vier Dimensionen<br />
sichergestellt (z.B.:<br />
+ Sicherstellung des<br />
Informationszugang<br />
e bei reduziertem<br />
Seh- und<br />
Hörvermögen)<br />
Benachteiligte<br />
KundInnengruppen<br />
werden aktiv<br />
angesprochen<br />
Das Unternehmen<br />
stellt einen<br />
barrierefreien<br />
Zugang in drei der<br />
vier Dimensionen<br />
sicher<br />
(z.B.: + Information /<br />
Beratung ist in den<br />
Sprachen von<br />
Minderheiten /<br />
MigrantInnengruppe<br />
n verfügbar )<br />
Das Unternehmen<br />
stellt einen<br />
barrierefreien<br />
Zugang in drei der<br />
vier Dimensionen<br />
sicher (z.B.: +<br />
Wesentliche<br />
Informationen sind<br />
in einer Easy-2-<br />
Read Version<br />
verfügbar)<br />
Prozesse und<br />
Maßnahmen<br />
bezüglich<br />
ethischer Risiken<br />
und sozialer<br />
Aspekte in der<br />
Kundensphäre<br />
(B2C: 10-30%;<br />
B2B: 30-50%)<br />
Keine<br />
Geschäftsbeziehung<br />
en mit ethisch<br />
kritischen<br />
Unternehmen<br />
Regelmäßige<br />
Evaluierung<br />
potentiell kritischer<br />
Aspekte in der<br />
KundenInnen-<br />
Sphäre<br />
Durchführung erster<br />
Maßnahmen<br />
Reduzierte Risken<br />
der P/D im Vergleich<br />
zu<br />
Alternativprodukten<br />
Ausformuliertes<br />
Konzept, Strategie<br />
und etablierte<br />
Maßnahmen zur<br />
Adressierung<br />
potentiell kritischer<br />
Aspekte in der<br />
KundInnen-Sphäre<br />
(z.B.: Integration<br />
von Experten)<br />
Umfassende<br />
Auseinandersetzung<br />
mit sozialen<br />
Aspekten in den<br />
KundInnenbeziehun<br />
g (z.B.:<br />
Institutionalisierte<br />
Überprüfung über<br />
die Wirksamkeit der<br />
Maßnahmen)<br />
UMSETZUNG<br />
Siehe Handbuch<br />
Redakteure: Christian Loy, Christoph Spahn: spahn@christophspahn.de<br />
39
D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN<br />
BRANCHENSTANDARDS<br />
HINTERGRUND<br />
Obwohl es derzeit nicht wenige ordnungspolitische Standards für soziale Sicherheit,<br />
Nachhaltigkeit oder Offenlegung der Lobbying-Aktivitäten gibt, verschlechtern sich global<br />
viele soziale und ökologische Probleme. Viele Faktoren erschweren eine Umsetzung höherer<br />
sozialer und ökologischer Branchenstandards, wobei meist die Wettbewerbsfähigkeit des<br />
Standortes (im Falle lokaler, nationaler oder supranationaler Regulierungen) bzw.<br />
ökonomische Restriktionen bei Unternehmen (im Falle von Branchenstandards) eine<br />
wesentliche Rolle spielen. Die freiwillige Anhebung von ökologischen oder sozialen<br />
Standards führt in der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung oftmals zu einem<br />
Wettbewerbsnachteil.<br />
ZIEL<br />
Ziel ist, dass Unternehmen einer Branche bezüglich der für sie relevanten sozialen und<br />
ökologischen Aspekte kooperieren, innovative Lösungen finden bzw. bereits bestehenden<br />
Initiativen (z.B.: Label, freiwillige Branchenstandards) beitreten und diesbezügliche<br />
Informationen transparent anderen MitwerberInnen zugänglich machen, um hiermit zu einer<br />
Erhöhung der Standards beizutragen. Auf politischer Ebene setzen sie sich – mit ihrer Größe<br />
und ihrem politischen Gewicht entsprechenden Maßnahmen - öffentlich und transparent für<br />
strengere gesetzliche Rahmenbedingungen ein.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Drei unterschiedliche Ansätze finden hinsichtlich der Erhöhung der sozialen und<br />
ökologischen Branchenstandards Berücksichtigung: Die Zielerreichung kann über<br />
Kooperationen mit MitwerberInnen und Wertschöpfungspartnern sowie die aktive,<br />
transparente Partizipation am politischen Prozess und die Offenlegung aller Lobbying-<br />
Aktivitäten erfolgen. Initiativen zur Erhöhung der Branchenstandards sind sowohl hinsichtlich<br />
ihrer unternehmensinternen Reichweite als auch ihrer inhaltlichen Qualität zu beurteilen.<br />
Reichweite ist hierbei im Sinne des Umsatz-, Produktions- oder Leistungsanteils der<br />
Produkte und Dienstleistungen, für welche die höheren Standards tatsächlich gelten, zu<br />
verstehen. Hinsichtlich der inhaltlichen Qualität geht es um Breite und Tiefe beinhaltenden<br />
Aspekte – handelt es sich nur um einzelne soziale bzw. ökologische Randaspekte der<br />
Branche oder werden mehrere, branchenrelevante Risiken durch die Standarderhöhung<br />
adressiert.<br />
40
Kriterium<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Kooperation mit<br />
MitwerberInnen und<br />
Partner der<br />
Wertschöpfungsket<br />
te (20%-40%)<br />
Erste Pilotprojekte<br />
zur gemeinsamen<br />
Entwicklung höherer<br />
Standards mit<br />
Marktpartnern (z.B.:<br />
F&E-Kooperation)<br />
Aktive<br />
Kommunikation<br />
höherer Standards<br />
nach Außen (z.B.:<br />
Webseite)<br />
Regelmäßige,<br />
etablierte<br />
Mechanismen zur<br />
gemeinsamen<br />
Entwicklung höherer<br />
Standards<br />
Höhere Standards<br />
wesentlichen<br />
Bestandteil der<br />
Kommunikationspoliti<br />
k des Unternehmen<br />
Selbstverpflichtung<br />
auf Branchenebene<br />
Sicherstellung und<br />
Überprüfbarkeit der<br />
höheren Standards<br />
(z.B.: externe Audits<br />
und unabhängige<br />
Kontrollen;<br />
Kooperation mit<br />
NGOs)<br />
Aktiver Beitrag zur<br />
Erhöhung<br />
legislativer<br />
Standards (5%-20%)<br />
Transparente<br />
Offenlegung der<br />
politischen Aktivitäten<br />
Kein Widerstand<br />
gegen höhere soziale<br />
und ökologische<br />
legislative Standards<br />
Brancheninternes<br />
Engagement für<br />
höhere legislative<br />
Standards<br />
(z.B.: im Kooperation<br />
mit<br />
Branchenvertretung)<br />
Über die Branche<br />
hinausgehendes<br />
Engagement für<br />
höhere legislative<br />
Standards<br />
(z.B.: Kooperation mit<br />
NGOs)<br />
Transparente,<br />
wesentliche<br />
Berührungsgruppen<br />
inkludierender<br />
Lobbying-Prozess<br />
(z.B.: Ausformulierte<br />
Gesetzesinitiativen,)<br />
Reichweite,<br />
inhaltliche Breite<br />
und Tiefe (40%-<br />
60%)<br />
Ein sozial oder<br />
ökologischer<br />
Randaspekt betroffen<br />
Ein wesentlicher<br />
sozial oder<br />
ökologischer Aspekt<br />
betroffen<br />
Tatsächliche<br />
Umsetzung höherer<br />
Standards betrifft ><br />
25% des Umsatzes<br />
Mehrere, wesentliche<br />
sozial oder<br />
ökologische Aspekte<br />
betroffen<br />
Tatsächliche<br />
Umsetzung höherer<br />
Standards > 50%<br />
Alle wesentlichen<br />
sozialökologischen<br />
Aspekte<br />
Erhöhung der<br />
Branchenstandards<br />
ist inhärenter<br />
Bestandteil der<br />
Unternehmenspositionierung<br />
(><br />
90%)<br />
Redakteure: Christoph Spahn, Christian Loy: christian.loy@gmx.at<br />
41
E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER<br />
PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN<br />
HINTERGRUND<br />
Produkte und Dienstleistungen stiften bis dato primär für Kunden und Kundinnen Nutzen. Bei<br />
Betrachtung des Gesamtsystems unseres Planeten kann eine reine Nachfragebefriedigung<br />
nicht Ziel gemeinwohlorientierter Unternehmen sein. Es gilt die gesellschaftliche Wirkung<br />
sowie die Sinnhaftigkeit der Produkte und Dienstleistungen zu bewerten. Neben der<br />
allgemeinen Frage, welches Grundbedürfnis das Produktportfolio direkt und indirekt<br />
befriedigt, ist darüber hinaus die Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit zu berücksichtigen.<br />
Die heutigen Konsummuster sind unter dem Aspekt limitierter Ressourcen, sozialer globaler<br />
Gerechtigkeit und ökologischer Folgewirkungen zu betrachten. Neben dem<br />
grundsätzlichen Produktsinn kommt hierbei der sinnvollen und der maßvollen Nutzung<br />
(Suffizienz) eine wesentliche Bedeutung zu.<br />
ZIEL<br />
Zielsetzung der <strong>Gemeinwohl</strong>ökonomie ist es, dass global nur noch das produziert wird, was<br />
die Menschen wirklich benötigen und das auf so ökologisch schonende Weise wie möglich.<br />
Unternehmen sollen Impulse erhalten, sinnvolle und sozial wie ökologisch schonende<br />
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten. Zweck der <strong>Gemeinwohl</strong>-<br />
Unternehmen ist es, sämtliche Mitglieder der Gesellschaft mit dem rechten Maß an<br />
nützlichen, d.h. für ein physisch und psychisch gesundes und suffizientes Leben nötigen<br />
Produkten und Dienstleistungen zu versorgen und diese so sozial und ökologisch wie<br />
möglich zu erzeugen.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Um der Komplexität dieses Indikators gerecht zu werden, gilt es die Produkte und<br />
Dienstleistungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten:<br />
−<br />
−<br />
Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse: Der Sinn eines Produktes oder einer<br />
Dienstleistung kann darin erkannt werden, ob ein P/D zur Deckung menschlicher<br />
Grundbedürfnisse dient und in welcher Form Nutzen gestiftet wird. Max-Neef’s Human-<br />
Scale-Development-Ansatz26 gibt Hilfestellung zur Messung von neun<br />
Grundbedürfnissen des Menschen sowie zur Klassifizierung unterschiedliche Arten von<br />
Nutzen (Details siehe Handbuchbeitrag zu E1).<br />
Indirekte Bedürfnisbefriedigung im B2B-Bereich: eine an sich sinnvolle Dienstleistung<br />
kann sowohl einem <strong>Gemeinwohl</strong> orientierten als auch für eine/n das <strong>Gemeinwohl</strong><br />
verletzenden Kunden/in erbracht werden. Hier sind die direkte und eine indirekte<br />
Bedürfnisbefriedigung zu unterscheiden. Einerseits befriedigen Anbieter direkt ein<br />
Bedürfnis bei seinen AbnehmerInnen, andererseits tragen diese indirekt zur Leistung<br />
des Unternehmens und damit indirekt zur Wirkung dessen<br />
Produkt/Dienstleistungsportfolios bei.<br />
26<br />
Human Scale Development: Conception, application and further reflections – Manfred A. Max-Neef<br />
http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf<br />
42
−<br />
−<br />
−<br />
Die gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen kann speziell bewertet<br />
werden durch den sozialen (Sozial- und Kulturverträglichkeit) und ökologischen<br />
Vergleich (Naturverträglichkeit, Suffizienz, Genügsamkeit) zu Alternativen mit<br />
ähnlichem Endnutzen. Beispielsweise ist ein Auto nicht nur im Vergleich zu anderen<br />
Autos zu sehen, sondern mit sämtlichen Alternativen hinsichtlich Mobilität (Zug, Bus,<br />
Bahn, etc.). Betrachtet wird hierbei der gesamte Lebenszyklus / die gesamte<br />
Wertschöpfungskette „vom Rohstoff bis zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung“ sowie<br />
die soziale und kulturelle Wirkung des Produkts. Hierbei verweisen wir auch auf die<br />
andere Indikatoren A1, D3 und D4.<br />
Sozial- und Kulturverträglichkeit: Neben den sozialen Effekten über den gesamten<br />
Lebenszyklus geht es um eine Betrachtung der Produkte und Dienstleistungen<br />
hinsichtlich Einsatzbereich, Gesundheitswirkung, Suchtgefahr oder nutzungsfremde<br />
Statusfunktion.<br />
Naturverträglichkeit, Suffizienz, Genügsamkeit: Derzeitige westliche Konsummuster,<br />
speziell „welche Produkte und Dienstleistungen wir in welchem Ausmaß“ konsumieren,<br />
sind aus ökologischer Sicht (Klimawandel, Ressourcenknappheit, ökologischer<br />
Fußabdruck, etc.) sowie aus sozialer Sicht (globale Gerechtigkeit) nicht zukunftsfähig<br />
(siehe auch D3 Ökologische Produktgestaltung). Viele Produkte und Dienstleistungen<br />
entfalten erst durch die gegenwärtige Nutzungsintensität ihre destruktive Kraft (z.B.<br />
fossile Energieträger, tierische Nahrungsmittel).<br />
43
Kriterien<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Unternehmensinterne<br />
Prozesse<br />
Evaluierung der<br />
direkten und<br />
indirekten Wirkung<br />
der P/D<br />
Konzept und<br />
Strategie zur<br />
Reduktion negativer<br />
Produktwirkungen<br />
Institutionalisierte<br />
Überprüfung der<br />
Wirksamkeit der<br />
Maßnahmen<br />
Regelmäßige<br />
Berichterstattung über<br />
die gesellschaftliche<br />
Wirkung der P/D<br />
Welche positiven Nutzen<br />
oder negative<br />
Folgewirkungen<br />
entstehen direkt oder<br />
indirekt durch unsere<br />
P/D?<br />
Mehrheitlich positive<br />
Wirkungen unserer<br />
Produkte auf<br />
KundInnen<br />
Keine primäre<br />
Statusfunktion,<br />
Ersatzbefriedigung<br />
oder Suchtwirkung.<br />
Mehrheitlich positive<br />
Produktwirkungen<br />
und aktive<br />
Bearbeitung<br />
möglicher negativer<br />
Folgen.<br />
Ausschließlich<br />
positive<br />
Produktwirkungen.<br />
P/D befriedigt<br />
Grundbedürfnisse und<br />
löst wesentliche<br />
gesellschaftliche<br />
Probleme, z.B. Armut,<br />
Gesundheit, Bildung<br />
Kulturverträglichkeit:<br />
Wie sind soziale<br />
Aspekte im<br />
Wertschöpfungsprozess<br />
im Vergleich zu<br />
Alternativen mit<br />
ähnlichem Endnutzen zu<br />
beurteilen? (Siehe<br />
soziale Aspekte bei A1<br />
sowie D4)<br />
Punktuelle Ansätze<br />
über<br />
Branchendurchschnitt<br />
Hinsichtlich sozialen<br />
Aspekte<br />
überdurchschnittlich<br />
e, P/D<br />
Hinsichtlich<br />
sozialer Aspekte<br />
wesentlich besser<br />
als Branchendurchschnitt<br />
Im Vergleich zu<br />
Alternativen sozial<br />
hochwertigste P/D<br />
Naturverträglichkeit,<br />
Suffizienz /<br />
Genügsamkeit:<br />
Wie sind ökologische<br />
Aspekte unserer P/D im<br />
Vergleich zu P/D mit<br />
ähnlichen Endnutzen zu<br />
beurteilen? (siehe D3)<br />
Punktuelle Ansätze<br />
über<br />
Branchendurchschnitt<br />
Hinsichtlich<br />
ökologischer<br />
Aspekte<br />
überdurchschnittlich<br />
e, P/D<br />
Hinsichtlich<br />
ökologischer<br />
Aspekte wesentlich<br />
besser als<br />
Branchendurchschnitt<br />
Im Vergleich zu<br />
Alternativen<br />
ökologisch<br />
hochwertigste P/D<br />
HILFEN FÜR DIE UMSETZUNG<br />
Für eine systematische Auseinandersetzung können tiefer gehende Fragestellungen den<br />
Diskurs im Unternehmen unterstützen. (siehe Handbuchbeitrag E1)<br />
RedakteurInnen: Angela Drosg-Plöckinger: a.drosg@mehrwerte.at , Christian Loy<br />
44
E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN<br />
HINTERGRUND<br />
Der Begriff „Unternehmensbürgerschaft“ beschreibt das aktive Engagement des<br />
Unternehmens als Bürger für das Gemeinwesen. Ähnlich wie ein normaler Bürger sich<br />
ehrenamtlich engagieren kann, kann auch eine Organisation einen (nicht profitorientierten)<br />
Beitrag für die Gesellschaft leisten.<br />
ZIEL<br />
Jedes Unternehmen soll seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und im<br />
Rahmen seiner Möglichkeiten einen angemessen Beitrag leisten um gesellschaftliche<br />
Defizite auszugleichen und/oder die Fähigkeiten der Gesellschaft insgesamt zu heben.<br />
Neben den von den Unternehmen erbrachten Leistungen soll in verstärktem Ausmaß auch<br />
die Wirkung dieser Maßnahmen (der „gesellschaftliche Footprint“) bewertet werden.<br />
DEFINITION<br />
Der Beitrag zum Gemeinwesen beruht auf einer freiwilligen Leistung, die vorwiegend der<br />
Allgemeinheit zugute kommt, auch wenn ein gewisser Eigennutzen des Unternehmens damit<br />
verbunden sein kann. Es handelt sich dabei aber z.B. nicht um Sponsoring von Profi-Sport<br />
oder Großveranstaltungen, die Trennlinien sind allerdings nicht immer leicht zu ziehen.<br />
Leistungen sind z.B.<br />
− finanzielle Mittel, insbesondere Geldspenden, zinslose oder zinsgünstige Kredite oder<br />
Einzahlungen an Stiftungen oder Förderpreise<br />
− Arbeitsleistungen oder die Zurverfügungstellung von materiellen Ressourcen<br />
− Bereitstellung immateriellen Vermögens wie Wissen (Beratung, Schulung,<br />
Qualifizierung) oder die Zurverfügungstellung von Kontakten und Einfluss<br />
Wirkungen sind z.B.<br />
− die Verbesserung individuellen Wohlbefindens, der Gesundheit und<br />
Beschäftigungsfähigkeit, Lösung gesellschaftlicher Probleme (siehe z.B.: UN Human<br />
Development Goals)<br />
− die Reduktion sozialer Kosten, die z.B. als Folge wirtschaftlicher Tätigkeit entstehen<br />
(z.B. Kosten durch Rehabilitationsmaßnahmen, Beseitigung ökologischer Schäden)<br />
− die Steigerung der Leistungsfähigkeit gesellschaftlicher Einrichtungen oder die<br />
bessere Verfügbarkeit kollektiver Güter wie Raum, Kapital oder Wissen für die<br />
Allgemeinheit<br />
Zusätzlich werden dabei das Wirkungsspektrum der Maßnahmen und die zeitliche Wirkung<br />
bewertet.<br />
Zusatzfaktoren können die Bewertung nach oben oder unten korrigieren, diese sind z.B.<br />
− die Ausgewogenheit zwischen den faktischen Möglichkeiten des Unternehmens und<br />
den tatsächlich erbrachten Leistungen<br />
− die „Stimmigkeit“ der angestrebten Wirkungen mit der Gesamtstrategie und den<br />
wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens<br />
− die Übernahme konkreter Verantwortung und die Nachhaltigkeit des Engagement<br />
45
BANDBREITE UND MESSUNG<br />
Kategorie<br />
Anteil<br />
Erste Schritte<br />
(0-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Leistungen<br />
27 70% 0-0,5% 0,5-1,5 1,5-2,5 % > 2,5%<br />
Wirkungen 30%<br />
+/-<br />
20%<br />
Zusatzfaktor<br />
(maximal)<br />
28<br />
Vereinzelt spürbare<br />
Wirkungen mit<br />
vorwiegendem<br />
Symptomcharakter<br />
Vereinzelte<br />
Maßnahmen, nicht<br />
institutionalisiert,<br />
geringe<br />
Verantwortungsübernahme<br />
Vertiefte Wirkungen ohne<br />
Nachhaltigkeit oder erste<br />
breitenwirksame<br />
Maßnahmen<br />
Regelmäßig einzelne<br />
Maßnahmen, erste<br />
Strategie erkennbar,<br />
Verantwortlichkeit<br />
erkennbar<br />
Vertiefte und<br />
nachhaltige Wirkung in<br />
einzelnen Feldern<br />
Umfassende Strategie,<br />
institutionalisierte<br />
Umsetzung,<br />
weitgehende<br />
Verantwortungsübernahme<br />
Nachhaltige<br />
Wirkung in<br />
mehreren Feldern<br />
dementsprechen<br />
de Praxis seit<br />
mind. drei Jahren<br />
Redakteur: Manfred Kofranek: manfred.kofranek@inode.at<br />
27 Geldwerter Umfang aller Maßnahmen (% vom Jahresumsatz bzw. der Jahresarbeitszeit)<br />
28 Additiv zum Gesamtergebnis aus Leistungen und Wirkungen, wobei insgesamt 100% nicht<br />
überschritten werden dürfen.<br />
46
E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN<br />
HINTERGRUND<br />
Sowohl auf globaler als auch regionaler Ebene haben gesellschaftliche Aktivitäten zu einer<br />
massiven Degradation und Störung der Ökosysteme beigetragen. 29 Für eine Transformation<br />
zu einer ökologisch nachhaltigen <strong>Ökonomie</strong> ist jede Branche und jedes Unternehmen<br />
gefordert zu einer signifikanten Reduktion der ökologischen Auswirkungen beizutragen. 30<br />
ZIEL<br />
Ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen a) setzt sich aktiv mit seinen ökologischen<br />
Auswirkungen auseinander, b) erhebt und dokumentiert seine direkten und indirekten<br />
Umweltauswirkungen - angemessen für der Unternehmensgröße und -aktivitäten und<br />
versucht c) seine Auswirkungen kontinuierlich zu reduzieren. Zielsetzung ist, dass die<br />
Unternehmensaktivitäten den vier Bedingungen der Effizienz, Konsistenz, Suffizienz und<br />
Resilienz entsprechen (siehe D3 – Ökologische Produktgestaltung).<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Für die Bewertung sind sowohl die absolute Umweltauswirkungen als auch die relative (im<br />
Branchenvergleich) zu beachten. Je nach Branche können sehr unterschiedliche Aspekte<br />
von Relevanz sein, weshalb zukünftig auf Branchenebene eine Präzisierung notwendig ist:<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Ressourcen: absoluter Materialeinsatz (Rohstoffe, Vorprodukte, Papier, etc.), Einsatz<br />
von Sekundärrohstoffe, Substitution durch ökologisch höherwertige Rohstoffe,<br />
Wasserverbrauch, Recycling und stoffliche Wiederverwendung, etc.<br />
Energie & Klima: Treibhausgas-Emissionen im Branchenvergleich; %-erneuerbarer<br />
Energieträger; Reduktion Energieverbrauch pro Mitarbeiter; Mobilitätsstatistiken<br />
Sonstige Emissionen in Luft, Wasser und Boden: SO²; NOx, VOC, PM, Schwermetalle,<br />
kanzerogene / mutagene / radioaktive Stoffe, Allergene, Dioxine, Furane, etc.<br />
Für die Beurteilung spielt der Branchenhintergrund eine wesentliche Rolle, eine Präzisierung<br />
erfolgt auf dieser Ebene. Für ein Unternehmen mit hohen ökologischen Auswirkungen (z.B.:<br />
Rohstoffexploration und -produktion) sind die Anforderungen sowohl hinsichtlich des<br />
Informationsbedarfs als auch die tatsächlichen Aktivitäten zur Reduktion weitaus<br />
anspruchsvoller zu sehen.<br />
29 Siehe u.a. das Millenium Ecosystem Assessment des UNEP (United Nations Environmental<br />
Program) - www.maweb.org/<br />
30 Z.B.: Verringerung der klimawirksamen Emissionen in Mitteleuropa um > 75% (vgl. Sondergutachten<br />
2009 des WBGU; www.wbgu.de), absolute Reduktion des Ressourcenverbrauches bzw. dessen<br />
Auswirkungen (vgl. UNEP 2011, Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from<br />
Economic Growth; www.unep.org), Vermeidung von Risiko-Stoffen (vgl. The International Chemical<br />
Secretariat; www.sinlist.org/), etc.<br />
47
Kriterien<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Absolute Auswirkungen:<br />
Für die Beurteilung der absoluten Auswirkungen gilt es<br />
noch ein geeignetes Indikatorenset zu erarbeiten (z.B.:<br />
ökologischer Fußabdruck für Unternehmen) 31<br />
Relative<br />
Auswirkungen: Im<br />
Branchenvergleich<br />
liegt das<br />
Unternehmen ...<br />
… hinsichtlich einiger<br />
ökol. Aspekte über<br />
dem Branchendurchschnitt<br />
… hinsichtlich<br />
einiger ökol. Aspekte<br />
über dem<br />
Branchendurchschnitt<br />
mit klar<br />
erkennbaren<br />
Maßnahmen zur<br />
Verbesserung<br />
… hinsichtlich<br />
wesentlicher ökol.<br />
Aspekte über dem<br />
Branchendurchschnitt<br />
mit klar<br />
erkennbaren<br />
Maßnahmen zur<br />
Verbesserung<br />
… hinsichtlich<br />
wesentlicher ökol.<br />
Aspekte weit über<br />
dem Durchschnitt<br />
(Innovationsführer,<br />
Branchenleader, etc.)<br />
Management und<br />
Strategie (mit<br />
zunehmender Größe<br />
von Relevanz, bei<br />
Branchen mit hohen<br />
ökol. Auswirkungen<br />
Grundvoraussetzung):<br />
Das<br />
Unternehmen …<br />
… setzt erste Schritte<br />
zur Identifikation der<br />
wesentlichen<br />
ökologischen<br />
Aspekte und Risiken<br />
(klare<br />
Verantwortlichkeiten,<br />
institutionalisierte<br />
Prozesse mit<br />
Unternehmensführung)<br />
+ … erhebt seinem<br />
Unternehmensgegen<br />
stand entsprechend<br />
Kennzahlen und<br />
verfügt über klare<br />
Strategien /<br />
Maßnahmen zu<br />
mehreren relevante<br />
Aspekte (z.B.: CO²-<br />
Footprint, Wasserund<br />
Ressourcenverbrauch,<br />
branchenspezifische<br />
Aspekte)<br />
+ … erhebt seinem<br />
Unternehmensgegen<br />
stand entsprechend<br />
Kennzahlen und<br />
verfügt über klare,<br />
ambitionierte<br />
Strategien / Maßnahmen<br />
zu allen<br />
relevanten Aspekten<br />
(z.B.: CO²-Footprint,<br />
Ressourcenverbrauch,<br />
branchenspezifische<br />
Aspekte)<br />
+ … verfügt über<br />
ambitionierte<br />
qualitative und<br />
quantitative Ziele und<br />
Strategien inkl.<br />
Fristen hinsichtlich<br />
wesentlicher<br />
Umweltaspekte<br />
UMSETZUNG<br />
„You can’t manage what you don’t measure.” Zu Evaluierung und Reduktion der<br />
ökologischen Auswirkungen des Unternehmens ist eine prozessorientierte<br />
Herangehensweise in Form eines an Größe und Branche angepassten<br />
Umweltmanagementsystems notwendig. Hier kann auf etablierte Standards zurückgegriffen<br />
werden. Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Umweltmanagementsysteme:<br />
− ISO 14001: Information des ÖkoBusinessPlan Wien zu ISO14001 -<br />
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekobusiness/modul-iso.html<br />
−<br />
−<br />
EMAS (eco-management and audit scheme): Informationen des österreichischen<br />
Lebensministeriums zu EMAS - http://www.emas.gv.at/article/articleview/52454/1/16769<br />
easyEMAS: ein auf die Bedürfnisse von KMUs zugeschnittenes, an EMAS orientiertes<br />
Umweltmanagement: www.emaseasy.eu<br />
Für EPUs und Kleinstunternehmen ohne klassische Produktionsprozesse (z.B.:<br />
Beratungsunternehmen) ist der Informationsbedarf geringer ausgeprägt, für eine Beurteilung<br />
sollten zumindest quantitative Angaben zum Energieverbrauch (Strom, Gas),<br />
Mobilitätsaufwand (ungefähre km / Verkehrsmittel) und Ressourcenverbrauch (z.B.: Papier,<br />
Wasser, etc. siehe E1) für eine Beurteilung vorliegen.<br />
Redakteur: Christian Loy: christian.loy@gmx.at<br />
31<br />
Auf EU-Ebene wird gegenwärtig an einem Handbuch zur Berechnung der ökologischen Auswirkungen<br />
von Organisationen gearbeitet. (Fertigstellung Herbst 2012):<br />
http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm<br />
48
E4 MINIMIERUNG DER<br />
GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN EXTERNE<br />
HINTERGRUND<br />
Einer der wichtigsten Gründe für die zunehmende Ungleichheit bei Einkommen ist, dass ein<br />
wachsender Anteil des Volkseinkommens aus (arbeitslosen) Kapitaleinkommen stammt und<br />
ein sinkender Anteil aus Arbeitseinkommen (Löhne, Gehälter). Da das Finanzvermögen in<br />
den Händen einer Minderheit konzentriert ist, bezieht diese Minderheit den Großteil aller<br />
Kapitaleinkommen. Die Mehrheit wird zu Gunsten der KapitalbesitzerInnen strukturell<br />
enteignet – über Zinsen, Dividenden und Kursgewinne.<br />
Langfristig ist eine Verzinsung des gesamten Finanzvermögens gar nicht möglich, weil<br />
dieses ein immer größeres Vielfaches der Wirtschaftsleistung (BIP) ausmacht und<br />
Finanzvermögen aber nur vermehrt werden kann, wenn es in die Wirtschaft investiert wird.<br />
ZIEL<br />
Einkommen sollen ausschließlich an Arbeitsleistungen gekoppelt werden. Kapitalbesitz soll<br />
nicht mehr zu einem Anspruch auf ein Einkommen führen.<br />
ABSTUFUNG & MESSUNG<br />
Belohnt wird der Rückgang der Gewinnausschüttung an „externe“ EigentümerInnen, die nicht<br />
im Unternehmen mitarbeiten gegen null.<br />
Kategorie<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbild<br />
(61-100%)<br />
Sinkende<br />
Dividendenausschüttung<br />
an<br />
Externe<br />
5-Jahresschnitt:<br />
Dividende nicht<br />
höher als<br />
Inflation plus 5%<br />
5-Jahresschnitt:<br />
Dividende nicht<br />
höher als Inflation<br />
plus 2,5%<br />
5-Jahresschnitt:<br />
Dividende nicht<br />
höher als Inflation<br />
Keine<br />
Gewinnausschüttung<br />
an externe<br />
EigentümerInnen<br />
HILFEN FÜR DIE UMSETZUNG<br />
Studium von Bürgerbeteiligungsmodellen wie der Regionalwert AG in Freiburg, der taz<br />
(tageszeitung), diverser Energiegenossenschaften oder des Projekts Demokratische Bank.<br />
49
BEST PRACTISE/LITERATUR/LINKS/EXPERTEN<br />
UNTERNEHMEN:<br />
Die in Gründung befindliche Demokratische Bank will „grundsätzlich keine Gewinne<br />
ausschütten“ (Auszug aus der Vision): http://www.demokratische-bank.at<br />
Die Regionalwert AG weist eine Fülle nichtmonetärer Gewinnaspekte aus:<br />
http://www.regionalwertag.de/index.php?option=com_content&view=article&id=15:gewinn&c<br />
atid=29:aktie&Itemid=15<br />
Düsselsolar: http://www.buefem.de/duessel-solar<br />
ZUM THEMA WACHSTUMSZWANG:<br />
De-growth-Bewegung: http://www.degrowth.net<br />
Casse: http://steadystate.org<br />
Redakteur: Christian Felber: info@christian-felber.at<br />
50
E5 GESELLSCHAFTLICHE<br />
TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG<br />
ZIEL<br />
Ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen informiert umfassend und aktiv die Öffentlichkeit<br />
über alle wesentlichen Aspekte ihrer geschäftlichen Tätigkeiten. Damit haben alle<br />
Berührungsgruppen (Zivilgesellschaft, Anrainer, etc.) einen Einblick in das Unternehmen,<br />
können ihre Interessen einbringen und das Unternehmen im Sinne des <strong>Gemeinwohl</strong>s positiv<br />
beeinflussen. Die Glaubwürdigkeit dieser Transparenz steigt, wenn die Angaben extern<br />
verifiziert werden können oder unabhängige Institutionen einen uneingeschränkten Zugang<br />
zu den Informationen haben.<br />
Die Mitbestimmung des gesellschaftlichen Umfeldes ist bei allen wesentlichen Grundsatzund<br />
Rahmenentscheidungen notwendig, die massive Auswirkungen auf die<br />
Berührungsgruppen haben. Dabei geht das Unternehmen aktiv vor der Entscheidungsfindung<br />
auf die betroffenen Berührungsgruppen zu und bindet sie konsensual ein. Eine breite<br />
Beteiligung bei alltäglichen, operativen Entscheidungen erscheint uns weder praktikabel<br />
noch zielführend.<br />
Der demokratischen Mitbestimmung wird in der GWÖ-Matrix hohen Wert beigemessen und<br />
findet sich in unterschiedlichen Indikatoren wieder, je nach betroffenen Berührungsgruppen<br />
in C5, D1, A1, B1, D2 und D5.<br />
Es bleiben „nur“ noch folgende Berührungsgruppen für diesen Indikator übrig:<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Anrainer/ Bevölkerung der Region (d.h. im nahen Umkreis zum Betriebsstandort)<br />
Das politische System in der Region (Gemeinde-, Landes- und Bundesebene)<br />
Natur, d.h. Pflanzen und Tierwelt der Region<br />
−<br />
Die zukünftigen Generationen<br />
Meistens haben diese Berührungsgruppen zivilgesellschaftliche Vertreter oder Anwälte, wie<br />
z.B. z.B. den Amnesty International, Caritas oder Greenpeace.<br />
51
BANDBREITE UND MESSUNGEN<br />
TRANSPARENZ<br />
Kriterium<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Inhaltl. Umfang Einzelne Aspekte Wichtige Aspekte<br />
Großteil wichtiger Aspekte,<br />
v.a. die kritischen 32<br />
Alle<br />
Reichweite<br />
Berührungsgruppen<br />
Interne Transparenz<br />
(Intranet)<br />
Stakeholder<br />
spezif.Transparenz<br />
(Extranet)<br />
Allgemein passive<br />
Transparenz (Internet)<br />
Allgemein aktive<br />
Transparenz (Kommunikationspolitik)<br />
Reichweite<br />
Standorte<br />
Mind. ein wesentlicher<br />
Standort<br />
Einige wesentliche<br />
Standorte<br />
Großteil der wesentliche<br />
Standorte, v.a. die<br />
kritischen<br />
Alle<br />
Bei Unterneh <<br />
100 Mitarbeit.<br />
Oberflächlicher GWÖ-<br />
Bericht<br />
Umfangreiche<br />
Beschreibung jedes<br />
Indikators<br />
Detaillierte Beschreibung<br />
jedes Indikators<br />
Detaillierte<br />
Beschreibung jedes<br />
Kriteriums von jedem<br />
Indikator<br />
Bei Unterneh ><br />
100 Mitarbeit. 33 GRI Level C GRI Level B GRI Level A<br />
GRI Level A und<br />
Sector Supplement<br />
Verifizierung ><br />
100 Mitarbeit.<br />
Punktuell, indirekt<br />
extern verifiziert<br />
Externe Evaluation<br />
der Risiken<br />
Externe Verifikation aller<br />
wesentl. Kriterien, low<br />
level of assurance<br />
High level of assurance<br />
+ umfassende<br />
Kooperation mit NGOs<br />
MITBESTIMMUNG<br />
Kriterium<br />
Erste Schritte<br />
(1-10%)<br />
Fortgeschritten<br />
(11-30%)<br />
Erfahren<br />
(31-60%)<br />
Vorbildlich<br />
(61-100%)<br />
Art der Mitbestimmung<br />
+<br />
Dokumentation<br />
Reaktiv:<br />
Anhörung von<br />
Beschwerden +<br />
Reaktion<br />
Aktiv:<br />
Dialog mit<br />
hochrang. Unternehmensvertretern<br />
+ umfassende<br />
Dokumentation<br />
Aktiv +:<br />
Konsensorientierte<br />
Entscheidungen,<br />
Dokumentation mit<br />
Konsequenzen<br />
öffentlich zugänglich<br />
Proaktiv/ innovativ:<br />
mind. 50% Konsensuale<br />
Entscheidungen<br />
Umfang der<br />
Mitbestimmg<br />
Einzelne Maßnahmen/<br />
Projekte über<br />
begrenzte Zeit<br />
Immer wieder umfassende<br />
Mitbestimmungsprozesse<br />
Regelmäßige Einbeziehung<br />
bei wichtigen<br />
Themen, bei strategischen<br />
Entscheidungen<br />
Permanenter Dialog und<br />
Mitbestimmung bei<br />
wesentlichen Themen/<br />
strategischen Entsch.<br />
Umfang einbezogener<br />
Berührungsgruppen<br />
Einige Die wichtigsten Alle Alle<br />
32<br />
Kritische Daten sind z.B. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften in<br />
Steueroasen, Lobbyingzahlungen an politische Entscheidungsträger/ - institutionen (Parteien/ Verbände),<br />
Produktionsprozesse mit Risikostoffen sowie potentiellen Beeinträchtigungen der Anrainer durch Emissionen (in<br />
Luft, Wasser, Boden), Lärm, Geruch, Lichtverschmutzung etc., Eingriffe in die Natur, Standortverlagerungen und<br />
der damit im Zusammenhang stehende Arbeitsplatzabbau<br />
33<br />
Auf Basis der Vorgaben des GRI = Global Reporting Initiative – derzeitiger Standard in der<br />
Nachhaltigkeitsberichterstattung, siehe auch www.globalreporting.org<br />
52
PROZENTUALE GEWICHTUNG TRANSPARENZ/ MITBESTIMMUNG NACH<br />
UNTERNEHMENSGRÖßE<br />
Prinzipiell gilt: Je größer das Unternehmen ist, desto höher ist die Bewertung der wirklichen<br />
Mitbestimmung im Vergleich zur Transparenz.<br />
Mitarbeiterzahl Gewichtung Transparenz Gewichtung Mitbestimmung<br />
1-2 80% 20%<br />
3-10 70% 30%<br />
11-50 60% 40%<br />
51-250 50% 50%<br />
251-1.000 40% 60%<br />
Über 1.000 30% 70%<br />
Auch hier wäre noch detaillierter zu differenzieren, ob es sich um Dienstleistungs- oder<br />
Produktionsbetriebe handelt. Dienstleistungsunternehmen haben prinzipiell eher geringere<br />
Auswirkungen auf die Umwelt als Produktionsunternehmen. Ausnahmen sind z.B.<br />
Architekten, Banken und PR-Agenturen<br />
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN<br />
Sowohl für EPUs als auch für alle anderen Unternehmen kann ein umfassend ausgefüllter<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-Bericht bis zu 100% des Transparenz-Anteiles ausmachen. Allerdings gehört<br />
bei größeren Unternehmen das Einhalten der GRI-Vorgaben auch dazu bzw. eine<br />
vergleichbare Transparenz im GWÖ-Bericht.<br />
Die Global Reporting Initiative (GRI) hat sich als Standard der<br />
Nachhaltigkeitsberichterstattung etabliert, nähere Infos auf www.globalreporting.org. Neben<br />
den allgemeinen Hinweisen gibt es auch branchenspezifische Aspekte (Sector<br />
Supplements). Für hierin nicht adressierte Aspekte können sonstige Standards und Labels<br />
einer Branche eine erste Orientierung bieten.<br />
Für EPUs kommt der Aspekt der Mitbestimmung kaum in Betracht, weil die Auswirkungen<br />
von EPUs sehr gering sind. Je kleiner ein Unternehmen, desto unwesentlicher ist der Aspekt<br />
der gesellschaftlichen Mitbestimmung.<br />
Redakteur: Christian Rüther: chrisruether@gmail.com<br />
53
MENSCHENWÜRDE<br />
NEGATIV-KRITERIEN<br />
VERLETZUNG DER ILO-ARBEITSRECHTENORMEN / MENSCHENRECHTE<br />
Menschenrechte und Kernarbeitsnormen der ILO (International Labour Organization) bilden<br />
wesentliche gesellschaftliche Grundpfeiler des globalen Zusammenlebens. Eine globale<br />
Ratifizierung ist ebenso wie eine gelebte Umsetzung in vielen Staaten bis heute nicht<br />
gegeben. In Staaten ohne Ratifizierung der Kernnormen (z.B.: China, USA) ist demnach ein<br />
proaktiver Zugang des Unternehmens im Rahmen der lokalen Möglichkeiten notwendig, um<br />
deren Einhaltung sicherzustellen. Auch mögliche menschenrechtsverletzende Auswirkungen<br />
und Effekte von Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens sind zu<br />
berücksichtigen.<br />
Kernarbeitsnormen:<br />
http://www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn/kernarbeitsnormen/index.htm<br />
MENSCHENUNWÜRDIGE PRODUKTE<br />
Unter menschenunwürdig werden jene Produkte verstanden, die in scharfem Widerspruch zu<br />
den Werten einer <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong> stehen. Hierunter fallen u.a. Waffen,<br />
Atomkraftwerke, ethisch problematische Gen-Technologien und Luxusgüter. Um eine<br />
Pauschalverurteilung ganzer Produktsparten zu vermeiden, gilt es, diesen Aspekt in Zukunft<br />
präziser zu formulieren und etwaige Ausnahmen zu benennen (z.B.: Jagdwaffen).<br />
BESCHAFFUNG BEI BZW. KOOPERATION MIT UNTERNEHMEN, WELCHE<br />
DIE MENSCHENWÜRDE VERLETZEN<br />
Die Produktion vieler Güter des täglichen Gebrauchs ist mit großen sozialen und<br />
ökologischen Problemen verbunden (z.B.: fossile Energieträger, agrarische Erzeugnisse,<br />
Telekommunikation und Elektronik). Folglich ist es für fast kein Unternehmen möglich,<br />
Verletzungen der Menschenwürde in der Lieferantensphäre auszuschließen.<br />
SOLIDARITÄT<br />
FEINDLICHE ÜBERNAHME<br />
Auf dem globalen Markt gilt derzeit: fressen und gefressen werden. Aktiengesellschaften<br />
beispielsweise können sowohl gegen den Willen der Geschäftsführung als auch der<br />
Beschäftigten „feindlich“ übernommen werden. In der <strong>Gemeinwohl</strong>-<strong>Ökonomie</strong> soll der<br />
Stärkere den Schwächeren nicht fressen dürfen. Eine einvernehmliche Verbindung ist<br />
hingegen kein Problem: Es müssen aber sowohl die Geschäftsführung als auch die<br />
Beschäftigten zustimmen. Liegt diese Zustimmung nicht vor, gilt die Übernahme als feindlich.<br />
SPERRPATENTE<br />
Manche Unternehmen melden sehr viel mehr Innovationen zum Patent an, als sie<br />
kommerziell verwerten, mit dem Ziel, die Forschung um ihr Patent „runtherum“ zu blockieren.<br />
54
Das plakativste Beispiel Autofirmen, welche Patente für verbrauchsarme oder<br />
Solarautomobile seit langem halten, aber nicht verwerten, weil dies einem<br />
Paradigmenwechsel von der fossilen in die postfossile Ära einleiten und bestehende<br />
Machtstrukturen angreifen würde. Im Regelfall handelt es sich um weniger spektakuläre<br />
Fälle, die nur einen längeren und größeren Vorsprung zur Konkurrenz sichern. Der Effekt ist<br />
die Blockade von Innovation und die Schädigung anderer Unternehmen. Derzeit sind uns<br />
keine Methoden bekannt, durch die Sperrpatente ausfindig gemacht werden könnten,<br />
deshalb wollen wir als ersten Schritt das Bewusstsein für diese unsolidarische Praxis<br />
wecken.<br />
DUMPINGPREISE<br />
Manche Unternehmen bieten Produkte in für sie neuen Märkten zu Preisen an, die unter den<br />
Produktionskosten liegen, um Marktanteile zu erobern. Das widerpsricht der Kostenwahrheit<br />
und dem fairen Mitbewerb. Dupingpreise könnten ausfindig gemacht werden, indem die<br />
Preise derselben Produkte an unterschiedlichen Standorten verglichen werden oder die<br />
Unternehmen ihre Kostenrechnung offen legen.<br />
ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT<br />
MASSIVE UMWELTBELASTUNGEN FÜR ÖKOSYSTEME<br />
Unternehmen greifen durch ihre Aktivitäten mitunter massiv in Ökosysteme ein, u.a. durch<br />
Zerstörung wichtiger Lebensräume, Rodung, Rückstände in Wasser, Luft und Boden.<br />
Verursacht ein Unternehmen nachgewiesenermaßen Umweltbelastungen oder wird deshalb<br />
sogar verurteilt (z. B.: Belo Monte Staudamm in Brasilien) gilt das Negativkriterium.<br />
GROBE VERSTÖßE GEGEN UMWELTAUFLAGEN (Z.B.: GRENZWERTE)<br />
Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn ein Unternehmen vorsätzlich gegen Umweltauflagen<br />
verstößt, wie zum Beispiel durch wiederholtes Überschreiten von Grenzwerten.<br />
GEPLANTE OBSOLESZENZ<br />
Unter „geplanter Obsoleszenz“ wird die produktionstechnisch vorgenommene Verkürzung<br />
der Lebensdauer von Produkten durch den Hersteller verstanden. Hierunter fallen neben der<br />
eigentlichen Gestaltung auch die Nicht-Reparierfähigkeit von Produkten. Bekanntestes<br />
Beispiel des 20.Jahrhunderts war die Glühbirne, deren Lebenszeit von den Herstellern<br />
zwecks Umsatzsteigerung künstlich verkürzt wurde.<br />
SOZIALE GERECHTIGKEIT<br />
UNGLEICHBEZAHLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN<br />
Unter Missachtung des Grundsatzes: gleicher Lohn für gleiche Arbeit erhalten viele Frauen<br />
immer noch für die gleiche Arbeitsleistung wie Männer geringeren Lohn oder geringeres<br />
Gehalt – obwohl es gesetzwidrig ist. Doch nicht immer wird geklagt. Angst und immer noch<br />
wirksame Rollenbilder und patriarchale Denk- und Handlungsmuster verhindern im dritten<br />
Jahrtausend die soziale und ökonomische Gleichstellung von Mann und Frau. Unternehmen<br />
sollten ihren Beitrag leisten, dass Männer und Frauen vollkommen gleich behandelt und für<br />
55
gleiche Leistung gleich bezahlt werden. Wird ein Unternehmen rechtskräftig verurteilt wegen<br />
Ungleichbehandlung und Ungleichbezahlung oder gibt es massive und glaubwürdige<br />
Hinweise, dass diese der Fall ist (z. B. Wal Mart:<br />
http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/frauen-scheitern-mit-sexismus-klage/ und<br />
http://www.sueddeutsche.de/karriere/usa-klage-wegen-diskriminierung-frauen-scheitern-mitsammelklage-gegen-wal-mart-1.1110904)<br />
gilt das als gravierendes Negativkriterium. Die<br />
<strong>Gemeinwohl</strong>-Bilanz will hier den Gesetzgeber nicht ersetzen, sondern ergänzen und<br />
verstärken.<br />
ARBEITSPLATZABBAU ODER STANDORTVERLAGERUNG TROTZ GEWINN<br />
Ein Unternehmen, das dem <strong>Gemeinwohl</strong> dient, wird bei stabiler Gewinnlage weder<br />
Arbeitsplätze abbauen noch Standorte schließen. Bei rein gewinnorientierten Unternehmen<br />
stehen solche Maßnahmen auf der Tagesordnung. Das Wohl der EigentümerInnen wird über<br />
das Wohl aller anderen Berührungsgruppen gestellt. Das sollte nicht sein, weil ein<br />
Unternehmen nicht dazu da ist, nur das Wohl einer bestimmten Berührungsgruppe zu<br />
maximieren.<br />
UNTERNEHMEN IN STEUEROASEN<br />
Zahlreiche Großunternehmen errichten Zweigstellen oder Briefkastenfirmen in Steueroasen,<br />
um ihre Steuerleistung zu „optimieren“. Doch das ist ein Vergehen am Gemeinwesen:<br />
einerseits alle Leistungen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen – Bildung, Ausbildung,<br />
Gesundheitsdienste, Verkehrsinfrastruktur, Rechtsstaat und Verwaltung – und andererseits<br />
keinen fairen Beitrag zu leisten. Zudem haben vor allem Großunternehmen die Möglichkeit<br />
der Steuervermeidung, das K.o.-Foul wird auch das ist kleineren Unternehmen unfair. Die<br />
OECD weist eine Liste von Steueroasen aus:<br />
http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_37427,00.html<br />
Das „Global Tax Justice Network“ hat den Finanzschattenindex erstellt:<br />
http://www.financialsecrecyindex.com/<br />
www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/FSI-Einfuehrung_Final.pdf<br />
EIGENKAPITALVERZINSUNG ÜBER 10%<br />
Kapitaleinkommen sind per se problematisch weil sie a) die Wirtschaft zum Wachstum<br />
zwingen: Jede Erwartung, für ein zur Verfügung gestelltes Kapital ein Einkommen zu<br />
erzielen, und sei es auch nur im Ausmaß der Inflation, zwingt die Wirtschaft zum Wachstum;<br />
und b) Zwei Drittel des Vermögens, auch des Finanzvermögens sind in den Händen von<br />
zehn Prozent der Bevölkerung. Folglich strömen auch mindestens zwei Drittel der<br />
Kapitaleinkommen nur zehn Prozent der Bevölkerung zu. Es ist sogar ein höherer Anteil, weil<br />
die Kapitaleinkommen umso höher sind, je reicher jemand ist. Der Kapitalismus ist ein<br />
„positiv rückgekoppeltes System“: Je reicher jemand ist, desto leichter wird das weitere<br />
Reichwerden, auch wenn keine Arbeitsleistung erbracht wird. Die Mehrheit der<br />
Großvermögen wurde ererbt, nicht erarbeitet. Deshalb sind a) der Wachstumszwang umso<br />
größer und b) die Verteilung umso ungerechter, je höher die Kapitaleinkommen sind. Im<br />
Durchschnitt können bei einem realen zweiprozentigen Wirtschaftswachstum alle<br />
Einkommen um zwei Prozent wachsen. Höhere Zuwachsraten sind in nur<br />
Ausnahmeunternehmen und -branchen möglich, aber nicht in Durchschnittsunternehmen<br />
56
und -branchen. Alle Unternehmen können einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten,<br />
indem sie die Kapitaleinkommen minimieren. Extremes Zuwiderverhalten wie etwa durch die<br />
dauerhafte Ausschüttung zweistelliger Renditen auf das Eigentum über einen Zeitraum von<br />
fünf Jahren sind als Negativkriterium zu werten.<br />
DEMOKRATISCHE MITBESTIMMUNG UND TRANSPARENZ<br />
NICHTOFFENLEGUNG ALLER BETEILIGUNGEN UND<br />
TOCHTERUNTERNEHMEN<br />
Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für Vertrauen, Kontrolle, Demokratie und die<br />
Verhinderung von Machtkonzentration. Unternehmenseigentum ist nicht reine Privatsache,<br />
sondern betrifft auch die Allgemeinheit. Es sollte offengelegt werden, welche Sub-Firmen<br />
überhaupt bestehen und wer (Mit-) Eigentümer welchen Unternehmens ist. Gibt es hier keine<br />
Transparenz, wird Steuerhinterziehung (z. B. anonyme Trusts oder Briefkastenfirmen in<br />
Steueroasen), Umweltzerstörung (z. B. Tankschiffe von EU-Unternehmen fahren unter<br />
panamesischer Flagge), Kriminalität (z. B. Korruption über Scheinfirmen) und<br />
Demokratieuntergrabung (z. B. versteckte Parteispenden) Tür und Tor geöffnet. Auch<br />
Unternehmen sind soziale Gebilde und an deren Regeln (Lizenzvergabe, Rechtsgrundlage<br />
für „juristische Personen“) gebunden - deshalb müssen sie sich transparent zeigen und<br />
deklarieren. Der Datenschutz hat hier Nachrang. Auch „natürliche Personen“ müssen ganz<br />
selbstverständlich ihren jeweiligen Wohnsitz den Behörden melden.<br />
VERHINDERUNG EINES BETRIEBSRATS<br />
Voraussetzung für die Errichtung eines Betriebsrats ist, dass in einem Betrieb (im Sinne des<br />
§ 34 Abs. 1 ArbVG) mindestens fünf ArbeitnehmerInnen dauernd beschäftigt sind.<br />
Eine Verhinderung des Betriebsrates liegt vor, wenn die Geschäftsführung durch<br />
unterschiedliche Maßnahmen der Konstituierung bzw. Wahl eines Betriebsrates<br />
entgegenwirkt.<br />
Belegbar ist die Verhinderung nur teilweise:<br />
−<br />
−<br />
Hilfreich könnte eine anonyme MitarbeiterInnenbefragung sein, in der abgefragt wird,<br />
wer sich einen Betriebsrat wünscht, ob es Maßnahmen der Verhinderung gab und wie<br />
mit MitarbeiterInnen umgegangen wurde, die sich dafür eingesetzt haben.<br />
Ebenso hilfreich sind Äußerungen von gekündigten MitarbeiterInnen, wenn sie in einem<br />
Zusammenhang mit einer Betriebsratsgründung sehen.<br />
− Auch könnte man sich bei der Arbeiterkammer oder den jeweiligen Gewerkschaften<br />
informieren, ob gegen den Betrieb Beschwerden vorliegen oder einschlägige negative<br />
Erfahrungen dokumentiert sind.<br />
Die Beweislast könnte aber auch umgekehrt werden, dass die Geschäftsführung beweisen<br />
muss, dass es keine Verhinderungen gab.<br />
Letztendlich obliegt es dem Auditor, ein ausgewogenes Urteil zu fällen.<br />
Skripten zum Arbeitsrecht/ Betriebsrat (VOEGB)<br />
Infoplattform der OEGB: www.betriebsraete.at<br />
57
NICHTOFFNICHTOFFENLEGUNG ALLER FINANZFLÜSSE AN LOBBYISTEN<br />
UND LOBBY-ORGANISATIONEN / NICHTEINTRAGUNG INS LOBBY-<br />
REGISTER DER EU<br />
Lobbying im Eigeninteresse – und nicht im Allgmeininteresse – ist eine der größten<br />
Bedrohung der Demokratie. Ein wichtiger Schritt zur Offenlegung sämtlicher Lobbying-<br />
Aktivitäten ist die Offenlegung aller Finanzflüsse eines Unternehmens an Lobby-<br />
AkteuerInnen. Wer dies nicht tut, unterstützt hier eine Praxis der Intransparenz zum Schaden<br />
der Demokratie. Unternehmen in der EU können diese Intransparenz beenden, indem sie<br />
sich in das EU-Lobbyregister eintragen. Falls dieses Register nicht zutreffen sollte, können –<br />
insbesondere kleinere Unternehmen – alternativ sämtliche Finanzflüsse offenlegen.<br />
Link: www.gemeinwohl-oekonomie.org<br />
Stand: 5. März 2012<br />
58