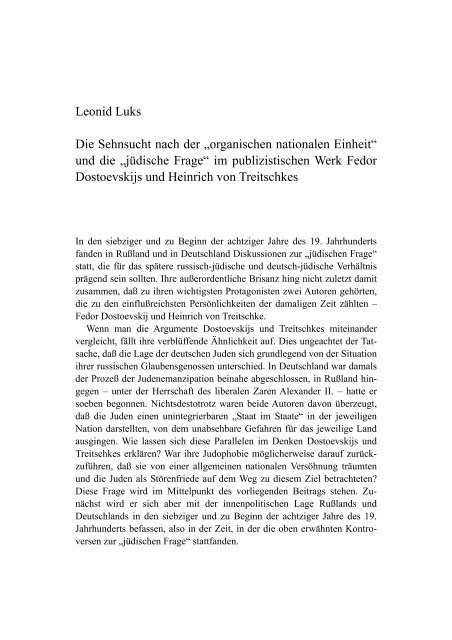"Die Sehnsucht nach der "organischen nationalen Einheit" und die "
"Die Sehnsucht nach der "organischen nationalen Einheit" und die "
"Die Sehnsucht nach der "organischen nationalen Einheit" und die "
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Leonid Luks<br />
<strong>Die</strong> <strong>Sehnsucht</strong> <strong>nach</strong> <strong>der</strong> „<strong>organischen</strong> <strong>nationalen</strong> Einheit“<br />
<strong>und</strong> <strong>die</strong> „jüdische Frage“ im publizistischen Werk Fedor<br />
Dostoevskijs <strong>und</strong> Heinrich von Treitschkes<br />
In den siebziger <strong>und</strong> zu Beginn <strong>der</strong> achtziger Jahre des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
fanden in Rußland <strong>und</strong> in Deutschland Diskussionen zur „jüdischen Frage“<br />
statt, <strong>die</strong> für das spätere russisch-jüdische <strong>und</strong> deutsch-jüdische Verhältnis<br />
prägend sein sollten. Ihre außerordentliche Brisanz hing nicht zuletzt damit<br />
zusammen, daß zu ihren wichtigsten Protagonisten zwei Autoren gehörten,<br />
<strong>die</strong> zu den einflußreichsten Persönlichkeiten <strong>der</strong> damaligen Zeit zählten –<br />
Fedor Dostoevskij <strong>und</strong> Heinrich von Treitschke.<br />
Wenn man <strong>die</strong> Argumente Dostoevskijs <strong>und</strong> Treitschkes miteinan<strong>der</strong><br />
vergleicht, fällt ihre verblüffende Ähnlichkeit auf. <strong>Die</strong>s ungeachtet <strong>der</strong> Tatsache,<br />
daß <strong>die</strong> Lage <strong>der</strong> deutschen Juden sich gr<strong>und</strong>legend von <strong>der</strong> Situation<br />
ihrer russischen Glaubensgenossen unterschied. In Deutschland war damals<br />
<strong>der</strong> Prozeß <strong>der</strong> Judenemanzipation beinahe abgeschlossen, in Rußland hingegen<br />
– unter <strong>der</strong> Herrschaft des liberalen Zaren Alexan<strong>der</strong> II. – hatte er<br />
soeben begonnen. Nichtsdestotrotz waren beide Autoren davon überzeugt,<br />
daß <strong>die</strong> Juden einen unintegrierbaren „Staat im Staate“ in <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Nation darstellten, von dem unabsehbare Gefahren für das jeweilige Land<br />
ausgingen. Wie lassen sich <strong>die</strong>se Parallelen im Denken Dostoevskijs <strong>und</strong><br />
Treitschkes erklären? War ihre Judophobie möglicherweise darauf zurückzuführen,<br />
daß sie von einer allgemeinen <strong>nationalen</strong> Versöhnung träumten<br />
<strong>und</strong> <strong>die</strong> Juden als Störenfriede auf dem Weg zu <strong>die</strong>sem Ziel betrachteten?<br />
<strong>Die</strong>se Frage wird im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags stehen. Zunächst<br />
wird er sich aber mit <strong>der</strong> innenpolitischen Lage Rußlands <strong>und</strong><br />
Deutschlands in den siebziger <strong>und</strong> zu Beginn <strong>der</strong> achtziger Jahre des 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts befassen, also in <strong>der</strong> Zeit, in <strong>der</strong> <strong>die</strong> oben erwähnten Kontroversen<br />
zur „jüdischen Frage“ stattfanden.
***<br />
Zu den <strong>nationalen</strong> Beson<strong>der</strong>heiten Deutschlands <strong>und</strong> Rußlands gehörte<br />
jahrhun<strong>der</strong>telang <strong>die</strong> tiefe innere Spaltung bei<strong>der</strong> Nationen. <strong>Die</strong> deutsche<br />
Spaltung hatte in erster Linie politisch-konfessionelle, <strong>die</strong> russische sozialkulturelle<br />
Gründe. In <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts erlebten beide<br />
Län<strong>der</strong> allerdings kurze Phasen <strong>der</strong> <strong>nationalen</strong> Versöhnung. Sie waren mit<br />
den Revolutionen von oben verb<strong>und</strong>en. In Rußland wie in Deutschland<br />
schienen sich <strong>die</strong> generationenalten Träume von <strong>der</strong> Überwindung <strong>der</strong> sozialen<br />
bzw. <strong>der</strong> politischen Kluft über Nacht zu verwirklichen. Im Zarenreich<br />
leitete <strong>der</strong> liberale Monarch Alexan<strong>der</strong> II. (1855–1881) ein gewaltiges Reformwerk<br />
ein, dessen Kernstück <strong>die</strong> Abschaffung <strong>der</strong> Leibeigenschaft bildete.<br />
In Deutschland beseitigte Otto von Bismarck <strong>die</strong> politische Zersplitterung<br />
des Landes <strong>und</strong> löste eine Aufgabe, an <strong>der</strong> <strong>die</strong> Revolution von 1848<br />
kläglich gescheitert war. Beide Geschenke von oben wurden von <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Gesellschaft zunächst mit Dankbarkeit angenommen. Eine allgemeine<br />
Versöhnung <strong>der</strong> Herrscher mit den Beherrschten schien zum Greifen nahe<br />
zu sein, <strong>die</strong> immer noch vorhandenen innenpolitischen Gegensätze begannen<br />
sich abzumil<strong>der</strong>n. In Rußland ließen sich sogar solch radikale Gegner<br />
des bestehenden Systems wie <strong>der</strong> Anarchist Michail Bakunin durch <strong>die</strong>se<br />
Atmosphäre <strong>der</strong> <strong>nationalen</strong> Aussöhnung vorübergehend beeinflussen. Er<br />
rief <strong>die</strong> politischen Gruppierungen, <strong>die</strong> ihren revolutionären Kampf fortsetzen<br />
wollten, zur Mäßigung auf. 1<br />
Neben <strong>der</strong> Kluft zwischen <strong>der</strong> herrschenden Bürokratie <strong>und</strong> den regimekritischen<br />
Kräften, <strong>die</strong> sich seit dem Aufstand <strong>der</strong> Dekabristen von 1825<br />
unentwegt vertiefte, wurde Rußland seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
– seit dem Erscheinen des „Philosophischen Briefs“ von Petr Čaadaev<br />
(1836) – durch <strong>die</strong> erbitterte Kontroverse zwischen Westlern <strong>und</strong> Slavophilen<br />
erschüttert. <strong>Die</strong> Westler hielten <strong>die</strong> durch Peter den Großen vollzogene<br />
Öffnung Rußlands <strong>nach</strong> Europa für einen Segen, <strong>die</strong> Slavophilen für<br />
einen Fluch. Während <strong>der</strong> „Tauwetter“-Periode <strong>der</strong> ersten Herrschaftsjahre<br />
Alexan<strong>der</strong>s II. wurden indes Versuche unternommen, <strong>die</strong>se Kluft zu überwinden.<br />
Mit beson<strong>der</strong>er Vehemenz plä<strong>die</strong>rte für <strong>die</strong> Aussöhnung zwischen<br />
1 Polonskij, Vjačeslav: Žizn´ Michaila Bakunina 1814-1874, 3. Aufl. Leningrad 1926.
den beiden ideologischen Lagern <strong>die</strong> Gruppierung <strong>der</strong> Počvenniki (von počva<br />
– Boden), <strong>der</strong>en wichtigste Vertreter <strong>der</strong> Dichter Appollon Grigor’ev,<br />
Fedor Dostoevskij <strong>und</strong> Dostoevskijs Bru<strong>der</strong> Michail waren. 2<br />
<strong>Die</strong> Počvenniki deckten <strong>die</strong> Schwächen des westlerischen <strong>und</strong> des slavophilen<br />
Konzepts auf <strong>und</strong> wiesen auf Mißverständnisse hin, <strong>die</strong> zur Entstehung<br />
<strong>der</strong> Kontroverse beigetragen hatten.<br />
Der kanadische Historiker Dowler, <strong>der</strong> sich mit dem Programm <strong>der</strong> Počvenniki<br />
eingehend befaßt hat, weist darauf hin, daß <strong>der</strong> Ehrgeiz <strong>die</strong>ser<br />
Gruppierung <strong>und</strong> ihres Presseorgans Vremja, im innerrussischen Streit eine<br />
Art Schiedsrichterrolle zu spielen, von den Kontrahenten selbst als Anmaßung<br />
empf<strong>und</strong>en wurde. Statt beide Parteien miteinan<strong>der</strong> zu versöhnen, seien<br />
<strong>die</strong> Počvenniki in eine Art Zweifrontenkrieg sowohl mit radikal westlerischen<br />
als auch mit slavophilen Gruppierungen verwickelt worden. 3<br />
Der schnelle Aufstieg <strong>und</strong> das ebenso schnelle Scheitern des Počvenničestvo<br />
war geradezu symptomatisch für <strong>die</strong> kurzlebigen liberalen Hoffnungen<br />
in den ersten Herrschaftsjahren Alexan<strong>der</strong>s II. <strong>und</strong> für <strong>die</strong> darauf folgenden<br />
Enttäuschungen. Statt auf eine Überwindung von inneren Spaltungen,<br />
statt auf eine allgemeine Versöhnung steuerte Rußland auf eine totale<br />
Konfrontation zu. <strong>Die</strong> unversöhnlichste Gegnerin des Zarenregimes – <strong>die</strong><br />
revolutionäre Intelligenzija – radikalisierte sich unentwegt, <strong>und</strong> zwar ungeachtet<br />
<strong>der</strong> Tatsache, daß <strong>die</strong> Petersburger Regierung nun viele For<strong>der</strong>ungen,<br />
<strong>die</strong> von den Kritikern <strong>der</strong> russischen Autokratie seit Generationen aufgestellt<br />
worden waren, eine <strong>nach</strong> <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en erfüllte: Bauernbefreiung, Lockerung<br />
<strong>der</strong> Zensur, Justizreform, Schaffung <strong>der</strong> relativ unabhängigen<br />
Selbstverwaltung. Für <strong>die</strong> radikalen Gegner <strong>der</strong> Monarchie hatte <strong>die</strong>s keine<br />
Relevanz. Im Gegenteil, je liberaler das bestehende Regime wurde, desto<br />
radikaler wurde es von <strong>der</strong> Intelligenzija bekämpft. Der Glaube an <strong>die</strong> heilende<br />
Kraft <strong>der</strong> Revolution, <strong>der</strong> im Westen <strong>nach</strong> dem Scheitern <strong>der</strong> Revolution<br />
von 1848/49 immer schwächer wurde, erfaßte erst jetzt mit voller<br />
Wucht <strong>die</strong> oppositionell gesinnte Öffentlichkeit. Es habe im vorrevolutionären<br />
Rußland einer ungewöhnlichen Zivilcourage bedurft, um sich offen zur<br />
Politik <strong>der</strong> Kompromisse zu bekennen, sagt in <strong>die</strong>sem Zusammenhang <strong>der</strong><br />
2 Siehe dazu Dowler, Wayne: Dostoevsky, Grigor´ev, and Native Soil Conservatism. Toronto<br />
u.a 1982.<br />
3 Ebenda.
ussische Philosoph Semen Frank. 4 Und <strong>der</strong> Kölner Historiker Theodor<br />
Schie<strong>der</strong> fügt hinzu: <strong>Die</strong> Unbedingtheit <strong>und</strong> <strong>die</strong> Absolutheit, <strong>die</strong> den revolutionären<br />
Glauben <strong>der</strong> russischen Intelligenzija auszeichneten, seien im Westen<br />
praktisch unbekannt gewesen. 5<br />
Im Jahre 1869, also in <strong>der</strong> Zeit, in <strong>der</strong> das liberale Regiment Alexan<strong>der</strong>s<br />
II. Rußland gründlich erneuerte, ja bis zur Unkenntlichkeit verän<strong>der</strong>te, verfaßte<br />
einer <strong>der</strong> radikalsten Regimegegner, Sergej Nečaev, den sogenannten<br />
Revolutionskatechismus, in dem folgendes zu lesen war:<br />
„Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch. Er hat keine persönlichen Interessen,<br />
[...] Gefühle o<strong>der</strong> Neigungen, kein Eigentum, nicht einmal einen Namen. Alles in<br />
ihm wird verschlungen von einem einzigen [...] Gedanken, einer einzigen Leidenschaft<br />
– <strong>der</strong> Revolution. [...] Wenn er in <strong>die</strong>ser Welt fortlebt, so geschieht es nur,<br />
um sie desto sicherer zu vernichten [...]. Zwischen ihm <strong>und</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
herrscht Krieg auf Tod <strong>und</strong> Leben, offener o<strong>der</strong> geheimer Kampf, aber stets ununterbrochen<br />
<strong>und</strong> unversöhnlich.“ 6<br />
Der unversöhnliche Extremismus, ja <strong>der</strong> revolutionäre Wahn eines Teils <strong>der</strong><br />
russischen Intelligenzija wurde von Fedor Dostoevskij in einem <strong>der</strong> größten<br />
Romane <strong>der</strong> Weltliteratur – in den Dämonen – schonungslos entlarvt.<br />
Dostoevskij war nur mit den ersten Ansätzen <strong>die</strong>ser verzerrten Weltsicht<br />
konfrontiert, aber als Seher erkannte er mit einer beispiellosen Genauigkeit,<br />
welch verheerende Folgen ein <strong>der</strong>artiges Denkmodell haben kann.<br />
<strong>Die</strong> fanatische Hingabe, mit <strong>der</strong> <strong>die</strong> Verfechter <strong>der</strong> Revolution ihren<br />
Idealen <strong>die</strong>nten, ihren bedingungslosen Glauben an das künftige soziale<br />
Para<strong>die</strong>s auf Erden betrachtete Dostoevskij als eine pervertierte Religiosität,<br />
als eine Art Götzenverehrung. Der Sozialismus wies für ihn nur vor<strong>der</strong>gründig<br />
Merkmale einer gesellschaftlich-politischen Lehre auf. Weit wichtiger<br />
als sein politischer Anspruch sei sein Streben, eine Alternative zum<br />
Christentum zu werden. 7<br />
4 Frank, Semen: Krušenie kumirov. Berlin 1924, S. 15f.<br />
5 Schie<strong>der</strong>, Theodor: Das Problem <strong>der</strong> Revolution im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t, in: Ders.: Staat <strong>und</strong><br />
Gesellschaft im Wandel <strong>der</strong> Zeit. Stu<strong>die</strong>n zur Geschichte des 19. <strong>und</strong> 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts,<br />
2.Aufl. München 1970, S. 11-57, hier S. 42ff.<br />
6 Zit. <strong>nach</strong> Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke, Band 1-39. Berlin 1959ff, hier Band 18,<br />
S. 427-431.<br />
7 Siehe dazu vor allem seine Romane <strong>Die</strong> Dämonen <strong>und</strong> Der Idiot.
<strong>Die</strong>se Definition beanspruchte zwar eine universale Geltung, dennoch<br />
beschrieb sie in erster Linie <strong>die</strong> russischen <strong>und</strong> nicht <strong>die</strong> westlichen Zustände.<br />
In den Dämonen wandte sich Dostoevskij indes nicht nur gegen den sozialistischen,<br />
son<strong>der</strong>n auch gegen den nationalistischen Götzen. Der Autor<br />
verwickelt den Protagonisten <strong>der</strong> Idee von <strong>der</strong> Auserwähltheit <strong>der</strong> russischen<br />
Nation, Šatov, in einen Disput mit dem Haupthelden des Romans Stavrogin,<br />
<strong>der</strong> Šatov folgendes vorwirft:<br />
„[Sie haben] Gott bis zu einem bloßen Attribut <strong>der</strong> Nationalität herabgezogen.“<br />
„Im Gegenteil“, antwortet Šatov, „ich hebe das Volk bis zu Gott empor [...]. Das<br />
Volk – das ist <strong>der</strong> Körper Gottes. Jedes Volk ist ja doch nur so lange ein Volk,<br />
wie es noch seinen beson<strong>der</strong>en Gott hat <strong>und</strong> alle übrigen Götter auf Erden unbestechlich<br />
ablehnt, so lange es daran glaubt, daß es mit seinem Gott alle an<strong>der</strong>en<br />
Götter besiegen <strong>und</strong> aus <strong>der</strong> Welt vertreiben werde [...]. Ein Volk, das <strong>die</strong>sen<br />
Glauben an sich einbüßt, ist bereits kein Volk mehr. Aber es gibt nur eine Wahrheit,<br />
<strong>und</strong> folglich kann nur ein einziges Volk den wahren Gott haben [...]. Das<br />
einzige ‚Gottträgervolk‘ ist – das russische Volk.“<br />
Und als Stavrogin Šatov <strong>nach</strong> <strong>die</strong>ser Tirade fragt, ob er an Gott glaube,<br />
antwortetet <strong>der</strong> konsternierte Šatov: „Ich [...], ich werde [an Gott] glauben.“<br />
8<br />
Um so unbegreiflicher ist, angesichts <strong>die</strong>ser schonungslosen Desavouierung<br />
<strong>der</strong> nationalistischen Verirrung seines Romanhelden, <strong>die</strong> Ideologie, <strong>die</strong><br />
Dostoevskij selbst in seinem publizistischen Werk vertrat. In vieler Hinsicht<br />
erinnert sie an das Šatovsche Konzept. Denn <strong>die</strong> immer tiefere soziale <strong>und</strong><br />
nationale Kluft, <strong>die</strong> Rußland spaltete, hoffte Dostoevskij mit Hilfe des <strong>nationalen</strong><br />
Sendungsgedanken zu überwinden. Im Januar 1877 stellt er in seinem<br />
Tagebuch eines Schriftstellers folgendes Postulat auf:<br />
„Jedes große Volk glaubt <strong>und</strong> muß glauben, wenn es nur lange am Leben bleiben<br />
will, daß in ihm, <strong>und</strong> nur in ihm allein, <strong>die</strong> Rettung <strong>der</strong> Welt liegt, daß es bloß<br />
lebt, um an <strong>die</strong> Spitze aller Völker zu treten, sie alle in das eigene Volk aufzunehmen<br />
<strong>und</strong> sie, in harmonischem Chor, zum endgültigen <strong>und</strong> vorbestimmten Ziel<br />
zu führen.“ 9<br />
8 Dostoevskij, Fedor: <strong>Die</strong> Dämonen. München 1975, S. 345-348.<br />
9 Dostoevskij, Fedor: Tagebuch eines Schriftstellers. München 1977, S. 303.
<strong>Die</strong>ser Glaube, <strong>der</strong> das alte Rom, Frankreich <strong>und</strong> Deutschland ausgezeichnet<br />
hätte, setzt Dostoevskij seine Gedankengänge fort, präge natürlich<br />
auch das russische Volk, vor allem <strong>die</strong> Slavophilen, <strong>die</strong> daran glaubten, daß<br />
„Rußland zusammen mit allen Slawen, <strong>und</strong> es selbst an ihrer Spitze, <strong>der</strong> ganzen<br />
Welt das größte Wort sagen werde, das <strong>die</strong> Menschheit jemals vernommen hat,<br />
<strong>und</strong> daß <strong>die</strong>ses Wort gerade das Gebot <strong>der</strong> allmenschlichen Vereinigung sein<br />
wird, <strong>und</strong> zwar nicht im Geiste eines persönlichen Egoismus [...]. Das Ideal <strong>der</strong><br />
Slavophilen war vielmehr <strong>die</strong> Vereinigung im Geist <strong>der</strong> wahren Liebe, ohne Lüge<br />
<strong>und</strong> Materialismus [...]. Unsere ganze Rettung liegt ja darin, daß wir nicht im voraus<br />
darüber streiten, wie <strong>und</strong> wann sich <strong>die</strong>se Idee verwirklichen wird, son<strong>der</strong>n<br />
daß wir alle zusammen von <strong>der</strong> Betrachtung zur Tat übergehen.“ 10<br />
Große Hoffnungen verknüpfte Dostoevskij mit dem Anfang 1877 ausgebrochenen<br />
russisch-türkischen Krieg, den <strong>der</strong> Göttinger Historiker Reinhard<br />
Wittram als den ersten <strong>und</strong> einzigen pan-slavistischen Krieg Rußlands bezeichnet<br />
hat. 11<br />
Dostoevskij hoffte, daß <strong>die</strong>ser Krieg, den <strong>die</strong> Unterdrückung <strong>der</strong> südslawischen<br />
Aufstände durch <strong>die</strong> Osmanen ausgelöst hatte, <strong>die</strong> zerrissene russische<br />
Gesellschaft einigen würde:<br />
„Wir brauchen <strong>die</strong>sen Krieg auch für uns selbst: nicht nur für unsere von Türken<br />
gequälten ‚slawischen Brü<strong>der</strong>‘ erheben wir uns, son<strong>der</strong>n auch zur eigenen Rettung.<br />
Der Krieg wird <strong>die</strong> Luft, <strong>die</strong> wir atmen, erfrischen […]. <strong>Die</strong> ‚Klugen‘ prophezeien<br />
zwar, daß wir an unseren eigenen inneren Unordnungen ersticken [...]<br />
würden <strong>und</strong> darum an Stelle des Krieges lieber einen langen Frieden wünschen<br />
sollten [...]. Es wäre wirklich interessant zu erfahren, [...] auf welche Weise sie<br />
sich durch evidente Unehre Ehre erwerben wollen.“ 12<br />
<strong>Die</strong>sen russischen Skeptikern, aber auch den westlichen Wi<strong>der</strong>sachern Rußlands<br />
schleu<strong>der</strong>t Dostoevskij entgegen:<br />
10 Ebenda, S. 308.<br />
11 Wittram, Reinhard: Das russische Imperium <strong>und</strong> sein Gestaltwandel, in: Historische<br />
Zeitschrift 187, 1959, S. 568-593, hier S. 588.<br />
12 Dostoevskij, Tagebuch, S. 340ff.; siehe dazu auch Vinogradov, V.N.: Kancler M. Gorčakov<br />
v vodovorote vostočnogo krizisa 70-ch godov XIX veka, in: Slavjanovedenie<br />
5/2003, S. 16-24, hier S. 18.
„Und <strong>der</strong> Anfang des gegenwärtigen volkstümlichen Krieges [hat] dort wohl allen,<br />
<strong>die</strong> zu sehen verstehen, deutlich <strong>die</strong> geschlossene Ganzheit <strong>und</strong> <strong>die</strong> Frische unseres<br />
Volkes gezeigt, <strong>und</strong> bis zu welchem Grade unsere Volkskräfte unberührt<br />
geblieben sind von jener Zersetzung, <strong>die</strong> unsere Klugen befallen hat. [... Sie] ü-<br />
bersahen das ganze russische Volk als lebendige Kraft <strong>und</strong> übersahen <strong>die</strong> kolossale<br />
Tatsache: das Einssein des Zaren mit seinem Volke! Ja, nur das ist ihnen entgangen!“<br />
13<br />
Es ist verblüffend, wie sehr <strong>der</strong> Visionär Dostoevskij, <strong>der</strong> in seinem literarischen<br />
Werk mit einer beispiellosen Schärfe <strong>die</strong> Tragö<strong>die</strong>n des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
vorausgesehen hat, in seinem publizistischen Werk hinter den Entwicklungen<br />
<strong>der</strong> Gegenwart hinterherhinkte. Er ließ sich durch <strong>die</strong> Fassade<br />
<strong>der</strong> <strong>nationalen</strong> Geschlossenheit, <strong>die</strong> den Krieg von 1877/78 begleitete, täuschen<br />
<strong>und</strong> übersah das tatsächliche Ausmaß <strong>der</strong> damaligen Zerrissenheit <strong>der</strong><br />
Nation.<br />
Vier Jahre <strong>nach</strong>dem Dostoevskij vom „Einssein des Zaren mit seinem<br />
Volke“ gesprochen hatte, wurde <strong>der</strong> wohl liberalste Zar <strong>der</strong> neuesten russischen<br />
Geschichte von <strong>der</strong> Terrororganisation „Narodnaja Volja“ ermordet.<br />
Der siegreiche Krieg über <strong>die</strong> Türkei trug in keiner Weise zur <strong>nationalen</strong><br />
Aussöhnung bei. Im Gegenteil, <strong>der</strong> Prozeß <strong>der</strong> Polarisierung <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
trat <strong>nach</strong> <strong>die</strong>sem Ereignis in eine noch radikalere Phase ein.<br />
***<br />
Ähnlich wie Rußland erlebte damals auch Deutschland eine Entwicklungsphase,<br />
<strong>die</strong> für <strong>die</strong> Verfechter <strong>der</strong> <strong>nationalen</strong> Harmonie nicht allzu erfreulich<br />
war. <strong>Die</strong> deutsche Einheit, <strong>die</strong> von vielen als eine Art Vollendung <strong>der</strong> <strong>nationalen</strong><br />
Geschichte empf<strong>und</strong>en wurde, war mit euphorischen Erwartungen<br />
verknüpft. Einige fragten sich sogar, warum ausgerechnet ihre Generation<br />
es ver<strong>die</strong>nt hätte, Zeuge <strong>der</strong>art epochaler Ereignisse zu sein. In <strong>die</strong>sem Sinne<br />
äußerte sich z.B. <strong>der</strong> Historiker Heinrich von Sybell: „Wodurch hat man<br />
<strong>die</strong> Gnade Gottes ver<strong>die</strong>nt, so große <strong>und</strong> mächtige Dinge erleben zu dürfen?<br />
13 Ebenda, S. 343ff.
Und wie wird man <strong>nach</strong>her leben?“, schrieb er am 27. Januar 1871 in einem<br />
Brief an seinen Kollegen Hermann Baumgarten: „Was zwanzig Jahre <strong>der</strong><br />
Inhalt alles Wünschens <strong>und</strong> Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich<br />
herrlicher Weise erfüllt! Woher soll man in meinen Lebensjahren noch einen<br />
neuen Inhalt für das weitere Leben nehmen?“ 14<br />
<strong>Die</strong> Geschichte kennt aber im Gegensatz zur These Francis Fukuyamas<br />
kein Ende. Sie geht weiter. <strong>Die</strong> Euphorie ließ sehr schnell <strong>nach</strong>, denn <strong>die</strong><br />
erhoffte nationale Versöhnung fand, ungeachtet <strong>der</strong> beispiellosen außenpolitischen<br />
Erfolge Bismarcks, nicht statt. Im Gegenteil: Der konfrontative innenpolitische<br />
Kurs des „Eisernen Kanzlers“, sein machiavellistisches Ausspielen<br />
einiger politischer Strömungen gegen an<strong>der</strong>e verschärfte lediglich<br />
<strong>die</strong> bereits vorhandenen <strong>und</strong> nicht überw<strong>und</strong>enen Spannungen <strong>und</strong> Interessenkonflikte.<br />
Immer neue Gruppierungen wurden in <strong>die</strong> Kategorie <strong>der</strong><br />
Reichsfeinde eingeordnet – Katholiken, Sozialdemokraten, Partikularisten.<br />
Nach <strong>der</strong> konservativen Wende des Reichskanzlers im Jahre 1878 gerieten<br />
schließlich sogar jene Teile <strong>der</strong> deutschen Öffentlichkeit, <strong>die</strong> das „Geschenk“<br />
Bismarcks an <strong>die</strong> Deutschen – <strong>die</strong> Reichgründung – mit beson<strong>der</strong>er<br />
Dankbarkeit entgegengenommen hatten, in einen Zwist mit <strong>der</strong> Regierung:<br />
<strong>die</strong> Nationalliberalen, vor allem ihr linker Flügel.<br />
Zur depressiven Stimmung trug auch das „Danaergeschenk“ <strong>der</strong> unterlegenen<br />
Franzosen bei – ihre unerwartet schnelle Bezahlung <strong>der</strong> Kriegskontributionen,<br />
was den Grün<strong>der</strong>krach von 1873 mitverursachte. Der rasante<br />
Mo<strong>der</strong>nisierungsprozeß des Landes, <strong>der</strong> <strong>die</strong> Bismarcksche Revolution von<br />
oben begleitete, erlitt damals seinen ersten Rückschlag. Viele begannen<br />
nun, am Sinn <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne zu zweifeln <strong>und</strong> vor allem <strong>die</strong> liberalen Werte,<br />
<strong>die</strong> als Synonym <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne angesehen wurden, in Frage zu stellen: „<strong>Die</strong><br />
[liberale] Manchester-Politik ist gemein- <strong>und</strong> staatsgefährlich“, schrieb kurz<br />
<strong>nach</strong> dem Grün<strong>der</strong>krach <strong>der</strong> Journalist Otto Glagau, <strong>der</strong> zu den radikalsten<br />
Kritikern <strong>der</strong> liberalen Ideen zählte: „Alle ehrlichen wohlmeinenden Leute<br />
müssen sie energisch bekämpfen <strong>und</strong> sich zu <strong>die</strong>sem Zwecke zusammentun,<br />
gleichviel welcher Parteirichtung sie sonst angehören.“ 15<br />
14 Zit. <strong>nach</strong> Gall, Lothar: Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt/Main 1980, S.<br />
467.<br />
15 Claussen, Detlev: Vom Judenhaß zum Antisemitismus. Materialien einer verleugneten<br />
Geschichte. Darmstadt 1987, S. 97.
Einen ähnlich vehementen Feldzug gegen liberale Wertvorstellungen<br />
führte damals auch <strong>der</strong> Orientalist Paul de Lagarde, <strong>der</strong> in seinen kulturpessimistischen<br />
„Deutschen Schriften“ manche Gedankengänge <strong>der</strong> Weimarer<br />
„Konservativen Revolution“ vorwegnahm. 16 <strong>Die</strong> Juden galten Lagarde <strong>und</strong><br />
seinen Gesinnungsgenossen als <strong>die</strong> wichtigsten Vorkämpfer des Liberalismus,<br />
<strong>und</strong> so richtete sich <strong>die</strong> von ihnen inspirierte Auflehnung gegen <strong>die</strong><br />
Mo<strong>der</strong>ne in erster Linie gegen <strong>die</strong> Juden. 1881 führte Lagarde aus: „Juden<br />
<strong>und</strong> Liberale sind naturgemäß B<strong>und</strong>esgenossen, denn jene wie <strong>die</strong>se sind<br />
nicht Naturen, son<strong>der</strong>n Kunstprodukte. Wer nicht will, daß das deutsche<br />
Reich <strong>der</strong> Tummelplatz <strong>der</strong> Homunculi werde, <strong>der</strong> muß gegen Juden <strong>und</strong><br />
Liberale [...] Front machen.“ 17<br />
Durch <strong>die</strong> Identifizierung <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne mit den Juden befreiten sich Lagarde<br />
<strong>und</strong> seine Gesinnungsgenossen scheinbar aus einem Teufelskreis. Der<br />
aussichtslose Kampf gegen <strong>die</strong> allmächtigen <strong>und</strong> anonymen Kräfte <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
verwandelte sich in einen Kampf gegen konkrete <strong>und</strong> durchaus verletzbare<br />
Juden. <strong>Die</strong> Bezwingung bzw. <strong>die</strong> „Entfernung“ <strong>der</strong> Juden sollte<br />
automatisch zur Herstellung <strong>der</strong> patriarchalischen Idylle <strong>und</strong> <strong>der</strong> so<br />
schmerzlich vermißten <strong>organischen</strong> Einheit <strong>der</strong> Nation führen. <strong>Die</strong> Konturen<br />
einer beispiellosen „biologistischen“ bzw. rassistischen Revolution<br />
bahnten sich nun an. Der israelische Historiker Jacob Talmon charakterisierte<br />
sie folgen<strong>der</strong>maßen:<br />
16 Zur „Konservativen Revolution“ siehe u.a. Rauschning, Hermann: The Conservative<br />
Revolution, New York 1941; Mohler, Armin: <strong>Die</strong> Konservative Revolution in Deutschland.<br />
Der Gr<strong>und</strong>riß ihrer Weltanschauung. Stuttgart 1950; Sontheimer, Kurt: „Der Tatkreis“,<br />
in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 6, 1958, S. 229-260; Ders.: Antidemokratisches<br />
Denken in <strong>der</strong> Weimarer Republik. München 1968; Kuhn, Helmut: Das geistige<br />
Gesicht <strong>der</strong> Weimarer Republik, in: Zeitschrift für Politik 8, 1961, S. 1-10; von Klemperer,<br />
Klemens: Konservative Bewegungen. Zwischen Kaiserreich <strong>und</strong> Nationalsozialismus,<br />
München 1962; Stern, Fritz; Kulturpessimismus als politische Gefahr, Bern 1963; Breuer,<br />
Stefan: Anatomie <strong>der</strong> Konservativen Revolution. Darmstadt 1993; Luks, Leonid: „Eurasier“<br />
<strong>und</strong> „Konservative Revolution“. Zur antiwestlichen Versuchung in Rußland <strong>und</strong> in<br />
Deutschland, in: Koenen, Gerd / Kopelew, Lew, Hrsg.: Deutschland <strong>und</strong> <strong>die</strong> Russische<br />
Revolution 1917-1924. München 1998, S. 219-239.<br />
17 de Lagarde, Paul: Deutsche Schriften, 5. Aufl. Göttingen 1920, S. 349; zum Weltbild<br />
Lagardes siehe u.a. Stern, Kulturpessimismus; Pulzer, Peter G.J.: <strong>Die</strong> Entstehung des<br />
politischen Antisemitismus in Deutschland <strong>und</strong> Österreich 1867-1914. Gütersloh 1966, S.<br />
75ff.; Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918. Erster Band. Arbeitswelt<br />
<strong>und</strong> Bürgergeist. München 1990, S. 825f.
„Racist antisemitism focused on the Jews as the solvent of the integrity of the nation<br />
(or race) and the destroyer of its unerring instinct. As capitalist or socialist,<br />
the Jew was the bearer of alien abstract values, the destroyer of national solidarity,<br />
fomenter of class war and internal strive, a cosmopolitan exploiter plotting world<br />
domination. The elimination of the Jews assumed the dimension of a social and<br />
national revolution and of a moral renaissance. On the universal plane, the Jew<br />
was made to appear as the eternal inciter, ever since Moses, of all the mobs of<br />
lower breeds against the national elites of the superior races.“ 18<br />
Mit welchen Methoden wollten <strong>die</strong> Kämpfer gegen <strong>die</strong> angebliche „jüdische<br />
Übermacht“ im Bismarck-Reich zur inneren Konsoli<strong>die</strong>rung <strong>und</strong> zur<br />
„Ges<strong>und</strong>ung“ <strong>der</strong> deutschen Nation beitragen? Otto Glagau schlug folgende<br />
„Therapie“ vor:<br />
„Ich will <strong>die</strong> Juden nicht umbringen o<strong>der</strong> abschlachten, sie auch nicht aus dem<br />
Lande vertreiben; ich will ihnen nichts nehmen von dem, was sie einmal besitzen,<br />
aber ich will sie revi<strong>die</strong>ren, <strong>und</strong> zwar f<strong>und</strong>itus revi<strong>die</strong>ren. Nicht länger dürfen falsche<br />
Toleranz <strong>und</strong> Sentimentalität, leidige Schwäche <strong>und</strong> Furcht uns Christen<br />
abhalten, gegen <strong>die</strong> Auswüchse, Ausschreitungen <strong>und</strong> Anmaßungen <strong>der</strong> Judenschaft<br />
vorzugehen. Nicht länger dürfen wir’s dulden, daß <strong>die</strong> Juden sich überall in<br />
den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>, an <strong>die</strong> Spitze drängen, überall <strong>die</strong> Führung, das große Wort an<br />
sich reißen. Sie schieben uns Christen stets bei Seite, sie drücken uns an <strong>die</strong><br />
Wand, sie benehmen uns <strong>die</strong> Luft <strong>und</strong> den Atem [...]. <strong>Die</strong> ganze Weltgeschichte<br />
kennt kein zweites Beispiel, daß ein heimatloses Volk, eine physisch wie psychisch<br />
entschieden degenerierte Race, bloß durch List <strong>und</strong> Schlauheit, durch Wucher<br />
<strong>und</strong> Schacher, über den Erdkreis gebietet.“ 19<br />
Und Paul de Lagarde fügte hinzu:<br />
„Je<strong>der</strong> frem<strong>der</strong> Körper in einem lebendigen an<strong>der</strong>n erzeugt Unbehagen, Krankheit,<br />
oft sogar Eiterung <strong>und</strong> den Tod [...]. <strong>Die</strong> Juden sind als Juden in jedem europäischen<br />
Staate Fremde, <strong>und</strong> als Fremde nichts an<strong>der</strong>es als Träger <strong>der</strong> Verwesung.<br />
Wollen sie Angehörige eines nicht-jüdischen Staates werden, so müssen sie von<br />
ganzem Herzen <strong>und</strong> aus allen Kräften das Gesetz Mosis verwerfen, dessen Absicht<br />
es ist, sie überall außer Judäa zu Fremden zu machen [...]. Denn <strong>die</strong>s Gesetz<br />
18 Talmon, Jacob: The Myth of the Nation and the Vision of Revolution. The Origins of<br />
Ideological Polarisation in the Twentieth Century. London 1981, S. 13.<br />
19 Claussen, Vom Judenhaß zum Antisemitismus, S. 103f.
<strong>und</strong> <strong>der</strong> aus ihm stammende erbitternde Hochmut erhält sie als fremde Rasse: wir<br />
aber können schlechterdings eine Nation in <strong>der</strong> Nation nicht dulden.“ 20<br />
<strong>Die</strong>ser Feldzug gegen „jüdische Störenfriede“, <strong>die</strong> <strong>der</strong> erträumten <strong>nationalen</strong><br />
Eintracht angeblich im Wege standen, sollte in dem Moment eine beson<strong>der</strong>e<br />
Durchschlagskraft erreichen, als sich ihm Heinrich von Treitschke,<br />
<strong>der</strong> damals wohl bekannteste deutsche Historiker <strong>und</strong> wortgewaltige Publizist,<br />
anschloß.<br />
In seinem Artikel „Unsere Aussichten“ vom 15. November 1879, <strong>der</strong> in<br />
<strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> deutschen Judenfeindschaft ein neues Kapitel eröffnete,<br />
wandte sich Treitschke zunächst gegen den sogenannten „Radauantisemitismus“,<br />
fragte aber, ob das Auftreten <strong>die</strong>ses Phänomens, des gegen <strong>die</strong> Juden<br />
gerichteten Volkszorns, gr<strong>und</strong>los sei, <strong>und</strong> gab darauf folgende Antwort:<br />
„Nein, <strong>der</strong> Instinkt <strong>der</strong> Massen hat in <strong>der</strong> Tat eine schwere Gefahr, einen<br />
hochbedenklichen Schaden des neuen deutschen Lebens richtig erkannt; es<br />
ist keine leere Redensart, wenn man heute von einer deutschen Judenfrage<br />
spricht.“<br />
Dann kommt Treitschke zu Schlußfolgerungen, <strong>die</strong> sich für <strong>die</strong> weitere<br />
Entwicklung <strong>der</strong> politischen Kultur in Deutschland noch verheeren<strong>der</strong> auswirken<br />
sollten, als manche Hetzparolen <strong>der</strong> „Radauantisemiten. Er schreibt:<br />
„[Es] ist schon ein Gewinn, daß ein Übel, das je<strong>der</strong> fühlte <strong>und</strong> niemand berühren<br />
wollte, jetzt offen besprochen wird. Täuschen wir uns nicht; <strong>die</strong> Bewegung ist<br />
sehr tief <strong>und</strong> stark; einige Scherze über <strong>die</strong> Weisheitssprüche christlich-sozialer<br />
Stump-Redner [Treitschke bezieht sich hier auf <strong>die</strong> Auftritte <strong>der</strong> antisemitischen<br />
Christlich-Sozialen (Arbeiter-) Partei des Hofpredigers Adolf Stoecker – L.L.]<br />
genügen nicht, sie zu bezwingen. Bis in <strong>die</strong> Kreise <strong>der</strong> höchsten Bildung hinauf,<br />
unter Männern, <strong>die</strong> jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit o<strong>der</strong> <strong>nationalen</strong><br />
20 Lagarde, Deutsche Schriften, S. 278; zum Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich<br />
siehe u.a. Pulzer, <strong>Die</strong> Entstehung des politischen Antisemitismus; Jochmann, Werner:<br />
Gesellschaftskrise <strong>und</strong> Judenfeindschaft in Deutschland 1870-1945. Hamburg 1991;<br />
Zechlin, Egmont: <strong>Die</strong> deutsche Politik <strong>und</strong> <strong>die</strong> Juden im Ersten Weltkrieg. Göttingen<br />
1969; Stern, Fritz: Gold <strong>und</strong> Eisen. Bismarck <strong>und</strong> sein Bankier Bleichrö<strong>der</strong>. Frankfurt/Main<br />
1980; Volkov, Shulamit: Jüdisches Leben <strong>und</strong> Antisemitismus im 19. <strong>und</strong> 20.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t. Zehn Essays, München 1990; Poliakov, Léon: Geschichte des Antisemitismus,<br />
Band 7.Worms 1988, S. 13-43.
Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem<br />
M<strong>und</strong>e: <strong>die</strong> Juden sind unser Unglück!“ 21<br />
Treitschkes Kritik an den Juden war in manchen Punkten <strong>der</strong>jenigen <strong>der</strong><br />
„Radauantisemiten“ zum Verwechseln ähnlich. Er schreibt nämlich:<br />
„[...] unbestreitbar hat das Semitentum an dem Lug <strong>und</strong> Trug, an <strong>der</strong> frechen Gier<br />
des Grün<strong>der</strong>unwesens einen großen Anteil, eine schwere Mitschuld an jenem<br />
schnöden Materialismus unserer Tage, <strong>der</strong> jede Arbeit nur noch als Geschäft betrachtet<br />
[...]; in Tausenden deutscher Dörfer sitzt <strong>der</strong> Jude, <strong>der</strong> seine Nachbarn<br />
wuchernd auskauft. Unter den führenden Männern <strong>der</strong> Kunst <strong>und</strong> Wissenschaft ist<br />
<strong>die</strong> Zahl <strong>der</strong> Juden nicht sehr groß; um so stärker <strong>die</strong> betriebsame Schar <strong>der</strong> semitischen<br />
Talente dritten Ranges [...]. Am gefährlichsten aber wirkt das unbillige<br />
Übergewicht des Judentums in <strong>der</strong> Tagespresse.“ 22<br />
Und wie wollte Treitschke <strong>die</strong> sogenannte „deutsche Judenfrage“ lösen?<br />
Eine erneute Entrechtung <strong>der</strong> Juden, wie sie viele radikale Antisemiten for<strong>der</strong>ten,<br />
lehnte er ab: „[Eine] Zurücknahme [...] <strong>der</strong> vollzogenen Emanzipation<br />
[...] wäre ein offenbares Unrecht, ein Abfall von den guten Traditionen<br />
unseres Staates <strong>und</strong> würde den <strong>nationalen</strong> Gegensatz, <strong>der</strong> uns peinigt, eher<br />
verschärfen als mil<strong>der</strong>n.“<br />
So betrachtete Treitschke als das einzig mögliche Mittel für <strong>die</strong> Überwindung<br />
des deutsch-jüdischen Gegensatzes eine totale Assimilation <strong>der</strong><br />
Juden, <strong>die</strong> gänzliche Aufgabe ihrer eigenen Identität:<br />
„[Sie] sollen Deutsche werden, sich schlicht <strong>und</strong> recht als Deutsche fühlen – unbeschadet<br />
ihres Glaubens <strong>und</strong> ihrer alten heiligen Erinnerungen, <strong>die</strong> uns allen<br />
ehrwürdig sind; denn wir wollen nicht, daß auf <strong>die</strong> Jahrtausende germanischer<br />
Gesittung ein Zeitalter deutsch-jüdischer Mischkultur folge.“ 23<br />
Zugleich weiß aber Treitschke, daß seine Auffor<strong>der</strong>ung an <strong>die</strong> Juden, „sich<br />
rückhaltlos zu entschließen, Deutsche zu sein“, niemals ganz erfüllt werden<br />
kann: „Eine Kluft zwischen abendländischem <strong>und</strong> semitischem Wesen hat<br />
21 von Treitschke, Heinrich: Unsere Aussichten, in: Ders.: Aufsätze, Reden <strong>und</strong> Briefe. 4.<br />
Band. Schriften <strong>und</strong> Reden zur Zeitgeschichte II, (im folgenden: Treitschke, Aufsätze,<br />
Band 4). Meersburg 1929, S. 466-482, hier S. 478, 481.<br />
22 Ebenda, S. 480; siehe dazu auch von Treitschke, Heinrich: Briefe, hrsg. v. M. Cornicelius,<br />
Band 3, Leipzig 1920, S. 468, 502f., 515.<br />
23 Treitschke, Aufsätze, Band 4, S. 479, 481.
von jeher bestanden [… Es] wird immer Juden geben, <strong>die</strong> nichts sind als<br />
deutschredende Orientalen.“ 24<br />
<strong>Die</strong>se Thesen des angesehenen Gelehrten riefen eine allgemeine Empörung<br />
innerhalb <strong>der</strong> jüdischen Öffentlichkeit hervor, <strong>und</strong> zwar nicht nur bei<br />
denjenigen Juden, <strong>die</strong> Treitschke in <strong>die</strong> Kategorie <strong>der</strong> „deutschredenden<br />
Orientalen“ einordnete, son<strong>der</strong>n auch bei solchen, denen Treitschke selbst<br />
das Ehrenattribut „Deutsche“ verliehen hatte. Zu den letzteren zählte auch<br />
<strong>der</strong> Historiker Harry Breßlau.<br />
<strong>Die</strong> Gedankengänge Treitschkes stellten für Breslau nichts Ungewöhnliches<br />
dar. In ihnen spiegele sich <strong>die</strong> allgemein beliebte Tendenz wi<strong>der</strong>,<br />
„einen Sündenbock aufzusuchen, dem man <strong>die</strong> eigene <strong>und</strong> <strong>die</strong> fremde Schuld aufzubürden<br />
geneigt ist. In Deutschland haben dazu von Alters her <strong>die</strong> Juden <strong>die</strong>nen<br />
müssen. Wie man im 13. Jahrhun<strong>der</strong>t den Verrat Deutschlands an <strong>die</strong> Mongolen,<br />
im 14. das Wüten <strong>der</strong> Pest ihnen zur Last legte, so sind sie auch heute <strong>der</strong> bequeme<br />
Prügelknabe, <strong>der</strong> für Je<strong>der</strong>mann herhalten muß. Ihnen schreiben <strong>die</strong> Konservativen<br />
<strong>die</strong> Hauptschuld an unserer liberalen Gesetzgebung, <strong>die</strong> Ultramontanen an<br />
dem Kulturkampfe zu; sie werden verantwortlich gemacht für <strong>die</strong> angebliche Korruption<br />
unserer Presse <strong>und</strong> unseres Buchhandels, für <strong>die</strong> wirtschaftliche Krisis, für<br />
den allgemeinen Notstand <strong>und</strong> für den Verfall <strong>der</strong> Musik.“ 25<br />
Daß Treitschke sich ungeachtet seines wissenschaftlichen Ranges <strong>und</strong> Rufes<br />
ähnlich vereinfachen<strong>der</strong> Denkmuster be<strong>die</strong>nte, erschütterte Breßlau.<br />
Treitschke wie<strong>der</strong>um, <strong>der</strong> vor Selbstgerechtigkeit strotzte, führte <strong>die</strong> Reaktion<br />
Breßlaus auf seinen Artikel, in dem er <strong>die</strong> Juden angeblich noch geschont<br />
hatte, auf <strong>die</strong> „krankhafte“, „übertriebene Empfindlichkeit“ <strong>der</strong> deutschen<br />
Juden zurück. 26<br />
So erwiesen sich sogar <strong>die</strong>jenigen Juden, <strong>die</strong> sich aus <strong>der</strong> Sicht Treitschkes<br />
„ohne Vorbehalte als Deutsche fühlten“, letztendlich als Juden <strong>und</strong> damit<br />
im Gr<strong>und</strong>e als nicht integrierbarer Fremdkörper im deutschen Volksorganismus.<br />
24 Ebenda, S. 481f.<br />
25 Breßlau, Harry: Zur Judenfrage. Sendschreiben an Herrn Professor Dr. Heinrich von<br />
Treitschke, in: Der Berliner Antisemitismusstreit, hrsg. von Walter Boehlich. Frankfurt/Main<br />
1965, S. 52-76, hier S. 74.<br />
26 Treitschke: Noch einige Bemerkungen zur Judenfrage, in: <strong>der</strong>s.: Aufsätze, Band 4, S.<br />
494-503, hier S. 494.
Innerhalb kürzester Zeit radikalisierten sich <strong>die</strong> Ansichten Treitschkes<br />
zur „deutschen Judenfrage“ immer mehr. Im Januar 1880, also nur zwei<br />
Monate <strong>nach</strong> Beginn des von ihm selbst ausgelösten „Antisemitismusstreits“,<br />
bezeichnete er <strong>die</strong> These eines seiner jüdischen Kontrahenten (M.<br />
Lazarus), daß „das Judentum ganz in demselben Sinne wie das Christentum<br />
deutsch ist“ als ungeheuerlich: „<strong>Die</strong> bestgesitteten Nationen <strong>der</strong> Gegenwart,<br />
<strong>die</strong> westeuropäischen, sind allesamt christliche Völker. Jenes lebendige<br />
Bewußtsein <strong>der</strong> Einheit, das <strong>die</strong> Nationalität bedingt, kann sich <strong>der</strong> Regel<br />
<strong>nach</strong> nicht bilden unter Menschen, <strong>die</strong> über <strong>die</strong> höchsten <strong>und</strong> heiligsten<br />
Fragen des Gemütslebens gr<strong>und</strong>verschieden denken.“ 27<br />
So hatten <strong>die</strong> Juden <strong>nach</strong> dem Diktum des Gelehrten nicht nur als Nation,<br />
son<strong>der</strong>n auch als Glaubensgemeinschaft im Gr<strong>und</strong>e kein Existenzrecht auf<br />
deutschem Boden. Damit wi<strong>der</strong>sprach Treitschke seinen eigenen Thesen,<br />
<strong>die</strong> er noch einige Wochen zuvor, im Dezember 1879, vertreten hatte. Damals<br />
schrieb er nämlich:<br />
„Unser Staat hat in den Juden nie etwas an<strong>der</strong>es gesehen als eine Glaubensgenossenschaft,<br />
<strong>und</strong> er kann von <strong>die</strong>sem allein haltbaren Rechtsbegriffe unter keinen<br />
Umständen abgehen; er hat ihnen <strong>die</strong> bürgerliche Gleichberechtigung nur zugestanden<br />
in <strong>der</strong> Erwartung, daß sie sich bestreben würden, ihren Mitbürgern gleich<br />
zu sein. [... Beansprucht aber] das Judentum gar Anerkennung seiner Nationalität,<br />
so bricht <strong>der</strong> Rechtsboden zusammen, auf dem <strong>die</strong> Emanzipation steht. [...] Auf<br />
deutschem Boden ist für eine Doppel-Nationalität kein Raum.“ 28<br />
Einige Wochen später stellte Treitschke aber, wie bereits gezeigt, auch den<br />
Status <strong>der</strong> Juden als Glaubensgemeinschaft in Frage.<br />
Der politische Skandal, den Treitschkes judenfeindliche Thesen auslösten,<br />
läßt sich in gewisser Hinsicht mit <strong>der</strong> an<strong>der</strong>thalb Jahrzehnte später ausgebrochenen<br />
Dreyfus-Affäre vergleichen. Dabei wird nicht selten das<br />
Scheitern des gegen Alfred Dreyfus gerichteten antisemitischen Komplotts<br />
als ein Zeichen <strong>der</strong> Reife <strong>der</strong> politischen Kultur Frankreichs aufgefaßt. <strong>Die</strong><br />
Ideale des Jahres 1789 behielten hier auch im ausgehenden 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
ihre prägende <strong>und</strong> identitätsstiftende Bedeutung.<br />
27 Ebenda, S. 500f.<br />
28 Treitschke: Herr Graetz <strong>und</strong> sein Judentum, in: Treitschke: Aufsätze, Band 4, S. 483-<br />
493, hier S. 492.
Man darf aber auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite nicht vergessen, daß auch <strong>die</strong> Provokationen<br />
Treitschkes viele Deutsche dazu bewogen, sich mit den angegriffenen<br />
Juden zu solidarisieren. Das „J’accuse“ Émile Zolas von 1898<br />
hatte sein Pendant in <strong>der</strong> von 75 Personen unterzeichneten Berliner Erklärung<br />
vom 12. November 1880, <strong>die</strong> den Antisemitismus aufs schärfste verurteilte<br />
<strong>und</strong> u.a. folgende Passagen enthielt:<br />
„In unerwarteter <strong>und</strong> tief beschämen<strong>der</strong> Weise wird jetzt an verschiedenen Orten,<br />
zumal den größten Städten des Reichs, <strong>der</strong> Racenhaß <strong>und</strong> <strong>der</strong> Fanatismus des Mittelalters<br />
wie<strong>der</strong> ins Leben gerufen <strong>und</strong> gegen unsere jüdischen Mitbürger gerichtet.<br />
[...] Wenn jetzt von den Führern <strong>die</strong>ser Bewegung <strong>der</strong> Neid <strong>und</strong> <strong>die</strong> Mißgunst<br />
nur abstrakt gepredigt werden, so wird <strong>die</strong> Masse nicht säumen, aus jenem Gerede<br />
<strong>die</strong> praktischen Konsequenzen zu ziehen. An dem Vermächtnis Lessings rütteln<br />
Männer, <strong>die</strong> auf <strong>der</strong> Kanzel <strong>und</strong> dem Kathe<strong>der</strong> verkünden sollten, daß unsere Kultur<br />
<strong>die</strong> Isolierung desjenigen Stammes überw<strong>und</strong>en hat, welcher einst <strong>der</strong> Welt <strong>die</strong><br />
Verehrung des einigen Gottes gab.“ 29<br />
Zu den Unterzeichnern <strong>der</strong> Erklärung gehörten führende Vertreter des liberalen<br />
Spektrums <strong>der</strong> deutschen Öffentlichkeit, u.a. solch berühmte Kollegen<br />
Treitschkes wie Theodor Mommsen, Johann Gustav Droysen, Rudolf Virchow<br />
<strong>und</strong> Rudolf von Gneist.<br />
Indes konnte <strong>die</strong>ses Bekenntnis <strong>der</strong> deutschen Liberalen zur Toleranz <strong>und</strong><br />
zur Anerkennung solch universaler Werte wie Rechtsgleichheit <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
<strong>die</strong> verhängnisvollen Folgen <strong>der</strong> antijüdischen Kampagne<br />
Treitschkes nur begrenzt abmil<strong>der</strong>n. <strong>Die</strong>s hatte mit <strong>der</strong> allgemeinen Erosion<br />
<strong>der</strong> universalen Werte <strong>und</strong> dem Siegeszug des partikularistischen, „linguistischen“<br />
Nationalismus (Lewis Namier) zu tun, <strong>der</strong> in ganz Europa, nicht<br />
zuletzt in Deutschland, in <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts zu beobachten<br />
war. Wie Jakov Talmon betont, war <strong>der</strong> europäische Nationalismus<br />
ursprünglich romantisch <strong>und</strong> schwärmerisch. Überall ergötzte man sich an<br />
<strong>der</strong> Vision von einer natürlichen Solidarität <strong>und</strong> Verbrü<strong>der</strong>ung freier Völker.<br />
30 <strong>Die</strong>se Vision erlebte aber während <strong>der</strong> Revolution von 1848 ihr klägliches<br />
Scheitern, <strong>und</strong> so setzte sich <strong>der</strong> voraussetzungslose, keinen universalen<br />
Werten verpflichtete nationale Egoismus durch. <strong>Die</strong> maximale Macht-<br />
29 Berliner Antisemitismusstreit, S. 203; zur Reaktion Treitschkes auf <strong>die</strong>se Erklärung<br />
siehe Treitschke, Briefe, Band 3, S. 524ff., 528.<br />
30 Talmon, Jacob: Political Messianism: The Romantic Phase. London 1960.
entfaltung <strong>der</strong> eigenen Nation auf Kosten an<strong>der</strong>er galt nun als eine Art kategorischer<br />
Imperativ. Nur in <strong>die</strong>ser Atmosphäre konnte sich <strong>die</strong> Konzeption<br />
<strong>der</strong> Realpolitik Alfred von Rochaus – des ehemaligen Acht<strong>und</strong>vierzigers –<br />
entwickeln, <strong>der</strong> <strong>nach</strong> dem Zusammenbruch <strong>der</strong> idealistischen Träume seiner<br />
Generation nun vor allem <strong>die</strong> Macht vergötterte, <strong>und</strong> Ideen, hinter denen<br />
keine Macht stand, als bloße Chimären abtat. 31<br />
Von Rechten hätten ursprünglich <strong>die</strong> Schwachen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Unterdrückten<br />
gesprochen, sagt in <strong>die</strong>sem Zusammenhang Jacob Talmon. <strong>Die</strong> Macht des<br />
Rechts sei für sie eine Art Schutzschild gewesen. Später habe man aber begonnen,<br />
vom Recht <strong>der</strong> Macht zu sprechen. 32<br />
Da <strong>die</strong> Verächter universaler Werte <strong>die</strong> eigene Nation für <strong>die</strong> Krönung<br />
<strong>der</strong> Schöpfung hielten <strong>und</strong> ihre maximale innere Geschlossenheit <strong>und</strong> organische<br />
Homogenität als das wohl wichtigste moralische Gebot ansahen, diffamierten<br />
sie alle politischen Kräfte, <strong>die</strong> <strong>die</strong>sem Ziel keine vorrangige Bedeutung<br />
beimaßen, als „vaterlandslose Gesellen“. Und <strong>die</strong>ser moralisierende<br />
Amoralismus hatte viele Gegner des rigiden Nationalismus nicht unbeeindruckt<br />
gelassen. Denn auch sie partizipierten, trotz all ihrer Zweifel, am<br />
nationalistischen Zeitgeist, den Thomas Nipperdey folgen<strong>der</strong>maßen charakterisiert:<br />
„<strong>Die</strong> Nation ist [für ihn] <strong>die</strong> innerweltlich am höchsten rangierende individuelle<br />
Gruppe – nicht <strong>der</strong> Stand, <strong>die</strong> Konfession, das Territorium des Staates, <strong>die</strong> Landschaft<br />
<strong>und</strong> Region <strong>und</strong> nicht <strong>die</strong> Klasse o<strong>der</strong> <strong>die</strong> politische Richtung im Weltbürgerkrieg;<br />
<strong>die</strong> Nation ist <strong>die</strong> Gruppe, <strong>die</strong> den höchsten Loyalitätsanspruch stellt <strong>und</strong><br />
stellen darf, <strong>die</strong> den Einsatz <strong>und</strong> das Opfer des Lebens lohnt <strong>und</strong> for<strong>der</strong>t, <strong>die</strong> <strong>die</strong><br />
Kultur <strong>und</strong> Erziehung, also <strong>die</strong> gemeinsame Weltlauslegung trägt <strong>und</strong> prägt, ja, je<br />
mehr Religion schwindet, auch den Sinn des gemeinsamen <strong>und</strong> des individuellen<br />
Lebens [...]. All das ist europäische Gemeinsamkeit <strong>und</strong> [...] kein ‚deutscher Son<strong>der</strong>weg.‘“<br />
33<br />
Man muß allerdings hervorheben, daß <strong>die</strong> Kluft zwischen den universalen<br />
<strong>und</strong> den partikularen (<strong>nationalen</strong>) Werten in Deutschland eine beson<strong>der</strong>e<br />
31 von Rochau, Ludwig August: Gr<strong>und</strong>züge <strong>der</strong> Realpolitik angewendet auf <strong>die</strong> staatlichen<br />
Zustände Deutschlands. Stuttgart 1853.<br />
32 Talmon, Jacob: The Unique and the Universal. London 1965, S. 165.<br />
33 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918. Zweiter Band. Machtstaat vor<br />
<strong>der</strong> Demokratie. München 1992, S. 84; siehe dazu auch <strong>der</strong>s.: Deutsche Geschichte 1866-<br />
1918. Erster Band, S. 814.
Tiefe erreichte. <strong>Die</strong>s nicht zuletzt deshalb, weil <strong>der</strong> deutsche Nationalismus<br />
seine größten Triumphe in einer Epoche feierte, in <strong>der</strong> <strong>die</strong> Realpolitik, <strong>die</strong><br />
Verherrlichung <strong>der</strong> Macht als solcher, ihren Höhepunkt erreichte. Thomas<br />
Nipperdey schreibt in <strong>die</strong>sem Zusammenhang von <strong>der</strong> erstaunlichen Intensität,<br />
mit <strong>der</strong> <strong>der</strong> politische „Idealismus“ <strong>und</strong> <strong>die</strong> „Prinzipienpolitik“ in<br />
Deutschland – nicht zuletzt in den national-liberalen Kreisen – infolge <strong>der</strong><br />
beispiellosen Erfolge <strong>der</strong> Bismarckschen Realpolitik in Machtglauben umschlugen.<br />
<strong>Die</strong> Wendung zur Realpolitik sei durchaus legitim gewesen, sie<br />
sei allerdings durch theoretische Reflexion radikalisiert <strong>und</strong> zu einem neuen<br />
Prinzip erhoben worden. <strong>Die</strong> Opposition gegen <strong>die</strong> Prinzipienpolitik sei<br />
selbst zum Prinzip geworden. 34<br />
Ludwig Dehio spricht seinerseits von <strong>der</strong> fehlenden universalen „Mission“,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> Hegemonialpolitik des Deutschen Reiches auszeichnete, <strong>und</strong><br />
fügt hinzu:<br />
„Wie an<strong>der</strong>s stand es um <strong>die</strong> früheren Hegemonialmächte, <strong>die</strong> in <strong>der</strong> Gegenreformation<br />
[Spanien – L.L.], französischer Weltkultur, den Errungenschaften <strong>der</strong> Revolution<br />
Ideen einzusetzen vermochten, <strong>die</strong> ihren Heeren werbend vorauseilten<br />
<strong>und</strong> selbst durch <strong>die</strong> Überfor<strong>der</strong>ung in sieglosen Kämpfen nicht völlig verbraucht,<br />
<strong>die</strong> Nie<strong>der</strong>lage überlebten <strong>und</strong> jenseits <strong>der</strong> Grenzen eine Klientel von Parteigängern<br />
zusammenhielten. [...] Wir aber vermochten [...] keinen einleuchtenden ‚Auftrag<br />
von Gott‘ vorzuweisen im Sinne Rankes, nicht im Sinne Hegels einen ‚Moment<br />
<strong>der</strong> Idee des Weltgeistes‘ zu verkörpern, ‚welcher gegenwärtig seine Stufe<br />
ist <strong>und</strong> daher absolutes Recht auch über <strong>die</strong> an<strong>der</strong>en auszuüben beanspruchen<br />
darf‘. [...] Überflüssig auszuführen, daß es nicht eine konstitutive Schwäche unserer<br />
<strong>nationalen</strong> geistigen Energien gewesen sein kann, <strong>die</strong> Schuld an <strong>der</strong> Schwäche<br />
unserer Sendung getragen hat. Im Gegenteil: Deutschland überragt zu Beginn des<br />
19. Jahrhun<strong>der</strong>ts an Fülle des Geistes wohl alle an<strong>der</strong>en Nationen <strong>und</strong> bleibt zu<br />
Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts hinter keiner zurück. Nein, es ist <strong>die</strong> spezifisch deutsche<br />
Distanz von Geist <strong>und</strong> Macht, <strong>die</strong> sich hier ausdrückt.“ 35<br />
Da sich <strong>der</strong> so spät entstandene deutsche Nationalstaat auf <strong>der</strong> Suche <strong>nach</strong><br />
seiner Identität befand, bemühten sich hier <strong>die</strong> national-gesinnten Kräfte<br />
beson<strong>der</strong>s eifrig um <strong>die</strong> innere Geschlossenheit des Volkes <strong>und</strong> betrachteten<br />
weltoffene, kosmopolitisch gesinnte Teile <strong>der</strong> Nation nicht als Bereicherung<br />
34 Ders.: Gr<strong>und</strong>probleme <strong>der</strong> deutschen Parteigeschichte im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t, in: Ders.:<br />
Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen 1976, S. 89-112.<br />
35 Dehio, Ludwig: Deutschland <strong>und</strong> <strong>die</strong> Weltpolitik im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t. München 1955,<br />
S. 104f.
für <strong>die</strong> eigene Kultur, son<strong>der</strong>n als beispiellose Gefahr. <strong>Die</strong> Juden, <strong>die</strong> das<br />
Universale <strong>und</strong> das Partikulare zugleich in einer einzigartigen Weise verkörperten,<br />
wurden nun von den Verfechtern <strong>der</strong> „<strong>organischen</strong>“ Einheit <strong>der</strong><br />
Nation zu einer solchen Bedrohung stilisiert. Erstaunlicherweise erfaßte <strong>die</strong><br />
Angst vor <strong>der</strong> „kosmopolitischen Gefahr“, welche <strong>die</strong> Juden angeblich darstellten,<br />
nicht nur solche radikalen Nationalisten wie Treitschke, son<strong>der</strong>n<br />
auch manche seiner liberalen Wi<strong>der</strong>sacher – z.B. Theodor Mommsen. Trotz<br />
seiner Empörung über <strong>die</strong> judenfeindlichen Schmähungen Treitschkes for<strong>der</strong>te<br />
Mommsen <strong>die</strong> deutschen Juden dazu auf, sich gänzlich zu assimilieren<br />
<strong>und</strong> ihre eigene Identität aufzugeben:<br />
„Der Eintritt in eine große Nation kostet seinen Preis [...]. Auch <strong>die</strong> Juden führt<br />
kein Moses wie<strong>der</strong> in das gelobte Land. [...Es] ist ihre Pflicht, so weit sie es können<br />
ohne gegen ihr Gewissen zu handeln, auch ihrerseits <strong>die</strong> Son<strong>der</strong>art <strong>nach</strong> bestem<br />
Vermögen von sich zu tun <strong>und</strong> alle Schranken zwischen sich <strong>und</strong> den übrigen<br />
Mitbürgern mit entschlossener Hand nie<strong>der</strong>zuwerfen.“ 36<br />
Durch <strong>die</strong>se Anpassung an das Vokabular <strong>der</strong> radikalen Nationalisten nahmen<br />
viele deutsche Liberale <strong>nach</strong> dem politischen Rückschlag (<strong>der</strong> konservativen<br />
Wende Bismarcks von 1878) auch einen geistigen Rückschlag in<br />
Kauf. Im Diskurs um <strong>die</strong> „deutsche Judenfrage“ setzte sich also <strong>die</strong> Position<br />
Treitschkes in einem immer stärkeren Ausmaß durch. <strong>Die</strong>s ungeachtet <strong>der</strong><br />
Tatsache, daß <strong>der</strong> Zulauf <strong>der</strong> antisemitischen Parteien im ausgehenden 19.<br />
<strong>und</strong> zu Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts keineswegs imposant war – sie stellten<br />
im Reichstag nur ein Randphänomen dar. Dafür nahm aber <strong>die</strong> Judenfeindlichkeit<br />
innerhalb <strong>der</strong> politischen Klasse Deutschlands, nicht zuletzt in den<br />
Akademikerkreisen, immer bedrohlichere Dimension an.<br />
In ihrem Aufsatz „Antisemitismus als kultureller Code“ schreibt <strong>die</strong> israelische<br />
Historikerin Shulamit Volkov:<br />
„Was in den siebziger Jahren [des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts – L.L.] in <strong>der</strong> Hitze <strong>der</strong> Leidenschaft<br />
geschmiedet worden war, wurde in den neunziger Jahren zur Selbstverständlichkeit.<br />
In dem früheren Zeitraum wurde <strong>der</strong> Antisemitismus mit echtem<br />
Haß gepredigt; gegen Ende des Jahrhun<strong>der</strong>ts wurde er zum Bestandteil einer ganzen<br />
Kultur. [...] <strong>Die</strong> schlimmste soziale <strong>und</strong> wirtschaftliche Krise <strong>der</strong> siebziger<br />
36 Mommsen, Theodor: Auch ein Wort über unser Judentum, in: Berliner Antisemitismusstreit,<br />
S. 210-225, hier S. 225.
Jahre war mittlerweile vorbei. <strong>Die</strong> mögliche therapeutische Funktion des Antisemitismus<br />
verlor zusehends an Bedeutung. Doch wurde er unterdessen zu einem<br />
[...] ständigen Begleiter des aggressiven Nationalismus <strong>und</strong> Antimo<strong>der</strong>nismus.“ 37<br />
Treitschke, <strong>der</strong> zu den einflußreichsten akademischen Lehrern <strong>der</strong> Berliner<br />
Universität zählte, trug außerordentlich dazu bei, daß antisemitische Denkklischees<br />
immer salonfähiger wurden. In seinen Vorlesungen über „Politik“<br />
beschrieb er <strong>die</strong> angeblichen Defizite des „jüdischen Nationalcharakters“<br />
mit einer ähnlichen Gehässigkeit, wie er <strong>die</strong>s in seinem publizistischen<br />
Werk bereits getan hatte. Einige Beispiele sollten genügen:<br />
„So gewiß das Vaterland <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>lage aller politischen Größe ist, ebenso gewiß<br />
zeigt ein Volk ohne Vaterland das genaue Gegenteil wirklicher politischer Begabung.<br />
Hierzu gehört Tapferkeit <strong>und</strong> lebendige Liebe zu Volk <strong>und</strong> Land. Der mo<strong>der</strong>ne<br />
Jude hat das Gegenteil dessen, was man politischen Sinn nennt; darum ist es<br />
so monströs, daß Juden heute bei uns <strong>die</strong> politische Presse beherrschen.“ 38<br />
Dann spricht Treitschke von einem „bis zur wildesten Leidenschaft gesteigerten<br />
Handelstrieb“ <strong>der</strong> Juden <strong>und</strong> fügt hinzu:<br />
„Immer waren <strong>die</strong> Juden ‚ein Element <strong>der</strong> <strong>nationalen</strong> Dekomposition‘, auf ehrlich<br />
Deutsch: <strong>der</strong> <strong>nationalen</strong> Zersetzung. Der Handel will überhaupt keine Grenzen in<br />
<strong>der</strong> Welt mehr anerkennen. Daß ein Teil des europäischen Großkapitals in einem<br />
inter<strong>nationalen</strong> B<strong>und</strong>e steht, um seine Interessen durchzusetzen gegenüber dem<br />
kleinen Kapital <strong>und</strong> dem Gr<strong>und</strong>besitz, ist doch mit Händen zu greifen.<br />
An<strong>der</strong>erseits bewahren <strong>die</strong> Juden durch das Heiraten unter sich ihr Volkstum<br />
so zähe, daß sie nicht aufgehen in einem fremden Volke. [...] <strong>Die</strong> Mehrzahl von<br />
ihnen [...] trägt <strong>die</strong> fremde Nationalität nur wie einen Mantel. Daher denn <strong>die</strong> bekannte<br />
Tatsache, daß <strong>die</strong> mo<strong>der</strong>nen Juden nur in einer einzigen Kunst eine wirkliche<br />
Genialität zeigen, in <strong>der</strong> Schauspielkunst.“ 39<br />
37 Volkov, Shulamit: Antisemitismus als kultureller Code, in: <strong>Die</strong>s.: Jüdisches Leben <strong>und</strong><br />
Antisemitismus, S. 13-36, hier S. 33; vgl. dazu auch Nipperdey: Deutsche Geschichte<br />
1866-1918. Erster Band, S. 405.<br />
38 von Treitschke, Heinrich: Vorlesungen gehalten an <strong>der</strong> Universität zu Berlin. Zweiter<br />
Band, 5. Aufl. Leipzig 1922, S. 27.<br />
39 Ebenda, Erster Band, S. 295; vgl. dazu auch zahlreiche antijüdische Passagen in<br />
Treitschkes Hauptwerk „Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhun<strong>der</strong>t“, so u.a.<br />
Band 2, S. 409ff., Band 3, S. 685-94, 697, Band 4, S. 287f., 413 (ich stütze mich hier auf<br />
<strong>die</strong> Leipziger Ausgabe vom Jahre 1927).
Zu den Hörern Treitschkes, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Botschaft des eloquenten Hochschullehrers<br />
verinnerlichten, gehörten viele Studenten, <strong>die</strong> später zu den aktivsten<br />
Kämpfern gegen <strong>die</strong> sogenannte „jüdische Gefahr“ zählen sollten, nicht<br />
zuletzt <strong>der</strong> langjährige Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes Heinrich<br />
Claß. 40<br />
Der amerikanische Historiker Georg Iggers schreibt in <strong>die</strong>sem Zusammenhang:<br />
„In [Treitschkes] Hörsaal saßen <strong>die</strong> zukünftigen Führer <strong>der</strong> Alldeutschen<br />
[...] sowie hun<strong>der</strong>te von späteren hohen Beamten, Stu<strong>die</strong>nräten,<br />
Offizieren usw. Es gelang ihm, seinen Ressentiments, seinem Haß gegen<br />
Sozialisten, Juden, Englän<strong>der</strong> <strong>und</strong> Nichtweiße [...] den Anschein wissenschaftlicher<br />
Respektabilität zu geben.“ 41<br />
***<br />
Etwa zur gleichen Zeit wie in Deutschland fand auch im Zarenreich ein Antisemitismusstreit<br />
statt. Zu seinen wichtigsten Protagonisten gehörte Fedor<br />
Dostoevskij, dessen Ansehen in Rußland mit demjenigen Treitschkes in<br />
Deutschland vergleichbar war. In <strong>der</strong> Ausgabe seines Tagebuchs eines<br />
Schriftstellers vom März 1877 schrieb Dostoevskij, daß manche seiner jüdischen<br />
Leser ihn <strong>der</strong> Judenfeindschaft bezichtigten. <strong>Die</strong>se Beschuldigung<br />
wies Dostoevskij mit Entrüstung zurück, was ihn aber nicht davon abhielt,<br />
sofort da<strong>nach</strong> einen massiven Angriff gegen das Judentum <strong>und</strong> den „jüdischen<br />
Charakter“ als solchen zu beginnen. 42<br />
<strong>Die</strong> Argumente Dostoevskijs erinnern in vielerlei Hinsicht an <strong>die</strong>jenigen<br />
<strong>der</strong> deutschen Antisemiten, nicht zuletzt an <strong>die</strong>jenigen Treitschkes. So<br />
spricht Dostoevskij von <strong>der</strong> Weigerung <strong>der</strong> Juden, sich mit den an<strong>der</strong>en<br />
Völkern zu verschmelzen, <strong>und</strong> bezeichnet sie deshalb als Fremdkörper in<br />
40 Dorpalen, Andreas: Heinrich von Treitschke. New Haven 1957, S. 234.<br />
41 Iggers, Georg: Heinrich von Treitschke, in: Wehler, Hans-Ulrich, Hrsg: Deutsche Historiker.<br />
Göttingen 1973, S. 174-188, hier S. 186; siehe dazu auch Langer, Ulrich: Heinrich<br />
von Treitschke. Politische Biographie eines deutschen Nationalisten. Düsseldorf<br />
1998, S. 335.<br />
42 Dostoevskij, Fedor: Dnevnik pisatelja za 1877 god, YMCA-Press Paris o.J. S. 97-117;<br />
siehe dazu auch Grossman, Leonid: Ispoved´ odnogo evreja. Moskau 1999.
je<strong>der</strong> sie umgebenden Nation. Daß <strong>die</strong> Juden im Laufe von Jahrtausenden,<br />
ungeachtet aller Verfolgungen, denen sie in <strong>der</strong> Diaspora ausgesetzt waren,<br />
ihre Eigenart bewahren konnten, erklärt Dostoevskij damit, daß sie innerhalb<br />
je<strong>der</strong> Nation einen „Staat im Staate“ bildeten. 43 Damit knüpft er indirekt<br />
an <strong>die</strong> Thesen des zuerst 1869 in Wilna veröffentlichten <strong>und</strong> später<br />
mehrmals neuaufgelegten Machwerks Das Buch vom Kahal an, das <strong>der</strong> jüdische<br />
Apostat Jakov Brafman verfaßt hatte 44 <strong>und</strong> das als eine Art Vorläufer<br />
<strong>der</strong> gefälschten „Protokolle <strong>der</strong> Weisen von Zion“ gilt. <strong>Die</strong> angebliche Idee<br />
vom jüdischen „Staat im State“ zeichnet sich <strong>nach</strong> Ansicht Dostoevskijs<br />
durch folgende Merkmale aus:<br />
„[<strong>Die</strong>] zum religiösen Dogma erhobene Entfremdung <strong>und</strong> Abson<strong>der</strong>lichkeit, <strong>die</strong><br />
Unverschmelzbarkeit, <strong>der</strong> Glaube daran, daß es in <strong>der</strong> Welt bloß eine nationale<br />
Persönlichkeit – den Juden – gibt, <strong>die</strong> an<strong>der</strong>en aber, wiewohl sie existieren, als<br />
nicht existent anzusehen sind. ‚Tritt aus <strong>der</strong> Völkergemeinschaft aus <strong>und</strong> forme<br />
deine eigene Individualität, wisse, daß fortan nur du allein bei Gott bist; alle an<strong>der</strong>en<br />
sollst du ausmerzen, o<strong>der</strong> mache sie zu deinen Sklaven o<strong>der</strong> beute sie aus.<br />
Glaube an den Sieg über <strong>die</strong> ganze Welt, glaube, daß alles dir untertan sein wird.<br />
Kehre dich streng von allen ab <strong>und</strong> pflege mit niemandem alltäglichen Umgang.<br />
Und selbst wenn du dein Land <strong>und</strong> deine politische Persönlichkeit verlierst, selbst<br />
dann, wenn du über das ganze Antlitz <strong>der</strong> Erde unter allen Völkern zerstreut sein<br />
wirst, sollst du dennoch an das glauben, was dir ein für allemal verheißen ist.<br />
[...Vorläufig] aber lebe, son<strong>der</strong>e dich ab, halte zusammen, beute aus <strong>und</strong> - warte,<br />
warte ...‘“ 45<br />
43 Ebenda, S. 107-114.<br />
44 Siehe dazu Klier, John Doyle: Imperial Russia´s Jewish Question 1855-1881. Cambridge<br />
University Press S. 169ff., 263-283; zur Lage <strong>der</strong> Juden <strong>und</strong> zum Antisemitismus<br />
im Zarenreich siehe auch u.a. Dubnow, Semen M.: Weltgeschichte des jüdischen Volkes.<br />
Berlin 1929, Band 9, S. 174-262, 395-451, Band 10, S. 119-225, 368-405, 427-437; Poliakov,<br />
Geschichte, Band 7, S. 85-162; Löwe, Heinz-<strong>Die</strong>trich: Antisemitismus <strong>und</strong> revolutionäre<br />
Utopie. Russische Konservative im Kampf gegen den Wandel von Staat <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
1890-1917. Hamburg 1978; Cohn, Norman: <strong>Die</strong> Protokolle <strong>der</strong> Weisen von<br />
Zion. Der Mythos von <strong>der</strong> jüdischen Weltverschwörung, Köln u.a. 1969; Hagemeister,<br />
Michael: Sergej Nilus <strong>und</strong> <strong>die</strong> „Protokolle <strong>der</strong> Weisen von Zion“. Überlegungen zur Forschungslage,<br />
in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 5, 1996, S. 127-147; Hil<strong>der</strong>meier,<br />
Manfred: <strong>Die</strong> jüdische Frage im Zarenreich. Zum Problem <strong>der</strong> unterdrückten Emanzipation,<br />
in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 32, 1984, S. 321-357; Čičerin, Boris:<br />
Pol´skij i evrejskij voprosy. Berlin 1901.<br />
45 Dostoevskij, Fedor: Status in statu. Vierzig Jahrhun<strong>der</strong>te <strong>der</strong> Existenz, in: Ingold, Felix<br />
Philipp: Dostojewskij <strong>und</strong> das Judentum. Frankfurt/Main 1981, S. 180-188, hier S. 181f.
<strong>Die</strong> Idee vom „Staat im Staate“ gibt den Juden <strong>nach</strong> Ansicht Dostoevskijs<br />
eine <strong>der</strong>artige Überlegenheit über alle an<strong>der</strong>en Völker <strong>der</strong> Erde, daß er eine<br />
rechtliche Gleichstellung <strong>der</strong> Juden im Zarenreich vehement ablehnt:<br />
„Natürlich muß alles, was Humanität <strong>und</strong> Gerechtigkeit, was Menschlichkeit <strong>und</strong><br />
christliches Gesetz verlangen, für <strong>die</strong> Juden getan werden. Aber wenn sie in <strong>der</strong><br />
vollen Wehrbereitschaft ihrer Lebensform <strong>und</strong> ihrer Eigenart, ihrer rassischen <strong>und</strong><br />
religiösen Abson<strong>der</strong>ung, in <strong>der</strong> Wehrbereitschaft ihrer eigenen Vorschriften <strong>und</strong><br />
Prinzipien, <strong>die</strong> <strong>der</strong> zumindest für <strong>die</strong> bisherige Entwicklung <strong>der</strong> ganzen europäischen<br />
Welt maßgebenden Idee entgegengesetzt sind, <strong>die</strong> Gleichstellung in allen<br />
möglichen Rechten mit <strong>der</strong> Stammbevölkerung for<strong>der</strong>n – werden sie dann nicht<br />
ein Mehr, ein Zuviel, ein Übergewicht sogar gegenüber <strong>der</strong> Stammbevölkerung<br />
erhalten?“ 46<br />
Insoweit unterscheidet sich <strong>die</strong> Argumentation Dostoevskijs von <strong>der</strong>jenigen<br />
Treitschkes, <strong>der</strong> im Gegensatz zu manchen seiner Schüler, z.B. im Gegensatz<br />
zu Heinrich Claß, 47 an <strong>der</strong> in Deutschland bereits vollzogenen Emanzipation<br />
<strong>der</strong> Juden nicht rütteln wollte.<br />
So enthalten <strong>die</strong> Thesen Dostoevskijs eine für viele Antisemiten typische<br />
Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeit. Einerseits werden <strong>die</strong> Juden dazu aufgefor<strong>der</strong>t, ihr<br />
Son<strong>der</strong>dasein aufzugeben, an<strong>der</strong>erseits wird <strong>die</strong> wichtigste Voraussetzung<br />
für <strong>die</strong> jüdische Assimilation – <strong>die</strong> rechtliche Gleichstellung – r<strong>und</strong>weg abgelehnt.<br />
Ähnlich wie Treitschke berauscht sich Dostoevskij an seiner eigenen Argumentation<br />
<strong>und</strong> wird immer radikaler in seinem Judenhaß. Noch zu Beginn<br />
seines Artikels wehrt er sich vehement, wie bereits gesagt, gegen <strong>die</strong><br />
Beschuldigung, er sei ein „Hasser <strong>der</strong> Juden“, um dann im gleichen Artikel<br />
folgendes über <strong>die</strong> Juden zu sagen:<br />
„[Der Jude hat] stets, wo auch immer er sich nie<strong>der</strong>ließ, das Volk noch mehr erniedrigt<br />
<strong>und</strong> verdorben, <strong>die</strong> Menschheit noch mehr nie<strong>der</strong>gedrückt, das Niveau <strong>der</strong><br />
Bildung herabgesetzt <strong>und</strong> zur Verbreitung <strong>der</strong> ausweglosen, unmenschlichen Armut<br />
[...] beigetragen. Man befrage <strong>die</strong> Stammbevölkerung in unseren Randgebieten:<br />
Was bewegt den Juden <strong>und</strong> was hat ihn so viele Jahrhun<strong>der</strong>te lang in Bewegung<br />
gehalten? Man erhält <strong>die</strong> einstimmige Antwort: Unbarmherzigkeit; ‚einzig<br />
46 Ebenda, S. 184.<br />
47 Frymann, Daniel (Pseud. von Heinrich Claß): Wenn ich <strong>der</strong> Kaiser wär´ . Politische<br />
Wahrheiten <strong>und</strong> Notwendigkeiten, 5. Aufl. Leipzig 1914, S. 74-78.
<strong>und</strong> allein Unbarmherzigkeit uns gegenüber <strong>und</strong> das Streben, sich an unserem<br />
Schweiß <strong>und</strong> Blut zu sättigen, haben ihn so viele Jahrhun<strong>der</strong>te hindurch in Bewegung<br />
gehalten.‘ Und in <strong>der</strong> Tat, <strong>die</strong> ganze Tätigkeit <strong>der</strong> Juden in <strong>die</strong>sen unseren<br />
Randgebieten bestand nur darin, daß sie, <strong>die</strong> lokalen Gesetze ausnutzend, <strong>die</strong><br />
Stammbevölkerung in eine möglichst ausweglose Abhängigkeit von sich selbst<br />
brachten.“ 48<br />
<strong>Die</strong> im Siedlungsrayon im Westen des russischen Imperiums zusammengepferchten<br />
Juden, denen durch eine Reihe diskriminieren<strong>der</strong> Gesetze sowohl<br />
<strong>die</strong> Bewegungsfreiheit als auch <strong>die</strong> freie Berufswahl untersagt waren, werden<br />
von Dostoevskij nicht als Verfolgte, son<strong>der</strong>n als erbarmungslose Verfolger<br />
dargestellt: „Man nenne mir ein an<strong>der</strong>es russisches Fremdvolk, das<br />
dem Juden, seinem schrecklichen Einfluß <strong>nach</strong> in <strong>die</strong>sem Sinne gleichkäme!<br />
Es gibt kein solches.“ 49<br />
Aber <strong>die</strong> Juden werden von Dostoevskij nicht nur als Beherrscher <strong>der</strong><br />
schwach entwickelten Westgebiete des Zarenreiches, son<strong>der</strong>n auch als Gebieter<br />
des hochentwickelten Westens stilisiert. Der gottlose Materialismus<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> zügellose Egoismus hätten sich im Westen als dominierende Prinzipien<br />
durchgesetzt. Zu <strong>die</strong>ser Entwicklung hätten <strong>die</strong> Juden einiges beigetragen<br />
<strong>und</strong> sie profitierten von ihr am meisten:<br />
„Nicht umsonst herrschen dort denn auch überall <strong>die</strong> Juden auf den Börsen, nicht<br />
umsonst [...] sind sie <strong>die</strong> Beherrscher des Kredits <strong>und</strong> [...] <strong>der</strong> ganzen inter<strong>nationalen</strong><br />
Politik; <strong>und</strong> was noch weiter kommt: Es naht ihre Herrschaft, ihre unumschränkte<br />
Herrschaft! Es steht <strong>der</strong> volle Triumph <strong>der</strong> Ideen bevor, denen <strong>die</strong> Gefühle<br />
<strong>der</strong> Menschenliebe, des Strebens <strong>nach</strong> <strong>der</strong> Wahrheit, <strong>die</strong> christlichen <strong>und</strong><br />
<strong>nationalen</strong> Gefühle, selbst <strong>die</strong> des <strong>nationalen</strong> Stolzes <strong>der</strong> europäischen Völker<br />
zum Opfer fallen werden.“ 50<br />
<strong>Die</strong>se Entwicklung setzt Dostoevskij mit dem Siegeszug <strong>der</strong> sogenannten<br />
„jidischen“ Idee gleich, <strong>die</strong> „an Stelle des ‚mißratenen‘ Christentums <strong>die</strong><br />
ganze Welt umfaßt.“ 51<br />
Man muß hervorheben, daß Dostoevskij hier nicht von einer „jüdischen“,<br />
son<strong>der</strong>n von einer „jidischen“ Idee spricht. Er benutzt also den unter den<br />
48 Dostoevskij, Status in statu, S. 185.<br />
49 Ebenda, S. 184.<br />
50 Ebenda, S. 187.<br />
51 Ebenda, S. 188.
ussischen Antisemiten gebräuchlichen pejorativen Begriff „Jid“ (žid). Auch<br />
in seinen Briefen <strong>und</strong> Notizen, in denen Dostoevskij seinem Judenhaß einen<br />
noch freieren Lauf läßt als in seinem publizistischen Werk, be<strong>die</strong>nt er sich<br />
in <strong>der</strong> Regel des Wortes „žid“. So beklagt er sich in einem Brief vom Februar<br />
1878 über <strong>die</strong> judenfre<strong>und</strong>liche Haltung <strong>der</strong> „rückständigen“ russischen<br />
Liberalen, <strong>die</strong> nicht imstande seien, den Charakter <strong>der</strong> neuen Epoche<br />
zu begreifen, <strong>der</strong>en Wesen darin bestehe, daß nicht <strong>der</strong> Russe den „Jid“ verfolge,<br />
son<strong>der</strong>n umgekehrt: „Der Jid triumphiert <strong>und</strong> unterdrückt den Russen.“<br />
52<br />
Eine beson<strong>der</strong>e Gefahr sieht Dostoevskij in <strong>der</strong> angeblichen Dominanz<br />
<strong>der</strong> Juden im russischen Pressewesen: „Der Jid verbreitet sich mit einer ungewöhnlichen<br />
Geschwindigkeit: Und <strong>der</strong> Jid mit seinem Kahal bedeutet –<br />
eine Verschwörung gegen <strong>die</strong> Russen.“ 53<br />
Und in einem an<strong>der</strong>en Brief (an Julija Abaza vom 15. Juni 1880) bezeichnet<br />
Dostoevskij <strong>die</strong> Juden sogar als Feinde des Menschengeschlechts,<br />
als Botschafter des Antichrist, <strong>die</strong> kurz vor ihrem, wenn auch vorübergehenden<br />
Triumph stünden:<br />
„<strong>Die</strong>s ist so offensichtlich, daß man darüber nicht streiten kann: Sie setzen sich<br />
durch, sie marschieren, sie haben ganz Europa geknechtet; alles, was egoistisch<br />
<strong>und</strong> menschenfeindlich ist, alle verwerflichen Leidenschaften <strong>der</strong> Menschen stehen<br />
auf ihrer Seite. Ihrem Triumph zum Ver<strong>der</strong>ben <strong>die</strong>ser Welt steht also nichts<br />
mehr im Wege.“ 54<br />
Angesichts <strong>die</strong>ser Haßtiraden ist es nicht ganz <strong>nach</strong>vollziehbar, warum Felix<br />
Philipp Ingold in seiner Monographie „Dostojewskij <strong>und</strong> das Judentum“,<br />
<strong>die</strong> von vielen Autoren konstatierte, eindeutig antisemitische Haltung<br />
Dostoevskijs, seinen „tiefen <strong>organischen</strong> Judenhaß“ (Simon Dubnow), partiell<br />
in Frage stellt. <strong>Die</strong> Tatsache, daß Dostoevskij in seinem Text über <strong>die</strong><br />
Judenfrage im Tagebuch eines Schriftstellers seine jüdischen Kontrahenten<br />
zu Wort kommen läßt, seine überspitzt formulierten judenfeindlichen Thesen<br />
gelegentlich relativiert, wird von Ingold als Beweis für eine differenzierte<br />
Einstellung Dostoevskijs zum Judentum angeführt, für seine Zweifel,<br />
52 Dostoevskij, F.M.: Polnoe sobranie sočinenij v tridcati tomach. Tom tridcatyj. Kniga<br />
pervaja. Pis´ma 1878-1881 (im folgenden Dostoevskij, Pis´ma). Leningrad 1988, S. 8.<br />
53 Ebenda.<br />
54 Ebenda, S. 19ff.
<strong>die</strong> er im fortwährenden Dialog mit seinen Kontrahenten zu beheben versucht<br />
habe. So trägt <strong>der</strong> Text Dostoevskijs über <strong>die</strong> Judenfrage aus <strong>der</strong> Sicht<br />
Ingolds denselben polyphonen Charakter wie Dostoevskijs geniale Romane.<br />
55 Damit wi<strong>der</strong>spricht Ingold <strong>der</strong> These des berühmten Literaturwissenschaftlers<br />
Michail Bachtin, „wo<strong>nach</strong> Dostojewskij seine publizistischen Artikel<br />
– im Gegensatz zur künstlerischen Prosa – durchweg in ‚systematischmonologischer‘<br />
o<strong>der</strong> rhetorisch-monologischer [...] Form abgefaßt habe, um<br />
ausschließlich ‚Ideen, von denen er selbst überzeugt war‘, zu verbalisieren.“<br />
56<br />
In Wirklichkeit verwechselt Ingold publizistische Kunstgriffe, <strong>die</strong><br />
Dostoevskij in seinem Text über <strong>die</strong> Judenfrage verwendet, mit einer authentischen<br />
Polyphonie. Denn <strong>die</strong> angebliche Dialogbereitschaft des Publizisten,<br />
<strong>die</strong> Darstellung <strong>der</strong> Argumente seiner Gegner, <strong>die</strong>nte ihm lediglich<br />
dazu, seine Kontrahenten noch <strong>nach</strong>haltiger zu desavouieren <strong>und</strong> seiner judenfeindlichen<br />
Position eine zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen.<br />
Da <strong>der</strong> Judenhaß Dostoevskijs kaum bezweifelt werden kann, stellt sich<br />
vielmehr <strong>die</strong> Frage, wie ein <strong>der</strong>art genialer Schriftsteller <strong>und</strong> zugleich so<br />
scharfsinniger Visionär zum Verfechter einer Ideologie werden konnte, <strong>die</strong><br />
einen <strong>der</strong> größten Zivilisationsbrüche in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Menschheit<br />
verursachen sollte.<br />
Gelegentlich wird <strong>der</strong> Judenhaß Dostoevskijs mit seiner allgemeinen<br />
Xenophobie in Verbindung gebracht. In seinen literarischen <strong>und</strong> publizistischen<br />
Werken wimmelt es bekanntlich von Charakteren, <strong>die</strong> er aus <strong>nationalen</strong><br />
o<strong>der</strong> religiösen Gründen in <strong>die</strong> Kategorie <strong>der</strong> Feinde des Russentums<br />
einordnet <strong>und</strong> mit einer außerordentlichen Boshaftigkeit karikiert – Polen,<br />
Franzosen, gelegentlich Deutsche, Katholiken usw.. Dennoch handelt es<br />
sich beim Judenhaß, <strong>und</strong> zwar nicht nur bei Dostoevskij, in <strong>der</strong> Regel um<br />
mehr als Fremdenfeindlichkeit. <strong>Die</strong> Juden werden oft als das Böse an sich<br />
geschil<strong>der</strong>t, das für beinahe alle Übel <strong>die</strong>ser Welt verantwortlich sei. <strong>Die</strong><br />
Judenfeindlichkeit beinhaltet also mystische <strong>und</strong> mythische Züge, <strong>die</strong> in<br />
den Xenophobien an<strong>der</strong>er Art in <strong>der</strong> Regel fehlen. Eine beson<strong>der</strong>e Intensität<br />
erreicht aber <strong>die</strong> Judenfeindschaft bei den Verfechtern von messianischen<br />
Ideen je<strong>der</strong> Art, <strong>die</strong> sich mit dem Gedanken von <strong>der</strong> jüdischen „Auserwähltheit“<br />
auf keinen Fall abfinden wollen. <strong>Die</strong>se in <strong>der</strong> Heiligen Schrift<br />
55 Ingold, Dostojewskij, S. 157-161.<br />
56 Zit. <strong>nach</strong> Ingold, Dostojewskij, S. 158.
enthaltene Botschaft stellt für sie ein permanentes Ärgernis dar. Um sich<br />
<strong>der</strong> „jüdischen Konkurrenz“ zu entledigen, versuchen sie vieles zu verdrängen,<br />
z.B. <strong>die</strong> Tatsache, daß <strong>die</strong> zivilisierte Menschheit den Juden immerhin<br />
sowohl <strong>die</strong> Zehn Gebote als auch <strong>die</strong> Bergpredigt verdankt. <strong>Die</strong> Folgen <strong>die</strong>ses<br />
Verdrängungsprozesses sind höchst merkwürdig, denn <strong>die</strong> Juden gelten<br />
für ihre messianisch gesinnten Wi<strong>der</strong>sacher immer noch als ein „auserwähltes<br />
Volk“, allerdings nicht mit einem Plus-, son<strong>der</strong>n mit einem Minus-<br />
Zeichen davor; sie werden zum Inbegriff des Unschöpferischen <strong>und</strong> des<br />
Infernalischen stilisiert.<br />
Auch <strong>der</strong> Judenhaß Dostoevskijs war eng mit seinem unerschütterlichen<br />
Glauben an eine beson<strong>der</strong>e Mission des russischen Volkes verknüpft. Der<br />
Sendungsgedanke, den er bei den Juden als Zeichen einer unermeßlichen<br />
Arroganz desavouiert, wird von ihm im Zusammenhang mit dem Russentum<br />
mit einem ungewöhnlichen Pathos verkündet. <strong>Die</strong>s insbeson<strong>der</strong>e in<br />
seiner berühmten Puškin-Rede vom 8. Juni 1880:<br />
„[<strong>Die</strong>] Bestimmung des russischen Menschen ist unstreitig alleuropäisch <strong>und</strong> universal.<br />
Ein echter, ein ganzer Russe werden, heißt vielleicht nur [...] – ein Bru<strong>der</strong><br />
aller Menschen werden, ein Allmensch, wenn Sie wollen. Oh, unsere ganze Spaltung<br />
in Slawophile <strong>und</strong> Westler ist ja nichts als ein einziges großes Mißverständnis,<br />
wenn auch ein historisch notwendiges. Einem echten Russen ist Europa <strong>und</strong><br />
das Geschick <strong>der</strong> ganzen großen arischen Rasse ebenso teuer wie Rußland selbst,<br />
wie das Geschick des eigenen Landes, eben weil unsere Bestimmung <strong>die</strong> Verwirklichung<br />
<strong>der</strong> Einheitsidee auf Erden ist, <strong>und</strong> zwar nicht einer durch das Schwert<br />
errungenen, son<strong>der</strong>n durch <strong>die</strong> Macht <strong>der</strong> brü<strong>der</strong>lichen Liebe <strong>und</strong> unseres brü<strong>der</strong>lichen<br />
Strebens zur Wie<strong>der</strong>vereinigung <strong>der</strong> Menschen verwirklichten Einheit.“ 57<br />
Was hier <strong>der</strong> von Dostoevskij so pathetisch verkündeten „Einheitsidee auf<br />
Erden“ indes fehlt, ist eine echte Universalität. Denn das Ziel des Russentums<br />
soll angeblich <strong>die</strong> „Wie<strong>der</strong>vereinigung aller Völker <strong>der</strong> großen arischen<br />
Rasse [von mir hervorgehoben]“ sein. Auf <strong>die</strong>ses Charakteristikum<br />
<strong>der</strong> Versöhnungsidee Dostoevskijs haben bereits solche Kenner<br />
Dostoevskijs wie Aaron Štejnberg <strong>und</strong> Felix Ph. Ingold hingewiesen. Der<br />
letztere schreibt:<br />
57 Dostoevskij, Tagebuch, S. 504.
„Dostoevskijs Inanspruchnahme <strong>der</strong> Allmenschlichkeit, des allweltlichen Versöhnungs-<br />
<strong>und</strong> Einfühlungswillens zur Rechtfertigung eines imperialen großrussischen<br />
Missionsgedankens, welcher zumindest den arischen Stämmen des Menschengeschlechts<br />
zu ‚brü<strong>der</strong>licher‘ Eintracht verhelfen sollte, ist auch insofern<br />
eher utopisch (o<strong>der</strong> auch propagandistisch) denn evangelisch zu nennen, als gerade<br />
<strong>die</strong> Juden von <strong>der</strong> universalen Verbrü<strong>der</strong>ung ausgeschlossen sind.“ 58<br />
<strong>Die</strong> Judenfeindschaft Dostoevskijs war indes nicht nur durch den messianischen<br />
Zug in seinem Denken verursacht. In ihr spiegelte sich auch <strong>die</strong> damalige<br />
krampfhafte Suche <strong>der</strong> russischen Konservativen <strong>nach</strong> einer Ideologie<br />
wi<strong>der</strong>, <strong>die</strong> das Volk gegen <strong>die</strong> revolutionäre Agitation <strong>der</strong> radikalen Regimegegner<br />
immunisieren sollte.<br />
In Rußland fand damals eine beispiellose Polarisierung <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
statt, <strong>die</strong> im Gr<strong>und</strong>e einen vorweggenommenen Bürgerkrieg darstellte. <strong>Die</strong><br />
russischen Reformer, <strong>die</strong> <strong>nach</strong> <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>lage des Landes im Krimkrieg ein<br />
gewaltiges Erneuerungswerk in <strong>die</strong> Wege geleitet hatten, verloren nun allmählich<br />
<strong>die</strong> Kontrolle über <strong>die</strong> Ereignisse. Der revolutionär gesinnte Teil<br />
<strong>der</strong> russischen Öffentlichkeit wollte sich an <strong>die</strong>sen Reformen nicht beteiligen.<br />
Nicht eine allmähliche Verän<strong>der</strong>ung des bestehenden Systems, son<strong>der</strong>n<br />
seine gänzliche Abschaffung war ihr Ziel. Ihr Denken war manichäisch –<br />
das Zarenregime, ungeachtet seiner reformatorischen Wendung, verkörperte<br />
für sie das Böse –, das einfache russische Volk, das sie von jeglicher Unterdrückung<br />
befreien wollte, das Gute. Der russische Philosoph Semen Frank<br />
schreibt in <strong>die</strong>sem Zusammenhang in dem berühmten Sammelband Vechi<br />
(1909), <strong>der</strong> sich schonungslos mit dem revolutionären Credo <strong>der</strong> Intelligenzija<br />
auseinan<strong>der</strong>setzte: <strong>Die</strong> russische Intelligenzija verwerfe den Glauben an<br />
<strong>die</strong> Transzendenz <strong>und</strong> verabsolutiere <strong>die</strong> Immanenz, das nur Menschliche.<br />
Sie glaube, daß es möglich sei, das absolute Glück auf Erden zu erreichen,<br />
<strong>und</strong> zwar durch eine bloße mechanische Beseitigung <strong>der</strong> Feinde des von ihr<br />
so vergötterten Volkes – <strong>der</strong> ausbeuterischen Min<strong>der</strong>heit <strong>und</strong> <strong>der</strong> sie schützenden<br />
zarischen Autokratie. Trotz ihrer Gottlosigkeit bleibe <strong>die</strong> Intelligen-<br />
58 Ingold, Dostojewskij, S. 138; siehe dazu auch Štejnberg, Aaron: Dostoevsky and the<br />
Jews, in: History as Expierence. Ktav Publishing House, New York 1983, S. 247-260,<br />
hier S. 251f.
zija in den religiösen Denkkategorien verhaftet – ihr „Gott“ sei das Volk, ihr<br />
„Teufel“ <strong>die</strong> Selbstherrschaft. 59<br />
<strong>Die</strong> zunehmende Radikalisierung einiger Teile <strong>der</strong> russischen Bildungsschicht<br />
brachten viele russische Konservative mit den liberalen Experimenten<br />
Alexan<strong>der</strong>s II. in Verbindung. <strong>Die</strong> Reformen hätten zur Aufweichung<br />
<strong>der</strong> staatlichen Kontrollmechanismen geführt <strong>und</strong> <strong>die</strong> Grenzen zwischen<br />
dem Erlaubten <strong>und</strong> Unerlaubten verwischt. <strong>Die</strong> beson<strong>der</strong>e Empörung <strong>der</strong><br />
Konservativen rief <strong>die</strong> Vorgehensweise <strong>der</strong> 1864 errichteten Geschworenengerichte<br />
hervor, <strong>die</strong> in vielen politischen Prozessen erstaunlich milde<br />
Urteile fällten. So wurden z.B in den 1870er Jahren 211 Angeklagte in solchen<br />
Prozessen freigesprochen, darunter auch <strong>die</strong> Terroristin Vera Zasulič<br />
(1878), <strong>die</strong> ein Attentat auf den Petersburger Gouverneur Trepov verübt<br />
hatte. 60<br />
Ungeachtet ihrer Empörung über <strong>die</strong> Folgen <strong>der</strong> Reform hatten <strong>die</strong> Konservativen<br />
dennoch einen Trost. Sie waren nämlich davon überzeugt, daß<br />
das einfache russische Volk von den liberalen Experimenten nichts wissen<br />
wolle <strong>und</strong> im Gegensatz zur Intelligenzija absolut zarentreu sei. Und damit<br />
hatten sie zumindest in bezug auf <strong>die</strong> Epoche Alexan<strong>der</strong>s II. (1855-1881)<br />
teilweise recht. So konnte sich z.B. <strong>die</strong> revolutionäre Bewegung <strong>der</strong> Narodniki<br />
(Volkstümler) von <strong>der</strong> immer noch vorhandenen Zarentreue <strong>der</strong> russischen<br />
Bauern in den 1870er Jahren überzeugen. Viele Narodniki begaben<br />
sich damals aufs Land (gingen „ins Volk“), um <strong>die</strong> Bauern gegen das Regime<br />
aufzuwiegeln. Da sie aber bei ihrer Agitation den Zaren beleidigten,<br />
wurden sie nicht selten von den Bauern <strong>der</strong> Polizei ausgeliefert – <strong>die</strong>s ungeachtet<br />
<strong>der</strong> Tatsache, daß <strong>die</strong> russische Bauernschaft auch <strong>nach</strong> <strong>der</strong> Abschaffung<br />
<strong>der</strong> Leibeigenschaft im Jahre 1861 mit ihrer sozialen Lage äußerst unzufrieden<br />
war. Sie hielt <strong>die</strong> Agrarfrage immer noch für ungelöst <strong>und</strong> träumte<br />
von einer gänzlichen Enteignung <strong>der</strong> Gutsbesitzer, <strong>die</strong> sie für Schmarotzer<br />
hielt, von <strong>der</strong> sogenannten „schwarzen Umverteilung“.<br />
Trotz ihrer Unzufriedenheit verspürte <strong>die</strong> russische Bauernschaft aber<br />
zunächst, wie bereits gesagt, keine Neigung, <strong>der</strong> Intelligenzija <strong>die</strong> Führung<br />
im Kampfe um ihre Belange anzuvertrauen. Der russische Wirtschaftswissenschaftler<br />
<strong>und</strong> Publizist Petr Struve schreibt in dem bereits erwähnten<br />
59 Frank, Semen: Ėtika nigilizma, in: Vechi. Sbornik statej o russkoj intelligencii, 2. Aufl.<br />
Moskau 1909, S. 175-210.<br />
60 Kulešov, S. u.a.: Naše otečestvo, Band 1-2. Moskau 1991, hier Band 1, S. 53.
Sammelband Vechi in <strong>die</strong>sem Zusammenhang: Im 17. <strong>und</strong> im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
habe das Kosakentum – das sozial unruhigste <strong>und</strong> zugleich kriegerischste<br />
Element <strong>der</strong> russischen Gesellschaft – eine unumstrittene Führungsposition<br />
bei allen Auflehnungsversuchen <strong>der</strong> Unterschichten gegen <strong>die</strong><br />
Herrschenden innegehabt. Nach <strong>der</strong> Zerschlagung des letzten großen<br />
Volksaufstandes (Pugačev – 1773-1775) habe <strong>die</strong> Monarchie es jedoch<br />
vermocht, <strong>die</strong> Kosaken durch eine großzügige soziale Privilegierung an sich<br />
zu binden <strong>und</strong> zu „verstaatlichen“. Dadurch sei <strong>die</strong> Bauernschaft im Kampfe<br />
gegen <strong>die</strong> soziale Unterdrückung führerlos geworden. 61<br />
<strong>Die</strong> Intelligenzija, könnte man hinzufügen, war, wie schon gezeigt, trotz<br />
unablässiger Bemühungen zunächst nicht imstande, den leergewordenen<br />
Platz einzunehmen. Dem Zusammenschluß <strong>der</strong> beiden rebellisch gesinnten<br />
Gruppen stand <strong>der</strong> tiefverwurzelte politische Konservatismus <strong>der</strong> Bauernschaft<br />
im Wege. Und <strong>die</strong>se Kluft versuchten konservative Verteidiger <strong>der</strong><br />
russischen Autokratie zu verewigen. Es war ihnen klar, daß das Schicksal<br />
des Regimes davon abhing, wer den Kampf um <strong>die</strong> „Seele des Volkes“ gewinnen<br />
würde. Eine immer wichtigere Rolle sollte in <strong>die</strong>sem Kampf um <strong>die</strong><br />
Anbindung <strong>der</strong> Volksschichten an das Regime <strong>die</strong> antijüdische Komponente<br />
spielen. Immer stärker war <strong>die</strong> Neigung <strong>der</strong> Konservativen, <strong>die</strong> immer<br />
schärferen sozialen <strong>und</strong> politischen Konflikte im Lande wie auch manche<br />
außenpolitischen Rückschlage, <strong>die</strong> das Zarenreich hinnehmen mußte (Berliner<br />
Kongreß, 1878), mit <strong>der</strong> Tätigkeit des inter<strong>nationalen</strong> Judentums in<br />
Verbindung zu bringen.<br />
Auch Dostoevskij, <strong>der</strong> in den siebziger Jahren zu einem <strong>der</strong> wichtigsten<br />
Ideologen des russischen Konservatismus werden sollte (<strong>die</strong>s trotz seiner<br />
revolutionären Vergangenheit, <strong>die</strong> ihn zehn Jahre Haft <strong>und</strong> Verbannung gekostet<br />
hatte), neigte zu solchen Thesen. Ungeachtet <strong>der</strong> Tatsache, daß <strong>die</strong><br />
Juden in <strong>der</strong> revolutionären Bewegung <strong>der</strong> siebziger Jahre so gut wie keine<br />
Rolle spielten, begann Dostoevskij in mancher seiner damaligen Stellungnahmen,<br />
ihre Bedeutung immer stärker hervorzuheben. Beson<strong>der</strong>s deutlich<br />
spiegelte sich <strong>die</strong>ses Interpretationsmuster in seinem Brief an den Herausgeber<br />
<strong>der</strong> Zeitung Graždanin, Pucykevič, vom 29. August 1878 wi<strong>der</strong>: „Odessa,<br />
<strong>die</strong> Stadt <strong>der</strong> Jiden, wurde zum Zentrum unseres kämpferischen Sozialismus.<br />
In Europa verhalten sich <strong>die</strong> Dinge genauso: <strong>Die</strong> Beteiligung <strong>der</strong><br />
61 Struve, Petr: Intelligencija i revoljucija, in: Vechi, S. 156-174.
Jiden am Sozialismus ist ungeheuerlich [...]. Und das ist verständlich: Jede<br />
radikale Erschütterung <strong>und</strong> je<strong>der</strong> Umsturz im Staate ist für den Jid von Vorteil,<br />
weil er selbst einen Staat im Staate bildet, [...] den nichts erschüttern<br />
kann, <strong>der</strong> aber immer von je<strong>der</strong> Schwächung <strong>der</strong> [nichtjüdischen Welt] profitiert.“<br />
62<br />
Auch <strong>die</strong>se Argumentation zeigt, welch ein Abgr<strong>und</strong> das schriftstellerische<br />
Werk Dostoevskijs von seinem publizistisch-politischen Schrifttum<br />
trennt. <strong>Die</strong> Revolution, <strong>die</strong> in seinen großen Romanen <strong>die</strong> Form eines beinahe<br />
transzendenten Mysteriums annimmt <strong>und</strong> als Folge <strong>der</strong> menschlichen<br />
Hybris, des Abfalls vom Glauben an Gott gilt, wird in seinen politischen<br />
Stellungnahmen spießerhaft <strong>und</strong> vereinfachend mit Hilfe einer Verschwörungstheorie<br />
erklärt.<br />
***<br />
Was verbindet das politische Programm Dostoevskijs mit demjenigen<br />
Treitschkes? Zunächst muß man hervorheben, daß beide Autoren neubekehrte<br />
Konservative waren, <strong>die</strong> sich von den revolutionären bzw. liberalen<br />
Träumen ihrer früheren Jahre radikal verabschiedet hatten. Liberale Methoden<br />
waren aus ihrer Sicht nicht mehr geeignet, um gegen <strong>die</strong> Zaren- bzw.<br />
<strong>die</strong> Reichsfeinde effizient vorzugehen. Der Liberalismus mit seinem Laisser-faire-Prinzip<br />
führe zur Erosion <strong>der</strong> Staatlichkeit, <strong>der</strong> traditionellen Werte,<br />
vor allem aber, aufgr<strong>und</strong> seiner kosmopolitisch-universalistischen Ausrichtung,<br />
zur Auflösung <strong>der</strong> „<strong>organischen</strong>“ Einheit <strong>der</strong> Nation. <strong>Die</strong> Juden<br />
galten beiden Denkern sowohl als das Sinnbild des Kosmopolitismus bzw.<br />
<strong>der</strong> Internationalität als auch <strong>der</strong> nicht assimilierbaren <strong>nationalen</strong> Beson<strong>der</strong>heit<br />
<strong>und</strong> daher als außerordentliche Gefahr. Bei ihren Versuchen, das Judentum<br />
zu definieren, stießen sie auf unlösbare Probleme, <strong>die</strong> <strong>der</strong> britische Historiker<br />
Lewis Namier folgen<strong>der</strong>maßen beschreibt: Bei jedem Versuch, <strong>die</strong><br />
Juden einzuordnen, stoße man auf Rätsel, <strong>die</strong> auf Nichtjuden irritierend<br />
62 Dostoevskij, Pis´ma, S. 43.
wirkten. Denn bei den Juden handele es sich sowohl um eine Nation als<br />
auch um eine Kirche, allerdings um eine Kirche aus Fleisch <strong>und</strong> Blut. 63<br />
Auch bei Treitschke <strong>und</strong> bei Dostoevskij rief <strong>die</strong>ser zwiespältige Charakter<br />
des Judentums große Irritationen hervor, <strong>die</strong> allmählich in eine immer<br />
stärker werdende Judenfeindschaft umschlugen. Daß es sich bei <strong>die</strong>sen radikalen<br />
Kritikern des Judentums um ehemalige Revolutionäre bzw. Liberale<br />
handelte, stellt nichts Ungewöhnliches dar. So weist z.B. Jacob Talmon darauf<br />
hin, daß viele radikale Antisemiten aus dem Lager <strong>der</strong> enttäuschten<br />
Demokraten stammten, nicht zuletzt Richard Wagner. 64<br />
Es war hier bereits <strong>die</strong> Rede davon, daß Dostoevskijs Ablehnung des Judentums<br />
eng mit seinem Glauben an den universalen Sendungsauftrag seiner<br />
eigenen Nation verknüpft war. Nicht zuletzt deshalb konnte er sich mit<br />
<strong>der</strong> Idee einer jüdischen Auserwähltheit nicht abfinden. Ähnliches kann<br />
man aber auch über Treitschke sagen, denn auch er war von <strong>der</strong> Sendung<br />
seiner eigenen Nation überzeugt. 65 Für das jüdische Sendungsbewußtsein<br />
war in seinem Begriff <strong>der</strong> Nation kein Platz.<br />
Soviel zu den Ähnlichkeiten zwischen den beiden Denkern. Nun aber einiges<br />
zu den Unterschieden.<br />
Der wichtigste bestand wohl darin, daß das politische Programm<br />
Dostoevskijs weitgehend scheiterte. Sein Rezept für <strong>die</strong> Ges<strong>und</strong>ung <strong>und</strong><br />
Erneuerung Rußlands wurde von <strong>der</strong> Mehrheit <strong>der</strong> russischen Intelligenz<br />
nicht akzeptiert. Als Schriftsteller <strong>und</strong> Visionär wurde er zwar allgemein<br />
bewun<strong>der</strong>t. <strong>Die</strong> sogenannte religiös-philosophische Renaissance, <strong>die</strong> in<br />
Rußland zu Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts stattfand, wurde nicht zuletzt<br />
durch sein literarisches Werk inspiriert. Ein vergleichbarer Erfolg aber war<br />
seinen politischen Ideen <strong>und</strong> denjenigen seiner konservativen Gesinnungsgenossen<br />
nicht beschieden. <strong>Die</strong> bewahrenden Kräfte im Lande waren, un-<br />
63 Namier, Lewis, Facing East. London 1947, S. 129-141.<br />
64 Talmon, The Myth, S. 208.<br />
65 Siehe dazu u.a. Treitschke: <strong>Die</strong> ersten Versuche deutscher Kolonialpolitik, in: Ders.:<br />
Aufsätze, Band 4, S. 665-676; <strong>der</strong>s.: Unser Reich, ebenda, S. 712-731; Bußmann, Walter:<br />
Treitschke. Sein Welt- <strong>und</strong> Geschichtsbild. Göttingen 1952, S. 352f.; Dorpalen, Treitschke,<br />
S. 180-269; Meinecke, Friedrich: <strong>Die</strong> Idee <strong>der</strong> Staatsräson in <strong>der</strong> neueren Geschichte.<br />
München 1924, S. 508ff.; Kohn, Hans: Propheten ihrer Völker. Bern 1948, S. 123-151;<br />
Braatz, Werner A.: Antisemitismus, Antimo<strong>der</strong>nismus <strong>und</strong> Antiliberalismus im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t,<br />
in: Politische Stu<strong>die</strong>n 22, 1971, S. 20-33, hier S. 31f.; Mordstein, Friedrich:<br />
Heinrich von Treitschkes Etatismus, in: Zeitschrift für Politik, 8, 1961, S. 30-53, hier S.<br />
33.
geachtet ihrer Versuche, mit Hilfe eines chauvinistischen <strong>und</strong> judenfeindlichen<br />
Kurses „Volksnähe“ zu erreichen, nicht imstande, den Siegeszug ihrer<br />
revolutionären Wi<strong>der</strong>sacher aufzuhalten. <strong>Die</strong>s offenbarte sich insbeson<strong>der</strong>e<br />
zu Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts – also etwa zwei Generationen <strong>nach</strong> <strong>der</strong><br />
Abschaffung <strong>der</strong> Leibeigenschaft –, als <strong>die</strong> russischen Unterschichten ihr<br />
„Schweigen“ brachen <strong>und</strong> vom Sog <strong>der</strong> politischen Leidenschaften erfaßt<br />
wurden. Der Glaube an den Zaren wurde bei ihnen nun in einem immer<br />
stärkeren Ausmaß durch den Glauben an <strong>die</strong> Revolution abgelöst. <strong>Die</strong> unermüdliche<br />
Aufklärungsarbeit <strong>der</strong> Intelligenzija sei nun vom Erfolg gekrönt,<br />
schrieb 1908 ironisch <strong>der</strong> russische Philosoph Sergej Bulgakov. Das Volk<br />
habe sich <strong>der</strong> Weltanschauung <strong>der</strong> Intelligenzija angeschlossen, es habe das<br />
„Bewußtsein“ erlangt. <strong>Die</strong>ser Erfolg <strong>der</strong> Intelligenzija könne aber für Rußland<br />
unabsehbare Folgen haben. 66<br />
<strong>Die</strong> russischen Unterschichten, <strong>die</strong> <strong>die</strong> konservativen Ideologen des Zarenreiches,<br />
nicht zuletzt Dostoevskij, für <strong>die</strong> wichtigste Stütze des Zarenregimes<br />
hielten, erwiesen sich letztendlich als dessen größte Bedrohung. Bei<br />
den Wahlen zur ersten <strong>und</strong> zur zweiten Staatsduma, <strong>die</strong> in Rußland 1906<br />
<strong>und</strong> 1907 stattfanden (infolge <strong>der</strong> Revolution von 1905 wurde in Rußland<br />
<strong>die</strong> Gewaltenteilung eingeführt), wählte <strong>die</strong> russische Bauernschaft beinahe<br />
geschlossen revolutionäre <strong>und</strong> nicht konservative Parteien. Dem politischen<br />
Traum Dostoevskijs <strong>und</strong> seiner Mitstreiter von <strong>der</strong> Einheit des Volkes mit<br />
dem Zaren wurde nun endgültig <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>lage entzogen.<br />
Das chauvinistische <strong>und</strong> judenfeindliche Programm Treitschkes hingegen<br />
bestimmte auch <strong>nach</strong> dem Tode seines Verkün<strong>der</strong>s in einem nicht unbeträchtlichen<br />
Ausmaß <strong>die</strong> politische Kultur seines Heimatlandes. Für viele<br />
seiner Bewun<strong>der</strong>er war es allerdings nicht radikal genug. <strong>Die</strong> Darstellung<br />
<strong>der</strong> weiteren Evolution <strong>die</strong>ses Programms geht allerdings über den Rahmen<br />
<strong>die</strong>ses Beitrages hinaus.<br />
66 Bulgakov, Sergej: Dva grada, Moskau 1911, Band 1-2, hier Band 2, S. 159-163.