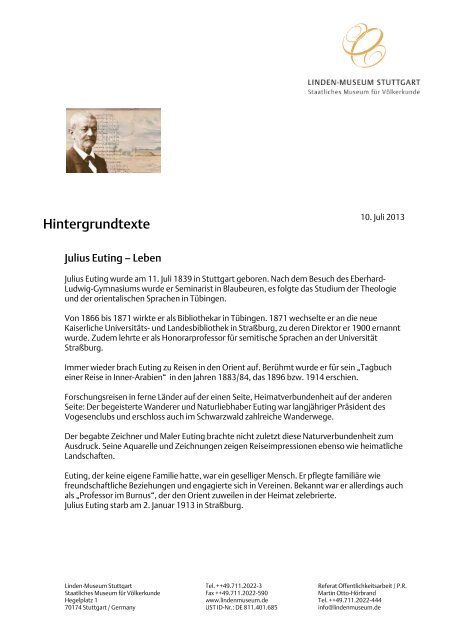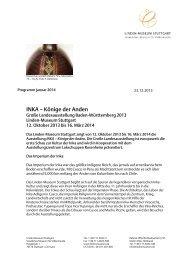Hintergrundtexte Julius Euting - Linden-Museum Stuttgart
Hintergrundtexte Julius Euting - Linden-Museum Stuttgart
Hintergrundtexte Julius Euting - Linden-Museum Stuttgart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Hintergrundtexte</strong><br />
10. Juli 2013<br />
<strong>Julius</strong> <strong>Euting</strong> — Leben<br />
<strong>Julius</strong> <strong>Euting</strong> wurde am 11. Juli 1839 in <strong>Stuttgart</strong> geboren. Nach dem Besuch des Eberhard-<br />
Ludwig-Gymnasiums wurde er Seminarist in Blaubeuren, es folgte das Studium der Theologie<br />
und der orientalischen Sprachen in Tübingen.<br />
Von 1866 bis 1871 wirkte er als Bibliothekar in Tübingen. 1871 wechselte er an die neue<br />
Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek in Straßburg, zu deren Direktor er 1900 ernannt<br />
wurde. Zudem lehrte er als Honorarprofessor für semitische Sprachen an der Universität<br />
Straßburg.<br />
Immer wieder brach <strong>Euting</strong> zu Reisen in den Orient auf. Berühmt wurde er für sein „Tagbuch<br />
einer Reise in Inner-Arabien“ in den Jahren 1883/84, das 1896 bzw. 1914 erschien.<br />
Forschungsreisen in ferne Länder auf der einen Seite, Heimatverbundenheit auf der anderen<br />
Seite: Der begeisterte Wanderer und Naturliebhaber <strong>Euting</strong> war langjähriger Präsident des<br />
Vogesenclubs und erschloss auch im Schwarzwald zahlreiche Wanderwege.<br />
Der begabte Zeichner und Maler <strong>Euting</strong> brachte nicht zuletzt diese Naturverbundenheit zum<br />
Ausdruck. Seine Aquarelle und Zeichnungen zeigen Reiseimpressionen ebenso wie heimatliche<br />
Landschaften.<br />
<strong>Euting</strong>, der keine eigene Familie hatte, war ein geselliger Mensch. Er pflegte familiäre wie<br />
freundschaftliche Beziehungen und engagierte sich in Vereinen. Bekannt war er allerdings auch<br />
als „Professor im Burnus“, der den Orient zuweilen in der Heimat zelebrierte.<br />
<strong>Julius</strong> <strong>Euting</strong> starb am 2. Januar 1913 in Straßburg.<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Staatliches <strong>Museum</strong> für Völkerkunde<br />
Hegelplatz 1<br />
70174 <strong>Stuttgart</strong> / Germany<br />
Tel. ++49.711.2022-3<br />
Fax ++49.711.2022-590<br />
www.lindenmuseum.de<br />
UST ID-Nr.: DE 811.401.685<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit / P.R.<br />
Martin Otto-Hörbrand<br />
Tel. ++49.711.2022-444<br />
info@lindenmuseum.de
Der Wissenschaftler <strong>Euting</strong> : Ein Leben für Sprache und Schrift<br />
„Seine besondere Gabe war die Sicherheit des Auges; was er einmal angesehen hatte, das hielt er im<br />
Geiste fest und konnte es nachzeichnen.“ (Theodor Nöldeke über <strong>Euting</strong>, 1913)<br />
<strong>Julius</strong> <strong>Euting</strong> beherrschte zahlreiche Sprachen und hieß im Volksmund<br />
„Sechzehnsprachenmännle“. Seine wissenschaftliche Spezialisierung galt den semitischen<br />
Sprachen. Dabei verband sich die Begabung für Fremdsprachen mit <strong>Euting</strong>s „Sicherheit des<br />
Auges“ und großer Leidenschaft für Schrift. Frühe Arbeiten zum Mandäischen, einer<br />
aramäischen Liturgiesprache, und ein Münzkatalog aus Tübingen stellen auch <strong>Euting</strong>s praktische<br />
kalligrafische Fähigkeiten unter Beweis.<br />
Auf seinen Reisen sammelte <strong>Euting</strong> Tausende von Inschriften. Im „Tagbuch einer Reise in Inner-<br />
Arabien“ sind die teilweise halsbrecherisch anmutenden Versuche abgebildet, Inschriften in<br />
großer Höhe „abzuklatschen“. Auch kopierte <strong>Euting</strong> zahlreiche Inschriften, fertigte Repliken an<br />
und brachte teilweise sogar Originale nach Europa. In der Straßburger Bibliothèque Nationale et<br />
Universitaire finden sich entsprechende Sammlungsstücke — Originale und Repliken sowie<br />
Abklatsche.<br />
<strong>Euting</strong> publizierte zahlreiche Inschriften und deren Lesungen. Auch sind die von ihm<br />
dokumentierten epigraphischen Zeugnisse bis heute Quellen für wissenschaftliche Studien.<br />
Bleibende Verdienste erwarb sich <strong>Euting</strong> in der semitischen Paläographie. Mehrere Generationen<br />
von Wissenschaftlern stützten sich auf die von <strong>Euting</strong> angefertigten Schrifttafeln, die in<br />
zahlreiche Standardwerke integriert wurden.<br />
Reisen im Dienst der Wissenschaft<br />
Eine erste Orientreise führte <strong>Euting</strong> 1867 donauabwärts bis in das Osmanische Reich mit den<br />
Städten Konstantinopel (Istanbul) und Smyrna (Izmir).<br />
1869 reiste <strong>Euting</strong> über Sizilien nach Tunis und Karthago. Dies ist die erste Forschungsreise<br />
<strong>Euting</strong>s, von der ein Tage- und ein Skizzenbuch erhalten sind. Im Anschluss erarbeitete er<br />
mehrere inschriftenbezogene Publikationen. 1870 folgte eine zweite Reise in die Türkei.<br />
Die spektakulärste und längste Forschungsreise führte <strong>Euting</strong> 1883/84 ins Innere Arabiens.<br />
Wichtigstes Ergebnis war vor allem reiches vorislamisches Inschriftenmaterial in Form von über<br />
900 Abklatschen und Abschriften.<br />
<strong>Euting</strong> hatte sich endgültig einen Namen in Fachkreisen gemacht und durfte an weiteren<br />
wissenschaftlichen Unternehmungen im Vorderen Orient teilnehmen. Nach der Reise nach<br />
Ägypten und auf die Sinai-Halbinsel (1889) erhielt <strong>Euting</strong> 1889/90 die Möglichkeit, an den<br />
Ausgrabungen in Sendschirli (heute: Zincirli) teilzunehmen und Nord-Syrien zu bereisen. <strong>Euting</strong><br />
arbeitete epigraphisch, übernahm jedoch auch organisatorische Aufgaben wie<br />
Grabungsaufsichten oder die Auszahlung von Arbeitern.<br />
1898 reiste <strong>Euting</strong> mit einer Expedition unter Leitung von Heinrich von Brünnow nach Port Said,<br />
Jerusalem und Petra. 1903 folgte seine Reise nach Syrien und Ägypten.<br />
Seine letzte Reise in den Orient führte <strong>Euting</strong> 1905 zum Orientalistenkongress nach Algier und<br />
nach Tunis.<br />
Die Universitätsbibliothek Tübingen bewahrt die Tage- und Skizzenbücher zu <strong>Euting</strong>s Reisen.<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Staatliches <strong>Museum</strong> für Völkerkunde<br />
Hegelplatz 1<br />
70174 <strong>Stuttgart</strong> / Germany<br />
Tel. ++49.711.2022-3<br />
Fax ++49.711.2022-590<br />
www.lindenmuseum.de<br />
UST ID-Nr.: DE 811.401.685<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit / P.R.<br />
Martin Otto-Hörbrand<br />
Tel. ++49.711.2022-444<br />
info@lindenmuseum.de
Die „Große Reise“<br />
1883 erfüllte sich <strong>Euting</strong>s langgehegter Wunsch, das „Innere Arabiens“ zu bereisen: Dank der<br />
Unterstützung durch den kaiserlichen Statthalter in Elsass-Lothringen, Freiherr Edwin von<br />
Manteuffel, und König Karl von Württemberg brach <strong>Euting</strong> am 22. Mai von Straßburg aus auf.<br />
Mit <strong>Euting</strong> reiste der bekannte Forschungsreisende Charles Huber, ein Franzose aus dem Elsass.<br />
Die beiden trennten sich am 19. März 1884, Huber wurde am 29. Juli bei Dscheddah ermordet.<br />
<strong>Euting</strong> kehrte im August 1884 nach Europa zurück. Rund 2300 km hatte er zu Pferd und auf dem<br />
Kamel zurückgelegt.<br />
Ziel der Reise war die Suche nach Inschriften und Denkmälern, speziell der vorislamischen Zeit.<br />
<strong>Euting</strong> sammelte über 900 Inschriften. Huber und <strong>Euting</strong> erwarben die berühmte Stele von<br />
Tayma (5. Jh. v. Chr.) und bereiteten sie für den Abtransport nach Europa vor. Sie befindet sich<br />
heute im Louvre in Paris.<br />
In seinen Tagebüchern notierte <strong>Euting</strong> auch Beobachtungen zum Alltagsleben und der<br />
materiellen Kultur, speziell der Beduinen, und illustrierte das Erlebte. Durch die Publikation als<br />
„Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien“ wurde <strong>Euting</strong> einem breiteren Publikum bekannt.<br />
Als Teil seiner Aufgabe verstand <strong>Euting</strong> auch das Anlegen einer ethnographischen Sammlung.<br />
„Meinen Kameelssattel nehme ich mit, um ihn als Antîka in meiner Heimath zu zeigen“, schrieb<br />
<strong>Euting</strong>. Auch wenn viele Sammlungsstücke verloren gegangen sind, faszinieren die vorhandenen<br />
Objekte als Zeugnisse der materiellen Kultur der Beduinen und als Erinnerungen an die „Große<br />
Reise“.<br />
Kamelsattel<br />
„Als ich mich meinem Delûl näherte, einem hochgesattelten Kameelshengst, breit behängt mit den<br />
Doppeltaschen, worin auf jeder Seite ein Koffer stack, darüber noch zwei kleine Säcke, oben darauf<br />
noch mein Teppich, und als Bett eine abgesteppte Decke, am hinteren Sattelknopf mein Mauser-<br />
Repetir-gewehr in Beduinenfutteral, auf der anderen Seite eine Säbel- und Stocktasche dazu eine<br />
Wasserpfeife in einem Lederbeutel, da war ich doch etwas befangen; mir war zunächst unklar, wie ich<br />
über all den Hausrath und Gepäck hinweg in den Sattel kommen sollte.“ (Tagbuch einer Reise in Inner-<br />
Arabien I, S. 34)<br />
Die „Sammlung <strong>Euting</strong>“ des <strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong>s<br />
<strong>Julius</strong> <strong>Euting</strong> stand lange Jahre in Verbindung mit dem Württembergischen Verein für<br />
Handelsgeographie, insbesondere mit dessen Vorsitzenden Graf von <strong>Linden</strong>. Interessiert<br />
verfolgte er die Bemühungen um den Aufbau eines Völkerkundemuseums in seiner<br />
Heimatstadt. In <strong>Stuttgart</strong> schätzte man den Wissenschaftler und bekannten Orientreisenden,<br />
den man 1907 zum Ehrenmitglied ernannte. <strong>Euting</strong> wiederum erklärte sich bereit, dem späteren<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> eine Sammlung von auf Reisen erworbenen Gegenständen zu stiften.<br />
Wenige Wochen vor seinem Tod bat der schwerkranke <strong>Euting</strong> um die Anreise eines<br />
<strong>Museum</strong>smitarbeiters zur Aufnahme der Sammlung. Auf diese Weise konnten noch wichtige<br />
Informationen notiert werden. Ende November 1912 traf eine Sammlung von fast 400 Objekten<br />
in <strong>Stuttgart</strong> ein. Weitere Objekte erhielt das <strong>Museum</strong> posthum aus Familienbesitz.<br />
Die Sammlung zeichnete sich ursprünglich unter anderem durch reiche Textilbestände aus. In<br />
besonderem Maße dokumentierte sie <strong>Euting</strong>s „Große Reise“. Auch hatte sich <strong>Euting</strong> um Objekte<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Staatliches <strong>Museum</strong> für Völkerkunde<br />
Hegelplatz 1<br />
70174 <strong>Stuttgart</strong> / Germany<br />
Tel. ++49.711.2022-3<br />
Fax ++49.711.2022-590<br />
www.lindenmuseum.de<br />
UST ID-Nr.: DE 811.401.685<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit / P.R.<br />
Martin Otto-Hörbrand<br />
Tel. ++49.711.2022-444<br />
info@lindenmuseum.de
verschiedenster Bevölkerungsgruppen und religiöser Minderheiten der durchreisten Gebiete<br />
bemüht.<br />
Allerdings ist nur noch ca. ein Drittel der Objekte vorhanden. Vor allem im Zweiten Weltkrieg<br />
gingen zahlreiche Sammlungsstücke verloren.<br />
Dennoch fasziniert die Sammlung bis heute — auch durch die Möglichkeit, die <strong>Euting</strong>schen<br />
Tagebücher in Verbindung mit den Objekten zu bringen. Die „Sammlung <strong>Euting</strong>“ zählt zu den<br />
wertvollen Altbeständen des <strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong>s.<br />
Asyut-Keramik<br />
In der „Sammlung <strong>Euting</strong>“ befanden sich ursprünglich zahlreiche Tonwaren aus dem<br />
ägyptischen Asyut. Sie machten etwa ein Sechstel der gesamten <strong>Euting</strong>-Bestände aus. Erhalten<br />
geblieben sind 19 Objekte.<br />
Auffällig an diesen Töpferarbeiten ist die glänzende rot-braune oder schwarze Oberflächenfarbe.<br />
Rohstoffe zur Herstellung dieser Keramik waren Granit und Hämatit. Angewendet wurden auch<br />
spezielle Brenn- und Poliertechniken.<br />
Der Ursprung dieser Keramik liegt in Nubien. In Assuan und Asyut wurde die Fertigungstechnik<br />
weiterentwickelt. Vor allem wurden die Töpferwaren zunehmend feiner dekoriert. In Asyut<br />
kamen hierfür Stempel aus Holz zum Einsatz.<br />
Reiseberichte des 19. Jahrhunderts loben die Keramik aus Asyut, vor allem die präzise<br />
ausgeführten Verzierungen mit reliefierten Ornamenten. In Wechselwirkung mit dem<br />
aufkommenden Niltourismus war hier ein bedeutender Wirtschaftszweig entstanden.<br />
Töpferwaren aus Asyut wurden zu beliebten Souvenirs. Präsentiert wurden diese auch auf den<br />
Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts.<br />
Die Asyut-Keramik gelangte in großer Zahl in europäische Museen. Im Vergleich zu<br />
hochwertiger islamischer Keramik oder Objekten aus Alt-Ägypten wurde sie allerdings als<br />
qualitativ minderwertig angesehen. Die Beliebtheit dieser Töpferei unter den Ägypten-<br />
Reisenden geriet in Vergessenheit.<br />
<strong>Euting</strong> erwarb Asyut-Keramik nur zum Teil als persönliche Souvenirs. Vermutlich sammelte er sie<br />
gezielt im Hinblick auf eine spätere Übergabe an <strong>Museum</strong>ssammlungen.<br />
Orient im Alltag<br />
Von seinen Reisen brachte <strong>Euting</strong> zahlreiche Dinge mit nach Hause. Allerdings ist nur im<br />
Zusammenhang mit der „Großen Reise“ von intensiver Sammeltätigkeit aus wissenschaftlicher<br />
Motivation heraus auszugehen.<br />
Auf den anderen Reisen sammelte <strong>Euting</strong> weniger systematisch. Dabei führte vermutlich oft sein<br />
persönlicher Geschmack zur Auswahl „schöner Dinge“. Viele Objekte sind als typisch für das<br />
gehobene Inventar städtischen Lebens anzusehen und dokumentieren Alltagskultur der<br />
bereisten Gebiete. Doch manche Gegenstände ließen sich auch in den heimischen Alltag oder<br />
zumindest in das Wohnzimmer integrieren. <strong>Euting</strong> war auch als „Professor im Burnus“ bekannt,<br />
der den Orient zuweilen zu Hause zelebrierte und seine Gäste in Beduinentracht bewirtete.<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Staatliches <strong>Museum</strong> für Völkerkunde<br />
Hegelplatz 1<br />
70174 <strong>Stuttgart</strong> / Germany<br />
Tel. ++49.711.2022-3<br />
Fax ++49.711.2022-590<br />
www.lindenmuseum.de<br />
UST ID-Nr.: DE 811.401.685<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit / P.R.<br />
Martin Otto-Hörbrand<br />
Tel. ++49.711.2022-444<br />
info@lindenmuseum.de
Entsprechend waren in der Sammlung ursprünglich zahlreiche Objekte vorhanden, die die<br />
Themen „Kaffeekultur“ und „Rauchen“ illustrierten. Während die meisten Sammlungsstücke<br />
zum Thema „Kaffee“ verloren gegangen sind, sind zahlreiche Objekte zu Tabakkultur und<br />
Rauchen noch vorhanden.<br />
Besonderen Gefallen scheint <strong>Euting</strong> an großen Tabletts bzw. Platten gefunden zu haben, die er<br />
zahlreich erwarb. Diese verblieben jedoch fast vollständig in der Familie. Eine große<br />
Messingplatte der <strong>Euting</strong>-Sammlung wurde 2012 wieder entdeckt. Ebenfalls 2012 erhielt das<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> eine „persische Platte“ aus Familienbesitz, die dem <strong>Museum</strong> bereits hundert<br />
Jahre zuvor als bemerkenswertes Stück aufgefallen war.<br />
Eine Namensliste — neu gelesen?<br />
Zu <strong>Euting</strong>s Zeit ging vom „Orient“ noch immer Faszination aus, obwohl die „Orientmode“<br />
bereits an Bedeutung verlor.<br />
Nicht zuletzt begeisterte die sagenhafte Vergangenheit der vorislamischen Kulturen, die in<br />
Ausgrabungen zum Vorschein kam. Am „Abenteuer Wissenschaft“ nahm die westliche<br />
Öffentlichkeit Anteil und freute sich an Funden, die nach Europa gelangten. Dies ging jedoch<br />
keineswegs mit dem Wunsch einher, die Gegenwart zu verstehen. Der Orient blieb exotisch und<br />
fremd.<br />
Auch <strong>Euting</strong>s Reiseerfahrungen stehen in diesem Kontext. In seinem „Tagbuch einer Reise in<br />
Inner-Arabien“ bedient <strong>Euting</strong> Klischees von „unzivilisierten“ oder „halbzivilisierten“<br />
„Orientalen“, denen er sich überlegen fühlte.<br />
Zugleich finden sich in <strong>Euting</strong>s Tagebüchern aber auch Schilderungen von Begegnungen, in<br />
denen seine Wertschätzung gegenüber einzelnen Menschen zum Ausdruck kommt. Spürbar ist<br />
auch seine Überzeugung, dass Islam, Christentum und Judentum eng miteinander verbunden<br />
sind.<br />
Heute sind Europa und <strong>Euting</strong>s Heimatstadt <strong>Stuttgart</strong> von Internationalität und kultureller<br />
Vielfalt geprägt. Auch die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts lebt von internationaler<br />
Zusammenarbeit.<br />
Im „Tagebuch einer Reise nach Nord-Syrien“ fasziniert <strong>Euting</strong>s akribische Aufstellung der<br />
Grabungsarbeiter in Zincirli und Umgebung. Diese Liste erstellte er vermutlich aus<br />
wissenschaftlichem Interesse an den Namen.<br />
Im Jahr 2013 möchten wir diese Namen als späte Wertschätzung nennen und sie symbolisch für<br />
wissenschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung auf Augenhöhe verstehen.<br />
<strong>Linden</strong>-<strong>Museum</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Staatliches <strong>Museum</strong> für Völkerkunde<br />
Hegelplatz 1<br />
70174 <strong>Stuttgart</strong> / Germany<br />
Tel. ++49.711.2022-3<br />
Fax ++49.711.2022-590<br />
www.lindenmuseum.de<br />
UST ID-Nr.: DE 811.401.685<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit / P.R.<br />
Martin Otto-Hörbrand<br />
Tel. ++49.711.2022-444<br />
info@lindenmuseum.de