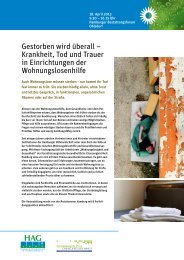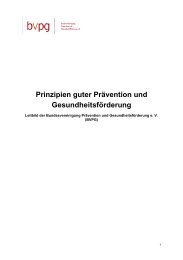pdf-Dokument 1414 kb - Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für ...
pdf-Dokument 1414 kb - Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für ...
pdf-Dokument 1414 kb - Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AUSGABE 2 | Mai 2013<br />
Informationen zur Gesundheitsförderung<br />
Lebensqualität bedeutet mehr als Wachstum und Wohlstand<br />
Immer häufiger ist in der Presse und in öffentlichen Debatten<br />
vom Begriff der Lebensqualität die Rede. Es scheint fast so, als<br />
sei das Konzept gerade erst aufgetaucht, jedoch hat es schon<br />
eine längere Geschichte. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts<br />
sprach der französische<br />
Wissenschaftler<br />
Cecil Pigou (1920)<br />
erstmals von „quality<br />
of life“ im Sinne von<br />
„non-economic welfare“.<br />
In einem Vortrag<br />
von Glatzer (1992) wird der Begriff Lebensqualität als offene<br />
Zielvorstellung bezeichnet (…) dessen Leistung vor allem darin<br />
bestand „das Ziel eines unreflektierten Wirtschaftswachstums<br />
und der damit verbundenen Umweltzerstörung relativiert zu<br />
haben“ (Glatzer 1992). Noch heute steht das Konzept der Lebensqualität<br />
in vehementer Konkurrenz zum Wachstums- und<br />
Wohlstandsbegriff und löst diesen teilweise ab.<br />
Auch der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2011 eine Enquetekommission<br />
zum Thema »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität<br />
– Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem<br />
Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft« eingesetzt.<br />
Im Anschluss an zahlreiche weltweite Bestrebungen soll sie<br />
„den Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft<br />
ermitteln, einen ganzheitlichen Wohlstands- und Fortschrittsindikator<br />
entwickeln und die Möglichkeiten und Grenzen der<br />
Thema dieser Ausgabe<br />
Wohlbefinden, Glück<br />
und Gesundheit<br />
Entkopplung von Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischem<br />
Fortschritt ausloten“ (Enquete Kommission Wachstum,<br />
Wohlstand, Lebensqualität, 2013). Weltweit scheint die<br />
Einsicht an Zustimmung zu gewinnen, dass Wirtschaftswachs-<br />
weiter auf Seite 2<br />
Gesundheit aktuell: 300 Fachleute aus dem Gesundheitswesen,<br />
der Schwangerenberatung, der Familienförderung,<br />
der Jugendhilfe und aller Einrichtungen, die mit werdenden<br />
Eltern und Familien mit kleinen Kindern in Kontakt sind,<br />
trafen sich am 20. und 21. Februar zur Auftaktveranstaltung<br />
zum Landeskonzept „Frühe Hilfen Hamburg“.<br />
Mehr auf S. 12<br />
Foto: ALBRECHTSBESTEBILDER<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
Wohlbefinden ist die Grundlage von Gesundheit – das besagt<br />
die Ottawa Charta. Glück begreifen wir als individuelle Optimierung<br />
von Wohlbefinden. Das Thema Lebensqualität liegt<br />
also quer zu allen Gesundheitsthemen.<br />
Darum stimmt es hoffnungsfroh, dass die Lebenszufriedenheit<br />
deutscher Erwachsener offenbar gestiegen ist. Besorgniserregend<br />
jedoch ist, dass deutsche Kinder und Jugendliche<br />
unglücklich sind – so das Fazit der im April veröffentlichten<br />
internationalen Unicef-Studie. Und das, obwohl sie gesünder<br />
leben. Der Gegensatz zwischen Lebensumständen, wie schulischer<br />
Erfolg, Bildung, Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit<br />
und der Lebenszufriedenheit scheint in Leistungsdruck und<br />
mangelnden Perspektiven begründet zu sein.<br />
Die Förderung des seelischen Wohlbefindens muss also früh<br />
beginnen. Darum sind wir mit unserem Projekt „Schatzsuche“<br />
im Setting Kita aktiv. Derzeit in Planung: Ein Modellprojekt<br />
zur Förderung des seelischen Wohlbefindens von Jugendlichen<br />
beim Übergang Schule – Ausbildung.<br />
Eine angenehme Lektüre wünscht<br />
Susanne Wehowsky und Team<br />
In Hamburg aktiv und gesund<br />
Editorial
Thema<br />
Es gibt verschiedene Indices, die sich auf objektive und / oder<br />
subjektive Kriterien beziehen. Ein Beispiel <strong>für</strong> einen eindeutum<br />
alleine nicht das einzige, vorrangige Ziel einer guten<br />
Gesellschaft sein kann, sondern ausschlaggebend muss die<br />
Lebensqualität der Menschen sein, also die qualitative Ausgestaltung<br />
der Lebensverhältnisse und ihre Wahrnehmung und<br />
Bewertung durch die Menschen.<br />
Im Folgenden wird auf den Begriff und das Konzept der Lebensqualität<br />
eingegangen.<br />
Was ist Lebensqualität?<br />
Die Entwicklung des Begriffs in Deutschland<br />
Lebensqualität ist ein Konzept, dass sich in der Diskussion<br />
befindet und im Rahmen unterschiedlicher Ansätze definiert<br />
wird.<br />
Willy Brandt war der erste prominente Politiker in Deutschland,<br />
der den Begriff „Qualität des Lebens“<br />
mehrfach in seinen Reden, erstmals 1971 an<br />
der Evangelischen Akademie in Tutzing (Brandt<br />
1971) angesprochen hat. Von ihm sowie von seinem<br />
Parteigenossen Erhard Eppler wurde der<br />
Begriff Lebensqualität – als wichtige politische<br />
Zielgröße – schon früh erkannt. Auch von der<br />
IG-Metall wurde der Begriff Lebensqualität auf<br />
einem großen Zukunftskongress im Jahr 1971<br />
der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Erste wissenschaftliche<br />
Aufsätze in Deutschland, die Lebensqualität<br />
im Titel trugen und entsprechende<br />
Analysen aufwiesen, wurden von Wolfgang Zapf<br />
publiziert (1972 a und b). Treffend und zusammenfassend<br />
kann Lebensqualität heute wie<br />
folgt verstanden werden: „Lebensqualität ist<br />
als multidimensionales Konzept zu verstehen,<br />
welches materielle und immaterielle, objektive<br />
und subjektive, individuelle und kollektive<br />
Wohlfahrtskomponenten gleichzeitig umfasst<br />
und das „besser“ gegenüber dem „mehr“ betont“<br />
(Huschka & Wagner 2010). Lebensqualität<br />
ist kein absoluter Gegensatz zum materiellen<br />
Lebensstandard, sondern die Überwindung von<br />
Armut ist eine Voraussetzung von Lebensqualität.<br />
Lebensqualität ist insbesondere mit dem<br />
Begriff der „Nachhaltigkeit“ verbunden und bezieht die ökologischen<br />
Veränderungen der Welt mit ein.<br />
Bereiche<br />
Persönlicher Kontext<br />
Familie und Haushalt<br />
Nachbarschaft<br />
Gemeinschaft<br />
Nation<br />
Supranat. Vereinigungen<br />
Umweltbedingungen<br />
Gesellschaftliche Probleme<br />
Armut<br />
Soziale Exklusion<br />
Soziale Konflikte/Kriege<br />
Soziale Ungleichheit<br />
Wie kann man Lebensqualität messen?<br />
Ausgehend von einem Lebensqualitätskonzept, das objektive<br />
und subjektive Indikatoren heranzieht, kann Lebensqualität<br />
anhand objektiver Kriterien, die von Experten ausgewählt<br />
wurden, gemessen sowie anhand subjektiver Kriterien, wie<br />
also die Bevölkerung die Lebensqualität wahrnimmt, auch<br />
ausdifferenziert werden auf verschiedene Lebensbereiche. Die<br />
wahrgenommene Lebensqualität kann aufgegliedert werden in<br />
drei große Komponenten, die relativ unabhängig voneinander<br />
sind. Meist wird die positive Seite – Glück und Zufriedenheit –<br />
betrachtet, während die negative Seite – Sorgen und Ängste –<br />
und die Zukunftsperspektive der Menschen, die durch Optimismus<br />
oder Pessimismus gekennzeichnet sein können, seltener<br />
in den Blick genommen werden.<br />
Objektive<br />
Lebensbedingungen<br />
Lebensqualität<br />
bzw. Soziales<br />
Wohlbefinden<br />
Positives Wohlbefinden<br />
Lebenszufriedenheit, Glück<br />
Übersicht 1: Lebensqualität und ihre Komponenten<br />
Quelle: Glatzer 2012b, S. 383<br />
Negatives Wohlbefinden<br />
Sorgen, Ängste<br />
Lebensbereiche<br />
Lebenspartner/in, Familie, Arbeit, Freizeit, Einkommen,<br />
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Religion<br />
Wahrgenommene Probleme<br />
Armut, Exklusion, Konflikte, Ungleichheit, Ungerechtigkeit<br />
Zukunftserwartungen<br />
optimistisch, pessimistisch<br />
Subjektiv<br />
wahrgenommene<br />
Lebensqualität<br />
Inhalt<br />
1 Editorial<br />
1 Thema: Wohlbefinden, Glück und Gesundheit<br />
1 Lebensqualität bedeutet mehr als Wachstum und Wohlstand<br />
4 Die Vermessung des Wohlstands<br />
5 Lebenszufriedenheit in der deutschen Bevölkerung<br />
7 Das Streben nach dem guten Leben<br />
8 Arbeit, Glück und Nachhaltigkeit<br />
10 HAG aktiv<br />
13 Gesundheit aktuell<br />
15 Kurz und Bündig<br />
17 Mediothek<br />
19 HAG Arbeitskreise<br />
19 Impressum<br />
20 Veranstaltungen<br />
2 |<br />
Stadtpunkte 02/13
tig objektiven Index <strong>für</strong> Lebensqualität ist beispielsweise der<br />
Human Development Index (HDI), der bei den Vereinten Nationen<br />
gebräuchlich ist. In ihm ist u. a. die Lebenserwartung<br />
bei der Geburt, die Bildung, aber auch das Bruttonationaleinkommen<br />
pro Kopf (BNE) enthalten. Demgegenüber ist die allgemeine<br />
Lebenszufriedenheit ein rein subjektiver Indikator.<br />
Darin kommen allein die Einstellungen der Bürgerinnen und<br />
Bürger zum Ausdruck. Der Indikator „Happy Life Expectancy“<br />
(HLE) ist ein Beispiel <strong>für</strong> einen kombinierten Index, der objektive<br />
(Lebenserwartung) und subjektive Kriterien (Zufriedenheit)<br />
vereint (siehe auch Glatzer 2012a).<br />
Lebensqualität am Beispiel Deutschlands<br />
Die wahrgenommene Lebensqualität in Deutschland wurde<br />
erstmals 1984 umfassend untersucht (Glatzer/Zapf 1984).<br />
Diese Untersuchung basiert auf mehrfach replizierten Bevölkerungsumfragen,<br />
den sogenannten Wohlfahrtssurveys<br />
(erstmals 1978), sowie drei ergänzenden Umfragen: einer Befragung<br />
der Gastarbeiterbevölkerung, einer Befragung unter<br />
Ehepartnern und einer Wiederholungsbefragung.<br />
Später wurde das Sozioökonomische Panel etabliert, durch<br />
das die sozialwissenschaftliche Datenbasis in Deutschland<br />
<strong>für</strong> Wohlfahrtsmessungen markant erweitert wurde (Wagner,<br />
Frick, Schupp 2007). Mit dem Datenreport, der 2011 in 13.<br />
Auflage herausgegeben wurde, erreichte die Sozialberichterstattung<br />
eine breitere Öffentlichkeit. Dieser stellt einen<br />
umfassenden Sozialbericht <strong>für</strong> Deutschland dar und enthält<br />
eine Zusammenstellung von objektiven, als auch subjektiven<br />
Indikatoren.<br />
Wie ist die subjektive Lebensqualität in<br />
Deutschland verteilt?<br />
Das folgende Beispiel stammt aus dem Sozialstaatssurvey<br />
2005-2008 (Glatzer, Hasberg 2010), in dem die Qualität der<br />
Gesellschaft durch vier Komponenten definiert wird:<br />
• Die Qualität der Gesellschaft bemisst sich daran, ob ein<br />
auskömmlicher Lebensstandard <strong>für</strong> alle gesichert wird. Es<br />
sollte keine dauerhafte Armut und keine inakzeptable sozioökonomische<br />
Ungleichheit geben.<br />
• Zur wahrgenommenen Lebensqualität einer Gesellschaft<br />
gehört, dass alle Menschen eine im Durchschnitt gute<br />
Lebenszufriedenheit erreichen können. Auf keinen Fall soll<br />
eine dauerhaft verfestigte Unzufriedenheit benachteiligter<br />
Bevölkerungsgruppen entstehen.<br />
• Ein zentrales Kriterium der Qualität einer Gesellschaft ist<br />
die wahrgenommene soziale Gerechtigkeit. Die gefühlte<br />
Ungerechtigkeit darf sich nicht auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen<br />
konzentrieren.<br />
• Obwohl soziale Konflikte zur Normalität von Gesellschaften<br />
gehören, darf ihr Gewalt- und Bedrohungspotenzial die<br />
Grenzen kaum vermeidbarer Beeinträchtigungen nicht überschreiten.<br />
Innerer und äußerer Frieden sind Grundlagen von<br />
wahrgenommener Lebensqualität.<br />
Eine subjektive Schichtung der Gesellschaft in Deutschland<br />
kann mithilfe von drei Indikatoren vorgenommen werden. Die<br />
Bewertung der eigenen Lebensverhältnisse erfolgt von sehr<br />
gut bis sehr schlecht, die Zufriedenheit mit dem Leben wird<br />
auf einer elfstufigen Zufriedenheitsskala von 0 bis 10 vorgenommen,<br />
die gerechte Behandlung im Leben erfolgt danach,<br />
ob man sehr viel weniger als einem zusteht, erhalten hat.<br />
• Die Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
erfolgt in Deutschland bei 8 % der Bundesbürger/innen mit<br />
der Bewertung „sehr gut“ und bei 4 % mit der Bewertung<br />
„sehr schlecht“; in einem hohen Wohlstand fühlen sich also<br />
doppelt so viele wie in strenger Armut (Abb. 1).<br />
• Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland stuft ihre<br />
wirtschaftlichen Verhältnisse – und das ist eine große<br />
Errungenschaft, die seit der Industrialisierung angestrebt<br />
wird – gut und sehr gut ein. Darunter in prekären Verhältnissen<br />
befinden sich 33 % der Bevölkerung, deren Lage<br />
zwischen aufstiegsorientiert und abstiegsbedroht schwankt.<br />
• Als Armutsquote kann man die Zusammenfassung der<br />
Kategorien „schlechte“ und „sehr schlechte“ wirtschaftliche<br />
Lage betrachten, also 11 % der Bevölkerung. Dieser Anteil<br />
liegt am unteren Bereich der objektiven einkommensbasierten<br />
Messung von Armut.<br />
Lebenszufriedenheit und Gerechtigkeitsempfinden der Bundesbürger<br />
variieren außerordentlich stark mit der Bewertung<br />
der Lebensverhältnisse:<br />
• Bei den Wohlhabenden ist nur 1 % mit ihrem Leben unzufrieden,<br />
bei den Ärmsten sind es 46 %.<br />
• Deutlich sind die Unterschiede beim Gerechtigkeitsempfinden:<br />
14 % der Wohlhabenden fühlen sich im Leben ungerecht<br />
behandelt, aber 87 % der Ärmsten glauben nicht, dass<br />
sie den gerechten Anteil erhalten, der ihnen zusteht.<br />
In Deutschland ist eine subjektiv stark geschichtete Gesellschaft<br />
entstanden, die auf längere Sicht ein erhebliches Spannungspotenzial<br />
darstellen wird. Zwar ist dieses Spannungsgefälle<br />
latent, aber der Umschlag in manifeste Konflikte erfolgt oft<br />
überraschend. Immerhin wird bereits jetzt die Spannung zwischen<br />
arm und reich von der Bevölkerung als wichtigste gesellschaftliche<br />
Konfliktdimension in Deutschland wahrgenommen.<br />
Unzufriedenheit<br />
1 %<br />
3 %<br />
10 %<br />
Quelle: Sozialstaatssurvey 2008<br />
Wirtschaftliche Lage<br />
8 % sehr gut<br />
48 % gut<br />
33 % teils-teils<br />
7 % schlecht<br />
25 %<br />
75 %<br />
sehr schlecht<br />
46 % 4 % 87 %<br />
Ungerechtigkeit<br />
29 %<br />
14 %<br />
Städtische Lebensqualität am Beispiel Hamburg<br />
Auch die Lebensqualität in Städten wird einerseits von Experten<br />
und andererseits aus der Sicht der Bürger beurteilt. Eine<br />
Experten-gestützte „objektive“ Messung der Lebensqualität in<br />
60%<br />
Abb. 1: Subjektive Schichtung der Lebensverhältnisse in<br />
Deutschland 2008<br />
Thema<br />
Stadtpunkte 02/13 | 3
Thema<br />
Städten ist das Deka Bank Städte Rating (Ditzen, 2012). Eine<br />
„subjektive“ Messung wird im Glücksatlas der Deutschen Post<br />
(Glücksatlas 2012) vorgenommen. Weltweit haben Unternehmen<br />
eine Neigung entwickelt mithilfe von Wissenschaftlern<br />
die Lebensqualität von regionalen Einheiten zu untersuchen.<br />
Macht glücklich(er): Lebensbalance<br />
Im Deka Bank Städte Rating wird Lebensqualität mithilfe folgender<br />
Indikatoren gemessen:<br />
• Bildung<br />
• Bevölkerungsdichte<br />
• Kriminalität<br />
• Kulturelle Einrichtungen.<br />
Alle Hauptstädte sind in dem Rating vertreten. In der Studie liegt<br />
Hamburg bei der Lebensqualität mit einem Gesamtscore von 75<br />
auf Platz drei und tut sich durch Bildung (Score 100), sowie kulturelle<br />
Einrichtungen (Score 94) hervor. Davor liegen Stuttgart<br />
(Gesamtscore 75) und München (Gesamtscore 84). Nach Hamburg<br />
folgen Berlin (Platz 4, Gesamtscore 73) und Bonn (Platz<br />
5, Gesamtscore 72). Interessant ist jeweils, worin der Vor- bzw.<br />
Nachteil der Städte besteht. Frankfurt beispielsweise, welches<br />
Foto: Katharina Ehmann<br />
mit einem Gesamtscore von 49 auf Rang 22 zu finden ist, schneidet<br />
insbesondere bei Kriminalität (Score 0) sehr schlecht ab.<br />
Ein Städteranking ist im Glücksatlas zu finden, den die deutsche<br />
Post erstellen ließ. Schaut man sich das Messverfahren und das<br />
Ranking dieser Studie an, sieht man den Unterschied: Hier wird<br />
die subjektive Lebenszufriedenheit gemessen. Hamburg liegt<br />
auf dem ersten Platz des Zufriedenheitsrankings und hat 84 von<br />
100 möglichen Basispunkten von seinen Einwohnern erhalten.<br />
Ausschlaggebend <strong>für</strong> diese hohe Städtezufriedenheit ist vor<br />
allem das reichhaltige Kulturangebot, die gute Verkehrsinfrastruktur<br />
sowie die überragende Luft- und Wasserqualität. Düsseldorf<br />
ist die finanziell solideste deutsche Metropole und folgt<br />
auf dem zweiten Rang mit 81 Punkten, danach folgt Dresden mit<br />
80 Punkten. In Bezug auf die Ballungsräume hat Ostdeutschland<br />
längst zu Westdeutschland aufgeschlossen. Schlusslicht ist<br />
Essen mit nur 69 von 100 Basispunkten, wo nahezu alle <strong>für</strong> die<br />
Einwohner relevanten Zufriedenheitsdimensionen gravierende<br />
Schwächen aufweisen (vgl. Glücksatlas 2012).<br />
Auch hier zeigt sich wieder die Relevanz der Kriterien, die<br />
zur Messung der Lebensqualität in Städten und auch Ländern<br />
herangezogen werden. Je nachdem welche anerkannt werden,<br />
kann dies zu einer geänderten Rangfolge führen. Deshalb wird<br />
der Bedeutung wie man Lebensqualität nun messen soll, welche<br />
Kriterien herangezogen werden sollen, viel Aufmerksamkeit<br />
gewidmet. Die Messung kann, wie an Beispielen gezeigt,<br />
auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen: Individuum, Familie<br />
und Haushalt, kommunale Ebene, Region, Nation, sowie der<br />
Welt. Dabei weisen die Messvorschläge Unterschiede auf und<br />
es gibt Spielräume und Kontroversen.<br />
Fest steht jedoch: Wohlstand und Wachstum alleine reichen<br />
weder in entwickelten noch in aufstrebenden Gesellschaften<br />
aus.<br />
Autor/in und Literatur: Jennifer Gulyas, Prof. Dr. Wolfgang Glatzer<br />
Kontakt: Goethe-Universität Frankfurt a. M., FB 03, Grüneburgplatz<br />
1 – Hauspostfach 15, 60323 Frankfurt am Main<br />
j.gulyas@soz.uni-frankfurt.de, glatzer@soz.uni-frankfurt.de<br />
www.global-wellbeing.uni-frankfurt.de/<br />
Die Vermessung des Wohlstands<br />
Wie gut geht es den Deutschen? Experten und Abgeordnete haben<br />
<strong>für</strong> den Bundestag Wohlstand neu definiert. Es zählt nicht nur das<br />
Materielle, sondern auch Soziales und Ökologisches. Der Wohlstand<br />
der Deutschen soll neu vermessen werden. Neben dem Bruttoinlandsprodukt<br />
(BIP) wollen die Parteien im Bundestag neun<br />
Indikatoren beachten, die anzeigen, wie es um die Lebensqualität<br />
der Deutschen bestellt ist. Darauf hat sich die Enquete-Kommission<br />
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ verständigt, die in diesen<br />
Tagen ihren Abschlussbericht dem Parlament vorlegt.<br />
Das neue Wohlstandsmaß: mehr als das Bruttoinlandsprodukt<br />
Derzeit wird häufig das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Gradmesser<br />
<strong>für</strong> das wirtschaftliche Wohlergehen herangezogen. Es<br />
misst den Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in einem<br />
Jahr erstellt werden. Doch seit vielen Jahren üben Politiker<br />
und Wissenschaftler Kritik an diesem Maßstab. So wird etwa<br />
nicht erfasst, was viele Menschen zu Hause bei Pflege und Kindererziehung<br />
leisten oder im Ehrenamt – wohlfahrtssteigernd<br />
sind diese Arbeiten dennoch. Andererseits steigt das BIP,<br />
wenn nicht nachwachsende Rohstoffe verbraucht werden oder<br />
Geld <strong>für</strong> die Beseitigung von Umweltschäden fließt.<br />
Das neue Wohlstandsmaß ist eine Art „BIP plus“, dass zusätzlich<br />
Soziales und Teilhabe sowie die Ökologie in den Blick<br />
nimmt. Künftig sollen, wenn es um das Materielle geht, auch<br />
die Verteilung der Einkommen und die Staatsschulden stärker<br />
beachtet werden. Im Bereich Soziales spielt eine Rolle, wie<br />
viele Menschen Arbeit und einen guten Bildungsabschluss ha-<br />
4 |<br />
Stadtpunkte 02/13
en, lange leben und wie es um die Freiheit in der Gesellschaft<br />
bestellt ist. Bei den Indikatoren <strong>für</strong> die Dimension Ökologie<br />
haben sich die Experten und Abgeordneten an bedeutenden<br />
globalen Umweltgrenzen orientiert, bei deren Einhaltung die<br />
Erde auch <strong>für</strong> künftige Generationen lebenswert bleibt: Die Indikatoren<br />
werfen ein Licht auf Treibhausgase, die Artenvielfalt<br />
und die Belastung von Böden und Gewässern mit Stickstoff.<br />
Von nun an zusammen denken: Materielles,<br />
Soziales, Ökologie<br />
Über Wohlstand sprechen heißt, von nun an immer alle drei<br />
Dimensionen – Materielles, Soziales und Ökologie – zusammen<br />
zu denken, so lautet die zentrale Botschaft der Enquete-<br />
Kommission. Die insgesamt zehn Indikatoren sollen Anstöße<br />
liefern, dass Verbesserungen oder Verschlechterungen in<br />
einzelnen Wohlstandsbereichen diskutiert werden – untermalt<br />
mit seriösen Statistiken. Dabei werden Zielkonflikte in<br />
Zukunft deutlicher sichtbar, die gesellschaftliche Debatte – so<br />
die Hoffnung – gewinnt an Fahrt. Auch der Vergleich mit anderen<br />
Ländern wird sich qualitativ ändern: Volkswirtschaften<br />
mit hohen Wachstumsraten wie China oder Indien sieht der<br />
Betrachter mit anderen Augen, wenn in einem Atemzug auch<br />
über soziale Inklusion, Freiheitsrechte oder die Umweltqualität<br />
berichtet wird.<br />
Materieller Wohlstand<br />
BIP<br />
Einkommensverteilung<br />
Staatsschulden<br />
Zielkonflikte<br />
Die 10 Leitindikatoren<br />
Soziales und Teilhabe<br />
Beschäftigung<br />
Gesundheit<br />
Freiheit<br />
Bildung<br />
Ökologie<br />
Treibhausgase<br />
Stickstoff<br />
Artenvielfalt<br />
Einen offensichtlichen Zielkonflikt bei der Debatte über<br />
Wachstum und Wohlstand hat die Enquete-Kommission besonders<br />
in den Fokus genommen. So hat sie sich damit beschäftigt,<br />
wie das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch<br />
und der Umweltverschmutzung entkoppelt werden kann. Der<br />
Befund war ernüchternd: Die Wirtschaft überlastet die Natur,<br />
weil Fortschritte bei der Einsparung von Ressourcen oder dem<br />
Verringern von Verschmutzung durch größeren Verbrauch<br />
zunichte gemacht werden. Ein einfaches Beispiel kann dies<br />
verdeutlichen: Nutzen immer mehr Menschen benzinsparende<br />
Autos, kann es sein, dass sie insgesamt mehr Auto fahren oder<br />
z.B. das gesparte Geld <strong>für</strong> Fernflüge ausgeben – die Umwelt<br />
hat also nichts davon. Was also tun?<br />
Solche und andere Fragen wird der Wohlfahrtsindikator immer<br />
wieder auf die Tagesordnung bringen. Er soll nach dem<br />
Wunsch der Kommission jährlich veröffentlicht, von Sachverständigenräten<br />
diskutiert und von der Bundesregierung<br />
kommentiert werden. Einen Wermutstropfen mussten die 17<br />
Experten und 17 Bundestagsabgeordneten jedoch hinnehmen:<br />
Die nicht bezahlte Arbeit zu Hause wird bislang noch nicht<br />
ausreichend statistisch erfasst. Schon bald jedoch soll es bessere<br />
Zahlen geben.<br />
Thema<br />
Abb.: HAG<br />
Kontakt: Michaela Hoffmann, Deutscher Bundestag, wiss.<br />
Mitarbeiterin der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand,<br />
Lebensqualität“, Michaela.Hoffmann@bundestag.de<br />
Lebenszufriedenheit in der deutschen Bevölkerung<br />
Die Lebenszufriedenheit in der deutschen Bevölkerung rückt<br />
seit Jahren vermehrt in den Fokus und wird wissenschaftlich untersucht.<br />
Daraus ergibt sich die Frage, in welchem Bundesland<br />
die Menschen in Deutschland über die höchste Zufriedenheit<br />
verfügen? Eine eindeutige Begriffsbestimmung <strong>für</strong> Lebenszufriedenheit<br />
festzulegen, wird aufgrund der Mannigfaltigkeit der<br />
Begriffe <strong>für</strong> positive Zustände, wie Freude, Glück, Wohlbefinden<br />
etc. erschwert. Infolgedessen verwenden einige Forscher in<br />
ihren Studien die Wortbedeutungen sinngleich. „Lebenszufriedenheit<br />
bezieht sich auf einen kognitiven Bewertungsprozess<br />
der eigenen Lebensqualität und setzt sich damit von affektiven<br />
Maßen (joy, positive affect bzw. Freude, positive Stimmung,<br />
gute Laune) ab.“<br />
Auf Basis von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP)<br />
wurde die Lebenszufriedenheit in einer 10-stufigen Likert-Skala<br />
erhoben. Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in Deutschland<br />
lag in den Jahren zwischen 1988-1996 im Osten unter dem<br />
Niveau von Westdeutschland. Nach der Wiedervereinigung stieg<br />
die Lebenszufriedenheit im Westen an, im Herbst 1991 und<br />
Frühjahr 1992 fiel diese jedoch wieder auf das Niveau von 1988<br />
zurück. Die ostdeutsche Bevölkerung war bei der ersten Messung,<br />
mit einem Wert von 2,84 deutlich unzufriedener als die<br />
westdeutsche von 3,15. Obwohl sich die objektiven Lebensbedingungen<br />
<strong>für</strong> die meisten Ostdeutschen beträchtlich verbessert<br />
haben, spielen neben Zukunftssorgen auch die Vergleiche mit<br />
der westlichen Bevölkerung eine Rolle. Weiterhin zeigen sich die<br />
gestiegenen Ansprüche an objektive Lebensbedingungen <strong>für</strong> die<br />
geringere Zufriedenheit mit dem Leben verantwortlich.<br />
Stadtpunkte 02/13 | 5
Thema<br />
Gute Gesundheit, hohe Lebenszufriedenheit<br />
Der individuelle Gesundheitszustand stellt <strong>für</strong> die Lebenszufriedenheit<br />
einen bedeutenden Faktor dar. Indikatoren wie<br />
Familienstand und Alter sind persönliche Glücksfaktoren. Sowohl<br />
junge als auch ältere Individuen sind tendenziell zufriedener<br />
mit ihrem Leben als Menschen im mittleren Lebensalter.<br />
Möglicherweise hängt diese Tatsache mit Verantwortung<br />
und Stress zusammen. Ebenso wird diskutiert, dass die persönliche<br />
Lebenszufriedenheit von genetischen Faktoren bestimmt<br />
ist. Des Öfteren sind Menschen bei objektiv gleichen<br />
Lebensumständen deutlich glücklicher als andere, weil ihre<br />
Lebenseinstellung positiver ist. Aktive Menschen sind deutlich<br />
glücklicher als passive Menschen. Die Lebenszufriedenheit<br />
und der Gesundheitsstatus sind von der Zugehörigkeit zu<br />
einer bestimmten sozialen Schicht und des sozialen Status abhängig.<br />
Menschen aus der unteren Sozialschicht weisen eine<br />
geringere Lebenszufriedenheit, deutliche Unterschiede in der<br />
Persönlichkeit, ausgeprägte körperliche Beschwerden und<br />
In Hamburg ist die subjektive Lebenszufriedenheit mit 7,38 in den Jahren 2009/2011<br />
am höchsten, in Thüringen mit 6,45 am niedrigsten<br />
(Raffelhüschen, B. & Köcher, R. (2011). Glücksatlas Deutschland)<br />
einen defizitären Gesundheitszustand auf. Mit steigendem<br />
Bildungsniveau und höherem Einkommen wird der Gesundheitszustand<br />
positiver beurteilt.<br />
In Hamburg leben viele zufriedene Menschen<br />
Positive Gesundheitseinschätzung nimmt mit dem<br />
Alter ab<br />
Die positive Einschätzung der Gesundheit nimmt mit steigendem<br />
Alter ab. Drei Viertel der über 18-jährigen Deutschen<br />
kennzeichneten im Jahr 2003 ihren eigenen Gesundheitszustand<br />
als „gut“ oder „sehr gut“. In der Tendenz zeigt sich zwischen<br />
1994 und 2003 ein Anstieg des Bevölkerungsanteils,<br />
der seine Gesundheit als „sehr gut“<br />
einschätzt. Auf einer Zufriedenheitsskala<br />
von 0 bis 10 wurden die<br />
Daten aus dem SOEP ausgewertet.<br />
2002 betrug der Mittelwert 6,6<br />
Punkte. Im Jahre 2006 betrug dieser<br />
6,5 Punkte. Bei der Stichprobe<br />
aus dem Jahre 2006 wird bei einer<br />
genaueren Betrachtung deutlich,<br />
dass Männer mit 6,6 Punkten ein<br />
wenig zufriedener mit ihrer Gesundheit<br />
sind als Frauen. Hinsichtlich<br />
des Alters liegen die 18 bis 34-Jährigen<br />
mit 7,5 Punkten vor der Altersgruppe<br />
der 35 bis 59-Jährigen<br />
mit 6,5 Punkten gegenüber den<br />
60-Jährigen und Älteren, welche 5,8<br />
Punkte aufweisen.<br />
Auch zwischen den Geschlechtern<br />
bestehen Unterschiede. Psychische<br />
Erkrankungen, welche vor allem bei<br />
Frauen nach Daten des Bundes-Gesundheitssurveys<br />
1998 weit in der<br />
Allgemeinbevölkerung verbreitet<br />
sind, spielen sowohl bei Arbeitsunfähigkeitsfällen<br />
wie Frühberentungen<br />
eine immer bedeutendere Rolle.<br />
Der subjektive Gesundheitszustand<br />
weist einen potenziell starken Einfluss<br />
auf die Lebenszufriedenheit auf. Ebenso sind Menschen<br />
in Westdeutschland glücklicher. Abschließend lässt sich zusammenfassen,<br />
dass jeder Mensch die Möglichkeit besitzt seine<br />
Zufriedenheit im Leben zu steuern und zu steigern, wenn<br />
er bewusst Fähigkeiten und Fertigkeiten nutzt und gezielt auf<br />
seine Gesundheit achtet.<br />
Kontakt: Christian M. Heidl, interdisziplinäres Zentrum <strong>für</strong><br />
Public Health, Universität Erlangen, CMHeidl@aol.com<br />
Foto: Katharina Ehmann<br />
6 |<br />
Stadtpunkte 02/13
Das Streben nach dem guten Leben<br />
Zum Zusammenhang von Gesundheit, Lebensalter und Zufriedenheit<br />
Gesundheit ist ein wichtiger Faktor <strong>für</strong> Zufriedenheit, Glück und<br />
Wohlfahrt. Gesund zu sein, ist dabei wichtig per se, aber auch Voraussetzung<br />
da<strong>für</strong>, bestimmte Tätigkeiten überhaupt ausführen zu<br />
können, die zur Zufriedenheit beitragen. Gesundheit verschlechtert<br />
sich mit zunehmendem Lebensalter objektiv, die subjektive Lebenszufriedenheit<br />
dagegen verbessert sich. Lebenszufriedenheit<br />
hängt somit maßgeblich von weiteren Faktoren ab, auch solchen,<br />
die ihrerseits von Gesundheit beeinflusst werden oder auf Gesundheit<br />
wirken. Zur Messung von Wohlfahrt gibt es unzählige Indikatoren,<br />
die sich in drei unterschiedliche Ansätze einteilen lassen:<br />
Eine Reihe von Vorschlägen basiert auf Maßzahlen, die das Bruttoinlandsprodukt<br />
(BIP) als Berechnungsbasis nehmen, um dann<br />
Korrekturen und Erweiterungen vorzunehmen. Eine zweite Gruppe<br />
von Indikatoren lässt sich unter dem Stichwort „synthetische<br />
Indikatoren“ zusammenfassen. Als dritte Alternative können die<br />
Indikatoren der Zufriedenheits- oder Glücksforschung aufgeführt<br />
werden, zum Beispiel das subjektive Wohlbefinden, oder „subjective<br />
well-being“ (vgl. Fleubaey, 2009). Diese letzte Gruppe ist <strong>für</strong><br />
den Gesundheitsbereich besonders interessant.<br />
Messung von subjektivem Wohlbefinden<br />
Häufig werden zur Messung von subjektivem Wohlbefinden zwei<br />
Arten von Fragen gestellt. Einerseits werden Individuen gebeten,<br />
ihre Lebenszufriedenheit zu beurteilen, beispielsweise anhand<br />
von Fragen wie „Wenn Sie Ihr Leben insgesamt betrachten, wie<br />
zufrieden sind Sie?“. Andererseits wird nach der erlebten Zufriedenheit<br />
zu einem bestimmten Zeitpunkt gefragt. Diese beiden<br />
Einschätzungen stimmen nicht immer überein: Während Kinder<br />
Menschen in der Eigeneinschätzung generell zufriedener machen,<br />
erhöhen sie doch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu<br />
einem bestimmten Zeitpunkt verärgert oder besorgt sind.<br />
Mit der ersten Fragestellung beschäftigt sich auf nationaler Ebene<br />
und im internationalen Vergleich unter anderem die Organisation<br />
<strong>für</strong> wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in<br />
ihrer „Better Life Initiative“. Sie unterscheidet dabei materielle<br />
Bedingungen wie Einkommen/Reichtum, Arbeit und Unterkunft<br />
auf der einen Seite sowie Lebensqualität auf der anderen Seite,<br />
zu der unter anderem der Gesundheitszustand, Work-Life-Balance,<br />
Bildung, soziale Beziehungen, Qualität der Umwelt, persönliche<br />
Sicherheit und subjektives Wohlbefinden zählen (vgl. OECD, 2011).<br />
Die thematische Struktur <strong>für</strong> aktuelles Wohlbefinden deckt im<br />
Rahmen des OECD-Ansatzes viele Komponenten ab, die als Teilaspekte<br />
sowohl materielle Faktoren als auch individuelle Befähigung<br />
(capabilities) berücksichtigt (vgl. ebenda). Letztere beziehen sich<br />
dabei auf die Bedingungen, unter denen Entscheidungen getroffen<br />
werden und die Möglichkeiten der Menschen, Ressourcen in<br />
bestimmte Zwecke zu transformieren, zum Beispiel in Gesundheit<br />
(vgl. Sen, 1998).<br />
Subjektive Zufriedenheitsforschung<br />
Die subjektive Zufriedenheitsforschung kommt dabei teilweise zu<br />
erstaunlichen Ergebnissen. Eine dieser überraschenden Beobachtungen<br />
ist, dass die subjektive Lebenszufriedenheit ab dem frühen<br />
Erwachsenenalter erst abnimmt, dann aber nach der Midlife-Crisis<br />
wieder ansteigt (vgl. The Economist, 2010). Damit ist der Zusammenhang<br />
zwischen Gesundheit, Lebensalter und Lebenszufriedenheit<br />
nicht linear, sondern folgt einer U-Kurve (siehe Abbildung):<br />
Während der Gesundheitszustand sich mit zunehmendem<br />
Lebensalter verschlechtert, nimmt die Lebenszufriedenheit im<br />
Alter wieder zu. Unzweifelhaft übt der Gesundheitszustand einen<br />
bedeutenden Einfluss auf die Lebensqualität eines Menschen aus.<br />
Der scheinbare Widerspruch lässt sich dahingehend auflösen,<br />
dass es offenbar nicht ausschließlich der absolute Gesundheitszustand<br />
ist, der die Lebenszufriedenheit bestimmt. Vielmehr scheinen<br />
sich Menschen in ihrer Empfindung von Lebenszufriedenheit<br />
an äußere Umstände, darunter auch das zunehmende Lebensalter,<br />
anzupassen. 1 Die Referenz, an der sich Zufriedenheit bemisst,<br />
verschiebt sich im Laufe der Zeit. Und schließlich weicht man auf<br />
andere Aktivitäten aus, wenn der körperliche Zustand Sport, Reisen<br />
etc. nicht mehr wie in jüngerem Lebensalter zulässt.<br />
Die Position der Person im Verhältnis zum Umfeld<br />
Ein weiterer Punkt betrifft auch die relative Position einer Person<br />
im Verhältnis zu ihrem Umfeld. Zum Teil bestimmt sich das Umfeld<br />
endogen, weil man sich soziale Kontakte danach auswählt,<br />
wie glücklich man mit diesen sein kann. Zum Teil ist das soziale<br />
Umfeld, insbesondere das berufliche, aber auch exogen gegeben.<br />
Sich mit anderen messen und vergleichen zu müssen, kann die<br />
subjektive Zufriedenheit maßgeblich beeinflussen. Die Bedeutung<br />
des relativen Einkommens oder Status ist vor allem in der<br />
mittleren Lebensphase entscheidend; sie nimmt jedoch mit zunehmendem<br />
Lebensalter ab. Auch das ist ein Grund, weshalb die<br />
Lebenszufriedenheit ungefähr ab dem 50. Lebensjahr wieder ansteigt<br />
(siehe Abbildung). Auch bei jüngeren Menschen hängt die<br />
Lebenszufriedenheit weniger vom relativen Einkommen bezogen<br />
auf das jeweilige soziale Umfeld ab; <strong>für</strong> sie zählt – aus nahelie-<br />
Thema<br />
Stadtpunkte 02/13 | 7
Thema<br />
genden Gründen – eher die Perspektive als der Zustand (vgl.<br />
zum Beispiel FitzRoy et al., 2011).<br />
Im Alter steigt die Lebenszufriedenheit<br />
Gesundheitsrelevante Schlussfolgerungen<br />
Die zweite Fragestellung nach der subjektiven Zufriedenheit zu<br />
einem bestimmten Zeitpunkt hat zwar einen anderen Schwerpunkt,<br />
ist aber <strong>für</strong> gesundheitsrelevante Schlussfolgerungen<br />
nicht minder interessant. Wie wir uns zu einem Zeitpunkt fühlen,<br />
hängt ausschlaggebend von unserer unmittelbaren Umgebung<br />
ab. Dabei treten die Faktoren, die die generelle Zufriedenheit<br />
beeinflussen, in den Hintergrund, situative Dinge hingegen in<br />
den Vordergrund. Der entscheidende Faktor hierbei ist unsere<br />
Aufmerksamkeit (vgl. Kahneman, 2011). Für unseren Gemütszustand<br />
ist das ausschlaggebend, worauf wir uns konzentrieren.<br />
Um uns an Dingen zu erfreuen, müssen wir daher unsere Aufmerksamkeit<br />
auf sie lenken. Kahneman beschreibt eine Studie,<br />
in der das Essverhalten von französischen und amerikanischen<br />
Foto: Katharina Ehmann<br />
Frauen verglichen wird. Obwohl beide Gruppen die gleiche Zeit<br />
zum Essen aufwendeten, war die Wahrscheinlichkeit, dass sich<br />
die Französinnen auf diese Aktivität konzentrierten, doppelt so<br />
hoch wie bei den Amerikanerinnen, die Essen häufig mit anderen<br />
Aktivitäten kombinierten. Der aus dem Essen erlebte Genuss war<br />
bei den Amerikanerinnen entsprechend niedriger.<br />
Verhalten und Zufriedenheit<br />
Diese Beobachtungen haben Auswirkungen <strong>für</strong> unser Verhalten<br />
in Bezug auf unsere Zufriedenheit. Sie legen nahe, dass man sein<br />
erlebtes Wohlbefinden steigern kann, indem man passive Beschäftigungen<br />
(beispielweise Fernsehen) meidet und durch aktive<br />
Formen ersetzt (beispielsweise soziale Kontakte, Sport). Dieses<br />
Ergebnis deckt sich mit der empirischen Glücksforschung, die<br />
soziale Interaktion als eine wichtige Determinante <strong>für</strong> Lebenszufriedenheit<br />
und Glück identifiziert hat (vgl. Frey/Stutzer, 2010).<br />
Anmerkung:<br />
1 Die Bedeutung von Zustand, Erwartungen und Zustandsänderungen <strong>für</strong> die Empfindung<br />
von Nutzen wird in der Prospect Theory formalisiert.<br />
Literatur:<br />
Die im Artikel verwendete Literatur finden Sie in der Studie: Vöpel, H.; Görlinger, M.;<br />
Hungerland, W.; Koller, C.; Quitzau, J.; Stöver, J. (2012):<br />
Strategie 2030 - Gesundheit, Berenberg Bank & HWWI (Hrsg.), Hamburg.<br />
Weitere Literaturangaben: FitzRoy, F.; et al. (2011): Age, Life-Satisfaction, and Relative<br />
Income: Insights from the UK and Germany, IZA Discussion Paper 6045, Bonn.<br />
Fleubaey, M. (2009): Beyond GDP: The Quest for a Measure of Social Welfare, in:<br />
Journal of Economic Literature 2009, 47:4, S. 1029–1075.<br />
Frey, B.; Stutzer, A. (2010): Glück: Die ökonomische Analyse, in: Witte, E. H. (Hrsg.):<br />
Sozialpsychologie und Ökonomie, Lengerich.<br />
Autor/in: Jana Stöver, Prof. Dr. Henning Vöpel<br />
<strong>Hamburgische</strong>s WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)<br />
Arbeit, Glück und Nachhaltigkeit<br />
Politik im Allgemeinen und Wirtschaftspolitik im Besonderen<br />
gelten als erfolgreich, wenn die Zahl der Arbeitslosen niedrig<br />
ist. Sind viele Menschen ohne Arbeit, wie etwa in Griechenland<br />
oder Spanien, macht sich Frustration, Not und Leid breit.<br />
Um neue Arbeitsplätze zu schaffen und alte zu bewahren, werden<br />
die endlichen Ressourcen unseres Planeten skrupellos<br />
vergeudet. Dem Weltklima wird eingeheizt, als gäbe es kein<br />
Morgen mehr. Stolz werden in Deutschland nun die entstandenen<br />
Jobs im Bereich der Erneuerbaren Energien vorgezeigt<br />
– an die 400 000 Stellen sind hier entstanden. Ein wahrlich<br />
vorzeigbarer Erfolg. Jede energetisch motivierte Gebäudesanierung<br />
schafft und sichert ebenfalls Arbeit.<br />
Doch sind trotz alledem die Kohlendioxidemissionen im Jahr<br />
2012 leicht angestiegen. Der Ressourcenverbrauch geht seit<br />
Jahrzehnten nur unmerklich zurück. Die Strategie des „grünen<br />
Wachstums“ wird mitnichten ausreichen, den Verbrauch von Öl,<br />
Gas, Indium etc. auf ein verantwortungsvolles Maß zu reduzieren.<br />
Notwendig ist neben den technischen Reformen auch ein<br />
kultureller Wandel. Nur durch eine Strategie der Selbstbegrenzung<br />
werden wir langfristig nachhaltig leben können.<br />
Essentieller Bestandteil des anstehenden kulturellen Wandels<br />
ist die Arbeitszeitverkürzung. Wenn die Menschen im Schnitt<br />
30 Stunden in der Woche <strong>für</strong> Lohn arbeiteten, ließe sich die<br />
Arbeitslosigkeit zumindest rechnerisch abschaffen. Dieser als<br />
„Kurze Vollzeit <strong>für</strong> Alle“ 1 bezeichnete Ansatz wäre keine starre<br />
Norm, sondern eine Art Durchschnittswert, der je nach persönlichen<br />
Wünschen, biografischer Situation und wirtschaftlichen<br />
Verhältnissen flexibel gewählt werden kann. Ziel sind kürzere<br />
Lebensarbeitszeiten in abhängiger Beschäftigung.<br />
Die Kurze Vollzeit macht es möglich, dass unsere Gesellschaft<br />
ihre Abhängigkeit von Natur zerstörenden Wirtschaftszweigen<br />
Schritt <strong>für</strong> Schritt abbaut.<br />
Zu: „Arbeit, Glück und Nachhaltigkeit“:<br />
http://wupperinst.org/publikationen/details/wi/a/s/<br />
ad/1644/<br />
Zur Studie „Zukunftsfähiges Hamburg“:<br />
http://wupperinst.org/projekte/details/wi/p/s/pd/317/<br />
Zur Studie über Energiearmut:<br />
http://wupperinst.org/publikationen/details/wi/a/s/ad/1252/<br />
8 |<br />
Stadtpunkte 02/13
Strategien und Maßnahmen<br />
Besser heute als morgen engagieren sich Gewerkschaften, Betriebs-<br />
und Personalräte <strong>für</strong> das Konzept der Kurzen Vollzeit. Sie<br />
verleiht dem Arbeitskampf einen idealistischen Kern 2 , indem das<br />
rein materielle Streben nach Einkommensmehrung durch immaterielle<br />
Werte erweitert wird. Notwendig ist da<strong>für</strong> eine Weiterentwicklung<br />
des Teilzeitgesetzes. Wer seine Arbeitszeit verringert,<br />
sollte zudem durch eine Prämie da<strong>für</strong> belohnt werden. Weiterhin<br />
können Heimarbeit, Lebensarbeitszeitkonten, entsprechende Tarifvereinbarungen,<br />
Abbau von Überstunden und anderes mehr<br />
den Wandel der Arbeitszeitkultur auf den Weg bringen.<br />
••••• KURZ UND BÜNDIG •••••<br />
Interessante Links zu<br />
„Glück“ und „Wohlbefinden“<br />
World Database of Happiness<br />
Die englischsprachige Website bietet eine umfassende<br />
Sammlung an internationalen Publikationen und wissenschaftlichen<br />
Studien zum Thema Glück und Wohlbefinden.<br />
http://www1.eur.nl/fsw/happiness/<br />
Glücksarchiv<br />
Im Glücksarchiv wird das Thema Glück aus der Perspektive<br />
unterschiedlicher Fachdisziplinen betrachtet und der<br />
Frage nachgegangen, wodurch Glück verursacht wird und<br />
wie man das Glückserleben steigern kann. Zudem werden<br />
Literaturtipps gegeben.<br />
http://www.gluecksarchiv.de/<br />
Thema<br />
Gipfel-Glück fernab von Hektik und Stress<br />
Foto: Katharina Ehmann<br />
Planet Wissen<br />
Auch Planet Wissen beschäftigt sich in der Rubrik „Alltag<br />
& Gesundheit“ mit dem Thema Glück. Behandelt werden<br />
unter anderem Themen wie Resilienz, positive Psychologie<br />
und Glücksökonomie.<br />
http://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/psychologie/glueck/index.jsp<br />
Indessen sind kürzere Arbeitszeiten indiskutabel, wenn<br />
selbst ein 40-Stunden-Job nicht zum Leben reicht. Daher<br />
wird ein nomineller, gesetzlicher Mindestlohn ohne Branchenbezug<br />
eingeführt werden. Die Prämie <strong>für</strong> kürzere Arbeitszeiten<br />
sollte im Niedriglohnbereich etwas großzügiger<br />
ausfallen. Ein bereits erprobtes Ausgleichskonzept <strong>für</strong> kürzere<br />
Arbeitszeiten ist die Kurzarbeit. Staat, Unternehmen<br />
und Gewerkschaften haben es in der Wirtschaftskrise bereits<br />
erfolgreich realisiert.<br />
Widerstände und Mythen<br />
Nun darf man sich nichts vormachen. Die Kurze Vollzeit stellt<br />
persönliche Gewohnheiten und gesellschaftliche Konventionen<br />
in Frage. Es wird viele Einwände geben. Was hilft es beispielsweise,<br />
wenn Maschinenbauingenieure durch Arbeitszeitverkürzung<br />
neue Stellen schaffen, wenn ohnehin alle Firmen mit<br />
Fachkräftemangel zu kämpfen haben? Doch ein solcher Mangel<br />
ist zumindest kurzfristig noch nicht in Sicht. 3 Es ist vielmehr<br />
eine Taktik der Arbeitgeber, um genügend Auswahl bei den Bewerbern<br />
zu haben.<br />
Die Kurze Vollzeit sorgt da<strong>für</strong>, dass die Unternehmen ihren<br />
künftigen Mitarbeitern etwas bieten müssen. Zudem halten<br />
besonders männliche Führungskräfte ihre Stelle <strong>für</strong> nicht teilbar.<br />
Doch heute wird in hoch arbeitsteiligen Organisationen<br />
gearbeitet. Jede Stelle lässt sich prinzipiell <strong>für</strong> die Kurze<br />
Vollzeit zuschneiden. Deutsche Unternehmen wie auch die<br />
öffentliche Verwaltung belegen mit eindrucksvoller Regelmäßigkeit,<br />
dass Verantwortungsbereiche innerhalb von Wochen<br />
neu zugeschnitten werden können. Die Kurze Vollzeit<br />
Wikipedia-Artikel<br />
Wohlbefinden gilt heute als Schlüsselbegriff in Bezug auf<br />
Wohlstand und nachhaltige Entwicklung von Menschen<br />
und Gesellschaften. Der Artikel beschäftigt sich mit der<br />
Veränderung des Wohlstandsverständnisses und geht der<br />
Frage nach, wie man Wohlbefinden und Entwicklung adäquat<br />
messen kann.<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlbefinden_%28Wohlstandsindikator%29<br />
hört nicht bei Führungskräften auf, sondern sollte dort ihren<br />
Anfang nehmen. Sie scheitert allenfalls an der kulturellen<br />
Borniertheit der Männerwelt.<br />
Auch Gutverdiener werden erwidern, sie könnten nicht auf einen<br />
Teil ihres Gehalts verzichten. Doch wer ehrlich mit sich<br />
selbst ist, wird erkennen, dass der ganze Fleiß sich überwiegend<br />
in überflüssige Technikspielereien und Luxus ergießt.<br />
Ob das neueste Handy, iPad, 3D-Fernseher oder iWatch: Allzu<br />
vieles ist allenfalls „praktisch“, aber keine nennenswerte<br />
Erleichterung, noch mehr verursacht es überdies permanente<br />
Zusatzkosten.<br />
Glück und Nachhaltigkeit<br />
Das leitet über zur Nachhaltigkeit. Denn wenn die Menschen<br />
weniger Geld <strong>für</strong> ressourcenvergeudende Produkte ausgeben<br />
können, ist das <strong>für</strong> die zukünftigen Generationen der reinste<br />
Segen. Verschiedene Untersuchungen wie etwa zur „Halbtagsgesellschaft“<br />
deuten darauf hin, dass Arbeitszeitverkürzungen<br />
Stadtpunkte 02/13 | 9
Thema<br />
auch das Konsumverhalten verändern und der Ressourcenverbrauch<br />
zurückgehen kann. 4<br />
Die Kurze Vollzeit mindert Hektik und Stress der Beschäftigten.<br />
Jeder zehnte Erwerbstätige arbeitet gewöhnlich mehr<br />
als 48 Stunden pro Woche. 5 Zweieinhalb Milliarden Überstunden<br />
im Jahr 6 sind kaum noch Zeugnis von Strebsamkeit<br />
und Fleiß. Sie schaden der physischen und psychischen Gesundheit.<br />
Währenddessen hat sich diese Zahl der Überstunden<br />
in Dänemark mehr als halbiert. Beeindruckend ist auch<br />
der Vergleich mit einem weiteren Nachbarland: Im Vergleich<br />
zu den Niederlanden arbeiten hierzulande achtmal so viele<br />
Angestellte über 50 Stunden in der Woche. Es geht auch<br />
anders. 7<br />
Wer 40, 50 oder gar 60 Stunden in der Woche der Erwerbsarbeit<br />
nachgeht, hat kaum noch Zeit <strong>für</strong> Familie und Freunde.<br />
Doch das ist es, worauf es im Leben ankommt, wenn die materiellen<br />
Grundbedürfnisse befriedigt sind. Gefordert sind<br />
vor allem die Männer. Sie werden lernen, dass man auch mit<br />
kürzeren Arbeitszeiten ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft<br />
sein kann. Eine Mischung aus finanziellen Anreizen,<br />
gesetzlichen Verpflichtungen, Kampagnen, Bildungsinitiativen<br />
und vieles mehr wird sie dazu ermutigen.<br />
Anmerkungen<br />
1 Diese Formulierung stammt von Helmut Spitzley †<br />
2 vgl.: Loske, Reinhard (2010): Abschied vom Wachstumszwang. Rangsdorf, S. 27<br />
3 Brenke, Karl (2010): Fachkräftemangel kurzfristig noch nicht in Sicht. Wochenbericht<br />
des DIW Berlin Nr. 46/2010, S. 2-15.<br />
4 Schaffer, Axel / Stahmer, Carsten (2005): Die Halbtagsgesellschaft – ein Konzept<br />
<strong>für</strong> nachhaltigere Produktions- und Konsummuster. In: GAIA 14/3, S. 235<br />
5 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 347 vom 28.09.2010<br />
6 Spiegel (14.2.2011) unter Berufung auf IAB (Institut <strong>für</strong> Arbeitsmarkt- und Berufsforschung)<br />
7 OECD (2011): How‘s Life?: Measuring well-being, OECD Publishing, S. 133<br />
Kontakt: Dr. Michael Kopatz, Wuppertal Institut <strong>für</strong> Klima,<br />
Umwelt, Energie; Forschungsgruppe Energie-, Verkehrs- und<br />
Klimapolitik, Tel: 0202 2492-148, www.wupperinst.org<br />
Gesundheit von Kindern und Familien in Rothenburgsort stärken<br />
Erste Schritte in Richtung einer Gesundheitsförderungskette<br />
HAG aktiv<br />
Um die Gesundheit von (werdenden) Familien zu verbessern,<br />
hat sich das Setting Stadtteil oder Kommune bewährt.<br />
Hier empfiehlt der Pakt <strong>für</strong> Prävention die Entwicklung einer<br />
Kultur des Miteinanders und den Aufbau von lokalen<br />
Gesundheitsförderungs- und Präventionsketten. Dies soll im<br />
Stadtteil Rothenburgsort (RBO) modellhaft erprobt werden<br />
und zukünftig auf weitere Gebiete in Hamburg übertragen<br />
werden.<br />
In Workshops werden die Akteure vor Ort begleitet<br />
Foto: HAG<br />
Rahmen des Kooperationsverbundes „Gesundheitliche Chancengleichheit“<br />
und in Zusammenarbeit mit den kommunalen<br />
Spitzenverbänden, dem Gesunde-Städte-Netzwerk (GSN) und<br />
der Techniker Krankenkasse durchgeführt.<br />
Koordinierungsstellen sind Ansprechpartner <strong>für</strong><br />
Kommunen<br />
In den Bundesländern sind die Koordinierungsstellen Gesundheitliche<br />
Chancengleichheit (ehemals Regionale Knoten) Anlaufstelle<br />
<strong>für</strong> die Beratung und Fortbildung von kommunalen<br />
Vertreterinnen und Vertretern. In Hamburg setzt die Koordinierungsstelle<br />
auf Stadtteilebene an und hat <strong>für</strong> Rothenburgsort<br />
eine Workshop-Reihe entwickelt, die das Ziel verfolgt die<br />
Akteure vor Ort beim Aufbau einer Gesundheitsförderungskette<br />
zu begleiten. Unterstützung erhalten die Beteiligten von Expert/innen<br />
aus Forschung und Praxis. An der Workshopreihe<br />
sind beteiligt:<br />
• die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit<br />
Hamburg – Regionaler Knoten in der HAG<br />
• die Behörde <strong>für</strong> Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
• das Bezirksamt Hamburg-Mitte.<br />
Das Angebot wird im Rahmen des Partnerprozesses „Gesund<br />
aufwachsen <strong>für</strong> alle“ gefördert und von der Techniker Krankenkasse<br />
finanziell unterstützt.<br />
Aktivitäten auf Bundesebene geben Anstöße<br />
Auch auf Bundesebene wird der Aufbau von integrierten kommunalen<br />
Ansätzen unterstützt. Der kommunale Partnerprozess<br />
„Gesund aufwachsen <strong>für</strong> alle!“ führt Kommunen zusammen,<br />
die sich auf den Weg gemacht haben, Präventionsketten<br />
zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen<br />
aufzubauen. Initiiert durch die Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche<br />
Aufklärung (BZgA) wird der Partnerprozess im<br />
Gelungener Start<br />
Am 16. Januar 2013 fand der Auftaktworkshop „Gesund aufwachsen<br />
in Rothenburgsort – Förderung einer Gesundheitsförderungs-<br />
und Präventionskette“ in der Elternschule statt.<br />
18 Akteure in Rothenburgsort, die mit Kindern und Familien<br />
zusammenarbeiten, nahmen teil, z. B. Allgemeiner Sozialer<br />
Dienst (ASD), Gesundheitsamt, Koordinierungsbaustein Gesundheitsförderung,<br />
Kitas, Elternschule, Familienhebamme.<br />
10 | Stadtpunkte 02/13
Die Veranstaltung moderierten Dr. Antje Richter-Kornweitz<br />
(LVG & AFS Niedersachsen) und Petra Hofrichter (HAG).<br />
Was ist eine Präventionskette?<br />
Leitgedanken einer Präventionskette sind Prävention und<br />
Partizipation statt Krisenintervention. Sie beinhaltet eine<br />
Neuorientierung und systematische Verankerung des präventiven<br />
und partizipativen Denkens und Handelns. Sie soll dazu<br />
beitragen Angebote und Ansätze über Ressortgrenzen hinweg<br />
aufeinander abzustimmen und somit von Geburt bis zum Ausbildungsbeginn<br />
(in Rothenburgsort bis zum 10. Lebensjahr)<br />
bedarfsgerechte Unterstützungsangebote sicherzustellen.<br />
Eine Präventionskette steht <strong>für</strong> eine präventive, lebensphasenorientierte<br />
Unterstützungskultur, an der sich alle verantwortlichen<br />
Akteure der Kommune/des Sozialraums beteiligen,<br />
um voneinander getrennt erbrachte Leistungen und Angebote<br />
aufeinander abzustimmen und zu koordinieren.<br />
Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Teilnehmenden einen<br />
gemeinsamen Lern- und Einigungsprozess gestartet. Am<br />
16. Januar standen Themen wie Haltung, Selbstverständnis,<br />
Ziele im Vordergrund. In den weiteren Workshops wird an dem<br />
spezifischen Design der Präventionskette in Rothenburgsort<br />
gearbeitet; besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Netzwerk<br />
als Organisationseinheit.<br />
Kontakt: Petra Hofrichter, Koordinierungsstelle Gesundheitliche<br />
Chancengleichheit Hamburg, HAG, Tel: 040 2880364-14<br />
petra.hofrichter@hag-gesundheit.de<br />
HAG aktiv<br />
Hamburger Gesundheitspreis 2013<br />
In diesem Jahr wird zum achten Mal der Hamburger Gesundheitspreis<br />
<strong>für</strong> Betriebe, Wirtschaft und Verwaltung ausgeschrieben.<br />
Mit ihm werden Unternehmen<br />
ausgezeichnet, die sich über ihre<br />
gesetzlichen Verpflichtungen hinaus<br />
<strong>für</strong> den Schutz und die Förderung der<br />
Gesundheit ihrer Beschäftigten einsetzen.<br />
Wichtig ist uns, dass Sie Maßnahmen<br />
in der betrieblichen Praxis umgesetzt wurden.<br />
Psychische Gesundheit bei der Arbeit<br />
In dieser Ausschreibung wird ein besonderes Augenmerk auf<br />
die psychische Gesundheit bei der Arbeit gelegt. Betriebe<br />
haben es in der Hand, Arbeitsaufgaben, -organisation, -umgebung<br />
sowie soziales Miteinander so zu gestalten, dass Mitarbeiter/innen<br />
die Balance zwischen den Arbeitsanforderungen<br />
und ihren Ressourcen gelingt. Psychische Belastungen zu erkennen,<br />
zu reduzieren und gesundheitsförderliche Potenziale<br />
in der Arbeit zu stärken, sind wichtige Schritte, damit sowohl<br />
Beschäftigte als auch Betriebe gemeinsam erfolgreich sein<br />
können.<br />
Wer kann sich bewerben?<br />
Jedes Hamburger Unternehmen kann sich bewerben – unabhängig<br />
von seiner Betriebsgröße und Branche. Es wird je ein<br />
Preis <strong>für</strong> die Kategorie Klein-, Mittel- und Großbetrieb verliehen!<br />
Wir vergeben eine Auszeichnung nicht nur <strong>für</strong> ein gelebtes<br />
Konzept betrieblicher Gesundheitsförderung, sondern auch<br />
<strong>für</strong> eine gute Qualität durchgeführter Maßnahmen. Es ist kein<br />
Preis nur <strong>für</strong> die Besten. Betriebe können sich auch mit besonderen<br />
Leistungen und Maßnahmen bewerben – wie mit<br />
Altersteilzeitmodellen, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie<br />
und Beruf oder Anti-Stress-Programmen. Preisträger des<br />
Gesundheitspreises 2011 können bei der Ausschreibung 2013<br />
leider nicht berücksichtigt werden.<br />
Die Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie bei der HAG oder<br />
online unter www.hag-gesundheit.de (Gesundheitspreis).<br />
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2013.<br />
Kontakt: Susanne Wehowsky, HAG, Tel: 040 2880364-0<br />
susanne.wehowsky@hag-gesundheit.de<br />
Gestorben wird überall<br />
Veranstaltung im Hamburger Bestattungsforum<br />
Am 18. April nahmen über 130 Fachkräfte und Ehrenamtliche<br />
an der Veranstaltung „Gestorben wird überall – Krankheit,<br />
Tod und Trauer in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe“ im<br />
Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf teil. Veranstalter der<br />
Tagung: der Arbeitskreis „Wohnungslosigkeit und Gesundheit“<br />
in der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit<br />
Hamburg.<br />
Wie sterben Wohnungslose?<br />
Auch Wohnungslose müssen sterben – nur kommt ihr Tod fast<br />
immer zu früh. Sie sterben häufig allein, ohne Trost und letztes<br />
Gespräch, in funktionalen, unpersönlichen Räumen oder auf<br />
der Straße. Diese Tatsachen bewog den Arbeitskreis zu dieser<br />
besonderen Veranstaltung an einem besonderen Ort.<br />
Dr. Frauke Ishorst-Witte führte das Thema ein mit ihrem Beitrag<br />
„Stimmt, Herr Meyer kommt gar nicht mehr!“ Sie arbeitet<br />
bei der Diakonie Hamburg in der ärztlichen Versorgung <strong>für</strong><br />
wohnungslose Menschen. Prof. Dr. Annelie Keil von der Universität<br />
Bremen sagte in ihrem Vortrag: „Die Orte, wo wir leben<br />
müssen auch Orte sein, wo wir sterben können“.<br />
Was ist zu tun, wenn Betroffene jede Hilfe ablehnen? Wie können<br />
Wohnungslose beim Sterben begleitet werden, Tod und<br />
Stadtpunkte 02/13 | 11
HAG aktiv<br />
Trauer in der Wohnungslosenhilfe, Lebensqualität bis zum<br />
Schluss? Sterben Wohnungslose anders – oder nicht? Wer<br />
begräbt Herrn Meyer, wenn er kein Obdach hat?<br />
Ins Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf kamen über 130<br />
Interessierte<br />
Zu diesen Themen wurde in Workshops gearbeitet. Ein kollegialer<br />
Austausch zum Thema Sterben in der Einrichtung und<br />
Entwicklung eines Leitbildes sowie ein Spaziergang über den<br />
Foto: Mauricio Bustamante<br />
Ohlsdorfer Friedhof – Synonym <strong>für</strong> Sterben, Tod und Trauer –<br />
vervollständigten das Programm.<br />
Arbeitskreis engagiert sich <strong>für</strong> Wohnungslose<br />
Seit Jahren arbeiten Vertreterinnen und Vertreter verschiedener<br />
Institutionen der Hamburger Hilfelandschaft unter dem<br />
Dach der HAG an der Schnittstelle zwischen Wohnungslosenhilfe<br />
und Gesundheitsversorgung. Mit dieser Fachtagung verfolgt<br />
der Arbeitskreis „Wohnungslosigkeit und Gesundheit“ in<br />
der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit<br />
Hamburg das Ziel, Erkenntnisse und Erfahrungen zusammenzutragen,<br />
um an einer besseren Versorgung <strong>für</strong> kranke und<br />
sterbende wohnungslose Menschen zu arbeiten.<br />
Mitglieder im Arbeitskreis sind: Asklepios Klinik St. Georg,<br />
BASFI, Caritasverband <strong>für</strong> Hamburg e. V., Diakonisches Werk<br />
Hamburg, Feuerwehr Hamburg, fördern und wohnen AöR,<br />
HAG, HUDE, Kemenate Tagestreff <strong>für</strong> wohnungslose Frauen,<br />
Malteser Werke gGmbH | Malteser Nordlicht und die Stadtmission<br />
Hamburg.<br />
Die Veranstaltung ist auf der Website der HAG dokumentiert.<br />
Kontakt: Petra Hofrichter, HAG, Tel: 040 2880364-14<br />
petra.hofrichter@hag-gesundheit.de<br />
Infos aus der Vernetzungsstelle<br />
Am 23. Januar veranstalteten die Vernetzungsstellen Schulverpflegung<br />
Schleswig-Holstein und Hamburg ihre erste Kooperationstagung<br />
unter dem Motto „Schulverpflegung kompakt:<br />
Beispiele aus dem Norden“. Über 110 Interessierte aus Hamburg<br />
und Schleswig-Holstein kamen in das Gymnasium Harksheide<br />
in Norderstedt.<br />
Nach der freundlichen Begrüßung durch Schulleiter Gerhard<br />
Frische und Jan-Peter Bertram, Vertreter der Stadt Norderstedt<br />
führten Birgit Braun von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung<br />
Schleswig-Holstein und Silke Bornhöft, Vernetzungsstelle<br />
in Hamburg in das Thema und den Ablauf der Tagung ein.<br />
Über den Zertifizierungsprozess, was unbedingt zu berücksichtigen<br />
ist, welche Meilen- und Stolpersteine es gibt, berichteten<br />
Maja Hofmeister und Manfred Heuer von der Grundund<br />
Gemeinschaftsschule Schafflund. Diese Schule trägt<br />
seit Februar 2012 das Zertifikat „Schule + Essen = Note 1“<br />
der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Ernährung e. V. (DGE).<br />
Blicke über den Tellerrand: von Hamburg nach<br />
Schleswig-Holstein und zurück<br />
In sechs Workshops ging es um Fragen rund um die Organisation<br />
und Umsetzung eine guten Schulverpflegung:<br />
Dipl. Ing. Paul-Hinrich Wiechers stellte ein modulares Konzept<br />
zur Küchenplanung vor. Wesentliche Grundlagen <strong>für</strong> den modularen<br />
Aufbau von Küchen im Hinblick auf spätere Änderungen<br />
und Erweiterung sind beispielsweise eine Standortananlyse,<br />
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, Betreiberauswahl,<br />
Lagerhaltung und Planung eine den Bedarfen angepassten<br />
Kücheneinrichtung.<br />
Workshops<br />
Am 4. April fand der Elternworkshop „Qualitätsstandards<br />
<strong>für</strong> die Schulverpflegung“ statt. Neben der Vorstellung<br />
eine guten Verpflegung stand der Erfahrungsaustausch<br />
im Mittelpunkt. Ein Wunsch der Elternvertreterinnen und<br />
-vertreter war es ein Elternnetzwerk zum Thema Schulverpflegung<br />
in Hamburg ins Leben zu rufen. Die Vernetzungsstelle<br />
arbeitet daran.<br />
Am 11. April nahmen fast 30 Personen am Hygiene-Workshop<br />
teil. Auch hier wurde von den Teilnehmenden hervorgehoben,<br />
dass neben der Information der Austausch<br />
und die kollegiale Beratung eine wichtige Rolle spielt.<br />
Birgit Uhlen-Blucha, stellte das Projekt „Mehr ! Wasser Kampagne“<br />
des Landes Schleswig-Holstein und Nina Krauß, Hamburg<br />
Wasser, das Projekt „TrinkWasser macht Schule“ <strong>für</strong> Hamburg<br />
vor. Beide Initiativen stellen das Wasser-Trinken in der Schule<br />
in den Fokus.<br />
Ein gutes Praxis-Beispiel zu einem Bestell- und Abrechnungssystem<br />
<strong>für</strong> die Schulverpflegung stellte Martina Tiemann,<br />
vom „Verein der Freunde des Gymnasium Harksheide<br />
e. V.“ vor. Anfängliche Kritik und Bedenken von Eltern sowie<br />
Schülerinnen und Schülern konnten ausdiskutiert werden.<br />
Danach fand die Umstellung große Akzeptanz bei allen Essenden<br />
– das sind ca. 400.<br />
Hermann Schauer, aus dem Kreis Dithmarschen informierte<br />
über die Wahl eines Speisenanbieters, das Vergaberecht, die<br />
12 | Stadtpunkte 02/13
Ausschreibung, Auslobung und Leistungsbeschreibung <strong>für</strong><br />
Schleswig-Holstein.<br />
Corinna Rohmann, Verbraucherzentrale Hamburg stellte das<br />
Modellprojekt der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hamburg<br />
„Lebensmittel aus der Region – <strong>für</strong> Schulen vor Ort“ im<br />
Rahmen von „Aus der Region – <strong>für</strong> die Region“ sowie Strategien<br />
zur Einführung regionaler und saisonaler Lebensmittel in<br />
der Schulverpflegung vor.<br />
Dr. Dieter Wilde, Landesinstitut <strong>für</strong> Lehrerbildung und Schulentwicklung<br />
Hamburg stellte im Workshop „Ernährungsbildung<br />
nachhaltig im Schulalltag verankern“ Chancen schulischer<br />
Ernährungsbildung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.<br />
Dabei sind Angebote wie der aid-Ernährungsführerschein, die<br />
aid-SchmExperten und der HAG-Ernährungsbaukasten handlungsorientiert<br />
ausgerichtet.<br />
Marktplatz: Plattform <strong>für</strong> den Austausch<br />
Ein großer Marktplatz mit Anbietern aus unterschiedlichen Bereichen<br />
der Schulverpflegung, zum Beispiel Caterer, Küchenausstattung,<br />
Wasserspender, Bestell- und Abrechnungssysteme,<br />
Automatenaufsteller, Projekte zur Ernährungsbildung und Verbraucheraufklärung<br />
bot den Teilnehmenden eine Plattform <strong>für</strong><br />
Information, Austausch und Vernetzung. Fazit eines Besuchers:<br />
„Die Veranstaltung war <strong>für</strong> mich eine gelungene Mischung von<br />
Beispielpräsentation und Dienstleistungsunternehmen“.<br />
Am IN FORM-Stand auf der Internorga – Leitmesse <strong>für</strong> die<br />
Außerhausverpflegung: Viele Messebesucher/innen haben<br />
Fragen zum Thema Schulverpflegung<br />
Weitere Informationen und Tagungsdokumentation:<br />
www.dgevesch-sh.de/ und www.hag-vernetzungsstelle.de<br />
Kontakt: Silke Bornhöft, Dörte Frevel, Vernetzungsstelle Schulverpflegung<br />
Hamburg c/o HAG, Tel: 040 2880364-17<br />
vernetzungsstelle@hag-gesundheit.de<br />
Foto: HAG<br />
HAG aktiv<br />
Guter Start <strong>für</strong> Hamburgs Kinder<br />
Hamburger Landesinitiative Frühe Hilfen gestartet<br />
Am 20. und 21. Februar 2013 fand die Auftaktveranstaltung<br />
zum Landeskonzept „Frühe Hilfen Hamburg“ statt. Rund 300<br />
Akteure aus den Bereichen Gesundheit und Familienförderung<br />
nahmen an der Tagung teil. Veranstalter waren die Behörde<br />
<strong>für</strong> Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) und die<br />
Behörde <strong>für</strong> Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV). Mit der<br />
Tagungsorganisation beauftragten sie die HAG.<br />
Neu am Start: Die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“<br />
In Hamburg beraten, unterstützen und begleiten zahlreiche<br />
Institutionen und sozialräumlich orientierte Netzwerke seit<br />
vielen Jahren schwangere Frauen und Familien mit kleinen<br />
Kindern. Die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ verfolgt eine Weiterentwicklung<br />
der beratenden und unterstützenden Strukturen<br />
<strong>für</strong> Familien rund um die Geburt. Mit den vorhandenen<br />
Angeboten und den Mitteln, die Hamburg aus der Bundesinitiative<br />
erhält, soll ein Rahmenkonzept umgesetzt werden,<br />
das allen Kindern in Hamburg einen guten Start ermöglicht.<br />
Entsäulung des Hilfesystems<br />
Gesundheits-Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks und Senator<br />
Detlef Scheele (BASFI) eröffneten die zweitägige Veranstaltung.<br />
Beide unterstrichen, dass es eine Vielzahl guter Unterstützungsangebote<br />
<strong>für</strong> junge Familien in Hamburg gibt – jedoch<br />
die Weiterleitung in das Hilfesystem nicht immer gelingt.<br />
Sie begrüßten die Landesinitiave als einen Schritt in Richtung<br />
„Entsäulung des Hilfesystems“: der Gesundheits- und der Sozialbereich<br />
sollen zukünftig enger und verbindlicher zusammenarbeiten.<br />
Diesen Aussagen schlossen sich die zuständigen<br />
Bezirks-Dezernentinnen und -Dezernenten an, wiesen aber<br />
auch auf bestehende Herausforderungen oder Umsetzungsschwierigkeiten<br />
hin.<br />
Netzwerkkordination wird gestärkt<br />
Alexandra Sann vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen stellte<br />
die Rahmenbedingungen der Bundesinitiative vor: Der Bund<br />
unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen<br />
und den Einsatz von Familienhebammen in allen Bundesländern<br />
durch eine auf vier Jahre befristete Initiative mit einem<br />
Fördervolumen von 177 Mio. Euro. Nach Überprüfung der Zielerreichung<br />
werden die Bundesländer ab 2016 jährlich mit insgesamt<br />
51 Mio. Euro unterstützt.<br />
Was kommt davon in Hamburg an? Wie werden hier die Handlungsschwerpunkte<br />
gesetzt? Das machte Dr. Bange, Leiter der<br />
Abteilung Familie und Kindertagesbetreuung in der BASFI<br />
deutlich: Von der Schwangerschaft bis zum Schuleintritt der<br />
Kinder werden (werdende) Eltern und ihre Kinder im Sinne einer<br />
Präventionskette begleitet und ggfs unterstützt.<br />
Hamburg setzt auf die vielfältigen Angebote und Maßnahmen<br />
sowie die aktiven Netzwerke Frühe Hilfen und entwickelt diese<br />
weiter: Die Netzwerkkoordination wird vereinheitlicht und<br />
gestärkt. Wohnortnahe Familienteams sind Anlauf- und Lot-<br />
Gesundheit aktuell<br />
Stadtpunkte 02/13 | 13
Gesundheit aktuell<br />
senstellen <strong>für</strong> (werdende) Eltern. Babylotsen werden Schwangere<br />
und Eltern mit besonderem Unterstützungsbedarf in den<br />
Geburtskliniken und Geburtshäusern über Angebote der Frühen<br />
Hilfen informieren und sie bei Bedarf an das zuständige Familienteam<br />
weiterleiten. Da<strong>für</strong> erhält Hamburg aus der Bundesinitiative<br />
FH in 2013 ca. 1,14 Mio. Euro, ab 2014 werden es ca. 1,3<br />
Mio. Euro sein. Die Mittel fließen zum einen an die Bezirksämter<br />
(640.000 Euro), an die Babylotsen Hamburg (250.000 Euro),<br />
in die Landeskoordination (120.000 Euro) und in übergeordnete<br />
Aufgaben. Die Aufteilung an die Bezirksämter erfolgt je<br />
zu einem Drittel nach dem prozentualen Anteil der Einwohner/<br />
innen/Bezirk, der Kinder von 0-3 Jahre/Bezirk sowie der Empfänger<br />
von Transferleistungen nach SGB II/Bezirk. Die Landeskoordination<br />
ist in der BASFI angedockt, Ansprechpartnerin ist<br />
Brigitte Hullmann.<br />
Erfahrungen und Potenziale nutzen<br />
Zielsetzung der Auftaktveranstaltung war es „auf der Grundlage<br />
der Erfahrungen und der Potenziale in den Bezirken (…) das<br />
Programm „Guter Start <strong>für</strong> Hamburgs Kinder“ <strong>für</strong> die Familien<br />
und <strong>für</strong> alle Leistungserbringer effektiv und effizient“ umzusetzen.<br />
In einem beteiligungsintensiven Arbeitsprozess, in<br />
Austausch- und Relexionsrunden wurden bereits vorhandene<br />
Strukturen und Potenziale sichtbar gemacht und die Anforderungen<br />
an die Umsetzung diskutiert.<br />
Prozessoptimierung, verbindliche Kooperationen, interdisziplinäre<br />
Arbeitsweisen, das Prinzip der Freiwilligkeit, die intensivere<br />
Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheits- und<br />
Sozialsektor und die Netzwerkarbeit wurde als besonders postiv<br />
herausgestellt. Sorge bereiteten den Teilnehmenden u. a. die<br />
Fragen rund um den Datenschutz, die Verteilung der finanziellen<br />
Mittel, die Qualität der Angebote oder die knappen fianziellen<br />
Mittel. Auf die Frage: Was macht mich richtig ärgerlich? wurden<br />
Unstimmigkeiten insbesondere in Bezug auf die Beteiligung,<br />
Niedrigschwelligkeit der Angebote, bürokratische Anforderungen,<br />
Stellenabbau, Scheinbeteiligung, Konkurrenz deutlich.<br />
Mit einem kreativen Austausch „Wie soll es in Zukunft<br />
sein?“ endete der erste Veranstaltungstag.<br />
Großer Raum <strong>für</strong> Ideen<br />
Am zweiten Konferenztag ging es um die konkreten Planungsschritte.<br />
In einem „Open Space“ – übersetzt „weiter, offener<br />
Raum“ – wurden die Teilnehmenden ermutigt ihre Themen<br />
zu den von ihnen gewünschten Entwicklungen und Lösungen<br />
einzubringen. In 30 Arbeitsgruppen bearbeiteten sie u. a. die<br />
Zusammenarbeit zwischen Babylotse Hamburg und den Familienteams,<br />
die Einbindung der Schwangerenberatung oder die<br />
Erwartungen an die Familienhebammen.<br />
Die Teilnehmer/innen arbeiten ergebnisorientiert in den<br />
Open-Space-Arbeitsgruppen<br />
Abschließend wurden die Ergebnisse vorgestellt und die nächsten<br />
Schritte verabredet, z. B.:<br />
• die Zusammenarbeit zwischen Familienteams und Babylotse<br />
Hamburg wird auf dem Familienhebammentag thematisiert<br />
• der Erhebungsfragebogen wird veröffentlicht<br />
• Fachbehörde und Hebammenverband erarbeiten gemeinsam<br />
einen Entwurf <strong>für</strong> eine „Handlungsanweisung bzgl. der<br />
verbindlichen Überleitung in passgenaue Hilfen“.<br />
Ausblick<br />
Die Veranstaltung spiegelte die Angebotsvielfalt der Akteure,<br />
die unterschiedlichen Handlungsebenen und -spielräume,<br />
den Stand der Praxis und des Landeskonzeptes – aber auch<br />
die noch offenen Fragen – wider.<br />
Inhalte und Ergebnisse der Tagung sind ausführlich dokumentiert<br />
und stehen auf der Website der HAG zur Verfügung.<br />
Kontakt: Petra Hofrichter, HAG, Tel: 040 2880364-14<br />
petra.hofrichter@hag-gesundheit.de<br />
Foto: ALBRECHTSBESTEBILDER<br />
Schulfach Glück: Eine Hamburger Initiative der Stiftung Kinderjahre<br />
„Wenn man <strong>für</strong>s Leben und nicht <strong>für</strong> die Schule lernt, fragt<br />
man sich, wann Glück ein allgemein verbindliches Schulfach<br />
wird? Denn alle Menschen wollen glücklich werden!“ betonte<br />
Dr. Eckart von Hirschhausen, Glücks-Botschafter der Stiftung<br />
Kinderjahre, in seiner Videobotschaft zum ersten Hamburger<br />
Glücks-Symposium der Stiftung Kinderjahre.<br />
Bildung ist lebenswichtig <strong>für</strong> die Zukunft<br />
Die bestmögliche Bildung von Kindern und Jugendlichen ist<br />
lebenswichtig <strong>für</strong> die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb<br />
setzt sich die Stiftung Kinderjahre <strong>für</strong> Chancen sozial und<br />
emotional benachteiligter Kinder ein mit mehreren Projekten<br />
und Initiativen – u. a. dem Schulfach Glück – vorwiegend<br />
in sozialen Brennpunkten unter den Maximen Bildung und<br />
nachhaltige Wertevermittlung. Kunst, Kultur, Musik, Bewegung<br />
und Sport sowie ein neues Bewusstsein <strong>für</strong> Ernährung<br />
stehen dabei im Fokus. Denn diese Fächer fördern Intelligenz,<br />
Eigeninitiative und Lebensfreude und tragen damit zu mehr<br />
Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt bei – gegen<br />
Ausgrenzung, Armut und Jugendgewalt!<br />
14 | Stadtpunkte 02/13
Schulfach Glück<br />
Das Schulfach Glück versteht sich dabei als lösungsorientierter,<br />
ganzheitlicher Ansatz zur Stärkung der Persönlichkeit<br />
der Schüler/innen, vermittelt Werte wie Achtsamkeit,<br />
Selbstverantwortung, soziale Verantwortung und Respekt!<br />
Mit dem Schulfach Glück soll die schulische Bildung der reinen<br />
Wissensvermittlung in emotionaler, kognitiver und psychologischer<br />
Dimension ergänzt werden! Schule muss ihrem<br />
Bildungsanspruch nach ganzheitlicher Erziehung von Kindern<br />
und Jugendlichen wieder gerecht werden!<br />
Zusammen mit Pädagogen, Psychologen, Sport- und Ernährungswissenschaftlern<br />
setzt sich die Stiftung Kinderjahre da<strong>für</strong><br />
ein, dass das Schulfach Glück ein anerkanntes Schul- und<br />
Prüfungsfach wird. Denn selbstbewusste, glückliche Kinder<br />
können soziale Kompetenz aufbauen und ihr Leben positiv<br />
gestimmt und selbstbestimmt in die Hand nehmen. „Wir arbeiten<br />
daran! Denn Glück kommt nicht von allein, wir müssen<br />
auch etwas da<strong>für</strong> tun!“, sagt Stiftungsvorsitzende Hannelore<br />
Lay und wird dabei unterstützt von Björn Lengwenus, Leiter<br />
Standort Fraenkelstraße der Stadtteilschule Barmbek: „Wir<br />
wollen die Kunst zu leben vermitteln“. Das Schulfach Glück ist<br />
die beste Präventionsmaßnahme gegen Ausgrenzung, Armut,<br />
Jugendgewalt, soziale Grabenkämpfe sowie volkswirtschaftliche<br />
und seelische Missstände!<br />
••••• KURZ UND BÜNDIG •••••<br />
Erstmals Carola-Gold-Preis verliehen<br />
Anlässlich des Kongresses „Armut und Gesundheit“<br />
wurde im März 2013 erstmals der Carola-Gold-Preis <strong>für</strong><br />
gesundheitliche Chancengleichheit verliehen. Die Auszeichnung<br />
ist benannt nach der im April vergangenen<br />
Jahres verstorbenen Geschäftsführerin von Gesundheit<br />
Berlin-Brandenburg e.V., Carola Gold. Die Preisträgerin<br />
Eva Göttlein setzt mit einer von der Kommune Fürth getragenen<br />
Projektagentur Projekte in sozial schwachen<br />
Stadtteilen um. Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen<br />
Kinderschutzbundes und ehemaliger Bürgermeister von<br />
Dormagen erhielt die Auszeichnung <strong>für</strong> sein Modell einer<br />
Präventionskette, die dem kommunalen Partnerprozess<br />
„Gesund aufwachsen <strong>für</strong> alle“ des Kooperationsverbundes<br />
„Gesundheitliche Chancengleichheit“ zugrunde liegt.<br />
Gesetz zur Förderung der Prävention<br />
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Prävention<br />
will die Bundesregierung die Prävention stärken und auf<br />
die tiefgreifenden Veränderungen, die der demografische<br />
Wandel <strong>für</strong> Deutschland mit sich bringt, reagieren. Aus Sicht<br />
Hamburgs greifen die bisherigen Ansätze der Bundesregierung<br />
deutlich zu kurz. Hamburg hatte bereits im Dezember<br />
2012 einen Entschließungsantrag zur Stärkung von Gesundheitsförderung<br />
und Prävention als gesamtgesellschaftliche<br />
Aufgabe in den Bundesrat eingebracht.<br />
Gesundheit aktuell | Kurz und Bündig<br />
Glück ist ... in duftendem Gras zu liegen<br />
Zwei Beispiele<br />
Musiktheater an der Elbinselschule: Die Schüler/innen in<br />
Hamburg-Wilhelmsburg erproben in diesem Projekt den<br />
produktiven Umgang mit kultureller Vielfalt über die musikalische<br />
und bildkünstlerische Erarbeitung einer Kinderoper.<br />
Spielerisch lernen sie, unterstützt von professionellen<br />
Theater- und Musikschaffenden, wie Teamgeist zu einem gelingenden<br />
gemeinsamen Ergebnis führt.<br />
Natur erforschen: Kinder benötigen <strong>für</strong> eine gesunde Entwicklung<br />
viel Bewegung in der Natur und möglichst intensive Begegnungen<br />
mit Tieren und Pflanzen. Die Wahrnehmung der<br />
Natur wirkt sich nachweislich positiv auf die Entwicklung von<br />
Sprache und Lernfähigkeit aus.<br />
Fortbildung<br />
„Glück entsteht in der Bewältigung von Herausforderungen.<br />
Wenn wir glückliche Kinder haben wollen, sollten wir ihnen<br />
Foto: Stiftung Kinderjahre<br />
Prinzipien guter Prävention und Gesundheitsförderung<br />
Die Bundesvereinigung <strong>für</strong> Prävention und Gesundheitsförderung<br />
e. V. (BVPG) hat sich in einem Leitbild auf<br />
sieben Prinzipien verständigt, die eine hohe Qualität<br />
in Prävention und Gesundheitsförderung sicherstellen<br />
sollen. Dazu zählen u.a. Autonomie und Empowerment,<br />
Partizipation und Lebenswelt- und Lebensstilbezug. Die<br />
grundlegenden Prinzipien sind <strong>für</strong> alle BVPG-Mitglieder<br />
handlungsleitend und verbindlich.<br />
Potenzial Gesundheit<br />
Gesundheit ist nicht nur ein individuelles, sondern auch<br />
ein gesellschaftliches Potenzial, das es zu stärken gilt.<br />
Darum diskutierte die BVPG bei ihrer Mitgliederversammlung<br />
2013 ihre vier Strategien zur Weiterentwicklung von<br />
Gesundheitsförderung und Prävention:<br />
• Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe<br />
gestalten<br />
• Prioritäten zur Förderung individueller und gesellschaftlicher<br />
Gesundheit festlegen, Ziele definieren<br />
• Strukturen und Ressourcen <strong>für</strong> Gesundheitsförderung<br />
auf der Ebene Bund, Land und Kommune ausbauen und<br />
miteinander verbinden<br />
• Qualität von Gesundheitsförderung und Prävention sichern,<br />
Wirksamkeit fördern und sichtbar machen<br />
Stadtpunkte 02/13 | 15
Gesundheit aktuell<br />
Schulbiologiezentrum Hamburg e. V.<br />
In der Januar-Ausgabe 2013 der Vereinszeitschrift „Lynx“<br />
geht es rund um das Thema „Geglücktes Leben in der<br />
Schule – Glück als neues Schulfach?“. Vorgestellt werden<br />
hier auch die Projekte der Stiftung Kinderjahre, die sich<br />
das Thema Glück nachhaltig auf die Fahne geschrieben hat.<br />
http://www.fs-hamburg.org/Download/LynxDruck<br />
_2013_01.<strong>pdf</strong><br />
spannende Aufgaben geben, die sie selbst bewältigen können.<br />
Dazu müssen wir sie beobachten, ihre Fähigkeiten und Inte-<br />
Mit dem Rad zur Arbeit fahren<br />
Aktion von ADFC und AOK startet am 1. Juni<br />
Gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V.<br />
(ADFC) Hamburg bringt die AOK Rheinland/Hamburg wieder<br />
mehr Bewegung und gesunde Lebensweise in den Alltag, indem<br />
sie alle Arbeitnehmer/innen – wie schon in den vergangenen<br />
Jahren – zur Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“<br />
einlädt. Ziel: bessere Gesundheit durch mehr Fitness, eine<br />
saubere Umwelt sowie attraktive Preise beim Gewinnspiel<br />
inklusive.<br />
Im Team oder allein mit dem Rad zur Arbeit<br />
Vom 1. Juni bis 31. August 2013 legen die Teilnehmer/innen an<br />
mindestens 20 Arbeitstagen den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad<br />
zurück. Kollegen in Unternehmen können Teams bilden,<br />
aber auch als Einzelpersonen teilnehmen. Pendler haben bei<br />
der Aktion ebenfalls gute Chancen: Die Fahrten bis zur nächsten<br />
Haltestelle von Bus und Bahn werden als Wettbewerbsbeitrag<br />
berücksichtigt. Als Gewinne winken neben Kurzreisen<br />
attraktive und nützliche Dinge rund um das Thema Radfahren.<br />
Ein weiterer Vorteil <strong>für</strong> AOK-Versicherte: Teilnehmer/innen am<br />
Familienbonus oder Prämienprogramm sammeln Punkte. Betriebe<br />
haben im Rahmen des Wettbewerbs die Möglichkeit, als<br />
„Fahrradaktiver Betrieb“ zertifiziert zu werden, wenn sie sich<br />
ressen kennen lernen“, so Dipl.-Psych. Michael Thiel, ebenfalls<br />
Glücks-Botschafter der Stiftung Kinderjahre. Da<strong>für</strong> bietet die<br />
Stiftung Kinderjahre Weiterbildungen <strong>für</strong> Lehrkräfte an. Einige<br />
Schulen in Hamburg haben das Themenfeld Glück schon in ihr<br />
Curriculum aufgenommen. Die beteiligten Lehrkräfte berichten<br />
zweimal im Jahr auf Lehrerfortbildungen des Landesinstituts <strong>für</strong><br />
Lehrerbildung und Schulentwicklung über ihre Erfahrungen und<br />
stellen Unterrichtsmaterialien zum Thema Glück vor. Die nächste<br />
Fortbildung ist der 22. Oktober von 15 – 18 Uhr.<br />
Kontakt: Stiftung Kinderjahre, Sierichstraße 48<br />
22301 Hamburg, Tel: 040 5394941, info@stiftung-kinderjahre.de<br />
www.stiftung-kinderjahre.de<br />
besonders <strong>für</strong> Rad fahrende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
einsetzen. Unter allen zertifizierten Unternehmen wird eine<br />
ADFC-geführte Betriebs- bzw. Abteilungs-Fahrradtour verlost.<br />
Im letzten Jahr haben in Hamburg 5.600 Beschäftigte aus 380<br />
Unternehmen mitgemacht.<br />
Aktionskalender und CO2-Rechner<br />
Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2013. Einsendeschluss <strong>für</strong> den<br />
ausgefüllten Aktionskalender – der gleichzeitig auch als Teilnahmeschein<br />
<strong>für</strong> die Verlosung gilt – ist der 21. September 2013.<br />
Nähere Informationen, Aktionskalender und die Teilnahmeunterlagen<br />
sind bei jeder AOK-Geschäftsstelle erhältlich. Den<br />
Aktionskalender zum Registrieren der gefahrenen Kilometer<br />
gibt es jetzt auch als iPhone-App. Unter www.mit-dem-radzur-arbeit.de<br />
im Button „Hamburg“ können sich Interessierte<br />
auch online anmelden. Mit dem CO2-Rechner auf der Aktionswebsite<br />
lässt sich leicht berechnen, wie viel Kohlendioxid der<br />
Umwelt durch den Umstieg aufs Rad erspart bleibt. Gleichzeitig<br />
wird auch ermittelt, wie viele Kalorien abgebaut wurden.<br />
Kontakt: Ahmed El-Jarad, AOK Rheinland/Hamburg<br />
Tel: 040 20234933, ahmed.el-jarad@rh.aok.de<br />
Internetabhängigkeit: Erste Selbsthilfegruppe in Hamburg gegründet<br />
In Hamburg sind laut der <strong>Hamburgische</strong>n Landesstelle <strong>für</strong> Suchtfragen<br />
e.V. (HLS) etwa 10.000 Menschen exzessive Computerund<br />
Internetnutzer/innen. Unterstützung finden sie nun in der<br />
ersten Selbsthilfegruppe <strong>für</strong> Computersüchtige in Hamburg.<br />
18 Stunden am PC<br />
Gründer der Gruppe „Computersucht“ ist Richard B. (24). Hinter<br />
ihm liegt ein langer Leidensweg: Bis zu 18 Stunden spielte er<br />
pro Tag am PC, verlor Freunde und sogar seinen Job. Nach einem<br />
dreimonatigen Entzug in einer Klinik suchte er vergeblich nach<br />
einer Selbsthilfegruppe. Nun hat er selbst eine gegründet: „Ich<br />
treffe mich jetzt mit Menschen, die das Gleiche durchgemacht<br />
haben wie ich und nach ähnlichen Lösungen suchen“, sagt<br />
Richard B. Er will Betroffene ermutigen, es ihm gleichzutun und<br />
Lebensfreude im „real life“ zurückzugewinnen. Die Mehrheit<br />
der „Internetsüchtigen“ ist erwachsen und ledig. Arbeitslose<br />
Männer sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, eine Abhängigkeit<br />
von Spielen oder virtuellen Beziehungen zu entwickeln.<br />
Projekt: Netz mit Webfehlern<br />
„Anders als bei einer Alkoholerkrankung müssen die Betroffenen<br />
allein schon im Berufsleben den Computer und das In-<br />
16 | Stadtpunkte 02/13
ternet weiter nutzen. Sie sind deshalb so oft nur einen Klick<br />
von Computerspielen oder Sozialen Netzwerken entfernt und<br />
daher hoch gefährdet“, sagt Colette See, Leiterin des Projekts<br />
„Netz mit Web-Fehlern?“ der HLS. Maren Puttfarcken, Leiterin<br />
der Landesvertretung Hamburg der Techniker Krankenkasse<br />
(TK), unterstützt das Projekt: „Wir freuen uns, mit der Selbsthilfegruppe<br />
im Rahmen der Nachsorge einen wichtigen Beitrag<br />
zu leisten, damit Betroffene auch in schwierigen Lebensphasen<br />
nicht rückfällig werden“.<br />
Die HLS unterstützt mit dem Projekt „Netz mit Web-Fehlern?“<br />
die Förderung von Selbsthilfe bei „Internetabhängigkeit“.<br />
„Kinder im Haus!?“<br />
Erlebnis-Ausstellung zur Unfallprävention<br />
Kinder sind neugierig, wollen und sollen alles entdecken und<br />
ausprobieren. Sie können dadurch im Haushalt aber auch in<br />
gefährliche Situationen kommen. Eltern und pädagogische<br />
Fachkräfte stehen vor der Aufgabe, den Forscherdrang der Kinder<br />
zu unterstützen und sie gleichzeitig vor folgenschweren<br />
Foto: BAG e. V.<br />
Die von der TK geförderten Aktivitäten zielen darauf ab, Betroffenen<br />
und Angehörigen die passende Hilfe zukommen zu<br />
lassen.<br />
Mehr Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf der<br />
Ratgeberseite www.webfehler-hamburg.de.<br />
Kontakt: Colette See, HLS e.V., Tel: 040 28499180<br />
see@sucht-hamburg.de, www.sucht-hamburg.de<br />
John Hufert, TK-Landesvertretung Hamburg, Tel: 040 69095513<br />
john.hufert@tk.de, www.tk.de/lv-hamburg<br />
Unfällen zu schützen. Diese Aufgabe ist leichter zu bewältigen,<br />
wenn die Erwachsenen die Möglichkeit haben, die Wohnung<br />
einmal aus Sicht der Kinder zu erleben. Die Ausstellung<br />
mit überdimensional großen Möbeln öffnet den Blick da<strong>für</strong>,<br />
wie riesig, interessant und verlockend Möbel und besonders<br />
die Küche <strong>für</strong> Kinder sein können. Erwachsene erleben hautnah,<br />
welchen Gefahren die Kinder dabei ausgesetzt sind, und<br />
es wird unmittelbar deutlich, wo Schutzmaßnahmen ergriffen<br />
werden müssen.<br />
Die Erlebnis-Ausstellung der Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
„Mehr Sicherheit <strong>für</strong> Kinder e. V.“ richtet sich an Eltern, Großeltern,<br />
Eltern-Kind-Gruppen, Tagesmütter/-väter und pädagogische<br />
Fachkräfte. Sie ist vom 8.6. bis 16.6.2013 täglich von<br />
10.00 – 17.00 Uhr, an den Wochenenden von 11.00-17.00<br />
Uhr im Kinder und Familien Zentrum (KiFaZ) Barmbek Basch,<br />
Wohldorfer Straße 30, 22081 Hamburg zu sehen. Der Besuch<br />
ist kostenfrei! Zusätzlich gibt es viele Informationen rund um<br />
das Thema Kindersicherheit, 1. Hilfe-Kurse am Kind und auf<br />
Nachfrage muttersprachliche Führungen.<br />
Kooperationspartner sind das Gesundheitsamt Hamburg-Nord,<br />
die Unfallkasse Nord und MiMi (mit Migranten <strong>für</strong> Migranten).<br />
Gesundheit aktuell<br />
Schublade als Kletterhilfe: Erwachsene erleben Unfallgefahren<br />
aus der Kinderperspektive<br />
Informationen unter Tel: 040 29821313 oder<br />
lucy.paczkowski@kifaz.de<br />
Lesbische Ärztinnen<br />
Das Buch präsentiert Ergebnisse zahlreicher Interviews und<br />
Gruppendiskussionen. Ärztinnen, die in Praxis, Klinik oder<br />
Pharmaindustrie arbeiten, am Beginn der Weiterbildung stehen<br />
oder im Ruhestand sind, werden mit ihren Berufswegen<br />
und Erfahrungen porträtiert: Wie entscheiden sie über das<br />
„Outen“ gegenüber Kolleg/innen oder Patient/innen? Wie<br />
gehen sie mit Diskriminierungen um? Wie managen sie die<br />
Leistungsanforderungen in ihrem Beruf?<br />
Das Buch kann lesbische Ärztinnen anregen, eigene Erfahrungen<br />
im Medizinbetrieb zu reflektieren. Leser/innen, die<br />
sich <strong>für</strong> das Thema Diversity interessieren,<br />
bietet es wertvolle Einblicke<br />
zu Situation und Erleben von Minderheiten<br />
im Arbeitsleben.<br />
Helga Seyler (2013). Lesbische Ärztinnen.<br />
Erfahrungen und Strategien<br />
im Berufsleben. Frankfurt/Main:<br />
Mabuse-Verlag. 199 S. ISBN: 978-3-<br />
863211325. EUR 19,90<br />
Mediothek<br />
Stadtpunkte 02/13 | 17
Mediothek<br />
Die nachhaltige Profiküche in Theorie und Praxis<br />
„Nachhaltigkeit“ – das ist ein häufig verwendeter und vielfältig<br />
definierter Begriff, der längst auch in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
Eingang gefunden hat. Im vorliegende Buch geht es um<br />
die Nachhaltigkeit in der Profiküche. Es gliedert sich in die drei<br />
Bereiche: Food, Technik und Rezepte. Im ersten Teil werden von<br />
„Regionalität“ über „C02 Fußabdruck“ bis hin zu den Nachhaltigkeitssiegeln<br />
viele relevante Begriffe beschrieben und erklärt.<br />
Im Teil „Technik“ werden der Energieverbrauch und andere<br />
Faktoren des nachhaltigen Agierens aufgeführt. Für die Praxis<br />
wertvoll sind die zahlreichen Best Practice Beispiele aus den<br />
unterschiedlichsten Bereichen der Gemeinschaftsverpflegung.<br />
Checklisten fassen die einzelnen Kapitel zusammen. Im dritten<br />
Teil finden sich etliche vegetarische Rezepte und Hinweise, wie<br />
tierische Lebensmittel ersetzt werden können. Das Buch liefert<br />
eine Fülle von Anregungen und<br />
Ideen, wie das Thema Nachhaltigkeit<br />
in gastronomischen Betrieben<br />
Schritt <strong>für</strong> Schritt umgesetzt<br />
werden kann. Das handliche Buch<br />
ist reich bebildert und farbenfroh<br />
gestaltet. Ein Glossar wäre hilfreich,<br />
um bei den umfangreichen<br />
Themen schnell die benötigte Information<br />
zu finden.<br />
Die nachhaltige Profiküche in<br />
Theorie und Praxis (2012).<br />
B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG. München.<br />
ISBN 978-3- 928709-16-3. 234 S. EUR 39,00<br />
Interaktionsordnungen – Gesundheit als soziale Praxis<br />
Gerade im Gesundheitsbereich<br />
treffen viele verschiedene Individuen<br />
in Interaktionen aufeinander.<br />
Die Herausgeber Hanses<br />
und Sander vom Institut <strong>für</strong> Sozialpädagogik,<br />
Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften<br />
der TU Dresden<br />
beschreiben im vorliegenden<br />
Buch zentrale Aspekte der Interaktion.<br />
Dabei steht der Begriff Interaktionsordnungen<br />
<strong>für</strong> verborgene<br />
soziale Arrangements, die zum Teil<br />
gelingen, jedoch genauso misslingen können. Im Zentrum der<br />
Publikation stehen neue Perspektiven, unter anderem die<br />
Veränderungen von Organisationsabläufen im Gesundheits-<br />
wesen, die zunehmende Komplexität des professionellen Handelns<br />
und der multiprofessionellen Abstimmung sowie eine<br />
umfassenderer Arzt-Patienten-Beziehung. Die Bedeutungen<br />
und Konsequenzen „sozialer Praxis“ im Gesundheitssystem<br />
werden aus erziehungs- und gesundheitswissenschaftlicher<br />
beschrieben. Die Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes<br />
geben Einblicke in Forschungszusammenhänge und<br />
empirische Untersuchungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern<br />
des Gesundheitsbereichs. Institutionen wie das Krankenhaus,<br />
das Altenheim und die Psychiatrie, aber auch die<br />
Arztpraxis, die Pflegeschule und die ambulante Versorgung<br />
werden dabei in ihren Interaktionen betrachtet.<br />
Andreas Hanses & Kirsten Sander (Hrsg.) (2012). Interaktionsordnungen.<br />
Gesundheit als soziale Praxis. Wiesbaden: Springer<br />
Fachmedien. 280 S. ISBN 978-3-531-16968-2. EUR 34,95<br />
Arbeitsleben 2025<br />
Was können Unternehmen und Beschäftigte<br />
tun, damit Arbeitnehmer/innen die Arbeit gesund,<br />
gerne, gut und produktiv bis ins Rentenalter<br />
ausüben zu können? – Es bedarf einer<br />
guten Arbeitsfähigkeit: die körperlichen, geistigen,<br />
psychischen und sozialen Kapazitäten<br />
einer Person und die Arbeitsanforderungen<br />
sollten in einer stabilen Balance sein. Da<strong>für</strong> ist<br />
darauf zu achten, dass Gesundheit, Kompetenz,<br />
Einstellungen/Werte, Arbeitsbedingungen einschließlich<br />
Führung und das persönliche und<br />
betriebliche Umfeld förderlich gestaltet sind.<br />
Das Konzept des „Hauses der Arbeitsfähigkeit“<br />
ermöglicht es, die Balance zwischen Anforderungen<br />
und individueller bzw. kollektiver Leistung zu sichern<br />
und zu fördern. Die Möglichkeiten zur Gestaltung guter Arbeit<br />
in Zeiten des demografischen Wandels bedürfen eines wohl<br />
abgestimmten Entwicklungsprozesses.<br />
Alles, was man zum gemeinsamen Bau des Hauses benötigt,<br />
wird in diesem Buch dargestellt. Arbeitswissenschaftliche<br />
Grundlagen werden verständlich erläutert;<br />
Methoden und Instrumente zur Analyse und<br />
zur Umsetzung werden vorgestellt und mit<br />
anschaulichen Praxisbeispielen angereichert.<br />
Dazu gehört auch der Tarifvertrag zum demografischen<br />
Wandel und der Generationengerechtigkeit<br />
der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein.<br />
Geschichte und Geschichten, instruktive<br />
Bilder und Grafiken … und immer wieder Fragen<br />
zum Nachdenken und Anregungen <strong>für</strong> den<br />
betrieblichen Dialog machen das Buch nicht<br />
nur unterhaltsam, sondern zu einer notwendigen<br />
und ermutigenden Lektüre <strong>für</strong> alle, die<br />
Personalführungsaufgaben und Verantwortung<br />
<strong>für</strong> die betriebliche Arbeitsgestaltung und das Gesundheitsmanagement<br />
haben.<br />
Jürgen Tempel, Juhani Ilmarinen (2013). Arbeitsleben 2015.<br />
Das Haus der Arbeitsfähigkeit im Unternehmen bauen. Hamburg:<br />
VSA Verlag. 296 S. ISBN 078-3-89965-464-6. EUR<br />
19,80<br />
18 | Stadtpunkte 02/13
Termine der HAG-Arbeitskreise<br />
AK Gesundheitsförderung in der Arbeitsumwelt<br />
Do 13.06.2013<br />
Do 12.09.2013<br />
Do 14.11.2013<br />
17.00 – 19.00 Uhr<br />
Ort: BGV, Billstraße 80 a, 11. Stock, Raum 11.03<br />
Axel Herbst, Tel: 040 4399033<br />
AK Sexualität – Sexualität / AIDS und sexuell<br />
übertragbare Krankheiten<br />
Mo 03.06.2013<br />
Mo 04.11.2013<br />
14.00 – 17.00 Uhr<br />
Ort: Pro Familia Landesverband Hamburg, Seewartenstr. 10<br />
Haus 1, 20459 Hamburg im Gesundheitszentrum St. Pauli<br />
Holger Hanck, Tel: 040 42837-2212<br />
Hamburger Bündnis gegen den Plötzlichen<br />
Säuglingstod<br />
Mi 04.12.2013, 16.00-18.00 Uhr<br />
Ort: Konferenzraum, Repsoldstr. 4, 20097 Hamburg<br />
Susanne Wehowsky, Tel: 040 2880364-11<br />
Zielpatenschaft „Stillen“<br />
Termin bitte erfragen<br />
Ort: Konferenzraum, Repsoldstr. 4, 20097 Hamburg<br />
Petra Hofrichter, Tel: 040 2880364-14<br />
HAG-Team 2013<br />
Termine HAG<br />
30.05.2013: Migranten-Communities besser kennenlernen<br />
durch „Community Mapping“ – 1. Workshop der Fortbildungsreihe<br />
„Praxisnahe Qualitätsentwicklung – Wie gelingen Empowerment<br />
und Partizipation?“ 10.00 – 17.00 Uhr, Zentrum <strong>für</strong><br />
Aus- und Fortbildung – ZAF, Kontakt: Denis Spatzier<br />
Tel: 040 2880364-18, denis.spatzier@hag-gesundheit.de<br />
05.09.2013: „Schatzsuche“, Fachtagung zum Thema seelisches<br />
Wohlbefinden von Kindern in Kindertagesstätten<br />
anlässlich des Abschlusses des HAG-Modellprojektes, Handwerkskammer<br />
Hamburg, Kontakt: Maria Gies<br />
Tel: 040 2880364-13, maria.gies@hag-gesundheit.de<br />
12.09.2013: Gemeinsam <strong>für</strong> ein gesundes Hamburg, Kongress<br />
des Paktes <strong>für</strong> Prävention 2013, Kontakt: Denis Spatzier<br />
Tel: 040 2880364-18, denis.spatzier@hag-gesundheit.de<br />
Foto: Heike Günther<br />
HAG-Arbeitskreise | Termine HAG<br />
Impressum<br />
Herausgeberin:<br />
<strong>Hamburgische</strong> <strong>Arbeitsgemeinschaft</strong> <strong>für</strong><br />
Gesundheitsförderung e. V. (HAG)<br />
Repsoldstr. 4 | 20097 Hamburg<br />
Tel: 040 2880364-0 | Fax: 040 2880364-29<br />
buero@hag-gesundheit.de | www.hag-gesundheit.de<br />
V.i.S.d.P.: Susanne Wehowsky<br />
Redaktionsteam: Ahmed El Jarad | Katharina Ehmann | Dörte Frevel<br />
| Petra Hofrichter John Hufert | Christine Orlt | Dorothee Schwab<br />
Susanne Wehowsky<br />
Koordination: Dörte Frevel<br />
Satzerstellung: Christine Orlt<br />
Druck: Drucktechnik | Auflage: 2500 | ISSN 1860-7276<br />
Erscheinungsweise: 4 x jährlich<br />
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des/der<br />
Autors/in wieder, nicht unbedingt die der Redaktion.<br />
17.09.2013: Empowerment und Partizipation: Strategien <strong>für</strong><br />
die Gesundheitsförderung im Ernährungsbereich – 2. Workshop<br />
der Fortbildungsreihe „Praxisnahe Qualitätsentwicklung<br />
– Wie gelingen Empowerment und Partizipation?“<br />
9.00 – 17.00 Uhr, Zentrum <strong>für</strong> Aus- und Fortbildung – ZAF<br />
Kontakt: Denis Spatzier, Tel: 040 2880364-18<br />
denis.spatzier@hag-gesundheit.de<br />
24.09.2013: Auszeichnung „Gesunde Schule 2012/2013“<br />
Kontakt: Susanne Wehowsky, Tel: 040 2880364-11<br />
susanne.wehowsky@hag-gesundheit.de<br />
24.09.2013: Tag der Schulverpflegung, Kontakt: Silke Bornhöft,<br />
Dörte Frevel, Tel: 040 2880364-17<br />
vernetzungsstellehag-gesundheit.de<br />
14. – 18.10.2013: Aktionswoche „Hamburger Kita Tag“<br />
organisiert durch das Netzwerk Gesunde Kitas in Hamburg<br />
Kontakt: Maria Gies, Tel: 040 2880364-13<br />
maria.gies@hag-gesundheit.de<br />
Sie können die Stadtpunkte kostenlos bestellen:<br />
per Telefon, Fax oder E-Mail.<br />
24.10.2013: Jahrestagung der HAG, Kontakt: Petra Hofrichter<br />
Tel: 040 2880364-14, petra.hofrichter@hag-gesundheit.de<br />
Stadtpunkte 02/13 | 19
Veranstaltungen<br />
Veranstaltungen in Hamburg<br />
„Baby mit Zukunft“, Aufwachsen zwischen virtuellen Netzwerken<br />
und emotionaler Präsenz, Fachtagung | 05.06.2013<br />
Kontakt: Ehlerding Stiftung, Tel: 040 4117230<br />
info@ehlerding-stiftung.de, www.ehlerding-stiftung.de<br />
„Kinder im Haus!?“ – Erlebnisausstellung zur Unfallprävention<br />
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit <strong>für</strong><br />
Kinder e. V.“ | 08.06. – 16.06.2013, Barmbek-Basch | Kontakt:<br />
Kinder- und Familienzentrum im Barmbek-Basch, Lucy Paczkowski<br />
Tel: 040 – 29821313, lucy.paczkowski@kifaz.de<br />
Wohnen ohne Grenzen – Barrierefreies Planen und Bauen …<br />
auch wenn Pflege und Assistenz nötig sind | 14.06.2013<br />
Kontakt: Hamburger Koordinationsstelle <strong>für</strong> Wohn-Pflege-Gemeinschaften<br />
STATTBAU HAMBURG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH<br />
Mascha Stubenvoll, Tel: 040 43294232<br />
koordinationsstelle@stattbau-hamburg.de<br />
www.koordinationsstelle-pflege-wgs-hamburg.de<br />
„Selbsthilfe ist vielfältig“, Hamburger Selbsthilfe-Tag | 24.08.2013<br />
Kontakt: Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg e. V.<br />
Tel. 040 4152010, www.paritaet-hamburg.de<br />
9. Gesundheitswirtschaftskongress | 24. – 25.09.2013 | Kontakt:<br />
Kongressbüro, Tel: 030 49855031<br />
info@gesundheitswirtschaftskongress.de<br />
www.gesundheitswirtschaftskongress.de<br />
Gemeinsam <strong>für</strong> ein gesundes Hamburg, Kongress des Paktes <strong>für</strong><br />
Prävention 2013 | 12.09.2013 | Kontakt: Denis Spatzier<br />
Tel: 040 2880364-18, denis.spatzier@hag-gesundheit.de<br />
„Das Leben ist ein Großes“, 10. Hamburger Alzheimer Tage<br />
21. – 23.10.2013 | Info: www.hamburgische-bruecke.de<br />
Bundesweit<br />
GUT DRAUF 2(.)0, Jahrestagung 2013 | 03. – 05.06.2013, Berlin<br />
Kontakt: GUT DRAUF-Gesamtkoordination, projecta köln, Benita C.<br />
Schulz, Tel: 0221 80083-26, gutdrauf-ft13@projecta-koeln.de<br />
www.projecta-koeln.de<br />
Suppenküchen im Schlaraffenland, Armut und Ernährung in<br />
unserer Gesellschaft | 05.06.2013, Hannover | Kontakt: Landesvereinigung<br />
<strong>für</strong> Gesundheit und Akademie <strong>für</strong> Sozialmedizin Nds. e. V.<br />
Tel: 0511 3500052, info@gesundheit-nds.de, www.gesundheit-nds.de<br />
Es ist nie zu spät und selten zu früh, 2. Bundeskonferenz der<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | 06.06.2013,<br />
Berlin | Kontakt: Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit und Akademie <strong>für</strong><br />
Sozialmedizin Nds. e. V., Tel: 0511 3500052<br />
Wie viel Wissen ist gesund?<br />
Jahrestagung 2013 | 19.06.2013, Hannover | Kontakt: Landesvereinigung<br />
<strong>für</strong> Gesundheit und Akademie <strong>für</strong> Sozialmedizin Nds. e. V., s. o.<br />
Mission Ernährung – Wenn Gesundheit zum Diktat wird<br />
17. Heidelberger Ernährungsforum | 25. – 26.09.2013, Heidelberg<br />
Kontakt: Dr. Rainer Wild Stiftung, Tel: 06221 7511-225<br />
nicole.schmitt@gesunde-ernaehrung.de, www.gesunde-ernaehrung.de<br />
33. Internationaler Kongress <strong>für</strong> Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br />
A+A | 05. – 08.11.2013, Düsseldorf | Kontakt: Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,<br />
(Basi), Tel: 02241 231-6040, hammer@basi.de, www.basi.de<br />
International<br />
Young People an Mental Health: Prevention and Early Intervention<br />
in Europe, Integrating the European Knowledge<br />
30.05.2013, Brüssel | Kontakt: Parvin Madahar, parvin.madahar@publicpolicyexchange.co.uk,<br />
www.publicpolicyexchange.co.uk<br />
„Markt. Wert. Wahrnehmung – Was ist Essen wert?, Symposium<br />
des „forum ernährung heute“ | 05. – 06.06.2013 | Kontakt:<br />
www.forum-ernaehrung.at<br />
„Adipositasprävention – eine (ge)wichtige Herausforderung“<br />
EUFEP-Kongress 2013, Europäisches Forum <strong>für</strong> evidenzbasierte Gesundheitsförderung<br />
und Prävention | 12. – 13.06.2013, Krems, Österreich<br />
| Kontakt: www.eufep.at<br />
„Mehr Wert durch Vielfalt: gesunde Teams und Führung“<br />
Nationale Tagung <strong>für</strong> Betriebliche Gesundheitsförderung 2013<br />
21.08.2013, Zürich | Kontakt: www.gesundheitsfoerderung.ch/<br />
Best Investments for Health, 21st IUHPE Word Conference on<br />
Health Promotion | 25. – 29.08.2013, Pattaya, Thailand | Kontakt:<br />
www.iuhpeconference.net/en/index.php<br />
2. Wirtschaftskonferenz zum Generationen-Management,<br />
„Praktische Beispiele alter(n)sgerechter Arbeitsgestaltung”<br />
15. – 16.10.2013, Bregenz | Kontakt: www.bf-geissler.com<br />
Redaktionsschluss<br />
10.06.2013<br />
Erscheinungstermin<br />
August 2013<br />
Wir freuen uns auf Ihre<br />
Anregungen, Beiträge und Informationen!<br />
Thema der<br />
nächsten Ausgabe<br />
Kita-Projekt<br />
„Schatzsuche“<br />
Die <strong>Hamburgische</strong> <strong>Arbeitsgemeinschaft</strong><br />
<strong>für</strong> Gesundheitsförderung<br />
e. V. (HAG)<br />
macht sich <strong>für</strong> Gesundheitsförderung<br />
und Prävention<br />
stark. Sie ist eine landesweit<br />
arbeitende Vereinigung<br />
und verbindet Akteure aus allen entscheidenden Sektoren<br />
und Arbeitsfeldern miteinander. Die HAG will die Gesundheitschancen<br />
von sozial Benachteiligten fördern, das Ernährungs-<br />
und Bewegungsverhalten verbessern und das psychosoziale<br />
Wohlbefinden stärken. Dazu koordiniert und vernetzt<br />
sie gesundheitsfördernde Aktivitäten und Projekte. Die HAG<br />
ist unabhängig und gemeinnützig. Sie wird gefördert von<br />
der Behörde <strong>für</strong> Gesundheit und Verbraucherschutz und den<br />
Hamburger Krankenkassen (GKV).<br />
www.hag-gesundheit.de | Telefon 040 2880364-0<br />
20 | Stadtpunkte 02/13



![Beitrag Dr. Ishorst-Witte [pdf Dokument, 121 KB]](https://img.yumpu.com/22329675/1/184x260/beitrag-dr-ishorst-witte-pdf-dokument-121-kb.jpg?quality=85)
![Vortrag Raimund Geene [pdf Dokument, 1610 KB]](https://img.yumpu.com/22286350/1/190x143/vortrag-raimund-geene-pdf-dokument-1610-kb.jpg?quality=85)

![Vortrag Ishorst-Witte [pdf Dokument, 26 KB]](https://img.yumpu.com/22142103/1/184x260/vortrag-ishorst-witte-pdf-dokument-26-kb.jpg?quality=85)


![SIDS-Präsentation 14.11.12_1 [pdf Dokument, 397 KB]](https://img.yumpu.com/22142097/1/190x143/sids-prasentation-141112-1-pdf-dokument-397-kb.jpg?quality=85)



![Begrüßung Hofrichter [pdf Dokument, 43 KB] - Hamburgische ...](https://img.yumpu.com/22142087/1/184x260/begrussung-hofrichter-pdf-dokument-43-kb-hamburgische-.jpg?quality=85)