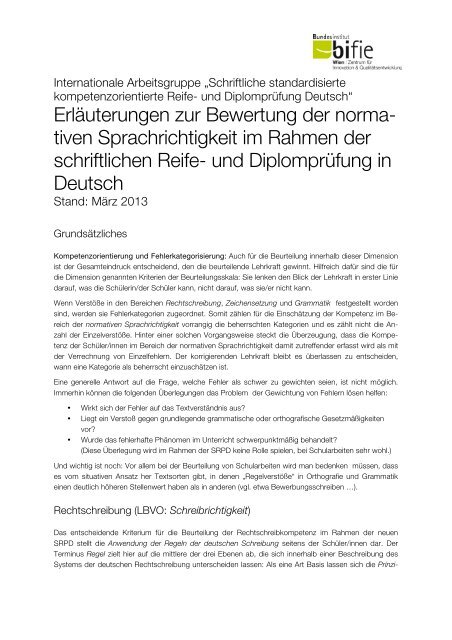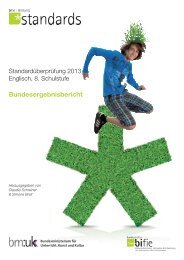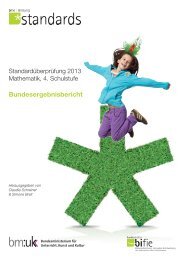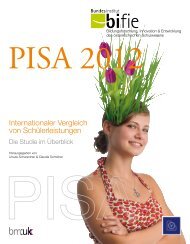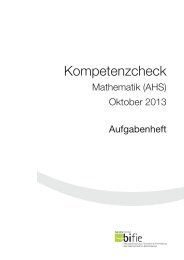Erläuterungen zur Bewertung der normativen Sprachrichtigkeit - Bifie
Erläuterungen zur Bewertung der normativen Sprachrichtigkeit - Bifie
Erläuterungen zur Bewertung der normativen Sprachrichtigkeit - Bifie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Internationale Arbeitsgruppe „Schriftliche standardisierte<br />
kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung Deutsch“<br />
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong><br />
<strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong><br />
schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in<br />
Deutsch<br />
Stand: März 2013<br />
Grundsätzliches<br />
Kompetenzorientierung und Fehlerkategorisierung: Auch für die Beurteilung innerhalb dieser Dimension<br />
ist <strong>der</strong> Gesamteindruck entscheidend, den die beurteilende Lehrkraft gewinnt. Hilfreich dafür sind die für<br />
die Dimension genannten Kriterien <strong>der</strong> Beurteilungsskala: Sie lenken den Blick <strong>der</strong> Lehrkraft in erster Linie<br />
darauf, was die Schülerin/<strong>der</strong> Schüler kann, nicht darauf, was sie/er nicht kann.<br />
Wenn Verstöße in den Bereichen Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik festgestellt worden<br />
sind, werden sie Fehlerkategorien zugeordnet. Somit zählen für die Einschätzung <strong>der</strong> Kompetenz im Bereich<br />
<strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> vorrangig die beherrschten Kategorien und es zählt nicht die Anzahl<br />
<strong>der</strong> Einzelverstöße. Hinter einer solchen Vorgangsweise steckt die Überzeugung, dass die Kompetenz<br />
<strong>der</strong> Schüler/innen im Bereich <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> damit zutreffen<strong>der</strong> erfasst wird als mit<br />
<strong>der</strong> Verrechnung von Einzelfehlern. Der korrigierenden Lehrkraft bleibt es überlassen zu entscheiden,<br />
wann eine Kategorie als beherrscht einzuschätzen ist.<br />
Eine generelle Antwort auf die Frage, welche Fehler als schwer zu gewichten seien, ist nicht möglich.<br />
Immerhin können die folgenden Überlegungen das Problem <strong>der</strong> Gewichtung von Fehlern lösen helfen:<br />
• Wirkt sich <strong>der</strong> Fehler auf das Textverständnis aus?<br />
• Liegt ein Verstoß gegen grundlegende grammatische o<strong>der</strong> orthografische Gesetzmäßigkeiten<br />
vor?<br />
• Wurde das fehlerhafte Phänomen im Unterricht schwerpunktmäßig behandelt?<br />
(Diese Überlegung wird im Rahmen <strong>der</strong> SRPD keine Rolle spielen, bei Schularbeiten sehr wohl.)<br />
Und wichtig ist noch: Vor allem bei <strong>der</strong> Beurteilung von Schularbeiten wird man bedenken müssen, dass<br />
es vom situativen Ansatz her Textsorten gibt, in denen „Regelverstöße“ in Orthografie und Grammatik<br />
einen deutlich höheren Stellenwert haben als in an<strong>der</strong>en (vgl. etwa Bewerbungsschreiben …).<br />
Rechtschreibung (LBVO: Schreibrichtigkeit)<br />
Das entscheidende Kriterium für die Beurteilung <strong>der</strong> Rechtschreibkompetenz im Rahmen <strong>der</strong> neuen<br />
SRPD stellt die Anwendung <strong>der</strong> Regeln <strong>der</strong> deutschen Schreibung seitens <strong>der</strong> Schüler/innen dar. Der<br />
Terminus Regel zielt hier auf die mittlere <strong>der</strong> drei Ebenen ab, die sich innerhalb einer Beschreibung des<br />
Systems <strong>der</strong> deutschen Rechtschreibung unterscheiden lassen: Als eine Art Basis lassen sich die Prinzi-
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 2<br />
pien <strong>der</strong> Rechtschreibung auffassen, allgemeine Grundsätze, denen Menschen gefolgt sind, lange bevor<br />
es Regeln gab; auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Prinzipien sind Regeln formuliert worden und dort, wo diese nicht ausreichten,<br />
Einzelfestlegungen (die das Wörterbuch aufführt). 1<br />
Exkurs: Die Prinzipien <strong>der</strong> Rechtschreibung im Überblick<br />
• Lautprinzip<br />
• Stammprinzip<br />
• grammatisches Prinzip<br />
• semantisch-pragmatisches Prinzip<br />
• Homonymieprinzip<br />
• ästhetisches Prinzip<br />
Die Prinzipien <strong>der</strong> deutschen Rechtschreibung im Detail (vereinfacht):<br />
• Lautprinzip: „Schreibe, wie du sprichst!“ Das Lautprinzip bezieht gewissermaßen gesprochene<br />
und geschriebene Sprache unmittelbar aufeinan<strong>der</strong>. Gleich Ausgesprochenes wäre danach im<br />
Prinzip gleich zu schreiben; entsprechend spielt es die Hauptrolle bei den Laut-Buchstaben-<br />
Zuordnungen.<br />
• Stammprinzip: „Schreibe Gleiches möglichst gleich!“ Das Prinzip zielt ab auf Gleichbehandlung<br />
gleicher Sprachelemente (z. B. Stämme) auch dort, wo die Aussprache ungleich ist – z. B. <strong>der</strong><br />
Tag und des Tages, auch wenn man bei <strong>der</strong> Tag eine Auslautverhärtung des Stammes hört, bei<br />
des Tages nicht.<br />
• Grammatisches Prinzip: „Mach den grammatischen Aufbau deines Textes deutlich.“ O<strong>der</strong> etwas<br />
genauer: Teile von Texten können nach grammatischen Gesichtspunkten geglie<strong>der</strong>t und<br />
mit geeigneten Mitteln beson<strong>der</strong>s gekennzeichnet werden. Beispiel: Substantive werden (im<br />
Deutschen) großgeschrieben.<br />
Dieses Prinzip beeinflusst (neben <strong>der</strong> genannten Substantivgroßschreibung) folgende Bereiche<br />
entscheidend:<br />
o Getrennt- und Zusammenschreibung<br />
o Zeichensetzung<br />
o Großschreibung am Satzanfang<br />
• Semantisch-pragmatisches Prinzip: „Hebe für den Leser wichtige Textstellen hervor!“ Teile von<br />
Texten können nach inhaltlichen (semantischen) und kommunikativen (pragmatischen) Gesichtspunkten<br />
geglie<strong>der</strong>t und mit geeigneten Mitteln beson<strong>der</strong>s gekennzeichnet werden.<br />
Dieses Prinzip beeinflusst vor allem<br />
o die Großschreibung von Eigennamen und<br />
o die Großschreibung <strong>der</strong> Anredefürwörter bei einer höflich-distanzierten Anrede.<br />
• Homonymieprinzip: „Schreibe Ungleiches ungleich!“ Gleichlautendes mit unterschiedlicher Bedeutung<br />
kann in geschriebener Sprache unterschiedlich behandelt werden. Beispiele: Lid – Lied,<br />
Lerche – Lärche.<br />
1<br />
Diese Erläuterungen orientieren sich eng an: Gallmann, P. & Sitta, H. (2004). Handbuch Rechtschreiben. 5. Auflage.<br />
Zürich: Lehrmittelverlag.
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 3<br />
• Ästhetisches Prinzip: „Vermeide verwirrende Schriftbil<strong>der</strong>!“ Dieses Prinzip ist eine Art Reparaturprinzip,<br />
das dort eintritt, wo bei konsequenter Anwendung von Prinzipien (und dann: Regeln)<br />
irritierende Schriftbil<strong>der</strong> entstehen würden.<br />
Es wirkt u. a. bei<br />
o<br />
o<br />
den Satzzeichen (kein Schlusspunkt nach drei Auslassungszeichen) und<br />
<strong>der</strong> Regelung <strong>der</strong> Schreibung von Wörtern mit bestimmten Endungen (Seen statt Seeen).<br />
Wichtige Regeln <strong>der</strong> Rechtschreibung, mit denen rational umzugehen von den Schülerinnen und Schülern<br />
im Rahmen <strong>der</strong> schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in Deutsch erwartet werden muss, beziehen<br />
sich auf folgende Bereiche:<br />
1. Laut-Buchstaben-Zuordnung<br />
Laute <strong>der</strong> gesprochenen Sprache und Buchstaben <strong>der</strong> geschriebenen Sprache sind einan<strong>der</strong> nicht<br />
regellos zugeordnet. Falsche, fehlende, überflüssige Buchstaben können Ergebnis einer falschen Zuordnung<br />
sein. Beson<strong>der</strong>e Berücksichtigung in diesem Regelbereich erfährt die Beachtung des<br />
Stammprinzips, denn zu seiner Umsetzung kann mit Absicht vom Lautprinzip abgewichen werden.<br />
Die Laut-Buchstaben-Beziehungen werden von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen <strong>der</strong><br />
schriftlichen Reife- und Diplomprüfung meistens korrekt beachtet, also gekonnt, sodass es in diesem<br />
Bereich wohl nur zu einzelnen Fehlern kommen wird. Die Anwendung des Stammprinzips stellt die<br />
Schüler/innen vor wesentlich größere Herausfor<strong>der</strong>ungen, weil sie ein entsprechendes Maß an grammatischem<br />
Wissen voraussetzt (etwa das Erkennen von Morphemen und Wortfamilien).<br />
2. Groß- und Kleinschreibung<br />
Die zentrale Regel <strong>zur</strong> Großschreibung umzusetzen, wonach man Nomen großschreibt, bereitet den<br />
Schülerinnen und Schülern im Rahmen <strong>der</strong> Reife- und Diplomprüfung nur in vereinzelten Fällen<br />
Schwierigkeiten.<br />
Wesentlich häufiger werden die Schreiber/innen Probleme mit <strong>der</strong> Nominalisierung von Wörtern und<br />
Wendungen haben. Beurteilungsrelevant sollen hier nicht Spezialfälle wie Farb- und Sprachbezeichnungen<br />
o<strong>der</strong> durchgekoppelte Fügungen wie das Von-<strong>der</strong>-Hand-in-den-Mund-Leben sein, son<strong>der</strong>n<br />
Fälle, in denen klar wird, dass das Prinzip <strong>der</strong> Nominalisierung nicht beherrscht wird, wie etwa: beim<br />
Schreiben, ohne Zögern, mit Bedauern o<strong>der</strong> etwas Gutes.<br />
3. Markierung von Kurzvokalen<br />
Die Markierung <strong>der</strong> Vokalkürze ist durch die Regel zuverlässig erklärbar, dass auf einen betonten<br />
Kurzvokal immer zwei Konsonantenbuchstaben folgen. Verstöße sind daher eher selten.<br />
4. Markierung von Langvokalen<br />
Die Markierung des Langvokals erfolgt in unterschiedlicher Form.<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Den Standardfall stellt das Fehlen einer speziellen Markierung des Langvokals dar (z. B. wir, Tal,<br />
malen, Biber, dämlich, nämlich, Name ...).<br />
Relativ verlässlich ist in ursprünglich deutschen Wörtern die ie-Schreibung geregelt.<br />
Der Doppelvokal als Ausdruck <strong>der</strong> Vokallänge beschränkt sich auf eine nicht allzu große Gruppe<br />
von Wörtern (weniger als 100 Stämme).<br />
Überhaupt nicht geregelt ist die Verwendung des Dehnungs-hs.
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 4<br />
Am fehleranfälligsten sind die Schüler/innen sicher im zuletzt genannten Bereich. Beurteilungsrelevant<br />
sollten solche Verstöße vor allem dann sein, wenn sich Bedeutungsunterschiede ergeben (mahlen :<br />
malen).<br />
5. s-ss-ß-Schreibung sowie das/dass<br />
In diese Gruppe fallen die häufigsten Fehlschreibungen – unabhängig von Alter und Bildungsstand. Bei<br />
<strong>der</strong> Schreibung von ss vs. ß kann einerseits eine nicht aufgenommene Rechtschreibreform <strong>der</strong> Hintergrund<br />
sein, an<strong>der</strong>erseits aber auch die Tatsache, dass für viele Schreibende mit an<strong>der</strong>en Muttersprachen<br />
als Deutsch (aber auch bei vielen österreichischen Dialektsprecherinnen und -sprechern) Vokalkürze<br />
und Vokallänge keine distinktive Rolle spielen. Obwohl die das-/dass-Schreibung aus Gründen<br />
<strong>der</strong> Vereinfachung im Rahmen <strong>der</strong> Rechtschreibung bewertet wird, stellt die unterschiedliche Schreibung<br />
von Artikel/Demonstrativum und Konjunktion eigentlich ein grammatisches Problem dar.<br />
6. Getrennt- und Zusammenschreibung<br />
Die Schüler/innen haben wie die meisten Schreiber/innen mit diesem Regelbereich große Probleme,<br />
weil echte Regeln fehlen. Fehler sollten daher vor allem nur dann bewertet werden, wenn die Getrennt-<br />
bzw. Zusammenschreibung eine Bedeutungsdifferenzierung ausdrückt, wie etwa bei zu<br />
schauen und zuschauen. Im Gegensatz dazu spielt es kommunikativ keine Rolle, ob Not leiden in zwei<br />
Wörtern o<strong>der</strong> in einem geschrieben wird.<br />
7. Schreibung gebräuchlicher und fachsprachlich erfor<strong>der</strong>licher Fremdwörter<br />
Dieser Regelbereich bezieht sich auf Fremdwörter, <strong>der</strong>en korrekte Schreibung die Schüler/innen beherrschen<br />
sollten, weil sie entwe<strong>der</strong> als Bestandteil ihres Weltwissens angesehen werden dürfen, in<br />
<strong>der</strong> alltäglichen Kommunikation häufig vorkommen, wie etwa Engagement o<strong>der</strong> Regisseur, o<strong>der</strong> zum<br />
gängigen Fachvokabular des Deutschunterrichts gehören, wie Metapher o<strong>der</strong> Rhythmus.<br />
Grammatik (LBVO: <strong>Sprachrichtigkeit</strong>)<br />
Vorbemerkung: Bei <strong>der</strong> Korrektur von Schülertexten, die in Prüfungssituationen entstanden sind, ist das<br />
verständliche Bedürfnis <strong>der</strong> korrigierenden Lehrkraft groß, die grammatische Korrektheit eines Textes<br />
ausschließlich an „richtigem“ Sprachgebrauch zu messen, wie er in bestimmten Grammatiken dargestellt<br />
wird. Die Komplexität des Systems Sprache impliziert jedoch Unterschiede, manchmal sogar Wi<strong>der</strong>sprüche<br />
zwischen verschiedenen <strong>Bewertung</strong>en und Beurteilungen desselben sprachlichen Phänomens. Auch<br />
generationsbedingte Auffassungsunterschiede können sich ergeben – im Allgemeinen wertet man als<br />
Lehrer/in das als richtig, was man selbst als richtig kennengelernt hat. Wie die einzelnen Auflagen des<br />
Duden, Band 9 (Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch <strong>der</strong> sprachlichen Zweifelsfälle) aber deutlich<br />
zeigen, gibt es beträchtliche Verän<strong>der</strong>ungen in dem, was die Sprachgemeinschaft als „richtig und gut“<br />
einschätzt.<br />
Eine Konsequenz daraus für die korrigierende Lehrkraft muss daher sein, Sprache nicht nur als ein strenges<br />
Regelsystem zu sehen, das für die Schüler/innen bindenden Vorschrifts-Charakter hat, son<strong>der</strong>n auch<br />
als Funktionssystem, das sprachliche Äußerungen unter dem Aspekt ihrer kommunikativen Leistungen im<br />
Text versteht. Eine Ellipse in einem Text etwa per se als Fehler zu bewerten, weil sie einen unvollständigen<br />
Satz darstellt, ist im Sinn einer solchen Herangehensweise nicht vertretbar. Die Frage muss vielmehr<br />
sein, ob sie die Kommunikation zwischen Schreiber/in und Leser/in stört, ob ihr Anschluss an den vorangegangenen<br />
Satz korrekt ausgeführt ist und ob sie <strong>zur</strong> Textsorte passt (in einer Meinungsrede wird sie<br />
an<strong>der</strong>s zu bewerten sein als in einer Zusammenfassung).
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 5<br />
Die <strong>Sprachrichtigkeit</strong> <strong>der</strong> zu bewertenden und beurteilenden Arbeit wird auf drei Ebenen überprüft: auf<br />
<strong>der</strong> Ebene<br />
• des Wortes,<br />
• des Satzes,<br />
• des Textes.<br />
Folgende Bereiche werden auf den unterschiedlichen Ebenen als beson<strong>der</strong>s wichtig angesehen:<br />
• Wortebene<br />
<br />
<br />
Wortbildung<br />
Genus/Numerus/Kasus<br />
Wortbildung: Dazu gehören alle Verän<strong>der</strong>ungen, mit denen man neue Wörter bildet, etwa die Bildung<br />
eines neuen Wortes mit Hilfe eines Ablauts (gehen → Gang, binden → Band) bzw. einer Voro<strong>der</strong><br />
Nachsilbe (betteln → Bettler, heiter → Heiterkeit).<br />
Probleme bei <strong>der</strong> Wortbildung könnten sich am ehesten bei Schülerinnen und Schülern mit einer an<strong>der</strong>en<br />
Muttersprache als Deutsch zeigen.<br />
Genus: Jedes Nomen hat im Allgemeinen ein festes grammatisches Geschlecht (Genus). Dieses bestimmt<br />
Genus und Form von Artikeln, Pronomen und Adjektiven, die vor dem Nomen stehen o<strong>der</strong><br />
das Nomen ersetzen.<br />
Numerus: Damit ist beson<strong>der</strong>s die korrekte Bildung von Pluralformen mit Hilfe beson<strong>der</strong>er Endungen<br />
und/o<strong>der</strong> des Umlautes gemeint. Beispiele: Tag → Tage, Kalb → Kälber, Brunnen → Brunnen, Bus<br />
→ Busse.<br />
Kasus: Nomen werden im Satz in verschiedenen Kasus (Fällen) verwendet. Der Kasus kann zum Teil<br />
an bestimmten Endungen abgelesen werden, vor allem aber an Artikeln, Pronomen und Adjektiven,<br />
die vor dem Nomen stehen.<br />
Diese drei grammatischen Eigenschaften des Nomens werden u. a. deswegen in einer Kategorie zusammengefasst,<br />
weil in <strong>der</strong> Korrekturpraxis immer wie<strong>der</strong> Fälle auftreten, wo sie schwer auseinan<strong>der</strong>zuhalten<br />
sind. Beispiel: „Der Kranke sieht kein Grund, seinen Lebenswandel zu än<strong>der</strong>n.“ (kein: Kasusfehler?<br />
Falsches Geschlecht des Nomens?)<br />
• Satzebene<br />
<br />
<br />
Satzbau<br />
Kongruenz<br />
Satzbau: Dieser <strong>Bewertung</strong>sbereich bezieht sich auf die Fähigkeit <strong>der</strong> Schüler/innen, grammatisch<br />
korrekte und inhaltlich vollständige Sätze zu bilden.<br />
Als Verstöße gegen den korrekten Satzbau zählen die unübliche und den Sinn eines Satzes / einer<br />
Aussage verfälschende Wortstellung, die Auslassung notwendiger Elemente, falsche Satzkonstruktionen,<br />
Satzabbrüche und unpassende Präpositionen.<br />
Beispiele:<br />
<br />
Unpassende Wortstellung: „Er behauptet, dass die Firma noch heuer wirtschaftlichen Erfolg haben<br />
wird mit den ergriffenen Maßnahmen.“
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 6<br />
<br />
<br />
Auslassung notwendiger Elemente: „Die ergriffenen Maßnahmen helfen o<strong>der</strong> nur wenig.“ Die Negationspartikel<br />
nicht fehlt.<br />
Falsche Satzkonstruktion: „Die Regierung ergriff zwar Maßnahmen, weswegen sich die Besserung<br />
<strong>der</strong> wirtschaftlichen Lage in absehbarer Zeit einstellen wird.“<br />
Kongruenz: Die beson<strong>der</strong>e Beziehung des Subjekts zum Prädikat äußert sich in seiner Übereinstimmung<br />
mit <strong>der</strong> finiten Verbform des Prädikats in Person und Numerus.<br />
In diesem Bereich gibt es zahlreiche Spezialfälle. 2 Deswegen erscheint es angebracht, allfällige Verstöße<br />
tolerant zu behandeln. Sie werden nämlich selten im Unterricht thematisiert und stören die<br />
Kommunikation kaum.<br />
Beispiele:<br />
„Ein Drittel <strong>der</strong> Eingeladenen ist/sind gekommen.“<br />
„Zeit und Geld fehlt/fehlen mir <strong>zur</strong> Verwirklichung des Plans.“<br />
„We<strong>der</strong> <strong>der</strong> Lenker des Unfallautos noch sein Beifahrer wurde/wurden verletzt.“<br />
„Die Schuhfabrik ist die größte Arbeitgeberin/<strong>der</strong> größte Arbeitgeber <strong>der</strong> Region.“<br />
• Textebene<br />
<br />
<br />
Konnektoren/Verweise<br />
Tempus und Modus<br />
Konnektoren/Verweise: Sie verbinden Satzteile und Sätze. Hierher gehören Konjunktionen, Pronomen<br />
und (in einem eingeschränkten Sinn) Adverbien. Erstere stellen die Satzverknüpfungsmittel<br />
schlechthin dar, sowohl innerhalb von zusammengesetzten Sätzen als auch zwischen selbstständigen<br />
Sätzen. Die gleiche Rolle können Adverbien spielen, doch sind diese nicht allein auf die Aufgabe<br />
<strong>der</strong> Satzverknüpfung festgelegt.<br />
Probleme <strong>der</strong> Satzverbindung und <strong>der</strong> Verweise finden sich bei vielen Schreiberinnen und Schreibern,<br />
wobei beson<strong>der</strong>s Fälle, in denen die sprachlichen Mittel dem Sinn <strong>der</strong> Verknüpfung nicht entsprechen<br />
(z. B. falsche/fehlende aber, jedoch, auch …) häufig sehr störend sind. Es erscheint wichtig, darauf<br />
beson<strong>der</strong>es Augenmerk zu legen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die falsche Verwendung<br />
von bestimmtem und unbestimmtem Artikel.<br />
Beispiele:<br />
<br />
<br />
„Die Veranstaltung wird verschoben, obwohl sie krank geworden ist.“ (Inhaltlicher Kontext: Eine<br />
Fortbildungsveranstaltung an einer Pädagogischen Hochschule musste wegen <strong>der</strong> Erkrankung<br />
<strong>der</strong> Referentin abgesagt werden.)<br />
„Der Zieleinlauf einer Goldmedaillengewinnerin über die Marathondistanz begeisterte gestern die<br />
Massen im Stadion.“<br />
Tempus: Bei <strong>der</strong> Reife- und Diplomprüfung verfassen die Schüler/innen Texte, in denen etwas dargestellt<br />
wird o<strong>der</strong> in denen sie argumentieren, analysieren und interpretieren. Sie besprechen etwas,<br />
daher ist die Haupttempus-Form <strong>der</strong> zu verfassenden Texte das Präsens.<br />
Da die einzelnen Tempora nicht strikt auf eine Bedeutung festgelegt sind und da es im Deutschen eine<br />
consecutio temporum im strengen Sinne nicht gibt, stehen den Schreiberinnen und Schreibern<br />
dort mehrere Möglichkeiten offen, Vergangenes wie<strong>der</strong>zugeben (Präteritum und Perfekt). Das in Mit-<br />
2<br />
Siehe etwa die entsprechende Darstellung im Duden-Band Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch <strong>der</strong> sprachlichen<br />
Zweifelsfälle.
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 7<br />
tel- und Süddeutschland in den Dialekten und darüber hinaus in <strong>der</strong> gesprochenen Sprache insgesamt<br />
nicht verankerte Präteritum drückt aus, dass etwas vergangen ist, betont dabei eher dessen<br />
Verlauf, weniger seine Abgeschlossenheit. Diesen Aspekt, also das Ergebnis, streicht das Perfekt e-<br />
her hervor. Das Perfekt ist auch dann angebrachter, wenn das dargestellte Geschehen in die Gegenwart<br />
reicht.<br />
Modus: Von den vier Modus-Formen Indikativ, Konjunktiv I und II sowie Imperativ spielen bei <strong>der</strong> Korrektur<br />
vor allem Fragen <strong>der</strong> korrekten Anwendung von Indikativ und Konjunktiv in <strong>der</strong> indirekten Rede<br />
eine Rolle. Ein Problem hier ist, dass die Regeln für die Moduswahl in indirekter Rede über den ganzen<br />
deutschen Sprachraum gesehen sehr unterschiedlich sind, ein an<strong>der</strong>es, dass die strenge For<strong>der</strong>ung<br />
nach Konjunktiv in indirekter Rede immer mehr verblasst. Vor diesem Hintergrund sollten bei <strong>der</strong><br />
Korrektur Verstöße nur dann schwer gerechnet werden, wenn Äußerungen Dritter wie<strong>der</strong>gegeben<br />
werden und dies nicht eindeutig erkennbar ist.<br />
Wichtig: Wenn die indirekte Rede mit den Konjunktionen dass und ob o<strong>der</strong> einem Fragewort eingeleitet<br />
wird, kann auch in <strong>der</strong> indirekten Rede <strong>der</strong> Indikativ stehen, solange die „Indirektheit <strong>der</strong> Rede“ /<br />
die „Referiertheit“ etc. durch an<strong>der</strong>e sprachliche Mittel deutlich zum Ausdruck gebracht ist.<br />
Beispiele:<br />
„Er hat versprochen, dass er erscheinen wird/werde.“<br />
„Sie fragte, ob <strong>der</strong> Zug pünktlich kommt/komme.“<br />
(Beide Möglichkeiten sind jeweils korrekt.)<br />
Zeichensetzung<br />
• Satzendezeichen<br />
• Kommasetzung: grammatische Kommasetzung bei<br />
o Aufzählung von Wörtern und Wortgruppen<br />
o zusammengesetzten Sätzen<br />
zwischen Hauptsätzen<br />
zwischen Haupt- und Nebensatz<br />
unter bestimmten Bedingungen zwischen Hauptsatz und satzwertigen Infinitiv- und<br />
Partizipialgruppen<br />
• Anführungszeichen (v. a. bei Zitaten)<br />
Satzendezeichen: Mit Satzendezeichen sind Punkt, Rufzeichen und Fragezeichen gemeint, also diejenigen<br />
einfachen Satzzeichen, die das Ende eines Ganzsatzes/Gesamtsatzes markieren. Von Ganzsatz o<strong>der</strong> Gesamtsatz<br />
spricht man vor allem dort, wo ein komplexer Satz aus mehreren Teilsätzen (grammatischen<br />
Sätzen) besteht. Diese Teilsätze sind entwe<strong>der</strong> Hauptsätze (= Teilsätze, die keinem an<strong>der</strong>en Teilsatz<br />
grammatisch untergeordnet sind) o<strong>der</strong> Nebensätze (= Teilsätze, die einem an<strong>der</strong>en Teilsatz grammatisch<br />
untergeordnet sind). Natürlich kann man auch einen Satz, <strong>der</strong> lediglich aus einem einzigen (Haupt-)Satz<br />
besteht, als Ganzsatz/Gesamtsatz bezeichnen.<br />
Bei den Satzendezeichen unterscheidet man:<br />
– Der Punkt als Satzschlusszeichen ist gleichsam das neutralste Zeichen, er markiert eine gewöhnliche<br />
Aussage und Auffor<strong>der</strong>ungen ohne beson<strong>der</strong>en Nachdruck.
Erläuterungen <strong>zur</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>der</strong> <strong>normativen</strong> <strong>Sprachrichtigkeit</strong> im Rahmen <strong>der</strong> SRPD in Deutsch 8<br />
– Das Rufzeichen verleiht dem Inhalt des Gesamtsatzes einen beson<strong>der</strong>en Nachdruck, sodass es bei<br />
nachdrücklichen Behauptungen, Ausrufen, Auffor<strong>der</strong>ungen usw. gesetzt wird.<br />
– Das Fragezeichen kennzeichnet den Gesamtsatz als Frage.<br />
Beistrichsetzung in zusammengesetzten Sätzen: Ein zusammengesetzter Satz besteht aus mehreren<br />
Teilsätzen, Hauptsätzen und/o<strong>der</strong> Nebensätzen. Die Beistrichsetzung zwischen gleichrangigen (nebengeordneten)<br />
Teilsätzen (Hauptsätzen) ist in einer Reihe von Fällen freigestellt (vor und, o<strong>der</strong>, beziehungsweise,<br />
entwe<strong>der</strong> – o<strong>der</strong>, nicht/we<strong>der</strong> – noch). Da innerhalb eines Textes eine möglichst einheitliche Vorgangsweise<br />
wünschenswert ist, sollte den Schülerinnen und Schülern empfohlen werden, in solchen<br />
Fällen grundsätzlich einen Beistrich zu setzen. Dies gilt auch für jene Fälle <strong>der</strong> Beistrichsetzung bei Infinitiv-<br />
und Partizipialgruppen, wo die Beistrichsetzung freigegeben ist.<br />
Sinnstörend sind fehlende Beistriche vor allem dort, wo sie (z. B. im Fall eines eingeschobenen Nebensatzes)<br />
nicht o<strong>der</strong> nicht paarig gesetzt werden (d. h., wo ein obligatorischer Beistrich nicht gesetzt worden<br />
ist).<br />
Beistrichsetzung bei Wörtern und Wortgruppen: Mit <strong>der</strong> Beistrichsetzung zwischen gleichrangigen Wörtern<br />
und Wortgruppen kommen die Schülerinnen und Schüler erfahrungsgemäß gut zu Rande. Bei Verstößen<br />
gegen die Ausnahmen (kein Beistrich, wenn die Konjunktionen und, sowie, beziehungsweise,<br />
sowohl … als auch o<strong>der</strong> we<strong>der</strong> … noch die Teile <strong>der</strong> Aufzählung verbinden) ist Toleranz angebracht. Dies<br />
gilt vor allem für die Fälle <strong>der</strong> schwierigen Entscheidung, ob in einer Aufzählung zwei Adjektive vor einem<br />
Nomen gleichrangig sind o<strong>der</strong> nicht.<br />
Anführungszeichen: Fehlende Anführungszeichen bei wörtlich wie<strong>der</strong>gegebenen Textstellen verfälschen<br />
möglicherweise die Aussage eines Textes und stören den Lesefluss.