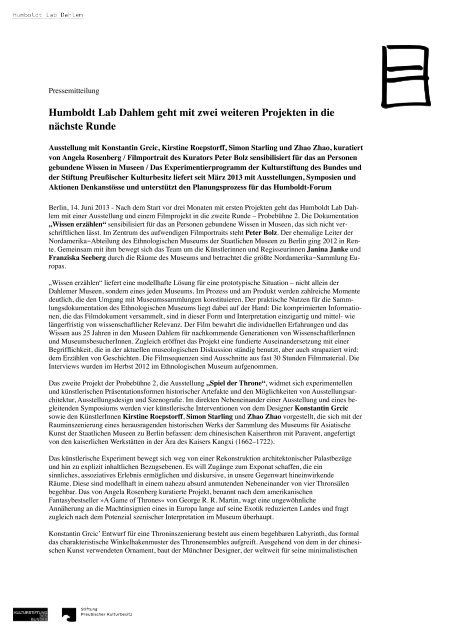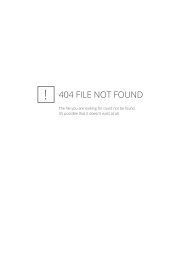Humboldt Lab Dahlem geht mit zwei weiteren Projekten in die ...
Humboldt Lab Dahlem geht mit zwei weiteren Projekten in die ...
Humboldt Lab Dahlem geht mit zwei weiteren Projekten in die ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Presse<strong>mit</strong>teilung<br />
<strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong> <strong>geht</strong> <strong>mit</strong> <strong>zwei</strong> <strong>weiteren</strong> <strong>Projekten</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong><br />
nächste Runde<br />
Ausstellung <strong>mit</strong> Konstant<strong>in</strong> Grcic, Kirst<strong>in</strong>e Roepstorff, Simon Starl<strong>in</strong>g und Zhao Zhao, kuratiert<br />
von Angela Rosenberg / Filmportrait des Kurators Peter Bolz sensibilisiert für das an Personen<br />
gebundene Wissen <strong>in</strong> Museen / Das Experimentierprogramm der Kulturstiftung des Bundes und<br />
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz liefert seit März 2013 <strong>mit</strong> Ausstellungen, Symposien und<br />
Aktionen Denkanstösse und unterstützt den Planungsprozess für das <strong>Humboldt</strong>-Forum<br />
Berl<strong>in</strong>, 14. Juni 2013 - Nach dem Start vor drei Monaten <strong>mit</strong> ersten <strong>Projekten</strong> <strong>geht</strong> das <strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong><br />
<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>er Ausstellung und e<strong>in</strong>em Filmprojekt <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>zwei</strong>te Runde – Probebühne 2. Die Dokumentation<br />
„Wissen erzählen“ sensibilisiert für das an Personen gebundene Wissen <strong>in</strong> Museen, das sich nicht verschriftlichen<br />
lässt. Im Zentrum des aufwendigen Filmportraits steht Peter Bolz. Der ehemalige Leiter der<br />
Nordamerika-Abteilung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berl<strong>in</strong> g<strong>in</strong>g 2012 <strong>in</strong> Rente.<br />
Geme<strong>in</strong>sam <strong>mit</strong> ihm bewegt sich das Team um <strong>die</strong> Künstler<strong>in</strong>nen und Regisseur<strong>in</strong>nen Jan<strong>in</strong>a Janke und<br />
Franziska Seeberg durch <strong>die</strong> Räume des Museums und betrachtet <strong>die</strong> größte Nordamerika-Sammlung Europas.<br />
„Wissen erzählen“ liefert e<strong>in</strong>e modellhafte Lösung für e<strong>in</strong>e prototypische Situation – nicht alle<strong>in</strong> der<br />
<strong>Dahlem</strong>er Museen, sondern e<strong>in</strong>es jeden Museums. Im Prozess und am Produkt werden zahlreiche Momente<br />
deutlich, <strong>die</strong> den Umgang <strong>mit</strong> Museumssammlungen konstituieren. Der praktische Nutzen für <strong>die</strong> Sammlungsdokumentation<br />
des Ethnologischen Museums liegt dabei auf der Hand: Die komprimierten Informationen,<br />
<strong>die</strong> das Filmdokument versammelt, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>die</strong>ser Form und Interpretation e<strong>in</strong>zigartig und <strong>mit</strong>tel- wie<br />
längerfristig von wissenschaftlicher Relevanz. Der Film bewahrt <strong>die</strong> <strong>in</strong>dividuellen Erfahrungen und das<br />
Wissen aus 25 Jahren <strong>in</strong> den Museen <strong>Dahlem</strong> für nachkommende Generationen von WissenschaftlerInnen<br />
und MuseumsbesucherInnen. Zugleich eröffnet das Projekt e<strong>in</strong>e fun<strong>die</strong>rte Ause<strong>in</strong>andersetzung <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Begrifflichkeit, <strong>die</strong> <strong>in</strong> der aktuellen museologischen Diskussion ständig benutzt, aber auch strapaziert wird:<br />
dem Erzählen von Geschichten. Die Filmsequenzen s<strong>in</strong>d Ausschnitte aus fast 30 Stunden Filmmaterial. Die<br />
Interviews wurden im Herbst 2012 im Ethnologischen Museum aufgenommen.<br />
Das <strong>zwei</strong>te Projekt der Probebühne 2, <strong>die</strong> Ausstellung „Spiel der Throne“, widmet sich experimentellen<br />
und künstlerischen Präsentationsformen historischer Artefakte und den Möglichkeiten von Ausstellungsarchitektur,<br />
Ausstellungsdesign und Szenografie. Im direkten Nebene<strong>in</strong>ander e<strong>in</strong>er Ausstellung und e<strong>in</strong>es begleitenden<br />
Symposiums werden vier künstlerische Interventionen von dem Designer Konstant<strong>in</strong> Grcic<br />
sowie den KünstlerInnen Kirst<strong>in</strong>e Roepstorff, Simon Starl<strong>in</strong>g und Zhao Zhao vorgestellt, <strong>die</strong> sich <strong>mit</strong> der<br />
Raum<strong>in</strong>szenierung e<strong>in</strong>es herausragenden historischen Werks der Sammlung des Museums für Asiatische<br />
Kunst der Staatlichen Museen zu Berl<strong>in</strong> befassen: dem ch<strong>in</strong>esischen Kaiserthron <strong>mit</strong> Paravent, angefertigt<br />
von den kaiserlichen Werkstätten <strong>in</strong> der Ära des Kaisers Kangxi (1662–1722).<br />
Das künstlerische Experiment bewegt sich weg von e<strong>in</strong>er Rekonstruktion architektonischer Palastbezüge<br />
und h<strong>in</strong> zu explizit <strong>in</strong>haltlichen Bezugsebenen. Es will Zugänge zum Exponat schaffen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong><br />
s<strong>in</strong>nliches, assoziatives Erlebnis ermöglichen und diskursive, <strong>in</strong> unsere Gegenwart h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>wirkende<br />
Räume. Diese s<strong>in</strong>d modellhaft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em nahezu absurd anmutenden Nebene<strong>in</strong>ander von vier Thronsälen<br />
begehbar. Das von Angela Rosenberg kuratierte Projekt, benannt nach dem amerikanischen<br />
Fantasybestseller »A Game of Thrones« von George R. R. Mart<strong>in</strong>, wagt e<strong>in</strong>e ungewöhnliche<br />
Annäherung an <strong>die</strong> Macht<strong>in</strong>signien e<strong>in</strong>es <strong>in</strong> Europa lange auf se<strong>in</strong>e Exotik reduzierten Landes und fragt<br />
zugleich nach dem Potenzial szenischer Interpretation im Museum überhaupt.<br />
Konstant<strong>in</strong> Grcic’ Entwurf für e<strong>in</strong>e Thron<strong>in</strong>szenierung besteht aus e<strong>in</strong>em begehbaren <strong>Lab</strong>yr<strong>in</strong>th, das formal<br />
das charakteristische W<strong>in</strong>kelhakenmuster des Thronensembles aufgreift. Ausgehend von dem <strong>in</strong> der ch<strong>in</strong>esischen<br />
Kunst verwendeten Ornament, baut der Münchner Designer, der weltweit für se<strong>in</strong>e m<strong>in</strong>imalistischen
Produkte gefeiert wird, e<strong>in</strong>e Art Schutzraum um das Objekt und nimmt da<strong>mit</strong> Bezug auf <strong>die</strong> verschachtelte<br />
Struktur ch<strong>in</strong>esischer Palastarchitektur. Um bis zum Kaiser zu gelangen, galt es, mehrere Gebäude und Höfe<br />
zu passieren oder adm<strong>in</strong>istrative Hürden zu überw<strong>in</strong>den. Ähnlich sieht es <strong>mit</strong> der Aufstellung des Throns <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Museum aus. Grcic’ <strong>Lab</strong>yr<strong>in</strong>th <strong>mit</strong> dem Titel „migong“ (ch<strong>in</strong>esisch: <strong>Lab</strong>yr<strong>in</strong>th) stellt dem Betrachter<br />
e<strong>in</strong> Autorität signalisierendes und auf Ordnung und Entschleunigung wirkendes H<strong>in</strong>dernis <strong>in</strong> den Weg – <strong>mit</strong><br />
der nachdrücklichen Aufforderung, sich h<strong>in</strong>ten anzustellen Diese Geste ist sowohl e<strong>in</strong>e Referenz an <strong>die</strong> hierarchischen<br />
Strukturen im Kaiserpalast als auch e<strong>in</strong> Verweis auf <strong>die</strong> Möblierung öffentlicher Orte. Sie kommentiert<br />
auf ironische und kritische Weise <strong>die</strong> im musealen Kontext oft überstrapazierte Metapher vom<br />
Schaffen e<strong>in</strong>es »breiten Zugangs« zum Exponat.<br />
Ursprünglich <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a erfunden und während der Kulturrevolution verboten, <strong>die</strong>nen Lampions dort nicht<br />
nur zur Dekoration. An Häusern angebracht, unterschiedlich e<strong>in</strong>gefärbt oder <strong>mit</strong> Schriftzeichen versehen,<br />
<strong>in</strong>formieren sie auch über Tod, Geburt oder gesellschaftliche Ereignisse. Die Lichtobjekte der dänischen<br />
Künstler<strong>in</strong> Kirst<strong>in</strong>e Roepstorff für <strong>die</strong> Probebühne 2 beziehen sich auf <strong>die</strong>se mediale Qualität. Mit<br />
Gerüsten aus Stahl, Holz oder Bambus und darüber gespannten Materialien wie Bänder oder Papier,<br />
werfen ihre Objekte Bilder <strong>in</strong> Form von Schatten <strong>in</strong> den Raum.<br />
Inspiriert von figurativen Motive aus der ch<strong>in</strong>esischen Mythologie wie Phönix, Drache, Schildkröte und<br />
Tiger folgt <strong>die</strong> Künstler<strong>in</strong> Aspekten der traditionellen, ch<strong>in</strong>esischen Fünf-Elemente-Lehre, <strong>die</strong> Gesetzmäßigkeiten<br />
dynamischer Prozesse erforscht, wie Werden, Wandlung und Vergehen. Auch bei der Ausleuchtung<br />
von Filmen ist das charakteristische, diffuse Licht von Lampions unersetzlich geworden, wo<br />
sogenannte „Ch<strong>in</strong>a Balls“ e<strong>in</strong>e Grundhelligkeit etablieren, <strong>die</strong> an <strong>die</strong> Lichtgestaltung <strong>in</strong> der Museumsarchitektur<br />
er<strong>in</strong>nert, bei der Tageslicht durch Milchglasoberlichter gleichmäßig auf <strong>die</strong> Exponate fällt. A-<br />
nalog dazu schaffen Roepstorffs Lampions e<strong>in</strong> atmosphärisches Licht, um das Thronensemble zu beleuchten<br />
und <strong>die</strong> dar<strong>in</strong> vorhandenen Figuren zu animieren und zu ergänzen.<br />
In Simon Starl<strong>in</strong>gs Video<strong>in</strong>stallation »Screen Screen« wird der Thron <strong>mit</strong> se<strong>in</strong>em eigenen Abbild konfrontiert.<br />
Dafür setzt sich der britische Turner Prize-Träger <strong>mit</strong> dessen reichen Intarsien ause<strong>in</strong>ander und<br />
der Art und Weise, wie <strong>die</strong>se das Licht reflektieren und modifizieren. Gleichzeitig nimmt se<strong>in</strong>e<br />
Installation <strong>die</strong> Anordnung von Thron und Paravent auf und reflektiert sie <strong>in</strong> der Beziehung zwischen<br />
Videoprojektor und Projektionsfläche sowie der gegenseitigen Abhängigkeit ihrer Wirkungsmacht. Die<br />
hier gezeigte Filmsequenz <strong>mit</strong> Detailaufnahmen der Oberflächenstruktur von Thron und Paravent<br />
erforscht <strong>in</strong> langsamen, be<strong>in</strong>ahe meditativen Kamerabewegungen <strong>die</strong> kunsthandwerkliche F<strong>in</strong>esse<br />
w<strong>in</strong>ziger Details. Mit bloßem Auge kaum erkennbar, er<strong>in</strong>nern bestimmte kle<strong>in</strong>teilige geometrische<br />
Strukturen an <strong>die</strong> Pixel von Computerbildern. Durch <strong>die</strong>se Analogie ergibt sich e<strong>in</strong>e überraschende Entsprechung<br />
zwischen Kunsthandwerk und Me<strong>die</strong>ntechnologie, aber auch zwischen traditionellen und<br />
modernen bildgebenden Verfahren <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a sowie deren Auswirkungen auf den Alltag. Begleitet wird<br />
<strong>die</strong> Installation von klassischer ch<strong>in</strong>esischer Musik, gespielt auf der Q<strong>in</strong>, dem traditionellen, ältesten<br />
ch<strong>in</strong>esischen Saiten<strong>in</strong>strument, <strong>in</strong>terpretiert vom zeitgenössischen Musiker Liang M<strong>in</strong>gyue.<br />
In der Installation des Ch<strong>in</strong>esen Zhao Zhao für das <strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> vers<strong>in</strong>kt der kaiserliche Thron<br />
schließlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sturzbach von rotem Wachs, der zu pittoresken Formen erstarrt ist. Während der<br />
Künstler <strong>die</strong> verme<strong>in</strong>tlich kunstvolle Form des Throns <strong>mit</strong> <strong>die</strong>ser be<strong>in</strong>ahe gewaltsamen Geste den Blicken<br />
des Betrachters entzieht, macht er gleichzeitig se<strong>in</strong>e eigene Ause<strong>in</strong>andersetzung und <strong>die</strong> se<strong>in</strong>er<br />
künstlerischen Umgebung <strong>mit</strong> <strong>die</strong>sem Relikt der ch<strong>in</strong>esischen Monarchie transparent. Auf e<strong>in</strong>em Bildschirm<br />
s<strong>in</strong>d se<strong>in</strong>e Überlegungen als E<strong>in</strong>träge auf dem Blog des Künstlers nachzulesen, neben Reaktionen<br />
und Kommentaren von Freunden, Bekannten und Museumsbesuchern. Dieser <strong>in</strong>teraktive, teils <strong>in</strong><br />
deutscher Übersetzung zugängliche Blog gibt Museumsbesuchern <strong>die</strong> Möglichkeit, sich an der Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
<strong>mit</strong> dem Umgang des musealen Artefakts zu beteiligen. Die Dynamik <strong>die</strong>ses demokratischen<br />
Austauschs steht <strong>in</strong> deutlichem Gegensatz zu der wie e<strong>in</strong>gefroren wirkenden Bewegung des roten<br />
Wachses und verweist e<strong>in</strong>erseits auf <strong>die</strong> kaiserliche Vergangenheit und deren gewaltsame Strukturen,<br />
wie auch auf <strong>die</strong> Stagnation demokratischer Bemühungen des aktuellen ch<strong>in</strong>esischen Regimes.
Dem »Spiel der Throne« g<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e Recherchephase voran, <strong>die</strong> sich <strong>mit</strong> der Inszenierung ch<strong>in</strong>esischer<br />
Kaiserthrone <strong>in</strong> Palästen, Museen und Sammlungen befasste. Im Rahmen der Ausstellung <strong>in</strong>formiert<br />
e<strong>in</strong>e Auswahl von Texten und Bildern über Architektur und Gestaltung kaiserlicher Palastanlagen <strong>in</strong><br />
Ch<strong>in</strong>a, <strong>die</strong> tra<strong>die</strong>rten kanonischen Vorgaben folgten, von denen aber nur wenige im Orig<strong>in</strong>al und am<br />
ursprünglichen Standort erhalten s<strong>in</strong>d. Doch während <strong>die</strong>se Paläste <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a das authentische Bild e<strong>in</strong>es<br />
Thronsaals wiedergeben, ist der historisch-architektonische Kontext <strong>in</strong> den Museen kaum zu ver<strong>mit</strong>teln.<br />
Stattdessen wählen <strong>die</strong> Aufstellungen der Throne oft karge, neutrale Annäherungen an den imperialen<br />
Rahmen. Auch <strong>die</strong> Präsentation des ch<strong>in</strong>esischen Kaiserthrons im Berl<strong>in</strong>er Museum für Asiatische Kunst<br />
wirkt deplatziert; se<strong>in</strong> architektonischer Kontext kann nicht rekonstruiert werden, da der ursprüngliche<br />
Aufstellungsort nicht mehr existiert. Die künstlerischen Interventionen von Konstant<strong>in</strong> Grcic, Kirst<strong>in</strong>e<br />
Roepstorff, Simon Starl<strong>in</strong>g und Zhao Zhao nehmen genau <strong>die</strong>se Ungewissheit zum Anlass, e<strong>in</strong>e alternative<br />
Thronsaalarchitektur zu entwerfen und da<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>en Zugang zu schaffen, der neue Möglichkeiten der<br />
Deutung und Ver<strong>mit</strong>tlung im Museum erschließt.<br />
<strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong><br />
Die derzeit wohl <strong>in</strong>teressanteste Möglichkeit, <strong>in</strong> das Planungsgeschehen für das zukünftige <strong>Humboldt</strong>-Forum<br />
E<strong>in</strong>blick zu nehmen, bietet das <strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong>: e<strong>in</strong> außergewöhnliches Experimentierprogramm<br />
der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dessen Resultate seit März 2013<br />
regelmäßig unter der Bezeichnung „Probebühne“ präsentiert werden. Warum „Probebühne“? Weil das<br />
<strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong> gezielt auf den großen Auftritt im <strong>Humboldt</strong>-Forums h<strong>in</strong>arbeitet. Rund 16 000 Quadratmeter<br />
Ausstellungsfläche stehen dort ab 2019 für <strong>die</strong> Sammlungen des Ethnologischen Museums und<br />
des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berl<strong>in</strong> zur Verfügung. Der besondere Rahmen<br />
des <strong>Humboldt</strong>-Forums legt dabei neue Formen der Museumsarbeit nahe. Das <strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong> reagiert<br />
auf den <strong>in</strong>haltlich wie zeitlich hohen Druck, dem <strong>die</strong> Museumsplanung hier ausgesetzt ist, <strong>mit</strong> der<br />
Möglichkeit praktischer Erprobung. Die „Probebühnen“ liefern <strong>mit</strong> Ausstellungen, Symposien und Aktionen<br />
Denkanstösse, Bilder und Materialien, <strong>die</strong> den Planungsprozess für das <strong>Humboldt</strong>-Forum unterstützen und<br />
für kreative Unruhe sorgen.<br />
www.humboldt-lab.de<br />
Ausstellungs<strong>in</strong>formationen <strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong> – Probebühne 2:<br />
Laufzeit: 18. Juni 2013 – 27. Oktober 2013<br />
Eröffnung: 16. Juni 2013, 11.30 Uhr<br />
Tag der offen Tür <strong>in</strong> den Museen <strong>Dahlem</strong>: 16. Juni 2013, 11.00 – 18.00 Uhr, E<strong>in</strong>tritt frei<br />
Symposium zu „Spiel der Throne“: 19. Oktober 2013<br />
Ausstellungsort: Museen <strong>Dahlem</strong>, Staatliche Museen zu Berl<strong>in</strong>, Lansstraße 8, 14195 Berl<strong>in</strong><br />
Öffnungszeiten: Di bis Fr 10.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sa und So 11.00 Uhr - 18.00 Uhr<br />
E<strong>in</strong>trittspreise: Bereichskarte Museen <strong>Dahlem</strong>: 8,- EUR, ermäßigt 4,- EUR<br />
Verkehrsverb<strong>in</strong>dung: U-Bahn U3 (<strong>Dahlem</strong>-Dorf)<br />
Pressekontakte:<br />
<strong>Humboldt</strong> <strong>Lab</strong> <strong>Dahlem</strong>: Achim Klapp, Projektbezogene Kommunikation, 030 - 25797016,<br />
<strong>in</strong>fo@achimklapp.de<br />
Kulturstiftung des Bundes: Friederike Tappe-Hornbostel, Leitung Kommunikation, 0345 - 2997120,<br />
presse@kulturstiftung-bund.de<br />
Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Stefan Müchler, Stabsstelle <strong>Humboldt</strong>-Forum, 030 - 266-42 2045,<br />
s.muechler@hv.spk-berl<strong>in</strong>.de