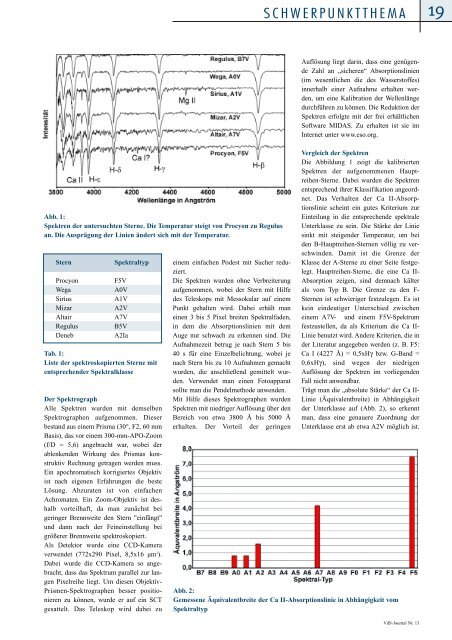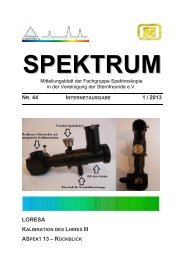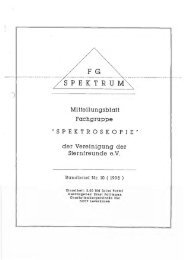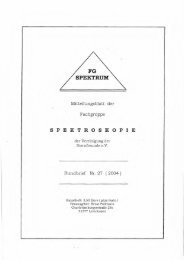Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen - FG ...
Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen - FG ...
Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen - FG ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SCHWERPUNKTTHEMA 19<br />
Abb. 1:<br />
Spektren <strong>der</strong> untersuchten Sterne. Die Temperatur steigt <strong>von</strong> Procyon zu Regulus<br />
an. Die Ausprägung <strong>der</strong> Linien än<strong>der</strong>t sich mit <strong>der</strong> Temperatur.<br />
Stern<br />
Procyon<br />
Wega<br />
Sirius<br />
Mizar<br />
Altair<br />
Regulus<br />
Deneb<br />
Spektraltyp<br />
F5V<br />
A0V<br />
A1V<br />
A2V<br />
A7V<br />
B5V<br />
A2Ia<br />
Tab. 1:<br />
Liste <strong>der</strong> spektroskopierten Sterne mit<br />
entsprechen<strong>der</strong> <strong>Spektralklasse</strong><br />
Der Spektrograph<br />
Alle Spektren wurden mit demselben<br />
Spektrographen aufgenommen. Dieser<br />
bestand aus einem Prisma (30°, F2, 60 mm<br />
Basis), das vor einem 300-mm-APO-Zoom<br />
(f/D = 5,6) angebracht war, wobei <strong>der</strong><br />
ablenkenden Wirkung des Prismas konstruktiv<br />
Rechnung getragen werden muss.<br />
Ein apochromatisch korrigiertes Objektiv<br />
ist nach eigenen Erfahrungen die beste<br />
Lösung. Ab<strong>zur</strong>aten ist <strong>von</strong> einfachen<br />
Achromaten. Ein Zoom-Objektiv ist deshalb<br />
vorteilhaft, da man zunächst bei<br />
geringer Brennweite den Stern "einfängt"<br />
und dann nach <strong>der</strong> Feineinstellung bei<br />
größerer Brennweite spektroskopiert.<br />
Als Detektor wurde eine CCD-Kamera<br />
verwendet (772x290 Pixel, 8,5x16 µm 2 ).<br />
Dabei wurde die CCD-Kamera so angebracht,<br />
dass das Spektrum parallel <strong>zur</strong> langen<br />
Pixelreihe liegt. Um diesen Objektiv-<br />
Prismen-Spektrographen besser positionieren<br />
zu können, wurde er auf ein SCT<br />
gesattelt. Das Teleskop wird dabei zu<br />
einem einfachen Podest mit Sucher reduziert.<br />
Die Spektren wurden ohne Verbreiterung<br />
aufgenommen, wobei <strong>der</strong> Stern mit Hilfe<br />
des Teleskops mit Messokular auf einem<br />
Punkt gehalten wird. Dabei erhält man<br />
einen 3 bis 5 Pixel breiten Spektralfaden,<br />
in dem die Absorptionslinien mit dem<br />
Auge nur schwach zu erkennen sind. Die<br />
Aufnahmezeit betrug je nach Stern 5 bis<br />
40 s für eine Einzelbelichtung, wobei je<br />
nach Stern bis zu 10 Aufnahmen gemacht<br />
wurden, die anschließend gemittelt wurden.<br />
Verwendet man einen Fotoapparat<br />
sollte man die Pendelmethode anwenden.<br />
Mit Hilfe dieses Spektrographen wurden<br />
Spektren mit niedriger Auflösung über den<br />
Bereich <strong>von</strong> etwa 3800 Å bis 5000 Å<br />
erhalten. Der Vorteil <strong>der</strong> geringen<br />
Auflösung liegt darin, dass eine genügende<br />
Zahl an „sicheren“ Absorptionslinien<br />
(im wesentlichen die des Wasserstoffes)<br />
innerhalb einer Aufnahme erhalten werden,<br />
um eine Kalibration <strong>der</strong> Wellenlänge<br />
durchführen zu können. Die Reduktion <strong>der</strong><br />
Spektren erfolgte mit <strong>der</strong> frei erhältlichen<br />
Software MIDAS. Zu erhalten ist sie im<br />
Internet unter www.eso.org.<br />
Vergleich <strong>der</strong> Spektren<br />
Die Abbildung 1 zeigt die kalibrierten<br />
Spektren <strong>der</strong> aufgenommenen Hauptreihen-Sterne.<br />
Dabei wurden die Spektren<br />
entsprechend ihrer Klassifikation angeordnet.<br />
Das Verhalten <strong>der</strong> Ca II-Absorptionslinie<br />
scheint ein gutes Kriterium <strong>zur</strong><br />
Einteilung in die entsprechende spektrale<br />
Unterklasse zu sein. Die Stärke <strong>der</strong> Linie<br />
sinkt mit steigen<strong>der</strong> Temperatur, um bei<br />
den B-Hauptreihen-<strong>Sternen</strong> völlig zu verschwinden.<br />
Damit ist die Grenze <strong>der</strong><br />
Klasse <strong>der</strong> A-Sterne zu einer Seite festgelegt.<br />
Hauptreihen-Sterne, die eine Ca II-<br />
Absorption zeigen, sind demnach kälter<br />
als vom Typ B. Die Grenze zu den F-<br />
<strong>Sternen</strong> ist schwieriger festzulegen. Es ist<br />
kein eindeutiger Unterschied zwischen<br />
einem A7V- und einem F5V-Spektrum<br />
festzustellen, da als Kriterium die Ca II-<br />
Linie benutzt wird. An<strong>der</strong>e Kriterien, die in<br />
<strong>der</strong> Literatur angegeben werden (z. B. F5:<br />
Ca I (4227 Å) = 0,5xHγ bzw. G-Band =<br />
0,6xHγ), sind wegen <strong>der</strong> niedrigen<br />
Auflösung <strong>der</strong> Spektren im vorliegenden<br />
Fall nicht anwendbar.<br />
Trägt man die „absolute Stärke“ <strong>der</strong> Ca II-<br />
Linie (Äquivalentbreite) in Abhängigkeit<br />
<strong>der</strong> Unterklasse auf (Abb. 2), so erkennt<br />
man, dass eine genauere Zuordnung <strong>der</strong><br />
Unterklasse erst ab etwa A2V möglich ist.<br />
Abb. 2:<br />
Gemessene Äquivalentbreite <strong>der</strong> Ca II-Absorptionslinie in Abhängigkeit vom<br />
Spektraltyp<br />
VdS-Journal Nr. 13