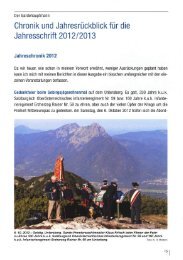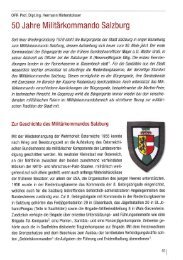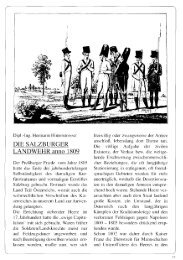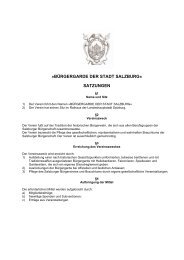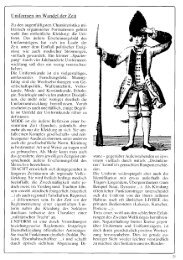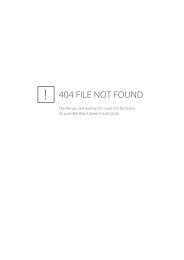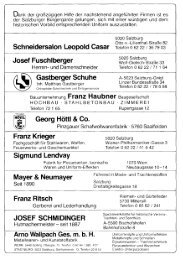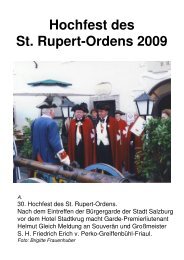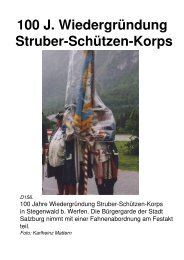Die Morzger Hügel und Schloss Montfort 39 - Bürgergarde der Stadt ...
Die Morzger Hügel und Schloss Montfort 39 - Bürgergarde der Stadt ...
Die Morzger Hügel und Schloss Montfort 39 - Bürgergarde der Stadt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reinhard Medicus<br />
<strong>Die</strong> <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> <strong>und</strong> <strong>Schloss</strong> <strong>Montfort</strong><br />
<strong>Die</strong> beiden eng heiehan<strong>der</strong> liegenden Teile des <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>s befinden sich, wie<br />
allen Salzbtrrgern bekannt, "ttisclten<br />
<strong>der</strong> Ortscln/i Morzg utd dent <strong>Schloss</strong> Mont-<br />
.fort. Sehr vielmehr ist allerdings einent Gutteil <strong>der</strong> Salzburger über diese bewaldeten<br />
Hägel nicllt bekannt. Des ist wirklich ein Grtntl, die heiden nuhe gelegenen urul<br />
doch entfernten <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>n in diesem Bein'ag inhaltlit'lt nciher zu bringen.<br />
Beide Hägel sind etv,o 31 nt hoch. Wirkliche Berge sincl tlas nicht, eher <strong>Hügel</strong>,<br />
o<strong>der</strong> in ober bat'risch-salzburger M<strong>und</strong>art ,,Bit'ltl" o<strong>der</strong> ,,Bergl". Nach SüdenJindet<br />
sich an oberen Rorul des Hanges ein tlurchkruferules Bantl eines kleinen Felsabbruches.<br />
Auclt die Osthänge sind steil, tkrgegen sind die sonstigen AblLänge<br />
JIuclrcr geneigt.<br />
<strong>Die</strong> Namen <strong>der</strong> <strong>Hügel</strong><br />
<strong>Die</strong> beiden <strong>Hügel</strong>, auch Goiser Bergl<br />
o<strong>der</strong> Goiser Bichl genannt, heißen aus<br />
dem Blickwinkel des nahen Dorfes<br />
gesehen seit Jahrh<strong>und</strong>erten Vor<strong>der</strong>er<br />
<strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>, im Osten gelegen <strong>und</strong><br />
Hinterer <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> im Westen. Es<br />
wird vermutet, dass <strong>der</strong> Name Goiser<br />
Bergl romanischen Ursprungesei, <strong>und</strong><br />
sich von COLLIS = <strong>Hügel</strong> ableitet. Es<br />
ist aber auch schlüssig, den Namen des<br />
Berges von den Herrn von Gols, den<br />
ersten bekannten Besitzern des Montfolterhofes<br />
herzuleiten. In den frühen<br />
Urk<strong>und</strong>en hießen ja die Erhebungen<br />
regelmäI3ig,,Golser" Berg.<br />
<strong>Die</strong> Fossilien <strong>der</strong> <strong>Hügel</strong><br />
<strong>Die</strong> höchstgelegenen Teile des <strong>Morzger</strong><br />
<strong>Hügel</strong>s sind aus Mergel <strong>und</strong> Mergel<br />
kalken aufgebaut, die auf alten Konglomeraten<br />
aufliegen. Alle diese Gesteine<br />
stammen aus <strong>der</strong> Oberkleide-Zeit. <strong>Die</strong><br />
feinkörnigen Mergel wurden damals in<br />
ein warmes flaches Meeresbecken über<br />
Flussschotter abgelagert. <strong>Die</strong> feinkörnige<br />
Schicht ist reich an Fossilien <strong>und</strong><br />
enthält neben Ammoniten verschiedenste<br />
Schnecken, Muscheln <strong>und</strong> Einzelkorallen<br />
aber auch Reste von Tintenflschen,<br />
Secigeln, Kalkröhrenwürmern,<br />
Moostierchen <strong>und</strong> Schwämmen, sehr<br />
selten auch von Krebsen, Fischen <strong>und</strong><br />
P1'lanzen. Der Geologe EBERHARD<br />
FUGGER hat 1885 die gleichartigen<br />
Schichten in Glaneg gut untersucht.<br />
<strong>Die</strong>ser Salzburger Ehrenbürger, <strong>der</strong> von<br />
1842 bis l9l9 lebte, war übrigens langjähriger<br />
Vorstand des Salzburger Museums<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft für Salzburger<br />
Landesk<strong>und</strong>e. Gerade im Westen<br />
sind winzige Fossilien, etwa Muschelkrebse,<br />
Kalkalgen <strong>und</strong> einzellige Foraminiferen<br />
gut erhalten. An herumliegenden<br />
Steinen lassen sich hier viele Fossil-<br />
Querschnitte beobachten.<br />
<strong>39</strong>
<strong>Die</strong> <strong>Hügel</strong> in <strong>der</strong> Bronzezeit<br />
Seit viertausend Jahren diente die Hangterrassenkante<br />
in Morzg als Wohnort<br />
<strong>und</strong> Begräbnisstätte. Hier war das Salzachufer<br />
leicht eneichbar, die trockene<br />
Terrasse ermöglichte gute landwirtschaftliche<br />
Erträge. Vermutlich haben in<br />
vorrömischer <strong>und</strong> römischer Zeit auch<br />
fischreiche Altwässer bis an die Terassenkante<br />
heran gereicht. Der <strong>Morzger</strong><br />
<strong>Hügel</strong> bot einen guten Überblick auf<br />
Feinde <strong>und</strong> die Quellen am Bergfuß versorgten<br />
den Ort ausreichend mit klarem<br />
Trinkwasser<br />
l9l I tand <strong>der</strong> Gastwirt <strong>und</strong> Heimrtforscher<br />
Leo Brandauer am nördlichen<br />
Unterhang des vor<strong>der</strong>en Berges zahlreiche<br />
Tonscherben <strong>und</strong> teilte dies dem<br />
damals unermüdlichen Landesarchäologen<br />
Manin Hell mit. Er legtc mit sciner<br />
Frau Lina bald die F<strong>und</strong>stelle frei: Es<br />
zeigte sich, dass <strong>der</strong> Boden des Platzes<br />
in einem Durchmesser von 25 m bis 75<br />
cm tief mit angebrannten Tierknochen<br />
<strong>und</strong> tausenden Gefäßscherben bedeckt<br />
war. Uber 8 m'Scherben, von kleinen<br />
Töpfchen bis zu Urnengefäßen, Schüsseln<br />
<strong>und</strong> Schalen wurden gesammelt.<br />
Schla
Elrcnrli ge s Stal lge bä ude i n I n ne re n<br />
Bild:R Mcdicus<br />
verwandte Lodronsche bzw. Montlbrtischen<br />
Nachkommen fallen. 1746 folgte<br />
Der <strong>Montfort</strong>er Stall<br />
Anton Graf <strong>Montfort</strong> <strong>und</strong> später Hieronymus<br />
Graf Lodron. 1791 veräuf3er-<br />
langem auch ein Wirtschaftstrakt mlt<br />
Zum <strong>Schloss</strong> Montibrt gehörte seit<br />
te <strong>der</strong> Letztgenannte das <strong>Schloss</strong> um Stallgebäude. <strong>Die</strong> Fortschrittlichkeit des<br />
12.000 Gulden an Fürsterzbischof Colloredo,<br />
<strong>der</strong> zugleich die alte Gr<strong>und</strong>herr Zeit Fürsterzbischofs Colloredo Iobt im<br />
landwirtschaftlichen Hofgebäudes zur<br />
schaft des Klosters tilgte. Damals bekam<br />
das <strong>Schloss</strong> als Jagdschlosserdentlich<br />
,,A/s Muster.liir aLle Viehst(ille<br />
Jahr 1800 Friedrich Graf Spaur außerorne<br />
heutige Fassadengestalt. Danach war kann seine innere Konstruktion angepriesen<br />
werden. Aus sleinernen Bah-<br />
das Gut im ärarischen Eigentum <strong>der</strong> k.k.<br />
Monarchie <strong>der</strong> Gutshof wurde dabei ren, in die Jrtsches Quellwasser zur<br />
dem jeweiligen Kreishauptmann (das Tränkung tutd Stiubenmg gelettet werdcn<br />
konn. crgrai.fcn dic Kühe ihrc gtrt<br />
entspricht etwa dem heutigen Landeshauptmann)<br />
zur Nutzung überlassen, gev,tihlte, mit Salz gemengte Nahrung,<br />
bis schließlich Graf Arco den <strong>Montfort</strong>erhof<br />
samt Umgebung kaufte, den da-<br />
Lic hen G ew ö I be angeb rac ht en Öffnun -<br />
die atrs dem ober dem schönen ltingnach<br />
1893 Sophie Gräfin Moy de Sons gen bey je<strong>der</strong> Futterzeit geworkn wird.<br />
erbte. <strong>Die</strong> Nachkommen <strong>der</strong> Gräfin Licht, ges<strong>und</strong>e immer sich erneuernde<br />
blieben dann bis vor wenigen Jahren LtrJi <strong>und</strong> seltene Reinlichkeit schenken<br />
Eigentümer, bis dann die Familie Flick dem dort gentihrten Melkvieh Ges<strong>und</strong>heit".<br />
das <strong>Schloss</strong> erwarb.<br />
42
Der alte Stall besitzt kantige, dreireihig den Barockgarten in <strong>der</strong> Gestalt elner<br />
in 6 hintereinan<strong>der</strong> liegenden Fel<strong>der</strong>n herrschaftlichen Allee, die quer durch<br />
angeordneten Säulen, über denen etn Acker lühne. Hinter.liesen Ac[ern folgte<br />
ein schmaler Waldstreifen, in dem<br />
Platzelwölbe mit Gurtbögen elrichtet<br />
ist. lm alten Stallgebäude, das vor 1995 sich bei<strong>der</strong>seits <strong>der</strong> Wegachse die Alleebäume<br />
fortsetzten. Hinter dem Wald-<br />
eine Tischlerei gemietet hatte, soll nun<br />
ein privates Fahrzeugmuseum eingerichtet<br />
werden. Der östliche, einst vom schmaler Wildacker an. Sowohl Waldstreil'en<br />
schloss nun ein langer <strong>und</strong><br />
Stall zuerst von einem Weg getrennte streifen als auch Wildacker waren rn<br />
Holzteil aus <strong>der</strong> Zeit nach 1800 wurde ihrer Längserstreckung zur Kirche von<br />
später mit dem Stall zu einem geschlossenen<br />
Bau mit einheitlichem Dach zuchetwald<br />
führte <strong>und</strong> führt die Garlen-<br />
Anif hin ausgerichtet. Im Großen Eisammengeschlossenachse<br />
sehließlich rl\ Durchschlrg rlcit<br />
in den mit verschwiegenen Wresen<br />
aufgelockerlen Wald hinein <strong>und</strong> reichte<br />
Der <strong>Montfort</strong>er Barockgarten einst fast bis zur Berchtesgadener Straße.<br />
<strong>Die</strong>ser ..Mont fofler Durchschlag" ist<br />
<strong>Schloss</strong> Montfoft besaß, wie alle großen<br />
Landschlösser Salzburgs dieser Zeit chen Rand dicscs Waldes befand sich<br />
bis heute groljteils erhaltcn. Am südli-<br />
einst cinen großen, geometrisch angelegten<br />
Barockgarten, <strong>der</strong> hier nach Süd-<br />
Kapelle, die nach einem Sturmschaden<br />
cine kleine, nach Anif hin blickende<br />
westen blickte. Der von einer Mauer rur etlichen Jrhren grol3tcils crneuerl.<br />
umgebene Gafien war etwa 150 m Iang hcutc inmitten einer Wiesenlandschaft<br />
<strong>und</strong> 50 m breit <strong>und</strong> besal3 einen mittigcn steht. Nur die vier umgebenden Linden<br />
erinnern noch an den früheren<br />
Hauptweg mit drei hintereinan<strong>der</strong> liegenden<br />
Springbrunnen. Beidelseits des Waldsaum. Im Süden umrahmtc <strong>der</strong><br />
Hauptweges befänden sich von Zier bis heute bestehende Wiesenweg den<br />
gehölz eingerahmte Beete. Es ist dabei Brrockgartcn. jm Norden begrenzlei<br />
nicht unwahrscheinlich, dass Colloredo ne Wegachse nach Westen den Barockgarten<br />
<strong>und</strong> den angrenzenden Land-<br />
in den Beeten dicses ,,Musterbauern<br />
hofes" neben Zierblumen auch Feldfrüchte<br />
zog. Im Nolden schloss an den<br />
schaftsgafien.<br />
zcntra len Cartenteil ein geplleglcr.<br />
schmal dreieckiger Garten an. In den Das Jagdschlösschen Gloriette<br />
Jahrzehnten vor 1900 wurde die\er einsl<br />
eindmcksvolle große Garten samt dem Aussichtswarten, oft Belve<strong>der</strong>e o<strong>der</strong><br />
umgebenden Landschallsgafien schrittweise<br />
aufgelöst.<br />
bischöflicher Zeit im Raum um Salz-<br />
Gloriette genannt, gab es in fürsterzburg<br />
nicht wenige. Das Belve<strong>der</strong>e vor<br />
dem <strong>Schloss</strong> Kleßheim, stand als kleincs<br />
turmafiiges Gebäude etwa dort, wo<br />
Der <strong>Montfort</strong>er Landschaftsgarten<br />
sich heute <strong>der</strong> östliche Parkplatz des<br />
<strong>Die</strong> Großc Gartenachse r er'längerle ein't Europarks befindet. Eine,,Gloriette"
Gnßer Tei(h .tri.t.hen .len Mua+(t Hiig(lr:,<br />
befand sich im späten 18. Jahrh<strong>und</strong>crt Festung Hohensalzburg <strong>und</strong> die dahinter'<br />
rm Südrrnd de' Hellbrunner Berges. licgcnde Altstadt hin. Colloredo konntc<br />
Das Schlösschen Belve<strong>der</strong>e von Markus seinen Jagdgästen hicr nicht ohne Stolz<br />
Sittikus erbaut, schaute im Hellbrunner ,,seire" Residenzstadt <strong>und</strong> <strong>der</strong>cn umgebende<br />
Landschaft in voller Anmut zei-<br />
Schlos'palk vom Rand Jes Kulrirricnberges<br />
auf die Salzachnie<strong>der</strong>ung. Ein gen. Das idyllische Dorl Morzg mit sciner<br />
Kirchc war im Blick nach Osten<br />
Schlös"chen Belve<strong>der</strong>e bereieherle ein.l<br />
cine Aussicht im bertihmten Aigner zum Greif'en nahc. Nach Westen führte<br />
Park. Das von Fürstbischof Colloredo vom JagdschJösschen cine Sichtverbindung<br />
durch den Wald in Richtung zum<br />
erbaute Jagdschlösschen auf dem Goiser'<br />
Bergl mit seinem Aussichtsturm befand Glanegger <strong>Schloss</strong> <strong>und</strong> ins damals noch<br />
sich am höchsten Punkt des Nordausläufers<br />
des Hinteren Goiscrberges. <strong>Die</strong>se Nach Stiden bestand einst cine schna-<br />
kaum kultivierte Leopoldskroner Moos.<br />
Gloriette stand auf einem etwa zwcl le Sichtachse in Form eines ctwa l0 m<br />
Meter hohen Sockel mit quadratischembrcitcn Walddurchschlages, <strong>der</strong> dcn<br />
Cl<strong>und</strong>lisr mit l2 tn SeitenlänEe. bis /ur Blick auf die Kirche Anif frei gab.<br />
Spitze <strong>der</strong> Latene war es dabei cbcnfalls<br />
12 m hoch. Das im Erclgeschosshcute<br />
im Wald gut erkennbar.<br />
<strong>Die</strong>se Sichtachse ist irr Ansätzen bis<br />
massiv gebaute Schlösschen besaß im<br />
Gr<strong>und</strong>riss eine Fläche von 9 x 9 m. <strong>der</strong> <strong>Die</strong> <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> als Jagdrevier<br />
hölzerne Aussichtsraum drrüber mit<br />
tlem allseitigen Aussichtsbalkon lag 5 m Colloretlo war wie seinc Vorgänger als<br />
über dem Cebäudeluß. DJ\ lurmrllige Fürstcn ein leidensc haftl ichel Jäger.<br />
Schlösschcn blickte einst genau aruf die Der Hellbrunncr <strong>Schloss</strong>park zwischen
Wasserpartere <strong>und</strong> Kalvarienberg war<br />
ebenso fürstliches Jagdrevier wie die<br />
dortigen Auen. Noch wichtiger als<br />
Jagdrevier waren aber <strong>der</strong> <strong>Morzger</strong><br />
<strong>Hügel</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> umgebende Eichetwald.<br />
Seine beliebteste <strong>und</strong> weitaus gröI3te<br />
Jagd besaß Colloredo schließlich im<br />
Blühnbachtal. <strong>Die</strong> Hofjagden gehörten<br />
zum repräsentativen Hofprotokoll, ja<br />
sie waren Höhepunkte des höllschen<br />
Lebens <strong>und</strong> offenbarten die fürstlichcn<br />
Hoheitsrechte. <strong>Die</strong> Jagd wu eine sicht<br />
bare Form <strong>der</strong> Besitzergreifung des untergebenen<br />
Landes.<br />
Damit in den höfischen Jagden genug<br />
Wild erlegt werden konnte, mussten die<br />
landesherrlichen Jäger die Wildbestände<br />
ausreichend hegen <strong>und</strong> ptlegcn. Zur'<br />
Zeit Colloredos bestanden daher am<br />
<strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> <strong>und</strong> dessen Umgebung<br />
zahlreiche Jagdeinrichtungen . Zu diesen<br />
gehörtcn viele kleine, in den Wald<br />
cingcstreute Wildäcker <strong>und</strong> Srlzu iesen.<br />
<strong>Die</strong>se Wildäcker <strong>und</strong> Wiesenblößen<br />
besaßen weidmännische Namen, etwa<br />
Große <strong>und</strong> Kleine Prunftwiese". <strong>Die</strong><br />
Wiese bei <strong>der</strong> Gloriette war ebcntalls<br />
ein ,,Salzwiesel", auf dem das Wild<br />
mit Lecksteinen verwöhnt wurde. Der<br />
schmale <strong>und</strong> lange Wildacker am Ostrand<br />
des Eichetwaldes besitzt bis heute<br />
den Namen ,,Schießstätte". Zu Colloredos<br />
Zeiten <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> Monar<br />
chie wurde hier nicht nur auf kapitalc<br />
Hirsche, son<strong>der</strong>n wohl auch auf<br />
Übungsziele geschossen. Heute steht bei<br />
<strong>der</strong> Schießstätte noch immer ein Hochstand.<br />
Es muss nicht näher erwähnt werden,<br />
dass die vielen Achsen <strong>und</strong> Waldschneisen<br />
des Montfbfier Landschatisgartens<br />
auch für die Jagd eine hohe<br />
Bedeutung besaf3en.<br />
<strong>Die</strong> historische Forstnutzung des<br />
<strong>Morzger</strong> Eichetwaldes<br />
Der Wald um den <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> war<br />
vor etlichen Jahrh<strong>und</strong>ertenoch wesentlich<br />
mit den typischen Moonand-Eichen<br />
bcstockt (,,Eichet"). Später versuchte<br />
man ungeachtet <strong>der</strong> waidmännischen<br />
Hege diesen Eichenmischwald in ertragreiche<br />
Fichtenlbrste umzuwandeln. Solche<br />
Fichtenreinbestände mit geometrisch<br />
angelegten Rückewegen bezeich<br />
nete man nicht selten als ,,Remisen",<br />
ein Wort, das eigentlich ,,Rückführung"<br />
bedeutet. Wir kennen das Wort in <strong>der</strong><br />
Bedeutung eines Wagenschuppens, in<br />
dem die rückgefühften Wägen <strong>und</strong> Lokomotiven<br />
aufbewahrt werden. Der<br />
tbrstmännischc Bcgritf Remise hat sich<br />
dann otl'ensichtlich weiter zum Begriff<br />
,,Maiß"(auch Mais) weiterentwickelt.<br />
Mit diesem Begriff sind daher in fürsterzbischöfl<br />
icher Zeit keineswegs Maisäcker<br />
zu verstehen, sondem alte Schlagflächen,<br />
auf denen man ,,Fichtenäcker"<br />
anlegte. Der Wald südlich des <strong>Montfort</strong>er<br />
Durchschlages hief3 nach 1800 etwa<br />
Napoleons Maiß, jcner nördlich davon<br />
Große Maiß. <strong>Die</strong> Benennung des<br />
Waldes nach dem seinerzeitigen erbarmungslosen<br />
Eroberer Napoleon, dessen<br />
Truppen in Salzburg einst so schrecklich<br />
wüteten, war in napoleonischer Zeit<br />
wohl nicht ganz freiwillig. Auch Tei<br />
le des Kleßheimer Eichetwaldes beim<br />
Flughafen hießen einst übrigens ,,Napoleon<br />
Mais".<br />
Der heutige Wald <strong>der</strong> <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong><br />
Der Großteil des Waldes am <strong>Morzger</strong><br />
<strong>Hügel</strong> ist auch heute von Fichten bedeckt.<br />
<strong>Die</strong> mächtigsten <strong>und</strong> ältesten
Fichten stocken dabei am Westabhang fäch vermutet, dass zumindest <strong>der</strong> große<br />
des Hinteren Golserbergls. Sie sind über Teich einst ein Fischteich gewesen seln<br />
40 m hoch <strong>und</strong> bis 180 Jahre alt. Nach könnte. Auf Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> historischen Pläne<br />
ist davon auszugehen, dass die Teiche<br />
Angaben des Fößters Henr Ing. Kufi<br />
Schlechtleitner, Förster <strong>der</strong> Moyschen um o<strong>der</strong> nach I900 angelegt wurden.<br />
Gutsverwaltung, würde eine solche Fich <strong>Die</strong> Anlage eines lichtbedürftigen Fischteiches<br />
inmitten eines schattigen Wal-<br />
te gefällt 15 bis 18 Raummeter Holz<br />
ergeben. <strong>Die</strong> vereinzelt in den Wald dcs. dcr hicl zwischcn 1900 <strong>und</strong> 1920<br />
eingestreuten Douglasien zeugen von aufgeforstet wurde. scheint aber un<br />
Forstversuchen früherer Generatiorrer. wahrscheinlich. Es ist daher eher anzunehmen,<br />
dass die Teiche etwa als Eisteichc<br />
tür cin nahe geJegenes Gasthaus<br />
Am steilen Südabhang stockt ein von<br />
Eschen dominierter Waldbestand, in den genutzt waren. Dulch die jüngsten<br />
auch Winterlinde, Rotbuche. Hainbuche.<br />
Bergulme. Spitzahorn <strong>und</strong> Berg-<br />
heute wie<strong>der</strong> deutlich mehr Licht. Damit<br />
Schlägerungen erhält <strong>der</strong> Teich übrigens<br />
ahom eingestreut sind. Am tlachgründig-trockenen<br />
Rand um den südlichen für unsere seltenen Amphibienarten, vor<br />
wird <strong>der</strong> Teich wie<strong>der</strong> als Lebensraum<br />
Felsabbruch wächst ein Bestan<strong>der</strong> sehr allem den Grasfrosch, den Springfrosch,<br />
genüg'amen Rotkielern. die :tn diesem den Bergmolch <strong>und</strong> die Erdköte erhebmageren<br />
Standort die Konkurrenz beschatten<strong>der</strong><br />
Laubbäume nicht fürchten Raum beson<strong>der</strong>s häufig waren. Gerade<br />
Iich aufgeuertet. die früher in diesem<br />
müssen. Der steile Südabhang besitzt die Erdkröten bevölkern nun in <strong>der</strong><br />
durch seine vielfältige Strukturen <strong>und</strong> Laichzeit wie<strong>der</strong> sehr zahlreich die Teiche.<br />
Am U1-er gedeihen Sumpfdotterblu-<br />
Felsen auch eine hohe tierökologische<br />
Bedeutung. Hier ist auch nicht wenig men, Waldsimsen <strong>und</strong> Bittere Schaumkräuter'.<br />
Der Graureiher steht gerne hier<br />
wertvolles Totholz vorhanden, einlach<br />
weil Einzelstämme dort schlecht zu <strong>und</strong> selten besucht auch einmal ein Eisvogel<br />
die Teiche.<br />
bringen sind. Am Süd- <strong>und</strong> Osthang<br />
blüht nicht selten die schmucke Türkenb<strong>und</strong>lilie.<br />
Liebe Leser, besucht auch ihl einmal<br />
diesen verträumten Flecken im Süden<br />
<strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Salzburg. Erwan<strong>der</strong>t die Htigel<br />
<strong>Die</strong> Teiche zwischen den <strong>Morzger</strong> <strong>und</strong> ihre Umgebung, sucht nach den<br />
<strong>Hügel</strong>n<br />
F<strong>und</strong>amcnten des Jagdschlösschens, besucht<br />
die Teiche <strong>und</strong> den <strong>Montfort</strong>er<br />
Unklar bleibt, wie Iange die Teiche am Durchschlag o<strong>der</strong> erforscht die kreidezeitlichen<br />
Fossilicn. Auch ein Blick auf<br />
Nordrand des <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>s schon bestehcn.<br />
Der größte Teich ist heute noch das alte <strong>Schloss</strong>, den dazugehörigen<br />
immer 'tattliche 1.500 m' groß. zuei Stall. die Kapelle <strong>und</strong> nicht zuletzt die<br />
weitere nächstgelegen etwa 150 m2 bzw. reizrolle Llnd'chllt im Siiden des einstigen<br />
Bauemdorfes Morzg lohnt sich.<br />
100 m2, während <strong>der</strong> Kleinste mit 50 m'?<br />
schon in <strong>der</strong> Größenordung eines größeren<br />
Gartenteiches liegt. Es wurde mehr-<br />
Dr. Reinhard Medicus<br />
41