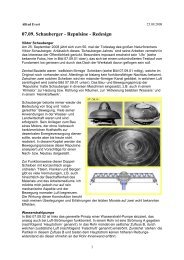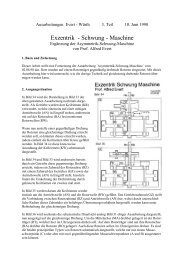Würth - Schwungscheiben - Maschine - Evert
Würth - Schwungscheiben - Maschine - Evert
Würth - Schwungscheiben - Maschine - Evert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7<br />
Während eines Umlaufs auf dem Zahnkranz führt der Rotor zwei Umdrehungen aus. Bei zwei<br />
Umdrehungen des Rotors führen normalerweise alle Massepunkte die Wegstrecke von 2 * 2*R*Pi aus,<br />
bei R=1 also etwa 12.6. Hier allerdings laufen alle Massepunkte einmal durch den Durchmesser des<br />
Zahnkranzes hin und einmal zurück, also acht mal R, also einen Weg von 8.<br />
Beim Beschleunigen muß also lediglich die Arbeit von 8<br />
(mkp) erbracht werden. Im System stecken aber damit<br />
12.6 (mkp), also ein Faktor von 1.57. Möglicherweise<br />
sind diese durch innen angeordnete Abnahme wie oben<br />
beschrieben heraus zu holen in der Bremsphase.<br />
12. Optimale Trägheitsrichtung<br />
Eine theoretische Erklärung hierfür könnte folgende sein.<br />
Jedes System strebt den Zustand geringsten Widerstandes<br />
an. Dieses wird hier erreicht, indem anstelle von Kreisbahnen,<br />
einrollenden oder ausrollenden Spiralbahnen oder<br />
auch obiger Ellipsen hier jeder Massepunkt den kürzest<br />
möglichen Weg geht, lediglich eine Gerade.<br />
Zum andern erfordert jede Änderung der Trägheitsrichtung<br />
Energie. Beim Rad leistet diese Arbeit die<br />
Speiche durch Zug und sie erscheint nach außen nicht, da<br />
vollkommen symmetrisch. Bei vorigen asymmetrischen<br />
Bahnverläufen ergaben sich jedoch unterschiedliche<br />
Drehmomente und -Richtungen. Hier allerdings muß das<br />
System keine Arbeit zur Umlenkung der Trägheitsrichtung<br />
leisten. Jede positive und negative Beschleunigung erfolgt in gleiche Richtung. Die Umkehr<br />
der Richtung erfolgt senkrecht zum Radius, drückt also auf das Rotorlager bzw. den Zahnkranz am<br />
Ende jeder Bahn.<br />
13. Überhang<br />
Man könnte nun aber auch die Massepunkte noch<br />
weiter außen am Rotor anbringen. In Bild 17 ist in<br />
etwas verkleinertem Maßstab wiederum obiges Übersetzungsverhältnis<br />
dargestellt. Der große Kreis stellt<br />
die Umlaufbahn (den Zahnkranz) dar, der kleine<br />
Kreis einen Rotor mit halb so großem Radius. Zwei<br />
korrespondierende Massepunkte sind hervorgehoben,<br />
verbunden durch die dicke Linie. Die kleinen Kreis<br />
bzw. Linien kennzeichnen die Bewegung dieser<br />
Massepunkte bzw. Verbindungslinie.<br />
Die Massepunkte beschreiben wiederum eine langgestreckte<br />
elliptische Bahn. An den langen flachen<br />
Streckenabschnitten ist die Trägheitsrichtung nahezu<br />
identisch mit dem weiteren Bahnverlauf. Nur an den<br />
spitzen Enden findet die wesentliche Umlenkung<br />
statt. Die über die Ellipse hinausragenden Linien<br />
zeigen das jeweilige Trägheitsmoment an. Die<br />
Trägheitsmomente korrespondierender Massepunkte<br />
sind dabei stets unterschiedlich hinsichtlich Richtung<br />
wie Kraft.