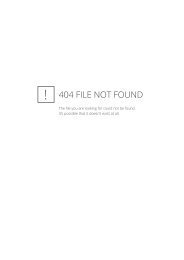Innovationen nutzen – Das Neue glaubhaft vermitteln ... - ffpress.net
Innovationen nutzen – Das Neue glaubhaft vermitteln ... - ffpress.net
Innovationen nutzen – Das Neue glaubhaft vermitteln ... - ffpress.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Innovationen</strong> <strong>nutzen</strong> <strong>–</strong> <strong>Das</strong> <strong>Neue</strong> <strong>glaubhaft</strong> <strong>vermitteln</strong><br />
Von Stephan Fink,<br />
Vorstand Fink & Fuchs PR AG<br />
Alles ist Innovation<br />
"Deutschland braucht <strong>Innovationen</strong>", mahnten zuletzt die Protagonisten des vergangenen<br />
Wahlkampfs auf ihren Parteibühnen. Bereits 2004 rief Gerhard Schröder das "Jahr der<br />
<strong>Innovationen</strong>" aus und gründete die Initiative "Partner für <strong>Innovationen</strong>", in der sich über 200<br />
namhafte Unternehmen, Verbände und Institutionen mit einem Ziel zusammenschlossen:<br />
Deutschland im globalen Wettbewerb wieder an die Spitze zu katapultieren. Aktuell einigten<br />
sich die koalierenden Kräfte sogar darauf, ab 2010 einen jährlichen Zuschuss von drei Prozent<br />
des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung bereitzustellen, um <strong>Innovationen</strong><br />
zu fördern. Innovation wohin man blickt!<br />
Doch was macht <strong>Innovationen</strong> eigentlich aus, warum stoßen sie in der Bevölkerung<br />
zunehmend auf Widerstand und welche Aspekte muss erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit bei<br />
ihrer Vermittlung berücksichtigen? Zu diesen Fragen führten kürzlich Gabriele Fischer (brand<br />
eins), Peter Gerdemann (IBM) und Dieter Schweer (HVB) auf dem zweiten<br />
Kommunikationskongress in Berlin eine lebhafte Diskussion unter dem Titel: "<strong>Das</strong> <strong>Neue</strong><br />
<strong>nutzen</strong>: PR für <strong>Innovationen</strong>." (Live Stream Video unter: www.Kommunikationskongress.de)<br />
Bereits die Trendumfrage "Innovate 2004" von Prof. Claudia Mast (Uni Hohenheim) und<br />
Ansgar Zerfaß (Medienentwicklung Baden-Württemberg) fand heraus, dass bei der<br />
professionellen Vermittlung von <strong>Innovationen</strong> noch reichlich Luft nach oben ist, da aktuell<br />
nur ein Prozent aller Artikel über Unternehmen Neuheiten thematisiert (Buchtipp: "<strong>Neue</strong><br />
Ideen erfolgreich durchsetzen", Mast/Zerfaß, F.A.Z. Institut -<br />
www.innovationskommunikation.de).<br />
Was aber lässt sich nun unter dem Begriff "Innovation" subsumieren? Ist es die Satellitengestützte<br />
Lkw-Maut, ein Chip, der im Supermarkt im Vorbeigehen die Preise unserer<br />
Einkäufe addieren lässt oder die Erfindung der Megaperls? Was macht diese Entwicklungen<br />
aus?<br />
Auffällig bei der Berichterstattung neuer (meist technischer) Entwicklungen ist die<br />
Konzentration auf Funktionen und Features, was nicht selten epische Züge annimmt. Welchen<br />
konkreten Nutzen aber ein neues Produkt dem Verbraucher bringt, bleibt oft im Nebel. "Es<br />
gibt sicher auch Produktlösungen für Probleme, die es ohne die entsprechenden Produkte<br />
nicht gegeben hätte", formulierte es Peter Gerdemann auf dem Kommunikationskongress.<br />
Unscharf bleibt oftmals auch die gesellschaftliche und soziale Dimension, die sich mit den<br />
Auswirkungen bzw. den Perspektiven einer <strong>Neue</strong>rung auseinandersetzt.<br />
Deutlich wird dies am Beispiel des RFID-Chips. Funktional betrachtet lässt sich auf<br />
minimaler Fläche ein Maximum an Informationen speichern, die jederzeit an einen<br />
Empfänger gesendet werden können. Der Nutzen liegt unter anderem im Beschaffungswesen,<br />
da durch die permanente Erfassung und Verarbeitung der Informationen Bestellvorgänge voll<br />
automatisiert werden können. Gesellschaftlich betrachtet kann die Möglichkeit, mit diesem
Chip Kaufgewohnheiten zu verfolgen, den Verlust von Privatsphäre bedeuten. Diese ist<br />
jedoch ein hohes Gut und unter dem Begriff der informationellen Selbstbestimmung sogar<br />
durch unser Grundgesetz geschützt. Nur wer <strong>Innovationen</strong> in dieser Vielschichtigkeit begreift,<br />
kann kommunikative Hürden bei deren Einführung in den Markt überhaupt verstehen und<br />
darauf gezielt Einfluss nehmen.<br />
Barrieren der Kommunikation<br />
Laut einer Untersuchung des Instituts Allensbach steht heute nur noch ein Drittel der<br />
Menschen in Deutschland dem technischen Fortschritt positiv gegenüber. In den sechziger<br />
Jahren begeisterten sich immerhin noch 80 Prozent der Deutschen für den Fortschritt.<br />
Dementsprechend negativ ist der Begriff "Innovation" heute besetzt. Welches sind die<br />
Ursachen für diese ablehnende Haltung? Gabriele Fischer beschrieb im Rahmen der<br />
Diskussion drei elementare Gründe für eine tief wurzelnde Angst vor <strong>Innovationen</strong>.<br />
Den Menschen wohnt eine grundlegende Angst vor jedweder Veränderung inne. "Alles soll<br />
so bleiben wie es ist. Dabei krallen sich die Menschen an dem fest, was gerade noch gerettet<br />
werden konnte", meint Fischer. Ein deutlicher Beleg dafür sind die zögerlichen Reformen in<br />
Deutschland, die immer noch mehr von Besitzstandswahrung als von Aufbruchstimmung<br />
zeugen. Als zweite Ursache lässt sich die Tendenz erkennen, dass der Fortschritt rückblickend<br />
meist kritisch mit der Frage "Was hat uns dieses oder jenes gebracht?" von den Bürgern<br />
beäugt wird. Die Medien tun hierbei ihr Übriges. Bereits im Vorfeld einer Entwicklung<br />
betonen diese häufig eher die Gefahren, als dass sie mögliche Chancen aufzeigen. Dahinter<br />
steckt ein einfaches aber wirkungsvolles und zugleich schützendes Prinzip: Ist das Produkt am<br />
Markt erfolgreich, wird die verantwortungsvolle Rolle der Medien dahingehend betont, dass<br />
man ja frühzeitig auf die Risiken hingewiesen und somit positiven Einfluss auf die<br />
Entwicklung genommen habe. Scheitert eine Innovation dagegen in der Umsetzung, wurde<br />
dies ja frühzeitig prophezeit, so Fischer.<br />
Der dritte wesentliche Grund für Innovationsfeindlichkeit liegt schlicht in der Überforderung<br />
der Menschen. Der amerikanische Wissenschaftler Edward Teller umschrieb dies einmal mit<br />
den Worten: "Die Menschen wollen einfach nicht mehr wissen." Angesichts der heutigen<br />
Informationsdichte fällt es nicht schwer, das zu glauben.<br />
Neben diese gesellschaftlichen Faktoren treten Probleme, die die Kommunikationsarbeit der<br />
Pressesprecher und Journalisten selbst betreffen. Laut der eingangs erwähnten Umfrage<br />
"Innovate 2004", die unter Journalisten und PR-Verantwortlichen durchgeführt wurde, wird<br />
das Thema <strong>Innovationen</strong> noch stiefmütterlich behandelt. Über die wachsende Bedeutung<br />
dieser Disziplin sind sich mithin zwei Drittel der Befragten einig. Ursachen mangelhafter<br />
Berichterstattung werden zum einen in der nicht mediengerechten Aufbereitung durch die<br />
Öffentlichkeitsarbeiter gesehen. Diese wiederum konstatieren mangelndes Fachwissen ihrer<br />
Gegenüber in den Redaktionen. Kritisch wird darüber hinaus die inflationäre Verwendung des<br />
Begriffs "Innovation" gesehen. Daneben scheint der interne Informationsfluss zwischen<br />
Marketing und PR einerseits und den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen andererseits<br />
in den Unternehmen noch verbesserungsbedürftig. Häufig verstehen die "PR-Menschen" ihre<br />
eigenen Produkte nicht und können deren Funktions- und Wirkungsweise nur ungenügend der<br />
breiten Öffentlichkeit <strong>vermitteln</strong>.<br />
Akzeptanz schaffen<br />
Wie lässt sich nun ein Klima erzeugen, in dem die Menschen den <strong>Innovationen</strong> nicht mit<br />
Ablehnung oder gar Feindseligkeit begegnen? "<strong>Innovationen</strong> werden dann als gut eingestuft,<br />
wenn sie das Leben der Menschen verbessern und beispielsweise Arbeit schaffen", meint
Fischer. <strong>Das</strong> gilt in Zeiten von Stellenabbau und Massenarbeitslosigkeit mehr denn je. Zum<br />
anderen wollen die Menschen die Dinge verstehen, die man Ihnen "verkaufen" möchte. Nur<br />
so lassen sich Ängste und Unsicherheiten abbauen. Technische Details überfordern jedoch<br />
den Laien und schaffen zusätzliches Misstrauen. Darüber hinaus ist ein ehrlicher, offener<br />
Dialog gefordert, der auch den Preis bestimmter <strong>Neue</strong>rungen nicht verschweigt. Unternehmen<br />
müssen weg vom reinen Sendungsbewusstsein und die Menschen einbeziehen, die letztlich<br />
von den <strong>Neue</strong>rungen "betroffen" sind. Zu oft wenden sich die Kommunikatoren nur an die<br />
Fachpresse und lassen dabei die wichtigste Frage oft unbeantwortet: Was bedeutet es für den<br />
Nutzer am Ende der Kette? "Innovation ist nicht die Entwicklung selbst, sondern das, was sie<br />
für mich verändert", warf daher ganz richtig eine Kongressteilnehmerin in die<br />
Diskussionsrunde ein. <strong>Innovationen</strong> sollten darüber hinaus im gesamtwirtschaftlichen Kontext<br />
dargestellt werden, also weg vom Produkt hin zur gesellschaftlichen (sozialen) Dimension,<br />
die weiter führende Prozesse und Zukunftsperspektiven aufzeigt.<br />
Herausforderungen für die PR<br />
Welche Erkenntnisse sind nun aus diesen Überlegungen für die PR-Arbeit zu ziehen?<br />
Betrachtet man zunächst die internen Anforderungen an das Unternehmen, so lässt sich der<br />
Dialog zwischen Entwicklern und Kommunikationsbeauftragten durchaus verbessern, indem<br />
letztere frühzeitig in die Entwicklungsphase einbezogen werden. Die PR-Profis werden ihrer<br />
Übersetzerfunktion nur dann wirklich gerecht, wenn sie Funktionsweise und Wirkung ihrer<br />
Neuheiten umfassend kennen. Daher sollten sie sich als Teil des Systems verstehen, für das<br />
sie sprechen und den Dialog zu den Entwicklungsabteilungen suchen, statt nur von außen<br />
einwirken zu wollen. Peter Gerdemann spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer<br />
Holschuld der Pressesprecher. Des Weiteren sind die eigenen Mitarbeiter für die <strong>Innovationen</strong><br />
zu gewinnen. Sind sie erst von den Produktentwicklungen überzeugt, tragen sie diese<br />
Überzeugung auch nach außen, so der Ansatz von Dieter Schweer. Die oft verkürzte<br />
Darstellung in den Medien ließe sich ebenfalls durch frühzeitiges Einbinden der Journalisten<br />
vermeiden. Eine Produktions- oder Laborbesichtigung, bei der auch der Chefentwickler zu<br />
Wort kommen darf und den Journalisten zusätzliche Informationen gibt, wäre ein möglicher<br />
Ansatz.<br />
Auf der anderen Seite geht es darum, den Menschen bzw. Verbrauchern den Nutzen einer<br />
Erfindung sichtbar und erfahrbar zu machen. Dazu muss man sie dort abholen, wo sie für sich<br />
einen Vorteil durch den Einsatz des Produktes erkennen. Dieter Schweer nennt es<br />
"persönliche Betroffenheit." <strong>Das</strong> erreicht man jedoch nicht mit seitenlangen technischen<br />
Details, sondern mit anschaulichen Beispielen und Geschichten zum Produkt. Dies setzt<br />
wiederum eine verständliche Sprache voraus, um die Komplexität des Themas zu reduzieren.<br />
Ein sich wandelnder Altersaufbau in unserer Gesellschaft (siehe Oktober-Ausgabe der<br />
PRoFILE) unterstreicht dieses Erfordernis. Aufgrund dessen wird in Zukunft die<br />
Bevölkerungsgruppe der über 45-Jährigen stärker einbezogen werden müssen. Diese bringt<br />
jedoch ein anderes Technikverständnis mit, als die Gruppe der 20-Jährigen. Eine wachsende<br />
Rolle spielt auch die soziale Verantwortung von Unternehmen, die mittlerweile unter dem<br />
Kürzel "CSR" (Corporate Social Responsibility) verschlagwortet ist. Unternehmen sollten<br />
dort, wo es Sinn macht, ihre Entwicklungen exemplarisch in den Dienst der Gesellschaft<br />
stellen. Damit ist keine selbstlose Hilfe gemeint. Vielmehr geht es "bei gesellschaftlichem<br />
Engagement von Unternehmen um Wertschöpfung für die Gesellschaft <strong>–</strong> aber auch um<br />
Nutzen für das Unternehmen", meinte der Sozialethiker Professor André Habisch kürzlich in<br />
der F.A.Z. Darüber hinaus wirkt dieses Engagement identitätsstiftend bei den eigenen<br />
Mitarbeitern, die <strong>–</strong> wie oben gesehen <strong>–</strong> ihre Überzeugung letztlich wieder nach Außen tragen.
Kontakt:<br />
Fink & Fuchs Public Relations AG<br />
Stephan Fink<br />
Berliner Straße 164<br />
D-65205 Wiesbaden<br />
Telefon: 06 11 - 74 13 10<br />
E-Mail: stephan.fink@ffpr.de<br />
www.ffpr.de