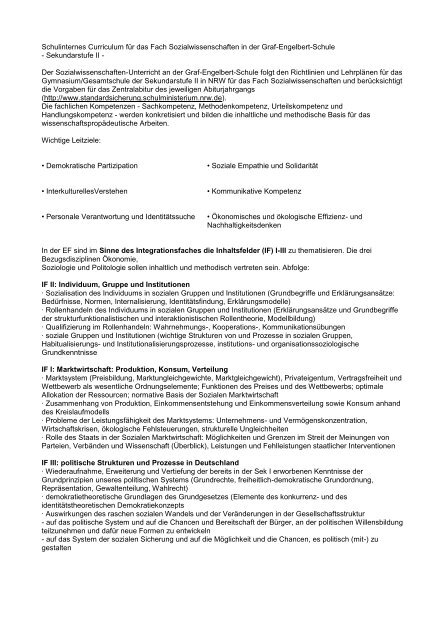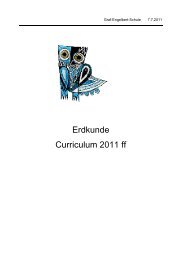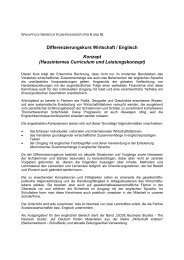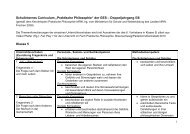Schulinternes Curriculum - Graf-Engelbert-Schule
Schulinternes Curriculum - Graf-Engelbert-Schule
Schulinternes Curriculum - Graf-Engelbert-Schule
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schulinternes</strong> <strong>Curriculum</strong> für das Fach Sozialwissenschaften in der <strong>Graf</strong>-<strong>Engelbert</strong>-<strong>Schule</strong><br />
- Sekundarstufe II -<br />
Der Sozialwissenschaften-Unterricht an der <strong>Graf</strong>-<strong>Engelbert</strong>-<strong>Schule</strong> folgt den Richtlinien und Lehrplänen für das<br />
Gymnasium/Gesamtschule der Sekundarstufe II in NRW für das Fach Sozialwissenschaften und berücksichtigt<br />
die Vorgaben für das Zentralabitur des jeweiligen Abiturjahrgangs<br />
(http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de).<br />
Die fachlichen Kompetenzen - Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz und<br />
Handlungskompetenz - werden konkretisiert und bilden die inhaltliche und methodische Basis für das<br />
wissenschaftspropädeutische Arbeiten.<br />
Wichtige Leitziele:<br />
• Demokratische Partizipation<br />
• Soziale Empathie und Solidarität<br />
• InterkulturellesVerstehen<br />
• Kommunikative Kompetenz<br />
• Personale Verantwortung und Identitätssuche<br />
• Ökonomisches und ökologische Effizienz- und<br />
Nachhaltigkeitsdenken<br />
In der EF sind im Sinne des Integrationsfaches die Inhaltsfelder (IF) I-III zu thematisieren. Die drei<br />
Bezugsdisziplinen Ökonomie,<br />
Soziologie und Politologie sollen inhaltlich und methodisch vertreten sein. Abfolge:<br />
IF II: Individuum, Gruppe und Institutionen<br />
· Sozialisation des Individuums in sozialen Gruppen und Institutionen (Grundbegriffe und Erklärungsansätze:<br />
Bedürfnisse, Normen, Internalisierung, Identitätsfindung, Erklärungsmodelle)<br />
· Rollenhandeln des Individuums in sozialen Gruppen und Institutionen (Erklärungsansätze und Grundbegriffe<br />
der strukturfunktionalistischen und interaktionistischen Rollentheorie, Modellbildung)<br />
· Qualifizierung im Rollenhandeln: Wahrnehmungs-, Kooperations-, Kommunikationsübungen<br />
· soziale Gruppen und Institutionen (wichtige Strukturen von und Prozesse in sozialen Gruppen,<br />
Habitualisierungs- und Institutionalisierungsprozesse, institutions- und organisationssoziologische<br />
Grundkenntnisse<br />
IF I: Marktwirtschaft: Produktion, Konsum, Verteilung<br />
· Marktsystem (Preisbildung, Marktungleichgewichte, Marktgleichgewicht), Privateigentum, Vertragsfreiheit und<br />
Wettbewerb als wesentliche Ordnungselemente; Funktionen des Preises und des Wettbewerbs; optimale<br />
Allokation der Ressourcen; normative Basis der Sozialen Marktwirtschaft<br />
· Zusammenhang von Produktion, Einkommensentstehung und Einkommensverteilung sowie Konsum anhand<br />
des Kreislaufmodells<br />
· Probleme der Leistungsfähigkeit des Marktsystems: Unternehmens- und Vermögenskonzentration,<br />
Wirtschaftskrisen, ökologische Fehlsteuerungen, strukturelle Ungleichheiten<br />
· Rolle des Staats in der Sozialen Marktwirtschaft: Möglichkeiten und Grenzen im Streit der Meinungen von<br />
Parteien, Verbänden und Wissenschaft (Überblick), Leistungen und Fehlleistungen staatlicher Interventionen<br />
IF III: politische Strukturen und Prozesse in Deutschland<br />
· Wiederaufnahme, Erweiterung und Vertiefung der bereits in der Sek I erworbenen Kenntnisse der<br />
Grundprinzipien unseres politischen Systems (Grundrechte, freiheitlich-demokratische Grundordnung,<br />
Repräsentation, Gewaltenteilung, Wahlrecht)<br />
· demokratietheoretische Grundlagen des Grundgesetzes (Elemente des konkurrenz- und des<br />
identitätstheoretischen Demokratiekonzepts<br />
· Auswirkungen des raschen sozialen Wandels und der Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur<br />
- auf das politische System und auf die Chancen und Bereitschaft der Bürger, an der politischen Willensbildung<br />
teilzunehmen und dafür neue Formen zu entwickeln<br />
- auf das System der sozialen Sicherung und auf die Möglichkeit und die Chancen, es politisch (mit-) zu<br />
gestalten
QI (11/12) 1. Halbjahr<br />
IF IV: Wirtschaftspolitik<br />
Grundzüge der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und Ansätze zur umwelt- und wohlfahrtsökonomischen<br />
Gesamtbilanzierung<br />
· mögliche Ursachen von Konjunktur- und Wachstumsschwankungen sowie von wirtschaftlichen<br />
Strukturproblemen (regionale, technologische)<br />
· wirtschaftspolitische Konzeptionen (Träger, Ziele, Instrumente; intendierte und nicht intendierte Wirkungen;<br />
theoretische und ideologische Grundlagen)<br />
·<br />
IF IV: Wirtschaftspolitik (Fortsetzung)<br />
-Europäische Währungsunion und europäische Geldpolitik im Spannungsfeld zwischen Stabilitätsziel und<br />
anderen Zielen (arbeitsmarktpolitische, sozialpolitische, umweltpolitische): Stellung und Aufbau, Ziele und<br />
Instrumente der Europäischen Zentralbank<br />
· Grenzen nationaler Wirtschaftspolitik angesichts fortschreitender Globalisierungsprozesse<br />
Wirtschaftspolitik im Zeichen der Globalisierung (Wirtschaftstheorien, Globalisierung: Bedrohung oder Chance,<br />
Analysen zur akuellen Wirtschaftslage<br />
(Bisher in unserem <strong>Curriculum</strong>: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland,<br />
Parteien und Verbände (Begriff und Funktion, rechtliche Bedingungen, Parteienfinanzierung, Wahlen und Politik<br />
in NRW, Handlungsfelder der Interessenverbände, Ehrenamtlichkeit in Verbänden, Vereinen und Gewerkschaft<br />
/ Die gegenwärtige Parteienlandschaft: Krise der Parteiendemokratie?)<br />
QI (11/12) 2. Halbjahr<br />
IF VI: Globale politische Strukturen und Prozesse<br />
Erscheinungsformen globaler Strukturen und Prozesse und deren Ursachen (Ent- und Neustrukturierung der<br />
Welt nach 1989; technologische Entwicklungen mit ihren Folgen und Nebenfolgen; zunehmende<br />
weltwirtschaftliche Verflechtung, Entwicklung einer medial geprägten „Weltkultur“)<br />
Entwicklungsländer und Entwicklungspolitik im Rahmen globaler politischer Strukturen und Prozesse (Merkmale<br />
und Strukturen der Unterentwicklung, Theorien von Entwicklung und Unterentwicklung, Akteure der<br />
Enwicklungspolitik, Konzepte nachhaltiger Entwicklung, das Modell "Global Governance")<br />
QI (12/13) 1. Halbjahr<br />
IF V: Gesellschaftsstrukturen und sozialer Wandel<br />
Sozialer Wandel in Deutschland (· Beschleunigter sozialer Wandel komplexer Gesellschaften in wichtigen<br />
Bereichen (Produktionspotentiale und Technologien, Organisationsstrukturen, Werte; Arbeits- und<br />
Medienmärkte, Familienformen, konkurrierende Wertsysteme)<br />
· Empirische Daten zur sozialen Ungleichheit und Zusammenhänge zwischen der Verfügung über Ressourcen,<br />
individuellen Lebenschancen und politischen Gestaltungschancen, zwischen Wohlstandssteigerung, sozialer<br />
Ungleichheit und Bedürfnisprioritäten – und ihre gesellschaftstheoretische Deutung (Klassen, Schichten,<br />
Milieus)<br />
· Entstrukturierungs- und Neustrukturierungsvorgänge, Konfliktpotentiale und Steuerungschancen im sozialen<br />
Wandel, verstärkte Individualisierungs- und Globalisierungsschübe<br />
· staatliches Handeln als Reaktion auf durch Marktmacht und Organisationsfähigkeit kumulierte Ungleichheiten<br />
mit abbauender, aber auch verstärkender Wirkung; sozialpolitische Entscheidungen am Beispiel;<br />
konkurrierende sozialpolitische Grundsätze<br />
· Auswirkungen des beschleunigten sozialen Wandels auf die soziale Sicherung, Arbeitsverhältnisse und<br />
Bildung, Chancen und Grenzen der politischen Gestaltbarkeit)<br />
QI (12/13) 2. Halbjahr<br />
IF V: Gesellschaftsstrukturen und sozialer Wandel<br />
Thema: Sozio-ökonomischer Strukturwandel und Modernisierung unter globalisierten Bedingungen (Fortsetzung<br />
und Vertiefung), Aufgreifen der anderen Inhalstfelder zur Abiturvorbereitung, z.B.: Soziale und wirtschaftliche<br />
Umschichtungen in Ost- und Westdeutschland, Facetten der modernen Sozialstruktur, Konfliktszenarien der<br />
Gesellschaft.
Zusatzkurse in Q2<br />
Im Zusatzkurs werden alle drei Bezugsdisziplinen (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft) unterrichtet, um den<br />
Schülerinnen und Schülern ein sozialwissenschaftliches Deutung-und Orientierungswissen zu ermöglichen<br />
(demokratische Willensbildung, marktwirtschaftliche Systemzusammenhänge, soziale Strukturen und ihre<br />
Entwicklung). Die Interessen der Schülerinnen und Schüler sollen bei der Themenwahl angemessen<br />
berücksichtigt werden.