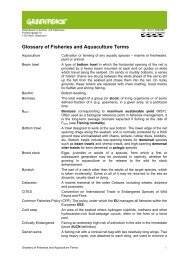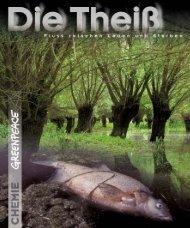GREENPEACE MAGAZIN / NACHRICHTEN
GREENPEACE MAGAZIN / NACHRICHTEN
GREENPEACE MAGAZIN / NACHRICHTEN
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>GREENPEACE</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> / <strong>NACHRICHTEN</strong><br />
REDAKTIONSANSCHRIFT: Greenpeace Media GmbH / Große Elbstraße 39 / FAX: (040) 30 618 - 212<br />
E-MAIL: gpm.germany@greenpeace.de / ISDN: Leonardo (040) 38 610 340 / INTERNET: www.greenpeace-magazin.de<br />
TELEFON: (040) 30 618 - 213<br />
Viel zu viele Fischer fischen viel zu viele frische Fische<br />
GPM 2/02 - Mit gnadenlos perfekter Technik plündern Fangflotten weltweit die Fischbestände - und damit ihre<br />
eigene Existnzgrundlage. Nur ein radikaler Wandel kann Fisch und Fischer retten.<br />
Spezial: Klicken Sie bitte hier, um in dem Fischführer zu blättern.<br />
Noch mal davongekommen!", titelten die englischen "Fishing News" in fetten Lettern. "Minister kippen die<br />
schlimmsten Pläne der EU-Kommission. Für viele Arten gibt es 2002 viel bessere Quoten als befürchtet." Das<br />
Lobbyblatt war voll des Lobes für Fischereiminister Elliot Morley, der im Dezember in einem 31-stündigen<br />
Verhandlungsmarathon des EU-Fischereirates manchen "Sieg" davontragen konnte. Obwohl etwa "die Irische See<br />
beim Schellfisch eine starke Kürzung erlitt", überwog die Freude über meist gleich bleibende, teils sogar steigende<br />
Gesamtfangmengen – und damit gute Quoten für britische Fischer.<br />
Es ist also gekommen wie jedes Jahr. Wieder gelang es der Fischereilobby, die Managementempfehlungen des<br />
Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES), der alljährlich Bestandsschätzungen für Nordsee, Ostsee und<br />
Nordatlantik liefert, als willkürlich oder geradezu schikanös abzutun. Wieder ignorierten die Minister die<br />
Warnungen der Wissenschaft und einigten sich auf Fangmengen, die unweigerlich den weiteren Niedergang der<br />
europäischen Fischerei zur Folge haben werden. Dabei hatte der zuständige EU-Kommissar Franz Fischler<br />
eigentlich einen neuen Kurs angekündigt und gewarnt: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wenn es uns ernst<br />
damit ist, die Zukunft des europäischen Fischereisektors zu sichern, müssen wir die Fangmengen deutlich<br />
reduzieren."<br />
Die Lage in Europas Meeren ist in der Tat dramatisch. Immer weiter schrumpfen die Fänge vor allem der<br />
wertvollen Grundfische. Ein Gutachten für die EU-Kommission zeigte, dass von 120 europäischen Fischbeständen<br />
zwei Drittel überfischt sind oder vor dem Kollaps stehen. Ob Scholle oder Seezunge, ob Schellfisch oder Seehecht<br />
– kaum ein Bestand wird noch "innerhalb sicherer biologischer Grenzen" bewirtschaftet. Zehn Jahre nach dem<br />
Zusammenbruch der Kabeljaufischerei vor Neufundland, der 30.000 Menschen den Job kostete, droht der<br />
Schwund der begehrten Art auch für Europas Fischer zum Desaster zu werden. Denn seit Jahren macht sich der<br />
Nachwuchs rar, in der Nordsee schwimmen heute fünfmal weniger geschlechtsreife Tiere als noch vor 30 Jahren<br />
(siehe Grafik Seite 26). Gezwungenermaßen wurden die Kabeljauquoten mehrfach gesenkt. Weil das nicht reichte,<br />
sperrte die Kommission im vergangenen Frühjahr als Notmaßnahme große Teile der Nordsee für den Kabeljaufang<br />
– als Auftakt eines mehrstufigen "Wiederauffüllungsplans". Doch an dessen Erfolg darf schon jetzt gezweifelt<br />
werden.<br />
Denn aus Sicht des ICES wäre 2002 eigentlich eine Nullrunde angebracht, ein vorübergehender Fangstopp. Die<br />
trotzigen Minister beschlossen jedoch – mit dem Verweis auf die geplanten selektiveren Netze und schärferen<br />
Kontrollen – sogar eine leichte Steigerung der Fangmengen. Obendrein erhöhten sie auch die Nordsee-Quoten für<br />
Schellfisch und die Krebsart Kaisergranat, bei deren Fang große Mengen Kabeljau mit ins Netz gehen. Dabei<br />
müssten die Fischereibürokraten endlich berücksichtigen, dass vor allem beim Beutezug am Meeresgrund viele<br />
Arten gemischt gefangen werden. In der Nordsee werfen Fischer ein Viertel der Fänge wieder über Bord –<br />
darunter häufig wertvolle Speisefische, deren Quote jedoch schon ausgeschöpft ist. Nur wenige Tiere überleben<br />
nach dem Rückwurf ins Wasser.<br />
Zudem bügelten die Minister auch Vorschläge der Kommission ab, wie sich die europäische Fischereiflotte effektiv<br />
verkleinern ließe. Nach offiziellen Berechnungen müssten – bei einer Überkapazität von mehr als 40 Prozent –<br />
eigentlich die Hälfte der etwa 100.000 Schiffe abgewrackt werden. Immerhin steckten die EU-Länder von 1994 bis<br />
Umweltschutz braucht gute Nachrichten<br />
Seite 1/3
<strong>GREENPEACE</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> / <strong>NACHRICHTEN</strong><br />
REDAKTIONSANSCHRIFT: Greenpeace Media GmbH / Große Elbstraße 39 / FAX: (040) 30 618 - 212<br />
E-MAIL: gpm.germany@greenpeace.de / ISDN: Leonardo (040) 38 610 340 / INTERNET: www.greenpeace-magazin.de<br />
TELEFON: (040) 30 618 - 213<br />
1999 fast 900 Millionen Euro in den Abbau der Überkapazitäten. Doch beinahe ebenso viel Geld floss in die<br />
Modernisierung von Schiffen und Hafenanlagen. Und so schrumpfte zwar die Zahl der Arbeitsplätze im Fischfang<br />
zwischen 1990 und 1997 um 19 Prozent, doch mit ihrem perfektionierten Gerät arbeiten die Kutter trotzdem<br />
effektiver denn je.<br />
Nicht nur die Nordsee, eines der am stärksten geplünderten Meere der Welt, macht Sorgen. Jenseits der<br />
britischen Inseln und im schlecht verwalteten Mittelmeer sieht es kaum besser aus, und auch die Ostsee ist<br />
überfischt – hier sanken deshalb die Dorschquoten für 2002 deutlich. Europas Meere sind leer, und darum<br />
exportieren die Europäer das Problem. Nur etwa die Hälfte des in der EU verspeisten Fischs stammt noch aus den<br />
eigenen Meeren. Der Rest wird importiert oder in internationalen Gewässern gefangen – und vor den Küsten<br />
anderer Länder. 26 Fischereiabkommen unterhält die EU, die sie mit 270 Millionen Euro jährlich subventioniert. 17<br />
davon sichern den Zugang zu Gewässern von Entwicklungsländern, meist in Westafrika.<br />
"Neben den traditionell fern fischenden Spaniern und Portugiesen weichen immer häufiger Franzosen und<br />
Niederländer dorthin aus, wo die Regelungen und Kontrollen noch schlechter sind als bei uns", sagt die belgische<br />
Greenpeace-Fischereifachfrau Helen Bours. Zwar betont die EU stets den gegenseitigen Nutzen der Abkommen –<br />
die einheimischen Fischer würden vom Technologietransfer und Know-how der Europäer profitieren. Doch die<br />
Realität sieht anders aus. Eine im Dezember veröffentlichte Studie der UN-Umweltorganisation UNEP zeigte am<br />
Beispiel des Senegals und Argentiniens, dass für die Vertragsländer die Nachteile langfristig überwiegen:<br />
Umweltschäden und sinkende Erträge der einheimischen Küstenfischerei. "Für Entwicklungsländer kann es ein<br />
kostspieliger Fehler sein, ausländische Fischereiflotten in ihre Gewässer zu lassen", sagt UNEP-Chef Klaus Töpfer:<br />
"Die Überfischung durch ausländische Flotten kann die Armut noch vergrößern."<br />
Vor Argentiniens Küste dauerte es nur ein gutes Jahrzehnt, bis der Fischereiboom, der in den 80er Jahren<br />
begann, wieder einknickte. Asiatische und europäische Trawler plünderten den riesigen patagonischen<br />
Kontinentalschelf, so dass der Bestand des dort einst massenhaft vorkommenden Seehechtes jetzt vor dem<br />
Kollaps steht. In Westafrika nehmen einige Länder inzwischen die rücksichtslosen Praktiken der Europäer nicht<br />
mehr klaglos hin. So beschweren sich senegalesische Politiker zunehmend über Missetaten meist spanischer<br />
Fischer, die Verlängerung des Fischereiabkommens mit der EU steht derzeit auf der Kippe. Namibia verwehrte<br />
ausländischen Flotten schon vor Jahren den Zugang zu seinen Gewässern, und Marokko schraubte seine<br />
Forderungen so hoch, dass keine Verlängerung des Vertrags mit der EU zustande kam. In beiden Ländern stiegen<br />
nur kurze Zeit später die Erträge der einheimischen Fischer.<br />
Neue Fischereiabkommen werden die Probleme nicht lösen. Denn rund um den Globus lassen schrumpfende<br />
Ressourcen Fischer, Forscher und Politiker verzweifeln. Während die weltweiten Anlandungen noch in den 50er<br />
und 60er Jahren um etwa sechs Prozent jährlich stiegen, stagnieren die Fänge seit Anfang der 90er bei etwa 90<br />
Millionen Tonnen pro Jahr – trotz steigendem Fischereiaufwand. Die Bilanz der Welternährungsorganisation FAO:<br />
International werden drei Viertel der Fischbestände so stark ausgebeutet, dass keine Steigerung möglich ist; fast<br />
ein Viertel ist überfischt oder erschöpft. Das Verhalten der Fischer erinnert an das Not leidender Bauern, die ihr<br />
Saatgut für das nächste Jahr verzehren.<br />
Zur Fischstäbchen- und Schlemmerfiletproduktion steuern immer größere Fabrikschiffe immer entlegenere<br />
Gebiete an – doch inzwischen schrumpfen selbst die scheinbar unermesslichen Bestände des Alaska-Seelachses,<br />
des weltweit am meisten gegessenen Fisches. Und die völlig unregulierte Ausbeutung der Tiefsee bringt nur<br />
kurzzeitig hohe Erträge, weil Arten wie Granatbarsch, Grenadier oder Degenfisch langsam wachsen und wenig<br />
Nachwuchs produzieren. Mancher Bestand wird binnen weniger Jahre ruiniert.<br />
Umweltschutz braucht gute Nachrichten<br />
Seite 2/3
<strong>GREENPEACE</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> / <strong>NACHRICHTEN</strong><br />
REDAKTIONSANSCHRIFT: Greenpeace Media GmbH / Große Elbstraße 39 / FAX: (040) 30 618 - 212<br />
E-MAIL: gpm.germany@greenpeace.de / ISDN: Leonardo (040) 38 610 340 / INTERNET: www.greenpeace-magazin.de<br />
TELEFON: (040) 30 618 - 213<br />
So genannte Piratenfischer, Fangschiffe unter der Billigflagge von Staaten wie Honduras, Panama oder Belize,<br />
verschärfen die Lage weiter. Sie missachten alle internationalen Abkommen und stellen – ohne jede<br />
Fangbeschränkung – zum Beispiel Schwarzen Seehechten in der Antarktis nach, Zackenbarschen und Seezungen<br />
vor Westafrika oder Tunfischen bei Australien. Die Ware gelangt zum großen Teil in die Industriestaaten, und nicht<br />
selten sind auch die verdeckten Eigner der Schiffe europäische, japanische oder US-amerikanische Unternehmen.<br />
Teilweise zahlte die EU sogar Stilllegungsprämien für Schiffe, die nicht verschrottet, sondern umgeflaggt wurden.<br />
Auch die Aquakultur, oft als Ausweg aus der Krise angesehen, ist meist keine Alternative. Zwar erzielt die Zucht<br />
von Fischen und Krebsen noch große Wachstumsraten von weltweit jährlich zehn Prozent, und ein Viertel der<br />
Fischereierträge stammt inzwischen aus Bassins und Käfigen. Doch nicht nur die Umweltverschmutzung in der<br />
Umgebung von Shrimps- oder Lachsfarmen ist oft verheerend, sondern auch die Futterbeschaffung: Arten wie<br />
Lachs, Forelle, Goldbrasse oder Wolfsbarsch fressen Fischmehl. Und das stammt, außer in Bio-Aquakulturen,<br />
wiederum aus zerstörerischer "Gammelfischerei" auf Sandaal, Sprotte und Stintdorsch oder den meistgefangenen<br />
Fisch der Welt, die Peruanische Sardelle.<br />
Was also muss passieren? Umweltverbände wie Greenpeace sind der Überzeugung, dass eine ökologisch<br />
verträgliche Fischerei möglich ist. Voraussetzung dafür ist ein effektives Management auf Basis des<br />
Vorsorgeprinzips und strenge Kontrollen. Regulierungsmaßnahmen dürfen nicht erst Antwort auf Überfischung<br />
sein, destruktive Fischereien müssen verboten werden. Zumindest auf dem Papier ist in den letzten Jahren auch<br />
der politische Wille zu einem grundlegenden Wandel erkennbar: Nicht nur die EU-Kommission, auch das in<br />
Deutschland zuständige Landwirtschaftsministerium unter Renate Künast strebt eine nachhaltige Fischerei an.<br />
Immerhin gelten hier zu Lande seit Anfang des Jahres neue Vorschriften, die amtliche Kontrollen auf den Schiffen<br />
erleichtern.<br />
Gerd Hubold, Leiter der Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg, hält eine deutliche Verkleinerung der<br />
Flotte für unumgänglich: "Wir müssen die Fangkapazität gnadenlos an der Produktion in den Meeren ausrichten."<br />
Zudem könne der Beifang stark verringert werden: "Wenn die Fischer selbst an einem möglichst geringen Beifang<br />
interessiert sind, werden sie auch die Vorschriften einhalten." Möglich sei eine Regelung nach norwegischem<br />
Vorbild: Zu kleine oder der falschen Art angehörende Fische dürfen nicht mehr über Bord gehen, sondern müssen<br />
an Land registriert, gegebenenfalls auf die Quote angerechnet und verarbeitet werden.<br />
In den letzten Jahren wird zudem der Ruf nach ganz neuen Ansätzen in der Fischereipolitik lauter: Naturschützer<br />
fordern Reservate, in denen niemand fischen darf – und erhalten dabei Rückendeckung aus der Forschung.<br />
Kürzlich zeigten Untersuchungen aus der Karibik eindrucksvoll, dass sich Zonen, in denen Fische ungestört leben<br />
können, günstig auf die Bestände auswirken: Nicht nur in den Schutzzonen selbst vervierfachte sich die Zahl der<br />
Fische binnen weniger Jahre, auch ringsum wuchs sie um das Dreifache. Die Fischer verbringen dort heute weniger<br />
Zeit auf dem Wasser – aber fangen mehr Fisch.<br />
WOLFGANG HASSENSTEIN<br />
Umweltschutz braucht gute Nachrichten<br />
Seite 3/3




![3. Die Energie-[R]evolution](https://img.yumpu.com/22078498/1/184x260/3-die-energie-revolution.jpg?quality=85)