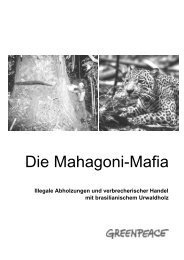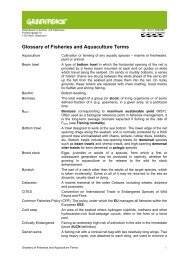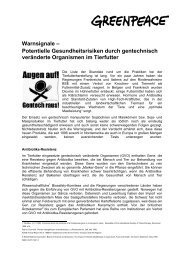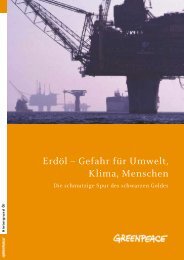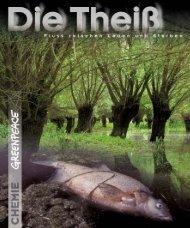2. Risiko Gentechnik
2. Risiko Gentechnik
2. Risiko Gentechnik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
RISIKO<br />
Autor:<br />
Mag. Thomas Fertl<br />
Herausgeber:<br />
Greenpeace Österreich<br />
Siebenbrunneng. 44<br />
A-1050 Wien<br />
Tel: ++43/1/5454580<br />
Fax: ++43/1/5454588<br />
Email: office@greenpeace.at<br />
Homepage: www.greenpeace.at<br />
Bezug:<br />
Der vorliegende Report kann bei Greenpeace<br />
Österreich und Greenpeace Schweiz (Adressen siehe Seite 32) bestellt<br />
oder direkt via Internet heruntergeladen werden.<br />
Cover-Fotos:<br />
Labor: © Thorsten Klapsch / Greenpeace<br />
Rapsfeld: © Bernhard Nimtsch / Greenpeace<br />
Monarch-Falter: © Bernhard Nimtsch / Greenpeace<br />
G E N T E C H N I K<br />
Wissenschaftliche Fallbeispiele<br />
aus Landwirtschaft und<br />
Lebensmittelproduktion<br />
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier<br />
Wien, im September 2000
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Vo r w o r t<br />
Die Firma Novartis hat Maispflanzen gentechnisch so manipuliert, dass diese selbst ein Insektengift<br />
produzieren. Damit sollten Maiszünsler-Larven getötet werden, die sich von der Pflanze ernähren.<br />
Florfliegen-Larven wiederum fressen die Maiszünsler-Larven und sind daher in der Landwirtschaft<br />
willkommene Nützlinge. Fressen die Florfliegen-Larven nun Maiszünsler-Larven, die sich von dem<br />
genmanipulierten Mais ernährt haben, so sterben auch sie an Vergiftungserscheinungen. Der Anbau<br />
von genmanipuliertem Mais kann so zum Tod wichtiger Nützlinge führen.<br />
Diese Forschungsergebnisse eines Schweizer Wissenschafter-Teams sind nur ein Beispiel unter vielen,<br />
die aufzeigen, dass der Einsatz von <strong>Gentechnik</strong> in der Landwirtschaft mit Risiken behaftet ist. Es<br />
verwundert daher nicht, dass – trotz massiver Propaganda der <strong>Gentechnik</strong>-Industrie – seit Jahren die<br />
breite Ablehnung der <strong>Gentechnik</strong> in diesem Anwendungsbereich durch die EU-Bürger anhält 1 . Zumal<br />
mit dem verstärkten kommerziellen Einsatz genmanipulierter Lebewesen – etwa in den USA – deutlich<br />
wird, dass die versprochenen Segnungen durch die neue Technologie nicht eintreten.<br />
Nach einer kurzen Einführung finden Sie in diesem Report Informationen über Risiken, die mit der<br />
Freisetzung genmanipulierter Organismen und mit Gentech-Nahrungsmitteln verbunden sind.<br />
Greenpeace hat dafür die interessantesten Fallbeispiele aus Wissenschaft und Forschung zusammengetragen.<br />
Die im Text erwähnten Studien sind jeweils in einer Fußnote zitiert, sodass Sie sich jederzeit<br />
mit Hilfe der Original-Literatur detaillierter informieren können.<br />
Am Ende der Studie finden Sie eine zusammenfassende Analyse. Und sollte Ihnen nach der Lektüre<br />
der Appetit auf <strong>Gentechnik</strong> vergangen sein, dann folgen Sie am besten den Act!-Tips über<br />
<strong>Gentechnik</strong>-freie Ernährung auf Seite 31.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Mag. Thomas Fertl<br />
Greenpeace Österreich<br />
1 Inra (Europa) - Ecosa (2000): Eurobarometer 5<strong>2.</strong>1 - Europeans and Biotechnology. Study on behalf of Directorate-General for Research, Directorate B -<br />
Quality of Life and Management of Living Resources Programme. Managed and organised by Directorate-General for Education and Culture „Citizens’<br />
Centre“ (Public Opinion Analysis Unit). Brüssel, 84 S.<br />
1
Report<br />
I n h a l t s v e r z e i c h n i s<br />
1. Was ist und kann <strong>Gentechnik</strong>? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
<strong>2.</strong> <strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
Genmanipulation mit überraschenden Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
Unsichtbar und dennoch von größter ökologischer<br />
Bedeutung: Mikroorganismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Genmanipulierte Nutzpflanzen: Maßgeschneidert für den Acker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Wachstumssteigerung um jeden Preis: Genmanipulierte Tiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
<strong>Gentechnik</strong> und Bio-Landwirtschaft: ein Widerspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
Am Ende der Gentech-Nahrungskette steht der Mensch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
3. Zusammenfassende Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
4. Act!-Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
Kaufen Sie <strong>Gentechnik</strong>-freie Lebensmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
Werden Sie Gen-Detektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
Unterstützen Sie die Arbeit von Greenpeace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
2
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
1. Was ist und kann <strong>Gentechnik</strong>?<br />
In der Zeitschrift „Plant Science“ wurde kürzlich berichtet, dass japanische<br />
Wissenschafter ein menschliches Gen in Karotten eingebaut<br />
haben. Dadurch erzeugen die Karotten eine Substanz, die ihnen<br />
Widerstandsfähigkeit gegen eine Pilzerkrankung verleihen soll. 2 Wie ist<br />
das möglich?<br />
Karotten mit menschlichen<br />
Genen – wie geht das?<br />
Zellen sind die kleinsten Bausteine von Lebewesen. In jeder Zelle<br />
befindet sich Erbgut in Form von Desoxyribonucleinsäure (DNS oder<br />
englisch DNA abgekürzt). In der Abfolge der einzelnen Bausteine dieses<br />
strangförmigen Moleküls ist die Erbinformation gespeichert. Die<br />
DNS wird von einer Generation auf die nächste weitergegeben, womit<br />
sichergestellt ist, dass Frösche nur Frösche, Sonnenblumen nur<br />
Sonnenblumen, Menschen nur Menschen usw. hervorbringen.<br />
Die Desoxyribonucleinsäure<br />
(DNS) ist Träger der<br />
Erbinformation<br />
Die DNS beeinflusst die Lebensvorgänge nur indirekt. Dazu werden<br />
basierend auf der Erbinformation sogenannte Proteine (Eiweiße)<br />
gebildet. Jeweils ein Teilabschnitt der DNS, ein sogenanntes Gen, enthält<br />
die Information über ein Protein (Eiweiß). Diese Proteine sind es<br />
letztendlich, die in den Stoffwechsel der Zellen eingreifen und somit<br />
die in der DNS gespeicherte Information umsetzen. Ein Großteil des<br />
Aussehens und der Eigenschaften von Lebewesen geht damit auf die<br />
Gene zurück. Die Vererbungslehre wird auch Genetik genannt.<br />
Die Erbinformation wird in<br />
Eiweiße übersetzt<br />
Unter <strong>Gentechnik</strong> fasst man eine Reihe von Verfahren zur Manipulation<br />
der Erbinformation durch Eingriffe in das Erbmaterial (DNS) zusammen.<br />
Voraussetzung dafür sind molekularbiologische Kenntnisse, die<br />
es erlauben, ein Gen aus der DNS eines Lebewesens auszuschneiden,<br />
in ein anderes zu transportieren und schließlich dort in die DNS wieder<br />
einzubauen. Die „molekularen Scheren“ zum Ausschneiden von<br />
Genen werden Restriktionsenzyme genannt. Sogenannte Vektoren<br />
dienen als Transportvehikel für derart isolierte Gene. Als Vektoren<br />
werden häufig Plasmide verwendet. Das sind ringförmige DNS-Stücke,<br />
die in Bakterien vorkommen. Die fremden, mittels Vektoren in eine<br />
Zelle eingebrachten Gene können schließlich mit Hilfe „molekularer<br />
Kleber“ (sogenannter Ligasen) in die zelleigene DNS eingebaut werden.<br />
Dabei entsteht sogenannte rekombinante DNS. Die anfangs<br />
Mittels <strong>Gentechnik</strong> kann die<br />
Erbinformation verändert<br />
werden<br />
2 M. Takaichi und K. Oeda (2000): Transgenic carrots with enhanced resistance against two major pathogens, Erysipheraclei and Alternaria dauci. Plant Science<br />
153(2):135-144.<br />
3
Report<br />
beschriebene Karotte mit menschlichem Gen wurde so erzeugt.<br />
Derartige Konstruktionen nennt man genmanipulierte Organismen<br />
(GMO). Weitere gebräuchliche Bezeichnungen sind genveränderte<br />
Organismen (GVO) oder transgene Organismen. Während in der Natur<br />
Erbinformation nur zwischen Individuen der selben Art oder nah verwandter<br />
Arten ausgetauscht wird, besteht für die <strong>Gentechnik</strong> diesbezüglich<br />
prinzipiell keine Einschränkung. Gene von Ratten können in<br />
Brokkoli-Pflanzen genauso eingebaut werden wie menschliche Gene in<br />
Schweine.<br />
Mittels gentechnischer Methoden können Ratten-Gene in Brokkoli-Pflanzen<br />
eingebaut werden<br />
Die Gentech-Industrie drängt<br />
mit genmanipulierten<br />
Organismen auf den Markt<br />
Ein weiterer wichtiger Vorgang ist das Klonen von Lebewesen. Dabei<br />
werden „Kopien“ mit exakt gleicher Erbinformation erzeugt (Klone).<br />
Dies funktioniert sowohl mit nicht genmanipulierten, als auch mit genmanipulierten<br />
Organismen.<br />
Seit der Geburtsstunde der <strong>Gentechnik</strong> Anfang der Siebzigerjahre hat<br />
sich diese Wissenschaft im Eiltempo entwickelt. Viele Lebewesen wurden<br />
inzwischen manipuliert, um ihnen neue, wirtschaftlichen Erfolg<br />
versprechende Eigenschaften zu verleihen. Eine Vielzahl genmanipulierter<br />
Organismen wird heute bereits kommerziell eingesetzt. Beispiele<br />
sind genmanipulierte Bakterien zur Erzeugung bestimmter<br />
Stoffe (wie Vitamine) und genmanipulierte Pflanzen mit völlig neuartigen<br />
Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit gegen Pflanzenschutzmittel<br />
oder Insektenfraß.<br />
4
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
<strong>2.</strong> <strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Genmanipulation mit überraschenden Folgen<br />
Genmanipulierte Pflanzen zeigen immer wieder überraschende Eigenschaften.<br />
Zum Beispiel haben Sojabohnen, die mittels <strong>Gentechnik</strong><br />
gegen ein Unkrautvernichtungsmittel widerstandsfähig gemacht wurden,<br />
völlig unerwartet auf Temperaturänderung reagiert: Der Stengel<br />
riss in der Hitze auf. Für betroffene Farmer könnte das Ernteeinbußen<br />
von bis zu 40 Prozent bedeuten. 3 Um Millionen Dollar ging es auch in<br />
Mississippi: Genmanipulierte Baumwollpflanzen auf ca. 1<strong>2.</strong>000 Hektar<br />
Anbaufläche haben die Blüten vor der Erntereife abgeworfen. 4<br />
Gentech-Pflanzen reagieren<br />
häufig anders als erwartet<br />
„Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist der Hauptgrund<br />
dafür, dass die <strong>Gentechnik</strong> die eigenen Versprechen nicht halten kann<br />
und zugleich Gefahren mit sich bringt“, so die britische Biophysikerin<br />
Dr. Mae-Wan Ho. Sie kritisiert damit die mechanistische Annahme,<br />
dass ein Gen für eine Eigenschaft eines Organismus zuständig sei.<br />
Diese Annahme ist in vielerlei Hinsicht falsch. Denn die Funktion von<br />
Genen ist eine komplexe, vernetzte Angelegenheit, bei der eine<br />
Wirkung viele Ursachen hat und Rückkopplungen verschiedener<br />
Prozesse eine große Rolle spielen. Gene „funktionieren“ nicht immer<br />
gleich, sondern reagieren dynamisch auf Umwelteinflüsse. Deshalb<br />
kann bei einer Pflanze, die ein Herbizidresistenz-Gen trägt, plötzlich<br />
Die <strong>Gentechnik</strong> geht von<br />
grundsätzlich falschen<br />
Annahmen aus<br />
3 A. Coghlan (1999): Splitting headache. Monsanto’s modified soya beans are cracking up in the heat. New Scientist, 20. November 1999. Elektronische<br />
Version publiziert im Internet unter: http://www.newscientist.com<br />
4 K. Kleiner (1999): Monsanto´s Cotton gets the Mississippi Blues. New Scientist, 1. November 1999. Elektronische Version publiziert im Internet unter:<br />
http://www.newscientist.com<br />
5
Report<br />
durch Hitzeeinwirkung der Stengel aufreißen. Somit werden Eingriffe in<br />
das Erbgut zu einem unpräzisen Unterfangen mit nicht vorhersagbaren<br />
Folgen. 5<br />
Versuch und Irrtum als<br />
Methode der <strong>Gentechnik</strong>?<br />
Wissenschafter in Neufundland haben versucht, Lachsen ein „Antigefrier-Gen“<br />
eines anderen Fisches einzubauen. Sie wollten die Tiere<br />
gegen die Kälte nordischer Winter widerstandsfähig machen. Die<br />
transgenen Lachse erwiesen sich aber nicht als kälteresistent. Dafür<br />
löste die Genmanipulation bei einem Teil der Fische eine im<br />
Vergleich zu natürlichem Lachs zehnmal höhere Wachstumsrate<br />
a u s . 6 Die überraschenden Folgen gentechnischer Manipulation an<br />
Lebewesen fallen leider nicht immer so „glimpflich“ aus. Wie die folgenden<br />
Beispiele zeigen, sind sie oft mit großen Risiken für Natur und<br />
Mensch verbunden.<br />
5 M.-W. Ho (1999): Genetic Engineering. Dream or Nightmare. Verl. Gateway, Dublin, 385 Seiten.<br />
6 D. MacKenzie (1996): Altered salmon grow by leaps and bounds. New Scientist, January 6:6.<br />
6
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Unsichtbar und dennoch von größter ökologischer<br />
Bedeutung: Mikroorganismen<br />
Mikroorganismen sind Kleinstlebewesen, die zumeist einzellig und nur<br />
unter dem Mikroskop sichtbar sind. Dazu zählen unter anderem<br />
Bakterien und manche Pilze. Im Stoffkreislauf der Natur spielen sie<br />
eine enorme Rolle – etwa für die Fruchtbarkeit von Böden.<br />
Auf Grund ihres relativ einfachen Aufbaus sowie der unkomplizierten<br />
und raschen Vermehrung durch Zellteilung sind sie beliebte<br />
Forschungsobjekte der Genetik. Sie dienen einerseits als ein „Werkzeug“<br />
der Gentechnologie und werden andererseits selbst manipuliert,<br />
um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.<br />
Als einfach strukturierte<br />
Lebewesen gehören Mikroorganismen<br />
zu den wichtigsten<br />
Forschungsobjekten der<br />
<strong>Gentechnik</strong><br />
Beispielsweise werden Bakterien zur Herstellung chemischer Stoffe<br />
verwendet. Das Bakterium Klebsiella etwa wurde gentechnisch manipuliert,<br />
um mit möglichst hoher Effizienz aus biologischen Abfällen<br />
durch Vergärung Alkohol zu erzeugen. Damit sollten letztendlich<br />
Pflanzenreste aus der Landwirtschaft zur Treibstoffherstellung genutzt<br />
werden. Ein Forschungsteam ging der Frage nach, welche Auswirkungen<br />
es hat, wenn Produktionsabfälle einer solchen Vergärung als<br />
Dünger auf landwirtschaftliche Nutzflächen ausgebracht werden. Das<br />
unerwartete Versuchsergebnis: Das Einbringen des genmanipulierten<br />
Bakteriums änderte die Zusammensetzung der Bodenlebewesen, und<br />
das Wachstum von Weizenpflanzen wurde bis hin zum Absterben<br />
gehemmt. Interessant ist, dass sich ohne Pflanzenbewuchs keine nachweisbare<br />
Änderung einstellte. Bei einer Versuchsanordnung ohne<br />
Kulturpflanzen wäre man auf diesen Effekt also nicht gestoßen. Die<br />
Wissenschafter leiten aus den Ergebnissen die Notwendigkeit ab, bei<br />
<strong>Risiko</strong>beurteilungen möglichst alle Glieder der Nahrungskette mit einzubeziehen.<br />
Da die Zusammenhänge in Ökosystemen sehr komplex<br />
und großteils unerforscht sind, bleibt die Frage, ob dies praktisch<br />
durchgeführt werden kann. 7<br />
Die Freisetzung eines genmanipulierten<br />
Bakteriums<br />
stört das Bodenökosystem<br />
2,4-D ist ein synthetisches Unkrautbekämpfungsmittel. Weil diese<br />
Chemikalie Boden und Grundwasser langfristig vergiftet, kamen findige<br />
Wissenschafter auf die Idee, das Bakterium Pseudomonas so zu manipulieren,<br />
dass es 2,4-D abbaut. Und das tat es auch. Als Abbauprodukt<br />
Genmanipulierte Bakterien<br />
für den Umweltschutz? Ein zu<br />
kurz gedachter Ansatz!<br />
7 M. T. Holmes, E. R. Ingham, J. D. Doyle und C. W. Hendricks (1998): Effects of Klebsiella planticola SDF20 on soil biota and wheat growth in sandy soil.<br />
Applied Soil Ecology 326:1-1<strong>2.</strong><br />
7
Report<br />
entstand jedoch eine Chemikalie mit Namen 2,4-DCP, die sich für<br />
Bodenpilze als giftig erwies. Binnen kurzer Zeit wurden auf der<br />
Versuchsfläche alle Bodenpilze abgetötet. Ein überraschender Effekt,<br />
der weder bei den natürlichen, nicht manipulierten Bakterien, noch<br />
beim ursprünglich verwendeten Pflanzenschutzmittel auftrat. Der<br />
Einsatz genmanipulierter Organismen als „Umweltschutz“-Technologie<br />
hat sich in diesem Fall also als Bumerang erwiesen. Die einzig nachhaltige<br />
Lösung für dieses Problem liegt im biologischen Landbau, der<br />
ohne synthetische Chemie auskommt und daher auch keine riskante<br />
„Reparatur-Technologie“ braucht. 8<br />
Horizontaler Gentransfer<br />
Unter horizontalem Gentransfer versteht man den Austausch von<br />
Genmaterial zwischen verwandten oder nicht verwandten Individuen<br />
der selben Generation – z. B. zwischen Mikroorganismen untereinander<br />
oder zwischen Mikroorganismen und Pflanzen. Im Gegensatz<br />
dazu steht die Vererbung an Nachkommen durch ungeschlechtliche<br />
Zellteilung oder sexuelle Fortpflanzung.<br />
Durch „Horizontalen<br />
Gentransfer“ können manipulierte<br />
Gene in der freien<br />
Natur rasch und unkontrollierbar<br />
verbreitet werden<br />
Eine wichtige Frage bei der <strong>Risiko</strong>bewertung der Freisetzung gentechnisch<br />
manipulierter Mikroorganismen lautet: Kann die genetische<br />
Information zwischen Individuen der selben Generation ausgetauscht<br />
werden? Forschungen im letzten Jahrzehnt haben gezeigt, dass dies<br />
zwischen Bakterien leichter möglich ist als ursprünglich angenommen.<br />
Dieser „Horizontale Gentransfer“ ist aber auch von Pflanzen auf Pilze<br />
oder Bakterien möglich. 1998 wiesen die deutschen Wissenschafter<br />
Gebhard und Smalla von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und<br />
Forstwirtschaft in Braunschweig in Laborexperimenten nach, dass<br />
Gene manipulierter Zuckerrüben unter bestimmten Umständen vom<br />
Bakterium Acinetobacter aufgenommen werden. Auf diese Weise<br />
beeinflussen genmanipulierte Kulturpflanzen auch die Bodenökosysteme.<br />
Jüngste, noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse aus<br />
Deutschland haben gezeigt, dass eine Übertragung von Genen manipulierter<br />
Rapspflanzen auf Bakterien und Pilze im Darm von Bienen<br />
stattfindet. Mittels „Horizontalem Gentransfer“ können sich manipu-<br />
8 J. D. Doyle, G. Stotzky, G. McClung und C. W. Hendricks (1995): Effects of Genetically Engineered Microorganisms on Microbial Populations and Processes<br />
in Natural Habitats. Advances in applied Microbiology 40:237-287.<br />
8
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
lierte Gene in der freien Natur rasch und unkontrolliert ausbreiten –<br />
mit unabsehbaren Folgen.<br />
9, 10, 11, 12<br />
Genmanipulierte Nutzpflanzen:<br />
Maßgeschneidert für den A c k e r ?<br />
Die gentechnische Veränderung von Kulturpflanzen zum Zwecke der<br />
Lebensmittelerzeugung ist ein in der Öffentlichkeit heiß diskutiertes<br />
Thema. Das Ziel der Manipulation kann die Veränderung pflanzeneigener<br />
Speicherstoffe (z. B. bei der Kartoffel) oder pflanzlicher<br />
Entwicklungsprozesse (wie bei der „Anti-Matsch“-Tomate) sein. Am<br />
häufigsten hat sie jedoch Herbizidresistenz, Insektenresistenz oder<br />
Resistenzen gegen Krankheitserreger zum Ziel. Soja, Raps, Mais,<br />
Kartoffeln und Baumwolle gehören zu den derzeit bedeutendsten<br />
Beispielen genmanipulierter Kulturpflanzen.<br />
Die <strong>Gentechnik</strong> sieht sich als<br />
die moderne Form der<br />
Pflanzenzucht<br />
Herbizid- und Insektenresistenz<br />
Ist eine Pflanze gegenüber einem bestimmten Umwelteinfluss resistent,<br />
so bedeutet dies, dass sie dagegen widerstandsfähig ist und durch<br />
dessen Einwirken keinen oder kaum Schaden erleidet. Im Fall der<br />
Herbizidresistenz sind die Pflanzen widerstandsfähig gegen ein<br />
Unkrautvernichtungsmittel (obwohl sie es aufnehmen).<br />
Insektenresistente Pflanzen produzieren selbst ein Gift, das ihre<br />
Fraßfeinde tötet.<br />
Eine genmanipulierte Soja-Pflanze der Firma Monsanto (RRS) beispielsweise<br />
ist herbizidresistent. Im Gegensatz zu den „Unkräutern“<br />
verträgt sie die Behandlung mit dem Unkrautvernichtungsmittel<br />
„Roundup-Ready“ (Glyphosat), das Monsanto im Kombi-Paket mit der<br />
Pflanze liefert. Es handelt sich dabei um ein Totalherbizid, das alle<br />
Pflanzen auf dem Acker abtötet – außer die kultivierten Gentech-<br />
Herbizidresistenz ermöglicht<br />
den Einsatz allesvernichtender<br />
Totalherbizide<br />
09 R. V. Miller (1998): Bacterial Gene Swapping in Nature. Scientific American, January.<br />
10 F. Gebhard und K. Smalla: Transformation of Acinetobacter sp. Strain BD413 by Transgenic Sugar Beet DNA. Applied and Environmental Microbiology<br />
64(4):1550-1554.<br />
11 T. Hoffmann, C. Golz und O. Schieder (1994): Foreign DNA sequences are received by a wild-type strain of Aspergillus niger after co-culture with transgenic<br />
higher plants. Current Genetics 27:70-76.<br />
12 Presseaussendung von Pressetext-Austria „Horizontaler Gentransfer zwischen Biene und Gen-Pflanzen. Mikroorganismen im Verdauungstrakt von Insekten<br />
nehmen Erbgut von Gen-Pflanzen auf“ vom 26. Mai. 2000. Publiziert im Internet unter: http://www.pressetext.at<br />
9
Report<br />
Pflanze selbst. Das mag auf den ersten Blick von Vorteil sein, stellt<br />
jedoch ein großes Naturschutzproblem dar. Viele der Ackerunkräuter<br />
sind bereits heute in ihrem Bestand gefährdet und der Einsatz von<br />
Totalherbiziden könnte sie zum Aussterben bringen. In der Folge sind<br />
auch jene Tiere betroffen, die an diese Ackerunkräuter gebunden sind.<br />
Amerikanische Insektenforscher sind im Rahmen von Untersuchungen<br />
über die Wanderungen des Monarchfalters auf dieses Problem gestoßen.<br />
Die Forscher befürchten, dass durch den Anbau genmanipulierter,<br />
herbizidresistenter Pflanzen die Monarchfalter gefährdet werden.<br />
Millionen von Monarchfaltern wandern jedes Jahr zwischen ihrem Winterquartier<br />
in Zentralmexiko und dem Sommerquartier in Südkanada und den<br />
USA (ca. <strong>2.</strong>500 Kilometer). Der Anbau herbizidresistenter Kulturpflanzen<br />
könnte die Nahrungsquelle der Larven gefährden.<br />
Denn der Einsatz von Totalherbiziden könnte die Seidenpflanze stark<br />
dezimieren, die als „Unkraut“ vorkommt und von welchen sich die<br />
Raupen des Monarchfalters hauptsächlich ernähren.<br />
13, 14<br />
Durch Auskreuzung können<br />
genmanipulierte<br />
Eigenschaften auf verwandte<br />
Wildarten übertragen werden<br />
Eine weitere Gefahr genmanipulierter Pflanzen liegt in der Möglichkeit,<br />
dass sie sich mit verwandten wilden Arten kreuzen. Verschiedene<br />
Untersuchungen haben diese Möglichkeit etwa für genmanipulierten<br />
Raps (Brassica napus)nachgewiesen, der sich beispielsweise mit wil-<br />
13 L. I. Wassenaar und K. A. Hobson (1998): Natal origins of migratory monarch butterflies at wintering colonies in Mexico: New isotopic evidence. Proceedings<br />
of the National Academy of Sciences of the USA 95(26):15436-15439<br />
14 C. Holden [Hrsg.] (1999): Monarchs and their Roots. Science 283:171.<br />
10
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
dem Kohl (Brassica rapa)oder Hederich (Raphanus raphanistrum) kreuzen<br />
kann.<br />
15, 16, 17<br />
In einer Studie dänischer Wissenschafter wurde mittels Versuchen<br />
nachgewiesen, dass die durch Kreuzung von herbizidresistentem Raps<br />
mit Wild-Kohl entstandenen „Hybride“ fruchtbar sind und sich mit<br />
dem natürlichen Wildkohl „rückkreuzen“ lassen. Nach nur zwei<br />
Rückkreuzungsversuchen mit dem Wild-Kohl waren 40 Prozent der<br />
Nachkommen ebenfalls herbizidresistent. Die Autoren folgern, dass<br />
„diese Ergebnisse darauf hinweisen, dass eine schnelle Ausbreitung<br />
manipulierter Gene von Gentech-Raps auf den verwandten Wild-Kohl<br />
möglich ist“. 18 So könnten beispielsweise „Superunkräuter“ entstehen,<br />
denen auch Totalherbizide nichts anhaben können. Das würde den<br />
Gedanken von herbizidresistenten Pflanzen ad absurdum führen.<br />
Die Annahme, dass sich Hybride (Kreuzungen) in der freien Natur nicht<br />
behaupten könnten, ist leider nicht stichhaltig. Untersuchungen mit<br />
Hybriden von Raps und Senf (Hirschfeldia incana) haben gezeigt, dass<br />
diese unter bestimmten Umweltbedingungen sogar konkurrenzfähiger<br />
sind als die Senf-Mutterpflanzen. 19 Neben Raps wurde die Möglichkeit<br />
der Auskreuzung auch für eine Reihe weiterer Kulturpflanzen – wie z.<br />
B. Zuckerrüben und Reis – auf verwandte Wild-Arten nachgewiesen. 20<br />
Auskreuzung ist besonders problematisch, wenn genmanipulierte<br />
Formen von Pflanzen in jenen Gebieten angebaut werden, wo sich die<br />
ursprüngliche Art im Rahmen der Evolution entwickelt hat (Entwicklungszentren).<br />
Denn dort wachsen in freier Natur viele nah verwandte<br />
Arten, die mögliche Auskreuzungs-Partner darstellen. Dies gilt z. B. für<br />
den Anbau von Raps in Europa und im Mittelmeerraum, Mais in Mexiko<br />
oder Reis in Asien. Wenn das eingebaute Gen den Wild-Pflanzen einen<br />
Konkurrenz-Vorteil verschafft (etwa durch erhöhte Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Schädlinge oder Krankheiten), dann ist es auch wahrscheinlich,<br />
dass sich diese Pflanzen in der freien Natur durchsetzen<br />
können. Die Folgen davon kann niemand abschätzen.<br />
15 R. B. Jörgensen und B. Andersen (1994): Spontaneous Hybridization between Oilseed Rape (Brassica napus) and weedy B. campestris (Brassicaceae): A risk<br />
of growing genetically modified Oilseed Rape. American Journal of Botany 81(12):1620-1626.<br />
16 A.-M. Chevre, F. Eber, A. Baranger und M. Renard (1997): Gene flow from transgenic crops. Nature 389:924.<br />
17 S. Frello, K. R. Hansen, J. Jensen, R. B. Jörgensen (1995): Inheritance of rapeseed (Brassica napus)-specific RAPS markers and a transgenic in the cross B. juncea<br />
x (B. juncea x B. napus). Theoretical and applied Genetics 91:236-241.<br />
18 T. R. Mikkelsen, B. Andersen und R. Bagger Jörgensen (1996): The risk of crop transgene spread. Nature 380:31.<br />
19 Lefol E., V. Danielou, H. Darmency, F. Boucher, J. Maillet und M. Renard (803) Gene dispersal from transgenic crops. I. Growth of interspecific hybrids between<br />
oilseed rape and the wild hoary mustard. Journal of applied Ecology 33:803-808.<br />
20 British Crop Protection Council [Hrsg.] (1999): Gene Flow and Agriculture: Relevance for Transgenic Crops. Proceedings of a symposium held at the University<br />
of Keele, Staffordshire 12 - 14 April 1999. BCPC symposium proceedings Nr. 72, Verl. BCPC Publ., Farnham, Surrey, 286 Seiten.<br />
11
Report<br />
Intensiver Einsatz von Giften<br />
fördert die Bildung von<br />
Resistenzen bei den betroffenen<br />
Lebewesen<br />
Herbizidresistenz kann aber nicht nur durch Auskreuzung entstehen,<br />
sondern auch durch natürliche Anpassungserscheinungen: Durch<br />
massiven Einsatz eines Giftes entsteht ein enormer Selektionsdruck<br />
auf die betroffenen Organismen. Individuen, die Abwehrmechanismen<br />
entwickeln, pflanzen sich schneller fort als andere und so entwickeln<br />
sich über kurz oder lang widerstandsfähige Populationen.<br />
1997 wurde erstmals berichtet, dass in Australien ein Weidelgras<br />
(Lolium rigidum)gegen das Unkrautvernichtungsmittel „Roundup-<br />
Ready“ resistent wurde. Ebenfalls 1997 tauchte eine resistente Form<br />
des Gänsegrases (Eleusina indica)<br />
Malaysien auf. Und in den USA<br />
entwickeln offenbar Amaranth-Pflanzen derzeit gesteigerte Toleranz<br />
gegen Roundup-Ready. Roundup-Ready ist ein Totalherbizid, das<br />
die Firma Monsanto mit ihren herbizidresistenten Pflanzen liefert.<br />
Der großflächige Anbau dieser Pflanzen fördert somit die<br />
Resistenzbildung bei Unkräutern.<br />
21, 22, 23<br />
Grundsätzlich können die gleichen Mechanismen bei virusresistenten<br />
Pflanzen 24 zur Bildung von Infektionserregern und bei Insektizid-produzierende<br />
Pflanzen zur Bildung von Insekten beitragen, welche die<br />
Abwehrmechanismen durchbrechen (siehe Seite 20).<br />
Pflanzen, die selbst ein<br />
Insektengift produzieren,<br />
töten nicht nur die Ziel-<br />
Organismen<br />
Die Idee scheint auf den ersten Blick einleuchtend: Pflanzen produzieren<br />
selbst ein Gift, das sie davor bewahrt, von Insekten aufgefressen zu<br />
werden. Doch so einfach ist die Sache nicht, denn das Gift tötet nicht<br />
nur die Schädlinge (Zielorganismen), sondern kann auch Nicht-<br />
Zielorganismen (darunter wertvolle Nützlinge) töten und damit das<br />
ökologische Gleichgewicht in der freien Natur stören.<br />
Das Gift von Bt-Pflanzen kann auch im Pollen produziert werden.<br />
Amerikanische Untersuchungen zeigen, dass durch den Wind verbreiteter<br />
Pollen von Bt-Pflanzen die Larven des Monarch-Falters schädigen<br />
kann. In Laborexperimenten wurden die Larven des Falters auf<br />
Seidenpflanzen aufgezogen, die mit Pollen von genmanipulierten Bt-<br />
Pflanzen bestäubt waren. Nach vier Tagen lebte von diesen Tieren beinahe<br />
nur mehr die Hälfte (56 Prozent), während auf den mit Nicht-Bt-<br />
Pollen verunreinigten Pflanzen alle Tiere überlebten. Weiters führte<br />
21 S. B. Powles und D. F. Lorraine-Colwill, J. J. Dellow, C. Preston (1998): Evolved resistance to glyphosate in rigid ryegrass. Weed Science 46:604-607.<br />
22 B. Hartzler (1998): Are Roundup Ready weeds in your future? Proceedings 18th Annual Crop Pest Management Short Course 18:12-19. Univ. Minnesota, St.<br />
Paul, MN..<br />
23 J. Doll (1999): Glyphosate Resistance in Another Plant. Wisconsin Crop Manager 171-172<br />
24 C. Eckelhamp, M. Jäger und B. Weber (1997): <strong>Risiko</strong>überlegungen zu transgenen virusresistenten Pflanzen. Studie des Öko-Institut Freiburg im Auftrag des<br />
Umweltbundesamtes, Berlin, 282 Seiten.<br />
12
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Bt-Pflanzen<br />
Sogenannten „Bt-Pflanzen“ wurde ein Gen des Bodenbakteriums<br />
Bacillus thuringiensis (Bt) eingebaut. Dadurch produzieren sie ein<br />
Gift, das Insekten tötet, wenn sie die Pflanze fressen.<br />
Derartige Sorten sind unter anderem von Mais, Kartoffel und<br />
Baumwolle erhältlich<br />
der Bt-Pollen dazu, dass die Larven weniger fraßen und daher langsamer<br />
wuchsen. Seidenpflanzen sind die wichtigsten Futterpflanzen der<br />
Monarch-Larven. Da diese Pflanzen vor allem in und am Rand von<br />
Äckern vorkommen und viele Bt-Pflanzen zu jener Zeit blühen, zu der<br />
auch die Monarch-Larven schlüpfen, besteht für die Monarch-Larven<br />
ein erhöhtes <strong>Risiko</strong> durch die Bt-Pflanzen zu sterben. Ähnliche<br />
Untersuchungen an der Iowa State-Universität deuten darauf hin, dass<br />
die im Bereich von Bt-Pflanzen real auftretenden Pollen-Ablagerungen<br />
tatsächlich ausreichen, um Larven des Monarchfalters zu töten. Für den<br />
Großteil der Schmetterlings-Arten liegen keine vergleichbaren Untersuchungen<br />
vor.<br />
25, 26<br />
Und was passiert, wenn sich Insekten von Insekten ernähren, die Bt-<br />
Pflanzen fressen? Angelika Hilbeck und Forschungskollegen von der<br />
Schweizer Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrarökologie und<br />
Landbau haben dazu folgenden Laborversuch durchgeführt:<br />
Maiszünsler-Larven wurden mit Maispflanzen gefüttert – und zwar einmal<br />
mit gentechnisch manipuliertem Bt-Mais und einmal mit natürlichem,<br />
nicht manipuliertem Mais. Diese Insekten wurden dann an<br />
Florfliegen-Larven verfüttert. Jene Florfliegen, die mit Insekten von Bt-<br />
Mais gefüttert wurden, starben mit doppelter Häufigkeit verglichen mit<br />
jenen, die Maiszünsler von natürlichen Pflanzen fraßen. Zwei<br />
Folgestudien haben bestätigt, dass Bt-Pflanzen über die Nahrungs-<br />
Insektengift-produzierende<br />
kette Nützlinge töten können.<br />
27, 28, 29<br />
Pflanzen gefährden wichtige<br />
Nützlinge<br />
25 L. Hansen (1999): Non-target effects of Bt-corn pollen on the Monarch butterfly (Lepidoptera: Danaidae). Poster. Veröffentlicht im Internet unter<br />
http://www.ent.iastate.edu<br />
26 J. E. Losey, L. S. Rayor, M. E. Carter (1999): Transgenic Pollen harms monarch larvae. Nature 399:214.<br />
27 A. Hilbeck, M. Baumgartner, P. M. Fried und F. Biegler (1998): Effects of transgenic Bacillus thuringiensis corn-fed prey on mortality and development time<br />
of immature Chrysoperla carnea. Environmental Entomology 27(2) :480-487.<br />
28 A. Hilbeck, W. J. Moar, M. Pusztai-Carey, A. Filippini und F. Bigler (1998): Toxicity of Bacillus thuringiensis CrylAb Toxin to the Predator Chrysoperla carnea<br />
(Neuroptera: Chrysopidae). Environmental Entomology 27(4):1255-1263<br />
29 A. Hilbeck, W. J. Moar, M. Pusztai-Carey, A. Filippini und F. Bigler (1999): Prey-mediated effects of Cry1Ab toxin and protoxin and Cry2A protoxin on the predator<br />
Chrysoperla carnea. Entomologia Experimentalis et Applicata 91: 305 – 316.<br />
13
Report<br />
Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass das Bt-Gift von Gentech-<br />
Maispflanzen auch über die Wurzeln in den Boden abgegeben wird.<br />
„Wir haben keine Hinweise darauf, wie Bodenlebewesen dadurch<br />
beeinflusst werden“, so die Wissenschafter. 30<br />
Mögliches Opfer von Gentech-Pflanzen: die nützliche Florfliege<br />
Negative Auswirkungen auf Nützlinge wurden auch bei genmanipulierten<br />
Kartoffeln festgestellt. Es handelte sich dabei um bisher am Markt<br />
nicht erhältliche, im Versuchsstadium befindliche Kartoffeln, welchen<br />
ein Gen des Schneeglöckchens eingepflanzt wurde, das sie gegen<br />
Insektenfraß schützen sollte. Wurden Läuse, die sich von diesen<br />
Pflanzen ernährten, an Marienkäfer verfüttert, so verschlechterte sich<br />
dadurch die Fruchtbarkeit, die Lebensfähigkeit der Eier und die<br />
Lebensdauer der Marienkäfer. 31<br />
Florfliegen und Marienkäfer gehören zu den wichtigsten Nützlingen in<br />
der biologischen Schädlingsbekämpfung, da deren Larven Blattläuse<br />
und andere Schädlinge mit großem Appetit fressen ohne selbst<br />
Schaden anzurichten. Über den beschriebenen Mechanismus können<br />
Insektengift-produzierende Pflanzen diese Nützlinge töten und somit<br />
die biologische Schädlingsbekämpfung schwächen.<br />
Über ein weiteres, mit Bt-Pflanzen verbundenes Problem lesen Sie im<br />
Kapitel über Biolandwirtschaft ab Seite 19.<br />
30 D. Saxena, S. Flores und G. Stotzky (1999): Insecticidal toxin in root execudates from Bt corn. Nature 402:480.<br />
31 A. N. E. Birch, I. E. Geoghegan, M. E. N. Majerus, J. W. McNicol, C. A. Hackett, A. M. R. Gatehouse und J. A. Gatehouse (1999): Tri-trophic interactions involving<br />
pest aphids, predatory 2-spot ladybirds and transgenic potatoes expressing snowdrop lectin for aphid resistance. Molecular Breeding 5:75-83.<br />
14
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Von Seiten der Gentech-Industrie wurde immer wieder versucht, herbizid-<br />
und insektenresistente Pflanzen als „ökologisch“ zu verkaufen.<br />
Damit würde, so die Argumentation, der Einsatz an umweltschädlichen<br />
Chemikalien reduziert.<br />
Erste Erfahrungen aus<br />
Amerika widerlegen die<br />
Versprechen der Gentech-<br />
Industrie<br />
Doch vor dem geschilderten Hintergrund wird klar, dass diese<br />
Argumentation nicht haltbar ist. Denn wenn Unkräuter resistent werden<br />
und Nützlinge sterben, dann wird man immer mehr und immer<br />
neue Chemikalien benötigen, um dieses System aufrechtzuerhalten –<br />
eine endlose Giftspirale.<br />
Der „World Wide Fund for Nature“ (WWF) Kanada ging in einer Studie<br />
der Frage nach, ob der Anbau gentechnisch manipulierter Pflanzen zu<br />
einer Verringerung des Pestizid-Einsatzes führt. Eine Auswertung der<br />
in den Jahren 1997 und 1998 gesammelten Erfahrungen zeigt, dass dies<br />
nicht der Fall ist. Ein Detail aus der Studie: In der Praxis ist es häufig<br />
so, dass – gerade weil die kultivierte Pflanze widerstandsfähig ist –<br />
häufiger Chemikalien eingesetzt werden. 32<br />
Der amerikanische Wissenschafter C. Benbrook sieht die Situation ähnlich.<br />
Benbrook war jahrelang als landwirtschaftlicher Berater des amerikanischen<br />
Präsidenten und des Repräsentantenhauses sowie als<br />
Mitarbeiter der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften tätig. In<br />
einer Studie hat Benbrook Daten über den Anbau genmanipulierter<br />
Soja im Jahre 1998 ausgewertet. Farmer die gentechnisch manipulierte<br />
Soja-Bohnen angebaut hatten, brauchten zwei- bis fünfmal mal mehr<br />
Herbizide (gemessen in Gewicht/Fläche) als Farmer, die konventionelle<br />
Unkrautvernichtungsmethoden anwenden. Farmer, die beim<br />
Pflanzenschutz nicht nur auf Chemie, sondern auch auf andere<br />
Kulturmaßnahmen setzen, brauchen oft nur ein Zehntel dieser Menge.<br />
Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass das Herbizid Roundup-<br />
Ready nur Pflanzen im Wachstumsstadium abtötet. Da sich aber nicht<br />
alle Unkräuter zum selben Zeitpunkt in dieser Phase befinden, wird<br />
ein mehrfacher Gifteinsatz notwendig. Ein anderer Grund liegt in der<br />
Bildung toleranter Unkräuter, wie sie weiter oben im Text beschrieben<br />
wurde. Die Studie von Benbrook brachte ebenfalls zu Tage, dass der<br />
erzielte Ertrag bei Gen-Soja durchschnittlich geringer ist als bei konventioneller<br />
Soja. In Summe kostet der Anbau genmanipulierte Soja<br />
32 World Wide Fund for Nature Canada (2000): Do Genetically Engineered (GE) Crops reduce Pesticides? The Emerging Evidence says not likely. Toronto, 14<br />
S. Publiziert im Internet unter: http://www.wwf.ca<br />
15
Report<br />
den Farmern bis zu 50 Prozent mehr als bei herkömmlichen<br />
Kultursorten. Wenn also die Rede davon ist, dass herbizidresistente<br />
Pflanzen weniger Unkrautvernichtungsmittel erfordern, dann fragt<br />
Benbrook: „Weniger im Vergleich zu was? Wenn es darum geht den<br />
Herbizid-Einsatz zu reduzieren, dann gibt es sicher bessere und billigere<br />
Alternativen das zu tun.“<br />
33, 34, 35<br />
33 C. Benbrook (1999): World Food System Challenges and Opportunities: GMOs, Biodiversity, and Lessons from America´s Heartland. Paper presented Jannury<br />
27, 1999 as a part of the University of Illinois World Food and Sustainable Agriculture Program. Publiziert im Internet unter: http://www.biotech-info.net.<br />
34 C. Benbrook (1999): Evidence of the Magnitude and Consequences of the Roundup Ready Soybean Drag from University-Based Varietal Trials in 1998. Ag<br />
BioTech InfoNet Technical Paper Number 1 (July 13). 28 Seiten. Veröffentlicht im Internet unter: http://www.biotech-info.net<br />
35 P. Montague (1999): Sustainability and AG Biotech. Rachel´s Environmental & Health Weekly Nr. 686, Electronic Edition. Veröffentlicht im Internet unter:<br />
http://www.rachel.org<br />
16
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Wachstumssteigerung um jeden Preis:<br />
Genmanipulierte Ti e r e<br />
Seit Jahrzehnten wird versucht, durch Genmanipulation die tierische<br />
Produktion zu steigern. Im Unterschied zu den Kulturpflanzen stehen<br />
hier nicht Resistenzen im Vordergrund, sondern das Ziel, mit möglichst<br />
wenig Futter möglichst viel Fleisch zu produzieren.<br />
Genmanipulierte Tiere als<br />
Fortsetzung der Massentierhaltung<br />
Bereits Ende der Achzigerjahre wurde versucht, das Wachstum von<br />
Nutztieren durch den Einbau von Hormon-Genen zu beschleunigen.<br />
Hormone sind chemische Botenstoffe, die über den Blutkreislauf im<br />
Körper verteilt werden und so in den Stoffwechsel eingreifen. Viele<br />
dieser Versuche verliefen problematisch, da Hormone und Wachstum<br />
sehr komplex zusammenspielen und diese Vorgänge bis heute nur<br />
wenig verstanden sind. Beispielsweise wurden Schafen Gene für ein<br />
Wachstumshormon eingebaut. Das Hormon wurde zwar in einigen der<br />
Schafe tatsächlich erzeugt, das Wachstum stieg dadurch aber nicht an.<br />
Dafür litten die Tiere an Diabetes und starben früh. Bei einem Tier<br />
wurde die Geschlechtsreife unterdrückt. 36<br />
Eingriffe in das<br />
Hormonsystem von Tieren<br />
verursachen Krankheit und<br />
Leid<br />
Vergleichbare Versuche mit Schweinen brachten ähnliche Ergebnisse.<br />
Die Schweine zeigten zwar den gewünschten Wachstumseffekt, litten<br />
aber an unzähligen Krankheiten: Magengeschwüre, Gelenksentzün-<br />
36 C. E. Rexroad, K. Mayo, D. J. Bolt, T. H. Elasser, K. F. Miller, R. R. Behringer, R. D. Palmiter und R. L. Brinster (1991): Transferrin- and Albumin-Directed<br />
Expression of Growth-Related Peptides in Transgenic Sheep. Journal of Animal Science 69:2995-3004.<br />
17
Report<br />
dungen, entzündliche Hautreaktionen, Herzvergrößerung und Nierenerkrankung.<br />
37<br />
Trotz dieser negativen Erfahrungen mit Eingriffen in das Hormonsystem<br />
wurde 1994 in den USA als erstes Gentech-Produkt im Lebensmittelbereich<br />
das sogenannte BST (Rindersomatropin), ein Rinder-Wachstumshormon,<br />
zugelassen. Es handelt sich dabei um ein mittels genmanipulierter<br />
Bakterien erzeugtes Hormon, das Kühen injiziert wird, damit<br />
sie mehr Milch geben. Ganz abgesehen von der Fragwürdigkeit solcher<br />
Maßnahmen angesichts landwirtschaftlicher Überproduktion ist dies für<br />
Tier und Mensch riskant. Es hat sich gezeigt, dass die Tiere vermehrt an<br />
Euterentzündung leiden. Der Konsum der Milch durch den Menschen,<br />
wird mit erhöhtem <strong>Risiko</strong> an Brust- oder Prostata-Krebs zu erkranken in<br />
Verbindung gebracht. In der Europäischen Union wurde daher die<br />
Anwendung des Hormons verboten.<br />
38, 39, 40, 41, 42, 43<br />
Die Freisetzung<br />
genmanipulierter Fische<br />
bedroht Populationen natürlicher<br />
Gewässer<br />
Als erste gentechnisch manipulierte Tiere könnten Fische in Kürze für<br />
den kommerziellen Einsatz zugelassen werden. Hauptziel der<br />
Manipulation ist es auch hier, durch Einpflanzung fremder Gene das<br />
Wachstum bei gleichzeitig möglichst wenig Nahrungsbedarf zu<br />
beschleunigen. Die amerikanische „A/F Protein Inc.“ bietet beispielsweise<br />
Lachse mit dem Handelsnamen „AquAdvantage Bred Salmon“<br />
an, die vier- bis sechsmal schneller wachsen als natürliche Lachse. 44<br />
Wenn es nach der Gentech-Industrie geht, dann kommen Lachse,<br />
Karpfen und Forellen in Zukunft genmanipuliert auf den Tisch.<br />
Was passiert, wenn solche Fische in die freie Natur gelangen? Forscher<br />
aus den USA haben diese Fragestellung mittels Computermodell<br />
untersucht und festgestellt, dass unter bestimmten Voraussetzungen<br />
schon wenige genmanipulierte Fische die natürlichen Fisch-Bestände<br />
ausrotten können. 45<br />
37 V. G. Pursel, C. A. Pinkert, K. F. Miller, D. J. Bolt, R. C. Campbell, R. D. Palmiter, R. L. Brinster, R. E. Hammer (1989): Genetic Engineering of Livestock. Science<br />
June 6:1281-1288.<br />
38 P. Montague (1998): Breast Cancer, rGBH and Milk. Rachel´s Environmental & Health Weekly Nr. 598, Electronic Edition. Veröffentlicht im Internet unter:<br />
http://www.rachel.org<br />
39 Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (1999): Report on Animal Welfare Aspects of the Use of Bovine Somatrophin. Bericht an den Rat<br />
der Europäischen Union, 10. März 1999, 91 Seiten. Veröffentlicht im Internet unter: http://europa.eu.int.<br />
40 D. S. Kronfeld (1991): Safety of Bovine Growth Hormone. Science 251:256.<br />
41 J. M. Chan, M. J. Stampfer, E. Giobannucci, P. H. Gann, J. Ma, P. Wilkinson, C. H. Hennekens, M. Pollak (1998): Plasma Insulin-Like Growth Factor-I and Prostate<br />
Cancer Risk: A Prospective Study. Science 279:563-566<br />
42 S. E. Hankinson (1998): Circulating concentrations of insulin-like growth factor I and risk of breast cancer. The Lancet 351(9113):1393-1396.<br />
43 T. B. Mepham, P. N. Schofiled, W. Zumkeller, A. M. Coterill (1994): Safety of milk from cows treated with bovine somatotropin. The Lancet 344:1445-1446.<br />
44 Firmeninformationen, veröffentlicht im Internet unter: http://webhoast.avint.net/afprotein<br />
45 W. M. Muir und R. D. Howard (1999): Possible ecological risks of transgenes effect mating success: Sexual selection and the Trojan gene hypothesis.<br />
Proceedings of the National Academy of Sciences of America 96(24):13853-13856<br />
18
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Erfahrungen mit der Freisetzung ortsfremder Fische zeigen, dass die<br />
Ergebnisse durchaus realistisch sind. In den Sechzigerjahren wurde<br />
beispielsweise der Nilbarsch in den afrikanischen Victoriasee eingesetzt.<br />
25 Jahre nach dem Einsetzen des ersten Nilbarsches waren<br />
bereits 70 Prozent der heimischen Fischarten ausgerottet und die<br />
Größe der natürlichen Fischgemeinschaften stark reduziert. 46<br />
Wenn genmanipulierte Fische in die freie Natur gelangen und sich<br />
gegen die natürlich vorkommenden Fische durchsetzen, dann könnte<br />
dies ähnliche Katastrophen auslösen.<br />
<strong>Gentechnik</strong> und Bio-Landwirtschaft:<br />
ein Wi d e r s p r u c h<br />
„Wir brauchen und wollen keine <strong>Gentechnik</strong>“ lautet die Devise von<br />
Biobauern auf der ganzen Welt. Der größte österreichische Biobauern-<br />
Verband „Ernte für das Leben“ hat schon vor Jahren <strong>Gentechnik</strong>-<br />
Freiheit in seine Produktionsrichtlinien aufgenommen. Mittlerweile ist<br />
durch EU-Recht vorgeschrieben, dass Bio-Produkte <strong>Gentechnik</strong>-frei<br />
sein müssen. Doch die Biobauern leben nicht in einer isolierten<br />
Umwelt. Der verstärkte Einsatz von <strong>Gentechnik</strong> in der Landwirtschaft<br />
gefährdet den biologischen Landbau durch verschiedene Wechselwirkungen.<br />
Die biologische<br />
Landwirtschaft kommt ohne<br />
<strong>Gentechnik</strong> aus<br />
Nützlinge wie der Marienkäfer sind wichtige „Mitarbeiter“ in der biologischen<br />
Schädlingsbekämpfung<br />
46 Kegel B. (1999): Die Ameise als Tramp - Von biologischen Invasionen. Verl. Ammann, Zürich, 416 Seiten.<br />
19
Report<br />
Pollenflug von benachbarten<br />
Gentech-Äckern verunreinigt<br />
die Ernte der Biobauern<br />
Wind oder Insekten können den Pollen von genmanipulierten Pflanzen<br />
verbreiten. Werden dadurch natürliche, nicht genmanipulierte Pflanzen<br />
bestäubt, dann enthält auch diese Ernte die manipulierten Gene.<br />
In Windrichtung sinkt die Pollenkonzentration von 100 Prozent beim<br />
Acker auf etwa 2 Prozent in 60 Meter, 1 Prozent in 200 Meter und 0,5<br />
Prozent in 500 Meter. Unter bestimmten Bedingungen kann fruchtbarer<br />
Mais-Pollen bis zu 180 Kilometer weit verweht werden. 47 Eine Studie<br />
des Ökologie-Instituts Freiburg hat gezeigt, dass unter realen<br />
Bedingungen die transgene Erbinformation durch Pollenflug von genmanipuliertem<br />
Mais auf Pflanzen eines Nachbarfeldes übertragen werden<br />
kann. 48 Der Pollen von Gentech-Raps kann durch den Wind über<br />
mindestens 2,5 km verbreitet werden. 49<br />
Negative Auswirkungen von<br />
Gentech-Pflanzen auf<br />
Nützlinge schaden der biologischen<br />
Landwirtschaft<br />
Der Pflanzenschutz im biologischen Landbau erfolgt durch eine<br />
Kombination mehrerer Maßnahmen. Eine davon ist die Förderung von<br />
nutzbringenden Insekten, die Schädlinge fressen. Wie weiter oben im<br />
Text gezeigt wurde, können durch den Anbau Insektengift-produzierender<br />
Gentech-Pflanzen Nützlinge geschädigt werden (siehe Seite<br />
13). Damit wird die biologische Schädlingsbekämpfung geschwächt.<br />
Großflächiger Anbau von Bt-<br />
Pflanzen könnte den Bio-<br />
Landbau um sein wichtigtes<br />
Pflanzenschutzmittel bringen<br />
Der Anbau von Bt-Pflanzen birgt noch ein weiteres <strong>Risiko</strong> für Biobauern<br />
in sich. Denn Bacillus thuringiensis-Präparate werden seit Jahren erfolgreich<br />
in der biologischen Landwirtschaft als natürliches Pflanzenschutzmittel<br />
verwendet. Wird dieses Gift vermehrt eingesetzt, so steigt<br />
dadurch der „Selektionsdruck“ auf die betroffenen Insekten. Das bedeutet,<br />
dass sich mit höherer Wahrscheinlichkeit Individuen bilden,<br />
die gegen das Gift immun sind.<br />
Die Wirkung von konventionellen Bt-Präparaten unterscheidet sich in<br />
vielerlei Hinsicht von jener der Bt-Pflanzen. In der Natur treten eine<br />
Vielzahl verschiedener Variationen des Giftes auf, weshalb sich<br />
Insekten nicht so leicht anpassen können. Die Gentech-Pflanzen dagegen<br />
produzieren nur eine Art des Giftes. Und Bt-Präparate werden in<br />
der biologischen Landwirtschaft sehr selektiv eingesetzt, das heißt nur<br />
zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, wo es die Situation erfordert. Die<br />
47 J. Emberlin (2000): Wind Pollination. In: GM on Trial – Scientific evidence presented in the defence of 28 Greenpeace volunteers on trial for their non-violent<br />
removal of GM maize crops (Hrsg: Greenpeace), London, S. 5-1<strong>2.</strong><br />
48 Freiburger Institut für Umweltchemie (1998): Untersuchung zur Ausbreitung einer gentechnisch veränderten Maissorte (BT 176) auf Nachbarfelder bei<br />
Riegel. FIUC-Bericht Nr. 98-16, Freiburg.<br />
49 A. M. Timmons, Y. M. Charters, J. W. Crawford, D. Burn, S. E. Scott, S. J. Dubbels, N. J. Wilson, A. Robertson, E. T. O´Brian, G. R. Squire, M. J. Wilkinson (1996):<br />
Risks from transgenic crops. Nature 380:487.<br />
20
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Bt-Pflanzen bilden im Gegensatz dazu in der ganzen Pflanze große<br />
Mengen des Giftes - und zwar immer und überall.<br />
50, 51<br />
Der vermehrte Einsatz von Bt-Pflanzen könnte Insekten daher widerstandsfähig<br />
gegen dieses Mittel machen und damit die biologische<br />
Landwirtschaft um ein wichtiges Pflanzenschutzmittel bringen.<br />
Wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass dies<br />
schneller möglich ist, als ursprünglich angenommen. In 10 Jahren, bei<br />
manchen Insektenarten bereits innerhalb weniger Jahre, könnte Bt-<br />
Resistenz bereits zum Problem werden. Die aktuelle Diskussion über<br />
„Resistenz-Management-Pläne“ in den USA bestätigt diese Befürchtungen.<br />
52, 53, 54, 55<br />
Am Ende der Gentech-Nahrungskette<br />
steht der Mensch<br />
Über verschiedene Wege landen die Produkte der <strong>Gentechnik</strong> auf<br />
unserem Tisch. Entweder direkt im Fall von genmanipulierten<br />
Tomaten oder Öl aus genmanipuliertem Raps. Oder indirekt als Fleisch<br />
von Tieren, die mit genmanipulierten Sojabohnen gefüttert wurden.<br />
Und auch weniger offensichtliche Wege führen vom Acker auf das<br />
Frühstücksbrot: Englische Wissenschafter haben in Versuchen nachgewiesen,<br />
dass genmanipuliertes Eiweiß aus dem Pollen von Gentech-<br />
Pflanzen mehrere Wochen in Bienen-Honig stabil erhalten bleiben<br />
kann. 56<br />
Gentechnisch manipulierte<br />
Lebewesen auf dem Weg in<br />
die Küche<br />
Mit Fütterungsversuchen an Mäusen haben deutsche Wissenschafter<br />
nachgewiesen, dass fremde Erbsubstanz (DNS) nicht im Magen zerstört,<br />
sondern über den Darm in den Körper aufgenommen werden<br />
kann. Sie haben Viren-DNS an Mäuse verfüttert und jene in der Folge<br />
in Blutzellen, der Milz und der Leber gefunden. Nach der Verfütterung<br />
Über den Darm kann fremde<br />
Erbsubstanz in den Körper<br />
aufgenommen werden<br />
50 Tapesser B. (1997): The differenes between conventional Bacillus thuringiensis strains and transgenic insect resistant plants. Possible reasons for rapid resistance<br />
Development and susceptibility of non-target organisms. Prepared for the third meeting of the open-ended Working Group on Biosafety, Okt 13-17,<br />
1997, Montreal. Gutachten des Ökologie-Instituts Freiburg, 5 Seiten.<br />
51 Villinger M. (1999): Effekte transgener insektenresistenter Bt-Kulturpflanzen auf Nicht-Zielorganismen am Beispiel der Schmetterlinge. Studie, herausgegeben<br />
vom WWF Schweiz, Zürich, 51 Seiten.<br />
52 Y.-B. Liu, B. E. Tabashnik, T. J. Dennehy, A. L. Patin, A. C. Bartlett (1999): Development time and resistance to Bt crops. Nature 400:519.<br />
53 F. Huang, L. L. Buschman, R. A. Higgins, W. H. McGaughey (1999): Inheritance of Resistance to Bacillus thuringiensis Toxin (Dipel ES) in the European Corn<br />
Borer. Science 284:965-967.<br />
54 F. Gould, A. Anderson, A. Jones, D. Sumerford, D. G. Heckel, J. Lopez, S. Micinski, R. Leonard und M. Laster (1997): Initial frequencies of alleles for resistance<br />
to Bacillus thuringiensis toxins in field populations of Heliothis virescens. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 94:3519-3523.<br />
55 B. E. Tabashnik, Y.-B. Liu, N. Finson, L. Masson und D. Heckel (1997): One gene in diamondback moth confers resistance to four Bacillus thuringiensis toxins.<br />
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 94:1640-1644.<br />
56 C. Eady, D. Twell und K. Lindsey (1994): Pollen viability and transgene expression following storage in honey. Transgenic Research 4:226-231.<br />
21
Report<br />
an trächtige Mäuse wurde die Fremd-DNS auch in Föten und<br />
Neugeborenen gefunden. Auf diese Weise kann über Lebensmittel<br />
gentechnisch manipulierte DNS aufgenommen werden – die Folgen<br />
sind unbekannt.<br />
57, 58<br />
Genmanipulation birgt die<br />
Gefahr ansteigender<br />
Lebensmittel-Allergien in sich<br />
Gene werden von Lebewesen in Proteine (Eiweiß) übersetzt. Und<br />
Lebensmittel-Allergien beruhen auf einer Überempfindlichkeit<br />
gegenüber Proteinen. Es besteht die Gefahr, dass mit der Anzahl neuer<br />
Proteine in Lebensmitteln auch die Häufigkeit von Nahrungsmittel-<br />
Allergien ansteigt. Wissenschafter aus den USA lieferten neuen<br />
Diskussionsstoff, als sie ihre diesbezüglichen Analysen mit genmanipulierten<br />
Soja-Bohnen veröffentlichten. Um den Nährstoffgehalt der<br />
Sojabohnen zu erhöhen, wurden den Pflanzen Gene der brasilianischen<br />
Paranuss eingebaut. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die auf<br />
die Paranuß allergisch reagieren, auch auf Gentech-Soja allergisch sind.<br />
Dies konnte nur festgestellt werden, da die Paranuss bereits als<br />
Allergieauslöser bekannt war. Einen eindeutigen Test für neue<br />
Allergene gibt es nämlich nicht. Die <strong>Gentechnik</strong> könnte somit unkontrollierbar<br />
allergieauslösende Lebensmittel auf den Markt bringen –<br />
ein groß angelegter Versuch am Konsumenten.<br />
59, 60, 61<br />
Antibiotika-Resistenz als Marker-Gene<br />
Einige der derzeit für den Markt zugelassenen Gentech-Pflanzen enthalten<br />
Gene, die ihnen Resistenz gegen Antibiotika verleihen. Der Bt-<br />
Mais der Firma Novartis kann beispielsweise die Wirkung des<br />
Antibiotika Ampicillin und einiger Penicilline inaktivieren. Die Gene<br />
dienen nur als sogenannte „Marker-Gene“, sind also ein „Werkzeug“<br />
der <strong>Gentechnik</strong>. Sie haben in der Pflanze letztendlich keine Funktion<br />
mehr und wären durch andere Methoden ersetzbar.<br />
57 W. Doerfler und R. Schubbert (1998): Uptake of foreign DNA from the environment: The gastrointestinal tract and the placenta as portals of entry. Wiener<br />
Klinische Wochenschrift, The Middle European Journal of Medicine 110(2):40-44.<br />
58 R. Schubbert, D. Renz, B. Schmitz und W. Doerfler (1997): Foreign (M13) DNA ingested by mice reaches peripheral leukocytes, spleen, and liver via the<br />
intestinal wall mucosa and can be covalently linked to mouse DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 94:961-966.<br />
59 Nestle M. (1996): Allergies to Transgenic Foods. Questions of Policy. The New England Journal of Medicine 334(11):726-728.<br />
60 J. A. Nordlee, S. L. Taylor, J. A. Townsend, L. A. Thomas und R. K. Bush (1996): Identification of a Brazil-Nut Allergen in Transgenic Soyabeans. The New<br />
England Journal of Medicine 334(11):688-68<strong>2.</strong><br />
61 B. Weber (1998): Gesundheitliche Risiken gentechnisch veränderter Lebensmittel, insbesondere Allergierisiken transgener Pflanzen. Soziale Medizin Nr.<br />
3:38-14<br />
22
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
1928 entdeckte Arthur Fleming das Antibiotikum Penicillin. Seither<br />
haben sich Antibiotika als wichtige und teilweise einzige Medikamente<br />
gegen Krankheiten wie Hirnhautentzündung, Tuberkulose und Lungenentzündung<br />
bewährt. Seit geraumer Zeit wird jedoch ein Ansteigen<br />
resistenter Krankheitserreger verzeichnet. Dies kommt einem medizinischen<br />
Albtraum gleich: Wie vor der Entdeckung von Penicillin könnten<br />
dadurch kleine Verletzungen zu schweren Krankheiten führen. 62<br />
Antibiotika-Marker-Gene verstärken<br />
die Bildung antibiotikaresistenter<br />
Krankheitserreger<br />
Die breite Anwendung von Gentech-Pflanzen mit Antibiotikaresistenz-<br />
Genen könnte die Bildung antibiotikaresistenter Krankheitserreger<br />
wesentlich verstärken. Bakterien können im Darm von Tieren (zum<br />
Beispiel von Gentech-Futtermittel) oder Menschen (etwa von Gentech-Tomaten)<br />
Antibiotika-Resistenzgene aufnehmen und dadurch<br />
selbst resistent werden. Dies ist ein Problem der Human- und Tiermedizin<br />
gleichermaßen.<br />
63, 64<br />
Prof. P. Courvalin beschäftigt sich am „Nationalen Zentrum für Widerstandsmechanismen<br />
gegen Antibiotika“ des Pasteur-Instituts in Paris<br />
mit Fragen der Antibiotika-Resistenz. Courvalin ist der Meinung, dass<br />
gentechnisch veränderte Organismen das Problem der Antibiotika-<br />
Resistenz verstärken können. Er stellt die rhetorische Frage: „Ist es<br />
angebracht, in den transgenen Pflanzen Gene verbleiben zu lassen, die<br />
für sie nutzlos sind und zur Resistenz beitragen gegen größere Antibiotikaklassen?<br />
Ist all dies angebracht, wo doch seit über zwanzig Jahren<br />
keine einzige neue Antibiotikaklasse in der klinischen Medizin eingeführt<br />
wurde?“ 65<br />
Am „Rowett Research Institute“ im schottischen Aberdeen wird seit<br />
Jahren an gentechnisch manipulierten Kartoffeln geforscht. Ziel ist es,<br />
Kartoffel-Pflanzen so zu manipulieren, dass sie ein Gift gegen<br />
Schädlinge produzieren, vom Menschen aber gefahrlos gegessen werden<br />
können. Dazu wurden den Pflanzen Gene des Schneeglöckchen<br />
eingebaut. In der Folge produzieren die Pflanzen ein Eiweiß aus der<br />
Gruppe der Lektine, das für Insekten giftig ist.<br />
Der „Fall Pusztai“ – Vom<br />
Umgang mit <strong>Gentechnik</strong>kritischen<br />
Forschungsergebnissen<br />
62 S. B. Levy (1998): The Challenge of Antibiotic Resistance. Scientific American March:32-39.<br />
63 C. Eckelkamp, M. Jäger und B. Weber (1997): Antibiotikaresistenzgene in transgenen Pflanzen, insbesondere Ampicillin-Resistenz in Bt-Mais. Studie des<br />
Ökologie-Institut Freiburg im Auftrag von Greenpeace, Freiburg.<br />
64 A. Baier und B. Tappeser (1999): Therapeutische Relevanz von Antibiotika in Zusammenhang mit der Nutzung von Antibiotikaresistenzgenen in transgenen<br />
Pflanzen. Kurzgutachten des Ökologie-Instituts Freiburg im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, Freiburg. Publiziert im Internet unter:<br />
http://www.oeko.de/deutsch/gentech/gentech.htm<br />
65 P. Courvalin (1998): Plantes transgéniques et antibiotiques. La Recherche 309:36-40.<br />
23
Report<br />
Dr. Pusztai, ein erfahrener und international anerkannter Lektin-<br />
Experte des Instituts, sollte in Versuchen die gesundheitlichen Auswirkungen<br />
der genmanipulierten Kartoffeln testen. Dazu wurden über<br />
10 Tage Mäuse mit folgenden drei Nahrungstypen gefüttert: Erstens<br />
mit natürlichen Kartoffeln, zweitens mit genmanipulierten Lektin-<br />
Kartoffeln und drittens mit natürlichen Kartoffeln vermischt mit Lektin,<br />
das separat hergestellt wurde.<br />
Der „Fall Pusztai“ begann damit,<br />
dass Kartoffeln ein Gen<br />
des Schneeglöckchens eingebaut<br />
wurde ...<br />
Pusztai stellte bei einigen Versuchstieren Veränderungen fest: Es<br />
waren dies ein verringertes Gewicht verschiedener Organe sowie<br />
Veränderungen im Immunsystem. Diese Effekte traten nur bei jenen<br />
Tieren auf, die mit Lektin-Kartoffeln gefüttert wurden. Sowohl die<br />
Versuchstiere, die natürliche Kartoffeln, als auch jene, die natürliche<br />
Kartoffeln gemischt mit Lektin fraßen, zeigten keine derartigen<br />
Veränderungen. Pusztai schloß daraus, dass diese Effekte nicht auf das<br />
Lektin an sich zurückzuführen sind, sondern mit dem gentechnischen<br />
Verfahren in Zusammenhang stehen. Seiner Meinung nach sind die<br />
gängigen Verfahren zur Prüfung gentechnisch manipulierter<br />
Lebensmittel nicht ausreichend, um solche Risiken zu erkennen. 66<br />
Die Präsentation seiner Zwischenergebnisse im August 1998 schlug ein<br />
wie eine Bombe. Pusztai wurde binnen zweier Tage vom Dienst suspendiert,<br />
weil er angeblich irreführende Schlüsse aus seinen<br />
Ergebnissen gezogen hat. Nach langem hin und her wurden die Daten<br />
Ende 1999 in der Zeitschrift „The Lancet“ doch noch publiziert. 67 Der<br />
Streit um die Bedeutung der Resultate hält bis heute unvermindert an.<br />
Die <strong>Risiko</strong>beurteilung für<br />
Gentech-Lebensmittel ist<br />
unzureichend<br />
Zwei Erkenntnisse lassen sich aus dem „Fall Pusztai“ aber mit<br />
Sicherheit ableiten: Erstens scheinen die Ergebnisse von großer<br />
Bedeutung zu sein, denn sonst wäre der Druck auf Pusztai und das<br />
Rowett Research Institute nicht so groß. Immerhin wurde die wissenschaftliche<br />
Reputation von Dr. Pusztai nach 35 Jahren Arbeit binnen<br />
zweier Tage ruiniert. Dr. Hoppichler von der Bundesanstalt für<br />
Bergbauernfragen in Wien hat sich gemeinsam mit Kollegen aus aller<br />
Welt hinter Pusztai gestellt und ein entsprechendes Memorandum<br />
unterzeichnet. „Für mich ist es nicht akzeptabel, dass ein angesehenes<br />
66 Bundesverband Verbraucher Initiative (1999): Streitfall Lektin-Kartoffeln. Sicherheitsüberprüfung in der Diskussion. Dossier zum Fall Pusztai publiziert im<br />
Internet unter http://www.transgen.de<br />
67 S. W. B. Ewen und A. Pusztai (1999): Effects of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intenstine. The<br />
Lancet 354:1353-1354.<br />
24
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinschaft suspendiert wird, weil<br />
seine Forschungsergebnisse nicht zum ökonomischen Mainstream und<br />
den Interessen der EU-Politik passen“, so Hoppichler über seine Beweggründe.<br />
68<br />
Zweitens sind die Ergebnisse von großer Bedeutung für die <strong>Risiko</strong>abschätzung<br />
gentechnisch manipulierter Lebensmittel. Denn in der<br />
staatlichen <strong>Risiko</strong>beurteilung steht die Frage im Vordergrund, ob sich<br />
das Gentech-Produkt substanziell vom natürlichen Produkt unterscheidet.<br />
Was „substanziell unterschiedlich“ bzw. „substanziell gleich“<br />
bedeutet ist nicht klar definiert. Selbstverständlich sind genmanipulierte<br />
Pflanzen anders beschaffen als natürliche. Die Gentech-<br />
Sojapflanze der Firma Monsanto wäre sonst wohl kaum herbizidresistent<br />
und als neuartiges Lebewesen patentierbar. Dennoch wurde im<br />
Zulassungsverfahren entschieden, dass sich die Gentech-Sojabohne<br />
substanziell nicht von der natürlichen Soja-Bohne unterscheidet. Und<br />
zwar weil für die einzelnen Veränderungen isoliert betrachtet keine<br />
negativen Auswirkungen erwartet wurden. Pusztai hat in seinem Versuch<br />
gezeigt, dass genau dieser Ansatz falsch ist. Er ist in seinem<br />
Versuch davon ausgegangen, dass die verschiedenen Nahrungstypen<br />
„substanziell gleich“ sind. Doch obwohl das Lektin alleine keinen<br />
Effekt hervorgerufen hat, wirkte sich das Lektin-Gen in der transgenen<br />
Kartoffel negativ aus. Aus diesem Grund ist der Ansatz der „Substanziellen<br />
Äquivalenz“ für die <strong>Risiko</strong>beurteilung von Gentech-Lebensmittel<br />
völlig unzureichend. 69, 70 25<br />
68 J. Hoppichler (1998): What we may learn from the genetically engineered lectin-potato and the suspension of Dr. Pusztai. Kommentar vom 10. September<br />
1998, publiziert im Internet unter: http://plab.ku.dk/tcbh/hoppichlercommentpusztai.html.<br />
69 B. Tappeser (1999): Human and animal health impacts of transgenic crops. The results of feeding experiments with transgenic potatoes. Consequences for<br />
the Biosafety Protocol. To the participants of the Sixth Open-ended Ad Hoc Working Group on Biosafety negotiating the final wording of an internationally<br />
binding Biosafety Protocol under the Convention on Biological Diversity taking place in Cartagena, Colombia, 15.-19.<strong>2.</strong>1999. Stellungnahme des Ökologie-<br />
Institut Freiburg.<br />
70 Millstone E., E. Brunner und S. Mayer (1999): Beyond `substantial equivalence. Showing that a genetically modified food is chemically similar to its natural<br />
counterpart is not adequate evidence that it is safe for human consumption. Nature 401:525-526.
Report<br />
3. Zusammenfassende A n a l y s e<br />
<strong>Gentechnik</strong> in Landwirtschaft<br />
und Lebensmittelproduktion<br />
birgt eine Vielzahl von<br />
Risiken in sich<br />
Der vorliegende Report zeigt anhand von Fallbeispielen aus Wissenschaft<br />
und Forschung, dass der Einsatz von <strong>Gentechnik</strong> in Landwirtschaft<br />
und Lebensmittelproduktion mit einer Reihe von Gefahren<br />
verbunden ist:<br />
• Genmanipulierte Organismen zeigen in der freien Natur häufig völlig<br />
unerwartete Eigenschaften<br />
• Gentech-Mikroorganismen können Bodenökosysteme massiv stören<br />
• Durch „Horizontalen Gentransfer“ können manipulierte Gene in der<br />
freien Natur unkontrolliert verbreitet werden<br />
• Herbizidresistente Gentech-Pflanzen ermöglichen den Einsatz<br />
allesvernichtender Totalherbizide. Das gefährdet bestimmte Pflanzenarten<br />
sowie von den Pflanzen abhängige Tiere (z. B. Insekten,<br />
Vögel, etc.) in ihrem Bestand. Weiters wird dadurch die Bildung<br />
resistenter Superunkräuter gefördert.<br />
• Insektengift-produzierende Gentech-Pflanzen können auch Nicht-<br />
Ziel-Organismen und Nützlinge schädigen<br />
• Durch Auskreuzung können Gene und damit Eigenschaften von<br />
Gentech-Kulturpflanzen auf nah verwandte Wildarten übertragen<br />
w e r d e n<br />
• Genmanipulation an Tieren verursacht Krankheit und Leid<br />
• Die Freisetzung genmanipulierter Tiere (wie Fische) stellt für die<br />
natürlichen Lebensgemeinschaften eine Bedrohung dar<br />
• Die Nutzung der <strong>Gentechnik</strong> in der Landwirtschaft gefährdet über<br />
verschiedene Wechselwirkungen den ökologischen Landbau<br />
• Genmanipulierte Lebensmittel stellen eine neue Form der Nahrung<br />
dar, die mit unabsehbaren Risiken – etwa neuen Allergien – verbunden<br />
ist.<br />
Atomtechnologie, synthetische<br />
Chemie und <strong>Gentechnik</strong><br />
sind „harte“ Technologien<br />
<strong>Gentechnik</strong> ist nicht per se gut oder schlecht. Zweifelsohne handelt es<br />
sich aber um eine harte Technologie. Eine sanfte Technologie ist fehlertolerant,<br />
wieder rückgängig machbar, dezentral, öffentlich zugängig,<br />
lokal orientiert und lokal kontrollierbar. <strong>Gentechnik</strong> ist eine harte<br />
Technologie: Kleine Fehler können zu Katastrophen führen, die<br />
Wirkung ist unabsehbar und nicht wieder rückgängig zu machen, und<br />
sie ist von den großen Gentech-Konzernen in fester Hand.<br />
26
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
Mit dem Eingriff in das Erbgut werden Lebewesen geschaffen, die in<br />
der Natur keinen angestammten Platz haben. Im Laufe der Evolution<br />
entstehen Arten innerhalb extrem langer Zeiträume und immer in<br />
Interaktion mit der Umwelt. Die <strong>Gentechnik</strong> umgeht diese Mechanismen<br />
und schafft von heute auf morgen völlig neuartige Lebewesen.<br />
Ähnlich schwerwiegende Eingriffe in die Natur stellen die synthetische<br />
Chemie und die Atomtechnologie dar. Und die negativen Folgen dieser<br />
Technologien sind mittlerweile leider hinlänglich bekannt.<br />
Das Zahlenspiel mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann nicht beruhigen.<br />
Denn auch wenn manche potentiellen Gefahren gentechnisch<br />
veränderter Organismen nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreffen:<br />
Durch die wachsende Anzahl zugelassener Gentech-Lebewesen<br />
und deren vermehrter Einsatz ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis<br />
der „größte anzunehmende Unfall“ (GAU) eintritt.<br />
Der gentechnische „GAU“ ist<br />
nur eine Frage der Zeit ...<br />
Politik und Industrie versprechen daher, dass genmanipulierte<br />
Lebewesen nur dann erlaubt werden, wenn sie „für Mensch und Natur<br />
ungefährlich“ sind. Doch wie wird das beurteilt? Die Ökosysteme sind<br />
bis heute nur wenig verstanden. Wie Boden, Wiesen oder Wälder<br />
„funktionieren“ ist großteils unbekannt. Ähnliches gilt für die menschliche<br />
Gesundheit – etwa das Immun- oder Hormonsystem. Daher ist es<br />
praktisch unmöglich die Gefahr abzuschätzen, die von genmanipulierten<br />
Lebewesen für Mensch und Natur ausgehen. Und wer bestätigt die<br />
Sicherheit? Die überforderten Beamten in Brüssel und die nationalen<br />
Ministerien können das nicht leisten. Es sind die Antragsteller selbst,<br />
die die Studien durchführen bzw. in Auftrag geben!<br />
Die Auswirkungen der<br />
<strong>Gentechnik</strong> auf die Natur<br />
können nur grob untersucht<br />
werden<br />
27
Report<br />
Eine Analyse der Untersuchungen zu den Auswirkungen von Insektengift-produzierenden<br />
Pflanzen auf Nützlinge hat gezeigt, dass die Untersuchungen<br />
teilweise nicht einmal vom methodischen Ansatz her geeignet<br />
sind, die bekannten Gefahren zu untersuchen. 71 Wie sonst ist es erklärbar,<br />
dass Österreich ein Importverbot für den genmanipulierten Bt-<br />
Mais mit Antibiotikaresistenz-Genen verhängt hat? Dies obwohl der<br />
Mais zuvor im Rahmen der <strong>Risiko</strong>beurteilungsverfahren nach europäischem<br />
Recht geprüft, für sicher befunden und daher zugelassen<br />
wurde. 72<br />
Die Lösung im Umgang mit<br />
der <strong>Gentechnik</strong> liegt im<br />
Vorsorgeprinzip<br />
Die Naturwissenschaften sind weder heute, noch werden sie in Zukunft<br />
im Stande sein, mit Sicherheit ein Gentech-Produkt als „sicher“ oder<br />
„gefährlich“ zu beurteilen. Es ist Aufgabe der Politik mit dieser Unsicherheit<br />
umzugehen. Das kann aber nicht bedeuten, dass man etwas<br />
als ungefährlich erklärt, wenn die Gefahr wissenschaftlich noch nicht<br />
bekannt, nachweisbar oder abschätzbar ist. Denn so wird Unwissenheit<br />
zum Garant für Sicherheit erklärt. Die Lösung liegt im Vorsorgeprinzip,<br />
das im Zweifelsfall für die Natur spricht. Eher unterlassen als riskieren,<br />
besser zuwarten als blind lospreschen lautet die Devise.<br />
Bauern brauchen keine<br />
<strong>Gentechnik</strong> und die<br />
Konsumenten wollen sie nicht<br />
Für <strong>Gentechnik</strong> in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion ist<br />
das Vorsorgeprinzip besonders leicht zu realisieren. Denn es ist nicht<br />
nur sicher, dass die <strong>Gentechnik</strong> in diesem Bereich ein <strong>Risiko</strong> in sich<br />
birgt. Es ist auch sicher, dass die Bauern die <strong>Gentechnik</strong> nicht brauchen<br />
und die Konsumenten keine Gentech-Lebensmittel wollen. Das<br />
hat das <strong>Gentechnik</strong>-Volksbegehren in Österreich eindeutig gezeigt.<br />
Warum dennoch versucht wird, die Bevölkerung mittels Zwangsernährung<br />
von Gentech-Lebenmittel zu überzeugen, bleibt unverständlich.<br />
Es muss wohl am Einfluss der wenigen großen Chemie-,<br />
Agrar- und Lebensmittelkonzerne liegen, denn sie sind es, die vorrangig<br />
davon profitieren.<br />
Für die Bauern bedeutet <strong>Gentechnik</strong>, ein Stück Freiheit aufzugeben.<br />
Sie werden zu Leibeigenen der Gentech-Multis. Ihnen wird in Knebelverträgen<br />
genauestens vorgeschrieben, was sie dürfen und was sie vor<br />
allem nicht dürfen. Zu letzterem gehört zum Beispiel die Saatgut-<br />
71 A. Hilbeck, M. S. Meier und A. Raps (2000): Review on Nont-Target Organisms and Bt-Plants. Studie der Ecostrat GmbH. (Ecological Technology Asessment<br />
& Environmental Consulting) im Auftrag von Greenpeace. Amsterdam, 80 Seiten.<br />
72 Bundesministerium für Gensundheit und Konsumentenschutz (1997): Gründe für die österreichische Entscheidung, den Gebrauch und Verkauf von gentechnisch<br />
veränderten Maislinien, notifiziert von CIBA-GEIGY in Übereinstimmung mit der Richtlinie 90/220/EWG und zugelassen von Frankreich am 5. <strong>2.</strong><br />
1997 zu verbieten. Skriptum, Wien, 9 Seiten.<br />
28
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
gewinnung aus der Ernte. Sie müssen jedes Jahr das Saatgut und die<br />
zugehörigen Chemikalien neu kaufen, ansonsten drohen deftige<br />
Strafen. Die Entwicklung des Terminatorgens geht ebenfalls in diese<br />
Richtung. Durch diese Genmanipulation wird erreicht, dass die Samen<br />
genmanipulierter Pflanzen nicht mehr keimfähig sind.<br />
Um <strong>Gentechnik</strong> dennoch zu rechtfertigen, werden letztendlich immer<br />
wieder die Argumente „Arbeitsplätze“ und „Ernährung der Entwicklungsländer“<br />
angeführt. Aber Arbeitsplätze bieten auch die alternativen,<br />
umweltfreundlichen Technologie-Sparten. Und zwar im<br />
Gegensatz zur <strong>Gentechnik</strong> nicht risikobehaftet und dafür nachhaltig.<br />
Eine Studie des Europäischen Zentrums für Wirtschaftsforschung und<br />
Strategieberatung „prognos“ stellte fest, dass die Umstellung auf ökologische<br />
Landwirtschaft in Summe positive Effekte auf die Beschäftigungsbilanz<br />
hätte. 73<br />
Die Scheinargumente von<br />
„Arbeitsplätzen“ und „Ernährung<br />
der Entwicklungsländer“<br />
greifen nicht<br />
Und die Hungersnöte in den Entwicklungsländern kann <strong>Gentechnik</strong><br />
leider nicht lösen. Denn es handelt sich dabei vor allem um ein Verteilungs-<br />
und nicht ein Produktionsproblem.<br />
Nach jahrelangem Ignorieren sind Politik und Industrie mittlerweile<br />
zumindest in der EU gezwungen, die ablehnende Haltung der Bevölkerung<br />
gegen <strong>Gentechnik</strong> in der Landwirtschaft ernst zu nehmen.<br />
Händler listen Gentech-Nahrung aus, mehrere Länder verbieten einzelne<br />
Gentech-Pflanzen und die Kennzeichnungs-Pflicht für Gentech-<br />
Lebensmittel soll verschärft werden. Die kritische Haltung ist auch<br />
schon von Europa auf die USA und Asien übergeschwappt. Selbst das<br />
„Wall Street Journal“ riet 1999 von Investitionen in den Gentech-Sektor<br />
ab. Doch der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Für die Gentech-<br />
Multis bedeutet dies alles nur, dass sie mit noch mehr Druck ihre<br />
Produkte am Markt durchsetzen müssen.<br />
73 Scheelhasse J. und K. Haker (1999): Mehr Arbeitsplätze durch ökologisches Wirtschaften? – Eine Untersuchung für Deutschland, die Schweiz und Österreich.<br />
Studie des Europäischen Zentrums für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung „Prognos“ im Auftrag von Greenpeace, Köln, 294 Seiten.<br />
29
Report<br />
Greenpeace setzt sich weltweit<br />
für <strong>Gentechnik</strong>-freie<br />
Landwirtschaft und<br />
Lebensmittel ein<br />
Gemeinsam mit lokal ansässigen Bauern protestiert Greenpeace gegen illegalen<br />
Anbau von Gentech-Raps<br />
Greenpeace kämpft daher weltweit für ...<br />
• Eine <strong>Gentechnik</strong>-freie Landwirtschaft<br />
• Die Förderung der Biologischen Landwirtschaft<br />
• Die Anwendung des Vorsorgeprinzips im Umgang mit der <strong>Gentechnik</strong><br />
• <strong>Gentechnik</strong>-freie Zonen (z. B. Österreich, Schweiz, Toskana etc.)<br />
• Keine Zwangsernährung mit Gentech-Lebensmittel. Nicht die Gentech-Konzerne,<br />
sondern die Kunden sollten entscheiden, was auf<br />
den Tisch kommt.<br />
30
<strong>Risiko</strong> <strong>Gentechnik</strong><br />
4. A c t ! - Ti p s<br />
Ob sich der Einsatz der <strong>Gentechnik</strong> in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion durchsetzen wird,<br />
hängt wesentlich davon ab, ob die Konsumenten diese Produkte kaufen. Hier finden Sie drei A c t !-<br />
Tips, wie Sie sich vor Gentech-Lebensmitteln schützen können.<br />
Kaufen Sie <strong>Gentechnik</strong>-freie Lebensmittel<br />
• Kaufen Sie Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft. Denn biologische Lebensmittel müssen<br />
auch <strong>Gentechnik</strong>-frei sein! Darüberhinaus vermeiden sie mit Bio-Lebensmitteln eine Reihe<br />
weiterer Umweltprobleme, da im biologischen Landbau weder chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel<br />
(Pestizide), noch Kunst-Dünger eingesetzt werden. Die Tierhaltung muss artgerecht<br />
erfolgen, und es ist nur eine eingeschränkte Anzahl von Zusatzstoffen zulässig. Da die Begriffe<br />
rechtlich geschützt sind, muss überall „bio“ drinnen sein, wo „aus biologischem Anbau“, „aus biologischem<br />
Landbau“ oder „aus biologischer Landwirtschaft“ auf der Verpackung steht. Statt „biologisch“<br />
können auch die Worte „organisch-biologisch“, „biologisch-dynamisch“ oder „ökologisch“<br />
verwendet werden.<br />
• Auch auf die Aufschrift „<strong>Gentechnik</strong>-frei erzeugt“ können sie sich verlassen. Denn<br />
dieser Begriff ist im Österreichischen Lebensmittelcodex klar definiert und darf nur<br />
in diesem Sinne verwendet werden. Am weitesten verbreitet ist das Gütesiegel der<br />
„ARGE für <strong>Gentechnik</strong>-frei erzeugte Lebensmittel“ (siehe Abbildung), das kontrolliert<br />
<strong>Gentechnik</strong>-freie Qualität garantiert. Weitere Informationen finden Sie im<br />
Internet unter www.gentechnikfrei.at.<br />
• Kaufen Sie keinesfalls Produkte mit der Aufschrift „hergestellt aus genetisch verändertem ...“.<br />
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Produkte mit gentechnisch veränderten Bestandteilen<br />
nach EU-Recht nur dann gekennzeichnet werden müssen, wenn die Veränderung im<br />
Endprodukt nachweisbar ist. Dies ist häufig nicht der Fall! Vorsicht ist daher insbesonders bei Ölen<br />
und Fetten aus Soja, Raps oder Mais angebracht, die nicht als „Biologisch“ oder „<strong>Gentechnik</strong>-frei“<br />
gekennzeichnet sind. Da in der österreichischen und schweizer Landwirtschaft bis heute keine<br />
genmanipulierten Pflanzen angebaut werden dürfen, kann man bei Produkten aus ausschließlich<br />
inländischem Anbau davon ausgehen, dass Sie <strong>Gentechnik</strong>-frei sind.<br />
31
Report<br />
Werden Sie Gen-Detektiv<br />
Fast alle Supermarktketten Österreichs haben versprochen, keine Gentech-Produkte zu verkaufen.<br />
Um dies zu kontrollieren hat Greenpeace die „Gendetektive“ ins Leben gerufen. Diese melden an<br />
Greenpeace, wenn sie genmanipulierte Produkte beim Einkaufen entdecken. Greenpeace verschickt<br />
daraufhin an alle Detektive eine Warnung und fordert den Produzenten bzw. Händler auf, das Produkt<br />
aus dem Programm zu nehmen. Auch Sie können Gendetektiv werden! Nähere Informationen dazu<br />
finden Sie auf der Greenpeace-Homepage unter www.greenpeace.at/gen-detektive<br />
Unterstützen Sie die Arbeit von Greenpeace<br />
Greenpeace setzt sich weltweit gegen die Risiken der <strong>Gentechnik</strong> und für eine nachhaltige und<br />
gesunde Lebensmittelproduktion ein. Sie können diese Arbeit als Förderer unterstützen. Nähere<br />
Informationen erhalten Sie bei:<br />
Greenpeace Österreich<br />
Siebenbrunneng. 44<br />
A-1050 Wien<br />
Tel: 0043/1/5454580<br />
Fax: 0043/1/5454588<br />
Email: office@greenpeace.at<br />
Homepage: www.greenpeace.at<br />
Greenpeace Schweiz<br />
Postfach<br />
Heinrichtstr. 147<br />
CH-8031 Zürich<br />
Tel: 0041/1/447 41 41<br />
Fax: 0041/1/447 41 99<br />
E-mail: gp@greenpeace.ch<br />
internet: www.greenpeace.ch<br />
32




![3. Die Energie-[R]evolution](https://img.yumpu.com/22078498/1/184x260/3-die-energie-revolution.jpg?quality=85)