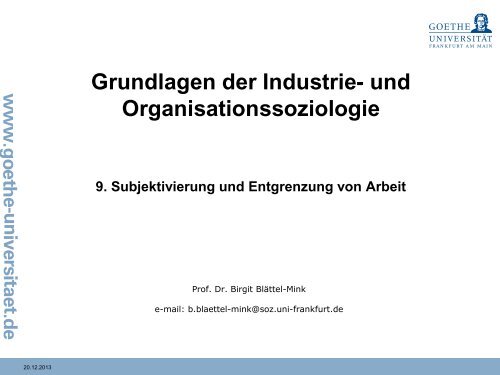Subjektivierung u Entgrenzung
Subjektivierung u Entgrenzung
Subjektivierung u Entgrenzung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Grundlagen der Industrie- und<br />
Organisationssoziologie<br />
9. <strong>Subjektivierung</strong> und <strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit<br />
Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink<br />
e-mail: b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de<br />
20.12.2013
Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie lehrt<br />
uns, dass das Funktionieren von Organisationen eher<br />
unwahrscheinlich ist. Wie begründen die VertreterInnen<br />
dieses Ansatzes ihre Behauptung und warum funktionieren<br />
Organisationen ihnen zufolge dennoch? Sie können diese<br />
Frage gerne entlang eines Beispiels beantworten.<br />
20.12.2013<br />
1
<strong>Subjektivierung</strong> und <strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit<br />
Kleemann, Frank/ Matuschek, Ingo/ Voß, Günter G.<br />
(2002): <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit. Ein Überblick zum Stand<br />
der soziologischen Diskussion. In: Moldaschl, Manfred/ Voß,<br />
Günter G. (Hrsg.): <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit.<br />
München/Mering: Hampp, S. 53-100.<br />
Pongratz, Hans J./ Voß, Günter G. (2000): Vom<br />
Arbeitnehmer zum Arbeitskraftunternehmer – Zur<br />
<strong>Entgrenzung</strong> der Ware Arbeitskraft. In: Minssen, Heiner<br />
(Hrsg.): Begrenzte <strong>Entgrenzung</strong>en, Wandlungen von<br />
Organisation und Arbeit. Berlin: edition sigma, S. 225-247.<br />
20.12.2013<br />
2
<strong>Subjektivierung</strong> und <strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit<br />
Arbeitssoziologisches Forschungsinteresse<br />
• Wie prägt die historisch konkrete Struktur der Gesellschaft die Arbeit?<br />
Wie ist Arbeit gesellschaftlich verfasst? Was wird gesellschaftlich als<br />
Arbeit anerkannt?<br />
• Welche Konsequenzen resultieren aus dem gesellschaftlichen Wandel<br />
für die Gestaltung von Arbeit und Organisation und welche Folgen hat<br />
das für Individuen?<br />
• Wie wird Arbeit von Individuen subjektiv empfunden? Welchen Einfluss<br />
haben diese auf die Gestaltung ihrer Arbeitsvollzüge?<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Karin Lohr 2008: <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit aus Sicht der Arbeitssoziologie.<br />
www.uni-bamberg.de/fileadmin/andragogik/Andragogik1/Andragogentag_2008/Vortrag_Bamberg_<strong>Subjektivierung</strong>_von_Arbeit.pdf<br />
3
<strong>Subjektivierung</strong> und <strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit<br />
Ausgangspunkt: Arbeit in der Industriegesellschaft<br />
Spezifischer Typus von Arbeit: Industriearbeit (männlich)<br />
Spezifische Organisation von Arbeit: tayloristisch-fordistisch, bürokratisch als<br />
Voraussetzung für Massenproduktion<br />
Enger Zusammenhang von Leistungserbringung und Entlohnung als<br />
Voraussetzung für Massenkonsum<br />
Spezifisches Institutionensystem, welches dem Arbeits- und<br />
Produktionsmodell entspricht und dieses absichert (Bildungssystem,<br />
Arbeitsmarktregulierung, industrielle Beziehungen, Geschlechterarrangement,<br />
staatliche Sozialleistungen)<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Karin Lohr 2008: <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit aus Sicht der Arbeitssoziologie.<br />
www.uni-bamberg.de/fileadmin/andragogik/Andragogik1/Andragogentag_2008/Vortrag_Bamberg_<strong>Subjektivierung</strong>_von_Arbeit.pdf<br />
4
<strong>Subjektivierung</strong> und <strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit<br />
Ausgangspunkt: Arbeit in der Industriegesellschaft<br />
Normalarbeitsverhältnis: Tariflich abgesichert, Geregelte<br />
Arbeitszeiten (8-Stunden-Tag, Urlaubsanspruch, usw.),<br />
sozialversicherungspflichtig, unbefristete<br />
Normalbiographie: Ausbildung – lebenslange<br />
Beschäftigung in einem Betrieb - Rente<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Karin Lohr 2008: <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit aus Sicht der Arbeitssoziologie.<br />
www.uni-bamberg.de/fileadmin/andragogik/Andragogik1/Andragogentag_2008/Vortrag_Bamberg_<strong>Subjektivierung</strong>_von_Arbeit.pdf<br />
5
Normalarbeitsverhältnis und <strong>Entgrenzung</strong> von<br />
Arbeit<br />
Das industrielle Paradigma der Arbeitsorganisation beruhte auf dem<br />
Normalarbeitsverhältnis<br />
Betrieb als fester Ort der Leistungserbringung<br />
Regelarbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung mit unbefristeter Dauer<br />
Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers<br />
gegenüber dem Arbeitgeber<br />
Tätigkeit an formale Qualifikation gebunden<br />
Flankierung durch Institutionen wie Tarifautonomie, betriebliche<br />
Mitbestimmung, duale Berufsausbildung,<br />
Sozialversicherungspflicht<br />
20.12.2013<br />
6
Normalarbeitsverhältnis und <strong>Entgrenzung</strong> von<br />
Arbeit<br />
<strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit:<br />
Pluralisierung von Erwerbsformen und<br />
Beschäftigungsverhältnissen<br />
Differenzierung und Flexibilisierung von Arbeitszeiten<br />
Diffusion des Arbeitsortes<br />
abnehmende Bindung der institutionellen<br />
Rahmenbedingungen (Arbeitsbeziehungen,<br />
Berufsausbildung, Sozialversicherung)<br />
20.12.2013<br />
7
Konzept der <strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit<br />
Quelle: Kratzer/Sauer 2003<br />
20.12.2013<br />
8
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit - Begriff<br />
Begriffsgeschichtlich zwei gegenläufige Verständnisse von<br />
„Subjekt“<br />
- zum einen das antike Verständnis des „Subjektum“ (lat. „das<br />
Zugrundeliegende“), das allgemein einen Träger von Eigenschaften<br />
bezeichnet, die diesem (z.B. von den Göttern, später auch von der<br />
Gesellschaft) gegeben sind und mit denen er umgehen muss<br />
- zum anderen das sich mit Renaissance und Aufklärung durchsetzende<br />
und sokratische Ideale aufgreifende moderne Verständnis des Subjekts<br />
als das sich reflexiv und selbstbestimmt auf die Welt beziehende, je<br />
besondere menschliche Individuum.<br />
Quelle: Kleemann/Voß 2010: Arbeit und Subjekt. S. 415. In: Böhle/Voß/Wachtler (Hrsg.): Handbuch Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS<br />
20.12.2013<br />
9
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit - Begriff<br />
Soziologisches Subjektverständnis<br />
Subjekt als gesellschaftlich beherrschtes, geprägtes (und<br />
dadurch vereinheitlichtes) menschliches Aggregat sozialer<br />
Merkmale<br />
Subjekt als mit komplexen Eigenschaften versehenes,<br />
autonomes Individuum, das sich aktiv mit Gesellschaft<br />
auseinandersetzt und diese dadurch prägt, wenn nicht gar<br />
konstituiert.<br />
Quelle: Kleemann/Voß 2010: Arbeit und Subjekt. S. 415. In: Böhle/Voß/Wachtler (Hrsg.): Handbuch Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS<br />
20.12.2013<br />
10
Doppelte <strong>Subjektivierung</strong><br />
Doppelte <strong>Subjektivierung</strong> als Spannungsverhältnis von<br />
Und<br />
gestiegenen subjektiven Ansprüchen der Beschäftigten an ihre Arbeit<br />
(Bedürfnis nach Selbstbestätigung, Anerkennung, Autonomie…) („normative<br />
<strong>Subjektivierung</strong>“, Baethge 1991)<br />
Unternehmerischen Ansätzen zur Nutzung von Arbeitskraft: Nutzung aller<br />
subjektiven Fähigkeiten, Kompetenzen einschließlich der Fähigkeiten und<br />
Bereitschaft, die eigene Arbeit aktiv zu steuern (Arbeitskraftunternehmer)<br />
mit dem Ziel der Rationalisierung, Kostenersparnis, Flexibilisierung<br />
D.h. zunehmende Bedeutung des Subjekts im Arbeits- und<br />
Verwertungsprozess, „doppelte <strong>Subjektivierung</strong>“<br />
Quelle: Karin Lohr 2008: <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit aus Sicht der Arbeitssoziologie.<br />
www.uni-bamberg.de/fileadmin/andragogik/Andragogik1/Andragogentag_2008/Vortrag_Bamberg_<strong>Subjektivierung</strong>_von_Arbeit.pdf<br />
20.12.2013<br />
11
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit<br />
Entscheidende Indizien für einen Veränderungsprozess in Richtung einer<br />
„<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit“ sind demnach:<br />
- Neue Arbeits- und Organisationsformen, die mit neuen Anforderungen an die<br />
Selbstorganisation und Selbstregulation der Beschäftigten einhergehen<br />
und/oder den Einsatz von Subjektivität (Emotionen, Kooperationsfähigkeit,<br />
Kreativität etc.) erfordern<br />
- Wandel von Qualifikationsanforderungen (Höherqualifizierung, soft skills<br />
etc.) und Tätigkeitsstrukturen (kunden- und/oder personenorientierte<br />
Dienstleistungen)<br />
-Veränderte Lebensstile und Erwerbsorientierungen (normative<br />
<strong>Subjektivierung</strong>).<br />
20.12.2013<br />
12
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit<br />
„Die Formulierung “<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit” bezeichnet in der<br />
arbeitssoziologischen Debatte ganz allgemein eine Intensivierung von<br />
‚individuellen’, d.h. Subjektivität involvierenden Wechselverhältnissen zwischen<br />
Person und Betrieb bzw. betrieblich organisierten Arbeitsprozessen. Dies kann<br />
einmal heißen, dass Individuen von sich aus mehr Subjektivität in die Arbeit<br />
hineintragen, aber auch, dass die Arbeit immer mehr Subjektivität von den<br />
Individuen fordert. In beiden Fällen ist der zunehmende Stellenwert von<br />
Subjektivität mit einem relativen Rückgang von eindeutig vorstrukturierten,<br />
Subjektivität beschränkendenSituationen verbunden.“<br />
(Kleemann/Matuschek/Voß 2002: 57-58)<br />
20.12.2013<br />
13
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit<br />
Vier Formen von Subjektivität:<br />
1. Kompensatorische Subjektivität: Dient dazu, explizit oder implizit<br />
regulierend einzugreifen, um Störungen des formalisierten Arbeitsprozesses<br />
flexibel zu bewältigen bzw. deren Entstehung zu verhindern.<br />
2. Strukturierende Subjektivität: Dient dazu, zur Sicherung eines effizienten<br />
Ablaufs der Arbeit (explizit oder implizit) in geeigneter Weise selbst Strukturen<br />
zu schaffen und seine Arbeitskraft dadurch in die betrieblichen Erfordernisse<br />
einzupassen<br />
3. Reklamierende Subjektivität: Die an die Gesellschaft und ihre Institutionen<br />
gerichtete Formulierung alternativer Orientierungen und Aspirationen sowie<br />
die Forderung nach deren Berücksichtigung.<br />
4. Ideologisierende Subjektivität: Bezieht sich auf eine Prägung der Person<br />
durch diskursiv bzw. kulturell vermittelte Sinn-Strukturen von Arbeit und<br />
Beschäftigung.<br />
20.12.2013<br />
14
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit<br />
.<br />
20.12.2013<br />
15
Dimensionen von <strong>Subjektivierung</strong><br />
Zeitlich: Selbstregulation wie lange, wie schnell, mit welcher Zeitlogik<br />
gearbeitet wird<br />
Räumlich: Entscheidungen über Ort von Arbeit, Mobilität<br />
Sachlich-qualifikatorisch: Erweiterung von Qualifikation und Kompetenz,<br />
Selbstdefinition der erforderlichen Kompetenzen<br />
Technisch: aktive Organisation der eigenen Arbeitsmittel, Anpassung dieser<br />
an individuelle Erfordernisse<br />
Sinnhaft: Erfordernis, Tätigkeit sinnhaft zu strukturieren, sich selbst zu<br />
motivieren aber auch betrieblicher Ziele an zu erkennen<br />
Sozial im engeren Sinne: Abstimmung mit anderen, Kooperationen<br />
Emotional: eigene Emotionalität bewusst gestalten<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Karin Lohr 2008: <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit aus Sicht der Arbeitssoziologie.<br />
www.uni-bamberg.de/fileadmin/andragogik/Andragogik1/Andragogentag_2008/Vortrag_Bamberg_<strong>Subjektivierung</strong>_von_Arbeit.pdf<br />
16
Chancen und Risiken der <strong>Subjektivierung</strong> von<br />
Arbeit<br />
Chancen<br />
Risiken<br />
Selbstverwirklichungs- und<br />
Partizipationsmöglichkeiten<br />
Aufhebung von Fremdkontrolle und<br />
Zwang<br />
Realisierung individueller Interessen<br />
und Orientierungen<br />
Vereinbarkeit von Arbeit und Leben –<br />
Chance für Frauen?<br />
Segmentierung der Beschäftigten:<br />
positive Wirkungen für höher<br />
Qualifizierte, negative für gering<br />
Qualifizierte<br />
Wachsende Anforderungen,<br />
Leistungsdruck, Selbstausbeutung<br />
Wachsende Unsicherheit und<br />
kumulierte Risiken: Prekarität<br />
<strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit und Leben:<br />
Zugriff auf Lebenswelt<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Karin Lohr 2008: <strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit aus Sicht der Arbeitssoziologie.<br />
www.uni-bamberg.de/fileadmin/andragogik/Andragogik1/Andragogentag_2008/Vortrag_Bamberg_<strong>Subjektivierung</strong>_von_Arbeit.pdf<br />
17
Indikatoren zur empirischen Messung der<br />
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit<br />
Indikatoren auf der betrieblichen Ebene<br />
Verbreitung neuer Steuerungsformen in den Unternehmen, die auf die<br />
Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation der Beschäftigten rekurrieren<br />
(Vertrauensarbeitszeit und Zielvereinbarungen)<br />
Spezifische Veränderungen der Organisationsstrukturen wie etwa der Abbau von<br />
Hierarchieebenen und die Delegation von Entscheidungskompetenz „nach<br />
unten“,<br />
Verbreitung neuer Arbeitsformen (vor allem Gruppen- und Projektarbeit), die<br />
nicht nur die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstorganisation, sondern auch<br />
Kompetenzen der Kommunikation und Kooperation voraussetzen<br />
Formen flexibler Arbeitszeitorganisation, die den Beschäftigten<br />
Gestaltungsspielräume im Hinblick auf ihren (zeitlichen) Arbeitseinsatz und das<br />
Verhältnis von Arbeit und Leben einräumen (Gleitzeit, Arbeitszeitkonten u.a.).<br />
20.12.2013<br />
18
Indikatoren zur empirischen Messung der<br />
<strong>Subjektivierung</strong> von Arbeit<br />
Indikatoren auf der individuellen Ebene<br />
Verbreitung von Tätigkeiten, die eigenverantwortliches Arbeiten<br />
und/oder die unmittelbare Interaktion mit „KundInnen“ beinhalten<br />
Verbreitung von Beschäftigtengruppen mit Gestaltungsspielräumen in<br />
bezug auf die Arbeitsausführung oder den Arbeitseinsatz<br />
Veränderungen in der Wahrnehmung und Bewertung von Arbeit sowie<br />
von Arbeits- und Erwerbsorientierungen, die sich mit wachsenden<br />
Ansprüchen an Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung in der Arbeit<br />
verbinden<br />
20.12.2013<br />
19
Der Arbeitskraftunternehmer<br />
Zugrunde liegende These<br />
Grundlegender Wandel der gesellschaftlichen Verfassung der „Ware<br />
Arbeitskraft“ (Karl Marx), der in der Tendenz auf einen neuen<br />
gesellschaftlichen Leittypus von Arbeitskraft hinauslaufe: den<br />
Idealtypus des aktiv und selbstverantwortlich handelnden<br />
„verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer“, der den bisherigen<br />
fordistischen Typus des „verberuflichten Arbeitnehmers“ allmählich<br />
ablöse.<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Kleemann/Voß 2010: Arbeit und Subjekt. S. 415. In: Böhle/Voß/Wachtler (Hrsg.): Handbuch Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS<br />
20
Der Arbeitskraftunternehmer<br />
Theoretischer Ausgangspunkt - „Transformationsproblem“<br />
Betriebe stehen vor der Aufgabe der Transformation der latenten<br />
Arbeits-Kraft von Beschäftigten in manifeste aufgabenfunktionale<br />
Arbeits-Leistung. Diese vollzieht sich zunehmend in einem<br />
veränderten Modus.<br />
Die bisher vorherrschende möglichst strikte Detailsteuerung von<br />
Arbeitskraft im Betrieb (nach den Prinzipien des Taylorismus) wird<br />
zum Rationalisierungshindernis; stattdessen wird nun tendenziell die<br />
Verantwortlichkeit von Arbeitskräften erhöht, um Flexibilität und<br />
Innovativität freizusetzen.<br />
Arbeit wird vermehrt indirekt und ergebnisbezogen gesteuert (z.B.<br />
durch Zielvereinbarungen) und die Arbeitsausführung im Detail den<br />
Arbeitenden selbst überantwortet.<br />
Dabei ist die Rücknahme direkter Steuerung von einer Ausweitung<br />
indirekter Kontrollen begleitet. Dadurch wird die Transformation von<br />
Arbeitskraft in neuer Qualität auf die Beschäftigten übertragen, also<br />
betrieblich ‚externalisiert‘.<br />
20.12.2013<br />
Quelle: Kleemann/Voß 2010: Arbeit und Subjekt. S. 415. In: Böhle/Voß/Wachtler (Hrsg.): Handbuch Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS<br />
21
Der Arbeitskraftunternehmer<br />
Quelle: Pongratz/Voß 2003: 15<br />
20.12.2013<br />
22
Proletarischer Lohnarbeiter, verberuflichter<br />
Arbeitnehmer, Arbeitskraftunternehmer<br />
Quelle: Voß/Pongratz 1998<br />
20.12.2013<br />
23
Erläutern sie, was unter dem Konzept der<br />
<strong>Entgrenzung</strong> von Arbeit verstanden wird.<br />
Gehen sie dabei auch auf die Erosion des<br />
Normalarbeitsverhältnisses ein und beachten<br />
sie die verschiedenen Ebenen der<br />
<strong>Entgrenzung</strong>.<br />
Quelle: Voß/Pongratz 1998<br />
20.12.2013<br />
24