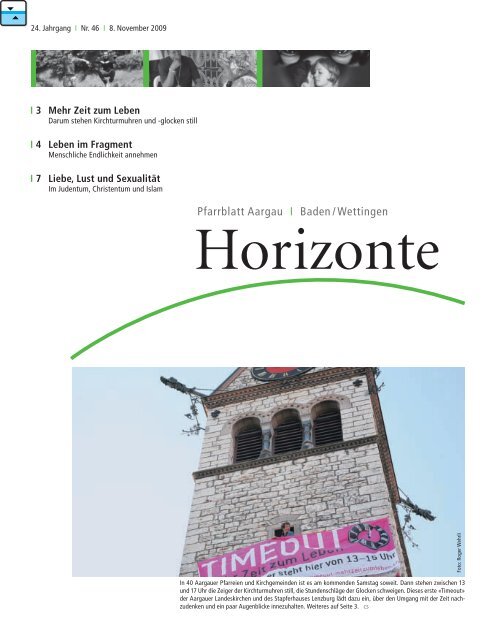h200946 - Horizonte Aargau
h200946 - Horizonte Aargau
h200946 - Horizonte Aargau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
24. Jahrgang I Nr. 46 I 8. November 2009<br />
I 3 Mehr Zeit zum Leben<br />
Darum stehen Kirchturmuhren und -glocken still<br />
I 4 Leben im Fragment<br />
Menschliche Endlichkeit annehmen<br />
I 7 Liebe, Lust und Sexualität<br />
Im Judentum, Christentum und Islam<br />
Pfarrblatt <strong>Aargau</strong> I Baden / Wettingen<br />
<strong>Horizonte</strong><br />
Foto: Roger Wehrli<br />
In 40 <strong>Aargau</strong>er Pfarreien und Kirchgemeinden ist es am kommenden Samstag soweit. Dann stehen zwischen 13<br />
und 17 Uhr die Zeiger der Kirchturmuhren still, die Stundenschläge der Glocken schweigen. Dieses erste «Timeout»<br />
der <strong>Aargau</strong>er Landeskirchen und des Stapferhauses Lenzburg lädt dazu ein, über den Umgang mit der Zeit nachzudenken<br />
und ein paar Augenblicke innezuhalten. Weiteres auf Seite 3. cs
I 2 fokus<br />
Vergesst die Gastfreundschaft nicht<br />
Der Sonntag der Völker in der Schweiz<br />
Thomas Schnelling<br />
Redaktor <strong>Horizonte</strong>, Bremgarten<br />
Ein geheimnisvoller Übergang<br />
«Zu Ende des Septembers war die fast neunzigjährige<br />
Trin Jans am Sterben. Ihre Augen gingen durch die<br />
Scheiben in die Ferne. In das Antlitz der Sterbenden<br />
grub eben der Tod das hippokratische Gesicht, und<br />
das Kind starrte atemlos auf die unheimliche, ihr unverständliche<br />
Verwandlung des unschönen, aber ihr<br />
vertrauten Angesichts. ‹Was macht sie? Was ist das,<br />
Vater?› flüsterte sie angstvoll. ‹Sie stirbt›, sagte der<br />
Deichgraf. ‹Stirbt!› wiederholte das Kind. Ihre Arme<br />
sanken, ein leises Krachen der Bettstatt wurde hörbar;<br />
sie hatte aufgehört zu leben. ‹Sie hat es vollbracht!›<br />
sagte der Deichgraf und nahm das Kind auf seinen<br />
Arm: ‹Sie ist nun weit von uns, beim lieben Gott.›»<br />
Unbegreifbar, fassungslos, eigentlich sprachlos lese ich<br />
diese Zeilen über die allmähliche Verwandlung eines<br />
Lebenden in einen Toten wieder. Theodor Storm hat sie<br />
1888 in seiner Novelle «Der Schimmelreiter» geschrieben.<br />
Da hat ein Mensch gerade noch geatmet, und<br />
dann, urplötzlich, hört dieser Mensch auf zu sein. Kalt<br />
und starr liegt er da, bewegungslos, eiskalt, wenn man<br />
ihn anfassen würde. Eine unüberwindbare Barriere.<br />
So ging es auch mir selbst, als ich vor über zwanzig<br />
Jahren vor der Leiche meines Vaters stand. Nur wenige<br />
Stunden nach seinem Zusammenbruch war er unter<br />
den Händen seiner Ärztekollegen, wohl unrettbar verloren,<br />
im Spital gestorben. Zum ersten Mal in meinem<br />
Leben stand ich vor ihm, erschrocken, und er reagierte<br />
nicht mehr auf mich, blieb stumm und starr liegen, den<br />
Kopf ein wenig nach links geneigt. «Wo ist er nur?»<br />
mag ich gedacht haben. Noch dort, wo er jetzt liegt,<br />
erst recht im Grab? Oder doch woanders, «beim lieben<br />
Gott»? Wo werde ich sein, wenn ich dereinst so<br />
daliegen werde? Kann ich mich damit abfinden, nichts<br />
zu sein? «Beim lieben Gott» – vielleicht ist es besser,<br />
hoffend zu sterben, und nicht zusammengekauert vor<br />
lauter Angst und Schrecken. Vielleicht.<br />
In diesem Jahr steht der «Sonntag der Völker»<br />
am 8. November unter dem Motto «Migranten,<br />
eine Chance für die Evangelisation». Den Hintergrund<br />
des diesjährigen Mottos bildet der<br />
«Welttag des Migranten und Flüchtlings», der<br />
bereits am 18. Januar angesetzt war und aufgrund<br />
des Paulusjahres unter dem Motto «Der<br />
Heilige Paulus – Migrant und Völkerapostel»<br />
stand. Das diesjährige Motto soll ein Impuls<br />
zum Nachdenken<br />
sein, wie die zugewanderten<br />
Katholiken die<br />
Einheimischen und<br />
umgekehrt zu einer<br />
Wandlung bewegen können, die das Denken<br />
und die Interessen der Menschen auf Gott und<br />
den Nächsten hin verändern und erneuern.<br />
Somit ist der «Sonntag der Völker» eine gute<br />
Gelegenheit, um der Frage nachzugehen, wie es<br />
mit der Präsenz von zugewanderten Gläubigen<br />
in der Pfarrei und in den Gremien vor Ort steht<br />
wie auch, um ihnen im Rahmen eines Gottesdienstes<br />
oder anderer Veranstaltungen eine<br />
hervorragende Stellung zu geben. Zudem bietet<br />
dieser spezielle Sonntag die Möglichkeit, diesen<br />
zusammen mit einer fremdsprachigen Mission<br />
zu gestalten. Geht es doch grundsätzlich<br />
darum, die Teilnahme der Migrantinnen und<br />
Migranten am kirchlichen und sozialen Leben<br />
KURZMELDUNGEN<br />
youth4you. Überall spricht man<br />
von «Jugendgewalt». Die Nachrichten<br />
sind voll davon. Experten<br />
sprechen von einem grossen Problem<br />
und suchen nach Lösungen.<br />
Doch diejenigen, die dazu am<br />
meisten zu sagen haben, werden<br />
kaum gefragt. Was meinen die<br />
jungen Leute zwischen 14 und 30<br />
Jahren selber dazu? Was möchten<br />
sie dazu sagen? Sie sollen und<br />
können ihre Sichtweise selbst in<br />
die Diskussion einbringen. Denn<br />
sie sind die eigentlichen Insider,<br />
die eigentlichen Experten. Mehr<br />
Informationen finden sich unter<br />
www.einmischen.ch<br />
Monatslohn. Aus Solidarität<br />
mit den Ärmsten in der Wirt-<br />
Jesus als göttlicher Wanderer<br />
besucht die Menschen und ist ihr Gast.<br />
schaftskrise sollen die Priester<br />
des Erzbistums Lyon auf einen<br />
Monatslohn verzichten. Damit<br />
wolle man eine «konkrete Geste»<br />
der Solidarität setzen, heisst<br />
es in einem auf der Homepage<br />
des Erzbistums veröffentlichten<br />
Appell des Priesterrates. Um die<br />
Würde der Ärmsten zu schützen,<br />
müsse man mit Politikern,<br />
Gewerkschaften und sozialen<br />
Einrichtungen zusammenarbeiten.<br />
Nach dem Vorschlag sollen<br />
die Priester die Summe von 1350<br />
Franken an eine caritative Einrichtung<br />
spenden.<br />
Rituale. Religiöse und andere Rituale<br />
üben nach den Worten des<br />
Konstanzer Soziologen Bernhard<br />
in der Schweiz zu fördern. Gerade die Seelsorge<br />
mit Immigranten hilft, die Erfahrungen im Einwanderungsland<br />
in der Eigenart ihres Glaubens<br />
zu deuten und im Dialog mit der Kirche vor Ort<br />
wachsen zu lassen. Weshalb der weitere Aufbau<br />
einer kirchlichen Gemeinschaft von Einheimischen<br />
und Fremdsprachigen notwendig bleibt.<br />
Aus Achtung vor den religiösen und seelsorgerlichen<br />
Bedürfnissen der Migrantinnen und<br />
Migranten. Um vernünftige<br />
und humane<br />
Rahmenbedingungen<br />
für das<br />
Zusammenleben von<br />
Menschen verschiedener Herkunft zu schaffen.<br />
In diesem Sinne erinnert der Benediktiner-Pater<br />
Anselm Grün zu Recht daran, dass es bereits<br />
vor zweitausend Jahren Migration, Wanderung<br />
zwischen den Völkern gegeben hat. Und dass<br />
sich, bei allen unleugbaren Gefahren, die Menschen<br />
gegenseitig befruchtet haben. Und insofern<br />
die Erfahrung der frühen Christen eine<br />
Herausforderung für uns heute darstellt. «Auch<br />
heute ist es die Gastfreundschaft, die das Fremde<br />
der Migranten heilig hält, die offen ist für das<br />
Fremde, die damit rechnet, dass im Fremden<br />
Jesus Christus selbst aufgenommen wird und<br />
dass er im Fremden uns etwas sagen möchte.»<br />
www.kath.ch/migratio Thomas Schnelling<br />
Giesen nach wie vor eine grosse<br />
Faszination aus. Es stimme<br />
nicht, dass sich Rituale «unter<br />
dem kalten Stern der Rationalität»<br />
aufgelöst hätten. «Es geht<br />
in der Moderne genau so wenig<br />
ohne Rituale wie in der Vormoderne»,<br />
so der Wissenschaftler.<br />
«Wir brauchen sie als letzte<br />
Versicherung gegen das Auseinanderfliessen<br />
der Gesellschaft.»<br />
So seien die Religionen durchaus<br />
«sehr öffentlich und ungeheuer<br />
rituell». Auch im privaten und<br />
politischen Bereich sind Rituale<br />
üblich. Solche Aktionen seien<br />
«Hoffnungs- und Widerstandsrituale».<br />
Sie könnten helfen, Identität<br />
zu erschaffen.
aargau 3 I<br />
Timeout – mehr Zeit zum Leben<br />
Oder warum am kommenden Samstag Kirchturmuhren und -glocken ruhen<br />
Nur eines kommt selten vor: dass Glocken schweigen.<br />
Die der katholischen Kirchen tun es nach<br />
dem Gloria des Hohen Donnerstages bis zum<br />
Gloria der Osternacht. Denn Glocken und Orgel<br />
sind triumphale Instrumente und ruhen aus Ehrfurcht<br />
vor dem Leiden Christi. Dies die offizielle<br />
Version. «Mancherorts erzählt man den Kindern<br />
gar, die Glocken würden nach Rom fliegen und<br />
dort die Ostereier holen, die sie dann auf ihrem<br />
Rückflug abwerfen», so Pater Adrian Willi in der<br />
Zeitschrift ferment. Noch ist nicht Ostern, sondern<br />
demnächst erst einmal Weihnacht. Dennoch<br />
verstummen im <strong>Aargau</strong> am kommenden<br />
Samstag nicht nur die Glocken, sondern auch<br />
die Zeiger der Kirchturmuhren stehen still. Mehr<br />
dazu im Kasten. Carmen Frei<br />
Kirchturmuhren stehen still, Paul Schreiber-Halbeisen aus Wegenstetten hält die Glocke an. «Stell dir vor,<br />
die Zeit steht still. Es gibt kein zu spät und kein zu langsam, es gibt nur Zeit zum Leben.» Unter diesem Slogan<br />
lancieren die <strong>Aargau</strong>er Landeskirchen und das Stapferhaus Lenzburg den Aktionstag wider die Hektik<br />
im Alltag.<br />
Sie verblüfft immer wieder. Die Tatsache, dass es<br />
ungemein viele Menschen gibt, die sich für Glocken<br />
interessieren. Auch Paul Schreiber-Halbeisen<br />
gehört zu ihnen. Er hat die Faszination für<br />
Glocken quasi in den Genen. Schon als Fünfjähriger<br />
durfte er beim Weihezeremoniell von Hand<br />
die Glocken der St. Michaelskirche in Wegenstetten<br />
anschlagen. Später übernahm er die Wartung<br />
des Geläuts von seinem Vater, hat es mittlerweile<br />
elektrifiziert und den Glockenvirus bereits<br />
weiter vererbt. Paul Schreiber findet: «Glocken<br />
machen Musik». Ganz ähnlich tönt es auch beim<br />
Schweizer Radio DRS: «Unser Glockenarchiv ist<br />
ein wertvoller Schatz – wir pflegen und hüten<br />
ihn dementsprechend. Jeden Samstag lassen sich<br />
viele Menschen vom Geläute aus dem Radio für<br />
einige Minuten verzaubern», erklärt Christoph<br />
Gebel, Programmleiter DRS1/DRS Musikwelle.<br />
Glocken – sie klingen an zwischen Begeisterung<br />
Foto: Roger Wehrli<br />
und Bedeutung. «Vivos voco, mortuos plango,<br />
fulgua fango» – «Die Lebenden rufe ich, die Toten<br />
beklage ich, die Gewitter zerschlage ich». So lautet<br />
in Latein eine alte Glockeninschrift. Damit ist in<br />
Kürze der Sinn der Kirchenglocken ausgedrückt.<br />
Sie rufen die Menschen zum Gottesdienst und<br />
zum Gebet. Sie verkünden, wenn jemand gestorben<br />
ist. Sie warnen bei Feuer und Gefahr und bitten<br />
um Schutz, Segen und gedeihliches Wetter. Im<br />
christlichen Abendland erlangten sie unter Papst<br />
Gregor dem Grossen (590–604) ihre Bedeutung.<br />
Von Irland brachten Wandermönche eine Glocke<br />
mit. Man kann sie noch heute im St. Galler Dom<br />
als älteste Glocke der Schweiz bewundern. Seit<br />
dem 7. Jahrhundert läuten sie am Morgen und am<br />
Abend. Später kam das Läuten zum Mittags-Angelus,<br />
dem englischen Gruss, hinzu. Die Abendglocke<br />
lädt zur Nachtruhe ein, die dem Schutze<br />
Gottes und seiner Engel empfohlen wird.<br />
Am 7. November ist alles anders – das<br />
erste <strong>Aargau</strong>er Timeout findet statt. 40<br />
reformierte Kirchgemeinden und römischkatholische<br />
Pfarreien schenken der Bevölkerung<br />
Zeit. In diesen Stunden können sie<br />
in den Kirchen zu Musik und Bildern meditieren,<br />
Cellosuiten oder Gedichte und<br />
Texte hören, «Eile mit Weile» spielen, oder<br />
einfach einen Augenblick der Stille suchen.<br />
Bei der Kirche St. Sebastian in Wettingen<br />
findet am Samstag der Startevent zur<br />
ganzen Aktion statt. Um fünf nach eins<br />
wird die Zeit gestoppt. «Was haben Glaube<br />
und Basketball gemeinsam?», wird danach<br />
zum Beispiel in die Runde gefragt. Antworten<br />
sollen der Bibeltext vom Zeithaben und<br />
der Agent XYQ/384/b der Zeit-Spar-Kasse<br />
liefern. Die zweite Timeout-Veranstaltung<br />
in Wettingen findet zwischen 15 und 17<br />
Uhr in der reformierten Kirche Wettingen<br />
statt. Während zweier Stunden wird der<br />
Lauf der Zeit nicht mit der Uhr, sondern<br />
mit Musik, Stille und mit Texten gemessen.<br />
Die Aktion «Timeout – mehr Zeit zum<br />
Leben» der <strong>Aargau</strong>er Kirchen findet im<br />
Rahmen von «nonstop», der Ausstellung<br />
über die Geschwindigkeit des Lebens des<br />
Stapferhauses Lenzburg statt, die eben<br />
bis zum 27. Juni 2010 verlängert wurde.<br />
www.timeout-mehrzeitzumleben.ch
I 4 impuls<br />
Leben im Fragment<br />
Die menschliche Endlichkeit annehmen lernen<br />
Foto: KNA-Bild<br />
Fulbert Steffensky: «Es ist etwas wundervoll Widerborstiges<br />
und Anarchistisches in einer Gesellschaft,<br />
die Alte, Kranke, Behinderte sichtbar sein<br />
lässt. Sie lehren uns, dass der Mensch nicht für<br />
Zwecke da ist. Sie lehren uns, was Gnade ist.»<br />
Loslassen lernen –<br />
abschiedlich leben.<br />
Das Alter(n) ist ein gesellschaftliches Phänomen.<br />
Nicht nur wegen der erstaunlichen Verlängerung<br />
der durchschnittlichen Lebenserwartung<br />
der Menschen, sondern auch wegen der<br />
rasanten Zunahme älterer und alter Menschen<br />
seit Mitte der 1960iger Jahre des 20. Jahrhunderts.<br />
Diese «Gesellschaft des langen Lebens»,<br />
das Altern und das<br />
Altsein ist längst<br />
schon ein gesamtgesellschaftliches<br />
Problem.<br />
Die zentrale soziale Frage des 21. Jahrhunderts.<br />
Nur – wie gehen wir damit um? Der<br />
Theologe Heinz Rüegger sieht als unhintergehbares<br />
Fundament dafür, das Alter selber überhaupt<br />
erst zu würdigen, den Prozess des Alterns<br />
ernst zu nehmen als entscheidenden Beitrag zu<br />
einer neuen Lebenskunst. Denn nicht altern zu<br />
wollen, ist das Zeichen einer «pathologischen<br />
Lebensverweigerung». Dazu gehört wesentlich,<br />
die menschliche Endlichkeit überhaupt<br />
anzunehmen, bejahen zu lernen, dass alles Leben<br />
nur Bruchstück ist, nie ganz, nie perfekt.<br />
Gegen alle «Vollendungsillusionen» «sich mit<br />
der unvollendbaren Begrenztheit des Lebens<br />
anzufreunden». Eine wirklich «reflektierte Lebenskunst»,<br />
eine wirkliche «Kunst des Alterns»<br />
umfasst im Kern immer, «sich in das sterbliche<br />
Leben einzuüben». Eine «Kultur des Pro-<br />
Aging» zu entwickeln. Also «alten Menschen in<br />
ihren Möglichkeiten als vollwertige Glieder der<br />
Gesellschaft dort solidarisch Unterstützung zu<br />
bieten, wo sie es brauchen». Wie dies geht, zeigt<br />
er eindrücklich an der «Herausforderung Demenz».<br />
Auch praktisch als Seelsorger.<br />
Mit voller Wucht spitzen dies Peter Wissmann<br />
und Reimer Gronemeyer noch zu. Sehen sie doch<br />
ganz klar Menschen mit Demenz nicht als Kranke,<br />
sondern betrachten die Demenz aus einer<br />
«zivilgesellschaftlichen Perspektive». «Demenziell<br />
veränderte Menschen» sind von vorneherein<br />
«Bürger eines Gemeinwesens», woraus notwendigerweise<br />
folgt, dass wir alle herausgefordert<br />
sind, eine gänzlich «neue Kultur des Miteinanders<br />
zu entwickeln». Es geht also um «Schritte,<br />
die eine neue, humanere, sozialere Einbettung<br />
des Menschen mit Demenz in unsere Lebenswelt<br />
erreichen wollen». Das bedeutet unter anderem,<br />
dass der Mensch in einer solchen Situation «in<br />
seiner Ganzheit als leiblich-geistiges und soziales<br />
Wesen in den Blick» tritt. Dass man Begegnungsplattformen<br />
schaffen muss, auf denen Menschen<br />
mit und ohne Demenz sich treffen können und<br />
so einander gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.<br />
Dass ihre «Fähigkeiten und Chancen»,<br />
«ihre Schätze und Angebote» wahrgenommen<br />
werden. Dass ihnen leibliche und sinnesorientierte<br />
Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden.<br />
Wie die beigegebenen Abbildungen von<br />
künstlerischen Arbeiten wunderbar zeigen. Dass<br />
Demenz alle angeht: «Ethik, Medizin, Kultur,<br />
Philosophie, Pädagogik,<br />
Soziologie, Pflege, Theologie,<br />
Kirche, Psychologie<br />
und Anthropologie». Dass<br />
es zu einem Thema wird «in der Nachbarschaft,<br />
auf dem Marktplatz und im Sportverein». Legt<br />
Demenz doch «mit ungeheurer Radikalität den<br />
Finger auf die Wunden dieser Gesellschaft»:<br />
Indem sie die «Fragen der Endlichkeit und der<br />
Abhängigkeit der Menschen von anderen Menschen»<br />
auf den Tisch wirft. Ist es wirklich «gesund»,<br />
grundlegende Dimensionen unseres<br />
Menschseins wie Leiblichkeit und Spiritualität<br />
«zugunsten der modernen, entleibten und entseelten<br />
Existenzform aufgegeben zu haben»?<br />
Worauf der evangelische Theologe und frühere<br />
Benediktiner Fulbert Steffensky eine eindrucksvolle<br />
meditativ-kritische, eine mystisch-politische<br />
Antwort zu geben versucht. Hinein in<br />
eine Gesellschaft, «in der Sinn durch Effektivität<br />
und Rentabilität ersetzt ist». Gefangen in ihrem<br />
«Unendlichkeitswahn». Gegen diesen «Totalitätsterror»<br />
setzt er die «gelungene Halbheit» des<br />
Lebens, weil die Endlichkeit im Leben selber<br />
liegt. «Nur zur Endlichkeit befreite Menschen<br />
können geschwisterliche Menschen sein und<br />
können ihren Siegeszwängen entsagen.» Denn<br />
«Gnade ist das Urwort». Thomas Schnelling<br />
Buch-Tipps<br />
Heinz Rüegger: Alter(n) als Herausforderung.<br />
Gerontologisch-ethische Perspektiven. TVZ,<br />
2009, 246 Seiten, ISBN 978-3-290-17517-7,<br />
CHF 32.00<br />
Peter Wissmann/Reimer Gronemeyer: Demenz<br />
und Zivilgesellschaft – eine Streitschrift.<br />
Mabuse, 2008, 207 Seiten, ISBN<br />
978-3-940529-16-9, CHF 35.00<br />
Fulbert Steffensky: Mut zur Endlichkeit. Sterben<br />
in einer Gesellschaft der Sieger. Radius,<br />
2007, 40 Seiten, ISBN 978-3-87173-369-7,<br />
CHF 19.00
zoom 5 I<br />
Bischof im Schatten von Minaretten<br />
Im Gespräch mit Muslimen auf gemeinsame Werte bauen<br />
In der Schweiz tobt die Diskussion um den<br />
Bau von Minaretten. Anders die Situation im<br />
westafrikanischen Senegal: Mehr als neunzig<br />
Prozent der Bevölkerung sind muslimisch.<br />
Die katholische Kirche lebt im Schatten zahlreicher<br />
Minarette. In guter Nachbarschaft mit<br />
den Muslimen und einer Atmosphäre der Zusammenarbeit<br />
mit<br />
Staat und Gesellschaft,<br />
wie Benjamin<br />
Ndiaye betont. Denn<br />
gegenseitiger Respekt kennzeichnet das gute<br />
Zusammenleben von Christen und Muslimen<br />
im Senegal. Aufgrund dieser guten Beziehung<br />
werde zu Recht vom Dialog des Lebens zwischen<br />
den Angehörigen beider Religionen gesprochen.<br />
«Insbesondere Dank Präsidenten wie<br />
Léopold Sédar Senghor oder Abdou Diouf ist<br />
unser Verhältnis so gut», erklärt der Bischof der<br />
senegalesischen Diözese Kaolak, der in diesem<br />
Oktober die Schweiz besucht hat. Ein Beispiel<br />
für diesen Dialog sei der Bau der Krankenstation<br />
in Popenguine, die von Christen und Muslimen<br />
gemeinsam errichtet wurde. Schon insofern<br />
verdiene der Ansatz von Bischof Ndiaye, im<br />
Gespräch mit den Muslimen auf gemeinsame<br />
Werte zu bauen, in der Schweiz mit Blick auf<br />
die Minarett-Initiative ohnehin eine besondere<br />
Beachtung.<br />
Der heute 61jährige Bischof, der in den 1970iger<br />
Jahren an der Universität Fribourg sein Theologiestudium<br />
absolviert hat, stammt aus der katholischen<br />
Küstenregion des Senegal, der Petite<br />
Côte, die sich südlich der Halbinsel Cabo Verde<br />
bis zum Sine-Saloum-Flussdelta erstreckt. «95<br />
Prozent der Menschen in diesem Gebiet sind<br />
katholisch, das Gegenteil zu den gesamtsenegalesischen<br />
Zahlenverhältnissen», sagt Bischof<br />
Ndiaye. «Als ich 2001 zum Bischof von Kaolak<br />
ernannt wurde, sagte ich mir: Jetzt muss ich in<br />
ein Missionsland», lacht der Bischof, der gern<br />
über den Tellerrand seiner Diözese hinausschaut.<br />
Die Solidarität zwischen den Senegalesen verschiedenen<br />
Glaubens sei gross, versichert der<br />
Oberhirte. Und sie zeige sich allerorten. «Die<br />
Menschen im Senegal respektieren die Wahl<br />
des Anderen. Man kann zwar einer anderen Religion<br />
angehören, aber das ändert nichts an den<br />
sozialen Beziehungen, die die Menschen hier<br />
mit ihren Nachbarn pflegen», beschreibt er das<br />
gute Miteinander.<br />
Für den Anderen zu handeln, bedeutet für Bischof<br />
Ndiaye, für Gott zu handeln. Und das<br />
Handeln ist ihm wichtig: «Wir dürfen als Kirche<br />
nicht nur reden.» Als Beispiel verweist er auf<br />
die Arbeit der Caritas in seiner Diözese, die sich<br />
dafür einsetze, dass die Bevölkerung Zugang<br />
zu Wasser und Gesundheit erhält. Das Betreiben<br />
von Schulen und Internaten gehört zu dieser<br />
Arbeit ebenso wie die Ausgabe von Reis in<br />
knappen Zeiten vor<br />
der neuen Ernte.<br />
Und alles, betont<br />
Bischof Ndiaye,<br />
wird geteilt: Christen und Muslime profitieren<br />
in gleichem Masse von dieser Hilfe.<br />
Anfangs gab es bei den Muslimen durchaus die<br />
Befürchtung, Caritas wolle sie mit ihrer Arbeit<br />
zum Glaubensübertritt bewegen. Inzwischen<br />
wüssten sie aber, dass die Kirche ohne Hintergedanken<br />
ihre Hilfe anbiete. «Wenn jemand nach<br />
reiflicher Überlegung konvertieren, übertreten<br />
Gegenseitiger Respekt<br />
in der Begegnung von Christen und Muslimen.<br />
möchte, weisen wir ihn nicht ab, aber wir betreiben<br />
keinen Proselytismus, keinen Konfessionswechsel!»,<br />
stellt der Bischof von Kaolak klar.<br />
Die Muslime wissen die Arbeit der Kirche zu<br />
schätzen. Wenn Bischof Ndiaye vor der Aussaat<br />
im Rahmen der Diözesanwallfahrt das Saatgut<br />
segnet, kommen nicht nur Katholiken. «Auch<br />
ein Imam, selber Landwirt, bringt seine Erdnuss-<br />
und Hirseaussaat zu mir. Umgekehrt legt<br />
derselbe Imam mit Hand an, wenn wir etwa<br />
eine Aufforstungsaktion starten.»<br />
Dass er heute Bischof ist, hat Benjamin Ndiaye<br />
unter anderem einem Islam-Gläubigen zu verdanken:<br />
«Als Seminarist war ich in einer tiefen<br />
Krise und wusste nicht mehr, ob ich wirklich<br />
Priester werden sollte. Der alte Mann sagte zu<br />
mir: «Wenn Gott Dich ruft, dann musst Du<br />
antworten!» www.missio.ch Jacques Berset,<br />
kipa/ts<br />
Bischof Benjamin Ndiaye: «Ein etwa zwölfjähriges Mädchen hat mich beispielhaft gelehrt, dass gesellschaftliche<br />
Beziehungen den Menschen prägen und ihn erst ganz Mensch werden lassen. Begegnungen<br />
bewirken immer etwas. Deshalb lohnt es sich, sie zu einer gegenseitigen Bereicherung zu machen.»<br />
Foto: Missio Schweiz
I 6 medien<br />
Web-Tipp<br />
Lernprojekt Religionen in der Welt<br />
Gegründet von Religionswissenschaftler/innen<br />
in Fribourg 2005 setzt sich das<br />
«Lernprojekt Religionen in der Welt» als<br />
wichtigstes Ziel, in der Öffentlichkeit das<br />
Wissen über Religionen und religiöse Bewegungen<br />
zu erweitern und zu vertiefen.<br />
Aussagen und Erkenntnisse über Religionen<br />
oder religiöse Gemeinschaften werden<br />
unabhängig von religiösen Anschauungen<br />
und Überzeugungen dargestellt.<br />
Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen<br />
vermittelt und gesellschaftlich nutzbar gemacht<br />
werden, um ein friedliches und tolerantes<br />
Zusammenleben der Menschen und<br />
der verschiedenen Religionen zu fördern,<br />
um gegenseitiges Verstehen und Respektieren<br />
möglich zu machen. Die Website<br />
www.lernprojekt-religion.ch bietet viele<br />
Informationen und Anknüpfungspunkte<br />
für eine solche Vermittlungsarbeit: Projekte<br />
an öffentlichen und privaten Schulen,<br />
Weiterbildungsveranstaltungen für<br />
Lehrkräfte, Pflegefachpersonen sowie Referate,<br />
Workshops und Diskussionsforen<br />
zu ausgewählten Themen, Beratung und<br />
Informationen von politischen und gesellschaftlichen<br />
Einrichtungen. ts<br />
Radio<br />
Sonntag, 8. November<br />
Perspektiven. 20 Jahre Mauerfall. Die politische<br />
Sprengkraft der Kirche. DRS2, 8.30 Uhr<br />
(WH Do 15 Uhr)<br />
Römisch-katholische Predigt. Manfred Belok,<br />
Theologe, Chur. DRS2, 9.30 Uhr<br />
Evangelisch-reformierte Predigt. Manuela<br />
Liechti-Genge, Theologin, Münchenbuchsee,<br />
DRS2, 9.45 Uhr<br />
Menschen und <strong>Horizonte</strong>. «Salaam» – Eine<br />
Zürcherin in Afrika. Die 71-jährige Verena<br />
Bakri blickt auf ein abenteuerliches Leben zurück:<br />
Seit 40 Jahren ist sie mit ihrem äthiopischen<br />
Mann Bakri Abdoullahi verheiratet<br />
und lebt in Addis Abeba. Die Geschichte eines<br />
Lebens voller Höhen und Tiefen und einer<br />
grossen Liebe zu Afrika und seinen Menschen.<br />
DRS1, 14.05 Uhr (WH Di 21 Uhr)<br />
Fernsehen<br />
Kino-Tipp<br />
Bild: www.outnow.ch<br />
Looking for Eric<br />
Eric schwimmen so ziemlich alle Felle davon;<br />
seine Stiefsöhne driften in die Halbwelt<br />
ab, und er selbst gerät wegen eines<br />
Wiedersehens mit seiner ersten Frau in Panik.<br />
Urplötzlich erscheint ihm sein Idol, der<br />
Fussballstar Eric Cantona. Mit einer guten<br />
Portion Selbstironie spielt Cantona sich<br />
selbst und gibt mit französischem Akzent<br />
eine Lebensweisheit nach der anderen von<br />
sich. Und damit setzt er bei Eric einiges in<br />
Bewegung. Ken Loach, der Meis ter britischer<br />
Sozialdramen, hat einen erstaunlich<br />
leichtfüssigen Workingclass-Film über<br />
Freundschaft und Solidarität gedreht, in<br />
dem er die Bande der grossen Familie der<br />
Fussballfans beschwört. chs<br />
Samstag, 7. November<br />
Fenster zum Sonntag. Raus aus dem Hamsterrad.<br />
Erfolg, Vorankommen, Zukunft planen.<br />
Claude Schnierl strebte stets Chefpositionen an.<br />
Nur durch äussere Umstände ist das Hamsterrad,<br />
in dem er gefangen war, zum Stillstand gekommen.<br />
Nun hat er sich zu etwas ganz Neuem<br />
entschieden, der Arbeit mit alten Menschen. SF<br />
2, 13.50 Uhr (WH So 10.15 Uhr)<br />
Wort zum Sonntag. Thomas Joller. SF 1, 19.55<br />
Uhr<br />
Sonntag, 8. November<br />
Katholischer Gottesdienst aus dem Dom St.<br />
Jakobus in Görlitz. ZDF, 9.30 Uhr<br />
Sternstunde Religion. «Mein Gott. Dein Gott.<br />
Kein Gott». Migrationskirchen in der Schweiz.<br />
SF 1, 10 Uhr<br />
Sternstunde Philosophie. Keine Identität ohne<br />
Liebe. Ein Gespräch mit dem Bestsellerautor<br />
Richard David Precht. SF 1, 11 Uhr<br />
Montag, 9. November<br />
DOK. Der Pfarrer, der Sohn und die Haushälterin.<br />
Priesterskandal in Irland. SF 1, 22.50 Uhr<br />
Dienstag, 10. November<br />
Planet Schule. Wenn die Hoffnung stirbt, beginnt<br />
die Trauer. Mit nur zwölf Jahren starb<br />
Leonhard Korbinian Meyer an Leukämie. Der<br />
Film erzählt Leos Geschichte, eine Geschichte<br />
von Freundschaft, Liebe, Hoffnung und Tod.<br />
SWR, 7.30 Uhr<br />
Menschen unter uns. Wenn der Glaube Beton<br />
versetzt. Zwei Pfarrer, zwei Gemeinden, zwei<br />
Konfessionen – und doch haben sie eine gemeinsame<br />
Kirche. Der Film porträtiert eine ungewöhnliche<br />
Zusammenarbeit und begleitet Familien,<br />
Gruppen und Gemeindemitglieder im<br />
Alltag und bei ihren Aktivitäten. SWR, 23 Uhr<br />
Freitag, 13. November<br />
Ein Tag im Hospiz. Mit 38 Jahren ist Susanne<br />
Kränzle eine der jüngsten Leiterinnen eines<br />
stationären Hospizes in Deutschland. Sie hat<br />
es vor elf Jahren mit aufgebaut, ist eine Fachfrau<br />
für die Pflege von Schwerkranken und<br />
Sterbenden. Sie weiss, was Sterbende und ihre<br />
Angehörigen an Pflege, Beistand und an Nähe<br />
brauchen. Eine Reportage über den Alltag im<br />
Hospiz. 3sat, 12 Uhr<br />
Liturgie<br />
Jesus verweist uns auf die Witwe. Damals das<br />
Bild für die Armen. Sie hat nur etwas für den<br />
heutigen Tag. Aber – sie hat einen grossen Glauben,<br />
dass es morgen weitergeht und dass Gott<br />
selbst dafür sorgt. Was für ein Vertrauen strahlt<br />
diese Witwe aus! Sie gibt, was sie zum Leben<br />
braucht, ganz selbstverständlich. Jesus lädt uns<br />
ein, unsere eigenen Möglichkeiten zu entdecken<br />
und sie zu leben.<br />
Sonntag, 8. November<br />
Sonntag der Völker<br />
32. Sonntag im Jahreskreis<br />
(Farbe Grün, Lesejahr B)<br />
Erste Lesung: 1 Kön 17,10–16<br />
Zweite Lesung: Hebr 9,24–28<br />
Evangelium: Mk 12,38–44 (oder 12,41–44)<br />
<strong>Horizonte</strong>-Abo<br />
<strong>Horizonte</strong> ist eine Dienstleistung Ihrer Pfarrei. Änderungen zu Ihrem<br />
Abonnement melden Sie darum direkt dem Pfarramt Ihres Wohnortes.<br />
Sie finden die entsprechenden Angaben ab Seite 8.<br />
Änderungen bei ausserkantonalen Abos nimmt die buag Grafisches<br />
Unternehmen AG, Postfach, 5405 Baden-Dättwil, entgegen.<br />
T 056 484 54 35, postbox@buag.ch<br />
Impressum<br />
«<strong>Horizonte</strong>» – Pfarrblatt<br />
<strong>Aargau</strong><br />
erscheint wöchentlich<br />
Herausgeber<br />
Röm.-kath. Pfarrblattgemeinschaft<br />
des Kantons <strong>Aargau</strong><br />
Präsident Beat Niederberger<br />
Grabenstrasse 57, 4814 Bottenwil<br />
T 062 721 12 13<br />
bniederberger.horizonte@ag.kath.ch<br />
Redaktion<br />
Leitung Carmen Frei<br />
Michelholzstrasse 22, 8967 Widen<br />
T 056 610 07 44, F 056 610 07 43<br />
carmen.frei@horizonte-aargau.ch<br />
Thomas Schnelling<br />
Isenlaufstrasse 4, 5620 Bremgarten<br />
T 056 631 12 58<br />
thomas.schnelling@horizonteaargau.ch<br />
Agenda Silvia Berger<br />
Nägelistrasse 14, 5430 Wettingen<br />
T 056 426 59 92, F 056 426 59 91<br />
silvia.berger@horizonte-aargau.ch<br />
Kolumnenfoto Felix Wey<br />
In der Güpf 5, 5610 Wohlen<br />
Für den Text im Pfarreiteil ist das<br />
entsprechende Pfarramt zuständig.<br />
Mitarbeitende dieser Nummer:<br />
Martin Brander, Postfach 7, 4805<br />
Brittnau<br />
Kipa, Bederstrasse 76, 8027 Zürich<br />
Claudio Magris/Süddeutsche Zeitung,<br />
Redaktion, Hultschiner Strasse 8,<br />
D-81677 München
kontakt 7 I<br />
Liebe, Lust und Sexualität<br />
Wie Judentum, Christentum und Islam damit umgehen<br />
Das Hohe Lied der Liebe (Altes Testament): «Wenn er mich doch küsste mit den Küssen seines Mundes!<br />
Denn besser als Wein ist deine Liebe. Nimm mich mit! Laufen wir weg! Wir wollen jubeln und uns freuen,<br />
das Spiel deiner Liebe mehr preisen als Wein.»<br />
Foto: KNA-Bild<br />
Man hat den Eindruck, dass die Religionen mit<br />
Lust und Sexualität Probleme haben. Ein interreligiöses<br />
Gespräch unter Frauen in Basel zeigte<br />
überraschende Unterschiede und Gemeinsamkeiten,<br />
zeigte sinnenfreudige Elemente, aber<br />
auch Grenzziehungen.<br />
Organisiert wurde das Gespräch vom Interreligiösen<br />
Think-Tank und von kirchlichen Frauenstellen<br />
in Basel. Teilgenommen haben Amira Hafner-<br />
Al Jabaji, Islam- und Medienwissenschaftlerin,<br />
Gabrielle Girau Pieck, jüdische Theologin, und<br />
Judith Stofer, katholische Theologin.<br />
Im Judentum wird offen über den Körper und<br />
die Sexualität gesprochen, der Körper ist so heilig<br />
wie die Seele. In der Tora, im Buch Genesis,<br />
gilt Sex sogar als «höchste Form des Wissens»,<br />
wie Gabrielle Girau Pieck erläuterte. Sexuelle<br />
Beziehungen gehören aber klar in die Ehe.<br />
Auch nach dem Katholischen Weltkatechismus<br />
(Abschnitte 2360–2363) gehört Sex in die Ehe,<br />
so Judith Stofer. Er ist auf die Weitergabe des Lebens<br />
ausgerichtet, dient aber auch dem «Wohl»<br />
der Ehepartner. Der Katholische Katechismus<br />
zeige «eine restriktive<br />
Sicht ohne grosse<br />
Lust», kommentierte<br />
die katholische Theologin.<br />
In der Praxis<br />
sei früher Vieles über<br />
die Beichte reglementiert worden, über das «6.<br />
Gebot» mit dem Thema «Unkeuschheit». Beim<br />
Beichten hätte der Priester den Frauen Schuldgefühle<br />
gegenüber der Sexualität gemacht.<br />
Der Islam beurteilt wie das Judentum Sexualität<br />
grundsätzlich positiv, konnte Amira<br />
Hafner-Al Jabaji aufzeigen. Der Mensch sei<br />
als sexuelles Wesen erschaffen worden, Sexualität<br />
gehöre zum Plan Gottes (Koran 30,21).<br />
Sexualität kann deshalb nicht negativ bewertet<br />
werden, darf im Gegenteil auch lustvoll sein,<br />
gehört aber in jedem Fall auch im Islam klar in<br />
die Ehe. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung,<br />
sondern gehört zur Beziehung. Sexuelle Wünsche<br />
haben auch im Paradies Platz – wenigstens<br />
für Männer.<br />
Gemeinsam ist allen drei Religionen die grundsätzlich<br />
positive Haltung gegenüber der Sexualität<br />
als Teil der Schöpfung. Spannend sind die<br />
Einzelfragen, und überraschend, wie Details da<br />
und dort angesprochen werden.<br />
Aus der Sicht jüdischer Rabbinen darf der Mann<br />
nicht bloss die eigene Befriedigung als Ziel sehen.<br />
Er ist verpflichtet, die Frau zum Orgasmus<br />
zu bringen. Wenn die Frau Sex wünscht, muss<br />
der Mann darauf eingehen, heisst es im Talmud.<br />
Zur Häufigkeit gibt dort Rabbi Eliezer Ratschläge,<br />
abgestuft nach dem Beruf (Ketubbot<br />
5, 6): Arbeitslose und selbständig Erwerbende<br />
täglich, Arbeiter zweimal in der Woche, Seeleute<br />
wenigstens alle sechs Monate. Besprochen<br />
werden im Talmud auch Vorteile und Nachteile<br />
der verschiedenen Stellungen.<br />
Mit Verweis auf die Bibel, insbesondere auf<br />
das Hohelied, das ebenfalls zur katholischen<br />
Tradition gehört, konnte Judith Stofer zeigen,<br />
dass Sexualität viel Positives hat. Insbesondere<br />
Frauen, betonte die Theologin, setzen sich mit<br />
dem Hohenlied auseinander, das die erotische<br />
Anziehungskraft besingt. Dass auf der anderen<br />
Seite die Frau verantwortlich für den Sündenfall<br />
und die Vertreibung aus dem Paradies ist,<br />
wurde von Augustinus in die Kirche hineingetragen.<br />
Belastend wirkt auch die Erbsünde,<br />
die nach dieser Lehre von den Frauen mit der<br />
Geburt weitergegeben wird – Maria ist die Ausnahme.<br />
Heute leben die jungen katholischen<br />
Frauen ihre Sexualität selbstbewusst, fügte Stofer<br />
an. Zu ergänzen<br />
wäre, dass mit Pierre<br />
Stutz ein katholischer<br />
Theologe die<br />
Berührungspunkte<br />
zwischen Mystik<br />
und Erotik herausgearbeitet und eine Spiritualität<br />
der Erotik skizziert hat.<br />
Amira Hafner-Al Jabaji betonte, dass der Koran<br />
keine Erbsünde kenne. Zudem verführe nicht die<br />
Frau den Mann, sondern der Teufel verführe beide.<br />
Trotzdem hat die Frau in der orientalischen<br />
Gesellschaft den Ruf, «verführerisch» zu sein, sie<br />
soll sich deshalb gegenüber den Männern zurückhaltend<br />
kleiden. Damit wird weibliche Sexualität<br />
von den Männern unter Kontrolle gehalten, wie<br />
Amira Hafner-Al Jabaji formulierte. Buch-Tipps<br />
zu dieser Thematik finden Sie am Freitag unter:<br />
www.horizonte-aargau.ch Martin Brander<br />
Erfahrung der Liebe<br />
führt die Menschen über sich selber hinaus.
punctum 15 I<br />
Frieden ist möglich<br />
Claudio Magris – Plädoyer für ein Europa der Vielfalt<br />
Alles verschwört sich, um uns die Notwendigkeit<br />
des Krieges glauben zu machen, in die<br />
wir uns resigniert zu fügen haben. Nicht von<br />
ungefähr beginnt die abendländische Literatur<br />
mit einer grossen Kriegsdichtung, der Ilias,<br />
und heilige Bücher wie das Mahabharata und<br />
zum Teil auch das Alte Testament sind ebenfalls<br />
Kriegsbücher. Doch der Sinn des Lebens<br />
besteht darin, den götzendienerischen Verführungen<br />
dessen zu widerstehen,<br />
was sich als schicksalhaft darstellt.<br />
Immanuel Kant antwortet,<br />
dass gerade der Anblick der<br />
Verheerung fordere, dass diese nicht die einzige<br />
Wirklichkeit sei, und rechtfertigt die Hoffnung<br />
aller Verzweiflung zum Trotz.<br />
Eine Grenze, die nicht als Durchgang, sondern<br />
als Mauer, als Bollwerk gegen die Barbaren, erlebt<br />
wird, bildet ein latentes Kriegspotenzial.<br />
Heute sind es andere Grenzen, die den Frieden<br />
bedrohen, bisweilen unsichtbare Grenzen im<br />
Inneren unserer Städte, zwischen uns und den<br />
Neuankömmlingen aus allen Teilen der Welt,<br />
die wir kaum wahrnehmen, denn, wie es im<br />
«Lied von Mackie Messer» heisst, «die im Dunkeln<br />
sieht man nicht». Nicht nur an den italienischen<br />
Küsten landen Flüchtlinge, die man<br />
für räuberische Piraten hält. Die Reaktionen<br />
auf eine solche mit einer Invasion verwechselte<br />
Exilsuche sind hysterisch und symptomatisch<br />
in ihrer Brutalität.<br />
Der neue Populismus, der heutzutage mehr<br />
oder weniger überall in Europa umgeht, schafft<br />
Demokratien ohne Demokratie. Er ist eine Gefahr<br />
für die Demokratie und für den Frieden.<br />
Zusammenleben verschiedener Kulturen<br />
gegen Ausgrenzung und kulturelles Dominanzstreben.<br />
Dieser Populismus ist eine schwammige gesamtgesellschaftliche<br />
Erscheinung, die die unverbrüchlichen<br />
Grundwerte, jedes Gefühl für<br />
Recht und Unrecht, jeden Bezug zwischen dem<br />
Wohl des Einzelnen und dem Gemeinwohl aufgibt.<br />
Ein Gefühl, das zwar nicht ausreicht, aber<br />
das zu haben notwendig ist, um wenigstens hoffen<br />
zu können, dass man Gerechtigkeit schafft<br />
und damit Frieden. Ohne Gerechtigkeit ist kein<br />
Frieden möglich. Die wachsende Unduldsamkeit<br />
gegenüber dem Gesetz bringt den düsteren<br />
Traum von einem Leben ohne Gesetz zum Ausdruck,<br />
also von einem Dschungel, einem Zu-<br />
stand des Krieges aller gegen alle, jeder gegen<br />
jeden, in dem die Starken auf wenig Widerstand<br />
stossen, wenn es darum geht, die Schwachen zu<br />
unterdrücken.<br />
Der Krieg liegt in der Luft als Drohung oder als<br />
objektive Realität. Wir sitzen – wir freilich noch<br />
recht bequem – am Rand eines Vulkans mit dem<br />
Gefühl, dass er jeden Augenblick glühende Lavamassen<br />
ausspeien könnte, und dass die Welt,<br />
wie ein jüdisches Sprichwort sagt,<br />
zerstört werden könnte zwischen<br />
dem Abend und dem Morgen.<br />
Es wird darum gehen, uns selbst<br />
in Frage zu stellen und offen zu werden für den<br />
grösstmöglichen Dialog mit anderen Wertsystemen,<br />
dabei jedoch Grenzen um ein winziges,<br />
aber präzises und nicht mehr verhandelbares<br />
Quantum an Werten zu ziehen, an für immer<br />
erworbenen und als absolut anzusehenden Werten,<br />
die nicht mehr zur Diskussion gestellt werden:<br />
wenige, aber eindeutige Werte, wie zum<br />
Beispiel die rechtliche Gleichstellung aller Bürger,<br />
unabhängig von Geschlecht, Religion oder<br />
Volkszugehörigkeit.<br />
Viele Utopien sind verflogen, doch nicht verflogen<br />
ist die Forderung, dass die Welt nicht nur<br />
verwaltet, sondern vor allem auch verändert werden<br />
muss. «Ändere die Welt, sie braucht es!» forderte<br />
Bertolt Brecht. Ändere sie auch, wenn alles<br />
dich drängt zu glauben, dies sei unmöglich.<br />
Papst Gregor der Grosse pflegte zu sagen, dass<br />
er ohne seine Brüder grundlegende Dinge des<br />
Lebens nicht verstanden hätte, und das gilt auch<br />
für jeden, der nicht Papst ist. Sicher, wer nicht<br />
Papst ist, weiss genau, dass man diese grundlegenden<br />
Dinge nicht nur den Brüdern, sondern,<br />
oder vor allem, auch den Schwestern verdankt.<br />
Claudio Magris, sz/ts<br />
Claudio Magris: «Ich bin davon überzeugt, dass man sich immer der anderen Seite öffnen muss. Dabei<br />
dürfen wir bestimmte Werte, die wir als universal anerkennen, nicht zur Disposition stellen: die Gleichheit<br />
von allen Bürgern, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit. Man muss das Unbekannte<br />
auf der anderen Seite entdecken, um es irgendwann als das Eigene zu begreifen.»<br />
Foto: Thompson Reuters<br />
Zur Person<br />
Claudio Magris, geboren 1939 in Triest, ist<br />
ein italienischer Schriftsteller, Germanist<br />
und Übersetzer. Von 1978 bis zu seiner Pensionierung<br />
2006 war er Professor für moderne<br />
deutschsprachige Literatur an der Universität<br />
Triest. Im Oktober 2009 erhielt er den<br />
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.<br />
Aus seiner Dankesrede in der Paulskirche in<br />
Frankfurt am Main sind diese Auszüge entnommen.
I 16 agenda<br />
Propstei Wislikofen<br />
15. November<br />
Wenn eigene Worte fehlen. Text und Musik<br />
in Zeiten der Trauer. 15.11., 17 Uhr, Kirche der<br />
Propstei Wislikofen. In der 6. Veranstaltung der<br />
Reihe «Wenn eigene Worte fehlen» sollen Texte<br />
von Autorinnen und Autoren, die in ebensolchen<br />
Situationen um Worte gerungen haben,<br />
der eigenen Stimme wieder einen Weg bereiten.<br />
Ohne Anmeldung. Eintritt frei (siehe auch Bildung<br />
Mobil).<br />
28. November<br />
Böse Mädchen kommen in die Chefetage.<br />
Durchsetzungstraining für Frauen. 28.11.,<br />
9.30 bis 17 Uhr. Leitung: Claudia Mennen,<br />
Theo login, Organisationsberaterin. Anmeldung:<br />
T 056 201 40 40, www.propstei.ch<br />
Bildung Mobil<br />
12. November<br />
Pilgern wohin? 12.11., 19 Uhr, Moschee Döttingen.<br />
Die ökumenische Erwachsenenbildung<br />
Surbtal lädt zu einem vierteiligen Veranstaltungszyklus<br />
«Islam-Christentum» ein. Der dritte<br />
Abend bietet eine Besichtigung der Moschee<br />
an und vergleicht Pilgern im Christentum und<br />
im Islam. Impulsreferate und Begegnungen.<br />
Auskunft/Anmeldung bis 10. November: T 056<br />
438 09 42, thomasmarkus.meier@ag.kath.ch<br />
ab 13. November<br />
Musikmeditation: Klingende Namen – swingende<br />
Noten. 13./20./27.11., 19.30 bis 21 Uhr,<br />
Chorherrenhaus, Baden. Drei Abende erzählen<br />
biblische, frühchristliche und mythologische<br />
Geschichten nach, mit Hörbeispielen, Deutungen<br />
und Anregungen. Leitung: Thomas<br />
Markus Meier. Anmeldung bis 8. November: T<br />
056 438 09 40, bildung-mobil@ag.kath.ch<br />
15. November<br />
Wenn eigene Worte fehlen. Text und Musik<br />
in Zeiten der Trauer. 15.11., 17 Uhr, Kirche der<br />
Propstei Wislikofen. Für Menschen, die einen<br />
Verlust betrauern, aber auch für Menschen, die<br />
kranke, sterbende oder trauernde Menschen begleiten.<br />
Texte: vorgelesen von Susanne Andrea<br />
Birke; Cello: Ruth Fischer (siehe auch Propstei<br />
Wislikofen).<br />
Gähnende Leere auf dem Nachttisch?<br />
Buchtipps<br />
auf www.horizonte-aargau.ch<br />
Aarg. Kath. Frauenbund<br />
12. November<br />
Verleihung des 13. AKF-Frauenpreises. 12.11.,<br />
19 Uhr, Kirche des Frauenklosters St. Martin,<br />
Hermetschwil. Feierliche Preisübergabe mit<br />
musikalischer Umrahmung, anschliessend<br />
Apéro. Auskunft/Anmeldung: AKF-Geschäftsstelle,<br />
T 056 668 26 42,<br />
info@frauenbund-aargau.ch<br />
Kirchenmusik<br />
Villmergen<br />
8. November<br />
Orgelkonzert. 8.11., 17 Uhr, St. Peter und Paul,<br />
Villmergen. Helene Thürig, Lenzburg, spielt<br />
Werke von J.S. Bach, J.P. Sweelinck, G. Cavazzoni,<br />
O. Messiaen und F. Mendelssohn-Bartholdy.<br />
Eintritt frei.<br />
Weitere Angebote<br />
21. November<br />
Informationstag über die neuen Ausbildungsmöglichkeiten<br />
zum Religionspädagogen,<br />
zur Religionspädagogin RPI. 21.11., 10.15<br />
bis 13 Uhr, Universitätsgebäude, Pfistergasse<br />
20, Luzern. Auskunft/Anmeldung: T 041 228<br />
55 20, rpi@unilu.ch<br />
22. November<br />
Was Paare zusammenhält. 22.11., 14.30 bis<br />
17.30 Uhr. Stella Matutina Bildungshaus, Hertenstein.<br />
In diesem Seminar stellt der bekannte<br />
Paartherapeut und Buchautor Jürg Willi dar,<br />
weshalb es heute so schwierig ist, eine stabile<br />
Paarbeziehung aufzubauen, obwohl sich nach<br />
wie vor die meisten Menschen danach sehnen.<br />
Auskunft/Anmeldung: T 041 390 11 57,<br />
www.stellamatutina-bildungshaus.ch<br />
Offene Stellen<br />
Mitarbeiter/in Café Forum<br />
Zur Ergänzung unseres Teams im Café Forum,<br />
Pfarrei St. Anton Wettingen, suchen wir per sofort<br />
oder nach Vereinbarung eine Servicemitarbeiterin/einen<br />
Servicemitarbeiter. Arbeitszeit:<br />
Vor allem am Abend und am Wochenende.<br />
Auskunft: Jeanette Ebner, Leiterin Café Forum,<br />
jeanette.ebner@bluewin.ch. Bewerbung: Kath.<br />
Kirchgemeinde Wettingen, Klosterstrasse 12,<br />
5430 Wettingen, T 056 437 08 37<br />
Schulleiter/in 10%<br />
Die Kirchenmusikschule <strong>Aargau</strong> sucht per<br />
1.2.2010 oder nach Vereinbarung einen Schulleiter/eine<br />
Schulleiterin. Voraussetzung: Kirchenmusikalische<br />
Ausbildung und/oder Praxis,<br />
organisatorisches Geschick, Führungsqualitäten.<br />
Auskunft: Veronika Kühnis, T 056 441 21<br />
36, www.kmsa.ch. Bewerbung mit Foto bis 30.<br />
November: Schulkommission KMSA, Hans-<br />
Dieter Lüscher, Zetzwilerstrasse 14, 5725 Leutwil,<br />
info@kmsa.ch<br />
In der Region<br />
Suhr<br />
29. November<br />
Adventstanzen. Einfach mittanzen, erleben,<br />
nachspüren und die Sinne für die Innigkeit dieser<br />
vorweihnächtlichen Zeit öffnen. 29.11., 14<br />
bis 17 Uhr, Pfarrsaal der kath. Kirche Suhr. Kosten:<br />
Fr. 30.–. Leitung/Auskunft/Anmeldung bis<br />
25.11.: Elisabeth Utz-Meier, 5722 Gränichen,<br />
T 062 842 90 36, elisabeth.utz@gmx.ch<br />
kurz notiert<br />
Informationstag Theologie in Luzern<br />
Die Theologische Fakultät der Universität<br />
Luzern bietet am 25. November 2009<br />
und auch am 17. März 2010 erstmals einen<br />
umfassenden Informationstag an. Nebst<br />
Informationen zum Theologiestudium<br />
und einem gemeinsamen Vorlesungsbesuch<br />
stehen am Nachmittag verschiedene<br />
Workshops auf dem Programm.<br />
Interessierte können sich dabei ein Bild<br />
verschaffen, wo Theologinnen/Theologen<br />
ihr Fachwissen in der Praxis einbringen.<br />
Herzlich eingeladen sind Maturandinnen/Maturanden<br />
sowie alle, die sich<br />
für ein Theologiestudium interessieren.<br />
Auskunft/Anmeldung bis 17. November<br />
T 041 228 46 14, stephan.mueller@unilu.ch,<br />
www.unilu.ch