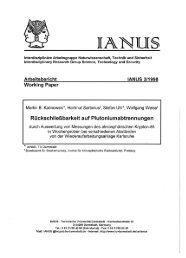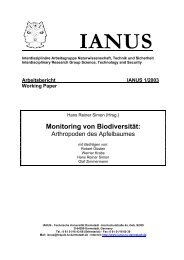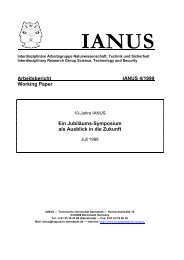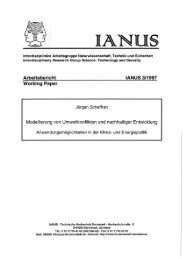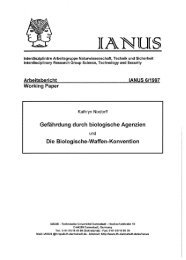ianus 13/1992
ianus 13/1992
ianus 13/1992
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhalt<br />
Vorwort....S. 1<br />
I. Konfliktfall Gerechtigkeit. Zum Stand der philosophischen Diskussion über den zentralen Begriff der politischen<br />
Ethik ....S. 2<br />
Zusammenfassung ....S. 2<br />
1. Vertragstheorie der Gerechtigkeit (John Rawls) ....S. 2<br />
1.1. Der Urzustand ....S. 2<br />
1.2. Die Grundsätze der Gerechtigkeit ....S. 3<br />
1.3. Vorzüge und Grenzen der Theorie der Gerechtigkeit ....S. 5<br />
2. Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat (Otfried Höffe) ....S. 6<br />
2.1. Ausgangspunkte und Grundgedanken ....S. 6<br />
2.2. Gerechte Herrschaft ....S. 8<br />
2.2.1. Lehren aus Platon und Aristoteles. Das Kooperationsmodell und seine Grenzen ....S. 8<br />
2.2.2. Die Begründung der Herrschaft aus dem Konflikt. Das Gedankenexperiment des Naturzustandes ...S. 9<br />
2.2.3. Sicherung der Freiheit in sozialen Institutionen ....S. 10<br />
2.2.4. Gerechtigkeitstheorie als Freiheitstheorie. Mittlere Prinzipien der Gerechtigkeit und Menschenrechte... S. 10<br />
2.3. Zum Stand der Diskussion ....S. 11<br />
3. Gerechtigkeit und Gemeinschaft: Die Kommunitarismus-Debatte ....S. 11<br />
3.1. Kommunitarismus ....S. 11<br />
3.2. Rekonstruktion der aristotelischen Tugendlehre (A. MacIntyre) .... S. 12<br />
3.2.1. Was ist Praxis? ....S. <strong>13</strong><br />
3.2.2. Was ist die narrative Ordnung eines einzelnen menschlichen Lebens? ....S. <strong>13</strong><br />
3.2.3. Was ist moralische Tradition? ....S.14<br />
3.3. Offene Fragen ....S. 14<br />
4. Ungerechtigkeit und Befreiung (Enrique Dussel) ....S.15<br />
4.1. Der historische Kontext ....S. 15<br />
4.2. Die Wirklichkeit ....S. 16<br />
4.3. Die Deutungskategorien ....S. 17<br />
4.4. Die befreiende Praxis ....S. 19<br />
5. Perspektiven der Gerechtigkeit ....S. 21<br />
5.1. Die Provokation der Befreiungsethik ....S. 22
1<br />
Vorwort<br />
Der Beitrag "Konfliktfall Gerechtigkeit. Zum Stand der philosophischen Diskussion über den zentralen Begriff der<br />
politischen Ethik" ist aus einem Vortrag entstanden, den ich im Frühjahr <strong>1992</strong> bei der Hessischen Stiftung für<br />
Friedens- und Konfliktforschung gehalten habe. Der Aufsatz ''Wege zum dauerhaften Frieden" steht im Zusammenhang<br />
kontinuierlicher Auseinandersetzungen mit friedensethischen Positionen; in der vorliegenden Form soll<br />
er in den "Friedensanalysen 25" veröffentlicht werden.<br />
Beide Aufsätze möchten die Einsicht fördern, daß der Friede ohne die Herbeiführung gerechter Weltverhältnisse<br />
nicht zu haben sein wird.
3<br />
Von den Menschen im Urzustand wird zweitens angenommen, daß sie einen Gerechtigkeitssinn haben. Damit ist<br />
nicht eine inhaltlich bestimmte Form von Gerechtigkeit gemeint, sondern ein "rein formaler GerechtigkeitssinnlI:<br />
Wenn bestimmte Regeln von allen gemeinsam - Mehrheitsbeschlüsse sind nicht vorgesehen - beschlossen worden<br />
sind, dann können sie sich darauf verlassen, daß alle sich streng nach ihnen richten werden. (6)<br />
Ein drittes Merkmal des Urzustandes besteht darin, daß die Menschen sich llhinter einem Schleier des Nichtwissens<br />
befinden" (7). Damit ist nicht gemeint, daß sie gar keine Kenntnisse besitzen. Im Gegenteil, sie verfügen über<br />
ein recht umfangreiches allgemeines Wissen: zum Beispiel über wirtschaftliche Zusammenhänge, soziale und psychologische<br />
Fragestellungen. Der Schleier des Nichtwissens verbirgt allerdings Einzeltatsachen: Keiner kennt seine<br />
Klassen- oder Schichtzugehörigkeit, seine Begabungen und seine psychischen Besonderheiten, seine Zugehörigkeit<br />
zu einer bestimmten Generation; die Parteien wissen nicht um ihre besondere politische und wirtschaftliche Lage<br />
oder den Entwicklungsstand ihrer Gesellschaft. (8) Die Annahme, daß a1l diese Einzelkenntnisse fehlen, ermöglicht<br />
ein faires Verfahren zur Aufstellung von Grundsätzen der Gerechtigkeit. (9)<br />
Die vierte Annahme besteht darin, "daß die Menschen im Urzustand gleich seien. Das heißt, sie haben bei der<br />
Wahl der Grundsätze alle die gleichen Rechte; jeder kann Vorschläge machen, Gründe für sie vorbringen usw."<br />
(10)<br />
Schließlich sei auf eine fünfte Annahme aufmerksam gemacht. Die Partner im Urzustand sind "Dauerpersonen",<br />
nicht Einzelpersonen. Sie werden gedacht als Familienhäupter oder Nachkommenlinien. Auf diese Weise wird sichergestellt,<br />
daß die Gerechtigkeitsgrundsätze auch die Gesichtspunkte der Gerechtigkeit zwischen den Generationen<br />
beachten. (11)<br />
Der Leitgedanke von Gerechtigkeit als Fairness besteht darin, daß die Grundsätze der Gerechtigkeit in einer fairen<br />
Ausgangssituation einstimmig ausgehandelt werden. (12) Diese Grundsätze lassen sich nach dem Gesagten<br />
formal bestimmen "als diejenigen, auf die sich vernünftige Menschen, die ihre Interessen verfolgen, als Gleiche einigen<br />
würden, wenn von keinem bekannt ist, daß er durch natürliche oder gesellschaftliche Umstände bevorzugt<br />
oder benachteiligt ist" (<strong>13</strong>). Auf welche Inhalte werden sich nun die Partner im Urzustand einigen können?<br />
1.2. Die Grundsätze der Gerechtigkeit<br />
Der erste Grundsatz, den alle Mitglieder im Urzustand annehmen würden, lautet: "Jeder Person hat ein gleiches<br />
Recht auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit dem entsprechhenden System von Freiheiten<br />
für alle vereinbar ist." (14) Die Liste der Grundfreiheiten umfaßt die politischen Freiheiten (aktives und<br />
passives Wahlrecht), die Rede- und Versammlungsfreiheit, die Gewissensfreiheit, die persönlichen Freiheiten<br />
(Unverletzlichkeit der Person), das Recht auf persönliches Eigentum und der Schutz vor willkürlicher Festnahme<br />
und Haft. "Diese Freiheiten sollen für jeden gleich sein." (15)<br />
Die Parteien könnten sich dagegen nicht auf das Prinzip der Mehrung des Nutzens der Allgemeinheit einigen. Die<br />
Annahme des Nutzenprinzips würde die Freiheit der Einzelnen von der Berechnung des gesellschaftlichen Nut-
5<br />
Die Grundsätze der Gerechtigkeit stellen den ersten Schritt in einem ''Vier-Stufen-Gang'' dar, in dem die Mitglieder<br />
des Urzustandes nun auch die Institutionen einer gerechten Gesellschaft erarbeiten müssen. (23) In einem<br />
zweiten Schritt konstituieren sie sich deshalb als verfassungsgebende Versammlung, 'die ausgehend von den Gerechtigkeitsgrundsätzen<br />
das Grundgesetz oder die Verfassung des gerechten Staates entwirft und verabschiedet.<br />
Dies ist die Voraussetzung dafür, daß drittens die verfassungsmäßigen Körperschaften die notwendigen gesetzgeberischen<br />
Maßnahmen einleiten und viertens - z.B. durch Gerichte - die Anwendung von Verfassung und Gesetz<br />
in konkreten Einzelfällen geklärt wird. Es ist offensichtlich: "Die wichtigsten Institutionen dieser Grundstruktur<br />
sind die einer konstitutionellen Demokratie." (24)<br />
1.3. Vorzüge und Grenzen der Theorie der Gerechtigkeit<br />
Ausgangspunkt von RawIs' Überlegungen ist eine intuitive Vorstellung, die des Urzustands, von der aus mit der<br />
Methode des Überlegungs-Gleichgewichts die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit entfaltet werden. Das Verhältnis<br />
von "moralischen Intuitionen" und "abwägender Vemunft" läßt sich noch weiter klären. Bezeichnet man<br />
mit Moral die Regeln des Verhaltens und mit Ethik die Begründung dieser Regeln, dann ist Moral das Primäre.<br />
Sie ist schon da, wenn Ethik einsetzt. Was die Ethik betrifft, ist eine Unterscheidung zwischen Entlarvung und Begründung<br />
angebracht. Geschichtlich früher noch als die Begründung moralischer Regeln ist der Aufweis des wirklichen<br />
Grundes der herrschenden Moral, z.B. Machterhalt und -durchsetzung, wodurch die Moral als Unmoral<br />
entlarvt wird. Beginnt die Entlarvung der Moral mit den Sophisten im fünften Jahrhundert v.ehr. - und wird besonders<br />
wirksam in Bezug auf die bürgerlich-christliche Moral bei K. Marx, F. Nietzsche und S. Freud -, so setzt<br />
die Begründung der moralischen Regeln später ein: in Platons "Staat", in den Ethiken des Aristoteles, - und wird<br />
in der Gegenwart besonders betont bei Karl-Otto Apel in seiner Letztbegründung der Kommunikationsethik. (25)<br />
Die Theorie der Gerechtigkeit ist mit ihren intuitiven Vorstellungen eines Urzustandes an Erfahrungen von Freiheit<br />
und Fairness, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie Vemünftigkeit orientiert. Diese Erfahrungen gehen in die<br />
Beschreibung des Urzustandes ein. Mit der Methode des Überlegungs-Gleichgewichts wird überprüft, welche<br />
Prinzipien den Intuitionen entsprechen und auf welche die Partner im Urzustand sich einigen könnten. (26) Die<br />
Theorie der Gerechtigkeit erweist sich als eine eher explikative Theorie; sie entfaltet den Gedanken der Gerechtigkeit,<br />
begründet ihn letzten Endes aber nicht. Dieser Begründungsaufgabe unterzieht sich Otfried Höffe in<br />
seinem Buch "Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat". (27)<br />
Das Gedankenexperiment des Urzustands konzipiert diesen als Idealzustand; d.h. er abstrahiert von den Widrigkeiten<br />
der Realität, den Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen den Menschen und ihren gesellschaftlichen<br />
Institutionalisierungen. Dies wird bewußt in Kauf genommen, um möglichst klar das Ideal der verteilenden<br />
Gerechtigkeit in den Grundnormen herausarbeiten zu können. Das Verfahren hat seine Vorteile in Gesellschaften,<br />
in denen Gleichheit prinzipiell zugestanden und das Gefälle sozialer Ungerechtigkeit begrenzt ist. Es wird ja in<br />
der Tat eine demokratische und soziale Grundordnung entwickelt, die kritische Anfragen an die bürgerliche Gesellschaft<br />
enthält. Das Unterschiedsprinzip mit seinem Grundsatz sowohl der Brüderlichkeit als auch des Sparens<br />
ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Hier erweist sich die Theorie von John RawIs als Reformkonzept,<br />
das "einigermaßen günstige" soziale Bedingungen als bereits verwirklicht voraussetzt. Sie hat Zustände im Auge,<br />
wie sie in den westlichen Industrienationen bestehen. (28) Was soll aber dort gelten, wo fast ausschließlich die
7<br />
ordnung und kam in den politisch-religiösen Bürgerkriegen zum. Ausdruck. Sie führte zu einer Entideologisierung<br />
des Staates, zur Erkenntnis, daß die Autorität - und nicht die Wahrheit - das Gesetz begründet ("auctoritas, non<br />
veritas facit legem ll ), und damit zum Rechtspositivismus. Für ihn ist die philosophische Legitimationsfrage ohne<br />
Bedeutung.<br />
Die zweite Grunderfahrung war die Radikalkritik der politischen Verhältnisse, durch die Menschen ausgebeutet<br />
und unterdrückt, in denen ihnen die Menschenrechte verweigert werden. Ausgehend von diesen Erfahrungen wird<br />
Herrschaftsfreiheit als Gesellschaftsprinzip gefordert. Die Konsequenz ist der Anarchismus, der die philosophische<br />
Legitimationsfrage von Recht und Staat verneint.<br />
Für denjenigen, der den Rechtspositivismus für unzureichend, weil unkritisch, und den Anarchismus für unrealistisch<br />
hält, stellt sich die Aufgabe einer Legitimation von Recht und Staat in Auseinandersetzung mit diesen beiden<br />
(negativen) Positionen. Hinzu kommt die Diskussion des Utilitarismus als der vielleicht einflußreichsten<br />
(positiven) ethischen Legitimationstheorievon Recht und Staat. Dabei will O. Höffe außerdem zwei Defizite der<br />
zeitgenössischen Ethik-Debatte im Auge behalten: Für die herrschaftsfreien Diskurstheorien (K.-O. Ape~ J. Habermas)<br />
spielt zumindest in ihrem theoretischen Ansatz die Frage nach den politischen Zwangsbefugnissen keine<br />
Rolle, während sich die ethikfreien Institutionstheorien (Th. Hobbes, A. Gehlen, H. Schelsky, N. Luhmann) nicht<br />
in der Lage sehen, diese Zwangsbefugnisse zu kritisieren. (36)<br />
In seiner politischen Fundamentalphilosophie fragt O. Höffe also nach der Legitimität von Recht und Staat<br />
schlechthin, "ob Recht und Staat überhaupt in die Freiheit des einzelnen und in das Spiel der gesellschaftlichen<br />
Kräfte (den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen "Markt") eingreifen dürfen"(37). Der Begriff der Handlungsfreiheit<br />
ist für die Theorie der politischen Gerechtigkeit zentral. Sie ist der Ausgangspunkt der Legitimationsüberlegungen,<br />
z.B. bei der Frage nach dem Naturzustand, und bleibt das entscheidende Überprüfungskriterium,<br />
z.B. bei den mittleren Prinzipien der Gerechtigkeit.<br />
Eine vorläufige semantische Bestimmung der Gerechtigkeitsperspektive führt zu den folgenden Ergebnissen. Mit<br />
dem Prädikat "gerecht" drücken wir eine Wertschätzung aus, die wir nicht subjektiv, sondern objektiv verstanden<br />
wissen wollen. Gegenstand einer solchen Beurteilung ist die menschliche Praxis, genauer sozial relevante Handlungen<br />
und gesellschaftliche Beziehungen. Gerechtigkeit drückt also eine soziale Verbindlichkeit aus. Dabei lassen<br />
sich verschiedene Stufen von Verbindlichkeit unterscheiden. Auf einer ersten Stufe bezeichnen wir etwas als gut<br />
und empfehlen es, weil es der Erreichung eines wünschenswerten Ziels - z.B. Wohlstand oder Umweltqualität <br />
dient; es handelt sich um die Stufe der Zweckrationalität, auf der eine Handlung als "gut für etwas" genannt wird.<br />
Die zweite Stufe ist die der pragmatischen Orientierung, die entweder individual- oder sozialpragmatisch sein<br />
kann; hier wird nach dem gefragt, was "gut für jemanden" ist. (Der Utilitarismus ist eine sozialpragmatische Theorie.)<br />
Die dritte Stufe ist die der sittlichen Beurteilung. Hier ist die Frage nach der Gerechtigkeit angesiedelt: Die<br />
zweckrationalen und die pragmatischen Orientierungen werden im Hinblick auf ihre Legitimität befragbar: ist das,<br />
was gut für etwas oder für jemanden ist, auch gerecht? Gerechtigkeit ist also eine Kategorie der sittlichen Beurteilung.<br />
(38)<br />
Verbindet man den zentralen Gedanken der menschlichen Handlungsfreiheit mit dem zentralen Legitimations-
9<br />
Unrecht in der Familie (Mann-Frau-, Eltem-Kind-, Herr-Sklave-Verhältnis), in den (Sippen-) Gemeinschaften<br />
und in der polis. Aristoteles vertieft und erweitert also das Kooperationsmodell. Was das Konfliktmodell betrifft,<br />
so deuten sich Ansätze an. Dies gilt besonders für die Feststellung, daß derjenige, der ohne Gesetz lebe, "gierig<br />
nach Krieg" sei. (42)<br />
Als Fazit hält O. Höffe fest: Das Kooperationsmodell zeigt, warum der Mensch die Gemeinschaft und sogar ausdifferenzierte<br />
Gemeinschaftsformen sucht und braucht; es reicht aber nicht aus, um Recht und die Sanktion von<br />
Recht durch Herrschaft zu begründen. Dazu ist das Konfliktmodell nötig. Platon wie Aristoteles sehen die Konfliktgefahren.<br />
Ersterer sieht sie in einer anthropologisch variablen Begehrlichkeit, letzterer eher in der Konfliktnatur<br />
des Menschen begründet. Wirkungsgeschichtlich blieb allerdings das Kooperationsmodell im Vordergrund.<br />
Beide Modelle verbinden sich in dem Begriff I. Kants von der "ungeselligen Geselligkeit", dem Hang der Menschen,<br />
"in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaften<br />
beständig zu trennen droht, verbunden ist" (43). Kant nennt dies einen Antagonismus. Es stellt sich demnach jetzt<br />
die Aufgabe, Recht und Staat in einem Konfliktmodell zu begründen.<br />
2.2.2. Die Begründung der Herrschaft aus dem Konflikt. Das Gedankenexperiment des Naturzustandes<br />
Bei dem Gedankenexperlment des Naturzustandes unterscheidet O. Höffe die Versuchsanordnung und die Versuchsdurchführung.<br />
In der Versuchsanordnung werden die Voraussetzungen des Versuchs festgelegt. Es ist der entscheidende Schritt<br />
des Gedankenexperiments. Da Höffe seinen philosophischen Gerechtigkeitsdiskurs mit dem entschiedensten<br />
Gegner von Recht und Staat, dem strengen Anarchismus, führen will, ist bei der Beschreibung des Naturzustandes<br />
hauptsächlich der Gedanke leitend, keine Annahmen zu machen, die der Anarchist nicht akzeptieren könnte.<br />
Deshalb kommt weder ein Gerechtigkeitssinn (J. Rawls) noch eine Glücksvorstellung (Aristoteles), aber auch<br />
nicht "a war of every man against every man" (Tb. Hobbes) für die Bestimmung des Naturzustandes in Frage. Positiv<br />
gewendet: Gerade weil es um die Auseinandersetzung mit dem Anarchismus geht, wird für die Versuchsanordnung<br />
die Freiheitsannahme zentral. Dabei wird Freiheit als Handlungsfreiheit - und ~cht etwa als Autonomie<br />
des Willens (I. Kant) - verstanden und zusätzlich angenommen, daß sie sozial unbegrenzt ist, d.h. nicht durch andere<br />
Menschen eingeschränkt wird. Eine solche Freiheit darf sich begehrend aufjeden Gegenstand richten. Begrenzt<br />
werden kann sie nur durch die eigene Entscheidung oder durch die äußere Natur, z.B. durch die Gefahren,<br />
die mit dem Erwerb eines begehrten Gegenstands verbunden sind. Eine solche Versuchsanordnung macht deutlich,<br />
daß die Gerechtigkeitstheorie als Freiheitstheorie - und nicht als Glückstheorie - konzipiert werden soll.<br />
Der VersuchsanordnungJolgt die Versuchsdurchtührung. Was spielt sich ab, wenn die uneingeschränkte Freiheit<br />
einer Person auf die ebenso uneingeschränkte Freiheit einer anderen Person trifft? Das Gedankenexperiment<br />
kommt schnell und einleuchtend zu einem ersten Resultat: "Bei einer Koexistenz freier Personen in derselben Außenwelt<br />
muß ständig mit Konflikten gerechnet werden; die Handlungsfreiheit des oder der einen muß stets durch<br />
die Handlungsfreiheit des oder der anderen begrenzt werden", sei es durch Verhandlung, durch Nachgeben oder<br />
durch Kampf; "das heißt: sie kann nicht mit ihr zusammen bestehen." (44) Die menschliche Sozialnatur ist - und
11<br />
der jeweiligen Person(engruppe) ein geringeres Gewicht haben, so kann A, dem das Leben über alles geht, der<br />
aber an Glauben und Ehre nicht sonderlich interessiert ist, dem B die Glaubensfreiheit und dem C die Freiheit vor<br />
Beleidigungen anbieten, wenn er jeweils im Gegenzug deren Tötungsverzicht erhält. Diesen Verzicht erhält er<br />
aber, weil seine Tauschpartner das Angebot, den Verzicht auf Beeinträchtigungen der Religionsausübung (für B)<br />
bzw. der Ehre (für C), für wertvoller halten als ihr eigenes Angebot, den Tötungsverzicht." (47)<br />
Auf diese Weise entsteht ein System von Freiheitsverzichten und Freiheitsanerkennungen (z.B. Schutz für Leib<br />
und Leben, Religionsfreiheit, Schutz der Ehre, Selbstbestimmungsrecht), die aus der Perspektive der einzelnen<br />
Subjekte den Charakter von Menschenrechten haben, wobei die einzelnen für sich die einzelnen Rechte unterschiedlich<br />
gewichten werden. (48)<br />
2.3. Zum Stand der Diskussion<br />
Handelt es sich bei der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls um eine Explikation des Gerechtigkeitsgedankens,<br />
so konzentriert sich Otfried Höffe auf die Legitimation von Recht und staatlicher Gerechtigkeit. Beide kommen<br />
darin überein, daß sie ihre Gerechtigkeitstheorie als Freiheitstheorie entwickeln, daß Regeln und Prinzipien<br />
innerstaatlicher Gerechtigkeit im Vordergrund ihres Interesses stehen und daß ihre Argumentation der Tradition<br />
der europäischen AuOdärung verpflichtet ist. Sie argumentieren ausgehend von einem vergleichbaren Modell, dem<br />
Urzustand bzw. Naturzustand; in beiden Fällen wird durch Abstraktion von realen Verhältnissen im Gedankenexperiment<br />
eine Situation herzustellen versucht, in der das vernünftige Argument sich entfalten kann.<br />
Die Stärken dieser Ansätze verbinden sich mit Schwächen. Die Gerechtigkeit in der Lebenswelt zwischen Individuen<br />
und Staat wird nicht oder nur wenig thematisiert. Dies gilt besonders für J. Rawls. Dagegen entwickelt O.<br />
Höffe ausdrücklich eine Institutionstheorie, die aber nicht zu einer Theorie der Gemeinschaften weiterentwickelt<br />
wird. Diesen Mangel jedenfalls nimmt der amerikanisehe Kommunitarismus wahr und reagiert darauf.<br />
Die Sphäre jenseits des Staates, also die zwischenstaatlichen Beziehungen und damit die Fragen der internationalen<br />
Gerechtigkeit kommen nicht in den Blick. Dies hängt mit den Abstraktionen und Definitionen eines Naturzustandes<br />
zusammen. Die durch den Nord-Süd-Konflikt und durch die ökologische Krise gekennzeichnete Weltlage<br />
wird deshalb nicht thematisiert. Diese Perspektiven aber vermissen die (lateinamerikanischen) Befreiungsethiken,<br />
die zudem das Konzept der Gerechtigkeitstheorie als Freiheitstheorie in Frage stellen.<br />
3. Gerechtigkeit und Gemeinschaft: Die Kommunitarismus-Debatte<br />
3.1. Kommunitarismus<br />
Kommunitarismus ist die Sammelbezeichnung für eine Argumentations- und Forschungsrichtung bestimmter<br />
amerikanischer Soziologen, Politologen und Philosophen, die übereinstimmen in der Kritik des Individualismus in<br />
der amerikanischen Gesellschaft, zum Teil auch in der Kritik des Rationalismus einer (mißverstandenen) Aufklärung,<br />
und die für eine Wiederbesinnung aufden Begriff der Gemeinschaft plädieren. (49) So wenden sich z.B.<br />
Robert N. Bellah und Mitarbeiter/innen gegen ein Verständnis von Freiheit, das nicht mehr bedeutet als das<br />
Recht, allein und von den Forderungen anderer unbehelligt gelassen zu werden. Sie plädieren für die weiterge-
<strong>13</strong><br />
bieten kann -, schlägt A. MacIntyre eine Rekonstruktion der aristotelischen TugendJehre vor. Dazu seien drei<br />
Fragen zu beantworten: Was istPraxis? Was ist die narrative Ordnung eines einzelnen menschlichen Lebens? Was<br />
ist moralische Tradition? (62)<br />
3.2.1. Was ist Praxis?<br />
Praxis meint nicht eine einzelne Handlung, sondern eine zusammenhängende und komplexe Tätigkeit; Praxis bezieht<br />
sich nicht nur auf die Tätigkeit von Einzelnen, sondern auf einen sozialen und kooperativen Zusammenhang.<br />
Deswegen ist Mauem noch keine Praxis, "wohl aber die Architektur. Rüben-Setzen ist keine Praxis, wohl aber die<br />
Landwirtschaft." (63) Ein weiterer, wichtiger Gesichtspunkt kommt noch hinzu. A. MacIntyre erläutert ihn am<br />
Beispiel eines Kindes, dem er - obwohl es wenig Begeisterung zeigt - Schachspielen beibringen möchte. Um das<br />
Kind zu motivieren, verspricht er ihm als Belohnung für jedes Schachspiel eine Süßigkeit, im Fall daß es gewinnt,<br />
noch eine Zugabe. In Erwartung der Belohnung wird das Kind spielen, und - wenn möglich - auch einmal betrügen,<br />
wenn dies den erwünschten Sieg und damit die zusätzliche Vergütung einbringt. Dies ändert sich in dem Augenblick,<br />
wo das Kind Freude am Schachspielen selbst gewinnt. Dann steht nicht mehr der Sieg im Vordergrund,<br />
sondern das Spielen und die Verbesserung der eigenen Fähigkeit, Schach zu spielen, - der Betrug scheidet von nun<br />
an als Möglichkeit aus. In der ersten Phase ist die Aufmerksamkeit des Kindes auf etwas gerichtet, das außerhalb<br />
des Schachspieles liegt, auf äußere Güter. Danach geht es um das Schachspielen selbst und die Vervollkommnung<br />
dabei, um die Förderung der "Vortrefflichkeit" beim Schachspielen, also um der Tätigkeit "inhärente" Werte.<br />
Praxis als kohärente, komplexe, soziale und kooperative menschliche Tätigkeit ist auf solche inhärenten Werte angewiesen,<br />
wie sie im Beispiel erläutert wurden. Bei Aristoteles heißen sie Tugenden. Äußere Güter werden hergestellt<br />
und erworben; Über ihren Besitz kann es Streit geben. Inhärente Güter dagegen ermöglichen kooperative<br />
und kommunikative Praxis; es sind dies: Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Tapferkeit (als Einsatz- oder<br />
Widerstands-bereitschaft). So läßt sich etwa am Beispiel des Lehrer-Schüler-Verhältnisses in einer Klasse leicht<br />
nachvollziehen, wie die kooperative Tätigkeit des Lehrens und Lernens darunter leidet, wenn die Gerechtigkeit,<br />
die Gleichbehandlung fordert, von Seiten des Lehrers verletzt wird. (64)<br />
3.2.2. Was ist die narrative Ordnung eines einzelnen menschlichen Lebens?<br />
Bekanntlich war Aristoteles der Meinung, daß ein Mensch dann gut ist, wenn er "ein volles Leben hindurch" wahrhaftig,<br />
gerecht und tapfer ist; "denn wie eine Schwalbe und ein Tag noch keinen Sommer macht, so macht auch ein<br />
Tag oder eine kurze Zeit noch niemanden glücklich und selig." (65) Das Leben eines Menschen besteht aus einer<br />
Abfolge von Tätigkeiten. Jede einzelne Tätigkeit hat einen oder auch mehrere "Rahmen". Der Bauer z.B., der<br />
einen sehr alten Bergbofbewirtschaftet, handelt im Rahmen einer Geschichte, die seine Familie übergreift, und<br />
gleichzeitig im Rahmen seiner Familie, für die er sorgt. Zwei und mehr Geschichten laufen in seinem Handeln zusammen,<br />
er verbindet sie zu seiner Vorstellung von einem guten menschlichen Leben. So stellt sich die Einheit des<br />
menschlichen Lebens als narrative Geschichte dar, die sowohl die Geschichte des Handelnden als auch die Geschichte<br />
des Rahmens, in dem der Handelnde eine Rolle spielt, ist. In dieser Geschichte wird ein narrativer Begriff<br />
des Selbst entfaltet, der zwei Dimensionen umfaßt: Das Selbst ist das Subjekt einer Erzählung, die von der<br />
Geburt bis zum Tod reicht, das verantwortlich ist für die Handlungen und Erfahrungen, aus denen erzählbares
15<br />
weis auf die lebendigen Traditionen des Gemeinsinns in sozialen Bewegungen und Gemeinschaften - diese Lücke<br />
zu schließen. Mindestens zwei wichtige Fragen allerdings bleiben offen, jedenfalls bei MacIntyre. Die eine Frage<br />
lautet: Um welche Gemeinschaften handelt es sich denn? Welche Geschichten sind von ihnen zu erzählen? Wie<br />
läßt sich das "richtige" Erzählen vom falschen, die "wahre" Gerechtigkeit von der deformierten unterscheiden? Es<br />
gibt ja die beschönigenden und verherrlichenden Erzählungen auf der einen Seite, die "praktisch-befreienden", sogar<br />
"gefährlich-befreienden" Erzählungen auf der anderen Seite. (71) Das zweite Problem: Es wird bei weitem<br />
nicht deutlich genug, daß die Gemeinschaften keinesfalls nur die eigenen Gesellschaften zu "wohlgeordneten", also<br />
gerechten Gesellschaften prägen, sondern diese Gesellschaften auch über sich hinaus öffnen müßten, damit<br />
Gerechtigkeit und Partnerschaft nicht nur als innerstaatliche, sondern als intemationale Gestaltungsprinzipien<br />
verwirklicht werden können.<br />
Für die Dimension der Gerechtigkeit ist die Befreiungsethik besonders sensibel. Deshalb ist es an dieser Stelle<br />
sinnvoll, sich mit ihren Herausforderungen auseinanderzusetzen.<br />
4. Ungerechtigkeit und Befreiung (Enrique Dussel)<br />
4.1. Der historische Kontext<br />
Die Befreiungsethik - wie auch die Befreiungstheologie - entstand in Lateinamerika in der zweiten Hälfte der sechziger<br />
Jahre. (72) Die in der Entwicklungsarbeit Engagierten mußten sich mit der Erfahrung auseinandersetzen,<br />
daß die Maßnahmen der ersten Entwicklungsdekade keine Bessemng in der Situation der Armen gebracht hatten;<br />
im Gegenteil: die Lage wurde immer bedrückender. Damit standen sie vor der Frage, ob die beiden Strategien des<br />
Assistentialismus (Brot für die Hungernden, Medikamente für die Kranken ...) und des Reformismus<br />
(Verbesserung der Infrastruktur z.B. durch Straßenbau, Industrialisierung, Modernisierung der Landwirtschaft)<br />
zur Lösung der Probleme der Armen geeignet waren.<br />
Wamm also sind die Armen arm? Drei Antworten wurden diskutiert. (73) Die erste, empiristische Erklärung<br />
führt die Armut auf menschliche Unzulänglichkeiten zurück, auf Trägheit zum Beispiel, Unwissenheit und Ungenauigkeit;<br />
kurz: Armut ist eine Folge des (individuellen) Lasters. Wie falsch diese Antwort ist, erfuhren diejenigen,<br />
die mit den Armen lebten und arbeiteten. So konnte das Massenphänomen, das ständig noch zunahm, nicht gedeutet<br />
werden. Politische und gesellschaftliche Faktoren mußten eine Rolle spielen. Dies beachtete die zweite,<br />
funktionalistische Antwort. Sie interpretierte Armut als Rückständigkeit und empfahl mehr "Fortschritt": mehr<br />
Schulen, mehr Technologie, mehr Produktion, mehr Konsum. Diese Erklärung und diese Strategie förderten zwar<br />
die wirtschaftliche Macht von Ländern in der Dritten Welt; die sozialen Verhältnisse innerhalb dieser Länder aber<br />
wurden immer katastrophaler.<br />
Als am ehesten zutreffend wurde schließlich die dritte, strukturelle Erklärung akzeptiert: Armut ist die Folge von<br />
jahrhundertewährender und in der Gegenwart fortbestehender Stmkturen der politischen, ökonomischen und<br />
kulturellen Abhängigkeit der kolonisierten Länder von den Kolonialmächten, der Länder der Dritten Welt von<br />
den Industrienationen, der Peripherie vom Zentrum. Dabei bilden die Länder des Zentrums in denen der Peripherie<br />
ihre Agenturen, die Subzentren, aus, sodaß sich das Abhängigkeitsverhältnis Zentrum - Peripherie in den
17<br />
das Mädchen des anrüchigen Viertels dem armen Arbeiter der Peripherie der Großstädte ... und fordert von seiner<br />
aristokratischen Frau 'Unberührtheit' und Keuschheit". Auf diese Weise entschlüsselt sich die modeme Rationalität<br />
als männliche Rationalität: "Das praktische 'Ich erobere' und das ontologische (das Sein als das System<br />
denkende, W.B.) 'Ich denke' ist das Wort des männlichen Unterdrückers, der - wie das bei Descartes<br />
psychoanalytisch zu sehen ist - seine Mutter, seine Geliebte und seine Tochter verleugnet." (79) Das Extrem der<br />
Unmoralität ist der Mädchen- und der Frauenmord.<br />
Zu der politischen und der erotischen, meist sexuellen Zwangsherrschaft kommt auf der dritten Ebene die pädagogische<br />
Herrschaft. Seit Aristoteles (80) sehen die Eltern die Kinder als Teil ihrer selbst an und wollen sie zu<br />
demselben machen, was sie sind. In einer patriarchalen Ordnung heißt dies: Der Vater weitet sein Ich aus. In der<br />
kolonisatorischen Ordnung bedeutet dies, dem Anderen, - dem Afrikaner, dem Asiaten, dem Volk, dem Arbeiter<br />
, die eigene Kultur, die eigene Religion, die eigene Moral aufzuzwingen. Das modeme pädagogische System ist<br />
durch die Kommunikations- und Massenmedien auf raffinierte Weise verfeinert und effizient. Es formt den Alltagsmenschen.<br />
"Der ideologisch-kulturelle Imperialismus übersteigt heute alle anderen Arten früheren Kultureinflusses<br />
und genießt die Unterstützung der Wissenschaften und derer, die Chomsky 'intellektuelle Soldaten' nennt,<br />
die in Harvard, Yale und anderswo geformte Elite." (81)<br />
Dieses System dreifacher Ungerechtigkeit hat Fetisch-Charakter angenommen. Die heilige Doktrin der "nationalen<br />
Sicherheit" schützt das politisch-ökonomische System. Gott kann nur ein Mann sein, nur Männer können seine<br />
Stelle vertreten; das sichert diesen die Herrschaft. Nur die aufgeklärte Kultur - mit ihrer Dominanz der logischen<br />
und ökonomischen Rationalität - ist die wahre Kultur. Multikulturalität ist als Folklore interessant, Aufklärung<br />
aber das universale pädagogische Angebot. (82)<br />
Mit dieser Analyse der Wirklichkeit sind bereits die Dimensionen benannt, in denen die Praxis der Befreiung sich<br />
bewähren muß. Zuvor aber ist auf die Deutungskategorien der Philosophie der Befreiung einzugehen.<br />
4.3. Die Deutungskategorien<br />
Mit ihnen erarbeitet sich E. Dussel die Möglichkeit der reflexiven Durchdringung derwahrgenommenen Wirklichkeit,<br />
grenzt sich gleichzeitig von der abendländischen und modemen europäischen Philosophie ab und<br />
entfal~et so die eigene Philosophie mit ihren Perspektiven befreiender Praxis. Es handelt sich vor allem um die<br />
Kategorien von Proxemie und Proximität, von Totalität und Exteriorität und schließlich um die ganz zentrale<br />
Kategorie des Anderen. (83) Dazu gebe ich einige kurze Erläuterungen.<br />
Die europäischen Kulturen thematisieren Philosophie unter dem Gesichtspunkt der "Proxemie", was bei E. Dussel<br />
soviel wie "natürliche Nähe" bedeutet. Damit ist gemeint, daß sie sich auf das Verhältnis von Mensch und Natur,<br />
Person und Seiendes, Erkenntnis und Sein konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen Subjekt-Objekt-Verhältnisse und<br />
damit Herrschafts- und Kontrollbeziehungen. Die Philosophie der Befreiung dagegen wendet sich dem Verhältnis<br />
von Mensch zu Mensch, der "Proximität" zu. Diese ist ursprüngliche, allem anderen vorausliegende Proximität,<br />
weil jeder Mensch von einem anderen Menschen geboren wird und von ihm Geborgenheit vrfährt. "Wenn wir<br />
nicht Lebendgebärende ... im Gegensatz zu Fischen wären, könnte man sagen, daß die Erf~g der Proxemie,
19<br />
diese Epiphanie ist eine realer, bestürzender Vorgang. Er kann sich noch in der äußersten Entfremdung des<br />
Gefängnisses und der Folter ereignen, wenn der vom System total Entwürdigte schreit: "Ich bin ein Anderer; ich<br />
bin ein Mensch; ich habe Rechte." (90) Er ereignet sich in der alltäglichen Wirklichkeit, wenn einer sagt: "Ieh bin<br />
hungrig." Es ist die Existenzbeschreibung dessen, der vom System negiert ist. Das Sytem drängt die Hungrigen an<br />
den Rand, ins Abseits - vor den Regierenden, die sich zum Beispiel in Rio de Janeiro versammelten, werden sie<br />
regelrecht zu einem Nichts gemacht, selbst vor dem Papst, wenn er die Dritte Welt bereist -, weil sie zwar als Andere<br />
die Hölle ffir das ungerechte System sind, gleichzeitig ffir die Gerechten der Anfang der Zukunft einer neuen<br />
Welt. "Der Hunger an sich ist die praktische Exteriorität oder die am meisten subversive innere Transzendentalität<br />
gegen das System; das totale und unüberbietbare "Außerhalb"." (91) Das Antlitz der Armen, "ihre Person ist durch<br />
ihre reine Selbstoffenbarung die Provokation und das Urteil ... über das System" (92). Dieses Antlitz ist gleichzeitig<br />
Ausdruck der Geschichte eines Volkes: der lateinamerikanischen Mestizen, der chinesischen Kulis, der afrikanischen<br />
Sklaven.<br />
Allerdings gilt es auch zu beachten: Was sich im Hungernden am offenbarsten zeigt, kennzeichnet als Möglichkeit<br />
jede freie Person: Ihr kommt die innere Transzendentalität gegenüber dem System zu. Das "Außerhalb" gegenüber<br />
dem System wird von E. Dussel also nicht absolut verstanden. Keine Person ist nur Teil des Systems. Selbst<br />
die Person des Unterdrückers kann ein Anderer werden. Damit verbinden sich Hoffnungen - und Konsequenzen<br />
für den Umgang mit den Unterdrückern nach dem Sturz des Systems.<br />
4.4. Die befreiende Praxis<br />
Die Befreiungsethik ist als die begleitende Reflexion einer Praxis von Basisgemeinschaften entstanden, die sich<br />
dem herrschenden System widersetzte. Sie kann deshalb ihren Ansatzpunkt nicht innerhalb des Systems finden,<br />
sondern in dem "Außerhalb". In der Sprache der theologischen Tradition macht es E. Dussel ganz deutlich: "Die<br />
reformistischen Moralsysteme fragen sich: Wie kann man gut sein in Ägypten? (und sie legen Normen, Tugenden<br />
usw. als Antwort vor, akzeptieren jedoch Ägypten als das geltende System). Mose hingegen fragt sich: Wie kann<br />
man aus Ägypten ausziehen? Doch um "auszuziehen", muß man sich beWUßt sein, daß es eine Totalität gibt, in der<br />
ich drin bin, und ein Draußen, in das ich ausziehen kann." (93) Das Wort Moral bleibt demnach den Normensystemen<br />
vorbehalten, die innerhalb des herrschenden sozio-ökonomischen Systems denken. Die Ethik der Befreiung<br />
dagegen wird herausgefordert vom "Anderen", der "jenseits" des Horizonts des Systems erscheint, und der Gerechtigkeit<br />
verlangt. In der lateinamerikanischen Wirklichkeit ist es der Mensch in der Randsituation, der<br />
Campesino, die Frau des Minenarbeiters, der Indio ... Diese Provokation führt unmittelbar zu dem absoluten und<br />
zugleich konkreten Imperativ, der für jede menschliche Situation und gegenüber jedem System gilt: "Befreie den<br />
Armen und Unterdrückten!" (94). Die Befreiungsethik kommt von der Bejahung des konkreten Anderen als'des<br />
Armen zur Negation der Negation, zur Negation der Totalität oder des Systems. (95)<br />
Ethisch betrachtet beinhaltet der Begriff des Armen und Unterdrückten dreierlei. Es besteht eine Totalität in Gestalt<br />
des herrschenden Moralsystems innerhalb des Gesellschaftssystems. Es gibt einen Unterdrücker, von dem die<br />
Repression, das Böse, ausgeht. Und es gibt einen gerechten Menschen - mindestens in der Beziehung, daß er andere<br />
nicht unterdrückt, sondern selbst ungerecht behandelt wird. Davon ausgehend, läßt sich etwas genauer sagen,<br />
was "befreien" heißt: "die Mechanismen der etablierten moralischen Totalität beachten, ... die ethische Pflicht,<br />
diese Mechanismen außer Kraft zu setzen, ... die Notwendigkeit, den Ausweg aus dem System zu finden, und die
21<br />
5. Perspektiven der Gerechtigkeit<br />
5.1. Die Provokation der Befreiungsethik<br />
Der europäische Kritiker der Befreiungsethik befmdet sich in einer mißlichen Situation: Er entbehrt die Erfahrung<br />
dessen, der in den Ländern der Dritten Welt mit den Armen lebt und arbeitet - bis hin zu der erlittenen Bedrohung<br />
des eigenen Lebens und dem miterlittenen Brudermord. (103) Einige Besuche reichen nicht aus, um aus<br />
der Perspektive einer ganz anderen Erfahrung reflektieren zu können. Dennoch können einige Fragen gestellt<br />
werden, die die theoretischen Instrumente der Interpretation der Erfahrung betreffen.<br />
Die Befreiungsethik geht bei ihrer sozialpolitischen Analyse von der Dependenztheorie als wichtigstem Erklärungsmodell<br />
aus. Es handelt sich um ein bipolares Deutungsmuster, das Beherrschen und Ausbeuten dem Zentrum,<br />
Unterdrückt- und Ausgebeutetwerden der Peripherie zuordnet. Die Theorie wird zunächst dadurch differenziert,<br />
daß diese Bipolarität nicht nur zwischen den Ländern des Zentrums und denen der Peripherie herrscht,<br />
sondern sich sowohl in den Ländern der Peripherie, in denen es städtische Subzentren gibt, die ihre Provinzen<br />
ausbeuten, als auch in den Ländern des Zentrums, in denen es immer größer und ärmer werdende marginale<br />
Schichten gibt, vorfindet. Diese Differenzierung ist für den "Zentristen" und "Eurozentristen" hilfreich, weil sie ihm<br />
Vergleichsmöglichkeiten zwischen seiner gesellschaftlichen Lage und derjenigen in Ländern der Dritten Welt eröffnet.<br />
Sie verhindert auch ein moralisierendes Mißverständnis der Abhängigkeitstheorie: ''Wir in der Dritten Welt<br />
sind die Ausgebeuteten und Unterdrückten. Ihr seid die Ausbeuter und Unterdrücker." Dies führt im übrigen zur<br />
Abwehr - so bei Kardinal J. Höffner: "Unser Volk lebt nicht von der Ausbeutung anderer Länder, sondern von der<br />
Arbeit" - und/oder zum Mitleid, zum Assistentialismus - derselbe Kardinal in derselben Rede: "Ankämpfen gegen<br />
Armut, Hunger, Elend, Krankheit und Ausbeutung ist christliche Pflicht", im Sinn eines wirksamen christlichen<br />
Zeugnisses "am Armen und Unterdrückten". (104) Es gibt Formulierungen in der Befreiungsethik. selbst, die ein<br />
solch assistentialistisches Verständnis hervorrufen können. Dies gilt sogar für ihr oberstes Prinzip: "Befreie den<br />
Armen und Unterdrückten." Das klingt so, als ob die Armen und Unterdrückten die Objekte des Befreiungsprozesses<br />
wären. Sie sind aber die Subjekte. Die "Option der Armen" ist die primäre und lautet: ''Wir wollen uns aus<br />
Armut und Unterdrückung befreien!" Die "Option für die Armen" - die Option derer, die in der Position der Reichen<br />
sind, aber den Armen als den ganz Anderen und zwar den Gerechten wahrnehmen und sich kraft ihrer<br />
"inneren Transzendentalität" auf den Weg der Gerechtigkeit machen wollen -lautet: ''Wir wollen mit den Armen<br />
solidarisch sein und zusammen mit ihnen kämpfen!"<br />
Noch eine Bemerkung zur Dependenztheorie. Sie ist in ihrem Erklärungswert für den Entwicklungsprozeß umstritten,<br />
seit die erdölfördernden Länder und die ostasiatischen Schwellenstaaten aus der Reihe der Dritte-Welt<br />
Länder ausscheren konnten und andererseits der Differenzierungsprozeß in die extremste Not der "Vierten Welt"<br />
fortgeschritten ist. Deshalb werden ergänzende Theorien, die zum Beispiel die internen Faktoren von Unterentwicklung<br />
oder Entwicklung stärker berücksichtigen, notwendig sein. (105) Bei E. Dussel wird eine Erweiterung<br />
der dependenztheoretischen Sicht insofern vorgenommen, als er Abhängigkeit und Unterdrückung nicht nur auf<br />
der ökonomisch-politischen Ebene, sondern auch auf der erotischen und pädagogischen Ebene analysiert.<br />
Die entscheidende Provokation der Befreiungsethik ergibt sich allerdings von ihren zentralen philosophischen
GesellschaftenIl gelöst werden können. Die IIvollkommenen GesellschaftenIl, die alle Mittel selbst besitzen, um die<br />
Lebensbedürfnisse ihrer Mitglieder zu befriedigen, gibt es nicht mehr. Die staatlich organisierten Gesellschaften<br />
sind durch vielfache Abhängigkeiten - von den wirtschaftlichen bis zu den ökologischen - miteinander verflochten.<br />
Weder das Problem der nicht realisierten Gerechtigkeit der Distribution noch das der nicht überall und ausreichend<br />
verwirklichten Gerechtigkeit der Partizipation können im jeweils staatlichen Rahmen allein, sondern nur<br />
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der internationalen Beziehungen gelöst werden. Insofern ist der Blickwinkel<br />
der meisten llliberal-reformistischen ll Gerechtigkeitstheorien sehr eingeschränkt, wenn sie nur die innergesellschaftliche<br />
und nicht die zwischenstaatliche Dimension beachten.<br />
23<br />
Allerdings ergibt sich aus dem theoretischen Ansatz von J. Rawls kein Grund dagegen, diese Erweiterung ausdrücklich<br />
vorzunehmen. Wir können den Urzustand so konstruieren, daß die Menschen in ihm nicht nur aus den<br />
verschiedensten Schi~ten, Klassen und Generationen, sondern auch aus den verschiedensten Regionen der Erde<br />
kommen. Sie würden sowohl das Prinzip gleicher Freiheiten wie auch das Unterschiedsprinzip beschließen. Letzteres<br />
gewinnt dann - gewissermaßen bei Tage besehen, nachdem der Schleier des Nicht-wissens hinweggenommen<br />
ist - angesichts des Nord-Süd-Gefälles eine revolutionäre Bedeutung: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten<br />
darf es nur unter der Bedingung geben, daß sie den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen,<br />
und: Ämter und Positionen müssen allen in fairer Chancengleichheit offenstehen. Die Argumentationsstrategie<br />
der Mitglieder des Nordens würde nun darauf abstellen zu zeigen, daß die Aufrechterhaltung der fmanziellen<br />
und sonstigen Potenz der Industrieländer gerade die Bedingung für eine Besserstellung der Entwicklungsländer<br />
ist. Ganz einfach dürfte dieser Nachweis nicht sein.<br />
Dennoch ist dem Rawls'schen Konzept das der Diskursethik vorzuziehen. Sie sieht folgende Diskursregeln vor:<br />
"1. Jedes sprach- und handlungsfähige Subjekt darf an Diskursen teilnehmen. 2.a) Jeder darfjede Behauptung<br />
I<br />
problematisieren. b) Jeder darfjede Behauptung in den Diskurs einführen. c) Jeder darf seine Einstellungen,<br />
Wünsche und Bedürfnisse äußern. 3. Kein Sprecher darf durch innerhalb oder außerhalb des Diskurses<br />
herrschenden Zwang daran gehindert werden, seine in 1. und 2. festgelegten Rechte wahrzunehmen." (112) Die<br />
Überprüfung der vorgetragenen Gesichtspunkte und Argumente erfolgt anband des Universalisierungsgrundsatzes:<br />
Jeder muß bei der Verständigung über eine Norm die Perspektivealler Betroffenen einnehmen.<br />
(1<strong>13</strong>) Dies impliziert, daß der Diskurs herrschaftsfrei geführt wird. Ein solcher Diskurs unterscheidet sich<br />
erheblich von der Beratungssituation im Urzustand. Der Diskurs legt die Interessen und die Betroffenheiten offen.<br />
Er berücksichtigt die Unterschiede in den Ausgangslagen der Diskursteilnehmer. Die Idee des Diskurses über<br />
weltweite Gerechtigkeit fordert, daß neben den Interessen der zwanzig Prozent Reichen die Forderungen der<br />
achtzig Prozent Armen angemessen zur Sprache kommen. Probeweise stelle man sich vor, das Gremium der für<br />
diesen Diskurs ausgewählten Repräsentanten werde diesem Verhältnis entsprechend zusammengesetzt. Dasselbe<br />
gelte für die diesem entscheidenden Gremium zuarbeitenden Expertenkommissionen für Finanzen, Wirtschaft,<br />
Technologie, Kultur etc. (114) Ein atemberaubender Prozeß des Umdenkens und reformerischen oder<br />
revolutionären Umgestaltens käme in.Gang.<br />
E. Dussel macht in diesem Zusammenhang allerdings auf ein gravierendes Problem aufmerksam. Die historischreale<br />
Kommunikationsgemeinschaft, in der Gedanke und Praxis des Diskurses entstanden, ist eingebettet in und<br />
abhängig von der jenigen historisch-realen Lebensgemeinschaft, die die Ausgebeuteten seit fünfhundert Jahren
werden solche Normen nur, wenn entsprechende gesellschaftliche Strukturen und Institutionen geschaffen<br />
werden. Dies gilt jedenfalls für den Mittelbereich (z.B. Produktion, Verteilung, Konsum; Arbeit und Freizeit; Erziehung,<br />
Bildung, Information) und den Fernbereich (internationale Beziehungen; globale Sicherung der Lebensbedingungen)<br />
verantwortlichen menschlichen Handelns. Von diesen Strukturen der Gerechtigkeit soll nun noch<br />
die Rede sein.<br />
25<br />
Von U. Beck stammt die kritische Diagnose der halbierten Demokratie. Er meint damit die Tatsache, daß demokratische<br />
Rechte im politischen Bereich zugesichert, im wirtschaftlichen und unternehmerischen Bereich dagegen<br />
nicht vorhanden bzw. höchst unterentwickelt sind, obgleich dort inzwischen Entscheidungen von höchster Relevanz<br />
für die Gestaltung gegenwärtiger und künftiger Lebensverhältnisse fallen. (119) Dieser Zustand ist ungerecht,<br />
weil er die Möglichkeiten der EinOupnahme aller Betroffenen aufdie gemeinsamen Lebensbedingungen ungerecht<br />
verteilt. Vor allem Bürgerinitiativen haben darauf sensibel reagiert und Partizipationsrechte eingeklagt und<br />
zum Teil durchgesetzt. In den Parlamenten wächst das Bewußtsein für die Notwendigkeit einer gesellschaftlich<br />
verantwortbaren Wissenschafts- und Technologiepolitik. Dabei geht es einerseits um Grenzziehungenmit dem<br />
Ziel, potentielle Gefahren von den Bürgern abzuwenden - ein Beispiel ist das Gentechnikgesetz -, andererseits um<br />
Anreize für Entwicklungen von menschen- und gemeinwohlgerechter Technik - ein Beispiel hierfür könnte die<br />
Solartechnik werden.<br />
Wenn das Parlament als Repräsentant aller Betroffenen diese Aufgabe kompetent wahrnehmen will, benötigt es<br />
die wissenschaftliche und technische Expertise nicht nur über "Chancen und Risiken" einer bestimmten, schon<br />
etablierten Technik, sondern auch über die Möglichkeiten alternativer Entwicklungspfade. Neben und in den Institutionen<br />
der Innovationsforschung muß die Alternativen-Erforschung, selbstverständlich auch die Risiko-Erforschung<br />
institutionalisiert werden. Dies ist noch kaum erfolgt. Als ein Beispiel dafür kann das Öko-Institut in<br />
Freiburg und Dannstadt gelten. Die Einrichtung eines Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag<br />
(TAB) ist ein weiterer Schritt in die gleiche Richtung. (120)<br />
Übrigens wird das Parlament diese Aufgabe als Repräsentant aller Betroffenen nur dann wahrnehmen können,<br />
wenn die Bürger sich selbst besser über ihre Bedürfnisse - über das, was für jeden das Seine ist - aufklären wollen<br />
und ihnen dazu auch die Möglichkeiten gegeben werden. Bedürfnisklärung statt Bedarfsweckung wäre hierfür das<br />
Stichwort.<br />
Eine Stärkung der Partizipationsrechte in anderen Bereichen ist dringend erforderlich. Dies gilt zum Beispiel für<br />
Betriebe und Unternehmen. Es reicht nicht aus, daß die Vertreter der Sozialpartner, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände,<br />
Rahmenbedingungen und Tarife für Arbeit und Lohn aushandeln. Das Problem des<br />
angemessenen Lohns ist sicher eine wichtige Frage der Tausch- und Verteilungsgerechtigkeit. Damit sind aber die<br />
Fragen der partizipativen Gerechtigkeit noch nicht berührt. Arbeitenden als autonomen Personen wird erst dann<br />
ihr volles Recht zuteil, wenn sie die unternehmerischen Entscheidungen mitgestalten und die<br />
Unternehmensleitung mitlegitimieren können. Diese Forderung einer qualifizierten Mitbest~ung im<br />
Unternehmen, einer arbeitsorientierten Unternehmensverfassung oder der Wirtschaftsdemokratie gründet in der<br />
Einsicht, "daß die Unterwerfung unter fremde Leitungs- und Organisationsgewalt mit der Würde des Menschen<br />
nur dann vereinbar ist, wenn dem Betroffenen die Möglichkeit der Einwirkung.auf die Gestaltung der Leitungs-
27<br />
Anmerkungen<br />
1 Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Übersetzt von Hermann Vetter. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979<br />
(Originalausgabe: A Theory ofJustice, 1971), S.12<br />
2 A.a.O., S. 39.<br />
3 A.a.O., S. 166.<br />
4 A.a.O., S. 31.<br />
5 Vgl. a.a.O., S.168.<br />
6 Vgl. a.a.O., S. 168f.<br />
7 A.a.O., S. 159.<br />
8 Vgl. a.a.O., S. 161.<br />
9 Im übrigen ist Rawls überzeugt, daß auch Kants Moralphilosophie implizit einen Schleier des Nichtwissens<br />
voraussetzt. Autonom handelt der, der dem allgemeinen praktischen Gesetz seiner Vernunft folgt; heteronom<br />
verhielte sich derjenige, der seine Entscheidungen von seinen Wünschen, von den Besonderheiten seiner gesellschaftlichen<br />
oder wirtschaftlichen Lage u.ä. abhängig machen würde. A.a.O., S. 284.<br />
10 A.a.O., S. 36. (Hervorhebung von mir.)<br />
11 Vgl. die Liste der Bestimmungen des Urzustandes, a.a.O., S. 170f.<br />
U Vgl. a.a.O., S. 28f.<br />
<strong>13</strong> Vgl. a.a.O., S. 37.<br />
14 Ders.: Der Vorrang der Grundfreiheiten, in: ders.: Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989.<br />
Frankfurt a.M.: Suhrkamp <strong>1992</strong>. S. 160. Vgl. ders.: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Fi'ankfurta.M.: Suhrkamp<br />
1979. S. 336.<br />
15 A.a.O., S. 82.<br />
16 Vgl. a.a.O., S. 238-240.<br />
17 A.a.O., S. 283; vgl. S. 336f. - Aus dem Zusammenhang ist deutlich, daß der Satz vom Vorrang der Freiheit sich<br />
nicht auf die Freiheit als solche, sondern auf die Liste der Grundfreiheiten bezieht. Vgl. Rawls, John: Der<br />
Vorrang der Grundfreiheiten, in: ders.: Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt<br />
a.M.: Suhrkamp <strong>1992</strong>. S. 159-254, hier S. 161.<br />
18 A.a.O., S. 336. - Vgl. S. 81 (erste Formulierung), 104 (zweite Formulierung).<br />
19 A.a.O., S. 127.<br />
20 A.a.O., S. 322.<br />
21 A.a.O., S.108. - Rawls unterscheidet vollkommene, unvollkommene und reine Verfahrensgerechtigkeit. Bei<br />
der vollkommenen Verfahrensgerechtigkeit gibt es einen unabhängigen Maßstab für gerechte Verteilung und<br />
ein sicheres Verfahren, um das. gerechte Ergebnis zu erreichen; bei der unvollkommenen Verfahrensgerechtigkeit<br />
gibt es zwar einen gerechten Maßstab, aber kein absolut sicheres Verfahren. Reine Verfahrensgerechtigkeit<br />
liegt vor, wenn es keinen unabhängigen Maßstab, wohl aber ein Verfahren gibt, das - korrekt<br />
angewandt - in jedem Fall zu einem fairen Ergebnis führt.<br />
22 Vgl. a.a.O., S. 126f.<br />
23 Vgl. a.a.O., S. 223-229.<br />
24 A.a.O., S. 223.<br />
25 Vgl. Spaemann, Robert: Die zwei Grundbegriffe der Moral, in: ders.: Zur Kritikder politischen Utopie. Zehn
29<br />
MUS und Gemeinsinn in der amerikanischen Gesellschaft. Köln: Bund 1987 (Originalausgabe: Habits of the<br />
Heart. Individualism and Commitment in american Life, 1985). - Dies.: The Good Society. New York: Knopf<br />
1991. - MacIntyre, Alasdair: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt a.M.:<br />
Campus 1987 (Originalausgabe: After Virtue. A Study in Moral Theory, 1981). - Walzer, Michael: Sphären<br />
der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit. Frankfurt a.M.: Campus <strong>1992</strong> (Originalausgabe:<br />
Spheres ofJustice. A Defense of Pluralism and Equality, 1983).<br />
50 Vgl. Bellah, Robert N. u.a.: The Good Society. New York: Knopf 1991. S. 9. - Dies.: Gewohnheiten des Herzens.<br />
Köln: Bund 1987. S. 47.<br />
51 Vgl. dies.: Gewohnheiten des Herzens. Köln: Bund 1987. S. 49.<br />
52 Dies.: The Good Society. New York: Knopf 1991. S. 6.<br />
53 Sie beziehen sich dabei auf die Analyse der Beziehung zwischen Charakter und Gesellschaft in Amerika, die<br />
der französische Sozialphilosoph Alexis de Tocqueville verfaßt hat. In seinem Buch "Democracy in America"<br />
nannte er die Sitten und Bräuche des amerikanischen Volkes gelegentlich "Gewohnheiten des Herzens". Vgl.<br />
dies.: Gewohnheiten des Herzens. Köln: Bund 1987. S. 16.<br />
54 A.a.O., S.185-188. 319-321.<br />
55 A.a.O., S.322.<br />
56 Vgl. a.a.O., S. 323.<br />
57 Vgl. a.a.O., S. 334.<br />
58 Siehe Anm. 49.<br />
59 Nozick, Robert: Anarchie - Staat - Utopia. München 1976. (Originalausgabe: Anarchy, State and Utopia,<br />
1974).<br />
60 Robert Nozick zit. nach Maclntyre, Alasdair: Der Verlust der Tugend. Frankfurt a.M.: Campus 1987. S. 330.<br />
61 Vgl. a.a.O., S. 325-339.<br />
62 Vgl. a.a.O., S. 250f.<br />
63 A.a.O., S. 252.<br />
64 A.a.O., S. 251-263.<br />
65 Aristoteles: Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes, herausgegeben von<br />
Günther Bien. Hamburg: Meiner 1972. S. 12.<br />
66 Vgl. MacIntyre, Alasdair: Der Verlust der Tugend. Frankfurt a.M.: Campus 1987. S. 273-293. - Zur narrativen<br />
Ethik vgl. Bender, Wolfgang: Ethische Urteilsbildung. Stuttgart: Kohlhammer 1988. S.160-162.<br />
67 MacIntyre, Alasdair, a.a.O., S. 292f.<br />
68 A.a.O., S. 295 (Hervorhebungen von mir).<br />
69 A.a.O., S. 294.<br />
70 A.a.O., S. 350.<br />
71 Vgl. Bender, Wolfgang: Ethische Urteilsbildung. Stuttgart: Kohlhammer 1988. S.162.<br />
72 Vgl. die Darstellung von Gutierrez, Gustavo: Theologie von der Rückseite der Geschichte her, in: ders.: Die<br />
historische Macht der Armen. München-Mainz: Kaiser-Grünewald 1984 (Originalausgabe: La fuerza hist6rica<br />
de los pobres, 1984). S.125-189, besonders S.167-170. - Vgl. auch das erste umfassende Buch von Gutierrez,<br />
Gustavo: Theologie der Befreiung. Mainz: Grünewald, 2. Aufl.1976 (Originalausgabe: "Theologia de la<br />
Liberaci6n", 1972). - Siehe ferner die Einleitung von RaUl Fornet-Betancourt in: Dussel, Enrique: Philosophie<br />
der Befreiung. Hamburg: Argument 1989 (Originalausgabe: Filosofia de la Liberaci6n, 1977). S. 5-10.
31<br />
87 A.a.O., S. 808.<br />
88 Adomo, Theodor W.: Gesammelte Schriften. Bd.4 (Minima Moralia). Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980. S. 55.<br />
89 Dussel, Enrique: Philosophie der Befreiung. Hamburg: Argument 1989. S. 64.<br />
90 A.a.O., S. 56.<br />
91 A.a.O., S. 56.<br />
92 A.a.O., S. 58.<br />
93 Ders.: Befreiungsethik. Grundlegende Hypothesen. In: Concilium, 20. Jg. (1984), S.<strong>13</strong>5. (Hervorhebungen von<br />
mir.)<br />
94 A.a.O., S. <strong>13</strong>5f. - Vgl. ders.: Läßt sich "eine" Ethik angesichts der geschichtlichen "Vielheit" der MoraIen legitimieren?<br />
In: Concilium, 17. Jg. (1981), S. 810f.<br />
95 Darin unterscheidet sich die Befreiungsethik von der kritischen Theorie Tb.W. Adornos wie H. Marcuses, VOn<br />
der Auffassung E. Blochs wie G. Lukacs über den revolutionären Prozeß. Dussel ergänzt die (negative) Dialektik<br />
durch die philosophisch Wie theologisch konzipierte "Analektik": ''Wir wollen mit Ana- (griech.) auf etwas<br />
hinweisen, das "jenseits" des ontologischen Horizonts (des Systems, ...) liegt, "jenseits" des Seins oder es<br />
transzendierend. Dieser Logos (Ana-Logos) dieser Diskurs, ~er von der ~ranszendierungdes Systems ausgeht,<br />
enthält die Originalität der hebräisch-christlichen Erfahrung. Wenn "am Anfang Gott schuf' (Gen. 1,1),<br />
dann deshaIb, weil der andere selbst dem Beginn der Welt, dem System, dem "Fleisch" zeitlich vorausgeht."<br />
(Ders.: Befreiungsethik. A.a.O., S. <strong>13</strong>8).<br />
96 Ders.: Läßt sich "eine" Ethik angesichts der geschichtlichen "Vielheit" der MoraIen legitimieren? In: Concilium,<br />
17. Jg. (1981), S. 811.<br />
97 Ders.: Ethik der Gemeinschaft. Düsseldorf: Patmos 1988. S. 83f.<br />
98 Ders.: Philosophie der Befreiung. Hamburg: Argument 1989. S. 167.<br />
99 L. und Cl. Boff berichten die Antwort einer Frau aus Pemambuco, nachdem sie als "Arme" angesprochen<br />
worden war: "Arm? Nein! Arm sind die Hunde. Wir sind mittellos, aber wir kämpfen." (Boff, Leonardo - Boff,<br />
Clodovis: Wie treibt man Theologie der Befreiung? Düsseldorf: Patmos 1986. S. 42. Vgl. Gutierrez, Gustavo:<br />
Die historische Macht der Armen. MÜDchen-Mainz: Kaiser-GrÜDewald 1984.)<br />
100 Dussel, Enrique: Philosophie der Befreiung. Hamburg: Argument 1989. S. 80.<br />
101 A.a.O., S. 82.<br />
102 Vgl. a.a.O., S. 93f.. 1QO-103.111f.<br />
103 Vgl. a.a.O., S.112.194.<br />
104 Joseph Kardinal Höffner: Soziallehre der Kirche oder Theologie der Befreiung. Eröffnungsreferat bei der<br />
Herbsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofkonferenz<br />
1984. S. 32. 8.<br />
105 Vgl. Boeckh, Andreas: Entwicklungstheorien, Weltmarkt und das Problem der Gerechtigkeit, in: Eicher, Peter<br />
- Mette, Norbert (Hrsg.): Auf der Seite der Unterdrückten? Theologie der Befreiung im Kontext Europas.<br />
Düsseldorf: Patmos 1989. S. 90-111. - Rottländer, Peter: Dependenztheorie in der Diskussion. Entwicklungstheoretische,<br />
politische und theologische Aspekte. A.a.O., S. 112-<strong>13</strong>2.<br />
106 Dussel, Enrique: Philosophie der Befreiung. Hamburg: Argument 1989. S. 28.<br />
107 Kerstiens, Ferdinand: Besuch der kleinen Leute. Partnerschaft konkret. In: Orientierung, 54. Jg. (1990). S.<br />
255-259.<br />
108 Vgl. Lutz, MatthiasiAutorenkollektiv: Arm in einer reichen Stadt - Zur Armutssituation in Frankfurt. Frank-
Ausgewählte Literatur<br />
33<br />
Armut in Deutschland - Armut im Wohlstand. Dokumentation der Fachkonferenz am IJuli <strong>1992</strong>. Herausgegeben<br />
vom Vorstand der SPD, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Ollenhauer Str.l, 5300 Bonn 1.<br />
BeUah, Robert N. - Madsen, Richard - Sullivan, William M. - Swidler, Ann • Tipton, Steven M.: The Good Society.<br />
New York: Alfred A. Knopf Inc.1991.<br />
dies.: Gewohnheiten des Herzens. Individualismus und Gemeinsinn in der amerikanischen Gesellschaft. Köln:<br />
Bund 1987 (Originalausgabe: Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life,<br />
1985).<br />
Boeckh, And.reas: Entwicldungstheorien, Weltmarkt und das Problem der Gerechtigkeit. In: Eicher, Peter - Mette,<br />
Norbert (Hrsg.): Auf der Seite der Unterdrückten? Theologie der Befreiung im Kontext Europas. Düsseldorf:<br />
Patmos 1989. S. 90-111.<br />
Dahrendorf, Ralf: Theorie und Praxis, in: Mäding, Heinrich (Hrsg.): Grenzen der Sozialwissenschaften. Konstanz:<br />
Universitätsverlag 1988. S.162-174.<br />
Dussel, Enrique: Philosophie der Befreiung. Hamburg: Argument 1989.<br />
ders.: Befreiungsethik. Grundlegende Thesen. In: Concilium. 20. Jg. (1984). S.<strong>13</strong>3-141.<br />
ders.: Ethik der Gemeinschaft. Düsseldorf: Patmos 1988.<br />
Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen<br />
Rechtsstaats. Frankfurt a.M.: Suhrkamp <strong>1992</strong>. Darin besonders: Soziologische Rechts- und philosophische<br />
Gerechtigkeitskonzepte, S. 61-108.<br />
Hengsbach, Friedhelm: Wirtschaftsethik. Autbruch-Konflikte-Perspektiven. FreiburglBr.: Herder 1991.<br />
HöfTe, Otfried: Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat. Frankfurt<br />
a.M: Suhrkamp 1987.<br />
ders.: Wirtschaftordnung und Gerechtigkeit, in: ders.: Sittlich-politische Diskurse. Frankfurt: Suhrkamp 1981. S.<br />
111-126.<br />
ders.: Die Menschenrechte als Prinzipien politischer Humanität, in: ders.: Sittlich-politische Diskurse. Frankfurt:<br />
Suhrkamp 1981. S. 98-108.<br />
Kessler, Wolfgang: Freies Geld für freie Bürger? Bedeutete der Ausstieg aus dem Zinssystem den Einstieg in die<br />
ökologische Kreislaufwirtschaft? In: Publik-Forum 21. Jg. <strong>1992</strong>, S.14-16.<br />
Leist, Anton: Intergenerationelle Gerechtigkeit. Verantwortung für zukünftige Generationen, hohes Lebensalter<br />
und Bevölkerungsexplosion, in: Bayertz, Kurt (Hrsg.): Praktische Philosophie. Reinbek: Rowohlt 1991.<br />
S.322-361.<br />
Uvinas, Emmanuel: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteritorität. Freiburg-München: Alber 1987.<br />
Lyotard, Jean-Francois: Der Widerstreit. München: Fmk 19892 (Reihe: Supplemente Bd. 6. Hrsg. Hans-Horst<br />
Henschen).<br />
Maclntyre, Alasdair: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt a.M.: Campus<br />
1987 (Originalausgabe: After Virtue. A Study in Moral Theory, 1981).<br />
Meran, Josef: Wohlstand und Gerechtigkeit, in: Bayertz, Kurt (Hrsg.): Praktische Philosophie. Reinbek: Rowohlt<br />
1991. S. 89-<strong>13</strong>4.<br />
Ockenfels, Wolfgang: Kolonialethik. Von der Kolonial- zur Entwicklungspolitik. Paderborn, München, Wien, Zürich:<br />
Schöningh <strong>1992</strong>.
35<br />
11. Wege zum dauerhaften Frieden<br />
Zusammenfassung<br />
Ausgehend von einem Verständnis von Friedensethik als Prozeß ethischer Urteilsbildung wird zunächst die Weltlage<br />
in ihren ethisch relevanten Problembereichen und Spannungsfeldern skizziert. Diese Weltlage macht die Besinnung<br />
auf elementare menschliche Lebensbedingungen notwendig, deren Mißachtung friedens- und überlebensgefährdend<br />
ist. Mit dem Abschnitt über ethische Traditionen und Positionen tritt die Untersuchung in die Auseinandersetzung<br />
mit der Lehre vom "gerechten Krieg" ein, die eine der wirkungsgeschichtlich bedeutsamsten Konzeptionen<br />
innerhalb der Friedensethik - bis hin zur Rechtfertigung des Golfkrieges - ist, und neuerdings noch in<br />
das Modell einer "gerechten Abschreckung ll hinein übertragen wurde. Als konsequente Friedensethik unter den<br />
Bedingungen einer Weltlage, für die Verfügbarkeit der nuklearen Waffen unhintergehbar ist, stellt sich die "Ethik<br />
zum nuklearen Frieden" dar, auf die mit dem Entwurf von Perspektiven eines dauerhaften Friedens, der auf den<br />
nuklearen Schild verzichten könnte, geantwortet wird.<br />
1. Friedensethik als Prozeß ethischer Urteilsbildung<br />
Spannungen bis hin zu Gegensätzen kennzeichnen die friedensethische Diskussion. Dies gilt für die Frage nach<br />
dem negativen oder positiven Begriff des Friedens, für das Problem der Rangordnung von Werten wie Frieden,<br />
Freiheit und Gerechtigkeit, für die Einschätzung von Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung sowie der Friedensbewegung,<br />
für die Lehre vom gerechten Krieg und ihrer Abwandlung im Konzept gerechter Abschreckung bis<br />
hin zu den anspruchsvollen Versuchen, das Paradigma einer zeitgemäßen Ethik als "Ethik zum nuklearen Frieden"<br />
zu entwerfen, gegenüber denen (nuklear-)pazifistische Optionen v~hementenWiderspruch anmelden müssen. (1)<br />
In einer solchen durch die Komplexität der Sachverhalte wie durch den Pluralismus der moralischen Einstellungen<br />
und ethischen Einsichten geprägten Situation, in der gleichwohl alle mit Recht Mündigkeit und Autonomie für<br />
sich in Anspruch nehmen, sollte Ethik als gemeinsamer, immer wieder zu erneuernder Prozeß ethischer Urteilsbildung<br />
verstanden werden. (2) Ethische Urteilsbildung bedenkt die Positionen und Argumente der anderen in<br />
gleicher Weise wie die eigenen und traut dem menschlichen Einfühlungs- und Denkvermögen die Fähigkeit zu,<br />
Verständigung erreichen zu können. Ein solches Konzept ist in seinem Ansatz und in seinem Fortgang bereits<br />
Verwirklichung von Friedensethik.<br />
Beim Prozeß ethischer Urteilsbildung lassen sich fünf Elemente oder Dimensionen unterscheiden: 1. Die Analyse<br />
der Situation, die zu Handlungen oder zur Unterlassung von Handlungen herausfordert. 2. Die Kenntnisnahme<br />
von elementaren Lebensbedingungen, die durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit ihren Existenzbedrohungen<br />
der Menschheit stärker ins Bewußtsein treten. 3. Die Auseinandersetzung mit ethischen Traditionen und<br />
Positionen, die alle, die sich am ethischen Urteilsbildungsprozeß beteiligen, in unterschiedlicher Weise mitbringen<br />
und die in ihre Urteile - bewußt oder unbewußt - eingehen. 4. Die Urteilsfindung und Entscheidung, die den<br />
Urteilsbildungsprozeß in einem vorläufigen, aber für jetzt bestmöglichen Urteil beenden und 5. zu Folgerungen für<br />
die persönliche und gemeinsame Lebenspraxis führen.
37<br />
Aufrüstung in den Entwicklungsländern bindet sie naturwissenschaftlich-technische Kompetenz und finanzielle<br />
Ressourcen, die dringend zur Lösung der anderen Weltprobleme gebraucht würden. Sie trägt zur Verschärfung<br />
dieser Probleme direkt bei. Gleichzeitig erhöht deren Zuspitzung die Gefahr militärischer Auseinandersetzungen<br />
um natürliche Ressourcen (z.B. Wasser) (6), um eine gerechtere Verteilung von Risiken (z.B. aufgrund der klimatischen<br />
Veränderungen und der mit ihnen verbundenen Verluste von Anbauflächen durch Überschwemmung oder<br />
Versteppung) und Gütern.<br />
Die Spannungen und Konflikte zwischen den Staaten sind Ausdruck, Ursache oder Folge der genannten Probleme.<br />
Zwar ist inzwischen der Ost-West-Konflikt beendet worden. Dadurch werden Abrü8tungsmaßnahmen im<br />
Bereich der NATO und des ehemaligen Warschauer Pakts in unerwartetem Ausmaß ermöglicht. Das tatsächlich<br />
Erreichte hält sich bislang allerdings in bescheidenen Grenzen. Der Vertrag über die Abschaffung der Mittel- und<br />
Kurzstrecken-Raketen (INF-Vertrag) aus dem Jahr 1987 leitete deren Abbau und Verschrottung ein. Im Rahmen<br />
der Gespräche über die Reduzierung strategischer Waffen (START) sind gewisse Fortschritte erzielt worden; im<br />
wesentlichen liegen aber bislang nur Absichtserklärungen (Präsident G. Bush am 27.09.1991 und 28.01.<strong>1992</strong>, Präsident<br />
M. Gorbatschow am 05.10.1991, Präsident B. Jelzin am 29.01.<strong>1992</strong>) vor. China, Frankreich und Großbritannien<br />
bauen ihr Atomwaffenpotential weiter aus. Das nukleare Abschreckungspotential besteht also - als overkill<br />
Potential- weiter, obwohl die politische Konfrontation der Kooperation gewichen ist. Hinzu kommt, daß wirtschaftliche<br />
und politische Unsicherheiten in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Fragen hinsichtlich der sicheren<br />
Kontrolle der Atomwaffen, hinsichtlich der Weitergabe atomwaffenfähigen Materials, Trägersystemen und<br />
zugehörigem wissenschaftlich-technischem Know-how aufwerfen. (7) Zugleich brechen unterdrückt gehaltene Nationalitätenkonflikte<br />
auf und werden militärisch - oft mit erschreckender Brutalität - ausgetragen.<br />
Der komplexe Nord-Söd-Konflikt gerät über all dem zeitweise aus dem Blick. Er wird die nächsten Jahre und<br />
Jahrzehnte zunehmend bestimmen. Dabei wird auch immer deutlicher werden, daß der Nord-Süd-Konflikt nicht<br />
nur wirtschaftliche und finanzielle, technologische und kulturelle, sondern auch rüstungs- und militärpolitische<br />
Dimensionen - bezogen sowohl auf die Nord-Süd- als auch die darin verwickelten Süd-Süd-Spannungsfelder - hat.<br />
Die Gefahr einer neuartigen und im Vergleich zum zweipoligen Ost-West-Konflikt ungleich schwerer kontrollierbaren<br />
Spirale des Wettrüstens deutet sich an und verknüpft sich mit nahezu unlösbar erscheinenden Problemen<br />
eines an und für sich notwendigen Wissenschafts- und Technologietransfers in die Entwicklungsländer.(8)<br />
Wissenschaften und Technologien sind in diese risiko- und konfliktträchtige Welt- und Gesellschaftssituation verstrickt.<br />
Betrachtet man den historischen Prozeß, der zu der jetzigen Lage geführt hat, so wird deren ambivalente<br />
Rolle überdeutlich. Die Nuldeartechnik ist der beredeste Ausdruck dafür. Betrachtet man die Gegenwart und die<br />
Herausforderungen der Zukunft, so ist die Janusköpfigkeit der WISsenschaften und Technologien ebenfalls nicht<br />
zu übersehen. Sie können die Krisenlagen verschärfen, sie können aber auch zur Minderung der Risiken und zur<br />
Entschärfung der Konflikte beitragen. (9)<br />
3. Elementare Lebensbedingungen<br />
Seit der Mitte unseres Jahrhunderts, seit der Explosion der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im Au<br />
, gust 1945, kommt die naturwissenschaftlich-technische Zivilisation zu einem neuen Bewußtsein. Der Preis des
nauere Bestimmungen im fortschreitenden Prozeß der Überwindung der Negativzustände möglich, wobei die Bezugnahme<br />
auf Erfahrungen und Einsichten früherer Epochen und anderer Kulturen nicht nur hilfreich, sondern<br />
unerläßlich ist. (17)<br />
Bisher war von Lebensbedingungen ausgehend von physischen Existenzbedrohungen die Rede. Der Mensch ist<br />
allerdings als Natur- und Kulturwesen auch ein soziales Wesen. Ohne menschliche Beziehungen - Zuwendung,<br />
Liebe, Anregung - kann er sich nicht entfalten; je nach den Umständen kann er aggressiv und destruktiv werden,<br />
oder sich in sich zurückziehen und verkümmern, im schlimmsten Fall gänzlich lebensunfähig werden. Kommunikation,<br />
in der die Identitätund Integrität der Personen geachtet und gefordert wird, erweist sich als elementare Lebensbedingung<br />
und psycho-soziale Voraussetzung für Friedensfähigkeit. (18)<br />
39<br />
Was hier mit Blick auf menschliche Individuen angedeutet worden ist, gilt auch vergleichsweise für gesellschaftliche<br />
Gruppen, kulturelle Gemeinschaften, Rassen und Nationalitäten. Sie benötigen die Spielräume zur Ausprägung<br />
ihrer kulturellen Identitäten und zur Aufrechterhaltung ihrer kulturellen Integrität. Dazu gehört auch die<br />
Anerkennung von seiten anderer Gesellschaften, Gemeinschaften oder Völker. Die Verweigerung der Anerkennung,<br />
die Mißachtung und oft auch brutale Unterdrückung kann tiefsitzende traumatische Verletzungen zur Folge<br />
haben, die zu aggressiver Abwehr oder Selbstbehauptung führen und mehr auf Abgrenzung denn auf Verständigung<br />
und Versöhnung setzen. Die Nationalitätenproblematik zum Beispiel mag hierin zum Teil ihren Grund haben.<br />
Jedenfalls zeigt sich, daß nicht nur interpersonale, sondern auch interkulturelle Achtung und Anerkennung<br />
Bedingungen für Frieden sind.<br />
4. Ethische Traditionen und Positionen<br />
4.1. Vom gerechten Krieg zur gerechten Abschreckung·<br />
4.1.1. "Gerechter Krieg"<br />
Die Lehre vom "gerechten Krieg" stellt das einflußreichste ethische Kriegsverhütungs- bzw. Kriegsbegrenzungsmodell<br />
dar. (19) Der Grundgedanke dieser Lehre besteht darin, daß Kriege nur um des Friedens willen geführt<br />
werden dürften. In allerersten Anfängen geht die Lehre vom "gerechten Krieg" auf Platon und Aristoteles zurück,<br />
bis Cicero die folgende Formulierung findet:<br />
"Jene Kriege sind ungerecht, die ohne Grund unternommen werden: denn ohne Grund, sich zu rächen<br />
oder die Feinde zurückzuschlagen, kann kein gerechter Krieg geführt werden. Kein Krieg gilt als gerecht<br />
außer dem angesagten, erklärten, außer nach Stellung der Forderung aufRückgabe des Eigentums." (20)<br />
Augustinus, der mit seiner Lehre die christliche Theologie wie kein anderer prägt, greift die Gedanken Ciceros<br />
auf und stellt sie in einen theologischen Rahmen, indem er den Frieden als "tranquillitas ordinis", als "Ruhe der<br />
Ordnung" beschreibt; damit meint er nicht die Beruhigung, die nach der Wiederherstellung der vor dem ungerechten<br />
Eingriff bestehenden Ordnung eintritt, sondern die von Gott gewollte Ordnung in der Welt, deren<br />
Grundlage die Schöpfungsordnung ist. (21) So sagt er von dem, der die göttliche Ordnung kennt und für sie eintritt:<br />
"Es ist das Unrecht des Gegners, das den Weisen zu einem gerechten Kriege zwingt." (22)<br />
An der weiteren Entfaltung der Lehre vom "gerechten Krieg" haben Theologen, Philosophen und Juristen - über
41<br />
für einen gerechten Krieg eine einzige akzentuiert, die gestörte Gerechtigkeitsordnung. Diese wird nicht nur absolut<br />
gesetzt, sondern es wird gleichzeitig unterstellt, daß wir erkennen können, wann ein Angriff sich objektiv gegen<br />
diese absolute Ordnung richtet und auch in dieser Absicht ausgeführt wird. Dem stalinistischen Sowjetkommunismus<br />
traute man solches zu.<br />
Allerdings läßt sich zeigen, daß G. Gundlach Pius XII. nicht zutreffend interpretiert, - oder aber zwischen den<br />
Aussagen des Papstes erhebliche Spannungen bestehen. Dieser hat nämlich in weiteren Ansprachen drei Bedingungen<br />
genannt, die das Recht auf einen Verteidigungskrieg begrenzen: Erstens muß eine begründete W~scheinlichkeit<br />
auf Erfolg gegeben sein. Zweitens dürfen die Schäden, die der Krieg anrichtet, Dicht ungleich<br />
größer sein als die erlittene Ungerechtigkeit; andernfalls kann man verpflichtet sein, die "Ungerechtigkeit auf sich<br />
zu nehmen" (27). Drittens: wenn der Verteidigungskrieg "eine solche Ausdehnung des Übels mit sich bringt, daß<br />
es sich der Kontrolle des Menschen völlig entzieht, muß sein Gebrauch als unsittlich verworfen werden" (28).<br />
An diese güterabwägende Traditionslinie in der Lehre vom gerechten Krieg knüpfen die katholischen Bischöfe<br />
der USA in ihrem Pastoralbrief über Krieg und Frieden vom Mai 1983 - der übrigens das Ergebnis eines intensiven<br />
Beratungs- und Diskussionsprozesses ist und als solcher eine exemplarische Bedeutung hat - an und kommen zu<br />
grundsätzlich anderen Ergebnissen als G. Gundlach. (29) Sie wollen die öffentliche Meinung in dreifacher Hinsicht<br />
beeinflussen: "allen Versuchen zu widerstehen, auf einen Nuklearkrieg als Mittel staatlicher Politik zurückzugreifen";<br />
"eine Schranke gegen die Vorstellung aufzubauen, daß ein Nuklearkrieg eine gangbare Verteidigungsstrategie<br />
sein kann"; "die Öffentlichkeit zu einer Haltung zu ermutigen, die eindeutige Grenzen für das Handeln<br />
unserer eigenen Regierung und anderer Regierungen in Sachen Nuklearpolitik setzt" (30). Sie lehnen jeden Einsatz<br />
von Massenvernichtungswaffen ab, auch für den Fall, daß eigene Städte bereits angegriffen worden sind. Dasselbe<br />
gilt für den Ersteinsatz von Kernwaffen; sie fordern deshalb von der NATO ein Verteidigungskonzept, das<br />
auf die Erstschlagsoption mit Atomwaffen verzichtet. Sie argumentieren gegen die Möglichkeit einer "Begrenzung"<br />
eines Atomkrieges.<br />
Mit G. Gundlachs Argumentation zeigte sich, zu welch verhängnisvollen Konequenzen man durch eine bestimmte<br />
Auslegung der Lehre vom "gerechten Krieg" kommen konnte. Der entscheidende Unterschied zwischen Gundlachs<br />
Verständnis dieser Lehre und dem der amerikanischen Bischöfe besteht in folgendem: G. Gundlach insistiert<br />
- und dafür kann er sich auf Aussagen des Papstes in der Weihnachtsansprache von 1948 berufen - auf ihrem<br />
deontologischen Fundament, d.h. sie beruht auf einer unbedingten Verpflichtung der Menschen, die Rechtsordnung<br />
Gottes in der Welt zu achten, zu schützen und zu verteidigen, was "einen aUßerordentlichen, ja einen ungeheuren<br />
Einsatz rechtfertigt" (31). Angesichts dieser unbedingten Forderung des Naturrechts treten die teleologischen<br />
Gesichtspunkte, die Fragen nach den Folgen und ihre Abwägung, in den Hintergrund. Die amerikanischen<br />
Bischöfe dagegen - und mit ihnen die überwiegende Mehrzahl der Vertreter einer Lehre vom "gerechten Krieg ll <br />
sehen in ihr ein Konzept, das auf Güterabwägung beruht; indem sie die in dieser Lehre genannten Bedingungen<br />
auf andere unbedingte sittliche Verpflichtungen beziehen - vor allem auf das Verbot, Unschuldige zu töten -, werden<br />
Massenvernichtungswaffen für sie unsittlich. Deshalb hat derjenige, dem der Einsatz solcher Waffen befohlen<br />
wird, die strenge Pflicht, sich diesem Befehl zu widersetzen (32).<br />
Im Zeitalter der Atomwaffen konnte eine Theorie, die derart weitreichende Interpretationsspielräume offenließ,
43<br />
"daran zu erinnern, daß der Streit um den Zugang des Irak zum Persischen Golf bis in die Zeit des Ersten<br />
Weltkriegs und auf die willkürliche Grenzziehung im Mittleren Osten nach dem Zerfall des Osmanischen<br />
Reiches durch die britische Regierung zurückgeht. Bereits 1961, bei der Entlassung des Emirats Kuwait in<br />
die Unabhängigkeit, hatte der Irak gegen die Nichtberücksichtigung seiner Interessen protestiert, 1973<br />
und 1975 kam es wiederum zur krisenhaften Zuspitzung dieses Konflikts. Jeder Versuch des Irak, die offene<br />
Frage Kuwait im Rahmen der arabischen Liga zu behandeln, wurde von dieser aufDruck der konservativen<br />
arabischen Regime mit nachhaltiger Unterstützung der westlichen Staaten zurückgewiesen.11<br />
(36)<br />
Darüber hinaus gehört zur Genese des Konflikts, daß auch westliche Staaten an den umfangreichen Rüstungsexporten<br />
in die Krisenregion beteiligt waren, daß gerade der Irak im Krieg gegen den Iran durch Waffenlieferungen<br />
unterstützt wurde, daß man nicht protestierte oder gar einschritt, als der Irak gegen den Iran und gegen die Kurden<br />
Giftgas einsetzte. Schließlich darf doch nicht übersehen werden, daß westliche Industrienationen erhebliche<br />
wirtschaftliche Interessen mit der Golfregion verbinden. Es ist deshalb sehr die Frage, ob eine vergleichbare Verletzung<br />
des Völkerrechts in einem weniger brisanten Winkel der Erde eine vergleichbar potente Verteidigung gefunden<br />
hätte.<br />
Dies alles wird hier erwähnt, nicht um eine Entscheidung im Streit um das Für und Wider des Golfkriegs vorzubereiten,<br />
sondern um zu zeigen, daß die Lehre vom IIgerechten Krieg" zu Vereinfachungen verleitet, die der Komplexität<br />
der Situationen und Probleme nicht angemessen sind, und daß sie deshalb leicht zu einer kriegslegitimierenden<br />
Theorie wird. Der entschiedene Perspektivenwechsel in der Friedensethik - weg von der Leitfrage des<br />
"gerechten Krieges ll hin zu der Frage nach der Bewahrung und der Förderung des Friedens - ist also überfällig,<br />
und vom Ökumenischen Rat der Kirchen, von der Friedens-Denkschrift der Evangelischen Kirchen in Deutschland<br />
(37), von Johannes xxm., vom Zweiten Vatikanischen Konzil (38) und vielen anderen bereits vorgenommen<br />
worden. Einprägsam formuliert hat das zeitgemäße Paradigma der Friedensethik C.F. von Weizsäcker in den drei<br />
Thesen seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche:<br />
"1. Der Weltfriede ist notwendig.<br />
2. Der Weltfriede ist nicht das goldene Zeitalter.<br />
3. Der Weltfriede fordert von uns eine aUßerordentliche<br />
. moralische Anstrengung.1I (39)<br />
4.1.2. "Gerechte Abschreckung"<br />
Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, für die friedensethische Diskussion insgesamt feststellen zu können,<br />
daß sie die neue Perspektive übernommen habe. Vielmehr kehrt in der neueren Diskussion die Lehre vom<br />
"gerechten Krieg" in veränderter Form, als Lehre von der "gerechten Abschreckung", wieder.<br />
In diesem Zusammenhang ist zunächst auf kirchliche Stellungnahmen zur atomaren Abschreckung hinzuweisen.<br />
Das wichtigste Dokument stellen die "Heidelberger Thesen" dar, eine gemeinsame Erklärung einer Kommission<br />
der Evangelischen Studiengemeinschaft vom 28.4.1959. Hier sind besonders die Thesen 6-8 von Bedeutung:<br />
"These 6: Wir müssen versuchen, die verschiedenen im Dilemma der Atomwaffen getroffenen Gewissensentscheidungen<br />
als komplementäres Handeln zu verstehen•...<br />
These 7: Die Kirche muß den Waffenverzicht als eine christliche-Handlungsweise anerkennen....<br />
These 8: Die Kirche muß die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frie-
siko des nuklearen Holocaust ... vertretbar machen.... im Prinzip kann ein physisches Übel um eines moralischen<br />
Wertes willen in Kauf genommen werden. 11 (47)<br />
45<br />
Zu beachten ist, daß alle angesprochenen Beiträge zu einem Zeitpunkt verfaßt wurden, da der Zusammenbruch<br />
der Sowjetunion nicht absehbar war. Sie gehen vom Faktum des West-Ost-Konflikts, vom bestehenden und fortdauernden<br />
Duopol aus. Durch die unerwartete Änderung der Weltlage sind manche Überlegungen überholt, im<br />
Kern aber werden die Motive, die zur Konzeption der Ethik nuklearer Abschreckung führen, davon nicht berührt.<br />
Es ist deswegen notwendig, deren Argumentationsgang weiter zu verfolgen. Dies soll am Beispiel des ausgearbeitetsten<br />
Beitrages, der "Ethik zum nuklearen FriedenIl von D. Henrich, geschehen. (48)<br />
4.2. "Ethik zum nuklearen Frieden"<br />
Der Titel bereits weist auf ein philosophisches Programm hin, das anspruchsvoller ist als eine bloße "Ethik der nuklearen<br />
AbschreckunglI. Hier wird nicht mehr das Konzept der Lehre vom "gerechten Krieg" weitergedacht unter<br />
den Bedingungen des atomaren Zeitalters, sondern eine konsequente Friedensethik angesichts dieser Weltlage zu<br />
entwickeln versucht. Der Perspektivenwechsel von der ethischen Rechtfertigung des Krieges oder der Abschreckung<br />
auf den Frieden hin ist also vorgenommen und zwar unter Bezugnahme auf I. Kant, für den kategorisch galt,<br />
daß kein Krieg sein soll und alle Bemühungen sich am Ziel des Friedens auszurichten hätten. (49) Deshalb ruft<br />
schon der Titel "Ethik zum nuklearen FriedenIl I. Kants Schrift "Zum ewigen Frieden" in Erinnerung und läßt als<br />
These vermuten, daß der Weltfriede notwendig und daß er die Lebensbedingung des technischen Zeitalters sei,<br />
daß er aber nur unter dem nuklearen Schild verwirklicht werden könne.<br />
Der Gang der Studie besteht in einer schrittweisen Vertiefung des sittlichen Bewußtseins, die hier wenigstens in<br />
einigen wichtigen Punkten nachgezeichnet werden soll. Auf einer ersten Reflexionsstufe ~ergewissert sich die<br />
praktische Vernunft der sittlichen Primärregel. Zu entscheiden ist die Frage, ob jemand wirklich wollen kann, daß<br />
die nukleare Waffe, die durch ihre nicht differenzierende Zerstörungskraft gekennzeichnet sei und deswegen immer<br />
auch Unbeteiligte treffe, eingesetzt wird. Sie wird anhand des kategorischen Imperativs geklärt. Dieser gibt ja<br />
eine Überprüfungsregel an die Hand: Kann ich wollen, daß die beabsichtigte Handlungsweise zur allgemeinen<br />
Regel werde?<br />
"Stellt sich die Beurteilungsfrage auf diese Weise, dann wird offensichtlich, daß der Grundsatz solchen<br />
Handelns nicht als Regel gedacht werden kann, die wirklich immer und von allen Handelnden befolgt<br />
wird, welche überhaupt in Konflikten gewaltsam aufeinander einwirken können. Das hätte nämlich zur<br />
Folge, daß jeder Handelnde zu beliebiger Zeit von irgend einem Konflikt betroffen würde. Er könnte also<br />
selbst nur folgerichtig handeln, wenn er sich alle möglichen Bedrohungsquellen jederzeit deutlich machen<br />
und wenn er sich auch gegen sie wappnen würde.... In dem Gedankenexperiment ... zeigt sich hier also,<br />
daß der Austrag von Konflikten zwischen Gegnern mit nuklearen Waffen, würde er der Regelfall für alle<br />
Auseinandersetzungen sein, einen Konflikt aller überhaupt Handelnden miteinander zur Folge haben<br />
würde. Ein solcher Konflikt ist aber unvereinbar mit der Verfolgung von Zwecken und Interessen im jeweils<br />
beschränkten Umkreis eines einzelnen Handelnden. Er würde die Grundsituation zerstören, kraft<br />
deren er überhaupt ein Handelnder zu sein vermag." (50)<br />
Dasselbe Ergebnis stellt sich ein, wenn man davon ausgeht, daß die nukleare Waffe zur Verteidigung eingesetzt
47<br />
Um die Sicherheit der nuklearen Friedenserhaltung zu gewährleisten, seien drei Imperative zu beachten. Erstens:<br />
Die Vernichtungswaffen sind von den taktischen Atomwaffen zum Zwecke der jeweils unterschiedlichen angemessenen<br />
Kontrolle und Überwachung zu trennen. Zweitens: Durch eine ausreichende konventionelle Bewaffnung<br />
muß erreicht werden, von den Nuklearwaffen als "Komfortwaffen" (weil sie z.B. billiger sind als vergleichbar effiziente<br />
konventionelle Waffen) in der strategischen Planung wegzukommen. So könnte schließlich ein Zustand eintreten,<br />
in dem Angriffswaffen nicht mehr und Nuklearwaffen nur noch zur Abwehr atomarer Drohung und Erpressung<br />
notwendig sind. Drittens: Es muß zu einer umfassenden Zusammenarbeit der Großmächte kommen, die<br />
sich auch auf die Weiterentwicklung der Waffen bezieht. Diese Kooperation<br />
"ist angesichts dessen, daß die Weltlage im Prinzip nicht verändert werden kann, die Grundlage dafür, daß<br />
sich eine Politik unter Bedingungen der Verfügbarkeit der nuklearen Waffe doch als gewaltlose Politik<br />
auszubilden vermag. Selbst Gandhi verstand Gewaltlosigkeit nicht als Haltung und Verhalten des Schwachen,<br />
sondern als die Einstellung, die gerade dem abgefordert werden muß, der sich seiner Stärke bewußt<br />
ist. ... Die Weltlage verweist also nicht auf die Perspektive einer neuen Weise der Kriegsführung, sondern<br />
auf die eines nuklear gedeckten Friedenszustandes und weiter auf eine Ordnung des Friedens. t1 (54)<br />
Frieden ist hier durchaus mehr als Nicht-Krieg. Er bedeutet den Prozeß der Entwicklung einer internationalen<br />
Ordnung, die auf Zusammenarbeit, Wohlstand und auf die endgültige Abschaffung der Institution Krieg ausgerichtet<br />
ist. Die Hoffnung auf all dies aber habe ihren "realen Anhalt" an der nuklearen Abschreckung. (55)<br />
5. Zur Möglichkeit eines dauerhaften Friedens<br />
Nach diesem Durchgang durch die ethischen Traditionen und Positionen der Lehre vom "gerechten Krieg", von<br />
der "gerechten Abschreckung" sowie der "Ethik des nuklearen Friedens ll muß nun der eigene Stand der Urteilsbildung<br />
umrissen werden, der seinerseits sich auf bestimmte Informationen und Einschätzungen der Weltlage und<br />
auf ethische Traditionen stützt, deren Herkunft aus dem bereits Aufgeführten oder aus den Belegen zum Folgenden<br />
deutlich werden dürfte. Ich beginne mit Anmerkungen zur Weltlage, fahre fort mit Überlegungen zu einer<br />
Ethik des dauerhaften Friedens und benenne schließlich die Schritte, die zur Verwirklichung eines dauerhaften<br />
Friedens hinführen können.<br />
5.1. Zur Einschätzung der Weltlage<br />
Es gehört zu den unumgänglichen Notwendigkeiten der philosophischen Ethik, wenn sie praktisch werden will,<br />
ihre prinzipiellen Aussagen auf das Handeln in Lebens- und in Weltlagen zu beziehen. Also muß sie sich auch<br />
eine Meinung über die betreffenden Lebenslagen oder Weltlagen bilden. Die wichtigsten Unterschiede zwischen<br />
der Einschätzung der Weltlage in den Modellen einer Ethik der "gerechten Abschreckung" od~r des "nuklearen<br />
Friedens" und der hier zu erläuternden Auffassung von der Ermöglichung eines dauerhaften Friedens lassen sich<br />
in drei Punkten zusammenfassen.<br />
1. Die These, das System der Abschreckung habe in den vergangenen 45 Jahren den Frieden gewährleistet, ist nur<br />
mit erheblichen Einschränkungen richtig. Historisches Faktum ist, daß es keinen nuklearen Frieden gab. Aber<br />
wieviel beweist dieses Faktum für die These von der friedenstiftenden Wirkung der Abschreckung? Alternative<br />
Konzepte sind ja nicht erprobt worden und konnten sich nicht bewähren.
49<br />
der verfügbaren Potentiale nicht mit den "Großen" gleichzuziehen? Wie sollen nuklearen "Newcomer" darin gehindert<br />
werden, die thermonukleare Waffe zu entwickeln? Zusätzlich ist zu bedenken, daß weitere Atomwaffentests<br />
erforderlich werden, verbunden mit den entsprechenden Gefahrenfolgen für die ökologische Sicherheit. (60)<br />
Alles in allem: Das Abschreckungssystem ist kein "fehlerfreundliches" System. Sollte es - aus technischen oder politischen<br />
Gründen - versagen, ist keine Korrektur mehr möglich. (61) Dies brachten 18 Atomwissenschaftler bereits<br />
1957 in der "Göttinger Erklärung" zum Ausdruck:<br />
'Wir leugnen nicht, daß die gegenseitige Angst vor der Wasserstoffbombe heute einen wesentlichen Beitrag<br />
zur Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt und der Freiheit in einem Teil der Welt leistet. Wir halten<br />
aber diese Art, den Frieden und die Freiheit zu sichern, auf die Dauer für unzuverlässig, und wir halten<br />
die Gefahr im Falle des Versagens für tödlich." (62)<br />
3. Die Beurteilung der Weltlage seitens der Ethik der "gerechten Abschreckung" und des "nuklearen Friedens"<br />
bleibt auf das Vorhandensein der Atomwaffen und aufdie Ost-West-Spannung konzentriert, während andere<br />
Konfliktursachen (Bevölkerungswachstum, Nord-Süd-Gelälle, Naturzerstörung) vernachlässigtwerden.<br />
Die genannten ethischen Modelle sind in den achtziger Jahren entwickelt worden. Sie antworten auf eine sich verschärfende<br />
Bedrohungssituation im Ost-West-Verhältnis einerseits und eine erstarkende Friedensbewegung andererseits.<br />
Ihre Besorgnis war, daß durch eine Minderung der Glaubwürdigkeit der Abschreckung auf einer Seite<br />
eine gefährliche Destabilisierung des Ost-West-Gleichgewichtsverhältnisses eintreten könnte. Die Weltsituation<br />
hat sich inzwischen grundlegend geändert: Der Ost-West-Konflikt existiert nicht mehr. Daraus ergeben sich neue<br />
hoffnungsvolle Perspektiven, aber auch neue Gefahren. (63)<br />
Perspektiven: In den Ländern Osteuropas und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist ein Demokratisierungsprozeß<br />
zustande gekommen, mit dem sich die Hoffnung verbindet, daß auch diese neuen Demokratien ein stärkeres<br />
Interesse an konsequenter Abrüstungs- und Friedenspolitik entwickeln, als dies bei totalitären Staaten der<br />
Fall ist. Gleichzeitig eröffnen sich nach dem Zusammenbruch der planwirtschaftlichen Systeme und dem Übergang<br />
zur Marktwirtschaft bisher unbekannte Möglichkeiten wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Die Wege zu einer<br />
umfassenden politischen Kooperation sind offen. Für die Vereinten Nationen ergibt sich ein erweiterter Handlungsspielraum..<br />
Sie können eine aktivere Rolle in der Umwelt-, Entwicklungs- und Friedenspolitik übernehmen.<br />
Sie können zunehmend in die Lage versetzt werden, kriegerische Auseinandersetzungen zu verhüten, zu entschärfen<br />
oder gegebenenfalls durch militärische Eingriffe zu beenden. Die politische Forderung, durch internationale<br />
Vereinbarung den Vereinten Nationen das Gewaltmonopol zu übertragen, ist erhoben worden und insofern nicht<br />
völlig unrealistisch, als bereits beim Vorgehen gegen den Irak 1990/1991 die "Koalition" größten Wert darauf legte,<br />
durch - in ihrem Sinn interpretierbare - Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen legitimiert zu<br />
werden.<br />
Gefahren: Die politischen Verhältnisse in den Ländern des ehemaligen Ostblocks sind nicht stabil. Die Demokratisierungsprozesse<br />
können Rückschläge erleiden. Der Übergang zur Marktwirtschaft erweist sich als äußerst<br />
schwierig. Nationalitätenkonklikte sind ausgebrochen und werden militärisch - zum Teil mit äußerster Brutalität <br />
ausgetragen, ohne daß die internationale Staatengemeinschaft wirksam zur Befriedung beitragen könnte.
gerade unter der Zivilbevölkerung; grauenhaftes Siechtum bei den noch Lebenden; erhebliche Schädigungen bei<br />
den Nachkommen; Zerstörung der natürlichen Umwelt. Die ausschließlich auf die militärische Potenz des Gegners<br />
zielende Absicht entbindet nicht von der moralischen Verantwortung für die darüber hinausgehenden Folgen.<br />
Und ehe man von der "in sich" wertfreien Bombe spricht, sollte man sich vergegenwärtigen, daß sie das Ergebnis<br />
menschlicher Handlungen ist, und zwar nicht nur wertfreier Handlungen der Grundlagenforschung. Schließlich<br />
läßt sich - mit H. Jonas - fragen, ob die Existenz der biologischen Gattung Mensch, deren Angehörige fähig sind,<br />
Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, moralisch wirklich ohne Bedeutung ist und ihre nukleare Vernichtung<br />
deshalb nur ein physisches Übel darstellt. (68)<br />
51<br />
Die "Ethik zum nuklearen Frieden" hält - im Gegensatz zu den erwähnten Konzepten der "gerechten Abschreckung"<br />
- auch in ihren vertiefenden Schritten - an der sittlichen Primäreinsicht fest, daß solche Vertilgungswaffen<br />
weder eingesetzt noch mit ihrem Einsatz gedrohtwerden darf. Das angestrebte Geflecht gemeinsam vereinbarter<br />
Sicherheit ist aber auf Dauer nicht sicher genug, um garantieren zu können, was es garantieren soll. Davon war bereits<br />
die Rede.<br />
2. Ein dauerhafter Frieden ist nur auf der Grundlage internationaler Gerechtigkeit, das bedeutet hier die gleichberechtigte<br />
Mitwirkung der Staaten bei der Gestaltung einer Friedensordnung, möglich. Der Vertrag über die<br />
Nichtverbreitung von Atomwaffen - dem ein richtiger Gedanke zugrunde liegt, nämlich daß die Welt umso unsicherer<br />
wird, je mehr Staaten über Nuklearwaffen verfügen - schafft zwei ungleiche Gruppen von Staaten: solche,<br />
die Atomwaffen haben, sie weiter besitzen dürfen und sie tatsächlich noch vermehrt und weiterentwickelt haben,<br />
und die anderen, die sie nicht besitzen und sie auch nicht bekommen sollen. Der Vertrag ist seit 1970 in Kraft.<br />
1995 wird zu entscheiden sein, ob der Vertrag weiter in Geltung bleibt. Im Interesse der Aufrechterhaltung des<br />
Friedens ist seine Erneuerung von höchster Dringlichkeit. Dabei wird die Diskussion um den Artikel 6 des Vertrages,<br />
der zu Verhandlungen zur Beendigung des Wettrüstens zu einem baldigen Zeitpunkt und über die nukleare<br />
Abrüstung, sowie über einen Vertrag über allgemeine und vollkommene Abrüstung unter strenger und wirksamer<br />
internationaler Kontrolle eine entscheidende Rolle spielen. Dieser Artikel war für die Nichtbesitzerländer von<br />
Atomwaffen gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von größter<br />
Bedeutung. Sie konnten auf den Besitz von Atomwaffen nur verzichten, wenn die Nuklearmächte ihrerseits bereit<br />
waren, sich einem solchen Verzicht in glaubwürdigen Schritten anzunähern. Bedenkt man die Laufzeit des Vertrags,<br />
so fällt das Urteil bezüglich der Vertragstreue der Besitzerstaaten, die zum Teil - wie Frankreich -den Vertrag<br />
allerdings gar nicht unterzeichnet haben, negativ aus. Jahrelang haben sie die "vertikale Proliferation"<br />
(Weiterentwicklung der Atomwaffensysteme) betrieben, ehe sie sich zu Rüstungsbegrenzungen und schließlich zu<br />
Abrüstungsmaßnahmen bereit fanden. Doch bleibt ja bis zu Jahre 1995 noch ein begrenzter Spielraum, um eine<br />
massive Abrüstung des atomaren Potentials einzuleiten.<br />
Jedenfalls haben sich seit Mitte der 60er Jahre, in denen der Vertrag ausgehandelt wurde, die Gewichte im internationalen<br />
Kräftefeld verschoben, - und dies mcht nur durch den Zerfall der Sowjetunion: Die Staaten der Welt<br />
haben gegenüber den Großmächten an Selbstbewußtsein gewonnen. Es wird kein Vertrag mehr zustimmungsfähig<br />
sein, der nicht den Grundsätzen der Gleichberechtigung der Staaten Rechnung trägt und deren Erfüllung überprütbar<br />
und einklagbar macht.
53<br />
näherung an die Idee des Friedens suchen.<br />
Die Hoffnung auf einen Frieden ganz ohne Gewalt gehört zu den lIalten Geschichten ll . Sie findet sich in einer<br />
Heilsschilderung, die aus der Zeit des babylonischen Exils (598-538) stammt und in der hebräischen Bibel bei Jesaja<br />
(2,2-4) und auch bei Micha (4,1-5) nachgelesen werden kann. Die Vision des an Jahwe glaubenden Propheten<br />
läßt "viele Völkerll vor Jahwe auf dem Berg Zion sich versammeln und seine Weisung hören.<br />
"Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein<br />
Volk wider das andere das Schwert erheben, denn sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen."<br />
"Alte Geschichten gewiß", meint E. Bloch, aber "fast völlig unabgegolten" und deshalb "aus der Zukunft her" herausfordernd.<br />
(75) Dabei ist besonders zu bedenken, daß diese Art von Hoffnung in der Auseinandersetzung mit<br />
einer bedrückenden und gewalttätigen Gegenwart entsteht. Dem Frieden kontrastierte Erfahrungen ließen sein<br />
vollendetes Bild entwerfen. Die Kontrasterfahrungen spitzen sich im Zeitalter der nuklearen Waffen, die von kosmischer<br />
Dimension sind, aufs Äußerste zu. Hier schließt sich der Gedanke Tb. W. Adornos an: Wohl sei "der<br />
Fortschritt von der Steinschleuder zur Megatonnenbombe satanisches Gelächter, aber erst im Zeitalter der Bombe<br />
ein Zustand zu visieren, in dem Gewalt überhaupt verschwände" (76).<br />
5.3. Schritte zum dauerhaften Frieden<br />
Die Erinnerung an utopische Gehalte in der Friedensethik kann nicht den Sinn haben, die Wirklichkeit zu überspringen.<br />
Vorschläge, die sich an ihr orientieren, brauchen ihre Vermittlung zur Realität. Deshalb müssen nun die<br />
Schritte angezeigt werden, die in die Richtung eines dauerhaften Friedens führen können.<br />
1. Dringend erforderlich ist eine intemationale Vereinbarung über die Beendigung der AtomwatTentests. Ein<br />
Atomwaffenstop wäre, wenn verbunden mit dem Verzicht auf die Weiterentwicklung von Kernwaffen, ein Schritt<br />
in die Richtung ihrer Abschaffung. Im übrigen wird ohne eine solche Vereinbarung der Vertrag über die Nichtverbreitung<br />
von Kemwaffen kaum erneuert werden können.<br />
2. Eine drastischere Abrüstung der NuklearwatTen, als sich bisher in den START-Gesprächen abzeichnet, ist<br />
möglich und könnte tür die aufstrebenden Entwicklungsländer ein positiver Hinweis sein, die NiChtverbreitungsbemühungen<br />
zu unterstützen. Ziel müßte eine nukleare Minimalabschreckung sein, d.h. Reduzierung der Potentiale<br />
der USA und der Staaten der ehemaligen Sowjetunion aufje tausend Sprengköpfe. Derzeit besitzen beide<br />
Seiten jeweils mehr als 10 000 Sprengköpfe; in den START-Verhandlungen ist eine Senkung aufje 6000 in Aussicht<br />
genommen. Die "Joint Understandingll Vereinbarung zwischen G. Bush und B. Yeltsin sehen bis zum Jahr<br />
2003 eine beiderseitige Abrüstung aufje 3000-3500 Sprengköpfe vor. Eine solche Beschränkung auf minimale Abschreckung<br />
könnte auch die anderen größeren Nuklearmächte (China, Frankreich, Großbritannien) dazu bewegen,<br />
ihre Potentiale deutlich zu begrenzen. (77)<br />
3. In einem weiteren Schritt könnten die USA, die GUS-Republiken sowie China, Frankreich und Gro~britannien<br />
vertraglich vereinbaren, die Herstellung von watTenfähigem Material (Plutonium, angereichertes Uran, Tritium)<br />
zu beenden. Die Einhaltung einer solchen Vereinbarung muß überprüft werden können. (78)
6. Wenn das Ziel einer vollständigen nuklearen Abrüstung und eines dauerhaften Friedens erreicht werden soll,<br />
sind verändemde Schritte in anderen Bereichen notwendig. So wird in der konventionellen Rüstung sowohl auf<br />
dem Abbau der Potentiale als auch aufeiner Umstellung von Angriffs- aufVerteidigungssysteme zu bestehen sein.<br />
Parallel dazu sind die Bemühungen um Konversion, d.h. um die Überführung der Rüstungs- in zivile Produktion,<br />
zu verstärken, wozu wiederum einschlägige wissenschaftliche Expertise notwendig ist.<br />
55<br />
7. Nur eine Verändernng des marktwirtschaftlieh orientierten Weltwirtschaftssystems kann die Chancen verstärken,<br />
die Ursachen für die schlimmsten Konflikte der kommenden Jahrzehnte - die Zerstörung der Natur, der<br />
Hunger und die Armut in der Welt - zu beseitigen. Gelänge es, die Lage der Armen entscheidend zu verbessern,<br />
könnte damit nach allen bisherigen Kenntnissen auch ein merklicher, vielleicht hinreichender Rückgang des Bevölkerungswachstums<br />
verbunden sein. Eine der größten Gefahren für das Ökosystem und eine der explosivsten Konfliktursachen<br />
wäre so gebannt. Damit dies gelingen kann, ist eine Entlastung des Wirtschafts- und Finanzsystems<br />
von Rüstungsausgaben nötig. Dazu gehören die schon erwähnte Rüstungskonversion und die Eindämmung der<br />
Rüstungsexporte. (82)<br />
8. Politisch durchsetzbar werden solche Vorschläge nur, wenn eine Mehrheit sie sich zu eigen macht. Das bedeutet<br />
Bewußtseinsbildung und BeWUßtseinswandel, orientiert an einer sensiblen Wahrnehmung der Wirklichkeit, an der<br />
Befähigung zur Vorauserkennung möglicher Gefährdungen, die in der Gegenwart bereits als Risiken angelegt<br />
sind, bemüht um den Abbau der Feindbilder und der Dominanz des militärischen Denkens, ausgerichtet auf die<br />
Grundsätze einer universalistischen Moral der Gerechtigkeit und der Fürsorge für die Mitwelt, die Umwelt und<br />
die Nachwelt.<br />
Damit soll hervorgehoben werden, daß der BeWUßtseinswandel auch seine moralische Dimension hat und - das sei<br />
nun noch hinzugefügt - weltweit vorangebracht werden muß. Diese EiDsicht verschafft sich Ausdruck, wenn von<br />
einer erneuerten Moral als dem Preis für die Moderne (83), wenn von der Notwendigkeit eines Weltethos die<br />
Rede ist (84), oder wenn C. F. von Weizsäcker feststellte: "Der Weltfriede fordert von uns eine außerordentliche<br />
moralische Anstrengung." (85) Diese Anstrengung besteht nicht so sehr im Aufbieten eines moralischen Gefühls,<br />
als in dem Einsatz von Verstand und Vernunft, um die Bedingungen und Voraussetzungen für einen dauerhaften<br />
Frieden zu klären, über diese Bedingungen aufzuklären und Schritte in seine Richtung zu planen und zu verwirklichen.
57<br />
14 Schweitzer, Albert: Kultur und Ethik. München: Beck 1960, S. 330.<br />
15 Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt<br />
a.M.: Insel 1979, S. 72.<br />
16 Vgl. Henrich, Dieter: Ethik zum nuklearen Frieden. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, S.119-212. - Jonas, Hans:<br />
Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt a.M.: Insel 1979,<br />
S. 84-102, S. 153-171.<br />
17 Vgl. Huber, Wolfgang - Reuter, Hans-Richard, Friedensethik. Stuttgart: Koblbammer 1990, S. 27-<strong>13</strong>1. - Koog,<br />
Hans: Projekt Weltethos. München: Piper 1990.<br />
18 Vgl. Spitz, Rene A. (unter Mitarbeit von W. Godfrey Cebliner): Vom Säugling zum Kleinkind. Stuttgart: Klett<br />
51976 (Originalausgabe: The fIrst Year Life, 1965). Besonders S. 279-295. - Ders.: Vom Dialog. Studien über<br />
den Ursprung der menschlichen Kommunikation und ihrer Rolle in der Persönlichkeitsbildung. Stuttgart: KIett<br />
1976.<br />
19 Vgl. Engelhardt, Paulus: Die Lehre vom "gerechten Krieg" in der vorreformatorischen und katholischen Tradition.<br />
Herkunft - Wandlungen - Krise, in: Der gerechte Krieg: Christentum, Islam, Marxismus, Redaktion R.<br />
Steinweg. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981, S. 72-124. - Hertz, Anselm: Die Lehre vom "gerechten Krieg ll als<br />
ethischer Kompromiss, in: ders., u.a. (Hrsg.): Handbuch der christlichen Ethik, Band 3: Wege ethischer Praxis.<br />
Freiburg-Gütersloh: Herder-Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1982, S. 425-448.<br />
20 Cicero, De re publica ill,23, zit. nach: Anselm Hertz, s. Anm. 19, S. 430.<br />
21 Vgl. Aurelius Augustinus, De civitate Dei XIX,<strong>13</strong>, deutsche Übersetzung: Die Gottesbürgerschaft. Frankfurt<br />
a.M.: Fischer 1961, S. 279.<br />
22 S. Anm. 21, XIX,7, S. 274.<br />
23 Vgl. Bender, Wolfgang: Zur Diskussion in der katholischen Kirche um Frieden und Abrüstung, in: Burkbardt,<br />
Armin (Hrsg.): Hochschule und Rüstung. Ein Beitrag von Wissenschaftlern der Technischen Hochschule<br />
Darmstadt zur (IlNach ll -)Rüstungsdebatte. Darmstadt: Darmstädter Blätter 1984, S.101-124. - Huber, Wolfgang<br />
- Reuter,Hans-Richard: Friedensethik. Stuttgart: Kohlhammer 1990, S.145-158.<br />
24 Utz, Arthur-Fridolin - Groner, Joseph-Fulko (Hrsg.): Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens.<br />
Soziale Summe Pius XII., Band 2. Freiburg (Schweiz): Paulusverlag 1954, Nr. 3494, S.1783.<br />
25 S. Anm. 24, Nr. 4152 f., S. 2141 f.<br />
26 Gundlach, Gustav: Die Lehre Pius' XII. vom modemen Krieg, in: Stimmen der Zeit, Band. 164 (1959), S. <strong>13</strong>. <br />
Vgl. auch Hirschmann, Johannes: Kann atomare Verteidigung sittlich gerechtfertigt werden? In: Stimmen der<br />
Zeit, Band 162 (1958), S. 284-296.<br />
27 S. Anm. 24, Nr. 2366, Band 1, S.1177 f.<br />
28 S. Anm. 24, Nr. 5364, Band 3, S. 3146 f.<br />
29 Vgl. Pastoralbrief der katholischen Bischofskonferenz der USA über Krieg und Frieden, in: Stimmen der<br />
Weltkirche 19: Bischöfe zum Frieden. Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 1983, S. 5-129.<br />
30 S. Auun. 29, S. 60.<br />
31 S. Anm. 26, S. 8.<br />
32 S.Auun.29,S.63.<br />
33 Johannes XXllI., Die Friedensenzyklika Ilpacem in terris". Freiburg i. Br.: Herder-Bücherei 1963, Nr. 127.'<br />
I'<br />
I<br />
\<br />
34 Weizsäcker, Carl Friedrich von: Christen und die Verhütung des Kriegs im Atomzeitaiter, in: ders.: Der bedrohte<br />
Friede. Politische Aufsätze 1945-1981. München: Hanser 1981, S. 90 f.
an Mr. H. Offhut, Ministerium für Verteidigung, Washington, in: Kursbuch 83, März 1986, S. 49-89; Weizenbaum,<br />
Joseph, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1978, S.<br />
311.<br />
58 S. Anm. 47, S. 263.<br />
59 S.Anm.47,S.263!<br />
60 UNO-Studie, Kernwaffen. S. Anm. 7. S. 117ff.<br />
61 Weizsäcker, Christine und Ernst Ulrich von: Warum Fehlerfreundlichkeit? In: Das Ende der Geduld. Carl<br />
Friedrich von Weiszäckers "Die Zeit drängt" in der Diskussion. München-Wien: Hanser, 1987.<br />
62 Erklärung der 18 Atomwissenschaftler vom 12.4.1957, in: s. Anm. 30, S. 30. - Vgl. Tugendhat; Ernst: Nachdenken<br />
über die Atomkriegsgefahr und warum man sie nicht sieht. Berlin: Rotbuch 1986, S. 35-44.<br />
63 Vgl. zum Folgenden Friedensgutachten 1991, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).<br />
Münster-Hamburg: Lit 1990, s. Anm. 4, S. 3-24.<br />
64 Scheffran, Jürgen - Neuneck, Götz - Altmann, Jürgen -Liebert, Wolfgang: Metamorphosen einer Vision. Kritische<br />
Anmerkungen zu SDI/GPALS, in: Infonnationsstelle Wissenschaft & Frieden, Dossier Nr. 10, Beilage<br />
zum Informationsdienst Wissenschaft & Frieden Nr. 2, <strong>1992</strong>.<br />
65 Liebert, Wolfgang: Proliferationsrisiken durch modeme Nukleartechnologie, in: Müller, Erwin - Neuneck,<br />
Götz (Hrsg.): s. Anm. 9, S. 147-167.<br />
66 Friedensgutachten 1991, s. Anm. 4, S. 2fj4-277.<br />
67S. Anm. 2fj, S. 12; s. Anm. 47, S. 255-265.<br />
68Vgl. Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt a.M.: Insel 1979, S. 86-92. - Zum Vorstehenden insgesamt<br />
vgl. Huber, Wolfgang - Reuter, Hans-Richard: Friedensethik. Stuttgart: Kohlhammer 1990, S. 315-323.<br />
69 UNO-Studie, Kernwaffen, s. Anm. 7.<br />
70 Lübbe, Hermann: Nukleare Abschreckung: Handeln, geschichtliche Lage und die Frage der moralischen Akzeptanz,<br />
in: s. Anm. 40, S. 222.<br />
71 Stürmer, Michael: Nukleare Abschreckung und politische Kultur: Die europäische Erfahrung, in: s. Anm. 40, S.<br />
189.<br />
72 Vgl. Bloch, Ernst: Kann Hoffnung enttäuscht werden? In: ders.: Verfremdungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp<br />
1962, S. 211-219.<br />
73 Horkheimer, Max: Gedanke zur Religion, in: ders., Kritische Theorie I. Frankfurt a.M.: S. Fischer 1968, S. 374<br />
376.<br />
74 S.Anm.49.<br />
75 Bloch, Ernst: Widerstand und Friede. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1968, S. 86. - Zur Interpretation der Jesaja<br />
Stelle vgl. s. Anm. 55, S. 35.<br />
76 Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften 10.1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1973, S. 629.<br />
77 Vgl. Neuneck, Götz - Liebert, Wolfgang: s. Anm. 7. - Joint Understanding, in: Arms Control Today, Vol. 22,<br />
No. 5, June <strong>1992</strong>, S. 33.<br />
78 S. Neuneck, Götz - Liebert, Wolfgang: s. Anm. 77.<br />
79 Vgl. Memorandum "Friedenssicherung in den 90er Jahren". Neue Herausforderungen an die Wissenschaft,<br />
herausgegeben von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden e.V. (IWIF), Bonn <strong>1992</strong>.<br />
80 Vgl. Hippel, Frank von - Levi, Barbara G.: Controlling Nuclear Weapons at the Source: Verification of a Cutoffin<br />
the ProductionofPlutonium and Highly Enriched Uranium for Nucle.ar Weapons, in: Tsipis, Kosta u.a.:<br />
59
Ausgewählte Literatur<br />
61<br />
Aktion SübnezeichenIFriedensdienste (Hrsg.): Christen im Streit um den Frieden. Beiträge zu einer neuen Friedensethik.<br />
Positionen und Dokumente. Freiburg: Treisam 1982.<br />
Anders, Günther: Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen. München: C.H. Beck 1981.<br />
Apel, Karl-Otto: Konfliktlösung im Atomzeitalter. In: Mensch, Natur, Gesellschaft. Zeitschrift zur internationalen<br />
wissenschaftlichen und kulturellen Verständigung, Jg. 3/1986.<br />
Bastian, Till: Naturzerstörung: Die Quelle der künftigen Kriege.Eine Studie der internationalen Ärzte für die<br />
Verhütung des Atomkrieges (IPPMW). Heidesheim 1991 (2.Auflage).<br />
Bender, Wolfgang: Zur Diskussion in der katholischen Kirche um Frieden und Abrüstung. In: Burkhardt, Armin:<br />
Hochschule und Rüstung. Ein Beitrag von WlSsenschaftlem der Technischen Hochschule Darmstadt<br />
zur ("Nach"-) Rüstungsdebatte. Darmstadt: Darmstädter Blätter 1984.<br />
Bensberger Kreis (Hrsg.): Frieden - Für Katholiken eine Provokation? Ein Memorandum. Reinbek: Rowohlt<br />
1982.<br />
Bemhardt, Ute - Rubmann, Ingo (Hrsg.): Ein sauberer Tod. Informatik und Krieg. Schriftenreihe Wissenschaft<br />
und Frieden Nr. 15, Nov. 1991. Herausgegeben für das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche<br />
Verantwortung i.V. (FIFF). 5300 Bonn 1, Reuterstr. 44.<br />
Bewußt-Sein für den Frieden. 1. Friedenskongress Psychosozialer Berufe. Herausgegeben von Gerhard BoIm u.a.<br />
in Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie, der Deutschen Gesellschaft<br />
für Verhaltenstherapie und der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie. Weinheim:<br />
Beltz 1983.<br />
Bewußtsein und Widerstand. Ausgewählte Beiträge vom 2. Friedenskongress Psychologie, Psychosoziale Berufe.<br />
Herausgegeben von Wilfried Belschner ll.a. in Verbindung mit der Gesellschaft für wissenschaftliche<br />
Gesprächspsychotherapie (GwG). Frankfurt a.M.: Haak und Herchen 1985.<br />
Böckle, Franz - Krell, Gert (Hrsg.): Politik und Ethik der Abschreckung. Beiträge zur Herausforderung der Nuklearwaffen.<br />
Mainz - München: Grünewald - Kaiser 1984. -<br />
Brock, Lothar: Die Ohnmacht der Mächtigen. Zur Bedeutung des Militärischen in den Nord-Süd-Beziehungen.<br />
In: Eicher, Peter - Mette, Norbert (Hrsg.): Auf der Seite der Unterdrückten? Theologie der<br />
. Befreiung im Kontext Europas. Düsseldorf: Patmos 1989.<br />
Burkbardt, Armin (Hrsg.): Hochschule und Rüstung. Ein Beitrag von Wissenschaftlemder Technischen Hochschule<br />
Darmstadt zur ("Nach"-) Rüstungsdebatte. Darmstadt: Darmstädter Blätter 1984.<br />
Czempiel, Ernst-Otto: Friedensstrategien: Systemwandel durch intemationale Organisationen, Demokratisierung<br />
und Wirtschaft. Paderbom: Schöningh 1986.<br />
ders.: Pax Universalis. Variationen über das Thema der neuen Weltordnung. In: Merkur. 46. Jg. (<strong>1992</strong>). S. 680-693.<br />
ders.: Konturen einer Gesellschaftswelt. Die neue Architektur der intemationalen Politik. In: Merkur, Okt.lNov.<br />
1990. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 835-851.<br />
Das Ende der Geduld. Carl-Friedrich von Weizsäckers·"Die Zeit drängt" in der Diskussion. München: Hanser<br />
1967.<br />
Diefenbacher, Hans - Moltmaon, Bernhard (Hrsg.): Zum Verhältnis von Frieden und Sicherheit. Heidelberg: Forschungsstätte<br />
der Evangelischen Studiengemeinschaft 1991.<br />
Dietze, Anita und Walter (Hrsg.): Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um. 1800. Leipzig-Wei-
Haunhorst, Benno: Kritik. einer ethischen Rechtfertigung der Abschreckung. In: Frankfurter Hefte, Jg. 38 (1983),<br />
Heft 3. S. 17-27.<br />
Henrich, Dieter: Ethik zum nuklearen Frieden. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990.<br />
Horn, Klaus: Gewalt - Aggression - Krieg. Baden-Baden 1988. Bd. <strong>13</strong> der Schriftenreihe der AG für Friedens- und<br />
Konfliktforschung.<br />
Horstmann, Ulrich: Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht. Wien: 1983.<br />
Huber, Wolfgang - Reuter, Hans-Richard: Friedensethik. Stuttgart: Kohlhammer 1990.<br />
Jannsen, Wilhelm: Art. Friede. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen<br />
Sprache in Deutschland, Bd. 2. Stuttgart: KIett-Cotta 1979. S. 543-591.<br />
Jaspers, Karl: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Ein Radiovortrag. München: Piper 1957.<br />
Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden. Ein politischer Entwurf. Stuttgart: Reclam 1961.<br />
Kaufmann, Arthur: Gerechtigkeit - der vergessene Weg zum Frieden. München: Piper 1986.<br />
Kornwachs, Klaus (Hg.): Offenheit - Zeitlichkeit - Komplexität. Zur Theorie der offenen Systeme. Frankfurt a.M.,<br />
New York: Campus 1984.<br />
Krusewitz, Knut: Ökologische Kritik der Abschreckung. In: Wissenschaft & Frieden 3/1989. S. 36-41.<br />
Koog, Hans: Projekt Weltethos. München - Zürich: Piper 1990.<br />
Lutz, Dieter S.: Neue Friedenspolitik. Ein System kollektiver Sicherheit in und für Europa. In: Concilium. 28. Jg.<br />
(<strong>1992</strong>), Heft 2. S.147-153.<br />
Mettner, Matthias: Art. Frieden. In: Eiche~ Peter (Hrsg.): Neues Handbuch Handbuch theologischer Grundbegriffe.<br />
Bd.l. München: Kösell984. S. 404-431.<br />
Metzler, Helmut: Untersuchungen zur Struktur des Friedensbegriffs im Alltagsdenken.lJi: BeWUßtsein für den<br />
Frieden. Rundbrief der Friedensinitiative Psychologie. Psychosoziale Berufe e.V. Marburg. Sonderausgabe<br />
Dez. 1989.<br />
Mokrosch, Reinhold: Christen vor der Friedensfrage. Die Diskussion in evangelischen Kirchen über Friede und<br />
Abrüstung. In: Burkhardt, Armin (Hrsg.): Hochschule und Rüstung.Ein Beitrag von Wissenschaftlern<br />
der Technischen Hochschule Darmstadt zur ("Nach"-) Rüstungsdebatte. Darmstadt: Darmstädter<br />
Blätter 1984.<br />
Moltmann, Bemhard (Hrsg.): Perspektiven der Friedensforschung. Baden-Baden: Nomus 1988. Bd. 15 der<br />
Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung.<br />
Negt, Oskar - Kluge, Alaander: Maßverhältnisse des Politischen. Fünfzehn Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen.<br />
Frankfurt a.M.: S. Fischer <strong>1992</strong>. Darin besonders: Golfkrieg und Politik. Abstraktionsfähigkeit<br />
konkreter Gewalt - ideologische Bilder mit hohem Gefühlswert - gegen die militärische Kriegslogik. S.<br />
171-191.<br />
Nerlich, Uwe • RendtortT, Trutz (Hrsg.): Nukleare Abschreckung. Politische und ethische Interpretationen einer<br />
neuen Realität. Baden-Baden 1989.<br />
Pastoralbriefder Katholischen Bischofskonferenz der USA über Krieg und Frieden: Die Herausforderung des<br />
Friedens - Gottes Verheißung und unsere Antwort. In: Stimmen der Weltkirche 19. Herausgegeben<br />
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1983.<br />
Pfeifer, Hans (Hrsg.): Frieden - Das unumgängliche Wagnis. Die Gegenwartsbedeutung der Friedensethik Dietrich<br />
Bonhoeffers. München: Kaiser 1982.<br />
63
65<br />
ders.: Der Golfkrieg, Deutschland und Israel (1991). In: Ders.: Ethik und Politik. Vorträge und Stellungnahmen<br />
aus den Jahren 1978-1991. Frankfurt a.M.: Surhkamp <strong>1992</strong>. S. 98-115.<br />
ders.: Nachdenken über die Atomkriegsgefahr und warum man sie nicht siehr. Berlin: Rotbuch 1986.<br />
UNO-Studie: Kernwaffen. Vollständiger Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. "General and complete<br />
disarmament: comprehensive study on nuclear weappons. Report of the secretary-general. München:<br />
C.H. Beck 1982.<br />
Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.): Streitfall Frieden. Positionen und Analysen zur Sicherheitspolitik und Friedensbewegung.<br />
Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag 1984.<br />
ders. (Hrsg.): Angst vorm Frieden. über die Schwierigkeiten der Friedensentwicklung für das Jahr 2000. Darmstadt:<br />
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1989.<br />
ders.(Hrsg.): Mut zum Frieden. über die Möglichkeiten einer Friedensentwicklung für das Jahr 2000. Darmstadt:<br />
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990.<br />
Von der Ohnmacht und Notwendigkeit des Religiösen. Regensburg: Pustedt 1982.<br />
Waas, Lothar: Problembereiche einer Ethik der nuklearen Abschreckung. In: Zeitschrift für Politik, Jg. 32 (1985).<br />
S.44-88.<br />
Wasmuth, U1rike C. (Hrsg.): Friedensforschung. Eine Handlungsorientierung zwischen Politik und Wissenschaft.<br />
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1991.<br />
Weizsäcker, Carl Friedrich von: Der bedrohte Friede. Politische Aufsätze 1945-1981. München: Hanser 1981.<br />
ders.:. Die Zeit drängt. Eine Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der<br />
Schöpfung. München: Hanser 1986.<br />
ders.: Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung. München: Hanser<br />
1979.<br />
ders.: Friede - Gerechtigkeit - Bewahrung der Schöpfung. In: Universitas 9/1989.<br />
W1schnath, Rolf (Hrsg.): Frieden als Bekenntnisfrage. Zur Auseinandersetzung um die Erklärung des Moderamens<br />
des Reformierten Bundes "Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der<br />
Kirche". Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1984.<br />
Zimmerli, Walther Ch.: Die Ambivalenz des bewaffneten Friedens. Ist die beste oder die zweitbeste Lösung<br />
''besser''? In: Universitas 12/1989. S. 1185-1195.
Damit ist der "Lebenshorizont" der Friedensethik angedeutet. Darüberhinaus lassen sich Richtungsangaben fiir<br />
Friedenshandeln im engeren Sinn machen.<br />
67<br />
~.<br />
Das unschuldige Opfer eines Angriffs hat das Recht, sich wirkungsvoll und angemessen zu wehren. Andere haben<br />
die Pflicht, ihm beizustehen - auch durch Anwendung von Gewalt gegen den Angreifer. Dies gilt für Einzelne, für<br />
Sippen, Gesellschaften und Völker. Voraussetzung für die Anwendung von Waffengewalt - die Rede ist jetzt von<br />
"konventionellen" Waffen - ist, daß alle anderen Mittel wirkungslos geblieben sind.<br />
Die Erfahrungen zeigen allerdings, daß militärische Einsätze möglicherweise zwar zu einem WatTenstillstand, der<br />
permanenter Überwachung bedarf, nicht aber zu einem Friedenszustand führen. Dies dürfte auch für<br />
"friedensstiftende Militärmissionen" aufgrund von UNO-Beschlüssen und unter UNO-Führung gelten.<br />
Deshalb sind gewaltfreie friedensfördemde Aktionen dringlicher als militärische Eingriffe. Sie folgen der an und<br />
für sich alten Einsicht, die in der Gegenwart immer wieder neu bestätigt wird, daß mit Gewalt der "Spirale der<br />
Gewalt" nicht Einhalt geboten werden kann, daß vielmehr gilt: "Friede ist derWeg" (M. Gandhi). Solche Aktionen<br />
sind die Sache von Einzelnen, Gruppen, Gemeinschaften, sozialen Bewegungen. Der Staat sollte deren Vorhaben<br />
z.B. durch Förderung der Friedenserziehung oder der Ausbildung für gewaltfreie Aktionen unterstützen.<br />
Zusammengefaßt: Die Friedensethik muß sich zweifellos der Frage stellen, wie angesichts brutaler Gewaltverhältnisse<br />
möglicherweise nur durch Gewaltanwendung noch Schlimmeres verhütet werden kann. Ein befriedeter Status<br />
quo aber ist nicht das Ziel der Friedensethik. Sie denkt über diesen hinaus auf das versöhnte Zusammenleben<br />
aller hin.
• IANUS-7/1990: Kathryn Nixdorff und Isolde Stumm, "Ambivalence of Basic Medical Research Using<br />
Techniques of Genetic Engineering for the Development of Vaccines"<br />
• IANUS-8/1990: Isolde Stumm und Wolfgang Bender, "Was treibt die Rüstungsdynamik voran? -<br />
Ein Einstieg in dieses Thema im Hinblick auf biologische Waffen"<br />
• IANUS-9/1990: Isolde Stumm, "Gentechnologie und Biowaffen"<br />
• IANUS-I0/1990: Martin Kalinowski, "Technical Problems with Safeguarding Tritium"<br />
• IANUS-ll/1990: IANUS-Arbeitsbericht "Erfahrungen mit drei interdisziplinären Seminaren"<br />
• IANUS-12/1990: Achim Seiler, "Neue Technologien und Rüstungskonversion"<br />
• IANUS-<strong>13</strong>/1990: Wolfgang Liebert, Martin Kalinowski, Götz Neuneck, "Technologische Möglichkeiten<br />
des Irak für eine Kernwaffe"<br />
• IANUS-l/1991: Lars CoIschen, Martin Kalinowski, "Die Kontrolle der militärischen Nutzung von<br />
Tritium"<br />
• IANUS-2/1991: Lars Colschen, Martin Kalinowski, Jan Vydra, "National Regulations of Accounting<br />
for and Control of Tritium"<br />
• IANUS-3/1991: Jürgen Scheffran, Jan Vydra, "The Application of Military-Related Resources to<br />
Protect the Enviroment"<br />
• IANUS-4/1991: Ulrike Benner, "Verantwortungsbegriffe und Verantwortungskonzepte"<br />
• IANUS-5/1991: Markus Jathe, Jürgen Scheffran, "Zivile und militärische Anwendungen Neuronaler<br />
Netze"<br />
• IANUS-6/1991: Martin Kalinowski, Andre Anders, "Fusionsenergie - Sichere und ökologisch<br />
verträgliche Energie der Zukunft?"<br />
• IANUS-7/1991: Isolde Stumm, Kathryn Nixdorff, "Haben Toxinwaffen militärische Relevanz?"<br />
• IANUS-8/1991: Wolfgang Liebert, "Ambivalenz der Naturwissenschaft und Notwendigkeit von Wissenschaftsfolgenforschung"<br />
• IANUS~9/1991:<br />
Wolfgang Bender, "Erhaltung und Entfaltung als Kriterien für die Gestaltung von<br />
Wissenschaft und Technik" (+ english translation: "Preservation and Development as Central Ideas<br />
for Designing Science and Technology")<br />
• IANUS-I0/1991: Axel Schrader, "Militärausgaben und wirtschaftliche Entwicklung in der Dritten<br />
Welt"<br />
• IANUS-l1/1991 Wilfried Engelmann, "Conditions for Disarmament - Game Theoretic Models of<br />
Superpower Conftict"<br />
• IANUS-l/<strong>1992</strong> Achim Seiler, "Bericht von der 41. Pugwash Konferenz"<br />
• IANUS-2/<strong>1992</strong> Wolfgang Liebert, "Risks of Horizontal and Vertical Proliferation of Emerging Nuclear<br />
Technologies - The Case of Laser Isotope Separation"<br />
• IANUS-3/<strong>1992</strong> Achim Seiler, "Technology Transfer or Technology Embargo ?"<br />
• IANUS-4/<strong>1992</strong> Markus Jathe, Jürgen Scheffran, "Security, Stability and Costs in the Armament<br />
Dynamics: The SCX-Model Framework"