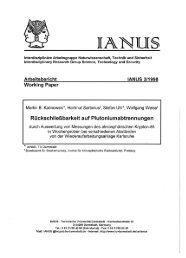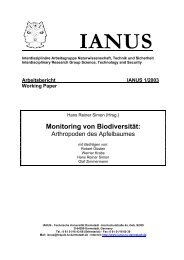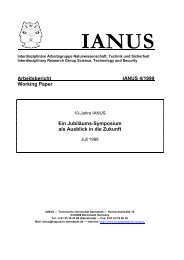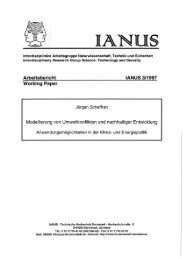ianus 6/1997
ianus 6/1997
ianus 6/1997
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
][AN1U[§<br />
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit<br />
Interdisciplinary Research Group Science, Technology and Security<br />
Arbeitsbericht<br />
Working Paper<br />
IANUS 6/<strong>1997</strong><br />
Kathryn Nixdorff<br />
Gefährdung durch biologische Agenzien<br />
und<br />
Die Biologische-Waffen-Konvention<br />
IANUS - Technische Universität Oarmstadt - Hochschulstraße 10<br />
0-64289 Oarmstadt, Germany<br />
Tel.: 061 51/164368 (Sekretariat) - Fax: 061 51/16 60 39<br />
Mail: IANUS @hrzpub.th-darmstadt.de - Internet: http://www.th-darmstadt.de/ze/<strong>ianus</strong>
1<br />
Kathryn Nixdorff<br />
GeIährdungen durch biologische Agenzien<br />
Die Mikrobiologie ist eine relativ junge Wissenschaft, die erst seit dem Ende des 19.<br />
Jahrhunderts etabliert wurde. Ein vorsätzlicher Einsatz von infektiösen Mikroorganismen als<br />
biologische Waffen zum Zeitpunkt des Ersten Weltkrieges war noch nicht realisierbar.<br />
Militärisches Interesse an potentiellen biologischen Waffen erreichte erstmals einen Höhepunkt<br />
in den Jahren gerade vor und während des Zweiten Weltkrieges. Es wurden von den Alliierten<br />
(insbesondere USA, Großbritannien) aber auch von Japan viel Energie und erhebliche<br />
finanzielle Mittel in die Erforschung, Entwicklung und Produktion von biologischen Waffen<br />
investiert!.<br />
Es wurde jedoch schnell erkannt, daß solche Kampfstoffe, von militärischem Standpunkt aus<br />
betrachtet, große Unzulänglichkeiten aufweisen 2 . Die hervorstechendste Eigenschaft<br />
infektiöser Krankheitserreger ist ihre Unberechenbarkeit; es ist praktisch unmöglich, sie präzise<br />
einzusetzen oder ihre Wirkung zu kontrollieren. Mit Ausnahme japanischer Angriffe aufChina<br />
zwischen 1940 und 1944 3 kamen biologische Waffen offenbar nicht zum Einsatz. Gegen Ende<br />
der sechziger Jahren konnte ein generelles Desinteresse der Militärs an biologischen Waffen<br />
registriert werden, das primär durch die Nachteile, die mit ihrer Anwendung assoziiert werden,<br />
hervorgerufen wurde.<br />
Ohne Zweifel war dies eine Ursache der politischen Entwicklung, die zu der 1972 vereinbarten<br />
Konvention über biologische Waffen (BWCt, die 1975 in Kraft getreten ist, gefuhrt hat 5 . Da<br />
biologische Waffen zu diesem Zeitpunkt als keine. aktuelle Bedrohung betrachtet wurden,<br />
konnte die Konvention vereinbart werden, allerdings ohne daß effektive<br />
Verifikationsmaßnahmen inkorporiert wurden 6 . Femer beinhaltet das Abkommen einige<br />
Unklarheiten. In Artikel I verbietet die BWC die Entwicklung, Herstellung und Lagerung<br />
biologischer Agenzien oder Toxine "o/types andin quantities that have nojustijicationfor<br />
prophylactic, protective or other peace/ulpurposes." Somit sind die Verbote sehr breit und<br />
umfassend formuliert, um alle möglichen Situationen zu decken. Gleichzeitig jedoch erschwert<br />
das Fehlen klarer Angaben zu Art und Mengen der Agentien, die fur erlaubte Zwecke<br />
gerechtfertigt werden, sowohl das Deklarations- als auch das Überprüfungsverfahren erheblich.<br />
Ein weiterer Problembereich liegt im potentiellen Konflikt :z
2<br />
Zwischenzeitlich sind diese Schwächen der BWC offensichtlicher geworden. Zum einen hat<br />
sich der Status von biologischen Waffen geändert. Mit der Revolution in der Biotechnologie,<br />
die auch die Entwicklung der Gentechnik beinhaltet, wurden.Befurchtungen geschürt, daß in<br />
vollkommener Entsprechung militärischer Anforderungen neue, effektivere biologische Waffen<br />
entwickelt werden können. Ob solche Ziele beim gegenwärtigen Stand der Entwicklungen<br />
realisierbar sind, ist noch eine offene Frage. Nichtsdestoweniger werden biologische Waffen<br />
seit der Entwicklung der Gentechnik als eine aktuelle Bedrohung empfunden 7 . Ebenso haben<br />
die Erfahrungen, die im Golfkrieg iesammelt wurden, das Augenmerk aufdie Aktualität einer<br />
biologischen Kriegfuhrung gelenkt . Darüberhinaus hat Präsident Boris Yeltsin zugegeben, daß<br />
die frühere Sowjet Union in der Zeit von 1946 bis März 1992 ein offensives biologisches<br />
Watfenprogramm gefuhrt hat 9 , und.es wird. vermutet, daß mindestens zehn Staaten weiterhin<br />
offensive biologische Waffenkapazitäten entwickeln10.<br />
Solche Überlegungen haben ernsthaften Zweifel an der Effektivität einer biologischen<br />
Waffenkonvention ohne unterstützende Verifikationsmaßnahmen erweckt 11 . In diesem<br />
Zusammenhang bemüht sich eine Ad Hoc Gruppe, die allen Vertragsstaaten offen steht,<br />
konkrete Vorschläge zur Stärkung der Konvention zu unterbreiten..Es ist vorgesehen, daß<br />
diese Vorschläge in einem Protokoll mit rechtsverbindlichem Charakter zur Konvention<br />
hinzugefügt werden. Das Mandat der Ad Hoc Gruppe umfaßt die Diskussion folgender<br />
Aspekte 12 :<br />
• Definitions 0/terms and objective criteria, such as lists 0/bacteriological (biological)<br />
agents and toxins, their threshold quantities, as weil as equipment and types 0/activities,<br />
where relevanttor specific measures designed to strengthen the convention;<br />
• The incorporation 0/existing andfurther enhanced confidence building andtransparency<br />
measures, as appropriate, into the regime;<br />
• A system 0/measures to promote compliance with the Convention, including, as<br />
appropriate, measures identified, examined and evaluated in the VEREXReport. Such<br />
measures shouldapply to all relevantfacilities andactivities, be reliable, cost effective,<br />
non-dicriminatory and as non-intrusive aspossible, consistent with the effective<br />
implementation 0/the system andshould not lead to abuse;<br />
• Specific measures designedto ensure ejjective andfull implementation 0/Article X which<br />
also avoid any restrictions incompatible with the obligations undertaken under the<br />
Convention, noting that the provisiopns 0/ the Convention shouldnot be used to impose<br />
restrictions and/or limitations on the transfer/or purposes consistent with the objectioves<br />
and the provisions 0/the convention 0/scientific knowledge, technology, equipment and<br />
materials.<br />
7 S. Wright: New designs for biological weapons, in: Bulletin ofthe Atomic Scientists Jan./Feb., 1987, S. 43<br />
46.<br />
8 1. Tucker: Biological weapons proliferation concems, in: G.S. Pearson (Hrsg.), New Scientific and .<br />
Technological Aspects ofVerification ofthe Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), Kluwer<br />
academic publishers, Dordrecht, in preparation (paper presented at the NATO Advanced Study Institute,<br />
Budapest, Hungary July 6-16, <strong>1997</strong>).<br />
9 lT. Dahlberg: Russia admits violating biological weapons pact, in: The Los Angeles Times, Washington<br />
Edition, 15 September, 1992.<br />
10 lS.McCain: Proliferation in the 1990s: Implications for US policy and force planing, in: Military<br />
Technology, Vol. 1190, 1990, S. 262-267.<br />
11 M. Moodie: Bolstering compliance with the Biological Weapons Convention. Prospects for the Special<br />
Conference, in: Chemical Weapons Convention Bulletin, Issue No. 25, 1994, S. 1-3.<br />
12 United Nations: Final Report. Special Conference ofthe States Parties to the Convention on the Prohibition<br />
ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on<br />
their Destruction, Geneva, 19-30 September, 1994. BWC/SPCONF/l.
3<br />
Die Verhandlungen der Ad Hoc Gruppe haben in July <strong>1997</strong> den Übergang zu einer rolling<br />
text-Fonn des Protokolls vollzogen 13 • ,< ~<br />
In den folgenden Ausführungen werden die Gefährdungen durch biologische Agenzien erörtert,<br />
insbesondere unter den Aspekten der neueren Entwicklungen in der Biotechnologie. In diesem<br />
Zusammenhang wird aufdie zeitgemäße Charakterisierung von Biotechnologie in Artikel 2 der<br />
Convention on BiologicalDiversity14 hingewiesen:<br />
'Biotechnology' meansany technological application that uses biologicalsystems, living<br />
organisms, or derivatives thereof, to make or modifyproducts orprozessesfor specijic use. "<br />
1. Kategorien biologischer Waffen<br />
Verschiedene Kategorien biologischer Agenzien werden als potentielle biologische Waffen<br />
genannt:<br />
1. Bakterien<br />
2. Viren<br />
3. Pilze<br />
4. Protozoen<br />
5. Tierische Überträger<br />
6. Toxine<br />
Die ersten vier Gruppen bestehen aus Mikroorganismen. Die Mehrzahl der Mikroorganismen<br />
sind gutartig und bereichern unser Leben. Potentielle biologische Waffen sind dagegen die<br />
spezifischen infektiösen Erreger innerhalb jeder Gruppe der Mikroorganismen. Die fünfte<br />
Gruppe wird von Tieren gebildet, zumeist Insekten wie Mücken, Zecken und Fliegen, die als<br />
Überträger krankheitsverursachender Mikroorganismen fungieren können. Die Toxine sind<br />
nicht-lebende, giftige Produkte von Mikroorganismen, Pflanzen oder Tieren. Da diese Stoffe<br />
zwar eine toxische, aber keine infektiöse Wirkung haben, sind sie den chemischen<br />
Kampfstoffen sehr·ähnlich. Mit der zweiten Überprüfungskonferenz der BWC 1986 15 wurden<br />
Unklarheiten bezüglich der Zugehörigkeit.der Toxine zur BWC beseitigt. Es gilt die<br />
Festlegung, daß Toxine mikrobiologischer, tierischer oder pflanzlicher Art sowie ihre<br />
synthetischen Entsprechungen den Regelungen der BWC unterliegen. Außerdem unterliegen<br />
die Toxine den Regelungen der Konvention über chemische Waffen (CWC)16, die April <strong>1997</strong><br />
in Kraft getreten ist.<br />
2. Die Eigenschaften biologischer Waffen<br />
Unter bestimmten Gesichtspunkten sind biologische den chemischen Waffen sehr ähnlich.<br />
Sowohl Mikroorganismen als auch chemische Substanzen können mit Hilfe von Aerosolen<br />
über große Gebiete verteilt werden. Der Einsatz beider Waffenarten bewirkt in gleicher Weise<br />
starke psychologische Effekte, insofern als sie nahezu unsichtbar sind und dabei Ängste sowie<br />
Demoralisierungswirkungen hervorrufen. Darüberhinaus besitzen infektiöse Krankheitserreger<br />
als potentielle biologische Kampfstoffe charakteristische Eigenschaften, die sie von chemischen<br />
13 United Nations: Rolling Text ofa Protocol to the Convention on the Prohibition ofthe Development,<br />
Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,<br />
Geneva 14 luly - 1 August <strong>1997</strong>, BWC/AD HOC GROUP/35.<br />
14 United Nations: Convention on Biological Diversity, 5 lune 1992, copy available in Internet www.unep.ch.<br />
15 United Nations: Final Document. The Second Review Conference of the Parties to the Convention on the<br />
Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons<br />
and on their Destruction, Geneva 8-26 September 1986, BWC/CONF.II/13.<br />
16 United Nations: Convention on the Prohibition ofthe Development, Production, Stockpiling and Use of<br />
Chemical Weapons and on thir Destruction, United Nations 93-0507, 1993.
4<br />
Waffen unterscheiden und gleichzeitig ihre militärische Anwendbarkeit einschränken. Die<br />
folgende Darstellung der Eigenschaften biologischer Waffen istin diesem Kontext weitgehend<br />
aus einer frühen, umfassenden Arbeit von Theodore Rosebury und Elvin A. Kabat l7<br />
genommen.<br />
Die Inkubationszeit: Es verstreicht eine bestimmte Zeitspanne zwischem dem Kontakt mit dem<br />
Erreger und dem ersten Auftreten von Symptomen. Diese Inkubationszeit kann mehrere Tage<br />
dauern. Bei dem Einsatz chemischer Waffen ist der Zeitraum sehr viel kürzer.<br />
Das Epidemierisiko: Die meisten infektiösen Erreger haben die Eigenschaft, sich von einem<br />
Träger aus über ein weites Gebiet zu verbreiten. Die präzise Eingrenzung aufeinen bestimmten<br />
geographischen Raum ist damit praktisch unmöglich.<br />
Die Infektivität: Die Infektivität ist definiert als die Frequenz innerhalb derer ein Erreger den<br />
Ausbruch von Krankheitssymptomen in einer Gruppe von Individuen bewirkt. Sie schränkt so<br />
die militärische Anwendung solcher Waffen in hohem Maße ein, denn sie ist abhängig von<br />
Bedingungen, die außerhalb des Labors nicht präzise zu bestimmen sind.<br />
Die Persistenz (Lebensdauer): Einige wenige infektiöse Erreger besitzen eine relativ lange<br />
Lebensdauer in der natürlichen Umwelt. Dazu gehören Mikroorganismen, die Endosporen<br />
produzieren und diejenigen, die von tierischen Überträgern verbreitet werden. Aber auch die<br />
lange Lebensdauer potentieller Infektionserreger ist aus militärischer Sicht nicht unbedingt<br />
vorteilhaft.<br />
Die Instabilität: Mit Ausnahme der gerade·genannten - wenigen - Mikroorganismen sind die<br />
meisten Erreger sehr instabil. Außerhalb des Wirtes verlieren diese labilen Organismen sehr<br />
schnell ihre Infektivität. Sie besitzen eine nur kurze Lebensspanne. Auffällig ist das<br />
Wechselverhältnis zwischen langer Lebensdauer und Instabilität. Stabile Erreger sind sehr<br />
leicht zu verbreiten. Ihre Lebensdauer kann aber auch einen gewünschten Zeitraum<br />
übersteigen. Dieses Problem stellt sich nicht bei instabilen Erregern, die dafiir wiederum<br />
schwer zu verbreiten sind.<br />
Die Retroaktivität: Dank des von ihnen ausgehenden Epidemierisikos, ihrer Infektivität und<br />
ihrer Lebensdauer können biologische Waffen, eher noch als chemische Kampfstoffe, leicht auf<br />
den Anwender selbst zurückwirken. Staaten, die eine biologische Kriegsfiihrung erwägen,<br />
müssen über ein entsprechendes Gegenmittel verfugen, oder in Kaufnehmen, daß<br />
kontaminierte Gebiete über einen bestimmten Zeitraum nicht besetzt werden können.<br />
3. Einsatzsysteme<br />
Biologische Agenzien können durch Bomben oder durch Sprühbehälter mit Einrichtungen, die<br />
Aerosole erzeugen können, eingesetzt werden l8 . Bomben haben den Vorteil, daß sie das<br />
Zielgebiet mit Agenzien relativ präzise sättigen können, auch wenn die meterologischen<br />
Verhältnisse ungünstig sind. Viele biologische Kampfstoffe eignen sich jedoch schon aufgrund<br />
ihrer Temperaturempfindlichkeit nicht rur einen solchen Einsatz im Konfliktfall.<br />
Aerosole sind Suspensionen oder Dispersionen kleiner Partikel (fest .oder flüssig) in Gas (Luft).<br />
Aerosole, die durch Sprühtanks erzeugt werden, sind fiir biologische Agenzien schonender als<br />
Bomben und können durch Flugzeuge, Helicopter, Schiffe oder auch Feldfahrzeuge abgesetzt<br />
werden. Ein solcher Einsatz kann jedoch besonders durch die meteorologischen Verhältnisse<br />
beeinflußt werden. Wenn z.B. der Wind eine Geschwindigkeit von weniger als 8 km/h hat,<br />
werden die Aerosole nicht effektiv genug verbreitet werden. Wenn dagegen die<br />
17 T. RoseburylE.A. Kabat, a.a.O. (Anm. 2).<br />
18 W.C. Patrick III: Biological warfare: an overview, in: K.C. Bailey (Hrsg.), Directors Series on Proliferation,<br />
Vol. 4, Lawrence Livennore National Laboratory 1994, S. 1-7.
5<br />
Windgeschwindigkeit höher als 50 km/h ist, werden die Aerosole aufgelöst und zerstreut 19 .<br />
Auch die Form der Aerosole spielt eine bedeutende Rolle. Partikel mit einem Durchmesser<br />
zwischen 0,5 und 5 Mikrometer können am besten in den Lungen zurückgehalten werden und<br />
dort einwirken. Kleinere Partikel werden ausgeatmet und größere Partikel werden im Nasenund<br />
Rachenraum zurückgehalten und gelangen dadurch nicht in die Lungen 2o • Der offensive<br />
Einsatz infektiöser Wolken ist sehr eng verknüpft mit der entsprechenden Technologie,<br />
Aerosole mit feinen Partikeln zu erzeugen. Es soll an dieser Stelle bemerkt werden, daß die<br />
MehrzaW der infektiösen Krankheitserreger als auch der Toxine ihre Wirkungen ausüben<br />
können, wenn sie über die Atmungswege aufgenommen werden 21 .<br />
4. Produktion biologischer Agenzien<br />
Es ist charakteristisch rur viele Mikroorganismen, daß sie schnell und relativ einfach gezüchtet<br />
werden können, auch wenn die Ausgangskultur nur geringe ZaWen von Zellen beinhaltet. Diese<br />
Eigenschaft von Mikroorganismen, sich rapide vermehren zu können, ist von besonderer<br />
Bedeutung im Hinblick aufdie Nutzung von biologischen Agenzien rur nicht-friedliche<br />
Zwecke. Häufig werden jedoch Mikroorganismen in diesem Kontext pauschal betrachtet,<br />
obwohl es erhebliche Unterschiede bezüglich des Aufwands und der Schnelligkeit bei der<br />
Züchtung verschiedener Mikroorganismen gibt. Um diese Aspekte diskutieren zu können,<br />
sollen einige Kategorien von Agenzien betrachtet werden, die rur die BWC besonders relevant<br />
sind. Die Ad Hoc Gruppe, die Verhandlungen über ein Verifikationsprotokoll zur BWC ruhrt,<br />
diskutiert gegenwärtig über eine Liste von biologischen Agenzien, die aufMenschen pathogen<br />
wirken (Tabelle 1). Diese Liste ist nicht erschöpfend, kann aber möglicherweise als eine<br />
Unterstützung rur Deklarationen und Verifikationszwecke benutzt werden 22 . Es sollte bemerkt<br />
werden, daß die Ad Hoc Gruppe auch Listen von Agenzien diskutiert, die aufTiere und<br />
Pflanzen pathogen wirken. Dies ist in Anerkennung der Tatsache, daß biologische<br />
Kriegruhrung auch gegen Tiere und Pflanzen gerichtet werden kann. In der Liste in Tabelle 1,<br />
umfassen die relevanten Kategorien Viren, Bakterien, Rickettsien, Pilze und Toxine.<br />
5. Vermehrung von Bakterien und Viren<br />
Bakterien gehören zu den kleinsten Lebewesen. Sie vermehren sich durch Zweiteilung, und<br />
einige haben eine besonders kurze Generationsdauer (die Zeit, die zur Zellteilung benötigt<br />
wird). Escherichia coli ist eines der am schnellsten wachsenden Bakterien, und hat eine<br />
Generationsdauer von etwa 15 Minuten unter den besten Kulturbedingungen.. Obwohl es<br />
gewiß große Unterschiede in der Generationsdauer unter den Bakterien gibt, können alle in<br />
Tabelle 1 aufgelisteten relativ schnell wachsen. Dies gilt sogar rur Clostridium botulinum, das<br />
in Abwesenheit von Sauerstoff: das es nicht gut verträgt, gezüchtet werden muß. Eine<br />
Ausnahme bildet Chlamydia psittaci. Dieses Bakterium kann eine bestimmte Sorte von<br />
Stoffwechselkomponenten, die rur biosynthetische Vorgänge benötigt werden, nicht selbst<br />
19 Ebenda<br />
20 D.R. Franz: Physical and medical countermeasures to biological weapons, in: K. C. Bailey (Hrsg.), Directors<br />
Series on Proliferation, Vol. 4, Lawrence Livermore National Laboratory 1994, S. 55-65.<br />
21 Bundesamt für Zivilschutz: Zivilschutz. Gefahren aus der Retorte. Gesundheitliche Aspekte bei chemischen<br />
und biologischen Kampfmittel, Band 6, BZS-Schriftenreihe, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Mönch,<br />
Bonn 1975; E. Geißler: Changing TW status, in: ders. (Hrsg.), Biological and Toxin Weapons Today, SIPRI,<br />
Oxford University Press, Oxford, 1986, S. 36-56.<br />
22 United Nations: Procedural Report ofthe Ad Hoc Group ofthe States Parties to the Convention on the<br />
Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons<br />
and on their Destruction, Fifth Session, Geneva, 16 - 27 September 1996. BWC/AD HOC GROUP/32
6<br />
synthetisieren. Es kann deshalb nur innerhalb von Tierzellen (Wirtszellen) wachsen, die dem<br />
Bakterium die benötigten Stoffe liefem 23 . Eine ähnliche Situation ist bei den Rickettsien zu<br />
finden. Rickettsien sind eigentlich Bakterien, die jedoch traditionell in eine eigene Kategorie<br />
gestellt werden. Diese Bakterien können bestimmte Kofaktoren, die rur die Aktivität einiger<br />
Enzyme benötigt werden, nicht selbst sYnthetisieren, und sie können sich deshalb auch nur in<br />
Wirtszellen vermehren 24 . Die Züchtung von Chlamydien und Rickettsien ist dementsprechend<br />
aufwendig, und sie wachsen viel langsamer als Escherichia coli. Die Generationsdauer rur<br />
Rickettsien liegt zum Beispiel zwischen acht und zehn Stunden, und der Vermehrungszyklus<br />
rur Chlamydien ist noch komplexer und dauert länger.<br />
Viren werden als Mikroorganismen eingeordnet, obwohl sie - streng betrachtet - keine echten<br />
Lebewesen sind. Es fehlen ihnen praktisch die gesamten biosynthetischen Kapazitäten von<br />
lebenden Zellen. Sie sind meist nur aus Nukleinsäuren (DNA oder RNA) und einer Eiweißhülle<br />
zusammengesetzt, .einige besitzen zusätzlich eine etwas komplexere Hülle. Die Nukleinsäure<br />
der Viren dirigiert die Wirtszelle, die sie infizieren, neue Viruspartikel zu produzieren. Dies ist<br />
anders als die Wege, die Chlamydien und Rickettsien Wirtszellen ausnutzen; es fehlen diesen<br />
Bakterien essentielle Metaboliten, sie besitzen aber sonst respektable biosynthetische<br />
Kapazitäten und vermehren sich intrazellulär in den Wirtszellen durch die übliche bakterielle<br />
Art der Zweiteilung. Die eigentliche Route der Reproduktion, die ein Virus nimmt, hängt von<br />
seiner Art und der Art der Wirtszelle ab. Wie bei den Chlamydien und Rickettsien, sind Viren<br />
rur ihre Vermehrung von Wirtszellen abhängig, und Wirtszellen müssen angewendet werden,<br />
um diese Mikroorganismen zu züchten.<br />
Viele Bakterien können in relativ einfachen Nährmedien gezüchtet werden. Der Ertrag hängt<br />
von der Stoffwechselfähigkeit der Bakterien sowie von den Kulturbedingungen (Temperatur,<br />
pH-Wert, Sauerstoff-Gehalt, Nahrungszugabe) ab. Um größere Mengen von Mikroorganismen<br />
zu produzieren, werden Fermenter (Bioreaktoren) benutzt, mit denen man die<br />
Kulturbedingungen steuern kann. Produktionserträge konnten in den letzten Jahren erheblich<br />
erhöht werden durch die Verfeinerung von kontinuierlichen Kultursystemen, die mit<br />
Biosensoren und Vorrichtungen rur On-Line-Überwachung und -Analyse integriert werden 25 .<br />
Ebenso wurden Kulturtechniken eingefuhrt, wobei besonders hohe Zelldichten während der<br />
Züchtung (z.B. bis zum 100 Gramm Trockengewicht pro Liter) durch streng regulierte<br />
Nahrungszugabe-Programme erreicht werden können 26 .<br />
Die Züchtung von Viren, Chlamydien und Rickettsien ist erheblich aufwendiger, weil<br />
Tierzellen für die Vermehrung dieser Mikroorganismen verwendet werden müssen. Tierzellen<br />
sind in der Regel viel anspruchsvoller als Bakterien bezüglich des Bedarfs an Nahrungsstoffen;<br />
die Formulierung der Bestandteile ist komplexer und Serum oder etwas entsprechendes wird<br />
benötigt. Tierzellen sind sensibler gegenüber mechanischer Beanspruchung (Streß), die bei den<br />
Mischungsprozessen in Kulturgefäßen vorkommt. Es ist daher nicht wunderlich, daß die<br />
Ausbeuten von Tierzellkulturen etwa zwei Größenordnungen geringer sind als die von<br />
Bakterienzellen. Es wurden jedoch einige Verbesserungen der Tierzellkultur in den letzten<br />
Jahren durch.die Einruhrung von kontinuierlichen Kulturtechniken sowie die Verwendung von<br />
23 G. McClarty: Ch1amydiae and the biochemistry ofintracellular parasitism, in: Trends in Microbio1ogy Vol.<br />
2, 1994, S. 157-164.<br />
24 H.H. Wink1er: Rickettsia prawazekii, ribosomes and slow growth, in: Trends in Microbiology Vol. 3, 1995,<br />
S. 196-198.<br />
25 K. SchügerlJB. HitzmannIH. Jurgensrr. KullickIR. Ulber/B. Weigal: Challenges in integrating biosensors<br />
and FIA for on-line monitoring and contral, in: Trends in Biotechnology Vol. 14, 1996, S. 21-31.<br />
26 S.Y. Lee: High cell-density culture ofEscherichia cali, in: Trends in Biotechnology Vol. 14, 1996, S. 98<br />
105.
7<br />
Mikrocarriern (z.B. Hohlglaskugel) erzielt 27 • Weiterhin konnten die Erträge durch den<br />
Einschluß der Tierzellen in semisoliden Gelatinkugeln sowie anderen Stoffen<br />
(Microencapsulation) verbessert werden. Somit werden· die Zellen vor mechanischer<br />
Beanspruchung besser geschützes. Je nach dem verwendeten Zelltyp sowie Virus können<br />
Wirtszelldichten von 8 x 10 6 Zellen pro Milliliter und Virustiter bis 10 10 Viruspartikel pro<br />
Milliliter erreicht werden.<br />
Die Mehrzahl der Toxine in Tabelle 1 werden durch Mikroorganismen produziert. Die<br />
Isolierung und Reinigung der Toxine nach der Kultivierung der Mikroorganismen werden<br />
möglicherweise nötig sein, obwohl die Aktivität einiger Toxine (wie z.B. das Botulinumtoxin<br />
von Clostridium botulinum) eher in Rohextrakten geschützt wird. In einigen Fällen konnte die<br />
Produktion von Toxinen durch die Methoden der Gentechnik verbessert werden 29 . Das Toxin<br />
Ricin kann relativ leicht aus den Samen der Pflanze Ricinus communis extrahiert und gereinigt<br />
werden. Es ist jedoch durch die Gentechnik möglich, die A-Kette (verantwortlich rur die<br />
toxische Wirkung) und die B-Kette (verantwortlichrur die Bindung des Toxins an die<br />
Wirtszelle) getrennt in Bakterien 30 oder in Tierzellen 31 zu produzieren. Die A-Kette ist nichttoxisch,<br />
wenn sie von der B-Kette getrennt ist. Erst wenn die beiden Ketten zusammen<br />
gemischt werden, bilden sie vollaktive Toxinmoleküle 32 .<br />
Es muß jedoch angerugt werden, daß anspruchsvolle, aufwendige Bioreaktortechniken rur die<br />
Kultivierung von Bakterien und sogar Viren nicht nötig sind. Viren können z.B. in flachen<br />
Kulturgefaßen an Schichten von Tierzellen gezüchtet werden. Viele Viren können auch in<br />
fertilisierten Hühnereiern produziert werden. Die strenge Einhaltung von Steriltechnik bei<br />
dieser Arbeit ist besonders angebracht, da Tierzellen in Kultur leicht mit Bakterien und vor<br />
allem Pilzen kontaminiert werden und absterben können.<br />
6. Sicherheit bei der Kultivierung von Mikroorganismen<br />
Einige Sicherheitsaspekte bei der Behandlung und Kultivierung von infektiösen<br />
Krankheitserregern sollen betrachtet werden. Es gibt Sicherheitsregeln rur das Arbeiten mit<br />
potentiell pathogenen Mikroorganismen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Diese<br />
Regeln sind formuliert worden, um Infektionen des Laborpersonals als auch der Bevölkerung<br />
generell zu vermeiden. Im allgemeinen gibt es vier Kategorien, die das je"weilige Risiko<br />
beschreibt. Mikroorganismen in der Risikogruppe 1 sind nicht rur Menschen, Tieren oder<br />
Pflanzen pathogen, d.h. sie stellen keine Infektionsgefahr, weder ruf das Laborpersonal noch<br />
rur die Bevölkerung dar. Die andere Risikogruppenwerden wie folgt beschrieben 33<br />
27 A.L. van Wezel: Monolayer growth systems: homogeneous unit processes, in R.E. Spier/ J.B. Griffiths<br />
(Hrsg.), Animal CellBiotechnology, Volume 1, 1989, Academic Press, London, S. 265-281.<br />
28 J.B. Griffiths: Cell biology: experimental aspects, in R.E. Spier/J.B. Griffiths (Hrsg.), Animal Cell<br />
Biotechnology, Volume 1, 1989, Academic Press, London, S. 49-83<br />
29 R. Rappuoli:New and improved vaccines against diphtheria and tetanus, in: G.C. WoodrowlM.M. Levine<br />
(Hrsg.), New GenerationVaccines, 1990, Marcel Dekker, Inc. New York, S. 251-268; 1. Stumm/J.<br />
BrauburgerlK. Nixdorff: Haben Toxinwaffen militärische Relevanz?, IANUS-Arbeitsbericht 411995, 84 Seiten.<br />
30 M. Q'HarelL.M. RobertslP.E. Thorpe/G. WatsonIB. Prior/J.M. Lord: Expression ofricin A chain in<br />
Escherichia coli, in: Federation ofEuropean Biochemical Societies Letters Vol. 216, 1987, S. 73-78.<br />
31 M.-S. ChangID.W. Russel/J.W. Uhr/E.S. Vitetta: Cloning and expression ofrecombinant, functional ricin B<br />
chain, in: Proceedings ofthe National Academy of Sciences USA, Vol. 84, 1987, S. 5640-5644.<br />
32 Ebenda.<br />
33 E. Geißler: Annexe 4. Description ofcontainment facilities and Annexe 5. Classification ofinfective<br />
microorganisms by risk group, in: E. Geißler (Hrsg.), Strengthening the Biological Weapons Convention by<br />
Confidence-Building Measures, Oxford University Press, New York, 1990, S. 176-197.
8<br />
"Risk Group 2 (moderate individual risk, limited community.risk). A pathogen that can cause<br />
human or animal disease but is unlikely to be a serious haiard to laboratory workers, the<br />
community, livestock, or the environment. Laboratory exposures may cause serious<br />
infection, but effective treatment andpreventive measures are available and the risk of<br />
spread is limited<br />
Risk Group 3 (high individual risk, low community risk). A pathogen that usuallyproduces<br />
serious human disease but does not ordinarily spread/rom one infected individual to<br />
another.<br />
Risk Group 4 (high individual and community risk). A pathogen that usually produces serious<br />
human or animal disease andmay be readily transmitted/rom one individual to another,<br />
directly or indirectly u.<br />
Für die Infektionskrankheiten, die durch Mikroorganismen der Risikogruppe 4 verursacht<br />
werden, gibt es häufig keine Vakzine oder andere Therapiemöglichkeiten.<br />
Wie schon erwähnt, sind einige Regeln rur das Arbeiten mit Mikroorganismen der<br />
verschiedenen Risikogruppen formuliert worden; diese werden rur vier verschiedene<br />
Biosicherheitsstufen beschrieben 34 (BLI bis BL4 in den USA, LI bis L4 in Deutschland). Im<br />
Folgenden·soll einige Hauptregeln erwähnt werden. Für das Arbeiten mit Mikroorganismen der<br />
Risikogruppe 1 (Biosicherheitsstufe LI) werden Standardverfahren, die in jedem<br />
Mikrobiologielabor üblich sind, vorgeschrieben.<br />
Für das Arbeiten mit Organismen der Risikogruppe 2 (Sicherheitsstufe L2) gelten dieselben<br />
Regeln mit·einigen zusätzlichen Anforderungen, wie z.B. die Benutzung einer<br />
Sicherheitswerkbank der Klasse II rur Arbeiten, die Aerosole erzeugen können, sowie das<br />
Tragen eines Laborkitte1s und. Schutzhandschuhe. Betriebsfremde Personen dürfen das Labor<br />
nur mit Erlaubnis des Verantwortlichen betreten. Waschbecken mit Armaturen, die mit dem<br />
Ellenbogen zu bedienen sind, werden vorgeschrieben.<br />
Bei Sicherheitsstufe 3, (Mikroorganismen der Risikogruppe 3) umfassen weitere<br />
Anforderungen u.a. die Benutzung einer Sicherheitswerkbank der Klasse II rur alle Arbeiten<br />
mit infektiösem Material. Das Betreten bzw. das Verlassen des Labors sollen durch zweitürige<br />
Schleusen erfolgen, und ein Negativdruck muß im Labor erzeugt werden. Die Abluft soll über<br />
ein Hochleistungsschwebstoff-Filter erfolgen, und ein Autoklav rur die Inaktivierung der<br />
Abfalle und des Abwassers muß im Labor vorhanden sein.<br />
Für das Arbeiten mit Risikogruppe 4 zugeordneten 1\1ikroorganismen (Sicherheitsstufe L4) soll<br />
das Labor in einem eindeutig abgetrennten Bereich eines Gebäudes liegen. Die Beschäftigen<br />
müssen das Labor über dreikammerige Schleusen betreten und verlassen. Die Strassenkleidung<br />
muß abgelegt und Arbeitskleidung angezogen werden. Beim Verlassen des Labors muß unter<br />
einer Dusche eine gründliche Körperreinigung vorgenommen werden. Es muß sichergestellt<br />
werden, daß kontaminierte Luft, Materialien und Geräte nicht aus dem Sicherheitsbereich<br />
gelangen. Es sollen ferner alle Arbeiten in Werkbänken der Klasse III oder mit<br />
Vollschutzanzügen durchgeruhrt werden.<br />
Eine Betrachtung der Liste der humanpathogenen Mikroorganismen und Toxine der Tabelle 1<br />
zeigt, daß die meisten Bakterien zurRisikogruppe 3 gehören, während die Viren in<br />
Risikogruppen 3 und 4 ihre Zuordnung finden. Es ist offensichtlich, daß ein erhebliches'<br />
Sicherheitsrisiko beim Arbeiten mit diesen Erregern verbunden ist. Besondere Bedenken liegen<br />
in der Befiirchtung, daß ein Aggressor, der die Absicht hat, biologische Agenzien als<br />
Kampfstoffe zu verwenden, nicht unbedingt sicherheitsorientiert ist.<br />
34 Sichere Biotechnologie. Austattung und organisatorische Maßnahmen: Laboratorien, in: Merkblatt B 002,<br />
1192, ZR 11342, Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.
9<br />
7. ModiflZierung von Mikroorganismen<br />
Es ist offensichtlich, daß·die Revolution in der Biotechnologie einige Berurchtungen geweckt<br />
hat, daß die neuen Techniken (insbesondere die Gentechnik) benutzt werden können, um<br />
biologische Kriegruhrungskapzitäten zu verbessern und biologische Waffen als alternative<br />
Kampfmittel attraktiver zu machen. Bezüglich der Manipulationen von·Mikroorganismen, die<br />
häufig in der aktuellen Debatte als Möglichkeiten genannt werden 35 , handelt es sich um<br />
1. die übertragung der Resistenz gegen Antibiotika,<br />
2. die Veränderung von Antigenen der Zelloberfläche von Mikroorganismen, und<br />
3. den Transfer von pathogenen Eigenschaften.<br />
7.1. übertragung der Resistenz gegen Antibiotika<br />
Die übertragung von Resistenz gegen Antibiotika aufMikroorganismen liegt rur die<br />
Gentechnik sicherlich bereits im Bereich des Möglichen. Antibiotikaresistenzen werden z.B.<br />
häufig als Marker in Klonierungsversuchen verwendet, um Zellen, die Gene übertragen<br />
bekommen haben, zu selektieren. Diese Modifikation findet in derNatur statt. Am Beispiel<br />
Krankenhaus erworbener Infektionen, die nur äußerst schwierig unter Kontrolle zu halten sind,<br />
läßt sich vielleicht am besten zeigen, welche verheerenden Folgen eine einmal erlangte<br />
Resistenz gegenüber einer Vielzahl von Antibiotika haben kann. Das Auftreten von<br />
Resistenzgenen in der Natur ist eine relativ neues Ereignis; multiresistente Bakterien wurden<br />
offensichtlich erst in den letzten runfJahrzenten erzeugt36. Resistente Mikroorganismen können<br />
häufig in Krankenhäusern gefunden werden, hauptsächlich wegen des selektiven Drucks der<br />
Antibiotika, die hier Verwendung finden.<br />
7.2. Veränderung von Antigenen der Zelloberfläche von Mikroorganismen<br />
Auch die Veränderung einzelner Komponenten bzw. Antigenen der Zelloberfläche durch<br />
genetische Manipulationen ist im Prinzip möglich. Das körpereigene Immunsystem erkennt und<br />
bekämpft eindringende Erreger über die Strukturen ihrer Zelloberflächen. Wenn ein bestimmter<br />
Erreger als Impfstoff dient, wird die Immunität gegen die Zelloberflächenstrukturen gerichtet.<br />
Das Immunsystem ist nur in der Lage bei späterem Kontakt mit dem Erreger, diesen zu<br />
identifizieren und zu bekämpfen, solange die Antigene der Zelloberfläche denen entsprechen,<br />
die beim ersten Kontakt das Immunsystem geprägt haben. Wenn beim späteren Kontakt mit<br />
dem Immunsystem die Antigenkomposition des Erregers jedoch verändert ist, kann dieser<br />
Erreger sich den spezifischen Schutzmechanismen des Immunsystems entziehen.<br />
Es ist möglich, gewisse Modifikationen der Zelloberflächenstrukturen zu erzielen. Es ist jedoch<br />
fraglich, ob diese Änderungen den gewünschten Effekt haben werden. Bakterien,z.B. verfugen<br />
über mehrere verschiedene Antigene auf ihrer Oberfläche. Die Veränderung von einem Antigen<br />
würde möglicherweise wenig zur überwindung des Immunsystems beitragen, da andere<br />
Antigenstrukturen noch erkannt werden. Außerdem sind einige Oberflächenstrukturen von<br />
Bakterien aus Polysacchariden zusammengesetzt. Eine Änderung solcher Strukturen würde<br />
weitreichende Manipulationen erfordern.<br />
35 S. Wright, a.a.O. (Anm. 2)~ M.R. Dando: New developments in biotechnology and their impact on biological<br />
warfare, in: O. Thränert (Hrsg.), Enhancing the Biological Weapons Convention, Verlag J.H.W. Dietz<br />
Nachfolger GmbH, Bonn, 1996, S. 21-56~ Germany: Anwendung der Gentechnologie zu militärischen<br />
Zwecken, in: Chancen und Risiken der Gentechnologie. Bericht der Enquete-Kommission des 10. Deutschen<br />
Bundestages, Deutscher Bundestag, Bonn, 1987, S. 260-267.<br />
36 1. Davies: Inactivation ofantibiotics and the dissemination ofresistance genes, in: Science , Vol. 264, 1994,<br />
S.375-264.
10<br />
Die Antigenzusammensetzung von Viren ist dagegen weniger Romplex. Modifikation der<br />
Antigenstruktur bei Viren findet auch in der Natur statt; hierzu können einige Viren das<br />
Immunsystem durch die Mutation ihrer Proteingene regelmäßig überwinden 37 .<br />
7.3. Transfer von pathogenen Eigenschaften<br />
Die intensivsten Forschungen im Bereich der infektiösen Krankheitserreger sind mit der<br />
Aufkärung der Mechanismen von pathogenen Wirkungen dieser Agenzien verbunden. Für eine<br />
effektive Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist es essentiell, die Mechanismen der<br />
krankmachenden Prozesse zu durchschauen. Eine Vielzahl von Informationen wurde im letzten<br />
Jahrzehnt gesammelt. Es wird immer deutlicher, daß viele verschiedene Faktoren eine Rolle bei<br />
solchen Prozessen spielen 38 , und kein System wird bis jetzt in seiner Gesamtheit verstanden.<br />
Die Produktion eines Toxins könnte z.B. fiir den krankmachenden Prozeß essentiell sein, es<br />
wird jedoch nur zusammen mit anderen, weniger gut definierten Faktoren wirksam, die das<br />
Eindringen der Mikroorganismen in den Wirt erlauben. In einem aktuellen Versuch wurde ein<br />
Toxingen von Listeria monocytogenes in das relativ harmlose Bodenbakteriunm Bacillus<br />
subtilis übertragen 39 . Das so manipulierte Bacillus subtilis konnte zwar das Toxin in Kultur<br />
produzieren, wirkte jedoch avirulent (harmlos, nicht infektiös), wenn es in Mäuse injiziert<br />
wurde. Weitere, ähnliche Versuche unterstützen die These, daß es äußerst schwierig ist, einen<br />
harmlosen Mikroorganismus durch die übertragung von Pathogenitätsmerkmalen·virulent zu<br />
machen 40 • Andererseits konnte offensichtlich die Virulenz eines schwach pathogenen<br />
Bakteriums (Bordatella parapertussis) durch die übertragung eines Toxingens von Bordatella<br />
pertussis (Verursacher von Keuchhusten) verstärkt werden 41 . Dies war offensichtlich nur<br />
deswegen möglich, da Bordatella parapertussis schon einige schwach pathogene<br />
Eigenschaften in sich trägt.<br />
Die übertragung von Pathogenitätsfaktoren aufViren ist ein Bereich von besonderem<br />
Ambivalenz. In den letzten Jahren wurde viel Arbeit in der Erforschung von targeted delivery<br />
systems fiir medizinische Zwecke investiert. Meistens beinhalten diese Systeme Komponenten,<br />
die eine gewünschte Aktivität zu einer spezifischen Stelleim Körper hinfUhren können.<br />
Gängige Beispiele sind die Bekämpfung von Tumoren mit giftigen Stoffen, die gezielte<br />
Immunisierung gegen bestimmte Krankheitserreger,. oder der Transfer von spezifizierten Genen<br />
zu Zellen im Rahmen der Gentherapie. In den beiden letzten Fällen \verden Viren häufig als<br />
Vektoren bzw. Überträger von neuen Genen in den Versuchen verwendet 42 . Gleichzeitig muß<br />
daraufhingewiesen werden, daß diese Virus-Vektor-Systeme im Ansatz noch nicht ausgereift<br />
37 A.J. McMichael: HIV. The immune response, in: Current Opinion in Immunology, Vol. 8, 1996, S. 537-539.<br />
38V.J. DiRita: Multiple regulatory systems in Vibrio cho/erae pathogenesis, in: Trends in Microbiology, Vol. 2,<br />
1994, S. 37-38~ S.C. Straley/R.D. Perry: Environmenta! modulation ofgene expression and pathogenesis in<br />
Yersinia, in: Trends in Microbiology, Vol. 3,1995, S. 310-317.<br />
39J. BieleckilP. YoungmanlP. Connelly/D.A. Portnoy: Bacillus subtilis expressing a hemolysin gene from<br />
Listeria monocytogenes can grow in mamalian cells, in: Nature, Vol. 345, 1990, S. 175-185.<br />
4
11<br />
sind. Targeted de/ivery systems sind potentiell sehr nutzlich für Vakzin- und Gentherapie<br />
Zwecke. Sie können jedoch mißbraucht werden. Ein Mißbrauch -in diesem Zusammenhang<br />
wäre die mögliche Verwendung von Viren, die Tmcingene tragen, um die Expremierung des<br />
Toxins im Körper nach der Infektion mit dem Virus zu erreichen.<br />
Die vorangegangenen Ausführungen sollten dazu dienen, die Möglichkeiten und Grenzen bei<br />
der Durchführung bestimmter Modifikationen von Mikroorganismen zu diskutieren, die für<br />
biologische Waffen-Herstellung bzw. -Produktion verwendet werden können. Diese<br />
Überlegungen führen zur folgenden Hauptthese: Obwohl einige gezielte Manipulationen von<br />
Organismen möglich sind, es ist äußerst schwierig vorauszusagen, ob eine bestimmte<br />
Modifikation den gewünschten Effekt haben wird. Ferner ist es noch schwieriger<br />
vorauszusagen, ob zukünftige Entwicklungen, die eine besondere Bedeutung für biologische<br />
Kriegführung haben könnten, stattfinden werden. Angesichts der rapiden Entwicklungen im<br />
Bereich der Biotechnologie bzw. Gentechnik in den letzten zehn Jahren können wir aufjeden<br />
Fall weitere, starke Entwicklungen erwarten, die erhebliche Implikationen für die Entwicklung<br />
von biologischen Waffen haben und berücksichtigt.werden müssen.<br />
Aufder anderen Seite wird mit Recht oft darauf hingewiesen, daß wenn solche Manipulationen<br />
erzielt werden·können, die Mikroorganismen immer noch viele der Eigenschaften besitzen<br />
werden, die ihren Einsatz nur begrenzt nutzbar machen, und das Risiko im Umgang mit diesen<br />
Kampfstoffen wird zumindest ebenso hoch sein.
12<br />
Tabelle 1. Liste einiger Mikroorganismen, die auf _~enschen pathogen wirken<br />
(Quelle: Anm. 22, modifiziert).<br />
The following list of human pathogens and toxins was discussed by the Group<br />
and recognized to be revelant ror developing a list or lists of<br />
bacteriological (biologieal) agents and toxins for specific measures to<br />
strengthen the Convention:<br />
Viruses<br />
1. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus<br />
2. Chickungunya virus<br />
3. Eastern encephalitis virus<br />
4. Ebola virus<br />
5. Hantavirus<br />
6. Japanese encephalitis virus<br />
7. Junin virus<br />
8. Lassa fever virus<br />
9. Machupovirus<br />
10. Marburg virus<br />
11. Rift Valley virus<br />
12. Tick-borne encephalitis virus (Russian<br />
spring-summer encephalitis virus)<br />
13. Variola virus (Smallpox virus)<br />
14. Venezuelen encephalitis virus<br />
15. Western encephalitis virus<br />
16. Yellow fever virus<br />
Bacteria<br />
1. Bacillus anthracis<br />
2. Brucella spp<br />
3. Chlamydia psittaci<br />
4. Clostridium botu1inum<br />
5. Francisella tularensis (tularemia)<br />
6. Pseudomonas (Burkholderia) mallei<br />
7. Pseudomonas (Burkholderia) pseudomallei<br />
8. Yersinia pestis<br />
Rickettsiae<br />
1. Coxiella burnetti<br />
2. Rickettsia prowazekii<br />
3. Rickettsia rickettsii<br />
Fungi<br />
1. Histoplasma capsulatum (incl. var duboisii)<br />
Risk Group<br />
4<br />
3<br />
3<br />
4<br />
3<br />
3<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
3<br />
3-4<br />
4<br />
3-4<br />
3<br />
3-4<br />
2-3<br />
2-3<br />
3<br />
2<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
Toxins<br />
1. Abrin (A. precatorius)<br />
2. Botulinum toxins (Clostridium botulinum)<br />
3. Clostridium perfringens (tox)<br />
4. Corynebacterium diphtheriae (tox)<br />
5. Cyanginosins (Microcystins) (Mxcrocystis aeruginosa)<br />
6. Enterotoxins (Staphylococcus aureus)<br />
7. Neurotoxin (Shigella dysenteriae)<br />
8. Ricin (Ricinus communis)<br />
9. Saxitoxin (Ganyaulax catanella)<br />
10. Shigatoxin<br />
11. Tetanus Toxin (Clostridium tetani)<br />
12. Tetrodotoxin (Spheroides rufripes)<br />
13. Trichothecene mycotoxins<br />
14. Verrucologen (Myrothecium verrucaria)
1<br />
Kathryn Nixdorff<br />
Die Biologische-Waffen-Konvention<br />
Die Biologische Waffen-Konvention (BwCi wurde 1972 vereinbart und ist 1975 in Kraft<br />
getreten. Diese Konvention war das erste internationale übereinkommen, das eine ganze<br />
Klasse von Massenvernichtungswaffen verbannt hat. Die Verbote, die im Artikel I der<br />
Konvention ausgelegt worden sind, werden umfassend formuliert:<br />
Article I<br />
Each State Party to this Convention undertakes never in any<br />
circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or<br />
retain:<br />
1. Microbial orother biological agents, or toxins whatever their<br />
origin or method of production, of types and in quantities that have<br />
no justification for prophyklactiic, protective or other peaceful<br />
purposes;<br />
2. Weapons, equipment or means of delivery designed to use such<br />
agents or toxins for hostile purposes or in armed corrflict.<br />
Es wurden jedoch keine effektiven Verifikationsmaßnahmen in die Konvention inkorporiert.<br />
Dies lag zum Teil an den Schwierigkeiten bei den Verhandlungen über solche Maßnahmen,<br />
aber auch an der Betrachtung dieser Waffen als ernsthaft limitiert in ihrer Nutzbarkeit; ihre<br />
Effekte können nicht so präzise wie bei anderen Waffenarten vorausgesagt werden, und sie<br />
können leicht außer Kontrolle geraten 2 . Zu diesem Zeitpunkt wurde es als.unwahrscheinlich<br />
empfunden, daß sie eingesetzt werden würden, sodaß auf ein umfassendes Verifikationsregime<br />
verzichtet wurde.<br />
Zwischenzeitlich hat sich der Status von biologischen Waffen verändert. Mit der Revolution in<br />
der Biotechnologie, die auch die Entwicklung der Gentechnik beinhaltet, wurden<br />
Befiirchtungen geschürt, daß in Entsprechung militärischer Anforderungen neue, effektivere<br />
biologische Waffen entwickelt werden können. Ob solche Ziele beim gegenwärtigen Stand der<br />
Entwicklungen realisierbar sind, ist noch eine offene Frage. Nichtsdestoweniger werden<br />
biologische Waffen seit der Entwicklung der Gentechnik als eine aktuelle Bedrohung<br />
empfunden 3 . Ebenso haben die Untersuchungen der United Nations Special Commission<br />
(UNSCOM) offenbart, daß Irak biologische· und Toxinwaffen im Golfkrieg produziert hat,<br />
obwohl er ein Vertragsstaat der BWC ist 4 . Darüberhinaus hat Präsident Boris Yeltsin<br />
zugegeben, daß die frühere Sowjetunion in der Zeit von 1946 bis März 1992 ein offensives<br />
biologisches Waffenprogramm unterhielt 5 , und es wird vermutet, daß mindestens zehn Staaten<br />
weiterhin offensive biologische Waffenkapazitäten entwickeln 6 • Ferner wurde bekannt, daß die<br />
lUnited Nations: Convention on the Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling of<br />
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 1972, Reprinted in S. Wright (ed.),<br />
Preventing a Biological Arms Race, MIT Press, Cambridge, Mass., 1990, S. 370-376.<br />
2M.S. Meselson: Chemical and biological weapons, in: Scientific American Vol. 222, 1970, S. 15-25.<br />
3S. Wright: New designs for biological weapons, in: Bulletin ofthe Atomic Scientists Jan./Feb., 1987, S. 43-46.<br />
4J. Tucker: Biological weapons proliferation concems, in: G.S. Pearson (Hrsg.), New Scientificand<br />
Technological Aspects ofVerification ofthe Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), Kluwer<br />
academic publishers, Dordrecht, in preparation (paper presented at the NATO Advanced Study Institute,<br />
Budapest, Hungary July 6-16, <strong>1997</strong>).<br />
5J.T. Dahlberg: Russia admits violating biological weapons pact, in: The Los Angeles Times, Washington<br />
Edition, 15 September, 1992.<br />
6J.S.McCain: Proliferation in the 1990s: Implications for US policy and force planing, in: Military Technology,<br />
Vol. 1190, 1990, S. 262-267.
2<br />
Aum-Shinrikyo-Sekte in Japan, die in der Tokyo-U-Bahn ~ärz 1995 die Attaken mit<br />
Nervengas durchfiihrte, den Aufbau eines B-Waffenprogrammes angestrebt hat 7<br />
Solche Überlegungen erwecken ernsthaften Zweifel an der Effektivität einer biologischen<br />
Waffenkonvention ohne unterstützende Verifikationsmaßnahmen.<br />
Bemühungen, die BWC zu stärken<br />
Alle fiinf Jahre findet eine Konferenz der BWC statt, die die Wirksamkeit der Konvention<br />
überprüfen und Wege zur Stärkung des Übereinkommens ausarbeiten soll.<br />
Die zweite Überprüfungskonferenz<br />
Bei der zweiten Überprüfungskonferenz 1986 wurden zwei Unklarheiten beseitigts. Bis zu<br />
diesem Zeitpunkt wurde oft die Frage gestellt, ob die Verbotsdefinition in Artikel I des<br />
Vertrages umfassend genug sei, um biologische Waffen, die durch die Gentechnik geschaffen<br />
werden, abzudecken. Eine andere Unklarheit betraf die Definition von Tmcinen. Aus dem<br />
Vertragstext geht nicht eindeutig hervor, ob Toxine als biologische oder chemische Waffen<br />
angesehen werden. In der Abschlußerklärung der zweiten Überprüfungskonferenz der BWC,<br />
die von allen anwesenden Vertragspartnern unterzeichnet wurde, einigten sich die Delegierten<br />
aufdie folgende Formulierung:<br />
" The Conjerence, conscious 0/ apprehensions anszng /rom relevant scientific and<br />
technological developments, inter alia, in the jields 0/microbiology, genetic engineering and<br />
biotechnology, and the possibilities 0/ their use /or purposes inconsistent with the objectives<br />
and the provisions 0/ the Convention, reaffirms that the undertaking given by the States<br />
Parties in Article 1 applies to all such developments.<br />
The Con/erence reaffirms that the Convention unequivocally applies to all natural or<br />
artijicially createdmicrobial or other biological agents, or toxins, whatever their origin or<br />
methods 0/production. "<br />
und weiterhin, daß<br />
" toxins (both proteinaceous andnon-proteinaceous) 0/a microbial, animalor vegetable<br />
nature and their syntheticallyproducedanalogues üre covered. "<br />
Nicht einigen konnte sich die zweite Überprüfungskonferenz allerdings auf Ausarbeitung eines<br />
Verifikationsregimes fiir die BWC 9 . Stattdessen wurden in der Abschlußerklärung der<br />
Konferenz einige vertrauensbildende Maßnahmen vereinbart, die als Verstärkung der<br />
Konvention angesehen wurden. Diese Maßnahmen wurden jedoch nicht zu Protokoll gegeben,<br />
da die Vertragsstaaten der Meinung waren, daß sie kein Mandat hatten, die Konvention<br />
gesetzlich zu verändern und stellten daher rur die Vertragsparteien lediglich eine politische<br />
Verpflichtung dar. Die vertrauensbildenden Maßnahmen umfaßten (A) den Austausch von<br />
Daten über die AktiVitäten in Hochsicherheits-Forschungseinrichtungen, (B) den Austausch<br />
von Informationen über den Ausbruch ungewöhnlicher Krankheiten,. (C) die Ermunterung zur<br />
7M.R. Dando/G.S. Pearson: The Fourth Review Conferenceofthe Biological and Toxin Weapons Convention:<br />
Issues, outcomes, and unfinished business, in: Politics and the Life Sciences Vol. 16, <strong>1997</strong>, S. 105-126.<br />
8United Nations: Final Document. The Second Review Conference ofthe Parties to the Convention on the<br />
Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biologieal) and Toxin Weapons<br />
and on their Destruction, Geneva 8-26 September 1986, BWC/CONF.II/13.<br />
9A.L. Levin: Historical Outline in: E. Geißler (ed.), Strengthening the Biological Weapons Convention by<br />
Confidence-Building Measures, SIPRI Chemical and Biological Warfare Studies No. 10, Oxford University<br />
Press,Oxford, 1990, S.l 5-14.
3<br />
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sowie (D) die aktive Förderung der Kontakte<br />
zwischen Wissenschaftlern, die an entsprechenden Forschungspr-ojekten arbeiten.<br />
Die dritte Überprüfungskonferenz<br />
Die dritte Überprüfungskonferenz hat sich wiederum der Frage der Verbotsdefinition<br />
gewidmet. In der Abschlußerklärung10 haben die Delegierten nochmals beteuert, daß die<br />
Formulierung der Verbote im Atikel I die neuen Entwicklungen in der Biotechnologie<br />
(einschließlich Gentecknik) deckt:<br />
"The Conference, conscious of apprehensions anslng ./rom relevant scientijic and<br />
technological developments, inter alia, in the fields ofmicrobiology, genetic engineering and<br />
biotechnology, and the possibilities oftheir use for purposes inconsistent with the objectives<br />
and the provisions of the Convention, reaffirms that the undertaking given by the States<br />
Parties in Article 1 applies to all such developments. The Conference also reaffirms·that the<br />
Convention unequivocally covers all microbial or other biological agents or toxins, naturally<br />
or artijicially created or altered, whatever their origin or methodofproduction ".<br />
Ein Vergleich dieses Abschnitts mit der (oben aufgeführten) ähnlichen Formulierung in der<br />
Abschlußerklärung der Zweiten Überprüfungskonferenz zeigt, daß das Wort "altered'<br />
dazugekommen ist.<br />
Die 1986 vereinbarten vertrauensbildenen Maßnahmen erwiesen sich als ein nicht ausreichend<br />
effektives Kontrollinstrument. Außer daß sie inhaltlich einen beschränkten Umfang hatten ll<br />
war die Beteiligung am Informationsaustausch unter den Vertragspartnern sehr dürftig12. Bei<br />
der dritten Überprüfungskonferenz 1991 wurden die vertrauensbildenden Maßnahmen<br />
deswegen gestärkt bzw. erweitert, und sie bestehen seit diesem Zeitpunkt aus folgenden<br />
Komponenten13.<br />
• Declarationform on "Nothing to declare " or "Nothing new to declare "<br />
• Exchange ofdata on research centers andlaboratories (parti) ,. Exchange ofinformation<br />
on national biological defense research anddevelopment programs (part 11)<br />
• Exchange ofinformation on outbreaks ofinfectious diseases andsimilar occurrences<br />
caused by toxins<br />
• Encouragement ofpublication ofresults andpromotion ofuse ofknowledge<br />
• Active promotion ofcontacts<br />
• Declaration oflegislation, regulations and other measures<br />
• Declaration ofpast activities in offensive andJor defensive biological research and<br />
development programs<br />
• Declaration ofvaccine productionfacilities.<br />
lOUnited Nations: Final Document Third Review Conference ofthe Parties to the Convention on the<br />
Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons<br />
and on their Destruction, Geneva 9-27 September 1991, BWC/CONF.III/23.<br />
llB.H. Rosenberg: North vs. South: Politics and the Biological Weapons Convention, in: Politics and the Life<br />
Sciences, Vol. 1, 1993, S. 69-77.<br />
12E. Geißler: The first three rounds ofinformation exchanges, in: E. Geißler (ed.), Strengthening the Biological<br />
Weapons Convention by Confidence-Building Measures, SIPRI Chemical and Biological Warfare Studies No.<br />
10, Oxford University Press, Oxford, 1990, S. 71-79.<br />
13United Nations, a.a. O. (Anm. 10).
4<br />
Die große Schwäche der vertrauensbildenden Maßnahmen ist jedoch nach wie vor, daß die<br />
Teilnahme an dem Informationsaustausch nur politisch und nicht gesetzlich bindend ist 14 . Auch<br />
existiert keine Institution, die zwischen den Überprüfungskonferenzen die Erklärungen<br />
einsammelt und auswertet15. Eine vorläufige Analyse der Effektivität des<br />
Informationsaustausches bis 1994 zeigt, daß die Teilnahme an der Berichterstattung auch nach<br />
der Verstärkung der Maßnahmen in Rahmen der dritten Überprüfungskonferenz noch<br />
mangelhaft ist 16 . Obwohl die Teilnahme über die Jahre langsam gestiegen ist, kann diese<br />
insgesamt als nichtzumedenstellend bezeichnet werden, vor allem im Hinblick auf die<br />
Regelmäßigkeit der Beteiligung. Nur etwa ein Drittel der 133 Vertragsstaaten beteiligen sich<br />
jedes Jahr an der Informationssammlung, und nur zehn Staaten haben für alle acht Jahre seit<br />
der Vereinbarung Berichte abgeliefert. Die Bedeutung der vertrauensbildenden Maßnahmen für<br />
die Kontrolle biologischer Waffen darf sicherlich nicht unterschätzt werden. Ihre Wirksamkeit<br />
könnte jedoch wesentlich erhöht werden, wenn sie neben den Verifikationsmaßnahmen als Teil<br />
eines vertraglich fixierten Kontrollregimes inkorporiert würden.<br />
Neben dem Ausbau der vertrauensbildenden Maßnahmen wurden auf der dritten<br />
Überprüfungskonferenz auch Fortschritte in Richtung eines Verifikationsregimes für<br />
biologische Waffen erzielt. Die Vertragsstaaten einigten sich auf die Einrichtung einer Ad Hoc<br />
Gruppe von Regierungsexperten (VEREX), die vom wissenschaftlich-technischen Standpunkt<br />
aus potentielle Verifikationsmaßnahmen identifizieren und überprüfen sollte. Zur veränderten<br />
Einstellung der Vertragsstaaten hat zweifellos der schon erwähnte neue Status biologischer<br />
Waffen beigetragen. Ein weiterer Faktor, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist<br />
der Abschluß der Verhandlungen zur Chemie-Waffen-Konvention 17 , die im April <strong>1997</strong> in Kraft<br />
getreten ist. Jahrelang waren die Verhandlungen über ein effektives Kontrollregime für die<br />
Verbreitung chemischer Waffen unter Hinweis auf den dual-use-Charakter aller chemischen<br />
Labors und Produktionsanlagen verhindert worden. Daß nun trotz der umfangreichen<br />
Kontrollen, die für eine effektive Verifikation notwendig sind, und den daraus resultierenden<br />
Souveränitätseinbußen für die Signatarstaaten die Konvention unterzeichnet wurde, hat für die<br />
Entstehung künftiger Kontrollregime "Wegweiserfunktion" und wird sicher noch auf die<br />
Verhandlungen über angemessene Verifikationsmaßnahmen im B-Waffen-Bereich einwirken18.<br />
Die VEREX-Gruppe hat zwischen 1992 und 1993 mehrmals getagt und ihre Arbeit mit einem<br />
Beriche 9 abgeschlossen, in dem 21 mögliche Verifikationsmaßnahmen identifiziert und<br />
evaluiert wurden:<br />
Off-site Measures<br />
- Information monitoring:<br />
surveillance ofpublications;<br />
surveillance oflegislation;<br />
data on transfers, transfer requests<br />
and production;<br />
multilateral information sharing;<br />
On-site Measures<br />
- Exchange visits:<br />
international arrangements.<br />
- Inspections:<br />
interviewing;<br />
visual inspections;<br />
identification ofkey equipment;<br />
141. Hunger: Article V: Confidence building measures, in: G.S. PearsonIM.R. Dando (eds.), Strengthening the<br />
Biological Weapons Convention. Key Points for the Fourth Review Conference, Quaker United Nations Office,<br />
Geneva, 1996, S. 77-92.<br />
15.H. Rosenberg, a.a.O. (Anm. 10).<br />
161. Hunger, a.a.O. (Anm. 13).<br />
17United Nations: Convention on the Prohibition ofthe Development, Production, Stockpiling and Use of<br />
Chemical Weapons and on their Destruction, 1993, United Nations pocument 93-05070.<br />
18C. Müller: Das Chemiewaffen-Übereinkommen vom 13. Januar 1993. Endpunkt oder Neubeginn<br />
multilateraler Rüstungskontrolle? in: Europa-Archiv Folge 11/1993, S.:327-337.<br />
l~nited Nations: Report. Ad Hoc Group ofGovemmental Experts to Identify and Examine Potential<br />
Verification Measures from a Scientific and Technical Standpoint, Geneva, 1993, BWC/CONF.IIIlVEREX 9.
5<br />
- Data exchange:<br />
declarations;<br />
notifications;<br />
- Remote sensing:<br />
surveillance by satellite;<br />
surveillance by aircraft;<br />
ground-based surveillance.<br />
auditing;<br />
sampling and identification;<br />
medical examination.<br />
- Continuous monitoring:<br />
by instruments;<br />
by personnel.<br />
- Inspections:<br />
sampling and identification;<br />
observation;<br />
auditing.<br />
Der VEREX-Bericht wurde aufeiner Sonder-Konferenz 2o im September 1994 in Genf<br />
behandelt. Die Konferenzteilnehmer einigten sich aufein Mandat rur eine neue Ad Hoc<br />
Gruppe, die weiterhin allen Vertragsstaaten offen stehen und konkrete Vorschläge zur<br />
Stärkung der Konvention unterbreiten sollte. Die Gruppe sollte bei ihren Arbeiten inter alia<br />
folgende Aspekte berücksichtigen:<br />
• Definitions ofterms and objective criteria, such as lists ofbacteriological (biological)<br />
agents and toxins, their threshold quantities, as weIl as equipment and types ofactivities,<br />
where relevantfor specific measures designed to strengthen the convention;<br />
• The incorporation ofexisting andfurther enhanced confidence building and transparency<br />
measures, as appropriate, into the regime,.<br />
" A system ofmeasures to promote compliance with the Convention, including, as<br />
appropriate, measures identified, examined and evaluated in the VEREXReport. Such<br />
measures shouldapply to alI relevantfacilities andactivities, be reliable, cost effective,<br />
non-dicriminatory andas non-intrusive aspossible, consistent with the effective<br />
implementation ofthe system andshouldnot lead to abuse;<br />
" Specific measures designed to ensure effective andfulI implementation ofArticle.x which<br />
also avoidany restrictions incompatible with the obligations undertaken under the<br />
Convention, noting that the provisiopns ofthe Convention shouldnot be used to impose<br />
restrictions andlor fimitations onthe transferfor purposes consistent with the objectioves<br />
andthe provisions ofthe convention ofscientific knowledge, technology, equipment and<br />
materials.<br />
Die Vorschläge der Ad Hoc Gruppe sollten auf der vierten Überprüfungskonferenz oder zu<br />
einem späteren Zeitpunkt der Konvention mit rechtsverbindlichem Charakter hinzugerugt<br />
werden.<br />
Bis zur Vierten Überprüfungskonferenz 1996 tagte die Ad Hoc Gruppe unter dem Vorsitz von<br />
Tibor Toth, Botschafter Ungarns (er war auch Vorsitzender der VEREX Ad Hoc Gruppe),<br />
fünfmal. Beim ersten Treffen wurden hauptsächlich Verfahrensbestimmungen behandelt und<br />
Verfahrensregeln ausgearbeitet (3.-5. Januar 1995), bei den anderen Treffen wurden die<br />
Kernfragen des Mandats behandelt (10.-21. Juli 1995, 27. November - 8. Dezember 1995, 15.<br />
26. Juli 1996, und 16.-27. September 1996). Die Arbeit der Gruppe wurde erleichtert durch<br />
20United Nations: Final Report. Special Conference ofthe States Parties to the Convention on the Prohibition of<br />
the Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their<br />
Destruction, Geneva, 19-30 September 1994, BWC/SPCONFIl.
6<br />
die Ernennung von vier Friends ofthe Chair (FOC), die die .sitzungen über die vier Elemente<br />
des Mandats geleitet haben 21 : -<<br />
• Definitions o[Terms and Objective Criteria: Dr. Ali Mohammadi ofthe Islamic Republic<br />
oflran;<br />
• Confidence-Building and Transparency Measures: Ambassador Tibor Toth ofHungary;<br />
• Measures to Promote Compliance: Mr. Stephen Pattison ofthe United Kingdom ofGreat<br />
Britain andNorthern Ireland;<br />
• Measures Related to ArticleX' Ambassador Jorge Berguno ofChile.<br />
Die Vierte Überprüfungskonferenz<br />
Es soll zunächst angemerkt werden, daß wegen der Kürze des Beitrags nicht alle<br />
Verhandlungsaspekte der Vierten überprufungskonferenz hier behandelt werden können.<br />
Daher wird nur eine begrenzte· Auswahl der Kernpunkte diskutiert. Der Leser wird auf<br />
ausfUhrliche Analysen der Ergebnisse dieser Konferenz hingewiesen 22 .<br />
1. Die Arbeit der Ad Hoc Gruppe<br />
Zum Zeitpunkt der Vierten Überprüfungskonferenz 1996 hat die Ad Hoc Gruppe zwar<br />
beachtliche Fortschritte gemacht, war jedoch nicht so weit in ihren Verhandlungen<br />
vorangekommen, daß sie ein Verifikationsprotokoll mit rechtsverbindlichem Charakter zur<br />
Inkorporation in die Konvention vorlegen konnte. Hierzu muß jedoch beachtet werden, daß die<br />
Ad ·Hoc Gruppe effektiv nur acht Wochen Verhandlungszeit zur Verfugung hatte. Davon<br />
abgesehen gestalteten sich die Verhandlungen über die Verifikation der BWC äußerst<br />
schwierig (s. unten). Insofern war es wichtig, daß die Delegierten der Vierten<br />
Überprufungkonferenz ihre Entschlossenheit bezüglich der Unterstützung von weiteren<br />
Aktivitäten der Ad Hoc Gruppe zeigten. In der Abschlußerklärung wurde diese Unterstützung<br />
so formuliert 23 :<br />
,,- The Ad Hoc Group has made significant progress towards fulfilling the mandate<br />
given by the Special Conference, including by identifying a preliminaryframework and<br />
elaborating potential basic elements 01 a legally-binding instrument to strengthen the<br />
Convention.<br />
The Conference welcomes the decision ofthe AdHoc Group, in order to fulfil its mandate, to<br />
intensify its workwith a view to completing it assoon as possible before the commencement of<br />
the Fifth Review Conference and submit its report, which shall be adopted by consensus, to<br />
the States Parties, to be considered at a Special Conference. The Conference encourages the<br />
Ad Hoc Groupto review its method ofwork and to move to a negotiatingformat in order to<br />
fulfil its mandate. "<br />
21United Nations: Procedural Report ofthe Ad HocGroup ofthe States Parties to the Convention on the<br />
Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons<br />
and on their Destruction, Second session, Geneva, 10-21 July, 1995, BWC/AD HOC GROUP/28.<br />
22M.R. Dando/G.S. Pearson: a.a.O. (Anm. 7)~ A. Kelle: Atombombe des kleinen Mannes? Die Bekämpfung der<br />
Weiterverbreitung von biologischen Waffen nach der Vierten Überprüfungskonferenz des Biowaffen<br />
Übereinkommens, in: Hessische Stiftung Friedens- und Konflikt-Forschung Report 6/1977; O. Thränert: Die<br />
Stärkung des Verbots biologischer Waffen, in: Spektrum der Wissenschaft, Januar <strong>1997</strong>, S. 108-110.<br />
23United Nations: Final Document Fourth Review Conference of the Parties to the Convention on the<br />
Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin Weapons<br />
and on their Destruction, Geneva 25 November - 6 December 1996, BWC/CONF.IV/9.
7<br />
So konnte die Konferenz sich nicht auf ein genaues Zieldatum :fur den Abschluß der<br />
Verhandlungen der Ad Hoc Gruppe einigen. Einige Vertragsstaaten wollten z.B. 1998 als<br />
Zieldatum setzen, andere haben argumentiert, daß die Ad Hoc Gruppe nicht unter solchen<br />
definitiven Termindruck gestellt werden sollte; dies könnte sonst zur Vereinbarung allgemein<br />
ungewünschter Kompromisse :fuhren.<br />
2. Artikel I<br />
Bei der Überprüfung der Formulierungen des Artikel I wurde weiterhin Sorge über die<br />
Reichweite der Verbote im Hinblick auf neue technologische Entwicklungen zum Ausdruck<br />
gebracht:<br />
" The Conference, conscious of apprehensions arlSlng from relevant scientijic and<br />
technological developments, inter alia. in the fields of microbiology, biotechnology,<br />
molecular biology, genetic engineering, and any applications resultingfrom genome studies,<br />
and. the possibilities 0/ their use for purposes inconsistent with the objectives· and the<br />
provisions of the Convention, reaffirms that the undertaking given by the States Parties in<br />
Article I applies to allsuch developments."<br />
Neu hinzugekommen ist die Bezeichnung ,,molecular biology" und die Phrase "and any<br />
applications resultingfrom genome studies H.<br />
Die immer wiederholten Versicherungen bezüglich des Umfangs der Verbote spiegeln die<br />
ständigen Besorgnisse der Vertragsstaaten um die· rasanten Entwicklungen in der<br />
Biotechnologie bzw. der Gentechnik wider. Daß diese Versicherungen jedoch stets Konsens<br />
bei den Delegierten zu den Überprüfungskonferenzen finden, ist eine klare Bestätigung der<br />
Stärke des Artikel I, der in diesem Zusammenhang den Test der Zeit bestanden hat.<br />
3. Artikel X.<br />
Ein Problemfeldist im potentiellen Konflikt zwischen Artikel IU und Artikel X der BWC zu<br />
finden. In Artikel IU verpflichtet sich jeder Vertragsstaat "... die in Artikel I bezeichneten<br />
Agentien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel an niemanden unmittelbar oder<br />
mittelbar weiterzugeben ... ", während sich in Artikel X die Vertragsstaaten verpflichten: " ...<br />
den weitestmöglichen Austausch von Ausrüstungen, Material und wissenschaftlichen und<br />
technologischen Informationen zur Verwendung bakteriologischer (biologischer) Agentien<br />
und von Toxinen für friedliche Zwecke ... zu erleichtern ... Dieses Übereinkommen ist so<br />
durchzuführen, daß es keine Behinderung für die wirtschaftliche und technologische<br />
Entwicklung der Vertragsstaaten des Übereinkommens ... darstellt H.<br />
Es gab erwartungsgemäß viel Diskussion über Artikel X. Wie bei vergangenen<br />
Überprüfungskonferenzen wurde insbesondere die Rechtfertigung von Exportkontrollen<br />
kontrovers diskutiert. Während vor allem Vertreter der Blockfreien-Gruppen in<br />
Exportkontrollen eine Verletzung der Bestimmungen von Artikel X sehen, betrachten die<br />
meisten an Exportkontrollregimen beteiligten Länder diese als unverzichtbar zur Erfiillung von<br />
Artikel IU und damit als notwendigen Bestandteil eines gestärkten Regimes. In der<br />
Zusammenfassung des Vorsitzenden der Committee ofthe Whole 24 wurde berichtet:<br />
"Some participants considered that national export licensing systems were a necessary means<br />
to implement the obligation ofthis Article [Artikel IU]. It was pointed out that such measures<br />
24United Nations: a.a.O. (Anm. 23)
8<br />
should not hamper transfer oftechnology for peaceful purposes. Some delegations suggested<br />
that efforts to strengthen the Convention should include consideration 0/ multilaterallyagreed<br />
guidelines on the implementation 0/ Article 111 and recalled that under the<br />
Declaration of the Third Review Con/erence the implementation of this Article should<br />
continue to be subject to multilateral consideration. U<br />
Gleichzeitig blieb unklar, wie "multilateral" unter den Vertragsstaaten verstanden wurde. Die<br />
Botschafterin aus Indien gab in der letzten Plenarsitzung zu bedenken, daß das Wort<br />
"multilateral"· oft in Sitzungen verwendet wurde, um auf "kleinere, exklusive Gruppierungen"<br />
hinzudeuten.<br />
Die Konferenz beteuerte die wesentliche Bedeutung von Artikel X als integraler Teil der BWC.<br />
Einige Teilnehmer haben auf ihre besonderen. Kooperationsprogramme in diesem<br />
Zusammenhang hingewiesen. Es war die Meinung mehrerer Delegierter, daß keine<br />
Maßnahmen irgendwelche Restriktionen oder Begrenzungen des Transfers von<br />
wissenschaftlichem Wissen, Technologie, Ausrüstung oder Materialien für friedliche Zwecke<br />
auferlegen sollen. Bezüglich aktiver Programme des Transfers von Technologie wiesen einige<br />
Delegierten auf die positiven Entwicklungen in Zusammenhang mit der Convention on<br />
Biological Diversity sowie der Agenda 21 der UN Conference on Environment and<br />
Development hin. Schließlich wurden, inter alia, acht mögliche Maßnahmen, um den<br />
Austausch von Ausrüstung , Materialien sowie wissenschaftliche und technologische<br />
Informationen zu fördern, aufgelistet.<br />
4. Die Beteiligung von Non-governmental Organisations (NGOs) an der Vierten<br />
lJberprüßUngskonferenz<br />
Eine bis dahin nicht verwendete Form der Beteiligung von NGOs fand bei der Vierten<br />
lJberprüßUngskonferenz statt. Am Mittwoch, der 27. November beendete das Committee o/the<br />
Whole seine Sitzung frühzeitig um 16:30 Uhr, um NGOs Gelegenheit zu geben, Erklärungen<br />
abzugeben. Der Präsident derlJberprüßUngskonferenz, Ambassador Sir Michael Weston der<br />
UK, ßUngierteals Moderator, unterstützt durch Dr. Sola Ogunbanwo, der Gereralsekretär der<br />
Konferenz. Elfvon den insgesamt 15 NGOs haben Erklärungen vorgetragen:<br />
.. Federation ofAmerican Scientists<br />
• Pugwash Conferences on Science and World Affairs<br />
• Department ofPeace Studies, University ofBradford, UK<br />
• Friedrich-Ebert-Stiftung, Gepnany<br />
• International Network ofEngineers and Scientists for Global Responsibility<br />
• Max-Delbrück Center for Molecular Medicine, Germany<br />
• Stockholm International Peace Research Institute<br />
• Friends World Committee for Consultation<br />
• British Medical Association<br />
• Pharmaceutical Research and Manufacturers ofAmerica<br />
• Chemical and Biological Arms Control Institute<br />
Im Verhältnis zu den Zahlen von NGOs (etwa 160), die bei den Verhandlungen über den<br />
nuklearen Nichtverbreitungs-Vertrag (NPT) in New York 1995 vorhanden waren, war diese<br />
Beteiligung an der Vierten lJberprüßUngskonferenz äußerst bescheiden. Nichtsdestoweniger hat<br />
diese Partizipation der NGOs einen bedeutsamen Präzidenzfall im Rahmen der BWC<br />
geschaffen.
9<br />
Die Problematik um die Kernfragen zur Verifikation der BWC<br />
Die Verhandlungen über ein Verifikationsprotokoll zur BWC gestalten sich viel schwieriger als<br />
die Verhandlungen über die Verifikation der CWC. Hierfiir gibt es mehrere Gründe. Der dualuse-Charakter<br />
von biologischen Agenzien ist zum einen ausgeprägter als der von chemischen<br />
Kampfstoffen. Im Falle von biologischen Agenzien ist es äußerst schwierig, zivile Forschungsund<br />
Entwicklungsziele, auch· diejenigen· im B-Waffen-Schutz-Bereich, von Interessen eines<br />
potentiellen Aggressors zu trennen. Zum anderen sind mehrere biologische Agenzien in viel<br />
kleineren Mengen als chemische Kampfstoffe effektiv, und ausgehend auch von kleinen Proben<br />
können relevante Mengen von Mikroorganismen schnell gezüchtet werden. Dies stellt<br />
naturgemäß besondere Erfordernisse an ein·Verifikationsregime. Bei den Verhandlungen der<br />
Ad Hoc Gruppe werden einige Kernfragen als besonders problematisch betrachtet.<br />
Artikel X<br />
Es wurde schon aufdie Problematik der Verhandlungen über Artikel X im Rahmen der Vierten<br />
Überprüfungskonferenz hingewiesen (s. oben). Die Debatte um Exportkontrollen im Hinblick<br />
auf die Bestimmungen in Artikel III und seine Implikationen rur die Durchfiihrung der<br />
Bestimmungen in Artikel X ist bis jetzt eine sehr polarisierende gewesen. Die Ad Hoc Gruppe<br />
wird sich in der nächsten Zeit intensiver damit befassen.<br />
Listen von Agentien und die Festlegung erlaubter Höchstmengen (threshold quantities) solcher<br />
Agentien .<br />
Sehr kontrovers ist die Debatte über die Erfassung und Führung. einer Liste einschlägiger<br />
Agentien und die Festlegung unzulässiger Mengen solcher Agentien. Von einer Seite wird<br />
argumentiert, daß die umfassende Formulierung der Verbote im Artikel I der BWC den Test<br />
der Zeit bestanden habe, und eine Liste der Agentien und die Festlegung der maximal erlaubten<br />
Mengen Artikel I nur einengen und sogar Schlupflöcher erzeugen würde. Die Problematik<br />
dahinter wird in der CWC an einem Beispiel .deutlich. Die Verwendung von Toxinen als<br />
Kampfstoffe ist in der CWC verboten. Erlaubte Höchstmengen bezüglich der Produktion<br />
potentieller Kampfstoffe werden rur die giftigsten Chemikalien, die in einer Liste in Schedule I<br />
der CWC zu finden sind, festgelegt. Nach diesen Regelungen darf ein Vertragsstaat nicht mehr<br />
als·· insgesamt eine Tonne von allen Stoffen dieser Kategorie besitzen.· Nicht mehr .als 10 Kilo<br />
solcher Stoffe dürfen pro Herstellungseinrichtung für medizinische, pharmazeutische oder<br />
Forschungszwecke in einem Jahr produziert werden. Ferner muß jede Einrichrung, die mehr als<br />
100 g pro Jahr herstellt, eine Deklaration einreichen 25 . Es bestehen also klare Bestimmungen<br />
bezüglich erlaubter Höchstmengen der giftigtsten Chemikalien. Das problematische liegt daran,<br />
daß diese Regelungen sich nur auf die Chemikalien, die tatsächlich auf der Schedule I Liste<br />
stehen, beziehen, und lediglich zwei Toxine, Ricin und Saxitoxin, stehen auf diese Liste. Alle<br />
Toxine sind zwar als Kampfstoffe verboten, aber die Bestimmungen bezüglich erlaubter<br />
Höchstmengen bei der Produktion von Toxinen umfassen lediglich Ricin und Saxitoxin. Dies<br />
zeigt, wie problematisch die Führung einer Liste sein kann.<br />
Ein Hauptargument gegen die Festlegung von threshold quantities rur die BWC liegt in der<br />
Berurchtung, daß dadurch Schlupflöcherer erzeugt werden können. In diesem Falle wird darauf<br />
hingewiesen, daß Mengen insgesamt wenig Bedeutung rur Mikroorganismen haben, die aus<br />
sogar winzigen Proben schnell zu relevanten Mengen gezüchtet werden können. Es wird ferner<br />
argumentiert, daß die Mengen von Agentien, die rur erlaubte Zwecke benötigt werden,<br />
kontinuierlich mit der Zunahme wachsender friedlicher Anwendungen steigen. In diesem<br />
Zusammenhang finden einige Toxine einen Einsatz als Therapeutika, z.B. das Ricin-Toxin bei<br />
25United Nations: a.a.O. (Anm. 17)
10<br />
Krebserkrankungen 26 oder die Botulinumtoxine und das Tetanustoxin bei neurologischen<br />
Krankheiten 27 . In einem Artikel über die Ambivalenz von 'Toxinen 28 wurde seitens der<br />
pharmazeutischen Industrie geschätzt, daß die Mengen von Toxinen, die fur therapeutische<br />
Zwecke im Jahr 2000 benötigt werden, im Bereich von 100 Kilogramm oder auch mehr liegen<br />
werden. Obwohl diese Angaben bezüglich der benötigten Mengen an Toxinen fur<br />
therapeutische Zwecke grob überschätzt erscheinen, deuten sie auf das Dilemma bei der<br />
Festlegung von erlaubten Höchstmengen hin: einerseits wird eine Kontrolle über die<br />
Produktion toxischer Stoffe benötigt, anderseits dürfen die zivilen Nutzungsmöglichkeiten<br />
dabei nicht eingeschränkt werden.<br />
Von einer anderen Seite wird hingegen argumentiert, daß das Fehlen klarer Angaben zu Art<br />
und Obergrenzen der verbotenen oder deklarationspflichtigen Agentien in Artikel I der Bwe<br />
sowohl das Deklarations- als auch das überprüfungsverfahren deutlich erschweren würde.<br />
Gegenwärtig diskutiert die Ad Hoc Gruppe 29 über eine Liste von humanpathogenen<br />
Mikroorganismen und Toxinen 30 , die möglicherweise fur .Deklarationzwecke als trigger<br />
benutzt werden soll: eine<br />
" ..list of human.pathogens and toxins was discussed by the Group and recognized to be<br />
relevant for developing a list or lists of bacteriological (biological) agents and toxins for<br />
specific measures [in particular for initiating or triggering declarations} to strengthen the<br />
Convention (t<br />
Diese Liste enthält gegenwärtig 17 Viren, 8 Bakterien, 3 Rickettsien, einen Pilz und 14 Toxine,<br />
die nach bestimmten Kriterien als relevant bezeichnet werden. Nur mit einer solchen<br />
einheitlichen und übersichtlichen Liste, so die Argumentation, könnten die Erklärungen der<br />
Vertragsstaaten vergleichbar gemacht und bewertet werden. Eine solche Liste könnte zugleich<br />
auch als Ausgangspunkt der Inspektionen nützlich sein, ohne daß allerdings der Umfang bzw.<br />
das Ausmaß einer Inspektion durch diese Liste beschränkt werden dürfe 31 .<br />
Inspektionen<br />
In der ewe sind sowohl challenge inspections (Inspektionen, die in einem Verdachtsfall<br />
durchgefuhrt werden) als auch Routineinspektionen vorgesehen. Hierzu hat die chemische<br />
Industrie eine durchaus positive Rolle in der Akzeptanz beider Elemente des Regimes gespielt.<br />
Beim derzeitigen Stand der Verhandlüngen der Ad Hoc Gruppe besteht weitgehende Einigkeit<br />
unter den Vertragsstaaten bezüglich der Notwendigkeit von challenge inspections in einem<br />
BWC-Verifikationsregime, keine Einigkeit jedoch über die Notwendigkeit von<br />
Routineinspektionen. PhRMA, eine· Gruppe von über 60 pharmazeutische und biotechnische<br />
26G.M. Mota/M. Margineanu/ R. Marches/ M. Nicolae/A. Bancu/I. Moraru: Experimental model for testing the<br />
efficiency ofimmunotoxins administered in vivo: Evaluation oftwo ricin A-chain-multivalent antibody<br />
immunotoxins, in: Immunology Letters, Vol. 20, 1989, S. 282-292.<br />
27E.J. Schantz/E.A. Johnson: Properties and use ofbotulinum toxin and other microbial neurotoxins in<br />
medicine, in: Microbiological Reviews, Vol. 56, 1992, S. 80-90.<br />
28J.B. Tucker: Dilemmas ofa dual-use technology: toxins in medicine and warfare, in: Politics and the Life<br />
Sciences, Vol. 13, 1994, S. 51-62.<br />
2~nited Nations: Annex I. Procedural Report ofthe Ad Hoc Group ofthe States Parties to the Convention on<br />
the Prohibition ofthe Development, Production and Stockpiling ofBacteriological (Biological) and Toxin<br />
Weapons and on theirDestruction, Seventh Session, Geneva 14 July - 1 August <strong>1997</strong>. BWC/AD HOC<br />
GROUP/36.<br />
30Auch Listen von tier- undpflanzenpathogenen Mikroorganismen werden von der Ad Hoc Gruppe diskutiert,<br />
in Anerkennung der Tatsache, daß biologische Kriegführung gegen Tiere und Pflanzen gerichtet werden kann.<br />
31G.S. Pearson: A Verification Regime for the Biological and Toxin Weapons Convention: The essential<br />
elements, 1995, D/ACSA(NP)1/4 (201/95).
11<br />
Firmen, ist ein starker Vertreter dieses Standpunkts und hat.ihre Position bei der Vierten<br />
überprüfungskonferenz der BWe 1996 klar dargestellt: ~~. ,<br />
" On-site Inspections Must Be Limited to Challenge Inspections ,,32<br />
Die pharmazeutische und biotechnische Industrie in den USA ist weltweit führend und<br />
befürchtet daher erhebliche Wettbewerbsnachteile und finanzielle Verluste durch Inspektionen<br />
und die Offenlegung von sensiblen Informationen 33 . Ferner hat diese Industrie bekanntgegeben,<br />
daß sie nur ein sogenanntes "grünes-Lieht-Verfahren" unterstützen kann 34 . Es ist z.B. in der<br />
ewe vorgesehen, daß ein Verdachtsfall durch ein Exekutivkommittee von 41 Vertragsstaaten<br />
überprüft werden soll. Eine challenge inspection wird dann eingeleitet, außer wenn dreiviertel<br />
der Mitglieder des Kommittees durch ein Votum innerhalb von 12 Stunden das Verfahren<br />
aufhalten, ein sogananntes "rotes-Lieht-Verfahren". Bei einem grünen-Licht Verfahren wird<br />
eine challenge inspection nur dann überhaupt eingeleitet, wenn dreiviertel der Mitglieder des<br />
Kommittees zustimmen.<br />
Dieser unbewegliche Stand der pharmazeutischen und biotechnischen Industrie gegenüber<br />
Vorort-Inspektionen kann möglicherweise durch die Tatsache erklärt werden, daß die<br />
biotechnische Komponente dieser Industrie insbesondere stark wächst und die Spitze ihres<br />
Wachstums noch nicht erreicht hat. Der Wettkampf ist grimmig und in dieser prekären Phase<br />
ist die Existenzangst besonders ausgeprägt.<br />
Obwohl die Verhandlungen über ein Verifikationsregime sich· schwierig gestalten, ist der<br />
politische Wille zur Stärkung der Bwe über die letzen Jahren erheblich gewachsen 35 . Die Ad<br />
Hoc Gruppe hat· beachtliche Fortschritte· gemacht, auch wenn die Vertragsstaaten von einer<br />
Einigung über manche Kernfragen noch weit entfernt sind. Als positiv zu bezeichnen ist das<br />
Intensivieren der Verhandlungen der Ad Hoc Gruppe seit der Vierten überprüfungskonferenz<br />
und der Übergang zu einer Rolling Text Art der Verhandlungen, in der das eigentliche Regime<br />
ausgehandelt wird.<br />
32PhRMA: Reducing the threat ofbiological weapons - a PhRMA perspektive. Statement presented at the<br />
Fourth Review Conference ofthe BWC, 25.11.96.<br />
33A. Holmberg: Industry concems regarding disclosure ofpropriety information, in: K. C. Bailey (ed.),<br />
Director's Series on Proliferation. National Technical Information Service, Springfield, VA, May, 1994, S. 91<br />
100.<br />
34PhRMA: a.a.O. (Anm. 32).<br />
35M. I. Chevrier: From verification to strengthening compliance: prospects and challenges ofthe Biological<br />
Weapons Convention, in: Politics and the Life Sciences, 1995, Vol. 14, S. 209-219; M.R. Dando/G.S. Pearson:<br />
a.a.O. (Anm. 7).
IANUS-Publikationsreihe<br />
Seit 1989 veröffentlicht IANUS Arbeitspapiere in einer eigenen Reihe. Exemplare sind auf Anfrage<br />
zum Selbstkostenpreis erhältlich. Die vollständige Liste kann angefordert werden bei:<br />
IANUS, TU Darmstadt, zu Hd. Brigitte Schulda,<br />
Hochschulstr. 10, D-64289 Darmstadt.<br />
Since 1989 working papers of IANUS have been published. Copies can be sent on request at cost<br />
price. A complete list can be ordered from:<br />
IANUS, TU Darmstadt, attn. Brigitte Schulda,<br />
Hochschulstr. 10, D-64289 Darmstadt, Germany.<br />
IANUS 1/1995<br />
IANUS 2/1995<br />
IANUS 3/1995<br />
IANUS 4/1995<br />
IANUS 1/1996<br />
IANUS 1A/1996<br />
IANUS 2/1996<br />
IANUS 3/1996<br />
IANUS 4/1996<br />
IANUS 5/1996<br />
IANUS 1/<strong>1997</strong><br />
IANUS 2/<strong>1997</strong><br />
IANUS 3/<strong>1997</strong><br />
IANUS 4/<strong>1997</strong><br />
IANUS 5/<strong>1997</strong><br />
IANUS 6/<strong>1997</strong><br />
IANUS 1/1998<br />
IANUS 2/1998<br />
IANUS 3/1998<br />
IANUS 4/1998<br />
W. Liebert,<br />
"After the NPT Review and Extension Conference: Results and Perspectives"<br />
B. Gotthold, "Conditio Humana und die Technik des 20.Jahrhunderts - Hannah Arendts<br />
Gedanken zu Naturwissenschaft und Technik aus heutiger Perspektive"<br />
W. Liebert,<br />
"Die Hanauer Brennelementefabrik ist tot - Es lebe Hanau für die Abrüstung'?, "<br />
I. Stumm, J. Brauburger, K. Nixdorff,<br />
"Haben Toxinwaffen militärische Relevanz?"<br />
M.B. Kalinowski, "Computersimulationen und subkritische Kernwaffentests"<br />
M.B. Kalinowski, "Virtual Nuclear Tests - Can the Comprehensive Test Ban Treaty be<br />
Circumvented by Computer Simulations?"<br />
D. Hahlbohm, K. Nixdorff, "Stand und Probleme der Verhandlungen zur Stärkung der<br />
Biologischen-Waffen-Konvention"<br />
M.B. Kalinowski, "Kritierien für Ganzwelt- und Zukunftsorientierung"<br />
J. Scheffran, "Frieden und nachhaltige Entwicklung"<br />
J. Scheffran, "Konfliktfolgen energiebedingter Umweltveränderungen am Beispiel des<br />
globalen Treibhauseffekts"<br />
W. Bender, "Ethische Dimensionen nachhaltiger Entwicklung"<br />
W. Liebert, "Gestaltung von Forschung und Technik.<br />
- Wertfreiheit oder Wertbindung der Wissensschaft.<br />
- Reformbedarf für eine zukunftsfähige Hochschule in der Gesellschaft."<br />
Drei Vorträge an der Technischen Hochschule Darmstadt<br />
J. Scheffran, "ModelIierung von Umweltkonflikten und nachhaltiger Entwicklung.<br />
Anwendungsmöglichkeiten in der Klima- und Energiepolitik"<br />
W. Liebert, "The Use of Highly-Enriched Uranium (HEU) in Research Reactors:<br />
Implications for Proliferation"<br />
M.B. Kalinowski, "Perspektiven der nuklearen Abrüstung"<br />
K. Nixdorff<br />
"Gefährduna durch biologische Agenzien" und "Die Biologische-Waffen-Konvention"<br />
W. Krabs,S. Pickl, "Time-Discrete Dynamical Games"<br />
M.E. Hummel, J. Scheffran, H.-R. Simon (Hrsg.),<br />
Konfliktfeld Biodiversität<br />
M.B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss, "Rückschließbarkeit auf<br />
Plutoniumabtrennungen durch Auswertung von Messungen des atmosphärischen<br />
Krypton-85in Wochenproben bei verschiedenen Abständen von der<br />
Wiederaufarbeitungsanlaae Karlsruhe"<br />
W. Bender, "Ethische Aspekte prospektiver Technikbewertung: Das Beispiel<br />
Kernfusion". Antrittsvorlesung im Fachbereich Gesellschafts- und<br />
Geschichtswissenschaften der Technischen Universität Darmstadt