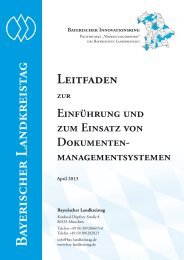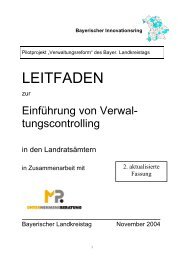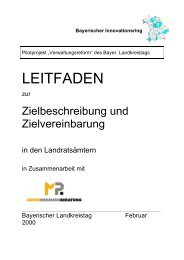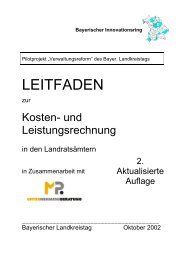Strategische Steuerung der Sozial- und Jugendhilfe in Zeiten des ...
Strategische Steuerung der Sozial- und Jugendhilfe in Zeiten des ...
Strategische Steuerung der Sozial- und Jugendhilfe in Zeiten des ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bayerischer Landkreistag<br />
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong><br />
<strong>des</strong> demografischen<br />
Wandels<br />
Dokumentation<br />
<strong>der</strong> 44. Landrätetagung<br />
am 17./18.10.2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld,<br />
Landkreis Bamberg<br />
Bayerischer Landkreistag<br />
Kard<strong>in</strong>al-Döpfner-Straße 8<br />
80333 München<br />
Telefon +49 (0) 89/286615-0<br />
Telefax +49 (0) 89/282821<br />
<strong>in</strong>fo@bay-landkreistag.de<br />
www.bay-landkreistag.de
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
2 <strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
3 Tagungsbericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
4 Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen<br />
Entwicklung für das Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen . . . . . . . . . . . 23<br />
5 Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik: Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
6 Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser, auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich . . . . . 50<br />
7 Arbeitsgruppe 1:<br />
Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
8 Arbeitsgruppe 2:<br />
Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
9 Arbeitsgruppe 3:<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge . . . . . . . . . . . . . 97<br />
Impressum:<br />
Herausgeber:<br />
Bayerischer Landkreistag<br />
Kard<strong>in</strong>al-Döpfner-Straße 8<br />
80333 München<br />
Telefon (089) 286615-0<br />
Telefax (089) 282821<br />
<strong>in</strong>fo@bay-landkreistag.de<br />
www.bay-landkreistag.de<br />
Für den Inhalt verantwortlich:<br />
Johannes Reile<br />
Geschäftsführen<strong>des</strong> Präsidialmitglied<br />
<strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags<br />
Herstellung:<br />
Sebastian Weiss OHG<br />
Werftstraße 11<br />
94469 Deggendorf<br />
2
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Dr. Jakob Kreidl, Präsident <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags<br />
Seit Jahren steigen die <strong>Sozial</strong>ausgaben <strong>der</strong> Kommunen <strong>in</strong> Deutschland unaufhörlich.<br />
Die f<strong>in</strong>anziellen Belastungen liegen zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> <strong>der</strong> Fallzahlsteigerung,<br />
zum an<strong>der</strong>en <strong>in</strong> neuen B<strong>und</strong>esgesetzen, die die Lösung gesamtgesellschaftlicher<br />
Problemlagen wie z. B. den Schutz vor Altersarmut auf die Kommunen abwälzen.<br />
Auch wenn <strong>in</strong> jüngster Zeit B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Län<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Übernahme <strong>der</strong> Kosten für<br />
die Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> dem <strong>in</strong> Aussicht<br />
gestellten B<strong>und</strong>esleistungsgesetz für E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungshilfe erste Schritte <strong>der</strong> Abhilfe<br />
unternommen bzw. angekündigt haben, s<strong>in</strong>d die von den kommunalen Spitzenverbänden<br />
erarbeiteten E<strong>in</strong>zelvorschläge aus dem Jahr 2005 auf B<strong>und</strong>esebene im<br />
Sand verlaufen. Hohe <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>ausgaben schlagen sich nicht nur <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er nachlassenden Investitionstätigkeit <strong>der</strong> Kommunen nie<strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n reduzieren<br />
auch <strong>der</strong>en Handlungs- <strong>und</strong> Gestaltungsspielräume bei <strong>der</strong> Bekämpfung<br />
<strong>der</strong> negativen Folgen <strong>des</strong> demografischen Wandels.<br />
S<strong>in</strong>d die Regionen <strong>in</strong> Bayern unterschiedlich von Ab- <strong>und</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Menschen betroffen, gilt die Verschiebung<br />
<strong>der</strong> Altersschichtung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft für alle gleich. Immer weniger K<strong>in</strong><strong>der</strong> werden geboren, immer mehr<br />
Menschen freuen sich über e<strong>in</strong>e höhere Lebenserwartung. Gesamtwirtschaftlich betrachtet wird sich das Verhältnis<br />
von Erwerbstätigen zu Transferleistungsempfängern <strong>in</strong> den nächsten Jahrzehnten dramatisch verschlechtern. In den<br />
von Abwan<strong>der</strong>ung betroffenen Regionen s<strong>in</strong>d die Auswirkungen dieser Entwicklung schon heute spürbar. In etwa<br />
zehn Jahren werden auch die heutigen Zuzugsregionen betroffen se<strong>in</strong>.<br />
Die negativen Folgen <strong>des</strong> demografischen Wandels betreffen die Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> die <strong>in</strong> ihnen lebenden Menschen<br />
unmittelbar. Nur e<strong>in</strong>e demografieorientierte <strong>und</strong> aktive Familienpolitik kann dem Wandel entgegenwirken. Im kreisangehörigen<br />
Raum sollten diese Maßnahmen s<strong>in</strong>nvollerweise vom Landkreis geplant <strong>und</strong> entwickelt werden; gelebt<br />
werden müssen sie aber auf Geme<strong>in</strong>deebene. Mittelfristiges Ziel muss es se<strong>in</strong>, junge Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region <strong>in</strong> die<br />
Lage zu versetzen, Eltern se<strong>in</strong> zu können <strong>und</strong> zu wollen. Dies setzt neben ökonomischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />
Bildung vor allem e<strong>in</strong>e familienunterstützende Infrastruktur <strong>und</strong> Dienstleistungen voraus. Passgenaue Angebote vor<br />
Ort müssen zielgerichtet geplant <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anziert werden. Sofern die Kommunen sich zu e<strong>in</strong>er aktiven Familienpolitik<br />
verpflichten, werden sie nicht nur für e<strong>in</strong>e bessere F<strong>in</strong>anzausstattung kämpfen, son<strong>der</strong>n auch eigene <strong>Steuerung</strong>spotenziale<br />
heben müssen. Da die f<strong>in</strong>anzpolitischen For<strong>der</strong>ungen seit geraumer Zeit ausformuliert <strong>und</strong> gegenüber <strong>der</strong><br />
B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Lan<strong>des</strong>regierung erhoben s<strong>in</strong>d, hat die diesjährige Klausurtagung <strong>der</strong> bayerischen Landräte den Fokus<br />
auf die strategische <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> gerichtet.<br />
Welche Lösungsansätze die bayerischen Landräte <strong>in</strong> den Arbeitsgruppen 1 (ab Seite 45), 2 (ab Seite 60) <strong>und</strong> 3 (ab<br />
Seite 73) entwickelt haben, aber auch die strategischen Vorüberlegungen (ab Seite 4), <strong>der</strong> Tagungsbericht (ab Seite 20)<br />
<strong>und</strong> die Hauptbeiträge <strong>der</strong> Fachreferenten, werden <strong>in</strong> dieser Broschüre gut lesbar zusammengefasst.<br />
3
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Jungse<strong>in</strong> <strong>und</strong> Altwerden im ländlichen Raum<br />
Neubetrachtung nach fünf Jahren<br />
o<strong>der</strong><br />
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Der Bayerische Landkreistag hatte sich im Rahmen <strong>des</strong> Landrätesem<strong>in</strong>ars am 16. <strong>und</strong> 17. Oktober 2007 <strong>in</strong> Bad Kiss<strong>in</strong>gen<br />
unter <strong>der</strong> Überschrift „Jungse<strong>in</strong> <strong>und</strong> Altwerden im ländlichen Raum“ schwerpunktmäßig mit den Leistungen<br />
<strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> als Zukunftsaufgaben <strong>der</strong> bayerischen Landkreise ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>gesetzt. Auslöser waren se<strong>in</strong>erzeit<br />
die sich immer deutlicher abzeichnende Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum sowie gewandelte Lebens-,<br />
Erwerbs- <strong>und</strong> Familienbiografien wie auch verän<strong>der</strong>te Werthaltungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bevölkerung, die e<strong>in</strong>e Anpassung<br />
<strong>der</strong> Leistungsgewährung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> notwendig ersche<strong>in</strong>en ließen. Die Landräte hatten se<strong>in</strong>erzeit<br />
e<strong>in</strong>en umfangreichen For<strong>der</strong>ungs- <strong>und</strong> Eckpunktekatalog erarbeitet, <strong>der</strong> <strong>in</strong> die politische Diskussion auf B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong><br />
Lan<strong>des</strong>ebene e<strong>in</strong>gebracht wurde. Nach fünf Jahren soll das Thema „Jungse<strong>in</strong> <strong>und</strong> Altwerden im ländlichen Raum“<br />
erneut e<strong>in</strong>er vertieften Betrachtung unterzogen werden. Dabei gilt es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e neue Entwicklungen zu berücksichtigen,<br />
aber auch das se<strong>in</strong>erzeit angedachte Konzept für e<strong>in</strong>e strategische <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> zu<br />
entwickeln.<br />
1. Weitere Verschlimmerung <strong>der</strong> Ausgangslage<br />
Dass sich die demografische Entwicklung <strong>in</strong> den vergangenen fünf Jahren nicht verbessert hat, wird u. a. daran erkennbar,<br />
dass die Überalterung <strong>der</strong> Gesellschaft <strong>und</strong> die fortschreitende Urbanisierung als Dauerthemen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tagespolitik<br />
angekommen s<strong>in</strong>d. Das Gutachten <strong>des</strong> Zukunftsrats Bayern <strong>und</strong> <strong>des</strong>sen öffentliche Wahrnehmung, aber auch Demografieberichte<br />
e<strong>in</strong>zelner Landkreise (z. B. Landkreis Regen vom März 2011) <strong>und</strong> Strategiekonzepte ganzer Regionen (z.<br />
B. „Aufbruch jetzt! Nie<strong>der</strong>bayern“ vom Juli 2011) lassen erkennen, wie dramatisch <strong>der</strong> Problem- <strong>und</strong> Handlungsdruck<br />
im ländlichen Raum mittlerweile auch von <strong>der</strong> Politik gesehen wird.<br />
Für städtische Verdichtungsgebiete <strong>und</strong> ländliche Räume weitgehend e<strong>in</strong>heitlich s<strong>in</strong>d die Entwicklungen <strong>der</strong> abnehmenden<br />
Geburtenrate bei permanent steigen<strong>der</strong> Lebenserwartung sowie <strong>des</strong> zunehmenden Bedarfs an Integrationsleistungen<br />
für Menschen mit E<strong>in</strong>schränkungen jeglicher Art. Was „die Stadt“ vom „Land“ unterscheidet, ist <strong>der</strong> permanent<br />
positive Wan<strong>der</strong>ungssaldo, also die Sogwirkung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Leistungszentren bzw. die Entleerung <strong>der</strong><br />
ländlichen Räume. E<strong>in</strong>en gegenseitigen Verstärkungseffekt erlangen die genannten Entwicklungen dadurch, dass sich<br />
gerade jüngere, besser ausgebildete Menschen als mobil erweisen, mit dramatischen Konsequenzen für die ländlichen<br />
Räume, denen <strong>in</strong> den nächsten Jahrzehnten ganze Generationen von zukünftigen Eltern ausfallen werden.<br />
Bayern steht bei dieser Problembeschreibung ke<strong>in</strong>eswegs alle<strong>in</strong>, son<strong>der</strong>n nähert sich vielmehr e<strong>in</strong>er Entwicklung an,<br />
die bereits seit zwei Jahrzehnten symptomatisch für die östlichen B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong> ist. Ähnlich wie dort darf jedoch nicht<br />
<strong>der</strong> falsche Schluss gezogen werden, dass diese Entwicklung schicksalsergeben h<strong>in</strong>genommen werden muss, son<strong>der</strong>n<br />
dass e<strong>in</strong> Umsteuern durch e<strong>in</strong>e aktive <strong>und</strong> aktivierende Politik möglich ist. Beson<strong>der</strong>s erkennbar wird dies <strong>in</strong> <strong>der</strong> b<strong>und</strong>esweiten<br />
Perspektive an zwei Beispielen von ehemals agrar<strong>in</strong>dustriell geprägten ländlichen Räumen im Nordwesten,<br />
<strong>der</strong> Euregio-Region sowie dem Oldenburger Münsterland („Silicon Valley <strong>der</strong> Agrartechnologie“). In beiden zwischen<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>und</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen gelegenen Regionen ist es gelungen, durch e<strong>in</strong>e kluge Clusterpolitik e<strong>in</strong>en<br />
sich selbst verstärkenden Zuzugstrend anzustoßen. Entgegen <strong>der</strong> landläufigen Me<strong>in</strong>ung, dass die Menschen den Arbeitsplätzen<br />
folgen würden, müsste man richtigerweise formulieren: Die Menschen folgen Innovationen.<br />
4
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Abbildung 1: Bevölkerungsprognose Bayern bis 2030<br />
Quelle: Lan<strong>des</strong>amt für Statistik <strong>und</strong> Datenverarbeitung (2011): Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern: Gesammelte Ergebnisse<br />
für alle kreisfreien Städte <strong>und</strong> Landkreise bis 2030 sowie Lan<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Bezirksergebnisse, S. 14<br />
Die Trends <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bevölkerungsentwicklung Bayerns s<strong>in</strong>d spätestens seit dem Gutachten <strong>des</strong> Zukunftsrats 1 weith<strong>in</strong><br />
bekannt. Alles sche<strong>in</strong>t nach dem Großraum München zu streben (vgl. Abbildung 1). Die Wachstumsprognosen <strong>der</strong><br />
Lan<strong>des</strong>hauptstadt sowie <strong>der</strong> umliegenden Landkreise für die kommenden 20 Jahre liegen z. T. im zweistelligen Prozentbereich.<br />
Selbst die weiteren Oberzentren Augsburg <strong>und</strong> Nürnberg mit ihren umliegenden Regionen entwickeln<br />
sich auf deutlich ger<strong>in</strong>gerem Niveau. E<strong>in</strong>igermaßen stabil bleiben daneben alle<strong>in</strong> noch die Regionen entlang <strong>der</strong><br />
überregionalen Autobahnen (A 3, A 6, A 8 sowie A 9). Beson<strong>der</strong>s negativ s<strong>in</strong>d die Perspektiven für das nördliche Unterfranken,<br />
das nördliche Oberfranken, den gesamten Bayerischen Wald sowie Teile von Westmittelfranken <strong>und</strong> <strong>des</strong><br />
nördlichen Schwabens.<br />
1<br />
Bericht <strong>des</strong> Zukunftsrates <strong>der</strong> Bayerischen Staatsregierung, Dezember 2010.<br />
5
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Abbildung 2: Entwicklungspotenziale <strong>der</strong> Regionen <strong>in</strong> Bayern<br />
Quelle: Zukunftsrat Bayern, Dezember 2010, S. 52.<br />
Die Schlussfolgerung <strong>des</strong> Zukunftsrats Bayern aus den von ihm getroffenen Modellannahmen, die raumplanerische<br />
Weiterentwicklung Bayerns auf die bestehenden Leistungszentren <strong>und</strong> <strong>der</strong>en angrenzende ländliche Räume zu konzentrieren<br />
<strong>und</strong> peripher gelegene Regionen (nördliches Oberfranken, südöstliches Nie<strong>der</strong>bayern) auf benachbarte<br />
regionale Zusammenhänge (nach Thür<strong>in</strong>gen/Sachsen bzw. Oberösterreich) zu verweisen (vgl. Abbildung 2), wurde <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Öffentlichkeit sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Politik außerordentlich strittig diskutiert. Dabei hat <strong>der</strong> Zukunftsrat <strong>in</strong>nerhalb <strong>des</strong> von<br />
ihm gewählten Modellrahmens nur Entwicklungen beschrieben, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Raumordnungspolitik längst bekannt s<strong>in</strong>d<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong>en Schlussfolgerungen bereits Realität s<strong>in</strong>d, wenn man den Aufbau <strong>der</strong> Euregio Egrensis <strong>in</strong> Nordostbayern<br />
sowie <strong>der</strong> Europaregion Donau-Moldau <strong>in</strong> Südostbayern betrachtet. Än<strong>der</strong>t man den Fokus <strong>des</strong> Zukunftsrats Bayern<br />
von <strong>der</strong> Betonung <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalen Wettbewerbsfähigkeit Bayerns auf die Betonung <strong>der</strong> Gleichwertigkeit <strong>der</strong><br />
Lebensverhältnisse <strong>in</strong>nerhalb Bayerns, muss man jedoch als Gegenthese formulieren: Nicht Starke durch zusätzliche<br />
6
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
För<strong>der</strong>ung weiter stärken, son<strong>der</strong>n Schwache för<strong>der</strong>n, um e<strong>in</strong> Innovationspotenzial zu schaffen, das für die Initiierung<br />
e<strong>in</strong>es eigendynamischen Multiplikatoreffekts notwendig ist.<br />
Das Problem für den ländlichen Raum besteht dar<strong>in</strong>, dass junge, gut ausgebildete Menschen zum Studium <strong>und</strong> zur<br />
Ausbildung <strong>in</strong> die Zentren abwan<strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em unzureichenden Maße später zurück kehren. Junge Menschen aus<br />
an<strong>der</strong>en Regionen o<strong>der</strong> aus dem Ausland können wegen <strong>der</strong> nicht vorhandenen regionalen Aff<strong>in</strong>ität <strong>und</strong> <strong>der</strong> Standortkonkurrenz<br />
gegenüber den Leistungszentren kaum o<strong>der</strong> nur unter erheblichem Aufwand angelockt werden. Daraus<br />
entsteht e<strong>in</strong> Ungleichgewicht von Angebot <strong>und</strong> Nachfrage auf dem Fachkräfte- <strong>und</strong> Ausbildungsmarkt, das zu e<strong>in</strong>em<br />
Teufelskreislauf nach unten führt, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e zusätzliche Abwan<strong>der</strong>ung <strong>in</strong>novativer Betriebe aus dem ländlichen Raum<br />
zur Folge hat. Wissenschaftlich umschrieben wird dieser Teufelskreislauf mit dem Begriff <strong>der</strong> Peripherisierung von<br />
Regionen, 2 die vier Entwicklungsstufen umfasst. Die (a) Abwan<strong>der</strong>ung von Menschen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von qualifizierten<br />
<strong>und</strong> jungen, führt zur (b) Abschottung <strong>der</strong> Region, da mangels Zuwan<strong>der</strong>ung Innovationskraft <strong>und</strong> Wachstumsimpulse<br />
fehlen; die nachlassende Kraft, selbst Anstöße zur Abwendung <strong>der</strong> Entwicklung geben zu können, führt zur stärkeren<br />
(c) Abhängigkeit von För<strong>der</strong>mitteln übergeordneter Ebenen, die <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit <strong>der</strong> permanenten For<strong>der</strong>ung nach<br />
Unterstützung schließlich e<strong>in</strong>e (d) Stigmatisierung zur Folge hat. Ist die Stufe <strong>der</strong> Stigmatisierung erst erreicht, besteht<br />
nach den heutigen För<strong>der</strong>regularien kaum noch die Möglichkeit, e<strong>in</strong>e Trendumkehr herbeizuführen. Dem <strong>der</strong>zeit<br />
geltenden För<strong>der</strong>recht ist immanent, dass die För<strong>der</strong>er ihren Mittele<strong>in</strong>satz mit e<strong>in</strong>em <strong>Steuerung</strong>sanspruch verb<strong>in</strong>den,<br />
<strong>der</strong> die Innovationskraft <strong>und</strong> Eigenverantwortlichkeit vor Ort eher beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t als stärkt.<br />
Raumplanerisch gilt es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e über Forschungs- <strong>und</strong> Wissenschaftsbetriebe <strong>und</strong> –e<strong>in</strong>richtungen den Wissenstransfer<br />
<strong>in</strong> den ländlichen Raum zu transportieren, um das für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen notwendige<br />
Innovationspotenzial zu schaffen. E<strong>in</strong>e Ergänzung um Wirtschaftscluster sowie die Betonung <strong>der</strong> herausragenden<br />
Standortqualität <strong>des</strong> ländlichen Raums „kurze Wege zwischen Arbeitsplatz, Natur <strong>und</strong> Familie“ ersche<strong>in</strong>en wesentlich<br />
zukunftsträchtiger als die re<strong>in</strong>e Konzentration auf touristische Angebote sowie die Subventionierung bestehen<strong>der</strong>,<br />
u. U. nicht mehr zukunftsfähiger Arbeitsplätze.<br />
2. <strong>Sozial</strong>politische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Die Bevölkerungsentwicklung <strong>und</strong> die Wan<strong>der</strong>ungsbewegungen s<strong>in</strong>d mit Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> zwei Dimensionen<br />
verb<strong>und</strong>en. In <strong>der</strong> wirtschaftspolitischen Dimension geht es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um die Bereitstellung <strong>der</strong> notwendigen<br />
Infrastruktur, die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen, die Kopplung von Bildung, Ausbildung <strong>und</strong> dauerhaften<br />
Beschäftigungsverhältnissen sowie die Initiierung von Multiplikatoreffekten; <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialpolitischen Dimension<br />
stehen dagegen <strong>der</strong> Ausbau e<strong>in</strong>es bedarfsgerechten Systems <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung <strong>und</strong> –bildung sowie von familienunterstützenden<br />
Diensten, die Neuausrichtung <strong>der</strong> Altenpflege, die Intensivierung <strong>der</strong> Integrationspolitik sowie die<br />
Sicherung <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung im Mittelpunkt (sog. „weiche Standortfaktoren“). Die Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
haben <strong>in</strong> beiden Dimensionen unterschiedliche Zielsetzungen. Muss beispielsweise die Infrastruktur <strong>in</strong> Ballungsräumen<br />
eher quantitativ ausgebaut werden, ist <strong>in</strong> ländlichen Regionen eher e<strong>in</strong>e qualitative Weiterentwicklung gefor<strong>der</strong>t<br />
(z. T. auch e<strong>in</strong> Rückbau), um die nachlassenden Skaleneffekte auffangen zu können. Nur auf diese Weise können auch<br />
soziale Dienstleistungen bei abnehmen<strong>der</strong> Bevölkerungszahl zu vertretbaren Kosten angeboten werden.<br />
Aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> öffentlichen <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>träger geht es letztlich um das übergeordnete Thema <strong>der</strong><br />
Vermeidung von Armut bzw. sozialer Bedürftigkeit <strong>in</strong> allen Lebenslagen. Zwar ist <strong>der</strong> Armutsbegriff außerordentlich<br />
schillernd <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Def<strong>in</strong>ition umstritten – entsprechend unterschiedlich s<strong>in</strong>d die Ergebnisse empirischer<br />
Datenauswertungen zu den Fragen, wer als arm gilt <strong>und</strong> welche Konsequenzen damit verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d –, jedoch ist<br />
weitgehend anerkannt, dass es e<strong>in</strong>e Gesellschaftsschicht gibt, die von strukturell verfestigter Armut betroffen ist. 3<br />
2 Vgl. etwa Beißwenger, Sab<strong>in</strong>e/Weck, Sab<strong>in</strong>e (2011): Zwischen Abkopplung <strong>und</strong> Erneuerung - Umgang mit Peripherisierung <strong>in</strong> Mittelstädten, ILS-Trends,<br />
Ausgabe 3/2011, hrsg. v. ILS - Institut für Lan<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Stadtentwicklungsforschung gGmbH, Dortm<strong>und</strong>; Bernt, Matthias/Weck, Sab<strong>in</strong>e (2012): Peripherisierung,<br />
Schrumpfung <strong>und</strong> Governance: Handlungsansätze <strong>der</strong> Stadtpolitik <strong>in</strong> sechs deutschen Mittelstädten. In: Michael Haus <strong>und</strong> Sab<strong>in</strong>e Kuhlmann (Hrsg.):<br />
Lokale Politik <strong>und</strong> Verwaltung im Zeichen <strong>der</strong> Krise? Wiesbaden, S. 256-273.<br />
3 Vgl. dazu etwa die Beiträge <strong>in</strong>: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte (APuZ), Nr. 51-52/2010.<br />
7
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Ebenfalls weitgehend anerkannt ist das statistische Ergebnis, dass e<strong>in</strong> Abstieg aus wohlhaben<strong>der</strong>en Gesellschaftsschichten<br />
<strong>in</strong> Armut quantitativ häufiger <strong>und</strong> statistisch wahrsche<strong>in</strong>licher ist als e<strong>in</strong> Aufstieg <strong>in</strong> <strong>der</strong> umgekehrten Richtung.<br />
Insofern verwun<strong>der</strong>t es nicht, wenn die Armutsberichterstattung <strong>in</strong> Deutschland seit geraumer Zeit trotz <strong>der</strong> positiven<br />
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (z. B. höchste Erwerbstätigenquote seit 20 Jahren 4 ) e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>gen, aber kont<strong>in</strong>uierlichen<br />
Aufwuchs <strong>der</strong> Armutsschicht feststellt (vgl. Abbildung 3). 5<br />
Armut <strong>und</strong> prekäre Familiensituationen stellen für die Betroffenen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel selbst Belastungsfaktoren dar o<strong>der</strong><br />
stehen mit diesen <strong>in</strong> engem Zusammenhang. Trotz <strong>der</strong> positiven volkswirtschaftlichen Gesamtlage muss daher von<br />
e<strong>in</strong>em schleichenden Aufwuchs von sozialen Gefährdungspotenzialen ausgegangen werden, von dem wenn auch nicht<br />
sprunghaft, aber doch zunehmend immer mehr Menschen, auch <strong>in</strong> Bayern betroffen s<strong>in</strong>d.<br />
Abbildung 3: Trendentwicklung von Armut, Prekarität <strong>und</strong> Wohlstand<br />
Quelle: Olaf Groh-Samberg (2010): Armut verfestigt sich – e<strong>in</strong> missachteter Trend, <strong>in</strong>: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte (APuZ, Nr. 51-52/2010),<br />
S. 9-15 (14).<br />
Für die steuerf<strong>in</strong>anzierte <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> entscheidend ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die Bedeutung <strong>des</strong> Teufelskreises<br />
<strong>der</strong> Vererbung von sozialer Bedürftigkeit. Der Ablauf dieses Teufelskreises lässt sich anhand <strong>der</strong> Faktoren<br />
beschreiben, die e<strong>in</strong>en sozialen Leistungsbezug im statistischen S<strong>in</strong>ne wahrsche<strong>in</strong>licher machen (vgl. Abbildung 4).<br />
Die Abbildung verdeutlicht nicht nur die Abfolge <strong>der</strong> armutsbegünstigenden E<strong>in</strong>flussfaktoren, son<strong>der</strong>n auch die kommunalen<br />
Beratungs-, Hilfs- <strong>und</strong> Unterstützungsleistungen, die für die jeweilige Bedarfslage zur Verfügung stehen.<br />
4<br />
Vgl. Pressemitteilung <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esregierung vom 2. Mai 2012, Erwerbstätigkeit auf Höchststand (www.b<strong>und</strong>esregierung.de, letzter Zugriff: 14. September<br />
2012); Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>ordnung, Familie <strong>und</strong> Frauen (StMAS, 2012): Dritter Bericht <strong>der</strong> Staatsregierung zur sozialen Lage<br />
<strong>in</strong> Bayern (3. <strong>Sozial</strong>bericht), S. 73-85.<br />
5<br />
Vgl. StMAS 2012: 3. <strong>Sozial</strong>bericht, S. 205-210.<br />
8
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Diese meist im Bedarfsfall nachlaufenden Leistungen reichen jedoch häufig nicht aus, um den Teufelskreislauf <strong>der</strong><br />
Vererbung von sozialer Bedürftigkeit zu durchbrechen.<br />
Dieser Teufelskreislauf nimmt <strong>in</strong> vielen Fällen se<strong>in</strong>en Ausgangspunkt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gestörten Mutter-K<strong>in</strong>d-B<strong>in</strong>dung. 6 Wie<br />
Gehirn-, B<strong>in</strong>dungs- <strong>und</strong> Resilienzforschung zeigen, haben frühk<strong>in</strong>dliche Belastungsfaktoren erhebliche negative Auswirkungen<br />
auf die spätere Entwicklung <strong>des</strong> Menschen. 7 Diese können therapiert <strong>und</strong> abgemil<strong>der</strong>t werden, können<br />
sich aber auch <strong>in</strong> späteren Entwicklungsphasen noch verstärken, wenn sie unbehandelt bleiben. Letztendlich dürfte<br />
im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> statistischen Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit gelten, dass die Chancen auf Abwendung <strong>der</strong> Belastungsfaktoren umso<br />
ger<strong>in</strong>ger s<strong>in</strong>d, je später mit e<strong>in</strong>er Therapie begonnen wird. In vielen Fällen werden bestehende <strong>und</strong> verfestigte prekäre<br />
<strong>und</strong> bildungsferne Familienverhältnisse 8 letztlich an die nächste Generation weitergegeben. 9<br />
Abbildung 4: Teufelskreislauf <strong>der</strong> Vererbung sozialer Bedürftigkeit<br />
Beruf: prekäre, häufig<br />
wechselnde Tätigkeiten;<br />
ke<strong>in</strong> Aufstieg, ke<strong>in</strong>e<br />
soziale Absicherung<br />
schlechter/fehlen<strong>der</strong><br />
Schulabschluss<br />
erschwert Übergang<br />
Schule-Beruf<br />
Hauptschule: wechselseitige<br />
Verstärkung<br />
von Bildungsdefiziten<br />
<strong>und</strong> psychosozialen<br />
Störungen<br />
arbeitsweltorientierte<br />
Jugendsozialarbeit;<br />
Schülercoach<strong>in</strong>g<br />
Jugendsozialarbeit<br />
an Schulen,<br />
Jugendarbeit<br />
Gr<strong>und</strong>sicherung für<br />
Arbeitsuchende;<br />
sozial flankierende<br />
Leistungen<br />
frühk<strong>in</strong>dliche Bildung<br />
<strong>und</strong> Erziehung durch<br />
<strong>Jugendhilfe</strong><br />
Gr<strong>und</strong>schule: Bildungsdefizite<br />
führen zu Überfor<strong>der</strong>ung<br />
von K<strong>in</strong>d <strong>und</strong> Eltern<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten: Verhaltensauffällig-<br />
keiten, Entwicklungsverzögerungen<br />
Krankenhäuser;<br />
Ges<strong>und</strong>heitsämter<br />
Psych.-soz. Beratungsstellen,<br />
Gewalt-/Suchtprävention,<br />
Betreuungen<br />
präventive<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>:<br />
Familienhebammen,<br />
Beratung<br />
statistischer Zusammenhang<br />
zwischen prekärer Lebenssituation<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
hohe Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
<strong>der</strong> Fortsetzung<br />
prekärer,<br />
bildungsferner<br />
Familienverhältnisse<br />
bei hoher Fertilität!<br />
prekäre, bildungsferne<br />
Familiensituation<br />
gestörtes B<strong>in</strong>dungsverhalten<br />
zwischen Mutter <strong>und</strong> K<strong>in</strong>d<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
© Bayerischer Landkreistag - Dr. Klaus Schulenburg 11 /19<br />
6<br />
Als mögliche Ursachen seien folgende Belastungsfaktoren beispielhaft erwähnt: schwierige Scheidungssituation, Alle<strong>in</strong>erziehungssituation <strong>der</strong> Mutter, psychosoziale<br />
Probleme e<strong>in</strong>es o<strong>der</strong> bei<strong>der</strong> Partner, Gewalt, Drogenkonsum, unbewältigte bzw. nicht zu bewältigende Funktionse<strong>in</strong>schränkungen (Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>,<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung), ökonomische Überfor<strong>der</strong>ung (Work<strong>in</strong>g-Poor-Status) o<strong>der</strong> bestehen<strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>leistungsbezug. Vgl. dazu auch die statistischen Daten <strong>in</strong>:<br />
StMAS 2012: 3. <strong>Sozial</strong>bericht.<br />
7<br />
Vgl. etwa Karl He<strong>in</strong>z Brisch (20122), B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> frühe Störungen <strong>der</strong> Entwicklung, Stuttgart.<br />
8<br />
Dies soll nicht ausschließen, dass es auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en, höheren Gesellschaftsschichten zur Vernachlässigung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen (sog. „gehobene<br />
Vernachlässigung“) o<strong>der</strong> gar zu K<strong>in</strong><strong>des</strong>wohlgefährdungen kommt. Die Häufigkeit bzw. Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit im statistischen S<strong>in</strong>ne ist jedoch ger<strong>in</strong>ger.<br />
9<br />
Diese Argumentation verkennt nicht, dass die <strong>der</strong>zeitigen Kostensteigerungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> auch <strong>in</strong> nicht-prekären Familienverhältnissen feststellbar s<strong>in</strong>d<br />
(vgl. vorhergehende Fußnote). Diese Entwicklung f<strong>in</strong>det aber außerhalb <strong>des</strong> beschriebenen Teufelskreislaufs statt <strong>und</strong> ist im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> gesamtgesellschaftlichen<br />
Verstärkungswirkung zu vernachlässigen.<br />
9
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung ist, dass e<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> gesamtgesellschaftlichen Geburtenrate <strong>in</strong> eben diesen Familienverhältnissen<br />
stattf<strong>in</strong>det. Dabei s<strong>in</strong>d die Auswirkungen <strong>und</strong> Folgen armer <strong>und</strong> bildungsferner bzw. prekärer Familienverhältnisse<br />
nicht nur als <strong>in</strong>dividuelle Erfahrung schwer zu ertragen, son<strong>der</strong>n auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive<br />
nicht akzeptabel. Verm<strong>in</strong><strong>der</strong>te Startchancen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> solchen Familienverhältnissen machen e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren<br />
Bildungsabschluss wahrsche<strong>in</strong>lich – <strong>in</strong> Deutschland verließen trotz aller Bemühungen <strong>in</strong> den vergangenen Jahren auch<br />
2009 im Durchschnitt 6,6 % aller Schüler die Schule ohne Hauptschulabschluss! 10 –, was wie<strong>der</strong>um Brüche <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Erwerbsbiografie auf niedrigem Niveau begünstigt. Dies führt zu e<strong>in</strong>er höheren Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit <strong>der</strong> lebenslangen<br />
Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen <strong>und</strong> endet häufiger <strong>in</strong> Altersarmut. Begleitet werden diese Symptome<br />
von e<strong>in</strong>er statistisch nachweisbaren Vermehrung von Ges<strong>und</strong>heitsproblemen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er höheren Suizidgefahr. 11<br />
Insgesamt führt <strong>der</strong> Zusammenhang zwischen dem Teufelskreislauf <strong>der</strong> Vererbung von sozialer Bedürftigkeit <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
höheren Fertilität zu e<strong>in</strong>em schleichenden Aufwuchs „abgehängter Gesellschaftsschichten“ (vgl. oben Abbildung 3);<br />
<strong>der</strong> steuerf<strong>in</strong>anzierte <strong>Sozial</strong>staat sitzt somit auf e<strong>in</strong>er tickenden Bombe.<br />
Diese Entwicklungen dürften auch e<strong>in</strong>en wesentlichen Erklärungsbeitrag zu e<strong>in</strong>em weit verbreiteten Missverständnis<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit liefern. Vielfach wird gerätselt, warum trotz zurückgehen<strong>der</strong> Geburtenrate seit mehreren Jahren<br />
wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong> deutlicher Aufwuchs an Ausgaben <strong>der</strong> öffentlichen <strong>Jugendhilfe</strong> zu verzeichnen ist. Richtig ist zwar, dass die<br />
Zahl <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> zurückgeht <strong>und</strong> damit weniger Schulklassen <strong>und</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartenplätze benötigt werden, jedoch verschieben<br />
sich <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> kle<strong>in</strong>er werdenden Gruppe <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen die Problemlagen <strong>und</strong> es ist e<strong>in</strong>e<br />
größere Spreizung zwischen „Normal- <strong>und</strong> Problemk<strong>in</strong><strong>der</strong>n“ festzustellen. Die zunehmende Mobilität <strong>der</strong> Familien,<br />
die Verkomplizierung <strong>und</strong> Verwissenschaftlichung vieler Lebensbereiche sowie <strong>der</strong> zunehmende Leistungsdruck schaffen<br />
völlig an<strong>der</strong>e Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für das Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n als noch vor zwanzig o<strong>der</strong> dreißig Jahren.<br />
H<strong>in</strong>zu kommen nachlassende Erziehungsbereitschaft <strong>und</strong> –fähigkeit vieler Eltern, was die gesellschaftliche Basis<strong>in</strong>stitution<br />
<strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>staats, die Familie, zunehmend <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Leistungsfähigkeit schwächt.<br />
Zwar ist die Erkenntnis <strong>des</strong> Zusammenhangs zwischen Bildungschancen <strong>und</strong> sozialer Bedürftigkeit zwischenzeitlich<br />
auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Politik angekommen, jedoch haben B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Län<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Verabschiedung <strong>des</strong> Bildungs- <strong>und</strong> Teilhabepakets<br />
für bedürftige K<strong>in</strong><strong>der</strong> Anfang 2011 (BGBl. I, S. 453) strukturell die falschen Schlüsse gezogen. Statt diejenigen<br />
gesellschaftlichen Leistungssysteme, die für Bildungs- <strong>und</strong> Teilhabechancen vorrangig zuständig s<strong>in</strong>d (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e das<br />
Schulsystem), stärker <strong>in</strong> die Pflicht zu nehmen, wurde e<strong>in</strong>e sozialstaatliche Lösung gewählt, <strong>der</strong>en Zielgenauigkeit <strong>und</strong><br />
Wirksamkeit <strong>in</strong> Zweifel gezogen werden müssen <strong>und</strong> die mit e<strong>in</strong>em erheblichen Verwaltungsmehraufwand verb<strong>und</strong>en<br />
ist.<br />
Diese hier nur knapp zu referierenden Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Entwicklung von Armutslagen erhalten e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e<br />
Brisanz, wenn man sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Zukunftsperspektive zusätzlich unter demografischen Aspekten betrachtet. In<br />
<strong>der</strong> Abbildung 5 ist die Entwicklung <strong>des</strong> sog. Versorgungsquotienten 12 anhand <strong>der</strong> Bevölkerungsprognose für Bayern<br />
bis 2060 dargestellt. Dieser Indikator veranschaulicht das quantitative Verhältnis zwischen Transferleistungsempfängern<br />
<strong>und</strong> denjenigen, die diese Transferleistungen erwirtschaften. Beträgt dieses Verhältnis <strong>der</strong>zeit noch etwa e<strong>in</strong>s zu<br />
zwei, wird es sich <strong>in</strong> den nächsten zwanzig Jahren dramatisch verschlechtern <strong>und</strong> <strong>in</strong> fünfzig Jahren bei knapp e<strong>in</strong>s zu<br />
e<strong>in</strong>s liegen, d. h. e<strong>in</strong> Erwerbstätiger <strong>in</strong> <strong>der</strong> hauptproduktiven Lebensphase <strong>der</strong> zwischen 21- <strong>und</strong> 65-Jährigen muss<br />
dann die Transferleistungen für die unter 21 bzw. über 65 Jahre alten Menschen erwirtschaften. Die Dramatik die-<br />
10<br />
Nach <strong>der</strong> amtlichen Statistik verließen <strong>in</strong> Bayern im Jahr 2009 <strong>in</strong>sgesamt 8.187 Schüler<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Schüler die Schule ohne Hauptschulabschluss. Das entspricht<br />
e<strong>in</strong>er Quote von durchschnittlich 5,92%, wobei die Werte für e<strong>in</strong>zelne kreisfreie Städte <strong>und</strong> Landkreise zwischen 2,39% <strong>und</strong> 10,35% schwanken. Im<br />
Vorjahr 2008 lag die Gesamtzahl noch bei 9.043 Abgängern ohne Schulabschluss (6,34%). Die Daten s<strong>in</strong>d abrufbar unter www.regionalstatistik.de / Bildung<br />
<strong>und</strong> Kultur / Absolventen allgeme<strong>in</strong> bilden<strong>der</strong> Schulen (Statistik Nr. 192-71-4). Die Zahl <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Schüler ohne Hauptschulabschluss müssen<br />
als grober, aber gleichwohl wichtiger Indikator angesehen werden, da e<strong>in</strong>erseits Anschlussqualifizierungen <strong>der</strong> jungen Menschen nicht berücksichtigt s<strong>in</strong>d,<br />
an<strong>der</strong>erseits aber Abschlüsse auf För<strong>der</strong>schulen unberücksichtigt bleiben.<br />
11<br />
Vgl. etwa Informationsdienst <strong>der</strong> Lan<strong>des</strong>zentrale für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> Bayern e.V., LZG Informationen, Son<strong>der</strong>heft 1/2008 (abrufbar im Internet unter: www.<br />
lzg-bayern.de/ LZG Publikationen).<br />
12<br />
Der sog. Versorgungsquotient (VQ) ist e<strong>in</strong>e wichtige Kennzahl zur E<strong>in</strong>schätzung sozialpolitischer Verän<strong>der</strong>ungen. Er br<strong>in</strong>gt zum Ausdruck, wie viele unter<br />
21-Jährige plus über 65-Jährige auf jeweils 100 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen im Alter von 21 bis unter 65 Jahren kommen. Er vermittelt so gewissermaßen e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck<br />
davon, wie viele Jüngere <strong>und</strong> Ältere von jeweils 100 Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> ökonomisch beson<strong>der</strong>s „produktiven“ Lebensphase mit versorgt werden müssen<br />
(Kommunalverband für Jugend <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es Baden-Württemberg (2011): K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> im demografischen Wandel – Zusammenfassung zentraler<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Berichterstattung 2010, Stuttgart, Verfasser: Dr. Ulrich Bürger, S. 9).<br />
10
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
ser Entwicklung resultiert aus <strong>der</strong> Tatsache, dass <strong>der</strong> demografische Wandel angesichts <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Geburtenrate <strong>in</strong><br />
Deutschland <strong>und</strong> selbst bei e<strong>in</strong>er deutlich stärkeren Zuwan<strong>der</strong>ung aus dem Ausland nicht aufzuhalten ist, da bereits<br />
zwei Generationen potenzieller Eltern <strong>in</strong> zu hohem Maße ausfallen.<br />
Abbildung 5: Entwicklung <strong>des</strong> Versorgungsquotienten <strong>in</strong> Bayern bis 2060<br />
Quelle: Dr. Ulrich Bürger, Vortrag bei <strong>der</strong> Lan<strong>des</strong>tagung „Kommunale Jugendpolitik 2012“ <strong>des</strong> Bayerischen Jugendr<strong>in</strong>gs mit den kommunalen<br />
Spitzenverbänden am 3. Juli 2012 <strong>in</strong> Beilngries. Vgl. H<strong>in</strong>weis <strong>in</strong> Fußnote 12.<br />
Die Entwicklung könnte allenfalls <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Wellenbewegung umgestaltet werden, sofern heute Voraussetzungen geschaffen<br />
werden, damit die heutigen jungen Menschen wie<strong>der</strong> bereit <strong>und</strong> befähigt werden, <strong>in</strong> zehn bis zwanzig Jahren<br />
Eltern werden zu wollen. In gleicher Weise müssten noch wesentlich größere Anstrengungen unternommen werden,<br />
um e<strong>in</strong>e zusätzliche Verschlechterung <strong>des</strong> Versorgungsquotienten zu vermeiden. Dies gilt sowohl demografisch als<br />
auch faktisch, <strong>in</strong>dem <strong>der</strong> oben skizzierte Teufelskreislauf <strong>der</strong> Vererbung sozialer Bedürftigkeit durchbrochen wird. Je<strong>der</strong><br />
junge Mensch, <strong>der</strong> nicht <strong>in</strong> die Lage versetzt wird, als vollwertiges Mitglied <strong>der</strong> Gesellschaft e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit<br />
nachzugehen, <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 21- bis 65-Jährigen Transferleistungen bezieht, belastet das demografisch<br />
schlechte Verhältnis zwischen Transferleistungsempfängern zu –bereitstellern doppelt. Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
sollte die Debatte um die Frage, ob im Bildungssystem weiter stärker auf e<strong>in</strong>e Elitenför<strong>der</strong>ung gesetzt wird als auf e<strong>in</strong>e<br />
stärkere För<strong>der</strong>ung sozial benachteiligter, bildungsferner K<strong>in</strong><strong>der</strong>, beendet werden, denn für K<strong>in</strong><strong>der</strong> dürfte das Gleiche<br />
gelten wie <strong>in</strong> Bezug auf die För<strong>der</strong>ung von städtischen <strong>und</strong> ländlichen Regionen (vgl. oben unter 1.): Man sollte nicht<br />
diejenigen zusätzlich för<strong>der</strong>n, die sich selbst aus eigener Kraft helfen können, son<strong>der</strong>n diejenigen, die auf fremde Hilfe<br />
angewiesen s<strong>in</strong>d.<br />
Den sozialpolitischen Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Bevölkerungsentwicklung, <strong>der</strong> B<strong>in</strong>nenwan<strong>der</strong>ung sowie <strong>der</strong> Vererbung<br />
sozialer Bedürftigkeit können sich die <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>träger nur stellen, wenn (1) die staatlichen Ebenen<br />
zukunftsfähige Reformen <strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>leistungsrechts sowie <strong>in</strong> benachbarten Gesellschaftsbereichen angehen, (2) die<br />
11
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
kommunalen <strong>Sozial</strong>ausgaben ausreichen <strong>und</strong> verlässlich ref<strong>in</strong>anziert werden <strong>und</strong> (3) die vorhandenen Planungs- <strong>und</strong><br />
<strong>Steuerung</strong>spotenziale gehoben werden. Zu den ersten beiden genannten Punkten haben die kommunalen Spitzenverbände<br />
auf B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Län<strong>der</strong>ebene wie<strong>der</strong>holt zahlreiche For<strong>der</strong>ungen erarbeitet, die von <strong>der</strong> wegweisenden<br />
vollständigen Übernahme <strong>der</strong> Kosten für die Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung durch den B<strong>und</strong><br />
ab dem Jahr 2014 abgesehen bislang weitgehend unberücksichtigt blieben. Da diese For<strong>der</strong>ungen allgeme<strong>in</strong> bekannt<br />
s<strong>in</strong>d, konzentrieren sich die weiteren Ausführungen auf den dritten Punkt <strong>und</strong> damit auf die Frage, was die <strong>Sozial</strong><strong>und</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong>träger aus eigener Kraft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage s<strong>in</strong>d zu leisten, um den sozialpolitischen Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
Zukunft zu begegnen.<br />
3. <strong>Steuerung</strong>spotenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Die <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> als <strong>der</strong> mit großem Abstand kosten<strong>in</strong>tensivste Aufgabenbereich <strong>in</strong> kommunaler Verantwortung<br />
weist verschiedene Potenziale auf, <strong>in</strong> denen die Aufgabenträger e<strong>in</strong>e aktive Rolle <strong>der</strong> Planung <strong>und</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
e<strong>in</strong>nehmen können. Hierzu gehören <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e: 13<br />
- die <strong>in</strong>tegrierte <strong>Sozial</strong>berichtserstattung/-planung,<br />
- die sozialraumorientierte Leistungsbereitstellung,<br />
- die zielgruppenorientierte Anpassung <strong>der</strong> Struktur <strong>des</strong> Leistungsangebots,<br />
- die Personalbemessung <strong>in</strong> den Fachämtern,<br />
- die Prozesssteuerung <strong>der</strong> Fallbearbeitung sowie<br />
- die Def<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> Kontrolle von Qualitätsstandards.<br />
Diese verschiedenen <strong>Steuerung</strong>spotenziale stehen aus fachlicher Sicht untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>in</strong> engem Zusammenhang bzw.<br />
bauen aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> auf.<br />
3.1 Integrierte <strong>Sozial</strong>berichterstattung/-planung<br />
Die Verwaltung <strong>in</strong> Deutschland betreibt zahllose allgeme<strong>in</strong>e Planungen (z. B. Raumordnungsplanung) <strong>und</strong> Fachplanungen<br />
(z. B. Verkehrswegeplanung, Krankenhausplanung). Auch im Bereich <strong>der</strong> kommunalen <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
gibt es verschiedene gesetzlich vorgeschriebene Fachplanungen, etwa die <strong>Jugendhilfe</strong>planung nach § 80 SGB<br />
VIII o<strong>der</strong> das seniorenpolitische Gesamtkonzept nach Art. 69 AGSG, das die frühere Pflegebedarfsplanung abgelöst<br />
hat. Während Großstädte daneben häufig auch <strong>Sozial</strong>- o<strong>der</strong> Armutsberichte erarbeiten o<strong>der</strong> bereits e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierte<br />
<strong>Sozial</strong>berichterstattung/-planung betreiben, waren vergleichbare Ansätze im ländlichen Raum <strong>in</strong> Bayern bislang noch<br />
selten. Erst mit <strong>der</strong> sich immer dramatischer abzeichnenden Bevölkerungsentwicklung beg<strong>in</strong>nen nun vermehrt Landkreise<br />
entsprechende Analysen <strong>der</strong> demografischen Entwicklung anzustellen.<br />
Für e<strong>in</strong>e strategische <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> bildet e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierte <strong>Sozial</strong>berichterstattung bzw. <strong>Sozial</strong>raumanalyse<br />
mit e<strong>in</strong>er demografischen Ausrichtung die Gr<strong>und</strong>lage. Mit „<strong>in</strong>tegriert“ ist dabei geme<strong>in</strong>t, dass die<br />
verschiedenen Ansätze e<strong>in</strong>er <strong>Sozial</strong>berichterstattung, wie sie für die <strong>Jugendhilfe</strong>planung o<strong>der</strong> das seniorenpolitische Gesamtkonzept<br />
bereits angestellt werden, vere<strong>in</strong>heitlicht <strong>und</strong> ergänzt werden um weitere für den <strong>Sozial</strong>bereich relevante<br />
Teilplanungen. Berücksichtigung f<strong>in</strong>den sollten etwa Aspekte die Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung, <strong>der</strong> Wohnraumversorgung,<br />
<strong>des</strong> Verkehrswesens sowie <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung. Konkret veranschaulichen lassen sich diese Zusammenhänge<br />
am Beispiel <strong>der</strong> Umsetzung <strong>des</strong> Gr<strong>und</strong>satzes „ambulant vor stationär“. Die Ausweitung <strong>und</strong> Dezentralisierung <strong>des</strong><br />
ambulanten Leistungsangebots etwa <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altenpflege o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenbetreuung setzt entsprechende Wohnraumkapazitäten,<br />
Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur sowie Nahversorgungs- <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ische Versorgungsstrukturen voraus. Diese<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen müssen daher bei e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten <strong>Sozial</strong>berichterstattung/-planung berücksichtigt werden.<br />
13<br />
Im weiteren S<strong>in</strong>ne können auch viele Aspekte <strong>der</strong> Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung genannt werden (z. B. Berichtswesen <strong>und</strong> Controll<strong>in</strong>g, produktorientiertes<br />
Haushaltswesen, dezentrale Budgetverantwortung, Mitarbeiterführung), die jedoch aufgr<strong>und</strong> ihres Querschnittbezugs hier außer Acht bleiben.<br />
12
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Nach den e<strong>in</strong>schlägigen Empfehlungen zur Erstellung von e<strong>in</strong>er <strong>Sozial</strong>berichterstattung/-planung 14 sollte an das Lebenslagenkonzept<br />
angeknüpft werden, da damit s<strong>in</strong>nvolle Schwerpunktsetzungen <strong>und</strong> Abgrenzungen möglich s<strong>in</strong>d.<br />
Als wesentliche Elemente e<strong>in</strong>er solchen Planung auf Landkreisebene können genannt werden:<br />
- Ermittlung <strong>und</strong> Darstellung <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>struktur <strong>in</strong> den kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den, <strong>der</strong> vorhandenen sozialen<br />
Bedarfe <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Lebenslagen (z. B. K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung, Bildung, Armut, Altenpflege, Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung) <strong>und</strong><br />
mittelfristige Projektion <strong>in</strong> die Zukunft anhand <strong>der</strong> zu erwartenden demografischen Entwicklung sowie<br />
- Ermittlung <strong>und</strong> Darstellung <strong>der</strong> Struktur <strong>der</strong> vorhandenen E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Dienste sowie <strong>der</strong> zur Befriedigung<br />
<strong>der</strong> Bedarfe vorgehaltenen Leistungen <strong>und</strong> Vorhaben.<br />
Der Aufwand für die Ermittlung <strong>und</strong> Aufarbeitung entsprechenden Datenmaterials ist nicht unerheblich, sofern die<br />
Berichterstattung über die Datenlage <strong>der</strong> amtlichen <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>statistik h<strong>in</strong>ausgehen soll. Insofern verwun<strong>der</strong>t<br />
es nicht, wenn sich zahlreiche kommunale Träger <strong>des</strong> Sachverstands von externen Beratungs<strong>in</strong>stituten bedienen.<br />
Mit e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>maligen Auftragsvergabe zur Erarbeitung etwa e<strong>in</strong>er <strong>Sozial</strong>raumanalyse ist es aber <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nicht<br />
getan, wenn die <strong>Sozial</strong>berichterstattung die Gr<strong>und</strong>lage für e<strong>in</strong>e strategische Aufgabensteuerung darstellen soll. Dieser<br />
Anspruch kann erst erfüllt werden, wenn strategische Ziele erarbeitet <strong>und</strong> mit Maßnahmen h<strong>in</strong>terlegt werden, <strong>der</strong>en<br />
Wirksamkeit zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt überprüft wird. Die <strong>Sozial</strong>planung muss als kont<strong>in</strong>uierlicher politischer<br />
Prozess verstanden werden, <strong>der</strong> <strong>in</strong> die Gremien <strong>der</strong> kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>getragen wird, was ausreichende<br />
personelle Planungskapazitäten auf Kreisebene voraussetzt. Mit <strong>der</strong> Zusammenführung <strong>der</strong> Ergebnisse auf<br />
Landkreisebene können Schnittstellen <strong>und</strong> Synergien aufgedeckt <strong>und</strong> nutzbar gemacht werden bzw. drohende Lücken<br />
identifiziert <strong>und</strong> geschlossen werden.<br />
In die <strong>in</strong>tegrierte <strong>Sozial</strong>berichterstattung/-planung s<strong>in</strong>d auch die Träger <strong>der</strong> freien Wohlfahrtsverbände <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Akteure e<strong>in</strong>zubeziehen. Dies entspricht dem Subsidiaritätsgedanken <strong>und</strong> dem Partizipationsgebot, wie es etwa für die<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>planung gesetzlich vorgeschrieben ist (§ 80 Abs. 3 SGB VIII).<br />
3.2 <strong>Sozial</strong>raumorientierte Leistungsbereitstellung<br />
E<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierte <strong>Sozial</strong>planung ermöglicht neben e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong><strong>des</strong>charfen Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung von demografierelevanten<br />
Maßnahmen auch e<strong>in</strong>e Identifizierung <strong>und</strong> Abgrenzung von <strong>Sozial</strong>räumen <strong>in</strong> den Landkreisen. Anhand<br />
ausgewählter entscheidungsrelevanter <strong>Sozial</strong><strong>in</strong>dikatoren können <strong>in</strong> vielen Landkreisen mehrere kreisangehörige<br />
Geme<strong>in</strong>den zu relativ homogenen <strong>Sozial</strong>räumen zusammengefasst werden, die als quasi Zwischenebene zwischen<br />
Landkreis <strong>und</strong> e<strong>in</strong>zelner Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Bündelung <strong>und</strong> unterschiedliche Schwerpunktsetzung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bereitstellung<br />
sozialer Dienstleistungen ermöglichen. Die Dezentralisierung <strong>der</strong> sozialen Arbeit <strong>und</strong> gleichzeitige Bündelung über<br />
verschiedene Aufgabenzuständigkeiten h<strong>in</strong>weg vor Ort schafft zusätzliche Möglichkeiten, die Wege für die Menschen<br />
kurz zu halten <strong>und</strong> das Innovationspotenzial <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den zu stärken. Voraussetzung dafür ist e<strong>in</strong>e permanente<br />
Rückb<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> dezentralen <strong>Sozial</strong>arbeit Tätigen mit dem Landratsamt, um e<strong>in</strong>er Verselbständigung vorzubeugen.<br />
E<strong>in</strong>e Dezentralisierung <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>arbeit <strong>in</strong> mehreren <strong>Sozial</strong>räumen schafft auch die Möglichkeit, Maßnahmen<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Landkreises den unterschiedlichen Verhältnissen anzupassen, zu erproben, später zu evaluieren <strong>und</strong><br />
ggf. nachzusteuern (Controll<strong>in</strong>g). Gel<strong>in</strong>gt darüber h<strong>in</strong>aus im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den<br />
e<strong>in</strong>e positive Verankerung <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>arbeit vor Ort, kann die Wirksamkeit <strong>der</strong> e<strong>in</strong>gesetzten Mittel erheblich gesteigert<br />
werden.<br />
14<br />
Zur Methodik <strong>und</strong> Datenauswahl vgl. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (2005): Entwicklung e<strong>in</strong>es lebenslagen- <strong>und</strong> haushaltsbezogenen<br />
Datenmodulsystems zur Qualifizierung von kommunalen Armuts- <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>berichterstattungsvorhaben - ELHDAMO -, Projektverantwortliche:<br />
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe (Universität Gießen).<br />
13
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
3.3 Zielgruppenorientierte Anpassung <strong>der</strong> Struktur <strong>des</strong> Leistungsangebots<br />
Der Bestand <strong>und</strong> die Trägerschaft von E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Diensten <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> haben sich <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Vergangenheit meist historisch entwickelt <strong>und</strong> waren nicht selten von Zufällen <strong>und</strong> Ad-hoc-Vorhaben gekennzeichnet.<br />
Auch stellt sich häufig die Frage, ob sämtliche Leistungsangebote aufgr<strong>und</strong> ihres natürlichen Beharrungsvermögens aktuell<br />
nach ihrem Umfang <strong>und</strong> ihrer Art bedarfsgerecht s<strong>in</strong>d. Um die für die Befriedigung <strong>der</strong> bestehenden Bedarfslagen<br />
notwendigen Leistungen vorhalten zu können, müssen entsprechende planerische Gr<strong>und</strong>lagen erarbeitet werden (vgl.<br />
oben 3.1). Zur Anpassung <strong>der</strong> <strong>in</strong>haltlichen Struktur <strong>des</strong> Leistungsangebots müssen zunächst die relevanten Zielgruppen<br />
<strong>in</strong> den Leistungsbereichen identifiziert werden (Familien mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>/mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> Heimen/mit<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n mit Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Alle<strong>in</strong>erziehende, verarmte Haushalte, Familien mit Pflegesituation etc.).<br />
Anschließend geht es um die fachliche Vorbereitung <strong>und</strong> politische Entscheidung, ob <strong>und</strong> <strong>in</strong> welchem Maße das Leistungsangebot<br />
umgebaut werden soll. Leitgedanken s<strong>in</strong>d dabei die Befriedigung <strong>der</strong> Bedarfe zu vertretbaren Kosten,<br />
die präventive Wirkung von Maßnahmen im niedrigschwelligen Bereich o<strong>der</strong> außerhalb <strong>des</strong> eigentlichen Systems <strong>der</strong><br />
<strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> (z. B. Schule, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Vere<strong>in</strong>swesen) <strong>und</strong> die Reichweite <strong>des</strong> Gr<strong>und</strong>satzes „ambulant<br />
vor stationär“. E<strong>in</strong> exemplarisches Beispiel anhand <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> veranschaulicht Abbildung 6.<br />
Abbildung 6: Zielgruppenorientierte Ausrichtung <strong>des</strong> Leistungsangebots<br />
Quelle: Gerhard Pfre<strong>und</strong>schuh, Vortrag beim Landrätesem<strong>in</strong>ar 2007 <strong>in</strong> Bad Kiss<strong>in</strong>gen.<br />
Parallel zur zielgruppenorientierten <strong>Steuerung</strong> <strong>des</strong> Leistungsangebots ist die Trägerschaft <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Dienste <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen zu h<strong>in</strong>terfragen. Gerade unter <strong>Steuerung</strong>sgesichtspunkten <strong>und</strong> unter <strong>der</strong> Berücksichtigung<br />
<strong>des</strong> Subsidiaritätsgedankens ist immer wie<strong>der</strong> die Frage zu diskutieren, ob die gegenwärtige Struktur selbst<br />
erbrachter <strong>und</strong> vergebener Leistungen das Optimum darstellt.<br />
14
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
3.4 Personalbemessung <strong>in</strong> den Fachämtern<br />
Die Träger <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> s<strong>in</strong>d kraft Gesetzes dazu verpflichtet, bei <strong>der</strong> Durchführung ihrer Aufgaben<br />
qualifiziertes Fachpersonal e<strong>in</strong>zusetzen (§ 6 SGB XII bzw. § 79 Abs. 3 SGB VIII). Die Träger <strong>der</strong> öffentlichen <strong>Jugendhilfe</strong><br />
s<strong>in</strong>d darüber h<strong>in</strong>aus gehalten, für e<strong>in</strong>e dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften zu sorgen (§ 79 Abs. 3 2.<br />
Halbsatz VIII). In <strong>der</strong> Praxis stellt sich allerd<strong>in</strong>gs regelmäßig die Frage, wie diese gesetzlichen Vorgaben quantifiziert<br />
werden können. Häufig kommen dabei die Fachämter zu an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>schätzungen als die Querschnittsämter, die für<br />
die notwendige Ressourcenbereitstellung zu sorgen haben. In <strong>der</strong> Vergangenheit wurde dieser – aus organisationstheoretischen<br />
Überlegungen s<strong>in</strong>nvolle – Konflikt eher auf <strong>der</strong> Basis von Vermutungen <strong>und</strong> groben Schätzungen ausgetragen.<br />
Abbildung 7: Zerlegung e<strong>in</strong>er Fachaufgabe <strong>des</strong> Jugendamts <strong>in</strong> Teilprozesse<br />
Quelle: Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt, Bayerischer Landkreistag,<br />
INSO: Entwurf zur Auflage <strong>des</strong> PeB-Handbuchs 2013.<br />
15
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Um hier e<strong>in</strong>e für beide Seiten verlässliche Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage zu entwickeln, haben sich das Bayerische Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Bayerische Landkreistag 2009 – unter Mitwirkung <strong>der</strong> Stadt Nürnberg – entschlossen, e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />
Projekt zur Erarbeitung e<strong>in</strong>es Konzeptes zur Personalbemessung bei den örtlichen Trägern <strong>der</strong> öffentlichen<br />
<strong>Jugendhilfe</strong> durchzuführen. Das Konzept baut auf dem arbeitswissenschaftlichen Ansatz auf, die Durchführung von<br />
e<strong>in</strong>zelnen Fachaufgaben <strong>in</strong> abgrenzbare Teilprozesse zu zerlegen. Anschließend wird <strong>der</strong> Zeitaufwand für die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Teilprozesse durch Selbstdokumentation <strong>der</strong> Mitarbeiter ermittelt, um e<strong>in</strong>en Vergleich über verschiedene Aufgaben<br />
<strong>und</strong> zwischen verschiedenen Ämtern zu ermöglichen. Die Aufteilung <strong>der</strong> Durchführung e<strong>in</strong>er Fachaufgabe im Jugendamt<br />
<strong>in</strong> verschiedene Teilprozesse wird <strong>in</strong> Abbildung 7 veranschaulicht.<br />
Das 2010 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ersten Auflage vorgelegte Handbuch, <strong>des</strong>sen Werte noch auf Daten von drei beispielhaft ausgewählten<br />
Jugendämtern beruhten, wurde zwischenzeitlich <strong>in</strong> mehr als 20 Landkreisen evaluiert <strong>und</strong> stellt damit e<strong>in</strong>e belastbare<br />
Gr<strong>und</strong>lage zur Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern dar, <strong>der</strong>en wesentliche Erkenntnisse durchaus auf an<strong>der</strong>e<br />
Fachämter übertragen werden können. Abbildung 8 verdeutlicht e<strong>in</strong>ige wichtige Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong><br />
Daten <strong>der</strong> Jugendämter am Beispiel <strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>dienstes. Alle<strong>in</strong> die Unterschiede bei den System- <strong>und</strong> Rüstzeiten machen<br />
deutlich, dass auch Faktoren für die Personalbedarfsbemessung (Größe <strong>und</strong> Organisation <strong>des</strong> Amtes, Schnittstellen<br />
mit an<strong>der</strong>en Fachämtern) wichtig s<strong>in</strong>d, die außerhalb <strong>der</strong> Verantwortung <strong>der</strong> Fachkräfte liegen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> Organisationsoptimierung zugänglich s<strong>in</strong>d.<br />
Abbildung 8: System- <strong>und</strong> Rüstzeitunterschiede<br />
Quelle: INSO Essen.<br />
Wichtig ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die Feststellung, dass e<strong>in</strong> gesteigerter <strong>Steuerung</strong>sanspruch <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> personalseitig nicht ger<strong>in</strong>gere, son<strong>der</strong>n höhere Kosten verursacht. Mit dieser Erkenntnis muss <strong>der</strong> vielfach<br />
verbreiteten Auffassung entgegen getreten werden, dass am eigenen Personal am leichtesten gespart ist. Zwar werden<br />
16
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
mit eigenem Personal auch f<strong>in</strong>anzielle Verpflichtungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft e<strong>in</strong>gegangen, jedoch belaufen sich die Personalausgaben<br />
im Regelfall nur auf e<strong>in</strong>en Bruchteil aller Ausgaben im <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>bereich. Das <strong>Steuerung</strong>sbzw.<br />
E<strong>in</strong>sparpotenzial ist auf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Leistungsausgaben wesentlich höher, das jedoch nur mit dem notwendigen<br />
Fachpersonal gehoben werden kann.<br />
3.5 Prozesssteuerung <strong>der</strong> Fallbearbeitung<br />
Die Darstellung von Geschäftsprozessen ermöglicht nicht nur e<strong>in</strong>e Personalbedarfsbemessung, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> Behördenorganisation, die über die Querschnittsperspektive (Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung, neues<br />
<strong>Steuerung</strong>smodell) h<strong>in</strong>aus fachliche Aspekte stärker <strong>in</strong> den Blick nimmt. Zwar beruht die Prozessoptimierung wie <strong>in</strong><br />
jedem an<strong>der</strong>en Fachgebiet so auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> im Wesentlichen auf Erkenntnissen <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en<br />
Organisationslehre, 15 jedoch müssen aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen aus den <strong>Sozial</strong>gesetzbüchern beson<strong>der</strong>e Aspekte Berücksichtigung<br />
f<strong>in</strong>den (z. B. Betroffenenbeteiligung, Subsidiaritätsgedanke, <strong>Sozial</strong>datenschutz), die den Gestaltungsspielraum<br />
e<strong>in</strong>engen.<br />
Anhand <strong>der</strong> fachlichen Analyse von Geschäftsprozessen können Schnittstellen <strong>und</strong> Überschneidungen zwischen e<strong>in</strong>zelnen<br />
Sachgebieten bei <strong>der</strong> Fallbearbeitung leichter aufgedeckt <strong>und</strong> optimiert werden. Nach Struktur <strong>und</strong> Aufgabenstellung<br />
kann beispielsweise für e<strong>in</strong>zelne Fachämter abgewogen werden, ob <strong>und</strong> <strong>in</strong>wieweit e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches Falle<strong>in</strong>gangsmanagement<br />
notwendig <strong>und</strong> s<strong>in</strong>nvoll ist <strong>und</strong> nach welchen Kriterien die Arbeitsteilung (z. B. regional, funktional)<br />
vorgenommen wird. Auch die Taktung <strong>und</strong> Dauer von Teambesprechungen (z. B. Hilfeplangespräch <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>)<br />
kann genauer <strong>in</strong> den Blick genommen werden. Von beson<strong>der</strong>er Bedeutung ist dabei die Prozesssteuerung im<br />
Verhältnis zu externen Akteuren wie an<strong>der</strong>en Sachgebieten o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Leistungsanbietern.<br />
3.6 Def<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> Kontrolle von Qualitätsstandards<br />
Die vorgenannten Instrumentarien zur Hebung <strong>der</strong> <strong>Steuerung</strong>spotenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> bleiben wirkungslos,<br />
wenn für die strategische Ausrichtung <strong>des</strong> Verwaltungshandelns die politischen Vorgaben fehlen. Für die<br />
demografisch ausgerichtete <strong>Sozial</strong>planung bedarf es geme<strong>in</strong>dlicher bzw. kreispolitischer Leitbil<strong>der</strong>, die ausgehend von<br />
den aktuellen Gegebenheiten <strong>und</strong> unter Berücksichtigung <strong>der</strong> zu erwartenden Entwicklung für das tägliche Verwaltungshandeln<br />
konkretisierbare Zukunftsideen vorgeben. Wie unter 3.1 angesprochen, sollten die Ergebnisse e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten<br />
<strong>Sozial</strong>berichterstattung/-planung <strong>in</strong> den Gremien <strong>der</strong> kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den zur Diskussion gestellt<br />
werden. Ähnlich wie bei Kreisentwicklungsprogrammen o<strong>der</strong> seniorenpolitischen Gesamtkonzepten können bei <strong>der</strong><br />
Entwicklung von Leitbil<strong>der</strong>n auch die Bürger im Rahmen von themenfeldstrukturierten Arbeitsgruppen unmittelbar<br />
<strong>in</strong> die Diskussion e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden, um <strong>der</strong>en Sachverstand zu nutzen <strong>und</strong> den Partizipationsgedanken zu för<strong>der</strong>n.<br />
Angesichts <strong>des</strong> umgekehrt proportionalen Verhältnisses von Reichweite <strong>und</strong> Realisierungschancen von Planungszielen<br />
sollten Zukunftsvorstellungen gr<strong>und</strong>sätzlich realistisch bleiben. Dies gilt <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Weise für die Kommunalpolitik,<br />
die bei <strong>der</strong> Ressourcenausstattung <strong>und</strong> dem Gestaltungsspielraum stärker von übergeordneten Ebenen abhängig<br />
ist.<br />
Aus <strong>der</strong> planerischen Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen für das Geme<strong>in</strong>wesen s<strong>in</strong>d die unter Beachtung <strong>der</strong><br />
gesetzlichen Gr<strong>und</strong>lagen notwendigen fachlichen Qualitätsstandards für die <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> abzuleiten. Hier<br />
gilt es <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Weise darauf zu achten, welche zukünftigen Mehrausgaben durch e<strong>in</strong> höheres Qualitätsniveau<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gegenwart vermieden werden können. Der ewige Streit um die Frage, ob die „Präventionsrendite“ nur zu<br />
Mehrausgaben geführt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Folge jedoch ke<strong>in</strong>e Absenkung <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>ausgaben ermöglicht habe,<br />
15<br />
Geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d Gr<strong>und</strong>lagen wie Standardisierung von Verfahren, Def<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> Anwendung von Methoden, Teambildung, Schleifen <strong>der</strong> Rückkopplung/<br />
<strong>Steuerung</strong>.<br />
17
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
o<strong>der</strong> ob ohne Prävention das aktuelle Ausgabenniveau nicht noch höher wäre, kann nur beantwortet werden, wenn<br />
entsprechende Maßnahmen nicht nur e<strong>in</strong>geführt, son<strong>der</strong>n zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt <strong>in</strong> ihren Wirkungen sowie<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>des</strong> Kosten-Nutzen-Verhältnisses auch überprüft werden. Dies setzt e<strong>in</strong> zentrales <strong>und</strong> dezentrales Controll<strong>in</strong>g-<br />
<strong>und</strong> Berichtswesen im Landratsamt bzw. <strong>in</strong> den Fachämtern voraus. Anhand steuerungsrelevanter Kennzahlen<br />
können Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong>nerhalb <strong>des</strong> eigenen Referenzrahmens aufgezeigt <strong>und</strong> Vergleiche zu an<strong>der</strong>en Aufgabenträgern<br />
angestellt werden. Die damit geschaffene Transparenz ermöglicht e<strong>in</strong>e wesentlich weitergehende Ursachenanalyse<br />
als Voraussetzung zur Organisationsentwicklung <strong>und</strong> Optimierung <strong>des</strong> Aufgabenvollzugs.<br />
Zwischenzeitlich hat <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esgesetzgeber <strong>in</strong> § 79 a SGB VIII solche Def<strong>in</strong>itionen <strong>und</strong> Überprüfungen von Qualitätsstandards<br />
für die K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> verpflichtend e<strong>in</strong>geführt. Für Bayern kann <strong>in</strong>soweit darauf verwiesen<br />
werden, dass das dafür notwendige Instrumentarium im Wesentlichen bereits vorhanden ist:<br />
- Mit <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>berichterstattung <strong>in</strong> Bayern (JUBB) wird vom Bayerischen Lan<strong>des</strong>jugendamt e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher<br />
Rahmen für vergleichbare Daten zur Verfügung gestellt, aus dem – ggf. durch weitere Daten vor Ort ergänzt –<br />
steuerungsrelevante Kennzahlen abgeleitet werden können.<br />
- Das PeB-Konzept versetzt die örtlichen Träger <strong>der</strong> öffentlichen <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> die Lage, nahezu alle Fachaufgaben<br />
im Jugendamt prozesshaft abzubilden, den Personalbedarf zu eruieren, die notwendige Qualitätsdiskussion zu<br />
führen <strong>und</strong> somit die Gr<strong>und</strong>lage für e<strong>in</strong>e laufende Qualitätsüberprüfung zu schaffen.<br />
- Die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Landratsämtern bereits vorhandenen zentralen <strong>und</strong> dezentralen Controll<strong>in</strong>ge<strong>in</strong>heiten arbeiten die<br />
steuerungsrelevanten Kennzahlen auf <strong>und</strong> können daraus Empfehlungen für die <strong>in</strong>terne <strong>Steuerung</strong> <strong>und</strong> politische<br />
Entscheidung ableiten.<br />
4. <strong>Sozial</strong>planung als Bestandteil <strong>der</strong> mittelfristigen F<strong>in</strong>anzplanung<br />
Wenn bei bayerischen Landkreisen unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Bezirksumlage mehr als zwei Drittel, teilweise sogar<br />
drei Viertel aller Ausgaben <strong>des</strong> Verwaltungshaushalts durch die Kosten für die <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d,<br />
liegt es auf <strong>der</strong> Hand, die mittelfristige F<strong>in</strong>anzplanung <strong>der</strong> Landkreise um die Ergebnisse e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten <strong>Sozial</strong>planung<br />
zu ergänzen. Auf diese Weise könnten die mittel- <strong>und</strong> langfristigen Vorausschätzungen verbessert <strong>und</strong> die Effekte<br />
e<strong>in</strong>er verbesserten <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> transparent gemacht <strong>und</strong> e<strong>in</strong>kalkuliert werden. Schließlich<br />
könnte auch besser unterschieden werden zwischen dem eigenverantwortlich steuerbaren Potenzial an kommunalpolitischem<br />
Gestaltungsspielraum <strong>und</strong> den als unverän<strong>der</strong>bar anzusehenden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen. Damit würde die<br />
F<strong>in</strong>anzplanung <strong>der</strong> Landkreise auch anschlussfähig gegenüber unter- <strong>und</strong> übergeordneten Planungen <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>den<br />
bzw. <strong>der</strong> Bezirke.<br />
Angesichts <strong>der</strong> im Bereich <strong>der</strong> kommunalen <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> geb<strong>und</strong>enen F<strong>in</strong>anzvolum<strong>in</strong>a <strong>und</strong> <strong>der</strong> aufgezeigten<br />
<strong>Steuerung</strong>spotenziale erstaunt die Erkenntnis, dass <strong>der</strong> Dauerkonflikt zwischen Querschnitts<strong>in</strong>teressen <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>politik<br />
auch auf kommunaler Ebene stark ausgeprägt ist. Die Notwendigkeit <strong>des</strong> permanenten Ausgleichs zwischen sozialpolitischen<br />
For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzpolitischer Realisierbarkeit führt hier wie auf übergeordneten Ebenen zu e<strong>in</strong>er<br />
ausgeprägten Neigung zur Ane<strong>in</strong>an<strong>der</strong>reihung von E<strong>in</strong>zelaktionen <strong>und</strong> Teilreformen. Dabei wird <strong>der</strong> Problemdruck<br />
<strong>in</strong> den nächsten Jahren nicht ger<strong>in</strong>ger, son<strong>der</strong>n aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels dramatisch steigen. Umso<br />
wichtiger ersche<strong>in</strong>t die Gründung e<strong>in</strong>er Allianz zwischen <strong>Sozial</strong>-, F<strong>in</strong>anz- <strong>und</strong> Controll<strong>in</strong>gfachleuten mit <strong>der</strong> Aufgabe,<br />
die Planbarkeit <strong>und</strong> strategische <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> weiteren Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> auf Landkreisebene<br />
im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Angriff zu nehmen. Nur so können die mit Blick auf<br />
den demografischen Wandel so dr<strong>in</strong>gend benötigten Synergien genutzt werden <strong>und</strong> die Effizienz <strong>des</strong> E<strong>in</strong>satzes „<strong>des</strong><br />
Steuereuros“ gesteigert werden.<br />
18
<strong>Strategische</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
5. Zusammenfassung<br />
Die unzureichende F<strong>in</strong>anzsituation <strong>der</strong> Kommunen aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> häufig gesetzlich geb<strong>und</strong>enen <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>ausgaben<br />
reduziert ihre Handlungs- <strong>und</strong> Gestaltungsspielräume bei <strong>der</strong> Bekämpfung <strong>der</strong> negativen Folgen <strong>des</strong><br />
demografischen Wandels. S<strong>in</strong>d die Regionen <strong>in</strong> Bayern unterschiedlich von Ab- <strong>und</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Menschen<br />
betroffen, gilt die Verschiebung <strong>der</strong> Altersschichtung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft für alle <strong>in</strong> gleicher Weise. Immer weniger<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> werden geboren, immer mehr Menschen freuen sich über e<strong>in</strong>e höhere Lebenserwartung. Gesamtwirtschaftlich<br />
betrachtet wird sich das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen <strong>und</strong> Transferleistungsempfängern <strong>in</strong> den nächsten Jahrzehnten<br />
dramatisch verschlechtern. In den von Abwan<strong>der</strong>ung betroffenen Regionen s<strong>in</strong>d die Auswirkungen dieser<br />
Entwicklung schon heute spürbar. In etwa zehn Jahren werden auch die heutigen Zuzugsregionen betroffen se<strong>in</strong>. Diese<br />
Entwicklung ist unaufhaltsam, selbst bei gesteigerter Zuwan<strong>der</strong>ung.<br />
Die negativen Folgen <strong>des</strong> demografischen Wandels betreffen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> die <strong>in</strong> ihnen lebenden<br />
Menschen unmittelbar. Nur mit e<strong>in</strong>er demografieorientierten, aktiven Familienpolitik können Gegenmaßnahmen<br />
entwickelt <strong>und</strong> erprobt werden. Geplant <strong>und</strong> entwickelt werden diese Maßnahmen im kreisangehörigen Raum<br />
s<strong>in</strong>nvollerweise vom Landkreis. Durchgeführt <strong>und</strong> gelebt werden müssen diese Maßnahmen auf Geme<strong>in</strong>deebene.<br />
Mittelfristiges Ziel muss es se<strong>in</strong>, junge Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region <strong>in</strong> die Lage zu versetzen, Eltern se<strong>in</strong> zu können <strong>und</strong><br />
zu wollen. Dies setzt neben ökonomischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Bildung vor allem familienunterstützende Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen voraus. Die Entwicklung passgenauer Angebote vor Ort muss zielgerichtet geplant<br />
<strong>und</strong> ausf<strong>in</strong>anziert werden. Sofern die Kommunen sich zu e<strong>in</strong>er aktiven Familienpolitik verpflichten, werden sie nicht<br />
nur für e<strong>in</strong>e bessere F<strong>in</strong>anzausstattung kämpfen, son<strong>der</strong>n auch eigene <strong>Steuerung</strong>spotenziale heben müssen. Da die<br />
f<strong>in</strong>anzpolitischen For<strong>der</strong>ungen seit geraumer Zeit ausformuliert <strong>und</strong> gegenüber <strong>der</strong> B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Lan<strong>des</strong>regierung<br />
erhoben s<strong>in</strong>d, muss <strong>der</strong> Fokus auf <strong>der</strong> strategischen <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> liegen. Nur wenn <strong>der</strong><br />
Nachweis erbracht werden kann, dass „<strong>der</strong> Steuereuro“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> effizient e<strong>in</strong>gesetzt wird <strong>und</strong> die<br />
Kommunen die weiteren Fallzahl- <strong>und</strong> Kostensteigerungen nicht zu verantworten haben, kann <strong>der</strong> politische Druck<br />
zu notwendigen Reformmaßnahmen erhöht werden.<br />
Dr. Klaus Schulenburg<br />
Bayerischer Landkreistag<br />
19
Tagungsbericht<br />
Tagungsbericht<br />
Die Landräte <strong>der</strong> 71 bayerischen Landkreise haben sich <strong>in</strong> ihrer 44. Landrätetagung am 17. <strong>und</strong> 18. Oktober 2012 <strong>in</strong><br />
Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, mit den Ursachen für die steigenden Ausgaben für <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> sowie<br />
den Auswirkungen <strong>des</strong> demografischen Wandels ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>gesetzt.<br />
Im e<strong>in</strong>führenden Hauptvortrag erläuterte Privatdozent Dr. Karl He<strong>in</strong>z Brisch, Leiter <strong>der</strong> Abteilung für Pädiatrische<br />
Psychosomatik <strong>und</strong> Psychotherapie am Dr. von Haunerschen K<strong>in</strong><strong>der</strong>spital, München, die Bedeutung <strong>der</strong> sicheren<br />
B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen. Verschiedene Forschungsrichtungen<br />
bestätigen wie<strong>der</strong>holt die herausragende Bedeutung <strong>des</strong> Verlaufs <strong>der</strong> Schwangerschaft <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er<br />
positiven Mutter-K<strong>in</strong>d-B<strong>in</strong>dung für die spätere Entwicklung <strong>des</strong> Menschen. Selbst- <strong>und</strong> fremdverschuldete Stressfaktoren<br />
im familiären Umfeld vor <strong>und</strong> nach <strong>der</strong> Geburt reduzieren die Chancen für e<strong>in</strong> gel<strong>in</strong>gen<strong>des</strong> Aufwachsen junger<br />
Menschen drastisch. Dem Erkennen <strong>und</strong> Abmil<strong>der</strong>n möglicher Belastungsfaktoren komme aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong><br />
präventiven <strong>Jugendhilfe</strong> unter den Vorzeichen <strong>des</strong> demografischen Wandels große Bedeutung zu. Neben an<strong>der</strong>en Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
müssten dazu <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e werdende Mütter <strong>in</strong> die Lage versetzt werden, ihr K<strong>in</strong>d anzunehmen<br />
<strong>und</strong> mit ihm verantwortungsbewusst umzugehen. Als Beispiele für entsprechende Präventionsmaßnahmen können<br />
die am Haunerschen K<strong>in</strong><strong>der</strong>spital entwickelten Programme SAFE (Sichere Ausbildung für Eltern) zur Stärkung <strong>der</strong><br />
Erziehungskompetenz von Eltern sowie BASE Babywatch<strong>in</strong>g (Baby-Beobachtung im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule<br />
gegen Aggression <strong>und</strong> Angst zur För<strong>der</strong>ung von Sensitivität <strong>und</strong> Empathie) angesehen werden.<br />
Im zweiten Hauptvortrag arbeitete Dr. Ulrich Bürger, Lan<strong>des</strong>jugendamt Baden-Württemberg, se<strong>in</strong>e Thesen zum kritischen<br />
Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik mit <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien heraus. Die<br />
Überalterung <strong>der</strong> Gesellschaft ist nicht mehr aufzuhalten. S<strong>in</strong>d die Auswirkungen <strong>der</strong> zu niedrigen Geburtenraten <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> längeren Lebenserwartung <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> Abwan<strong>der</strong>ungsgebieten heute schon sichtbar, werden davon <strong>in</strong> wenigen<br />
Jahren auch die meisten bisherigen Zuzugsregionen massiv betroffen se<strong>in</strong>. Das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen <strong>und</strong><br />
Transferleistungsbeziehern wird sich <strong>in</strong> den kommenden zehn Jahren dramatisch verschlechtern. Sollen junge Menschen<br />
aus volkswirtschaftlicher Sicht als Transferleistungsempfänger nicht zur doppelten demografischen Belastung werden,<br />
müsse <strong>in</strong> <strong>der</strong> nächsten Dekade alles daran gesetzt werden, sie zur vollwertigen Erwerbsfähigkeit zu führen. Langfristig<br />
müssen parallel dazu die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für Familien vor Ort zu verbessert werden, damit die Bereitschaft <strong>und</strong><br />
die Befähigung junger Menschen, selbst Verantwortung als Eltern übernehmen zu wollen, gestärkt werden. Gefor<strong>der</strong>t<br />
sei daher nicht nur e<strong>in</strong>e aktive<br />
kommunale Familienpolitik,<br />
wie sie <strong>in</strong> Ansätzen schon betrieben<br />
wird, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong><br />
aktives Lobby<strong>in</strong>g <strong>der</strong> Kommunen<br />
für Familien <strong>und</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
gegenüber den Län<strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
dem B<strong>und</strong>. Die demografische<br />
Zukunft liege <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den,<br />
die sich zur Verstärkung<br />
ihrer Maßnahmen Instrumente<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>terkommunalen<br />
Zusammenarbeit sowie <strong>der</strong><br />
Unterstützung <strong>der</strong> Landkreise<br />
bedienen müssten.<br />
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke referiert über Schuldenbremse <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>staat.<br />
Als e<strong>in</strong> geeignetes Instrument<br />
zur <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit<br />
stellte Dr. Jürgen<br />
20
Tagungsbericht<br />
Gros, Genossenschaftsverband<br />
Bayern, die Genossenschaftsidee<br />
<strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten<br />
im <strong>Sozial</strong>bereich vor. In<br />
Bayern gebe es bereits 50 Genossenschaften,<br />
<strong>in</strong> denen sich<br />
E<strong>in</strong>zelne o<strong>der</strong> Institutionen<br />
zur Verfolgung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen<br />
(sozialen) Ziels zusammengef<strong>und</strong>en<br />
haben, etwa zur<br />
Organisation von Seniorenwohnen,<br />
zur Sicherstellung<br />
<strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung<br />
bzw. <strong>der</strong> <strong>in</strong>frastrukturellen<br />
Nahraumversorgung o<strong>der</strong> zur<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung. Die Vorteile<br />
<strong>des</strong> Genossenschaftsmodells<br />
liegen u. a. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Möglichkeit<br />
Präsident Dr. Jakob Kreidl (Mitte) <strong>und</strong> <strong>der</strong> gastgebende Landrat Dr. Günther Denzler, Bamberg, mit dem<br />
<strong>Sozial</strong>referenten <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags Dr. Klaus Schulenburg (l<strong>in</strong>ks) bei <strong>der</strong> Pressekonferenz.<br />
<strong>der</strong> Verknüpfung öffentlicher <strong>und</strong> privatwirtschaftlicher Interessen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vernetzung unterschiedlichster Akteure<br />
sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Flexibilität <strong>der</strong> satzungsmäßigen Ausgestaltung. Mit <strong>der</strong> Erweiterung <strong>der</strong> Zweckbestimmung im Genossenschaftsgesetz<br />
2006 um soziale <strong>und</strong> kulturelle Belange wurden auch für die Kommunen völlig neue Möglichkeiten<br />
geschaffen, Genossenschaften selbst e<strong>in</strong>zugehen o<strong>der</strong> solche <strong>in</strong> ihrem Zuständigkeitsbereich zu <strong>in</strong>itiieren.<br />
Staatsm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Christ<strong>in</strong>e Ha<strong>der</strong>thauer, Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>ordnung, Familie <strong>und</strong><br />
Frauen, erläuterte <strong>in</strong> ihrem Vortrag unter <strong>der</strong> Überschrift „Solidarität braucht Subsidiarität“ die Gr<strong>und</strong>sätze <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>politik<br />
<strong>der</strong> Bayerischen Staatsregierung. Beson<strong>der</strong>en Wert legte sie auf die Feststellung, dass im S<strong>in</strong>ne gelebter Subsidiarität<br />
Eltern <strong>und</strong> Familien wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> die Lage versetzt werden müssten, ihre zentrale Rolle für die Gesellschaft ausfüllen<br />
zu können. In diesem Zusammenhang warnte sie vor e<strong>in</strong>er immer weiter gehenden Substituierung nachlassen<strong>der</strong> Elternkompetenzen<br />
durch professionelle Dienste, die auf lange Sicht volkswirtschaftlich nicht f<strong>in</strong>anzierbar sei. Es müsse<br />
vielmehr darum gehen, über präventive Maßnahmen möglichst frühzeitig Eltern <strong>in</strong> ihren Erziehungskompetenzen zu<br />
stärken. Der Freistaat beabsichtige daher, neben <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Familienstützpunkten u. a. Geburtsvorbereitungskurse<br />
über den re<strong>in</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Fokus auf die Nie<strong>der</strong>kunft h<strong>in</strong>aus um Informationen zum späteren verantwortungsbewussten<br />
Umgang mit dem K<strong>in</strong>d zu erweitern. Neben dem gel<strong>in</strong>genden Start <strong>in</strong>s Leben müsse angesichts <strong>der</strong><br />
gesellschaftlichen Entwicklung die K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung qualitativ gesteigert <strong>und</strong> das Angebot flexibilisiert werden, <strong>in</strong>dem<br />
etwa die Tagespflege gestärkt wird. Jede Ebene im Staatsaufbau müsse ihren spezifischen Beitrag zur Bewältigung<br />
<strong>der</strong> Auswirkungen <strong>des</strong> demografischen Wandels leisten. Für die Kommunen gehe es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie darum, maßgeschnei<strong>der</strong>te<br />
Konzepte für örtliche Projekte zu entwickeln. Um sie dazu <strong>in</strong> die Lage zu versetzen, müsse die f<strong>in</strong>anzielle<br />
Entlastung <strong>der</strong> Kommunen durch den B<strong>und</strong> wie im Rahmen <strong>der</strong> Kostenübernahme bei <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter<br />
<strong>und</strong> bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung zw<strong>in</strong>gend fortgesetzt werden, <strong>in</strong>dem für die E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungshilfe e<strong>in</strong> B<strong>und</strong>esleistungsgesetz<br />
geschaffen wird.<br />
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer <strong>des</strong> Deutschen Landkreistags, formulierte schließlich zum<br />
Thema „Schuldenbremse <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>staat“ e<strong>in</strong>ige Leitgedanken für die anstehende politische Diskussion. Trotz <strong>der</strong> mit<br />
<strong>der</strong> Fö<strong>der</strong>alismusreform II 2009 <strong>in</strong>s Gr<strong>und</strong>gesetz e<strong>in</strong>geführten Schuldenbremse (Art. 109, 115 <strong>und</strong> 143d GG) haben<br />
bereits e<strong>in</strong>ige Län<strong>der</strong> (u. a. Nie<strong>der</strong>sachsen <strong>und</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen) politische Entscheidungen getroffen, die <strong>der</strong>zeit<br />
noch geltenden Ausnahmeregelungen zur Kreditermächtigung ausnutzen zu wollen. Wenn die Regelungen <strong>der</strong> Schuldenbremse<br />
im Gr<strong>und</strong>gesetz ab 2020 vollständig greifen, stellt sich angesichts <strong>des</strong> demografischen Wandels die Frage,<br />
wie damit das weitere Ausgreifen <strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>staats vere<strong>in</strong>bar se<strong>in</strong> soll. Letztlich werde sich die Politik mit <strong>der</strong> Frage<br />
beschäftigen müssen, ob die bisherigen Standards <strong>und</strong> Def<strong>in</strong>itionen von sozialen Bedarfslagen zukunftsfest s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />
„weiter wie bisher“ könne es ke<strong>in</strong>esfalls geben. Der Riester-Gedanke <strong>des</strong> Ansparens von freien E<strong>in</strong>nahmen für die Zukunft<br />
müsse auf die Staatsf<strong>in</strong>anzen übertragen werden. Wenn <strong>der</strong> demografische Wandel vor Ort gestaltet werden soll,<br />
21
Tagungsbericht<br />
müssten die Kommunen f<strong>in</strong>anziell dazu <strong>in</strong> die Lage versetzt<br />
werden. Dazu müsste aber nicht nur auf <strong>der</strong> Ausgabenseite<br />
Entlastung geschaffen werden; auch die kommunalen E<strong>in</strong>nahmen<br />
müssten verbessert werden.<br />
Die Tagung bot den Landräten neben fachlichen Anregungen<br />
aus den Vorträgen auch die Möglichkeit, sich im Rahmen<br />
von Arbeitsgruppen mit bestehenden Instrumenten<br />
<strong>der</strong> strategischen <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> zu<br />
befassen. Anhand von Praxisbeispielen wurden die <strong>in</strong>tegrierte<br />
<strong>Sozial</strong>planung, die sozialräumliche Organisation <strong>der</strong><br />
Leistungsgewährung, die Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
sowie <strong>der</strong> fachlich unterlegte Kennzahlenvergleich<br />
als Gr<strong>und</strong>lage für das steuerungsrelevante Controll<strong>in</strong>g<br />
vorgestellt <strong>und</strong> beraten. Aus den Erfahrungsberichten<br />
wurde deutlich, dass zahlreiche Landkreise bereits e<strong>in</strong>zelne<br />
Instrumente e<strong>in</strong>setzen. Alle Instrumente im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es<br />
strategischen Managementkreislaufs gleichzeitig zu realisieren,<br />
scheitert jedoch nicht alle<strong>in</strong> an den beschränkten Ressourcen.<br />
Vielmehr müssen erst nach <strong>und</strong> nach Erfahrungen<br />
auf e<strong>in</strong>zelnen Gebieten gesammelt werden, um Politik <strong>und</strong><br />
Verwaltung vor Ort nicht zu überfor<strong>der</strong>n. Angesichts <strong>der</strong><br />
bereits laufenden <strong>und</strong> sich <strong>in</strong> den nächsten Jahren voraussichtlich<br />
<strong>in</strong>tensivierenden Diskussion über den „effizienten“<br />
E<strong>in</strong>satz <strong>des</strong> Steuereuros <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> werden<br />
die Landkreise jedoch nicht umh<strong>in</strong> können, ihr Engagement<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich zu verstärken.<br />
<strong>Sozial</strong>m<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Christ<strong>in</strong>e Ha<strong>der</strong>thauer wird von Dr. Jakob Kreidl,<br />
dem Präsidenten <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags, als Ehrengast empfangen.<br />
Der Präsident <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags, Landrat Dr.<br />
Jakob Kreidl, Miesbach, <strong>und</strong> <strong>der</strong> gastgebende Landrat, Dr.<br />
Günther Denzler, Bamberg, betonten bei <strong>der</strong> abschließenden<br />
Pressekonferenz die Notwendigkeit <strong>der</strong> Unterstützung<br />
von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Freistaat Bayern. E<strong>in</strong>e aktive kommunale<br />
Familienpolitik zur Begegnung <strong>der</strong> Auswirkungen <strong>des</strong> demografischen<br />
Wandels setze f<strong>in</strong>anzielle <strong>und</strong> konzeptionelle<br />
Handlungsspielräume voraus, die die übergeordneten staatlichen<br />
Ebenen gewähren müssten.<br />
22
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für<br />
das Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
Jugendlichen<br />
Karl He<strong>in</strong>z Brisch<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> Polikl<strong>in</strong>ik<br />
im Dr. von Haunerschen K<strong>in</strong><strong>der</strong>spital<br />
Abteilung Pädiatrische Psychosomatik <strong>und</strong> Psychotherapie<br />
Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München<br />
PD Dr. Karl He<strong>in</strong>z Brisch unterstreicht die überragende Bedeutung e<strong>in</strong>er sicheren B<strong>in</strong>dung für<br />
frühk<strong>in</strong>dliche Entwicklung.<br />
23
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Übersicht<br />
• B<strong>in</strong>dungsentwicklung<br />
• B<strong>in</strong>dungsqualitäten<br />
• Vorteile e<strong>in</strong>er sicheren B<strong>in</strong>dung<br />
• B<strong>in</strong>dungsstörungen<br />
• Vorbeugung von B<strong>in</strong>dungsproblemen<br />
Überlebenswichtige Bedürfnisse<br />
1.<br />
Physiologische<br />
2. 3.<br />
Bedürfnisse<br />
B<strong>in</strong>dung<br />
Exploration<br />
6.<br />
Sensorische<br />
Stimulation<br />
Beziehung<br />
5.<br />
Selbstwirksamkeit<br />
4.<br />
Vermeidung von<br />
negativen Reizen<br />
24
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
John Bowlby<br />
"B<strong>in</strong>dung ist das gefühlsgetragene Band,<br />
das e<strong>in</strong>e Person zu e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en<br />
spezifischen Person anknüpft <strong>und</strong> das sie<br />
über Raum <strong>und</strong> Zeit mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verb<strong>in</strong>det."<br />
B<strong>in</strong>dung zum Überleben <strong>und</strong> zur<br />
Entwicklung<br />
• B<strong>in</strong>dung ist für das Leben so gr<strong>und</strong>legend<br />
wie Luft zum Atmen <strong>und</strong> Ernährung<br />
• Die emotionale B<strong>in</strong>dung sichert das<br />
Überleben <strong>und</strong> die Entwicklung <strong>des</strong><br />
Säugl<strong>in</strong>gs – <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es jeden Menschen<br />
25
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
B<strong>in</strong>dungstheorie<br />
• E<strong>in</strong> Säugl<strong>in</strong>g entwickelt im Laufe <strong>des</strong> ersten<br />
Lebensjahres e<strong>in</strong>e spezifische emotionale<br />
B<strong>in</strong>dung an e<strong>in</strong>e Hauptb<strong>in</strong>dungsperson<br />
• Die emotionale B<strong>in</strong>dung sichert das<br />
Überleben <strong>des</strong> Säugl<strong>in</strong>gs<br />
• Die B<strong>in</strong>dungsperson ist <strong>der</strong><br />
„sichere emotionale Hafen“<br />
für den Säugl<strong>in</strong>g<br />
B<strong>in</strong>dungstheorie<br />
• Die Haupt-B<strong>in</strong>dungsperson muss nicht die<br />
leibliche Mutter/Vater se<strong>in</strong><br />
• Emotionale B<strong>in</strong>dung <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>des</strong> an die<br />
B<strong>in</strong>dungsperson entsteht NICHT durch<br />
genetische Verwandtschaft<br />
• In <strong>der</strong> wiss. f<strong>und</strong>ierten B<strong>in</strong>dungstheorie gibt<br />
es ke<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>dung durch "Blutsbande"<br />
26
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Hierarchie <strong>der</strong> B<strong>in</strong>dungspersonen<br />
(B<strong>in</strong>dungspyramide)<br />
• Hauptb<strong>in</strong>dungsperson<br />
– wird bei größtem Stress aufgesucht<br />
– kann am besten beruhigen<br />
• Nachgeordnete B<strong>in</strong>dungspersonen<br />
– können bei kle<strong>in</strong>erem Stress trösten<br />
– werden als Ersatz für Hauptb<strong>in</strong>dungsperson<br />
akzeptiert, wenn diese nicht verfügbar ist<br />
„B<strong>in</strong>dungs - Erk<strong>und</strong>ungs - Wippe“<br />
B<strong>in</strong>dung<br />
Erk<strong>und</strong>ung<br />
Erk<strong>und</strong>ung<br />
aktiviert<br />
B<strong>in</strong>dung<br />
beruhigt<br />
B<strong>in</strong>dung<br />
aktiviert<br />
Erk<strong>und</strong>ung<br />
gestoppt<br />
27
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Fe<strong>in</strong>fühligkeit<br />
• Die Pflegeperson mit <strong>der</strong> größten<br />
Fe<strong>in</strong>fühligkeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Interaktion wird die<br />
Hauptb<strong>in</strong>dungsperson für den Säugl<strong>in</strong>g<br />
• Große Fe<strong>in</strong>fühligkeit för<strong>der</strong>t e<strong>in</strong>e sichere<br />
B<strong>in</strong>dungsentwicklung<br />
• Die B<strong>in</strong>dungsperson muss nicht die<br />
leibliche Mutter se<strong>in</strong><br />
• Verhalten<br />
• Sprache<br />
• Rhythmus<br />
• Blickkontakt<br />
• Berührung<br />
Fe<strong>in</strong>fühligkeit II<br />
28
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
B<strong>in</strong>dungsqualitäten<br />
• Schutzfaktor B<strong>in</strong>dung<br />
– Sichere B<strong>in</strong>dung (ca. 55-60%)<br />
• Risikofaktor B<strong>in</strong>dung<br />
– Unsichere B<strong>in</strong>dungen<br />
• Vermeidend (ca. 15-20%)<br />
• Ambivalent (ca. 5-10%)<br />
• Beg<strong>in</strong>nende Psychopathologie <strong>der</strong> B<strong>in</strong>dung<br />
– Desorganisiert (ca. 5-10%)<br />
• Manifeste frühe Psychopathologie <strong>der</strong> B<strong>in</strong>dung<br />
– B<strong>in</strong>dungsstörung (ca. 3-5%)<br />
Ursachen <strong>der</strong> <strong>des</strong>organisierten<br />
B<strong>in</strong>dung<br />
• Ungelöstes Trauma <strong>der</strong> Eltern<br />
• Auffälligkeiten <strong>der</strong> Pflegeperson <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Interaktion mit dem K<strong>in</strong>d<br />
– Angstmachen<strong>des</strong> Verhalten<br />
– Ängstliches Verhalten<br />
– Hilfloses Verhalten<br />
• In e<strong>in</strong>zelnen Episoden Wie<strong>der</strong>holung <strong>des</strong><br />
Traumas mit eigenem K<strong>in</strong>d (Gewalt)<br />
29
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Verhalten <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>des</strong> bei<br />
<strong>des</strong>organisierter B<strong>in</strong>dung I<br />
• Wi<strong>der</strong>sprüchliches, nicht voraussagbares <strong>und</strong><br />
rasch wechseln<strong>des</strong> Verhalten zwischen<br />
Nähesuche, Vermeidung, Ignorieren <strong>der</strong><br />
B<strong>in</strong>dungsperson<br />
• Stereotype motorische Verhaltensweisen<br />
• "Unterwasser-Bewegungen" (verlangsamte<br />
Motorik)<br />
• Wie<strong>der</strong>holt für e<strong>in</strong>ige bis viele Sek<strong>und</strong>en wie im<br />
Halbschlaf o<strong>der</strong> Tagtraum („Trance“, dissoziativer<br />
Zustand)<br />
B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> psychische<br />
Entwicklung<br />
• Sichere B<strong>in</strong>dung<br />
SCHUTZ<br />
• Un-sichere B<strong>in</strong>dung<br />
RISIKO<br />
30
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Folgen <strong>der</strong> B<strong>in</strong>dungsentwicklung<br />
(1)<br />
• Sichere B<strong>in</strong>dung<br />
– Schutzfaktor bei Belastungen<br />
– Mehr Bewältigungsmöglichkeiten<br />
– Sich Hilfe holen<br />
– Mehr geme<strong>in</strong>schaftliches Verhalten<br />
– Mehr Beziehungen<br />
– Mehr Kreativität<br />
– Mehr Flexibilität <strong>und</strong> Ausdauer<br />
– Mehr Gedächtnisleistungen <strong>und</strong> Lernen<br />
– Bessere Sprachentwicklung<br />
– Sehr gute Empathiefähigeit<br />
B<strong>in</strong>dung<br />
zwischen den Generationen<br />
• Zusammenhang zwischen<br />
B<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> Eltern <strong>und</strong> <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>des</strong><br />
– sichere Eltern mit sicheren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
• Mutter-K<strong>in</strong>d ca. 75%<br />
• Vater-K<strong>in</strong>d ca. 65%<br />
– unsichere Eltern mit unsicheren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
– traumatisierte Eltern mit <strong>des</strong>organisierten<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
31
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Ursachen von B<strong>in</strong>dungsstörungen<br />
• Viele unverarbeitete Traumatisierungen von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n durch B<strong>in</strong>dungspersonen<br />
– Massive Vernachlässigung<br />
– Sexuelle Gewalt<br />
– Körperliche Gewalt<br />
– Emotionale Gewalt<br />
– Gewalt durch Worte (Kränkungen, Demütigungen)<br />
– Häufig wechselnde Bezugssysteme<br />
– Multiple Verluste von Bezugspersonen<br />
– K<strong>in</strong>d wird Zeuge von Gewalt<br />
Säugl<strong>in</strong>g ist Auslöser („Trigger“)<br />
für Trauma-Er<strong>in</strong>nerung<br />
• B<strong>in</strong>dungspersonen werden durch Verhalten<br />
<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> an eigenes Trauma er<strong>in</strong>nert<br />
• Trigger im Verhalten <strong>des</strong> Säugl<strong>in</strong>gs,<br />
K<strong>in</strong><strong>des</strong>, Jugendlichen<br />
– B<strong>in</strong>dungswünsche, Nähe<br />
– We<strong>in</strong>en, Kummer, Schmerz, Bedürftigkeit<br />
– Ablösung, Abgrenzung<br />
32
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Re-Inszenierung <strong>des</strong> Traumas<br />
• In <strong>der</strong> Interaktion mit dem Säugl<strong>in</strong>g<br />
– Zurückweisung <strong>der</strong> Nähewünsche -Vermeidung<br />
– Gewalt<br />
– Abrupte Handlungsabbrüche<br />
– Überstimulation (sexuell-sensorisch)<br />
• In <strong>der</strong> affektiven Kommunikation<br />
– Übertragung <strong>der</strong> Trauma-Affekte<br />
• Panik, Wut, Scham, Erregung<br />
B<strong>in</strong>dungsstörungen<br />
• ohne B<strong>in</strong>dung<br />
• Promiskuität<br />
• Übererregung<br />
• Hemmung<br />
• Aggression<br />
• Unfall-Risiko<br />
• Rollenwechsel<br />
• Sucht<br />
• Psychosomatik<br />
33
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
SAFE ®<br />
SICHERE AUSBILDUNG<br />
FÜR ELTERN<br />
www.safe-programm.de<br />
Ziele <strong>der</strong> primären Prävention<br />
• För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> psychischen Ges<strong>und</strong>heit von Eltern<br />
<strong>und</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
• Entwicklung von sicherem B<strong>in</strong>dungsverhalten<br />
• Sensibilisierung <strong>der</strong> Eltern für die Signale <strong>und</strong><br />
emotionalen Bedürfnisse ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
• E<strong>in</strong>übung von fe<strong>in</strong>fühligem Interaktionsverhalten<br />
• Verarbeitung von elterlichen Traumatisierungen<br />
• Durchbrechung von „Teufelskreisen“<br />
34
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Zielgruppen<br />
• Werdende Väter <strong>und</strong> Mütter<br />
– Erstgebärende<br />
– Mehrgebärende<br />
– Paare <strong>und</strong> Alle<strong>in</strong>erziehende<br />
– Motivation für emotionale Entwicklung ihres<br />
K<strong>in</strong><strong>des</strong><br />
Module<br />
• Elterngruppen vor <strong>und</strong> nach <strong>der</strong> Geburt<br />
• Fe<strong>in</strong>fühligkeitstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />
• Hotl<strong>in</strong>e<br />
• Individuelle Beratung bis Traumatherapie<br />
35
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
SAFE - Mentor-<br />
Multiplikatoren<br />
• Weiterbildung zur SAFE-Gruppenleitung für Menschen,<br />
die mit Schwangeren, Eltern <strong>und</strong> Säugl<strong>in</strong>gen arbeiten<br />
– Schwangerschaftsberater<strong>in</strong>nen<br />
– Hebammen <strong>und</strong> Stillberater<strong>in</strong>nen<br />
– Krankenschwestern<br />
– ErzieherInnen<br />
– Geburtshelfer<br />
– Psychologen<br />
– K<strong>in</strong><strong>der</strong>ärzte<br />
– K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
– Sprachheilpädagogen <strong>und</strong> Sprachtherapeuten<br />
– Und an<strong>der</strong>e<br />
Was ist beson<strong>der</strong>s an SAFE?<br />
• Beg<strong>in</strong>n <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schwangerschaft<br />
• Nutzung <strong>des</strong> Gruppeneffektes<br />
• Fortführung bis Ende <strong>des</strong> 1. Lebensjahres<br />
• Komb<strong>in</strong>ation von Gruppe <strong>und</strong> E<strong>in</strong>zelberatung<br />
• Hotl<strong>in</strong>e bietet Sicherheit im Alltag<br />
• Vorbeugende <strong>in</strong>dividuelle Beratung <strong>und</strong> Hilfe<br />
durchbricht „Teufelskreis“<br />
• SAFE wendet sich an ALLE Eltern<br />
36
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
SAFE-Spezialkurse (1)<br />
• SAFE nach <strong>der</strong> Geburt<br />
• Fremdbetreuung/Krippe<br />
• Eltern mit Mehrfachbelastungen<br />
• Pflege- /Adoptiveltern<br />
• Eltern von frühgeborenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
• Psychisch kranke Eltern<br />
• Drogenabhängige Eltern (Substitution)<br />
SAFE-Spezialkurse (2)<br />
•Kiga<br />
• Schule<br />
• Jugendliche/<strong>Jugendhilfe</strong><br />
• Mutter-K<strong>in</strong>d-Heim<br />
37
Bedeutung <strong>der</strong> sicheren B<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Entwicklung für das<br />
Aufwachsen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
B.A.S.E.<br />
®<br />
Babywatch<strong>in</strong>g<br />
Baby-Beobachtung<br />
im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Schule<br />
Vorbeugung von aggressiven <strong>und</strong><br />
ängstlichen Verhaltensstörungen<br />
www.base-babywatch<strong>in</strong>g.de<br />
Zusammenfassung<br />
• E<strong>in</strong>e sichere B<strong>in</strong>dung ist e<strong>in</strong> gutes F<strong>und</strong>ament für<br />
die Entwicklung <strong>der</strong> Persönlichkeit<br />
• E<strong>in</strong>e sichere B<strong>in</strong>dung ist die Voraussetzung für<br />
gute Bildung<br />
• För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>er sicheren<br />
B<strong>in</strong>dung durch<br />
Unterstützung <strong>der</strong> Eltern <strong>in</strong> SAFE-Gruppen<br />
• Prävention von Verhaltensstörungen durch<br />
BASE-Babywatch<strong>in</strong>g.<br />
38
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Dr. Ulrich Bürger<br />
„Kommunalpolitik im kritischen Jahrzehnt“<br />
Bayern im demografischen Wandel <strong>und</strong> Auswirkungen<br />
auf die Kommunale K<strong>in</strong><strong>der</strong>- Jugend- <strong>und</strong> Familienpolitik<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung<br />
<strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Kontakt zum Referenten: ulrich.buerger@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Dr. Ulrich Bürger erläutert das kritische Jahrzehnt für die Kommunalpolitik.<br />
39
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Dr. Ulrich Bürger<br />
„Kommunalpolitik im kritischen Jahrzehnt“<br />
Bayern im demografischen Wandel<br />
<strong>und</strong> Auswirkungen auf die Kommunale<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>- Jugend- <strong>und</strong> Familienpolitik<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
„Kommunalpolitik im kritischen Jahrzehnt“<br />
Bayern im demografischen Wandel <strong>und</strong> Auswirkungen<br />
auf die Kommunale K<strong>in</strong><strong>der</strong>- Jugend- <strong>und</strong> Familienpolitik<br />
Thematische Aspekte<br />
1. Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns aus dem Blickw<strong>in</strong>kel<br />
<strong>der</strong> Handlungsbedarfe für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
2. Die erwartete Entwicklung <strong>der</strong> Alterspopulation <strong>der</strong> 0- bis 18-Jährigen <strong>in</strong><br />
Bayern bis zum Jahr 2025 <strong>und</strong> regionale Disparitäten im Vergleich <strong>der</strong><br />
Landkreise <strong>in</strong> Bayern<br />
3. Abschließende Thesen zum strategischen Umgang mit dem Thema<br />
demografischer Wandel <strong>in</strong> jugendhilfe- <strong>und</strong> kommunalpolitischer<br />
Perspektive<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
40
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
„Kommunalpolitik im kritischen Jahrzehnt“<br />
Bayern im demografischen Wandel <strong>und</strong> Auswirkungen<br />
auf die Kommunale K<strong>in</strong><strong>der</strong>- Jugend- <strong>und</strong> Familienpolitik<br />
1. Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig<br />
erwarteten Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau<br />
Bayerns aus dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> Handlungsbedarfe<br />
für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
Datenquelle hier: Eigene Berechnungen auf Basis <strong>der</strong> 12. koord<strong>in</strong>ierten<br />
Bevölkerungsvorausrechnung <strong>des</strong> Statistische n B<strong>und</strong>esamts von 2009<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns aus dem Blickw<strong>in</strong>kel<br />
<strong>der</strong> Handlungsbedarfe für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
-> Bayern auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e alternde Gesellschaft<br />
12,52 Mio. 11,62 Mio.<br />
- 7 %<br />
100%<br />
90%<br />
19,5%<br />
21,8%<br />
26,8%<br />
30,1%<br />
31,3%<br />
32,7%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
61,1%<br />
60,8%<br />
56,0%<br />
53,3%<br />
53,1%<br />
51,6%<br />
65- u älter<br />
20- u 65<br />
unter 20<br />
30%<br />
20%<br />
19,4%<br />
10%<br />
17,4%<br />
17,2%<br />
16,6%<br />
15,6%<br />
15,7%<br />
- 25 %<br />
0%<br />
2,42 Mio.<br />
1,82 Mio.<br />
2008 2020 2030 2040 2050 2060<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
41
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns aus dem Blickw<strong>in</strong>kel<br />
<strong>der</strong> Handlungsbedarfe für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
-> Bayern auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e alternde Gesellschaft<br />
Folgerungen aus dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
‣Angesichts dieser Entwicklungsdynamik werden K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Familien<br />
mehr denn je auf die Unterstützung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung durch e<strong>in</strong>e breite<br />
bürgerschaftliche <strong>und</strong> (kommunal-) politische Lobby angewiesen se<strong>in</strong>,<br />
die ihren Belangen im Aushandeln mit den berechtigten Interessen<br />
an<strong>der</strong>er Gruppierungen nachdrücklich Geltung verschafft<br />
‣E<strong>in</strong>e solche Stärkung <strong>der</strong> Interessen von Familien <strong>und</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>n dient<br />
dabei allerd<strong>in</strong>gs nicht nur <strong>der</strong> Unterstützung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> jungen<br />
Menschen, son<strong>der</strong>n sie ist zugleich auch unabweisbare Konsequenz<br />
angesichts absehbarer volkswirtschaftlicher <strong>und</strong> sozialpolitischer<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen im demografischen Wandel<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns<br />
-> Volkswirtschaftliche <strong>und</strong> sozialpolitische Aspekte <strong>in</strong> ihren<br />
Konsequenzen für die Unterstützung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
100%<br />
90%<br />
19,5%<br />
21,8%<br />
26,8%<br />
30,1%<br />
31,3%<br />
32,7%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
61,1%<br />
60,8%<br />
56,0%<br />
53,3%<br />
53,1%<br />
51,6%<br />
65- u älter<br />
20- u 65<br />
unter 20<br />
30%<br />
20%<br />
19,4%<br />
10%<br />
17,4%<br />
17,2%<br />
16,6%<br />
15,6%<br />
15,7%<br />
0%<br />
2008 2020 2030 2040 2050 2060<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
42
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns<br />
-> Volkswirtschaftliche <strong>und</strong> sozialpolitische Aspekte <strong>in</strong> ihren<br />
Konsequenzen für die Unterstützung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Folgerungen aus dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
‣Es bedarf deutlicher Verbesserungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie <strong>und</strong><br />
Berufstätigkeit für Väter <strong>und</strong> Mütter, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Gestalt e<strong>in</strong>er<br />
bedarfsgerechten Ausgestaltung von Angeboten <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesbetreuung (wobei die Fragen <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie <strong>und</strong><br />
Beruf im Übrigen zunehmend auch Aspekte <strong>der</strong> Pflege älterer Angehöriger<br />
betreffen werden)<br />
‣Die Anstrengungen zu e<strong>in</strong>er frühzeitigen, umfassenden <strong>und</strong> breiten<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Bildung aller jungen Menschen müssen dr<strong>in</strong>gend<br />
<strong>in</strong>tensiviert werden, um morgen nicht - partiell - vor unzureichend<br />
gebildeten, <strong>in</strong>tegrierten <strong>und</strong> damit ohne reelle Chancen auf<br />
gesellschaftliche Teilhabe ausgestatteten jungen Menschen zu stehen<br />
‣Diese Herausfor<strong>der</strong>ung gew<strong>in</strong>nt zusätzlich dadurch an Bedeutung, dass<br />
zukünftig <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>, die <strong>in</strong> bildungsferneren Familien <strong>und</strong> die <strong>in</strong><br />
Familien mit e<strong>in</strong>em Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> aufwachsen, zunehmen wird<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns aus dem<br />
Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> Handlungsbedarfe für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
-> Neujustierungen im generationenübergreifenden Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
100%<br />
90%<br />
19,5%<br />
21,8%<br />
26,8%<br />
30,1%<br />
31,3%<br />
32,7%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
61,1%<br />
Auszug aus dem Koalitionsvertrag<br />
60,8%<br />
zwischen CDU, CSU <strong>und</strong> FDP Oktober 2009:<br />
56,0%<br />
53,3%<br />
„K<strong>in</strong><strong>der</strong>lärm darf ke<strong>in</strong>en Anlass für<br />
53,1%<br />
gerichtliche Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungen geben.<br />
Wir werden die Gesetzeslage<br />
entsprechend än<strong>der</strong>n.“<br />
51,6%<br />
65- u älter<br />
20- u 65<br />
unter 20<br />
30%<br />
20%<br />
19,4%<br />
10%<br />
17,4%<br />
17,2%<br />
16,6%<br />
15,6%<br />
15,7%<br />
0%<br />
2008 2020 2030 2040 2050 2060<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
43
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns aus dem<br />
Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> Handlungsbedarfe für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
-> Neujustierungen im generationenübergreifenden Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
Folgerungen aus dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
‣Um die anstehenden Herausfor<strong>der</strong>ungen gel<strong>in</strong>gend zu bewältigen, bedarf es<br />
auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Kommunen e<strong>in</strong>es frühzeitigen E<strong>in</strong>stiegs <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sam<br />
getragene Gestaltungsprozesse e<strong>in</strong>es zukunftsfähigen Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>s <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
sozialen Kultur, die generationenübergreifend denkt <strong>und</strong> handelt <strong>und</strong> die<br />
dar<strong>in</strong> angelegten Chancen nutzt<br />
‣In diesen Prozessen muss K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> Familienfre<strong>und</strong>lichkeit als<br />
Gr<strong>und</strong>haltung <strong>und</strong> als Leitl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ausgestaltung <strong>der</strong> sozialen<br />
Infrastruktur als e<strong>in</strong> zentraler Gr<strong>und</strong>satz gelten, <strong>der</strong> im Übrigen als Standort<strong>und</strong><br />
Zukunftsfaktor auch ganz entscheidend die Entwicklungsperspektiven<br />
<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Städte <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den – im Ergebnis aber auch die <strong>des</strong><br />
jeweiligen Stadt- bzw. Landkreises – mit bee<strong>in</strong>flussen wird<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Zur Dr<strong>in</strong>glichkeit <strong>der</strong> Handlungserfor<strong>der</strong>nisse für K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
Familien im demografischen Wandel (VQ = Versorgungsquotient)<br />
Der Zeitraum bis 2020 als das „Kritische Jahrzehnt“ noch e<strong>in</strong>maliger Chancen<br />
zukunftssichern<strong>der</strong> Investitionen <strong>in</strong> die nachwachsende Generation<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
19,5%<br />
VQ<br />
64<br />
61,1%<br />
21,8%<br />
VQ<br />
65<br />
60,8%<br />
26,8%<br />
VQ<br />
79<br />
56,0%<br />
30,1%<br />
VQ<br />
87<br />
53,3%<br />
31,3%<br />
VQ<br />
88<br />
53,1%<br />
32,7%<br />
VQ<br />
94<br />
51,6%<br />
65- u älter<br />
20- u 65<br />
unter 20<br />
20%<br />
19,4%<br />
10%<br />
17,4%<br />
17,2%<br />
16,6%<br />
15,6%<br />
15,7%<br />
0%<br />
2008 2020 2030 2040 2050 2060<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
44
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Gr<strong>und</strong>legende Betrachtungen zu den langfristig erwarteten<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Bevölkerungsaufbau Bayerns aus dem<br />
Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> Handlungsbedarfe für junge Menschen <strong>und</strong> Familien<br />
Letztlich liegt e<strong>in</strong>e Qu<strong>in</strong>tessenz <strong>der</strong> Analysen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Paradox:<br />
Entgegen e<strong>in</strong>er auf den ersten Blick plausiblen Annahme erfor<strong>der</strong>t <strong>der</strong><br />
demografische Wandel <strong>und</strong> <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>ene Rückgang <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Zahl <strong>der</strong> jungen Menschen nicht weniger, son<strong>der</strong>n mehr<br />
Engagement <strong>und</strong> mehr Investitionen <strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Familien.<br />
Die Geschw<strong>in</strong>digkeit <strong>und</strong> die Ernsthaftigkeit, mit <strong>der</strong> dieser<br />
Sachverhalt zur Kenntnis genommen <strong>und</strong> <strong>in</strong> konkretes Handeln<br />
umgesetzt wird, wird wesentlich über die Zukunftschancen <strong>der</strong><br />
Städte <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den, damit aber auch die <strong>des</strong> jeweiligen Kreises<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> entscheiden !<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
„Kommunalpolitik im kritischen Jahrzehnt“<br />
Bayern im demografischen Wandel <strong>und</strong> Auswirkungen<br />
auf die Kommunale K<strong>in</strong><strong>der</strong>- Jugend- <strong>und</strong> Familienpolitik<br />
2. Die erwartete Entwicklung <strong>der</strong> Alterspopulation <strong>der</strong><br />
0- bis 18-Jährigen <strong>in</strong> Bayern bis zum Jahr 2025 <strong>und</strong><br />
regionale Disparitäten im Vergleich <strong>der</strong> Landkreise<br />
<strong>in</strong> Bayern<br />
Datenquelle hier: Eigene Berechnungen auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Regionalisierten<br />
Bevölkerungsvorausrechnung für Bayern bis 2030 <strong>des</strong> Bayerischen<br />
Lan<strong>des</strong>amts für Statistik <strong>und</strong> Datenverarbeitung vom November 2011<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
45
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Die voraussichtliche Entwicklung <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 0- bis 18-<br />
Jährigen <strong>in</strong> Bayern bis zum Jahr 2025 unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> B<strong>in</strong>nenaltersstruktur<br />
2010 2015 2020 2025<br />
absolut Basis absolut % absolut % absolut %<br />
0- u 3 319.200 100 316.100 99 317.300 99 309.800 97<br />
3- u 6 325.200 100 318.700 98 319.600 98 316.900 97<br />
6- u 10 456.800 100 433.800 95 426.500 93 427.900 94<br />
10- u 16 768.600 100 698.600 91 661.500 86 650.000 85<br />
16- 18 411.800 100 394.600 96 354.300 86 339.700 83<br />
0- 18 2.281.600 100 2.161.800 95 2.079.200 91 2.044.300 90<br />
Dies s<strong>in</strong>d die<br />
Geburtenjahrgänge<br />
2007 bis 2009 !<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
M ünchen LK<br />
Ebersberg<br />
Fürstenfeldb.<br />
Dachau<br />
Berchtesg.L.<br />
Freis<strong>in</strong>g<br />
Neu-Ulm<br />
Erlangen-H.<br />
Erd<strong>in</strong>g<br />
Fürth LK<br />
Starnberg<br />
Bad Tölz-W.<br />
Eichstätt<br />
Pfaffenhofen<br />
Neuburg-S.<br />
M iesbach<br />
Regensburg LK<br />
Landsberg a.L.<br />
Kelheim<br />
Rosenheim LK<br />
Traunste<strong>in</strong><br />
Landshut<br />
Altött<strong>in</strong>g<br />
Würzburg LK<br />
Günzburg<br />
Deggendorf<br />
Aichach-F.<br />
Weilheim-S.<br />
Augsburg LK<br />
M ühldorf a.I.<br />
L<strong>in</strong>dau<br />
Ostallgäu<br />
D<strong>in</strong>golf<strong>in</strong>g-L.<br />
Bamberg LK<br />
Nürnberger L. LK<br />
Roth<br />
Aschaffenb. LK<br />
Forchheim<br />
Straub<strong>in</strong>g-B. LK<br />
Donau-Ries<br />
Oberallgäu<br />
Passau LK<br />
Rottal-Inn<br />
Unterallgäu<br />
Garmisch-P.<br />
Kitz<strong>in</strong>gen<br />
Schwandorf<br />
Ansbach LK<br />
Neumarkt/Opf.<br />
Amberg-S. LK<br />
Weißenburg-G.<br />
Neustadt/A.-BW<br />
Cham<br />
Dill<strong>in</strong>gen a.d.D.<br />
Bayreuth LK<br />
M iltenberg<br />
Schwe<strong>in</strong>furt LK<br />
Rhön-Grabfeld<br />
Haßberge<br />
Neuenstadt/W.<br />
Regen<br />
M a<strong>in</strong>-Spessart<br />
Freyung-G.<br />
Bad Kiss<strong>in</strong>gen<br />
Kulmbach<br />
Lichtenfels<br />
Coburg LK<br />
Tirschenreuth<br />
Wunsiedel/F.<br />
Kronach<br />
Hof LK<br />
-30,8<br />
Regionale Disparitäten<br />
im demografischen Wandel plus 8,3 %<br />
-29,1<br />
-22,8<br />
-23,0<br />
-23,1<br />
-23,6<br />
-23,9<br />
-24,1<br />
-24,3<br />
-24,5<br />
-24,7<br />
-25,1<br />
-25,6<br />
-26,2<br />
-26,8<br />
-27,0<br />
-27,4<br />
-12,1-12,3<br />
-12,6<br />
-12,7<br />
-13,1<br />
-13,9<br />
-14,0<br />
-14,4<br />
-14,5<br />
-14,9<br />
-15,3<br />
-15,6<br />
-16,1<br />
-16,2<br />
-16,4<br />
-17,0<br />
-17,0<br />
-17,2<br />
-17,3<br />
-17,5<br />
-17,6<br />
-17,6<br />
-17,9<br />
-18,1<br />
-18,3<br />
-18,3<br />
-19,4<br />
-19,4<br />
-19,6<br />
-19,7<br />
-19,9<br />
-20,4<br />
-20,6<br />
-20,6<br />
-20,7<br />
-20,8<br />
-21,1<br />
-21,3<br />
-21,4<br />
m<strong>in</strong>us 30,8 %<br />
-9,9<br />
-10,0<br />
-10,8<br />
-11,4<br />
-7,1<br />
-7,4<br />
-7,6<br />
-3,0<br />
-3,6<br />
-3,7<br />
-4,6<br />
-4,9<br />
-5,9 -5,0<br />
-35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0<br />
8,3<br />
Erwartete<br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Altersgruppe <strong>der</strong><br />
0- bis 18-Jährigen<br />
von 2010 bis 2025<br />
<strong>in</strong> den<br />
Landkreisen Bayerns<br />
<strong>in</strong> Prozent<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
46
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
M ünchen LK<br />
Ebersberg<br />
Starnberg<br />
Fürstenfeldb.<br />
Freis<strong>in</strong>g<br />
Dachau<br />
Erd<strong>in</strong>g<br />
Bad Tölz-W.<br />
Neu-Ulm<br />
Fürth LK<br />
M iesbach<br />
Erlangen-H.<br />
Berchtesg.L.<br />
Landsberg a.L.<br />
Landshut<br />
Kelheim<br />
Pfaffenhofen<br />
Eichstätt<br />
Neuburg-S.<br />
Rosenheim LK<br />
Regensburg LK<br />
Aichach-F.<br />
L<strong>in</strong>dau<br />
Traunste<strong>in</strong><br />
Günzburg<br />
Straub<strong>in</strong>g-B. LK<br />
M ühldorf a.I.<br />
Donau-Ries<br />
Altött<strong>in</strong>g<br />
Weilheim-S.<br />
Nürnberger L. LK<br />
Würzburg LK<br />
Deggendorf<br />
Garmisch-P.<br />
Oberallgäu<br />
Ostallgäu<br />
Augsburg LK<br />
Unterallgäu<br />
Aschaffenb. LK<br />
D<strong>in</strong>golf<strong>in</strong>g-L.<br />
Passau LK<br />
Bamberg LK<br />
Rottal-Inn<br />
Roth<br />
Amberg-S. LK<br />
Kulmbach<br />
Weißenburg-G.<br />
Neumarkt/Opf.<br />
Forchheim<br />
Kitz<strong>in</strong>gen<br />
M iltenberg<br />
Ansbach LK<br />
Cham<br />
Schwandorf<br />
Bayreuth LK<br />
Dill<strong>in</strong>gen a.d.D.<br />
Neustadt/A.-BW<br />
Regen<br />
Rhön-Grabfeld<br />
Freyung-G.<br />
Kronach<br />
Neuenstadt/W.<br />
Coburg LK<br />
Wunsiedel/F.<br />
Lichtenfels<br />
M a<strong>in</strong>-Spessart<br />
Schwe<strong>in</strong>furt LK<br />
Bad Kiss<strong>in</strong>gen<br />
Haßberge<br />
Hof LK<br />
Tirschenreuth<br />
-36,8<br />
-37,5<br />
-39,3 -38,2<br />
Regionale Disparitäten<br />
im demografischen Wandel<br />
-34,4<br />
-34,5<br />
-34,8<br />
-35,1<br />
-35,5<br />
-36,0<br />
-36,0<br />
-36,2<br />
-36,4<br />
-31,4<br />
-31,6<br />
-32,4<br />
-32,4<br />
-33,3<br />
-30,0<br />
-30,2<br />
-30,3<br />
-30,6<br />
-31,0<br />
-31,1<br />
-27,8<br />
-27,9<br />
-28,3<br />
-28,9<br />
-29,2<br />
-29,4<br />
-25,5<br />
-26,4<br />
-26,9<br />
-27,0<br />
-27,3<br />
-27,3<br />
-24,6<br />
-25,0<br />
-25,0<br />
-25,0<br />
-25,5<br />
-23,1<br />
-23,4<br />
-23,7<br />
-24,0<br />
m<strong>in</strong>us 39,3 %<br />
-22,2<br />
-22,9<br />
-21,2<br />
-21,3<br />
-21,4<br />
-21,7<br />
-20,6<br />
-20,7<br />
-18,5<br />
-19,0 -19,0<br />
-19,1<br />
-15,2<br />
-15,6<br />
-16,7<br />
-8,5<br />
-12,2 -10,9<br />
-12,7<br />
-12,8<br />
-12,9<br />
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
-7,3<br />
-2,3<br />
-2,4<br />
-3,1<br />
plus 16,3 %<br />
16,3<br />
Erwartete<br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Altersgruppe <strong>der</strong><br />
16- bis 18-Jährigen<br />
von 2010 bis 2025<br />
<strong>in</strong> den<br />
Landkreisen Bayerns<br />
<strong>in</strong> Prozent<br />
„Kommunalpolitik im kritischen Jahrzehnt“<br />
Bayern im demografischen Wandel <strong>und</strong> Auswirkungen<br />
auf die Kommunale K<strong>in</strong><strong>der</strong>- Jugend- <strong>und</strong> Familienpolitik<br />
3. Abschließende Thesen zum strategischen Umgang<br />
mit dem Thema demografischer Wandel <strong>in</strong><br />
jugendhilfe- <strong>und</strong> kommunalpolitischer Perspektive<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
47
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Abschließende Thesen zum strategischen Umgang<br />
mit dem Thema demografischer Wandel <strong>in</strong><br />
jugendhilfe- <strong>und</strong> kommunalpolitischer Perspektive<br />
These zur Ausgangslage:<br />
Die K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> hat die Bedeutung <strong>des</strong> demografischen<br />
Wandels unter fachplanerischen <strong>und</strong> fachpolitischen Aspekten<br />
<strong>und</strong> damit auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en strategischen Dimensionen für die<br />
Vertretung <strong>der</strong> Belange <strong>der</strong> junger Menschen <strong>und</strong> ihrer Familien<br />
bisher weitgehend unterschätzt<br />
Folgerungen:<br />
Es bedarf e<strong>in</strong>es offensiven Aufgreifens <strong>der</strong> Thematik auf <strong>der</strong><br />
Ebene <strong>der</strong> Städte <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den, <strong>der</strong> Kreise <strong>und</strong> <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> <strong>in</strong><br />
Gestalt regionalspezifischer Datenaufbereitungen <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>legen<strong>der</strong> Analysen, im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Thesen vom „Paradox <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> im demografischen Wandel“ <strong>und</strong> <strong>des</strong><br />
„Kritischen Jahrzehnts“ sowie darauf bezogener Folgerungen für<br />
e<strong>in</strong>e tatsächlich zukunftsträchtige Politik für K<strong>in</strong><strong>der</strong>, Jugendliche<br />
<strong>und</strong> Familien<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Abschließende Thesen zum strategischen Umgang<br />
mit dem Thema demografischer Wandel <strong>in</strong><br />
jugendhilfe- <strong>und</strong> kommunalpolitischer Perspektive<br />
Folgerungen:<br />
Der demografische Wandel muss als e<strong>in</strong> unverzichtbares<br />
Querschnittsthema kommunaler Entwicklungsperspektiven<br />
begriffen werden – gerade auch aus dem Blickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong>planung unter Berücksichtigung <strong>der</strong> jeweils<br />
spezifischen örtlichen Ausgangslagen <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ener<br />
Handlungserfor<strong>der</strong>nisse<br />
Insbeson<strong>der</strong>e im ländlicheren Raum/<strong>in</strong> Anhängigkeit von<br />
regionalen Dynamiken dürften Geme<strong>in</strong>degrenzen übergreifende<br />
Kooperationen erheblich an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen<br />
-> tendenzieller Bedeutungszuwachs <strong>der</strong> Ebene Landkreis<br />
gegenüber/mit den kreisangehörigen Städten <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den<br />
Ausrichtung <strong>und</strong> Weiterentwicklung <strong>der</strong> Praxisfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong><strong>und</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> im Blick auf die spezifischen Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>und</strong> Handlungsbedarfe im demografischen Wandel mit dem Ziel<br />
e<strong>in</strong>es demografie-orientierten Ressourcene<strong>in</strong>satzes<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
48
Das kritische Jahrzehnt <strong>der</strong> Kommunalpolitik:<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung zur För<strong>der</strong>ung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Familien<br />
Investitionen <strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
Investitionen <strong>in</strong> die Zukunft !<br />
-> Programmatische Konsequenz zur<br />
Bewältigung <strong>des</strong> demografischen Wandels<br />
Landtag von Baden-Württemberg:<br />
Bericht <strong>und</strong> Empfehlungen <strong>der</strong> Enquetekommission „Demografischer Wandel –<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen an die Lan<strong>des</strong>politik“ (2005):<br />
„Gleichwohl führt ke<strong>in</strong> Weg an <strong>der</strong> elementaren rationalen Erkenntnis vorbei,<br />
dass die mittel- <strong>und</strong> langfristige Zukunftsfähigkeit e<strong>in</strong>er Gesellschaft nur mittels<br />
e<strong>in</strong>er ausreichenden Zahl von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n gesichert werden kann. … In diesem<br />
Zusammenhang ist es pr<strong>in</strong>zipiell legitim <strong>und</strong> angesichts <strong>der</strong> erheblichen<br />
Tragweite <strong>der</strong> demografischen Herausfor<strong>der</strong>ungen geboten, <strong>der</strong><br />
gesamtgesellschaftlichen Bedeutung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n im Steuer- <strong>und</strong><br />
Transfersystem konsequent <strong>und</strong> durchgängig Rechnung zu tragen, auch wenn<br />
dies zu <strong>in</strong>nergesellschaftlichen Umverteilungsprozessen führt. K<strong>in</strong><strong>der</strong> stellen<br />
nämlich für alle Menschen – unabhängig davon, ob sie selbst K<strong>in</strong><strong>der</strong> haben<br />
o<strong>der</strong> nicht – e<strong>in</strong>e zentrale Zukunfts<strong>in</strong>vestition dar.“<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Die gr<strong>und</strong>sätzlichen Ausführungen basieren <strong>in</strong> weiten Teilen auf dem Bericht<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> im demografischen Wandel –<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Perspektiven <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>und</strong><br />
Unterstützung von jungen Menschen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Familien <strong>in</strong> Baden-<br />
Württemberg – Berichterstattung 2010<br />
Dieser Bericht sowie e<strong>in</strong>e dazu verfasste Kurzbroschüre mit <strong>der</strong><br />
Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse stehen als kostenloser<br />
Download unter<br />
www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demografischer-wandel.html<br />
zur Verfügung.<br />
_______________________________________<br />
Kontakt zum Referenten: ulrich.buerger@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Dr. Ulrich Bürger/Folien zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
49
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
Dr. Jürgen Gros<br />
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht<br />
geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre<br />
E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
Dr. Jürgen Gros zum Vortrag bei <strong>der</strong> 44. Landrätetagung<br />
<strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags am 18.10. 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld<br />
Dr. Jürgen Gros erklärt den Genossenschaftsgedanken im <strong>Sozial</strong>bereich.<br />
50
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong> nicht schafft, geht<br />
geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre<br />
E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich.<br />
Dr. Jürgen Gros<br />
Schlüsselfeld, 18.10.2012<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
– passt das zusammen?<br />
2. Mit <strong>der</strong> Zeit gehen <strong>und</strong> Bereitschaft zur Selbsthilfe beför<strong>der</strong>n!<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
4. Und er hat noch immer recht!<br />
5. Wer steht Interessenten zur Seite?<br />
51
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
- passt das zusammen?<br />
sozial = das Geme<strong>in</strong>wohl betreffend, <strong>der</strong><br />
Allgeme<strong>in</strong>heit nutzend, die Gesellschaft<br />
betreffend.<br />
Genossenschaft =<br />
Gesellschaften von nicht geschlossener<br />
Mitglie<strong>der</strong>zahl, <strong>der</strong>en Zweck darauf gerichtet<br />
ist, den Erwerb o<strong>der</strong> die Wirtschaft ihrer<br />
Mitglie<strong>der</strong> o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en soziale o<strong>der</strong> kulturelle<br />
Belange durch geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Geschäftsbetrieb zu för<strong>der</strong>n.<br />
(Genossenschaftsgesetz § 1,1)<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
– passt das zusammen?<br />
„Genossenschaften <strong>und</strong> Kooperativen als<br />
zukunftsfähige Unternehmen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Bürgergesellschaft“<br />
(Zukunftsrat <strong>der</strong> Bayerischen Staatsregierung 2010)<br />
52
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
- passt das zusammen?<br />
Drei Typen von <strong>Sozial</strong>genossenschaften:<br />
Kooperation von Betroffenen auf <strong>der</strong> Basis von Selbsthilfe<br />
Solidarische Kooperation auf <strong>der</strong> Basis ehrenamtlichen<br />
Engagements<br />
Kooperation zur Erbr<strong>in</strong>gung von Leistungen, die (gesellschaftlich)<br />
gewünscht, aber vom Markt nicht (adäquat) zur Verfügung gestellt<br />
werden<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
– passt das zusammen?<br />
„Genossenschaften s<strong>in</strong>d immer das, was menschliche<br />
E<strong>in</strong>sicht, geistige Kraft <strong>und</strong> persönlicher<br />
Mut aus ihnen macht.“<br />
(Friedrich-Wilhelm Raiffeisen)<br />
53
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
– passt das zusammen?<br />
In Bayern ist bereits e<strong>in</strong>iges entstanden …<br />
…<br />
26 Genossenschaften im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Pflegebereich<br />
- Palliativbereich<br />
- Seniorenwohnen<br />
- Krankenhausnetzwerke<br />
- Bereitschaftsdienste von Ärzten<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
– passt das zusammen?<br />
…<br />
24 Genossenschaften r<strong>und</strong> um Erhalt <strong>und</strong> Schaffung<br />
sozialer/gesellschaftlicher Infrastruktur<br />
- K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung<br />
- <strong>Jugendhilfe</strong><br />
- altersgerechtes Wohnen<br />
- Nahraumversorgung<br />
54
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
1. Genossenschaften <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
– passt das zusammen?<br />
2. Mit <strong>der</strong> Zeit gehen <strong>und</strong> Bereitschaft zur<br />
Selbsthilfe beför<strong>der</strong>n!<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung <strong>des</strong> demografischen Wandels kommt <strong>in</strong> den<br />
Köpfen <strong>der</strong> Bürger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Bürger allmählich an.<br />
Persönliche Betroffenheit wird zunehmend erkannt. Es steigt die<br />
Bereitschaft<br />
- sich selbst im Verb<strong>und</strong> mit an<strong>der</strong>en zu helfen,<br />
- Verantwortung für das soziale Umfeld zu übernehmen,<br />
- abseits traditierter Organisationswege Neues <strong>in</strong><br />
selbstverwalteter Unabhängigkeit zu etablieren.<br />
Menschen fangen an zu verstehen: Staat wird <strong>und</strong> kann nicht<br />
alles regeln <strong>und</strong> lösen.<br />
55
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
2. Mit <strong>der</strong> Zeit gehen <strong>und</strong> Bereitschaft zur<br />
Selbsthilfe beför<strong>der</strong>n!<br />
Gründungsmotive von Genossenschaften spiegeln diesen<br />
gesellschaftlichen Bef<strong>und</strong>:<br />
privatwirtschaftliche Ausrichtung <strong>und</strong> tragfähige<br />
Geschäftsmodelle<br />
hohe Solidarisierung mit dem jeweiligen Projekt <strong>und</strong><br />
hohe emotionale B<strong>in</strong>dung<br />
lokale bzw. regionale Verortung<br />
Erbr<strong>in</strong>gung von Leistungen, die unmittelbar ankommen<br />
2. Mit <strong>der</strong> Zeit gehen <strong>und</strong> Bereitschaft zur<br />
Selbsthilfe beför<strong>der</strong>n!<br />
Reflex auf Unzufriedenheit mit e<strong>in</strong>er gesellschaftlichen<br />
Entwicklung<br />
Besetzung von organisationsfreien Räumen o<strong>der</strong> solchen mit<br />
(zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t gefühltem) Gesellschaftsversagen<br />
perspektivegebend <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zeitalter allgeme<strong>in</strong>er<br />
Unzufriedenheit<br />
56
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
2. Mit <strong>der</strong> Zeit gehen <strong>und</strong> Bereitschaft zur<br />
Selbsthilfe beför<strong>der</strong>n!<br />
Praxiserkenntnis:<br />
Netzwerkbildung erfolgt auf drei Ebenen. Zwischen<br />
- Privatpersonen<br />
- Privatpersonen <strong>und</strong> etablierten Organisationen<br />
- Privatpersonen <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> etablierten Organisationen<br />
<strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Institutionen <strong>der</strong> öffentlichen Hand/Kommunen<br />
2. Mit <strong>der</strong> Zeit gehen <strong>und</strong> Bereitschaft zur<br />
Selbsthilfe beför<strong>der</strong>n!<br />
Praxiserkenntnis:<br />
Genossenschaften s<strong>in</strong>d die (unternehmerische) Organisation<br />
gleichgerichteter Interessen. Diese verb<strong>in</strong>den. Sie s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> ganz<br />
wesentlicher Kitt. Erfolg durch mitglie<strong>der</strong>orientierte Kräftebündelung<br />
wird möglich <strong>und</strong> hilft, das zu realisieren, was <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelne Akteur<br />
für sich im gleichen Maße nicht zu erreichen vermag.<br />
57
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
Handlungsfel<strong>der</strong><br />
Attraktivität<br />
Familienpolitik<br />
F<strong>in</strong>anzen<br />
Infrastrukturen<br />
Kommunen<br />
Ärztliche<br />
Versorgung<br />
Bürgerschaftliches<br />
Engagement<br />
Pflege<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
Genossenschaftliches Netzwerk<br />
Akteure im<br />
<strong>Sozial</strong>bereich<br />
weitere<br />
Akteure<br />
<strong>Sozial</strong>e<br />
Netzwerk eG<br />
Kommunen<br />
Betroffene<br />
Generationszusammenhalt<br />
Seniorenpolitik<br />
Jugendpolitik<br />
<strong>Sozial</strong>verbände<br />
Bürger<br />
58
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
Demografischer Wandel ist gestaltbar. Genossenschaften können<br />
dabei helfen.<br />
Netzwerkbildung nach Möglichkeit frühzeitig beför<strong>der</strong>n.<br />
Nicht nur Nahraumverwalter se<strong>in</strong>, son<strong>der</strong>n sich als<br />
Lebensraummanager begreifen.<br />
Genossenschaften besitzen Intergenerationenfähigkeit <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d<br />
langlebig.<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
Praxiserkenntnis:<br />
Die Genossenschaft ist im Vergleich zu an<strong>der</strong>en<br />
Rechtsformen ke<strong>in</strong>eswegs die zw<strong>in</strong>gend bessere.<br />
Sie kann gleichwohl bei spezifischen Zielsetzungen<br />
<strong>und</strong> speziellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen die durchaus<br />
klügste Unternehmensvariante se<strong>in</strong>.<br />
59
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
Vorteile zugunsten e<strong>in</strong>er Genossenschaft s<strong>in</strong>d u. a. gegeben,<br />
- wenn es um den Aufbau von Kooperationsnetzwerken<br />
geht, <strong>in</strong> denen je<strong>des</strong> Mitglied e<strong>in</strong>e Stimme hat,<br />
- e<strong>in</strong>e regionale Kräftebündelung <strong>und</strong> Ausrichtung <strong>der</strong><br />
Zusammenarbeit im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> steht,<br />
- e<strong>in</strong>e wirtschaftliche Beziehung zwischen öffentlicher<br />
Hand <strong>und</strong> privaten Wirtschaftsakteuren beabsichtigt ist,<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
- das öffentliche Interesse an <strong>der</strong> Übernahme o<strong>der</strong><br />
Fortführung e<strong>in</strong>er Leistung besteht, die staatsseitig nicht<br />
(mehr) erbracht werden kann,<br />
- ke<strong>in</strong> festes Stammkapital gewünscht respektive<br />
gefor<strong>der</strong>t ist o<strong>der</strong> Sache<strong>in</strong>lagen angestrebt werden,<br />
- kapitalgetriebene Interessen von Investoren nicht<br />
gewünscht s<strong>in</strong>d.<br />
60
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
3. Mit Genossenschaften Vorsorge treffen!<br />
Praxiserkenntnis:<br />
Die Genossenschaft ist von ihren Gr<strong>und</strong>strukturen her e<strong>in</strong><br />
Unternehmen <strong>des</strong> Maßhaltens – was Unternehmensausrichtung,<br />
regionales Geschäftsfeld <strong>und</strong> Gew<strong>in</strong>norientierung angeht.<br />
4. Und er hat noch immer recht!<br />
„Alle<strong>in</strong> darüber kann ke<strong>in</strong> Zweifel se<strong>in</strong>, dass die soziale Frage<br />
niemals von e<strong>in</strong>zelnen, spekulierenden Köpfen auf dem<br />
Studienzimmer durch die Erf<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>er neuen Theorie gelöst<br />
werden wird. Vielmehr gehört die geme<strong>in</strong>same Arbeit ganzer<br />
Generationen, das praktische Erfassen von allen Seiten dazu,<br />
die Lösung allmählich anzubahnen.“<br />
(Hermann Schule-Delitzsch)<br />
61
Was e<strong>in</strong>er alle<strong>in</strong>e nicht schafft, geht geme<strong>in</strong>sam besser - auch im <strong>Sozial</strong>en?<br />
Die Genossenschaftsidee <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten im <strong>Sozial</strong>bereich<br />
5. Wer steht Interessenten zur Seite?<br />
GVB-Ansprechpartner <strong>in</strong> den Regionen:<br />
Mittelfranken<br />
Friedrich Blaser, Roland Streng, Theaterstraße 26, 97070 Würzburg<br />
Tel.: 0931 50113 E-Mail: rd.franken@gv-bayern.de<br />
Nie<strong>der</strong>bayern<br />
Gerhard Hornauer, Dreikronengasse 2, 93047 Regensburg<br />
Tel.: 0941 54082 E-Mail: ghornauer@gv-bayern.de<br />
Oberfranken<br />
Friedrich Blaser, Roland Streng, Theaterstraße 26, 97070 Würzburg<br />
Tel.: 0931 50113 E-Mail: rd.franken@gv-bayern.de<br />
GVB-Genossenschaftsgründung:<br />
Bayern<br />
Wolfdieter von Trotha<br />
Genossenschaftsverband Bayern e. V.<br />
Türkenstraße 22-24, 80333 München<br />
Tel.: 089 2868-3571<br />
Fax: 089 2868-3575<br />
E-Mail: gruendungsberatung@gv-bayern.de<br />
www.gv-bayern.de -> Genossenschaften gründen<br />
Oberbayern<br />
Anton Kandler, Türkenstraße 22-24, 80333 München<br />
Tel: 089/2868-3890 E-Mail: akandler@gv-bayern.de<br />
Oberpfalz<br />
Gerhard Hornauer, Dreikronengasse 2, 93047 Regensburg<br />
Tel.: 0941 54082 E-Mail: ghornauer@gv-bayern.de<br />
Schwaben<br />
Peter Ferner, Am H<strong>in</strong>teren Perlachberg 1 c, 86150 Augsburg<br />
Tel.: 0821 35005 E-Mail: pferner@gv-bayern.de<br />
Unterfranken<br />
Friedrich Blaser, Roland Streng, Theaterstraße 26, 97070 Würzburg<br />
Tel.: 0931 50113 E-Mail: rd.franken@gv-bayern.de<br />
Dr. Jürgen Gros<br />
Bereichsdirektor<br />
Vorstandsstab <strong>und</strong> Kommunikation<br />
Genossenschaftsverband Bayern e.V.<br />
Türkenstraße 22-24, 80333 München<br />
Tel.: 089 / 2868 - 3402<br />
Fax: 089 / 2868 - 3405<br />
E-Mail: jgros@gv-bayern.de<br />
www.gv-bayern.de<br />
62
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Bericht aus <strong>der</strong> Arbeitsgruppe 1:<br />
Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Die Arbeitsgruppe 1 befasste sich mit <strong>der</strong> <strong>in</strong>tegrierten <strong>Sozial</strong>planung <strong>in</strong> Landkreisen sowie <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Organisation <strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>dienstes. Die Landkreise Coburg – vertreten durch Landrat Michael Busch <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Leiter<strong>in</strong> <strong>der</strong> Stabsstelle für Landkreisentwicklung, Mart<strong>in</strong>a Berger – <strong>und</strong> Bad Tölz-Wolfratshausen – vertreten durch<br />
Landrat Josef Nie<strong>der</strong>maier, Abteilungsleiter Daniel Waidelich sowie Jugendamtsleiter Ulrich Re<strong>in</strong>er – berichteten von<br />
ihren jeweiligen Erfahrungen bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> weitreichenden Konzeptionen.<br />
Der Landkreis Coburg hatte sich bereits im Jahr 2000 aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> überproportionalen Steigerungen <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>ausgaben<br />
auf den Weg gemacht, die Leistungsgewährung im Allgeme<strong>in</strong>en <strong>Sozial</strong>dienst stärker vor Ort zu bündeln<br />
<strong>und</strong> damit näher an die Leistungsberechtigten zu br<strong>in</strong>gen. Nach <strong>der</strong> planerischen Abgrenzung von acht <strong>Sozial</strong>räumen<br />
konnten mit <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den acht <strong>Sozial</strong>raumbüros errichtet werden, <strong>in</strong> denen<br />
die <strong>Sozial</strong>arbeiter zuständigkeitsübergreifend, aber rückgeb<strong>und</strong>en an das Landratsamt vor Ort tätig s<strong>in</strong>d. Im Ergebnis<br />
konnten die Leistungen vom stationären zum ambulanten Angebot umgesteuert, ehrenamtliche Unterstützung aktiviert<br />
<strong>und</strong> kreative Lösungen vor Ort entwickelt werden. Die <strong>Sozial</strong>raumorientierung hat sich im Landkreis Coburg<br />
vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>der</strong> demografischen Entwicklung zur umfassenden Handlungsmaxime im <strong>Sozial</strong>bereich entwickelt.<br />
Die Steigerungen <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>ausgaben waren auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen <strong>der</strong> Auslöser, die Planungsgr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>und</strong> die Leistungsgewährung im <strong>Sozial</strong>bereich anzupassen. Mit <strong>der</strong> <strong>in</strong>tegrierten <strong>Sozial</strong>planung wird<br />
<strong>der</strong> Versuch unternommen, die verschiedenen Fachplanungen auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Landkreise ergänzt um e<strong>in</strong>e demografische<br />
Komponente zu bündeln, um Synergien zu nutzen <strong>und</strong> Schnittstellen aufzudecken. Der Landkreis hat dazu e<strong>in</strong><br />
Modellprojekt auf den Weg gebracht, das <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er umfassenden Konzeption für den Landkreisbereich Pilotcharakter<br />
hat. Die <strong>Sozial</strong>raumorientierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> hatte zum Ziel, <strong>in</strong> vier abgrenzbaren <strong>Sozial</strong>räumen präventive<br />
Netzwerke zu etablieren, die im Wesentlichen von den Trägern <strong>der</strong> freien Wohlfahrtspflege getragen werden. Statt<br />
Leiter von <strong>Sozial</strong>raumbüros wurden Regionalleiter e<strong>in</strong>gerichtet, die geme<strong>in</strong>sam mit den Vere<strong>in</strong>barungspartnern <strong>der</strong><br />
freien Wohlfahrtspflege die Bewirtschaftung e<strong>in</strong>es regionalen Budgets verantworten. Mit <strong>der</strong> Verlagerung <strong>der</strong> Budgetverantwortung<br />
<strong>in</strong> die <strong>Sozial</strong>räume konnte neben e<strong>in</strong>er erhöhten Kostentransparenz <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e e<strong>in</strong>e Umsteuerung <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Leistungsgewährung ausgelöst werden.<br />
Die an <strong>der</strong> Arbeitsgruppe teilnehmenden Landräte nahmen die Präsentation <strong>der</strong> beiden Praxisbeispiele zustimmend<br />
zu Kenntnis. Angesichts <strong>der</strong> demografischen Entwicklung müssten die planerischen <strong>und</strong> organisatorischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>in</strong> den Landkreisen weiterentwickelt werden. Dabei komme es zum e<strong>in</strong>en auf die Unterstützung seitens<br />
<strong>der</strong> kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den an; zum an<strong>der</strong>en müsse je<strong>der</strong> Landkreis <strong>in</strong> Abhängigkeit se<strong>in</strong>er örtlichen Strukturen<br />
se<strong>in</strong>en eigenen Weg f<strong>in</strong>den.<br />
Berichterstatter: Dr. Klaus Schulenburg<br />
63
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
nah am Menschen – nah am Umfeld<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
Lauter ><br />
Bad Rodach<br />
Mee<strong>der</strong><br />
Neustadt<br />
b. Coburg<br />
< Rodach<br />
Dörfles-<br />
Esbach<br />
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Struktur <strong>des</strong> Jugendamtes vor<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Jugendamtsleiter/<strong>in</strong><br />
Kommunale Jugendarbeit<br />
Erzieherischer K<strong>in</strong><strong>der</strong><strong>und</strong><br />
Jugendschutz<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>planung<br />
(2 VZ)<br />
Allgeme<strong>in</strong>er <strong>Sozial</strong>dienst<br />
Büro im Landratsamt, Lkr. <strong>in</strong><br />
Bezirke e<strong>in</strong>geteilt<br />
(5 VZ)<br />
Pflegek<strong>in</strong><strong>der</strong>wesen <strong>und</strong><br />
Adoptionsvermittlung<br />
(1 VZ besetzt mit 2x 0,5)<br />
Wirtschaftliche<br />
<strong>Jugendhilfe</strong><br />
- Beistandschaft, Pflegschaft,<br />
Vorm<strong>und</strong>schaft<br />
- Wirtschaftliche Hilfen<br />
- K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen<br />
- Unterhaltsvorschuss (UVG)<br />
- Buchhaltung<br />
- Betreuungen<br />
(8 VZ)<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
2000<br />
Dramatische Kostensteigerungen <strong>in</strong> den Vorjahren<br />
Juli 2000: Haushalt <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> aufgebraucht<br />
Politik artikuliert, quer durch alle Fraktionen, dr<strong>in</strong>genden<br />
Handlungsbedarf<br />
Schaffung e<strong>in</strong>er <strong>Sozial</strong>planungsstelle (ab Okt.2000)<br />
Sparkommission aus Fraktionen <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>planung<br />
Politischer Auftrag an die <strong>Sozial</strong>planung zur Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Oktober 2000: Entwicklung <strong>des</strong> Konzeptes zur<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Oktober 2000: Beschluss <strong>des</strong> JHA das Konzept<br />
umzusetzen – e<strong>in</strong>stimmig<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
65
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Ausgangslage <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> soll e<strong>in</strong>en breitgefächerten Katalog von<br />
Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellen, gleichzeitig aber<br />
dazu beitragen die Ausgabenseite <strong>der</strong> kommunalen Haushalte nicht<br />
überzustrapazieren<br />
<strong>Jugendhilfe</strong> erreicht die Menschen <strong>und</strong> ihre Probleme zum Teil gar<br />
nicht, zum Teil eher zufällig <strong>und</strong> verspätet<br />
Der angebotene Hilfekatalog <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> ist starr <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Struktur <strong>und</strong> relativ festgelegt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Ausprägungsformen<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>karrieren s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel durch e<strong>in</strong>e Vielzahl von<br />
Beziehungsabbrüchen durch den Durchlauf verschiedener<br />
Hilfeformen gekennzeichnet – die erreichten / erreichbaren Erfolge<br />
halten sich <strong>in</strong> engen Grenzen<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung als Chance<br />
Lebensweltbezug<br />
Hilfen sollen möglichst im sozialen Umfeld angesiedelt se<strong>in</strong> <strong>und</strong> über<br />
flexible Konstruktionen Bezugspersonen im Wohnquartier anbieten<br />
können<br />
Flexibilisierung<br />
ständige Neuentwicklung passgenauer Hilfen, die den sich än<strong>der</strong>nden<br />
Lebens- <strong>und</strong> Bedarfslagen gerecht werden können<br />
Beziehung statt Maßnahme<br />
Entwicklung von Hilfen die situativ auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>er tragenden<br />
Beziehung unterstützend wirken, unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> vorhandenen<br />
Ressourcen<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
saubere Kalkulation <strong>der</strong> Hilfen <strong>und</strong> seriöse Darstellung <strong>der</strong> Qualität<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
66
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Kernpunkte <strong>der</strong> Neustrukturierung<br />
- <strong>in</strong>tern -<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
E<strong>in</strong>führung von Aufgabenbereichsleitungen (<strong>in</strong>cl.<br />
Controll<strong>in</strong>gfunktion)<br />
Gezielte Personalauswahl bei Neue<strong>in</strong>stellungen<br />
Vertrauensarbeitszeit<br />
Gezielte Fortbildung, Supervision <strong>und</strong> Praxisberatung <strong>in</strong><br />
Koppelung mit e<strong>in</strong>em unterstützenden <strong>und</strong> anleitenden<br />
Führungsstil<br />
Methodenmix aus <strong>in</strong>ternem Qualitätsmanagement <strong>und</strong> externer<br />
E<strong>in</strong>schätzung von Fachleuten <strong>und</strong> Leistungsempfängern<br />
Dienstort für die Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>dienstes werden die<br />
<strong>Sozial</strong>raumbüros <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
Bildung von <strong>Sozial</strong>räumen<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong>en personelle Ausstattung<br />
In je<strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>de Geme<strong>in</strong>dejugendpfleger /<br />
Geme<strong>in</strong>wesenarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
8 <strong>Sozial</strong>raumbüros <strong>in</strong> den Städten / Geme<strong>in</strong>den vor Ort<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
67
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientiertes Arbeiten<br />
am Beispiel<br />
Mitarbeiter<strong>in</strong> seit 1996 im Amt für Jugend <strong>und</strong> Familie<br />
tätig<br />
Hat den kompletten Prozess <strong>der</strong> Umstrukturierung<br />
miterlebt<br />
Ist im <strong>Sozial</strong>raum Seßlach/Itzgr<strong>und</strong>/Großheirath<br />
e<strong>in</strong>gesetzt <strong>und</strong> hat ihr Büro <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt Seßlach im<br />
Bürgerhaus, das auch die Jugendpflege <strong>und</strong> die<br />
Bücherei beherbergt<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
Kernpunkte <strong>der</strong> Neustrukturierung<br />
- <strong>Jugendhilfe</strong>ausschuss -<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>ausschuss<br />
Amt für Jugend <strong>und</strong> Familie<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung aller im Kreistag<br />
vertretenen Fraktionen<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>planung<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>der</strong><br />
Fachgruppenleitungen<br />
Starkes pol. Gewicht als<br />
Fachausschuss<br />
<br />
<br />
Regelmäßige Teilnahme <strong>des</strong><br />
Ausschussvorsitzenden bei<br />
Dienstbesprechungen<br />
Regelmäßige Zielabsprachen<br />
von Jugendamtsleitung <strong>und</strong><br />
Ausschussvorsitzendem<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
68
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Kernpunkte <strong>der</strong> Neustrukturierung<br />
- extern -<br />
<br />
<br />
<br />
Run<strong>der</strong> Tisch mit allen <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> tätigen freien Trägern<br />
Bek<strong>und</strong>ung <strong>des</strong> landkreisseitigen Interesses geme<strong>in</strong>sam mit den<br />
Trägern neue Wege zu gehen<br />
Auslaufen lassen bzw. Kündigung <strong>der</strong> bisherigen Verträge <strong>und</strong><br />
Vere<strong>in</strong>barungen mit freien Trägern<br />
Neuverhandlung mit den Leistungserbr<strong>in</strong>gern unter <strong>der</strong> Prämisse<br />
sozialraumorientierten Handelns / Abschluss von<br />
Leistungsvere<strong>in</strong>barungen<br />
Effekt:<br />
<br />
<br />
Viele Träger haben sich neu positioniert, e<strong>in</strong>ige s<strong>in</strong>d nicht mehr für<br />
uns tätig, neue Träger s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>zugekommen<br />
Neue Kreativität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung von Hilfeformen (z.B.<br />
Heilpädagogisch-therapeutische Ambulanz statt Heilpädagogische Tagesstätte)<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
Struktur <strong>des</strong> Jugendamtes nach<br />
Umstrukturierung<br />
Leiter/<strong>in</strong> <strong>des</strong> Amtes für<br />
Jugend <strong>und</strong> Familie<br />
Servicebüro<br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
Präventive <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
<strong>Sozial</strong>e Dienste<br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
wirtschaftliche <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Kommunale Jugendarbeit<br />
Jugendsozialarbeit<br />
Erzieherischer K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendschutz<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erziehung <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Familie<br />
(2 VZ)<br />
Allgeme<strong>in</strong>er <strong>Sozial</strong>dienst<br />
ausgelagert <strong>in</strong> die <strong>Sozial</strong>räume vor<br />
Ort<br />
(7,5 VZ = +2,5)<br />
Pflegek<strong>in</strong><strong>der</strong>wesen <strong>und</strong><br />
Adoptionsvermittlungsstelle<br />
(1 VZ besetzt mit 2x 0,5)<br />
Wirtschaftliche <strong>Jugendhilfe</strong> ab<br />
2002 umstrukturiert nach<br />
<strong>Sozial</strong>räumen<br />
(8 VZ)<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
69
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Was hat sich von 2000 bis 2012<br />
getan?<br />
Breiter politischer Konsens, dass dieses Herangehen das Richtige ist – auch wenn<br />
die <strong>Jugendhilfe</strong> nach wie vor hohe Kosten verursacht<br />
<strong>Sozial</strong>raumbüros fest etabliert <strong>und</strong> aus <strong>der</strong> örtlichen Struktur nicht mehr<br />
wegzudenken<br />
Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen alle mit Engagement an Bord – die S<strong>in</strong>nhaftigkeit wird seit langem<br />
nicht mehr <strong>in</strong> Frage gestellt, son<strong>der</strong>n erkannt <strong>und</strong> das Arbeiten <strong>in</strong> dieser Form<br />
geschätzt<br />
Neue Leistungsanbieter – auch viele „Privatpersonen“ die für uns tätig s<strong>in</strong>d; das Feld<br />
passt sich den Bedarfen <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> an<br />
Es werden beständig bedarfsgerechte Hilfeformen neu entwickelt – von <strong>der</strong> HPTA bis<br />
zur Familienkonferenz; ke<strong>in</strong>e „alten Zöpfe“ mehr<br />
Immense Qualitätssteigerung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Art <strong>und</strong> Weise <strong>der</strong> Hilfegewährung auch durch<br />
die E<strong>in</strong>führung von neuen Verfahrensstandards (bsp. <strong>Sozial</strong>raumteams, versch.<br />
Formen kollegialer Beratung)<br />
Kostenbewusstse<strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sb. im Bereich <strong>der</strong> stat. Hilfen hat sich klar<br />
erhöht<br />
Stagnation <strong>der</strong> stationären Hilfen auf nahezu gleichbleibendem Niveau seit 2000 (!)<br />
bei deutlichem Anstieg ambulanter Hilfen<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
Struktur <strong>des</strong> Jugendamtes 2012<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>planung<br />
/ Jugendschutz<br />
Leiter/<strong>in</strong> <strong>des</strong> Amtes für<br />
Jugend, Familie <strong>und</strong> Senioren<br />
Servicebüro<br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
Jugend/sozial/arbeit<br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
<strong>Sozial</strong>e Dienste<br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
wirtschaftliche <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Aufgabenbereichsleitung<br />
Senioren<br />
Kommunale<br />
Jugendarbeit<br />
(2 VZ)<br />
Jugendsozialarbeit an<br />
Schulen (JaS)<br />
(1,5 VZ an drei Schulen)<br />
Allgeme<strong>in</strong>er<br />
<strong>Sozial</strong>dienst<br />
ausgelagert <strong>in</strong> den<br />
<strong>Sozial</strong>räumen vor Ort<br />
(10,25 VZ = +2,75)<br />
Pflegek<strong>in</strong><strong>der</strong>fachdienst<br />
<strong>und</strong> Adoptionsvermittlungsstelle<br />
(1,5 VZ = +0,5)<br />
Koord<strong>in</strong>ieren<strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>schutz (KoKi)<br />
(1 VZ = +1)<br />
Wirtschaftliche<br />
<strong>Jugendhilfe</strong><br />
umstrukturiert nach<br />
<strong>Sozial</strong>räumen<br />
- Beistandschaft /<br />
Pflegschaft /<br />
Vorm<strong>und</strong>schaft (3 VZ)<br />
- Wirtschaftliche <strong>Jugendhilfe</strong><br />
(1,1 VZ)<br />
- K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen<br />
(1,5 VZ)<br />
- Unterhaltsvorschuss<br />
(UVG)<br />
(2,0 VZ)<br />
- Buchhaltung (0,75 VZ)<br />
(Gesamt 8,35 VZ = +0,35)<br />
Altenhilfeplanung /<br />
seniorenpolítisches<br />
Gesamtkonzept (1 VZ)<br />
Gesetzliche<br />
Betreuungen<br />
(1 VZ)<br />
FQA Fachstelle für<br />
Pflege- <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tene<strong>in</strong>richtungen<br />
(1VZ)<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
70
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Nachlese zur<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung ist ke<strong>in</strong> Sparmodell…<br />
…aber sie rechnet sich nachweislich!<br />
In <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels können wir es uns schlichtweg nicht leisten,<br />
Potenziale verkümmern zu lassen – je<strong>des</strong> K<strong>in</strong>d <strong>und</strong> je<strong>der</strong> Jugendliche ist wichtig –<br />
sowohl für se<strong>in</strong>e eigene Zukunft, aber auch für unser aller Zukunft. Die <strong>Jugendhilfe</strong><br />
kann hier Entscheiden<strong>des</strong> leisten.<br />
Bürgerschaftliches Engagement wird zur immer wichtigeren Ressource. Durch<br />
sozialraumorientiertes Arbeiten wird das vorhandene Engagement von Bürger<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Bürgern zur Geltung gebracht <strong>und</strong> gleichzeitig neues Engagement gehoben.<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung stärkt auch den Zusammenhalt <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Dörfern, da<br />
es auch darum geht füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zustehen <strong>und</strong> sich zu helfen.<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung ist im Landkreis Coburg zur übergreifenden<br />
Handlungsmaxime – weit über die <strong>Jugendhilfe</strong> h<strong>in</strong>aus - geworden. Sie f<strong>in</strong>det auch <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Altenhilfe <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitsprävention sowie <strong>in</strong> eigentlich allen Bereichen, die<br />
das Zusammenleben betreffen, E<strong>in</strong>gang.<br />
Zur Landrätetagung <strong>des</strong> Bay. Landkreistags am 17.Oktober 2012<br />
Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong><br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
im Landkreis<br />
Bad Tölz – Wolfratshausen<br />
44. Landrätetagung <strong>des</strong> Bayerischen Lankreistags 17./18. Oktober 2012 <strong>in</strong> Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg<br />
71
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Demographische Entwicklung<br />
Bevölkerung im<br />
Landkreis Bad<br />
Tölz-<br />
Wolfratshausen<br />
2030 im Vergleich<br />
zu Anfang 2010<br />
Alter / Geburtsjahr<br />
100/1910<br />
95/1915<br />
90/1920<br />
85/1925<br />
80/1930<br />
75/1935<br />
70/1940<br />
65/1945<br />
60/1950<br />
55/1955<br />
50/1960<br />
45/1965<br />
40/1970<br />
35/1975<br />
30/1980<br />
25/1985<br />
20/1990<br />
15/1995<br />
10/2000<br />
5/2005<br />
0/2010<br />
1.2501.000<br />
750 500 250<br />
0 250 500 750 1.0001.250<br />
Männer 2030 Frauen 2030<br />
Männer 2009 Frauen 2009<br />
Quelle: AfA/SAGS 2011<br />
Demographische Entwicklung<br />
Altersgruppen<br />
2009 2024<br />
Mit<br />
Wan<strong>der</strong>ung<br />
Verän<strong>der</strong>ung<br />
<strong>in</strong> %<br />
Ohne<br />
Wan<strong>der</strong>ung<br />
Verän<strong>der</strong>ung<br />
<strong>in</strong> %<br />
0-24 J. 31.705 28.597 -9,8 26.078 -17,7<br />
25-50 J. 42.063 36.154 -14,0 32.831 -21,9<br />
50-65 J. 22.021 30.448 +38,3 28.059 +28,7<br />
65-79 J. 17.812 19.875 +11,6 19.344 +8,6<br />
80 J. plus 5.484 10.375 +89,2 10.249 +86,9<br />
Insgesamt 119.085 125.449 +5,3 116.561<br />
-2,1<br />
Quelle: SAGS/AfA, 2011<br />
72
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Demografie<br />
im Verhältnis<br />
weniger<br />
E<strong>in</strong>nahmen<br />
mehr<br />
Hilfeempfänger<br />
= mehr<br />
Klienten<br />
pro Klient /<br />
K<strong>und</strong>e<br />
mehr Ausgaben<br />
komplexere<br />
Dienstleistungen<br />
höherer<br />
Arbeitsaufwand<br />
Unsere Ziele<br />
1. In Anbetracht <strong>der</strong> jeweiligen F<strong>in</strong>anzlage das Gewährleisten e<strong>in</strong>er<br />
Ressourcenbereitstellung für die Bürger <strong>in</strong> unserem Landkreis <strong>in</strong><br />
höchstmöglicher Qualität <strong>und</strong> Quantität<br />
2. Die kont<strong>in</strong>uierliche Erhaltung (<strong>und</strong> Verbesserung?) <strong>der</strong> Lebensqualität<br />
unserer Bürger <strong>und</strong> Bürger<strong>in</strong>nen<br />
3. Das Herstellen <strong>und</strong> Aufrechterhalten e<strong>in</strong>er flächendeckenden,<br />
gleichwertigen <strong>und</strong> regional ausgewogenen Versorgung<br />
(=Chancengleichheit)<br />
4. Deshalb: „Müssen wir alle Überlegungen <strong>und</strong> Planungen, die für unsere<br />
Bürger <strong>in</strong> sozialer H<strong>in</strong>sicht wichtig s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e zeitlich ausreichende,<br />
ganzheitliche <strong>und</strong> örtliche Planung zusammenfassen“.<br />
73
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Integrierte <strong>Sozial</strong>planung …<br />
… bedeutet verstärktes Agieren.<br />
… bedeutet erhöhte <strong>Steuerung</strong>.<br />
… bedeutet mit den vorhandenen<br />
Mitteln besser auskommen.<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Modellprojekt<br />
Integrierte <strong>Sozial</strong>planung Bad Tölz - Wolfratshausen<br />
E<strong>in</strong> vom Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>ordnung,<br />
Familie <strong>und</strong> Frauen geför<strong>der</strong>tes<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Modellprojekt<br />
Stabsstelle <strong>in</strong> <strong>der</strong> Abteilung für <strong>Sozial</strong>e Angelegenheiten, 50%:<br />
<strong>Sozial</strong>manager, <strong>Sozial</strong>arbeiter, langjährige Leitung von Nonprofit<br />
Organisationen<br />
Wissenschaftliche Begleitung durch Katholische Stiftungsfachhochschule<br />
München<br />
74
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
<strong>Sozial</strong>planung = <strong>Steuerung</strong> ?<br />
Gew<strong>in</strong>n<br />
• Planungsverantwortung über alle Abteilungen <strong>und</strong> Fachplanungen<br />
(= Erkennen <strong>und</strong> Nutzen von Geme<strong>in</strong>samkeiten)<br />
• <strong>Sozial</strong>controll<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Hand (= Ausgabensteuerung <strong>des</strong> größten<br />
Kostenfaktors von unabhängiger Stelle)<br />
• Abbau von fachlichen Grenzen („über den Tellerrand schauen, kritisch<br />
h<strong>in</strong>terfragen, s<strong>in</strong>nvolles Neues e<strong>in</strong>for<strong>der</strong>n“)<br />
• Fachkompetenz Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe im Hause (UN - BRK, Inklusion)<br />
• kompetenter Ansprechpartner zum Thema „Demografie“<br />
• Reduzierung externer Kosten (Beratung, Datenerhebung)<br />
E<strong>in</strong> Teilaspekt<br />
Zukunft für K<strong>in</strong><strong>der</strong> - K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit Zukunft<br />
Regional <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>sam<br />
MNPM Prozess & Instrumente<br />
Inhalt<br />
<strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
75
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Die Kostenpyramide<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>kosten<br />
massiver Kostenaufwand für<br />
wenige Fälle<br />
mittlerer<br />
Kostenaufwand<br />
für zunehmende<br />
Fallanzahl<br />
Ger<strong>in</strong>ger Kostenaufwand<br />
für die Mehrzahl von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n/Jugendlichen/Familien<br />
76
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Präventive Netzwerke<br />
• Gezielter Aufbau <strong>und</strong> Ausbau präventiver<br />
Netzwerke<br />
• Aufteilung <strong>des</strong> Landkreises durch<br />
Kreistagsbeschluss <strong>in</strong> vier <strong>Sozial</strong>räume (Süd,<br />
Mitte, Nord <strong>und</strong> Loisachtal)<br />
• Kooperation mit Partnern, die geme<strong>in</strong>sam mit<br />
uns den Aufbau <strong>und</strong> Ausbau dieser Netzwerke<br />
betreiben:<br />
Träger <strong>der</strong> freien <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Trägeraufteilung<br />
77
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Neue Struktur <strong>des</strong> Amtes für<br />
Jugend <strong>und</strong> Familie<br />
• Anstatt e<strong>in</strong>es Leiters <strong>des</strong> <strong>Sozial</strong>en Dienstes vier<br />
Regionalleiter-Stellen<br />
• Für jeden <strong>Sozial</strong>raum e<strong>in</strong> Regionalleiter<br />
• An Stelle <strong>der</strong> zentralen E<strong>in</strong>heit im Landratsamt<br />
zusätzlich drei Außenstellen<br />
Entscheidungsf<strong>in</strong>dung<br />
im Regionalteam<br />
• E<strong>in</strong> Regionalteam / <strong>Sozial</strong>raum / Woche<br />
• 50 x im Jahr x 4 <strong>Sozial</strong>räume = 200<br />
Regionalteams<br />
• Die Freien Träger s<strong>in</strong>d mite<strong>in</strong>bezogen<br />
• Ziel: weg von <strong>der</strong> Defizitorientierung h<strong>in</strong><br />
zur Ressourcenorientierung<br />
78
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Regionalteam<br />
Regionalleiter<br />
Fe<strong>der</strong>führen<strong>der</strong><br />
Träger<br />
Kooperationspartner<br />
Vertreter<br />
<strong>Sozial</strong>er Dienst<br />
Fallbetreuen<strong>der</strong> MA<br />
Freier Träger<br />
Jugendsozialarbeiter<br />
an <strong>der</strong> Schule<br />
Vertreter<br />
WiHi<br />
MA<br />
Jugendarbeit<br />
MA Erziehungsberatungsstelle<br />
Kernteam<br />
Sonstige<br />
Flexible Teilnehmer<br />
Controll<strong>in</strong>g:<br />
Virtuelle Budgets für jeden <strong>Sozial</strong>raum<br />
Stand_30_09_2012 Nord Mitte Süd Loisachtal Gesamt<br />
Begleiteter Umgang 564 0 1.384 0 1.948<br />
§ 19 Mutter-K<strong>in</strong>d-Heim 491 0 0 8.929 9.420<br />
Erziehungsbeistandschaft 52.833 70.480 114.361 49.207 286.881<br />
<strong>Sozial</strong>pädagogische Familienhilfe 116.197 200.881 164.571 104.787 586.436<br />
Heilpädagogische Tagesstätte 88.613 107.995 120.962 15.541 333.110<br />
Unterbr<strong>in</strong>gung <strong>in</strong> Pflegefamilie 118.035 126.555 141.678 56.010 442.277<br />
Heim M<strong>in</strong><strong>der</strong>jährige 426.209 729.308 441.079 52.387 1.648.983<br />
Heim Volljährige<br />
232.180 192.088 118.026 34.233 576.526<br />
Intensive sozialpäd. E<strong>in</strong>zelfallhilfe 0 11.675 0 0 11.675<br />
Ambulante E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungshilfe § 35a 56.271 60.552 49.347 7.474 173.645<br />
gesamt 1.091.392 1.499.535 1.151.407 328.568 4.070.902<br />
Prognose Jahresende 1.439.452 1.982.505 1.516.319 430.623 5.368.898<br />
Ansatz 2012 1.573.420 2.134.032 1.412.407 379.141 5.499.000<br />
79
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Ausgaben<br />
brutto 2009 – 2012<br />
8.700.000,00 €<br />
8.600.000,00 €<br />
8.500.000,00 €<br />
8.400.000,00 €<br />
8.300.000,00 €<br />
8.200.000,00 €<br />
8.100.000,00 €<br />
8.000.000,00 €<br />
7.900.000,00 €<br />
7.800.000,00 €<br />
7.700.000,00 €<br />
IST 2009 IST 2010 IST 2011 Prognose<br />
2012<br />
PLAN 2013<br />
10.000.000,00 €<br />
9.000.000,00 €<br />
8.000.000,00 €<br />
7.000.000,00 €<br />
6.000.000,00 €<br />
5.000.000,00 €<br />
4.000.000,00 €<br />
3.000.000,00 €<br />
2.000.000,00 €<br />
1.000.000,00 €<br />
- €<br />
IST 2009 IST 2010 IST 2011 Prognose<br />
2012<br />
PLAN 2013<br />
IST 2009 IST 2010 IST 2011 Prognose 2012 PLAN 2013<br />
Ausgaben (blau) 8.624.387 € 8.037.215 € 8.173.069 € 8.320.000 € 8.580.006 €<br />
E<strong>in</strong>nahmen (gelb) 1.926.947 € 2.337.582 € 1.866.358 € 1.730.000 € 1.645.760 €<br />
Nettoausgaben (rosa) 6.697.440 € 5.699.633 € 6.306.711 € 6.590.000 € 6.934.246 €<br />
80
Arbeitsgruppe 1: Integrierte <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>raumorientierung<br />
Das Verhältnis <strong>der</strong><br />
Hilfearten än<strong>der</strong>t sich<br />
Produktkosten (Nettoaufwand)<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Stationäre Hilfen / Vollzeitpflege<br />
Vater/Mutter-K<strong>in</strong>d-Maßn., Heimerz., Pflegek<strong>in</strong><strong>der</strong>, Inobhutnahmen 3.885.067 € 3.360.565 € 2.499.701 € 2.897.949 €<br />
Anteil an Summe Zwecke<strong>in</strong>zelkosten 57% 50% 44% 46%<br />
Teilstationäre Hilfen<br />
Stütz-/För<strong>der</strong>klasse, Tagesgruppen 715.217 € 769.114 € 637.532 € 603.364 €<br />
Anteil an Summe Zwecke<strong>in</strong>zelkosten 10% 12% 11% 10%<br />
Ambulante Hilfen<br />
<strong>in</strong>cl. <strong>Sozial</strong>pädag. Familienhilfe <strong>und</strong> Erziehungsbeist., ISE 1.055.938 € 1.415.389 € 1.322.078 € 1.466.019 €<br />
Anteil an Summe Zwecke<strong>in</strong>zelkosten 15% 21% 23% 23%<br />
Betreuungs- <strong>und</strong> Bildungsmaßnahmen<br />
Tagespflege, Tagese<strong>in</strong>richtungen 551.899 € 403.860 € 464.321 € 453.425 €<br />
Anteil an Summe Zwecke<strong>in</strong>zelkosten 8% 6% 8% 7%<br />
Präventionskosten<br />
Jugendarbeit, -schutz, -sozialarbeit, Sportförd., <strong>Sozial</strong>raum, Erz.Ber. 646.082 € 735.758 € 770.578 € 870.153 €<br />
Anteil an Summe Zwecke<strong>in</strong>zelkosten 9% 11% 14% 14%<br />
Soll-Stand:<br />
Die Kostenpyramide steht wie<strong>der</strong> richtig<br />
81
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Bericht aus <strong>der</strong> Arbeitsgruppe 2:<br />
Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Die Arbeitsgruppe 2 befasste sich mit <strong>der</strong> Personalbemessung <strong>und</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> auf <strong>der</strong><br />
Gr<strong>und</strong>lage von Qualitätsstandards.<br />
Stefanie Krüger vom Bayerischen Lan<strong>des</strong>jugendamt stellte hierzu das Projekt „Personalbemessung <strong>der</strong> Jugendämter <strong>in</strong><br />
Bayern (PeB)“ vor. Mit Stand September 2012 wurde bereits <strong>in</strong> 35 Jugendämtern <strong>in</strong> Bayern die Personalsituation auf<br />
<strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von PeB untersucht. Im Rahmen von PeB wird auf transparenter Gr<strong>und</strong>lage die Fragestellung geklärt,<br />
mit welcher def<strong>in</strong>ierten Qualität die gesetzlichen Aufgaben im Jugendamt erfüllt werden <strong>und</strong> welches Personal hierfür<br />
erfor<strong>der</strong>lich ist. Dadurch, dass durch PeB die Qualität <strong>und</strong> Quantität <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> sichtbar gemacht wird, ist<br />
PeB dazu geeignet, die <strong>in</strong> § 79a SGB VIII gesetzlich normierte Qualitätsentwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
sicherzustellen.<br />
Von Peter Tomaschko wurde die Vorgehensweise <strong>des</strong> Bayerischen Kommunalen Prüfungsverban<strong>des</strong> (BKPV) bei Organisationsuntersuchungen<br />
vorgestellt. Vom BKPV wird dabei die Geschäftsverteilung <strong>und</strong> zur Geschäftsprozessoptimierung<br />
die Ablauforganisation untersucht. Der Personalbedarf wird auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Auftragszeiten<br />
anhand von Kern- <strong>und</strong> Teilprozessen berechnet. Bei den Jugendämtern werden dabei die Bemessungsgr<strong>und</strong>lagen von<br />
PeB verwendet. Neben <strong>der</strong> Stellenbemessung nimmt <strong>der</strong> BKPV auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> wahrgenommenen Aufgaben<br />
auch Stellenbewertungen vor.<br />
Marco Szlapka vom Institut für <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> Organisationsentwicklung e.V. stellte Möglichkeiten zur <strong>Steuerung</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> vor. Hierzu gilt es die Informationen auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>berichterstattung <strong>in</strong> Bayern<br />
(JUBB), die im Rahmen von PeB ermittelten Zahlen <strong>und</strong> Vergleiche sowie die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lan<strong>des</strong>statistik dargestellten<br />
„Wirkungen“ so zu verb<strong>in</strong>den, dass diese steuernd verwendet werden können. Als Beispiel nannte Marco Szlapka<br />
die Heimerziehung (§ 34 SGB VIII). Der Erfolg solcher Maßnahmen kann danach überprüft werden, <strong>in</strong>wieweit es<br />
gel<strong>in</strong>gt, dass im Anschluss an e<strong>in</strong>e stationäre Heimunterbr<strong>in</strong>gung ke<strong>in</strong>e ambulanten Hilfen mehr erfor<strong>der</strong>lich wurden.<br />
Entsprechend dem Gr<strong>und</strong>satz ambulant vor stationär kann geprüft werden, wie häufig vor e<strong>in</strong>er stationären Hilfe<br />
ambulante Maßnahmen durchgeführt wurden. E<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Beratung nach § 16 SGB VIII ist beispielsweise dann<br />
erfolgreich, wenn <strong>in</strong> den nachfolgenden beiden Jahren ke<strong>in</strong>e Erziehungshilfe nach § 27 SGB VIII erfor<strong>der</strong>lich wurde.<br />
Zur <strong>Steuerung</strong> ist <strong>in</strong>sofern e<strong>in</strong>e Prüfung erfor<strong>der</strong>lich, ob <strong>der</strong> gewünschte Erfolg e<strong>in</strong>getreten ist. Wenn ne<strong>in</strong>, dann stellt<br />
sich die Frage nach den Konsequenzen, die sich daraus ergeben.<br />
Neben <strong>der</strong> klientenbezogenen <strong>Steuerung</strong> kann auch die Untersuchung <strong>des</strong> Systembezugs erfolgen. Wird dabei festgestellt,<br />
dass zu viele Besprechungen erfolgen, können diese e<strong>in</strong>geschränkt werden. Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von Auftragszeiten wurde von Marco Szlapka darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass sich bei Teilzeitkräften<br />
e<strong>in</strong> höherer prozentualer Anteil an System- <strong>und</strong> Rüstzeiten <strong>und</strong> damit weniger Klientenzeit ergibt. Es stellt sich daher<br />
die Frage, für welche Aufgaben Teilzeitkräfte am effektivsten e<strong>in</strong>gesetzt werden können.<br />
Die Kosten für PeB werden von Marco Szlapka je nach Intensität auf 10 – 20.000 € beziffert. Die Untersuchungsdauer<br />
beträgt dabei zwischen e<strong>in</strong>em halben <strong>und</strong> maximal e<strong>in</strong>em Jahr.<br />
82
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er Abfrage zeigten sich die anwesenden Landräte, <strong>der</strong>en Jugendämter an PeB teilgenommen haben,<br />
mit dem zugr<strong>und</strong>eliegenden Verfahren zufrieden bis sehr zufrieden. Teilweise wurde <strong>der</strong> anlässlich <strong>der</strong> Untersuchung<br />
festgestellte erhebliche Personalbedarf kritisch gesehen. Von Marco Szlapka wurde <strong>in</strong> diesem Zusammenhang darauf<br />
h<strong>in</strong>gewiesen, dass im Rahmen <strong>der</strong> Untersuchung auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bereichen von Jugendämtern Überbesetzungen<br />
festgestellt wurden. Die sich ergebenden Personalmehrungen h<strong>in</strong>gen häufig damit zusammen, dass für <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren neu h<strong>in</strong>zugekommene gesetzliche Aufgaben zum Untersuchungszeitpunkt ke<strong>in</strong>e bzw. unzureichende Personalmehrungen<br />
erfolgt waren. Ferner zieht <strong>der</strong> ermittelte Personalbedarf ke<strong>in</strong>e zw<strong>in</strong>gende Verpflichtung zu Personalmehrungen<br />
nach sich. Um den Personalbedarf zu verr<strong>in</strong>gern, können beispielsweise Standards <strong>in</strong> Arbeitsbereichen<br />
abgesenkt werden.<br />
Berichterstatter: Michael Sturm<br />
83
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Bayerischer Landkreistag<br />
Landrätetagung am 17. <strong>und</strong> 18. Oktober 2012<br />
Personalbemessung <strong>und</strong> <strong>Steuerung</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von<br />
Qualitätsstandards<br />
„Personalbemessung <strong>der</strong> Jugendämter <strong>in</strong> Bayern - PeB“<br />
Stefanie Krüger,<br />
Peter Tomaschko,<br />
Marco Szlapka<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Personalbemessung <strong>der</strong> Jugendämter <strong>in</strong> Bayern (PeB)<br />
PeB-Standorte (1. R<strong>und</strong>e):<br />
1. Stadt Nürnberg<br />
2. Landkreis Fürstenfeldbruck<br />
3. Landkreis Neumarkt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Oberpfalz<br />
25<br />
6<br />
5<br />
28<br />
Stand: September 2012<br />
PeB-Standorte (2. R<strong>und</strong>e):<br />
4. Stadt Ingolstadt<br />
24<br />
5. Stadt Hof<br />
6. Landkreis Hof<br />
17. Landkreis Neuburg<br />
7. Landkreis Cham<br />
Schrobenhausen<br />
8. Landkreis Landshut<br />
18. Landkreis Dachau<br />
9. Landkreis Regen<br />
19. Landkreis Donau-Ries<br />
10. Landkreis Freis<strong>in</strong>g<br />
20. Landkreis Augsburg<br />
11. Landkreis Ebersberg<br />
21. Landkreis Nürnberger Land<br />
12. Landkreis München<br />
22. Landkreis Erlangen-Höchstadt<br />
13. Landkreis Landsberg am Lech 23. Landkreis Schwe<strong>in</strong>furt<br />
14. Landkreis L<strong>in</strong>dau (Bodensee) 24. Landkreis Würzburg<br />
15. Landkreis Dill<strong>in</strong>gen an <strong>der</strong> Donau 25. Landkreis Bad Kiss<strong>in</strong>gen<br />
16. Landkreis Aichach-Friedberg<br />
Standorte außerhalb von PeB:<br />
26. Landkreis Günzburg<br />
27. Landkreis Traunste<strong>in</strong><br />
28. Landkreis Wunsiedel i. Fichtel.<br />
31. Stadt Fürth<br />
32. Landkreis Fürth<br />
33. Stadt Rosenheim<br />
14<br />
29. Landkreis Schwandorf<br />
30. Landkreis Altött<strong>in</strong>g<br />
34. Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm<br />
35. Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen<br />
23<br />
26<br />
31<br />
3<br />
20<br />
22<br />
32<br />
19<br />
1<br />
16<br />
17<br />
2<br />
21<br />
4<br />
18<br />
3<br />
13 12<br />
36. …<br />
37. …<br />
38. …<br />
10<br />
11<br />
29<br />
35 36<br />
34<br />
8<br />
33<br />
7<br />
27<br />
30<br />
9<br />
84
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
B<strong>und</strong>esk<strong>in</strong><strong>der</strong>schutzgesetz – BKiSchG<br />
§ 79a SGB VIII<br />
Qualitätsentwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
(1) Um die Aufgaben <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> nach § 2 zu erfüllen, haben<br />
die Träger <strong>der</strong> öffentlichen <strong>Jugendhilfe</strong> Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Maßstäbe für die<br />
Bewertung <strong>der</strong> Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung<br />
für<br />
1. die Gewährung <strong>und</strong> Erbr<strong>in</strong>gung von Leistungen<br />
2. die Erfüllung an<strong>der</strong>er Aufgaben<br />
3. den Prozess <strong>der</strong> Gefährdungse<strong>in</strong>schätzung nach § 8a<br />
4. die Zusammenarbeit mit an<strong>der</strong>en Institutionen<br />
zu entwickeln, anzuwenden <strong>und</strong> regelmäßig zu überprüfen.<br />
Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die Sicherung <strong>der</strong> Rechte von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger <strong>der</strong><br />
öffentlichen <strong>Jugendhilfe</strong> orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen<br />
<strong>der</strong> nach § 85 Absatz 2 zuständigen Behörden <strong>und</strong> an bereits angewandten<br />
Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>und</strong> Maßstäben für die Bewertung <strong>der</strong> Qualität sowie Maßnahmen<br />
zu ihrer Gewährleistung.<br />
Quantität <strong>und</strong> Qualität<br />
Leistungen <strong>der</strong> <strong>Sozial</strong>en Dienste<br />
Leistungsbereiche<br />
SGB VIII<br />
Arbeitsprozesse<br />
Def<strong>in</strong>ierte<br />
Qualität<br />
Aktivitäten<br />
Erfor<strong>der</strong>liche<br />
Ressourcen<br />
Standards<br />
Qualität<br />
Ressourcen<br />
85
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Rechtliche, fachliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Beschreibung<br />
von Arbeitsprozessen<br />
Zugang<br />
über an<strong>der</strong>es JA<br />
Zugang<br />
über „Falle<strong>in</strong>gang“,<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em „an<strong>der</strong>en<br />
KP/TP“<br />
Teilprozess 1b:<br />
Fallübergabe<br />
durch an<strong>der</strong>es JA<br />
Meldung KWG<br />
Gewichtige<br />
Anhaltspunkte<br />
Statistik<br />
24 St<strong>und</strong>en<br />
Ende<br />
Entscheidung<br />
KP § 16<br />
Beratungsangebot<br />
Teilprozess 2:<br />
Teilprozess 1a:<br />
Gefährdungserste<strong>in</strong>schätzung<br />
Vorortabschätzung<br />
KP § 42<br />
Inobhutnahme<br />
Ende<br />
Entscheidung<br />
5<br />
KP §§ 50/1666<br />
Familiengericht<br />
Rechtliche, fachliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Beschreibung<br />
von Arbeitsprozessen<br />
Teilprozess 1a<br />
Ziel / Ergebnis<br />
Aktivitäten<br />
Prozessbeteiligte<br />
Instrumente /<br />
Dokumente<br />
Gefährdungserste<strong>in</strong>schätzung<br />
Der H<strong>in</strong>weis ist dah<strong>in</strong>gehend bewertet, ob gegenwärtig Anhaltspunkte<br />
für e<strong>in</strong>e mögliche Gefährdungssituation <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>des</strong> vorliegen.<br />
Sofortige Bearbeitung von Anliegen, H<strong>in</strong>weisen <strong>und</strong> Mitteilungen:<br />
• schriftliche Dokumentation <strong>der</strong> Informationen<br />
• erste Bewertung <strong>der</strong> Informationen<br />
• Prüfung, ob die Familie bereits bekannt ist<br />
• Klärung <strong>der</strong> Zuständigkeit, ggf. direkte Weitergabe an die zuständige<br />
Fachkraft (o<strong>der</strong> das zuständige Jugendamt)<br />
• Erörterung <strong>des</strong> Sachverhaltes mit e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en Fachkraft <strong>und</strong>/o<strong>der</strong><br />
Leitung <strong>und</strong> Dokumentation <strong>des</strong> Ergebnisses<br />
• Mitteilende Person<br />
• Leitung (kollegiale Reflexion)<br />
• „Meldung K<strong>in</strong><strong>des</strong>wohlgefährdung“ „Gewichtige Anhaltspunkte“<br />
• „B<strong>und</strong>esstatistik KWG“ Fallakte elektronische Fallakte<br />
Zeit<br />
Gespräch mit<br />
Mitteilende<br />
Person<br />
Dokumentation<br />
Gewichtige<br />
Anhaltspunkte<br />
Vorortabschätzung<br />
Datenabgleich<br />
Kurzgespräche<br />
(z.B.<br />
Kita, Schule)<br />
Beratung mit<br />
Leitung<br />
Zeitbedarf 20 m<strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong> 10 m<strong>in</strong> 15 m<strong>in</strong> 15 m<strong>in</strong><br />
Häufigkeit 1 Gespräch 1 x 1 x 1 x 1 x<br />
86
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Berechnung von Arbeitszeiten (Klientenzeit)<br />
Kernprozess:<br />
"§8a"<br />
Dauer <strong>in</strong><br />
M<strong>in</strong>uten<br />
Faktor<br />
Zeitvolumen <strong>in</strong><br />
M<strong>in</strong>uten pro<br />
Tätigkeit<br />
Gespräche 20 1 20<br />
Dokumentation 20 1 20<br />
Adm<strong>in</strong>istration 10 1 10<br />
Kurzgespräche 15 1 15<br />
Koll. Reflexion 15 1 15<br />
Fahrzeiten 0<br />
0<br />
0<br />
1800<br />
Zeitvolumen <strong>in</strong> M<strong>in</strong>uten pro e<strong>in</strong>zelner TP 80<br />
Anzahl <strong>der</strong> TP 120<br />
Zeitvolumen <strong>in</strong> St<strong>und</strong>en <strong>in</strong>sgesamt 160<br />
Bestandteile <strong>der</strong> Arbeitszeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Ausführungszeit<br />
Verteilzeit<br />
Rüstzeit<br />
Klientenzeit<br />
TP 1: Gefährdungserste<strong>in</strong>schätzung<br />
Systemzeit<br />
=100%<br />
87
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
„Qualität <strong>und</strong> Quantität <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> wird sichtbar“<br />
Arbeitsprozesse <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong> lassen sich beschreiben <strong>und</strong> damit<br />
auch vergleichen<br />
Arbeitsabläufe <strong>und</strong> Standards s<strong>in</strong>d rechtlich, fachlich <strong>und</strong> wirtschaftlich<br />
zu beurteilen <strong>und</strong> transparent<br />
Gewünschte <strong>und</strong> erfor<strong>der</strong>liche Qualität lässt sich durch Leitung<br />
def<strong>in</strong>ieren<br />
Notwendige Arbeitszeiten können berechnet <strong>und</strong> Handlungsbedarfe<br />
rechtzeitig erkannt werden<br />
Leitung kann Qualität <strong>und</strong> Quantität steuern<br />
Politik erhält transparente Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage h<strong>in</strong>sichtlich<br />
fachlicher Qualität <strong>und</strong> notwendiger Ressourcen<br />
Organisationsuntersuchungen durch den<br />
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband<br />
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung<br />
Nachvollziehbare Berechnung <strong>des</strong> hierfür notwendigen<br />
Personalbedarfs<br />
Unklare Zuständigkeiten beseitigen<br />
Schwächen <strong>und</strong> Stärken transparent werden lassen<br />
Sachgerechte Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> Basis für<br />
künftige Verwaltungsentwicklung<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Abläufe, Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
88
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Geschäftsverteilung<br />
S<strong>in</strong>d die Aufgaben nach sachlichen Gesichtspunkten<br />
zugeordnet?<br />
Gibt es mehrfache Zuständigkeiten?<br />
S<strong>in</strong>d problematische Schnittstellen vorhanden?<br />
Sollten Aufgaben zweckmäßigerweise e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en<br />
Organisationse<strong>in</strong>heit zugeordnet werden?<br />
Berücksichtigung örtlicher Beson<strong>der</strong>heiten<br />
Berücksichtigung Bürgerfre<strong>und</strong>lichkeit <strong>und</strong> räumliche<br />
Verhältnisse<br />
Ablauforganisation - Geschäftsprozessoptimierung<br />
Wie werden die Aufgaben erledigt?<br />
Welche Hilfsmittel werden e<strong>in</strong>gesetzt?<br />
Welche Aufgaben könnten besser EDV-gestützt erledigt<br />
werden?<br />
Werden vorhandene EDV-Verfahren umfassend genutzt?<br />
S<strong>in</strong>d die Zuständigkeiten <strong>und</strong> Befugnisse für e<strong>in</strong>e optimale<br />
Aufgabenerledigung ausreichend?<br />
89
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Ablauforganisation im Kreisjugendamt<br />
Beispiel: Kernprozess §§ 27 ff. SGB VIII - Hilfen zur Erziehung<br />
13<br />
Qualität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Leistungserbr<strong>in</strong>gung<br />
Beispiel: Kernprozess §§ 27 ff. SGB VIII - Hilfen zur Erziehung<br />
14<br />
90
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Berechnung von erfor<strong>der</strong>lichen Auftragszeiten auf<br />
<strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von Kern- <strong>und</strong> Teilprozessen<br />
(Personalbedarf)<br />
Teilprozess 5.1:<br />
Klärung<br />
<br />
4 Gespräche<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
Koll. Reflexion (50%)<br />
530 M<strong>in</strong>.<br />
x<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
=<br />
Teilprozess 5.2:<br />
Bewilligungsteam<br />
Teilprozess 5.3:<br />
Kontakt mit<br />
Leistungserbr<strong>in</strong>ger<br />
Team<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
<br />
80 M<strong>in</strong>.<br />
<br />
2 Gespräche<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
240 M<strong>in</strong>.<br />
x<br />
x<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
=<br />
=<br />
Zeitbedarf<br />
für<br />
den<br />
Kernprozess<br />
Teilprozess 5.4:<br />
1. Hilfeplangespräch<br />
(HPG)<br />
<br />
Gespräche<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
Koll. Reflexion (50%)<br />
178 M<strong>in</strong>.<br />
x<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
=<br />
Stellenbemessung <strong>und</strong> Stellenbewertung<br />
Stellenbemessung <strong>Sozial</strong>dienst<br />
Zeitbedarf für …<br />
St<strong>und</strong>en im Jahr (FK)<br />
St<strong>und</strong>en im Jahr<br />
(VZÄ)<br />
Klientenzeit 8.844 8.844 79,1%<br />
Fahrzeiten 300 300 2,7%<br />
Rüstzeit 623 548 4,9%<br />
Systemzeit 1.110 1.002 9,0%<br />
Verteilzeit 498 492 4,4%<br />
100%<br />
11.374 11.186<br />
Stellenbewertung<br />
WiHi<br />
Aufgabenbereich St<strong>und</strong>en Anteil %<br />
Leistungsgewährung 643,97 17,03<br />
Zahlbarmachung 641,75 16,97<br />
Ref<strong>in</strong>anzierung 872,92 23,08<br />
Kostenerstattung 100,33 2,65<br />
Sonstige Aufgaben 271,63 7,18<br />
Prosoz Adm<strong>in</strong>istration 389,00 10,29<br />
Haushalt 91,00 2,41<br />
Rüstzeit 267,00 7,06<br />
Systemzeit 360,00 9,52<br />
Verteilzeit 144,53 3,82<br />
Gesamt 3782,13 100,00<br />
91
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
<strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong><br />
Ergebnisse & Wirkungen<br />
Was wollen wir erreichen?<br />
Programme, Leistungen<br />
Was wollen wir tun?<br />
Ressourcen<br />
Was wenden wir auf?<br />
Prozesse & Strukturen<br />
Wie wollen wir etwas tun?<br />
<strong>Steuerung</strong> mit Hilfe von PeB <strong>und</strong> JuBB<br />
(JuBB = <strong>Jugendhilfe</strong>berichterstattung <strong>in</strong> Bayern)<br />
JuBB Zahlen<br />
für das Jugendamt<br />
<strong>und</strong> für Vergleiche<br />
PeB Zahlen<br />
für das Jugendamt<br />
<strong>und</strong> für Vergleiche<br />
Lan<strong>des</strong>statistik<br />
(„Wirkungen“)<br />
Fallzahlen<br />
Alter<br />
Klientenzeit<br />
Auftragszeit<br />
Zeit pro Fall<br />
Anregung zur<br />
Hilfe<br />
Gesamtkosten<br />
Kosten pro Fall<br />
Personalbedarf<br />
Personalkosten<br />
Gr<strong>und</strong> für die<br />
Hilfe<br />
Laufzeit<br />
Anteil a. Leistungen<br />
Jugende<strong>in</strong>wohnerwert<br />
Standards<br />
Informationen zur<br />
Beendigung<br />
Nachfolgende<br />
Hilfen<br />
92
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Merkmale zur <strong>Steuerung</strong> von Erziehungshilfen<br />
Heimerziehung<br />
§ 34 SGB VIII<br />
mittlere<br />
Bearbeitungszeit<br />
Kosten pro Fall Laufzeit Personalkosten<br />
vorangegangene<br />
Hilfen<br />
Begründung<br />
<strong>der</strong> Hilfe<br />
Ende <strong>der</strong> Hilfe<br />
Anschlusshilfen<br />
<strong>Steuerung</strong> <strong>des</strong> Produktes Heimerziehung<br />
Zielfel<strong>der</strong> Prozessebene Ziele<br />
Erwartungen<br />
Ergebnisse,<br />
Wirkungen Was<br />
wollen wir erreichen?<br />
Heimerziehung /<br />
Betreutes Wohnen<br />
(<strong>in</strong>kl. junge Volljährige)<br />
Der junge Mensch erhält<br />
e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle<br />
För<strong>der</strong>ung außerhalb<br />
se<strong>in</strong>es Familiensystems.<br />
Ziele s<strong>in</strong>d die Rückkehr<br />
<strong>in</strong> die Herkunftsfamilie,<br />
die Integration <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
an<strong>der</strong>e Familie, die<br />
selbständige<br />
Lebensführung.<br />
Indikatoren<br />
Schlüsselzahlen<br />
In 80 % <strong>der</strong> Hilfen wird<br />
das Ziel erreicht (Ziel<br />
im Hilfeplan). In 20%<br />
<strong>der</strong> Hilfen gel<strong>in</strong>gt die<br />
Rückkehr <strong>in</strong> die<br />
Herkunftsfamilie, <strong>in</strong><br />
20% die Integration <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Familie<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> 40% die<br />
Verselbständigung.<br />
Leistungen,<br />
Programme Was wollen<br />
wir tun?<br />
Heimerziehung /<br />
Betreutes Wohnen<br />
(<strong>in</strong>kl. junge Volljährige)<br />
Junge Menschen<br />
erhalten entsprechend<br />
ihres För<strong>der</strong>bedarfes die<br />
geeignete Hilfe.<br />
Anzahl <strong>der</strong> jungen<br />
Menschen nach Alter<br />
<strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungsart<br />
(Heimerziehung <strong>und</strong><br />
betreutes Wohnen) -<br />
Fallzahlen<br />
Anteil <strong>der</strong><br />
Heimerziehung<br />
gemessen an <strong>der</strong><br />
Anzahl aller HzE<br />
Anteil <strong>der</strong><br />
Heimerziehung<br />
gemessen an <strong>der</strong><br />
Anzahl EW-Wert 0-21<br />
Prozesse, Strukturen<br />
Wie wollen wir es tun?<br />
Heimerziehung /<br />
Betreutes Wohnen<br />
(<strong>in</strong>kl. junge Volljährige)<br />
Der junge Mensch wird<br />
so geför<strong>der</strong>t, dass <strong>der</strong><br />
Hilfeerfolg zeitnah<br />
realisiert werden kann.<br />
Dabei stehen ambulante<br />
<strong>und</strong>/o<strong>der</strong> teilstationäre<br />
Hilfen im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>.<br />
In 80% <strong>der</strong> stationären<br />
Hilfen gab es e<strong>in</strong>e<br />
vorangegangene<br />
ambulante o<strong>der</strong><br />
teilstationäre Hilfe.<br />
Die durchschnittliche<br />
Hilfedauer liegt bei 12<br />
Monaten.<br />
93
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
<strong>Steuerung</strong> auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von<br />
Leistungserbr<strong>in</strong>gung für den Bürger<br />
Ablauforganisation <strong>in</strong> den Kernprozessen ….<br />
Trennungs<strong>und</strong><br />
Scheidungsberatung<br />
(§ 17/18)<br />
Mitwirkung<br />
Familiengericht<br />
(§ 50)<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Beratung<br />
(§ 16)<br />
Erziehungshilfe<br />
(§ 27 )<br />
TP 1<br />
TP 1<br />
TP 1<br />
TP 1<br />
TP 2<br />
TP 2<br />
TP 2<br />
TP 2<br />
TP 3 TP 3<br />
TP 2<br />
TP 3<br />
TP 4<br />
TP 3<br />
TP 3<br />
Bestandteile <strong>der</strong> Arbeitszeit (Beispiel: <strong>Sozial</strong>dienst)<br />
Auftragszeit = Netto-Jahresarbeitszeit (VZÄ)<br />
Ausführungszeit<br />
Rüstzeit<br />
Klientenbezug<br />
Systembezug<br />
Verteilzeit<br />
5% bis<br />
8%<br />
70% bis 80%<br />
10% bis<br />
20%<br />
5%<br />
=100%<br />
© INSO 22<br />
94
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
<strong>Steuerung</strong> auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von Auftragszeiten<br />
Teilprozess 5.1:<br />
Klärung<br />
<br />
4 Gespräche<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
Koll. Reflexion (50%)<br />
530 M<strong>in</strong>.<br />
x<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
=<br />
Teilprozess 5.2:<br />
Bewilligungsteam<br />
Teilprozess 5.3:<br />
Kontakt mit<br />
Leistungserbr<strong>in</strong>ger<br />
Team<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
<br />
80 M<strong>in</strong>.<br />
<br />
2 Gespräche<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
240 M<strong>in</strong>.<br />
x<br />
x<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
=<br />
=<br />
Zeitbedarf<br />
für<br />
den<br />
Kernprozess<br />
Teilprozess 5.4:<br />
1. Hilfeplangespräch<br />
(HPG)<br />
<br />
Gespräche<br />
Dokumentation<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
Koll. Reflexion (50%)<br />
178 M<strong>in</strong>.<br />
x<br />
Häufigkeit<br />
<strong>des</strong> Teilprozesses<br />
=<br />
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
Stefanie Krüger,<br />
Zentrum Bayern Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es, Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Peter Tomaschko,<br />
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband<br />
Marco Szlapka,<br />
Institut für <strong>Sozial</strong>planung <strong>und</strong> Organisationsentwicklung e.V.<br />
95
Arbeitsgruppe 2: Personalbemessung <strong>in</strong> den Jugendämtern<br />
Ergebnisse <strong>in</strong> den Landratsämtern vor Ort<br />
Beschreibung <strong>der</strong> Ablauforganisation sowie <strong>der</strong><br />
Fachlichen Standards (Qualitätshandbuch)<br />
Fortschreibungsfähiges Konzept <strong>der</strong> Ermittlung<br />
von Auftragszeiten (Personalbemessung)<br />
Mittlere Bearbeitungszeiten für die Anpassung bei<br />
neuen Aufgaben <strong>und</strong> Standards (Ressourcensteuerung)<br />
Ressourcenorientierte Gr<strong>und</strong>lagen für das<br />
Controll<strong>in</strong>g (Qualitative <strong>und</strong> Quantitative <strong>Steuerung</strong>)<br />
96
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong><br />
Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
In Arbeitsgruppe 3 wurden die <strong>Jugendhilfe</strong>berichterstattung <strong>in</strong> Bayern (JUBB) durch Hans Re<strong>in</strong>fel<strong>der</strong>, Bayerisches<br />
Lan<strong>des</strong>jugendamt, sowie die Anfor<strong>der</strong>ungen an e<strong>in</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen aus <strong>der</strong> Sicht <strong>des</strong> Controll<strong>in</strong>gs durch<br />
Brigitte Keller, Landkreis Ebersberg, vorgestellt.<br />
JUBB hat die Vere<strong>in</strong>heitlichung <strong>und</strong> Aufbereitung von planungsrelevanten Daten für die örtlichen Träger <strong>der</strong> öffentlichen<br />
<strong>Jugendhilfe</strong> zum Ziel. Darüber h<strong>in</strong>aus werden durch JUBB fachlich s<strong>in</strong>nvolle Vergleiche ermöglicht. So wurden<br />
etwa auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> JUBB-Daten bereits die Jugendämter <strong>in</strong> den schwäbischen Landkreisen mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verglichen.<br />
Derzeit beteiligen sich 68% <strong>der</strong> Jugendämter an JUBB (davon 58 Landkreise). Die Zukunft von JUBB sieht das<br />
Lan<strong>des</strong>jugendamt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dar<strong>in</strong>, dass es als Teil <strong>des</strong> Qualitätsentwicklungsprozesses nach § 79a SGB VIII <strong>in</strong> den<br />
strategischen Managementprozess <strong>der</strong> Jugendämter <strong>in</strong>tegriert wird.<br />
Im Landkreis Ebersberg wird seit 2012 auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> JUBB-Daten strategisch gesteuert. Wesentliche Elemente s<strong>in</strong>d<br />
e<strong>in</strong> Kontrakt, <strong>in</strong> dem die strategischen Ziele <strong>und</strong> Strategien <strong>des</strong> Jugendamts vere<strong>in</strong>bart werden, sowie die enge Zusammenarbeit<br />
zwischen dem dezentralen Controll<strong>in</strong>g im Jugendamt <strong>und</strong> dem zentralen Controll<strong>in</strong>g <strong>des</strong> Landratsamts,<br />
um die Wirksamkeit <strong>der</strong> ergriffenen Maßnahmen zu überprüfen <strong>und</strong> diese Informationen den Führungskräften als<br />
Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage zur Verfügung zu stellen. Für die strategische <strong>Steuerung</strong> wäre es hilfreich, die eigenen Kennzahlen<br />
mit den Kennzahlen an<strong>der</strong>er Landkreise vergleichen zu können. Hierbei kann auch auf die Erfahrungen aus den<br />
<strong>in</strong>terkommunalen Vergleichen <strong>des</strong> Innovationsr<strong>in</strong>gs <strong>des</strong> Bayerischen Landkreistags zurückgegriffen werden.<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Arbeitsgruppe 3 „<strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge“:<br />
- E<strong>in</strong>e strategische <strong>Steuerung</strong> <strong>der</strong> Jugendämter ist gerade <strong>in</strong> <strong>Zeiten</strong> <strong>des</strong> demografischen Wandels s<strong>in</strong>nvoll. Soweit<br />
datenschutzrechtliche Vorschriften e<strong>in</strong>e strategische <strong>Steuerung</strong> beh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, sollten diese kritisch überprüft werden.<br />
- Die Durchführung von <strong>in</strong>terkommunalen Vergleichen zwischen den Jugendämtern zur Unterstützung <strong>der</strong> strategischen<br />
<strong>Steuerung</strong> wird befürwortet. Der Landkreistag soll geme<strong>in</strong>sam mit dem Lan<strong>des</strong>jugendamt e<strong>in</strong>e Lösung<br />
erarbeiten, die es allen <strong>in</strong>teressierten Landkreisen ermöglicht, an entsprechenden <strong>in</strong>terkommunalen Vergleichen<br />
teilzunehmen.<br />
Berichterstatter: Klaus Geiger<br />
97
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches<br />
Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Hans Re<strong>in</strong>fel<strong>der</strong><br />
17.10.2012<br />
22.01.2013<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
JuBB<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>berichterstattung<br />
Bayern<br />
98
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
<strong>der</strong>zeit ausgewiesene Daten <strong>der</strong><br />
Leistungserbr<strong>in</strong>gung<br />
99
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zusätzlich ausgewiesen…<br />
<strong>Sozial</strong>strukturdaten, z.B.:<br />
• AL-Quote <strong>der</strong> unter 25-Jährigen<br />
• AL-Quote im Rechtskreis <strong>des</strong> SGB III<br />
• <strong>Sozial</strong>geld nach SGB II bei unter 15-<br />
Jährigen<br />
• Inanspruchnahme von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesbetreuung<br />
• Frauenerwerbstätigenquote<br />
• Anteil Schulabgänger<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zusätzlich ausgewiesen…<br />
Demografische Gr<strong>und</strong>daten, z.B.:<br />
• Altersaufbau<br />
• Bevölkerungsentwicklung<br />
(<strong>in</strong>kl. M<strong>in</strong><strong>der</strong>jährige)<br />
• Anteil <strong>der</strong> EW mit ausländischer<br />
Staatsbürgerschaft<br />
• Verhältnis <strong>der</strong> 0- unter 18-Jährigen zum<br />
Rest <strong>der</strong> Bevölkerung (Jugendquotient)<br />
100
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
JuBB ermöglicht fachlich s<strong>in</strong>nvolle Vergleiche<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Vergleich von zwei Landkreisen anhand<br />
JuBB am Beispiel <strong>des</strong> § 33 (Pflege)<br />
Fallzahlen<br />
Inanspruchnahme je<br />
1.000 EW <strong>der</strong> 0 bis<br />
unter 21-Jährigen<br />
Anteil an den HzE<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
51 <strong>und</strong> 22 2,1 <strong>und</strong> 1,24 19,3% <strong>und</strong> 6,9%<br />
101
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Jugendquotient <strong>der</strong> unter 18- Jährigen <strong>in</strong> Bayern<br />
(Stand: 31.12.2010)<br />
< 0,15 (2)<br />
< 0,18 (10)<br />
< 0,21 (35)<br />
< 0,24 (45)<br />
>= 0,24 (4)<br />
Resultat:<br />
E<strong>in</strong>fluss auf die Arbeit<br />
<strong>des</strong> Jugendamtes:<br />
Jugendquotient (unter 18-Jährige)<br />
<strong>in</strong> Bayern: 0,21<br />
Bsp.:<br />
„junger“ Landkreis<br />
vs.<br />
„alter “Landkreis<br />
Auslösen<br />
verschiedener<br />
Ansprüche an das<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>system<br />
Vergleichbarkeit…<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Jugendämter s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e homogene Gruppe<br />
<strong>und</strong> daher nicht per sé<br />
mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> vergleichbar<br />
JuBB-Lösung: Clusterbildung<br />
nach e<strong>in</strong>em relevanten Satz von zehn<br />
soziodemographischen Variablen<br />
Landkreise: 7 Cluster<br />
Kreisfreie Städte: 4 Cluster<br />
102
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Cluster<strong>in</strong>g: herangezogene Variablen zur Berechnung<br />
Bevölkerung <strong>und</strong> Demographie:<br />
1. Bevölkerung <strong>der</strong> 0 bis unter 21 - Jährige n<br />
2. Verhältnis <strong>der</strong> 0 bis unter 21 - Jährigen<br />
zum Rest <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
3. Bevölkerungsstand<br />
4. Auslän<strong>der</strong>anteil an <strong>der</strong><br />
Gesamtbevölkerung<br />
Familien- <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>struktur:<br />
1. Arbeitslosenquote Jahresdurchschnitt<br />
2. Empfänger <strong>Sozial</strong>geld bezogen auf je<br />
1000 <strong>der</strong> bis unter 15 - Jährigen<br />
3. Verhältnis E<strong>in</strong>personenhaushalte zu<br />
Haushalten mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
4. Frauenerwerbstätigenquote<br />
5. Anteil Schulabgänger ohne Abschluss<br />
6. Verhältnis Ehelösungen zu<br />
Eheschließungen<br />
Struktur <strong>der</strong> Landkreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte wird relativ gut abgebildet<br />
7 Lkr.-Cluster 4 Stadt-Cluster<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Vergleichbarkeit…<br />
Jugendämter können sich <strong>in</strong>tern zum<br />
Vergleich zusammen schließen …d.h.<br />
ohne Beteiligung <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong>jugendamtes<br />
„Schwabenvergleich“ im Auftrag <strong>der</strong><br />
Landräte unter fachlicher Begleitung<br />
<strong>des</strong> Bayerischen Lan<strong>des</strong>jugendamts<br />
103
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Schwabenvergleich…Umgang<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Schwabenvergleich: Beispiel Al-Quote<br />
104
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Schwabenvergleich…Beispiel 1<br />
Verweildauer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Heimerziehung <strong>in</strong> Tagen<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Schwabenvergleich…Beispiel 2<br />
Kostenübersicht „Re<strong>in</strong>e Ausgaben“ Heimerziehung (§§ 34, 35a stationär)<br />
105
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Schwabenvergleich …<br />
Empfohlene Fragestellungen<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
• Wie erfolgt die Art <strong>und</strong> Höhe <strong>der</strong><br />
Leistungsgewährung im Abgleich mit an<strong>der</strong>en<br />
Cluster-Landkreisen?<br />
• Ist die Belegpraxis von E<strong>in</strong>richtungen historisch<br />
gewachsen o<strong>der</strong> wird fallspezifisch nach e<strong>in</strong>em<br />
geeigneten Platz gesucht?<br />
• Welchen E<strong>in</strong>fluss hat die Trägerlandschaft vor Ort<br />
auf die Hilfegewährungs– <strong>und</strong> Belegungspraxis<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zukunft von JuBB…<br />
Erweiterung <strong>der</strong> Datengr<strong>und</strong>lage mit dem<br />
Ziel, alle relevanten Daten für e<strong>in</strong>e<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>planung zu erfassen<br />
Zusammenführung mit PeB<br />
(Personalbemessung <strong>der</strong> Jugendämter <strong>in</strong><br />
Bayern)<br />
Teil <strong>des</strong> Qualitätsentwicklungsprozesses<br />
nach § 79a SGB VIII<br />
106
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zukunft von JuBB…<br />
JuBB als fester Teil <strong>des</strong><br />
Managementkreislaufes <strong>des</strong><br />
Jugendamtes<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
JuBB <strong>und</strong> PEB als<br />
Datengr<strong>und</strong>lage<br />
(Fallzahlen,<br />
Kosten,<br />
Personal…)<br />
107
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Voraussetzung<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
• JuBB wird als Aufgabe <strong>des</strong> JA‘s ver<strong>in</strong>nerlicht,<br />
gefor<strong>der</strong>t <strong>und</strong> geför<strong>der</strong>t<br />
• JuBB ist den politischen Entscheidungsträgern<br />
<strong>und</strong> dem JHA zugänglich<br />
• JuBB erfährt Unterstützung <strong>der</strong> politischen<br />
Entscheidungsträger<br />
• JuBB wird nicht alle<strong>in</strong>e aus Gründen <strong>der</strong><br />
Kostenreduktion betrieben<br />
• JuBB wird als Qualitätsentwicklungs<strong>in</strong>strument<br />
gesehen<br />
Ansprechpartner<br />
JuBBerater<br />
im Bayerischen Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Zentrum Bayern<br />
Familie <strong>und</strong> <strong>Sozial</strong>es<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>jugendamt<br />
Grit Hradetzky<br />
(grit.hradetzky@zbfs-blja.bayern.de, 089-1261-2269)<br />
Hans Re<strong>in</strong>fel<strong>der</strong><br />
(hans.re<strong>in</strong>fel<strong>der</strong>@zbfs-blja.bayern.de, 089-1261-2281)<br />
108
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Landrätetagung am 17./18.10.2012:<br />
<strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong><br />
Innovationsr<strong>in</strong>g /<br />
Vergleichsr<strong>in</strong>ge:<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen aus <strong>der</strong> Sicht<br />
<strong>des</strong> Controll<strong>in</strong>gs am Praxisbeispiel<br />
Landkreis Ebersberg<br />
©Brigitte Keller Folie 1<br />
Ausgangssituation im Ebersberger<br />
Jugendamt<br />
In den letzten 10 Jahren wurden Organisationsmodelle<br />
angewandt, mit e<strong>in</strong>er Dreiteilung <strong>und</strong> Zweiteilung <strong>des</strong><br />
Jugendamtes.<br />
Diese Modelle s<strong>in</strong>d gescheitert, 2011 kehrte EBE zur <strong>Steuerung</strong><br />
EINES Jugendamtes mit e<strong>in</strong>er Jugendamtsleitung zurück.<br />
Bisher ist das Budget <strong>des</strong> Ebersberger Jugendamtes steigend<br />
<strong>und</strong> schwer steuerbar.<br />
Von 2005 bis 2012 stiegen die Nettoaufwendungen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> um fast 25 % auf 10,4 Mio Euro. Das ist e<strong>in</strong> Viertel<br />
aller Produktkosten <strong>des</strong> Landkreises.<br />
Gleichzeitig stieg <strong>der</strong> Personale<strong>in</strong>satz von 37 VZ-Kräften auf 42<br />
VZ-Kräfte an, die Personalkosten stiegen um 40 % auf über 2,4<br />
Mio Euro.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 2<br />
109
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Handlungsdruck ist hoch….<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> erprobt <strong>der</strong> Landkreis Ebersberg<br />
laufend weitere Verfahren, <strong>Jugendhilfe</strong> transparenter <strong>und</strong> für die<br />
Politik steuerbar zu machen.<br />
2011 wurden hierzu mehrere Gutachten <strong>in</strong> Auftrag gegeben, die<br />
nun Schritt für Schritt umgesetzt werden.<br />
2011 bis 2013 liegt <strong>der</strong> Schwerpunkt auf <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong><br />
<strong>Steuerung</strong> durch das Jugendamt selbst <strong>und</strong> die Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Entscheidungsgr<strong>und</strong>lagen für die Politik.<br />
Dezentrales <strong>und</strong> zentrales Controll<strong>in</strong>g müssen dabei eng<br />
zusammenarbeiten.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 3<br />
<strong>Jugendhilfe</strong> kostet sehr viel Geld…..<br />
S<strong>in</strong>d wir sicher, dass das, was wir tun, richtig ist?<br />
Zur Beantwortung dieser Frage MÜSSEN wir strategisch<br />
steuern<br />
Nachfolgend werden 2 <strong>Steuerung</strong>sansätze vorgestellt.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 4<br />
110
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
1. <strong>Steuerung</strong>sansatz:<br />
Balanced Scorecard im Jugendamt –<br />
BSC fit gemacht für die Praxis<br />
<strong>Strategische</strong>s Management<br />
Zielfeld „Ergebnisse/ Wirkungen“<br />
„Was wollen wir erreichen?“<br />
Zielfeld „Produkte“<br />
„Was müssen wir tun?“<br />
Zielfeld „Ressourcen“<br />
„Was müssen wir e<strong>in</strong>setzen?<br />
Zielfeld „Prozesse / Strukturen“<br />
„Wie müssen wir es tun?“<br />
Kontrakt mit dem Jugendamt<br />
<strong>Strategische</strong> Ziele <strong>und</strong> Strategien<br />
<strong>des</strong> Jugendamtes<br />
Produktorientierter Haushalt<br />
Zusammenfassung <strong>der</strong> strategischen<br />
Ziele<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 5<br />
1. Schritt: - Ziele <strong>und</strong> Erwartungen<br />
Bereich: Allgeme<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erziehung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie ASD (§ 16 SGB VIII –<br />
Beson<strong>der</strong>heit EBE: wir stellen unsere eigene Beratung <strong>und</strong> Betreuung dar).<br />
Zielfeld „Ergebnisse/ Wirkungen“<br />
„Was wollen wir erreichen?“<br />
1 2<br />
Zielfeld „Produkte“<br />
„Was müssen wir tun?“<br />
Auftragsklärung aus Sicht <strong>des</strong><br />
Bürgers / Bedarfsfeststellung aus<br />
Sicht <strong>der</strong> Fachkraft / Verweis auf<br />
eigene Ressourcen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Unterstützungsmöglichkeiten<br />
Zielfeld „Ressourcen“<br />
„Was müssen wir e<strong>in</strong>setzen?<br />
4<br />
Bei allen Anfragen von Familien<br />
wird <strong>der</strong>en Unterstützungsbedarf<br />
festgestellt<br />
Zielfeld „Prozesse / Strukturen“<br />
„Wie müssen wir es tun?“<br />
3<br />
Personelle Ausstattung auf<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>des</strong> PeB*) –<br />
Personalkosten angepasst an<br />
Jahresarbeitsst<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
Fallzahlen<br />
*) PeB = Personalbemessungsprozess beim<br />
allgeme<strong>in</strong>en <strong>Sozial</strong>dienst<br />
Alle Anfragen werden zeitnah<br />
bearbeitet <strong>und</strong> geprüft, ob<br />
gewichtige Anhaltspunkte bezogen<br />
auf e<strong>in</strong>e akute<br />
K<strong>in</strong><strong>des</strong>wohlgefährdung vorliegen<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 6<br />
111
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
2. Schritt: - Indikatoren, Schlüsselzahlen –<br />
ASD - § 16 SGB VIII<br />
1 2<br />
Zielfeld „Ergebnisse/ Wirkungen“ Zielfeld „Produkte“<br />
„Was wollen wir erreichen?“<br />
„Was müssen wir tun?“<br />
In 30 % <strong>der</strong> Familien (aktuelles IST:<br />
32 %) konnte die Beratung mit<br />
Verweis auf die eigenen<br />
Ressourcen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Hilfsmöglichkeiten außerhalb <strong>der</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> abgeschlossen werden.<br />
Zielfeld „Ressourcen“<br />
„Was müssen wir e<strong>in</strong>setzen?<br />
4<br />
In 100 % aller Anfragen erfolgt e<strong>in</strong>e<br />
Auftrags- <strong>und</strong> Bedarfsklärung<br />
(Fallzahl, Falle<strong>in</strong>gang)<br />
Zielfeld „Prozesse / Strukturen“<br />
„Wie müssen wir es tun?“<br />
3<br />
Nettojahresarbeitsst<strong>und</strong>en<br />
Klientenzeit<br />
In 100 % <strong>der</strong> Fälle erfolgt <strong>der</strong><br />
Erstkontakt <strong>in</strong>nerhalb von 1 Woche.<br />
In 100 % <strong>der</strong> Fälle wird überprüft,<br />
ob e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>des</strong>wohlgefährdung<br />
vorliegt.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 7<br />
Wirkung dieser klaren strategischen<br />
Ausrichtung<br />
Es ist zu erkennen, dass 3 Kontakte ausreichen, um 30 % <strong>der</strong><br />
Fälle abzuschließen.<br />
In dem Umfang, <strong>in</strong> dem es gel<strong>in</strong>gt, diesen %Satz zu<br />
steigern, wird die pädagogische Arbeit im Jugendamt<br />
entlastet <strong>und</strong> es entsteht im Jugendamt ke<strong>in</strong> Fall, damit<br />
auch ke<strong>in</strong>e Kosten.<br />
Bereitschaft zur<br />
Transparenz ist<br />
Voraussetzung<br />
für <strong>Steuerung</strong><br />
Problem: Ebersberg verfügt <strong>der</strong>zeit über ke<strong>in</strong>en „Benchmark“ –<br />
wir wissen nicht, ob 30 % „gut“ o<strong>der</strong> „schlecht“ s<strong>in</strong>d…..<br />
..damit ist es auch schwer, den optimalen Personale<strong>in</strong>satz zu<br />
ermitteln um kosten<strong>in</strong>tensive Hilfen zu vermeiden.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 8<br />
112
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Quelle zum Nachlesen<br />
Auf die beschriebene Art <strong>und</strong> Weise werden – erstmals im<br />
Haushalt 2012 <strong>in</strong>sg. 7 Produkte gesteuert.<br />
http://www.lraebe.de/Landratsamt.aspx?view=/kxp<br />
/orgdata/default&OrgID=05B61B65-<br />
3BB6-4BC3-8A5F-8859423D1022<br />
Das Jugendamt wird ab 2012 mit BSC<br />
gesteuert – im Internet zum Download<br />
Haushalt 2012 – ab Seite 59<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 9<br />
2. <strong>Steuerung</strong>sansatz:<br />
Wie müssen wir unsere Daten aufbereiten?<br />
‣ JUBB wertet nur rückblickend <strong>in</strong> „Jahren“ aus - das ist zu<br />
wenig, denn Personen haben „Karrieren“, vorangegangene<br />
Maßnahmen werden nur unvollständig dargestellt, damit<br />
bleibt folgende Frage unbeantwortet:<br />
„Welche Maßnahme unterstützt den Klienten am<br />
effektivsten?“<br />
Seit September 2012 haben wir <strong>in</strong> OK JUG e<strong>in</strong>e „Eigenentwicklung“<br />
im E<strong>in</strong>satz, jetzt können z.B. folgende Fragen beantwortet werden:<br />
-Was folgt auf die Erziehungsbeistandschaft?<br />
-Wurde die Hilfe tatsächlich beendet o<strong>der</strong> war lediglich die E<strong>in</strong>leitung<br />
e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en Maßnahme notwendig?<br />
Diese Frage beantworten zu können, ist für alle Hilfearten wichtig, um<br />
die Effizienz <strong>der</strong> <strong>in</strong>stallierten Maßnahme beurteilen zu können.<br />
Es ist technisch möglich, jeden Fall auszuwerten, unabhängig<br />
davon, wie lange er <strong>in</strong> welcher Hilfe war.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 10<br />
113
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Beispiel (1)<br />
Auswertung von § 34 Heimerziehung im Zeitraum 1.1.12 bis<br />
13.9.12:<br />
Man sieht, dass dieser Klient seit 2000 Hilfen erhält <strong>und</strong> auch,<br />
wie lange welche Hilfe gewährt wurde. Durch systematische<br />
Auswertungen erhält man e<strong>in</strong> Bild <strong>des</strong> „Erfolgs“ <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Hilfearten.<br />
Bei <strong>der</strong> letzten Hilfegewährung fällt sofort <strong>der</strong> lange<br />
Bewilligungszeitraum auf – 4 (!) Jahre!<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 11<br />
Beispiel (2)<br />
Auswertung „Beendigung <strong>der</strong> Maßnahmen § 30 SGB VIII<br />
(Erziehungsbeistand) zwischen 01/2012 <strong>und</strong> 09/2012 <strong>und</strong> was<br />
folgt auf die Beendigung?<br />
Diese Auswertung zeigt den Erfolg e<strong>in</strong>er Maßnahme auf <strong>und</strong><br />
beantwortet mehrere Fragen:<br />
- In wie viel % <strong>der</strong> Fälle folgt auf die EB ke<strong>in</strong>e Hilfe mehr?<br />
- In wie viel % <strong>der</strong> Fälle müssen weitere SGB VIII Hilfen<br />
aufgesetzt werden?<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 12<br />
114
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Neue Auswertemöglichkeiten <strong>in</strong> OK JUG<br />
Die beschriebenen Beispiele s<strong>in</strong>d für alle Hilfearten möglich,<br />
damit kann (endlich) <strong>der</strong> „Erfolg“ e<strong>in</strong>zelner <strong>in</strong>stallierte r Hilfen<br />
dargestellt werden.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs werden damit die Leistungserbr<strong>in</strong>ger (Jugendamt<br />
selbst aber auch die Träger) transparenter.<br />
Folge: Maßnahmen, die teuer s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> nicht aus <strong>der</strong><br />
<strong>Jugendhilfe</strong> herausführen, müssen überprüft werden.<br />
Landräte müssen diese Transparenz aber auch wollen<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 13<br />
Voraussetzungen für diese <strong>Steuerung</strong><br />
Technisch:<br />
Jasper-Modul für OK.JUG – Kosten e<strong>in</strong>malig 1.500 €,<br />
monatlich 66 €<br />
iReport, Oracle SQL Datenbank <strong>und</strong> Zugriffsrechte darauf<br />
Persönlich:<br />
Sem<strong>in</strong>ar <strong>der</strong> AKDB „Erstellen von e<strong>in</strong>fachen Auswertungen<br />
mit JasperReports <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Integration <strong>in</strong> OK.JUG jug31<br />
Sehr gute SQL-Kenntnisse<br />
Gr<strong>und</strong>legende JAVA-Kenntnisse<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 14<br />
115
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
JUBB <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g<br />
JUBB liefert den Landratsämtern das Datengerüst.<br />
Für e<strong>in</strong>e steuerungsrelevante Nutzung auf Kreisebene<br />
wertet <strong>der</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g die Daten an<strong>der</strong>s aus.<br />
Nutzen entfalten beide Instrumente erst wirklich, wenn<br />
auf Kreisebene Bereitschaft für den Datenaustausch<br />
entsteht – das Benchmark<strong>in</strong>g.<br />
Dabei geht es nicht darum, das „schlechteste<br />
Jugendamt“ zu identifizieren – verglichen wird <strong>der</strong> sog.<br />
„Best Practise“ <strong>und</strong> <strong>der</strong> Median.<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 15<br />
Was brauchen Landräte zur <strong>Steuerung</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Jugendhilfe</strong>?<br />
‣ Dezentrales Controll<strong>in</strong>g im Jugendamt, angesiedelt<br />
unmittelbar bei <strong>der</strong> Jugendamtsleitung (z.B. Stabsstelle)<br />
‣ EDV-Fachwissen im <strong>Jugendhilfe</strong>verfahren<br />
‣ Das Lan<strong>des</strong>jugendamt muss die Clustervergleiche zur<br />
Verfügung stellen, um Vergleiche <strong>der</strong> LK zu för<strong>der</strong>n (so wie<br />
dies <strong>der</strong> Innor<strong>in</strong>g macht). Praxis ist, dass Controller nur<br />
schwer an Informationen an<strong>der</strong>er Landkreise<br />
herankommen <strong>und</strong> oft auch e<strong>in</strong> „Nichtöffentlichkeitsvermerk“<br />
erfolgt – das br<strong>in</strong>gt die Diskussion aber nicht<br />
voran – wir brauchen Öffentlichkeit!<br />
‣ Das Wichtigste: Landräte müssen Benchmark<strong>in</strong>g zulassen!<br />
©Brigitte Keller<br />
Folie 16<br />
116
Arbeitsgruppe 3: <strong>Jugendhilfe</strong>berichtswesen <strong>und</strong> Innovationsr<strong>in</strong>g/Vergleichsr<strong>in</strong>ge<br />
Vielen Dank für Ihre<br />
Aufmerksamkeit!<br />
brigitte.keller@lra-ebe.de<br />
Ich freue mich auf e<strong>in</strong>e<br />
spannende Diskussion<br />
©Brigitte Keller Folie 17<br />
117
Der Bayerische Landkreistag ist e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> vier kommunalen<br />
Spitzenverbände <strong>in</strong> Bayern.<br />
Neben dem Bayerischen Landkreistag s<strong>in</strong>d dies <strong>der</strong> Bayerische Geme<strong>in</strong>detag, <strong>der</strong> Bayerische Städtetag <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verband <strong>der</strong> bayerischen<br />
Bezirke. Die 71 bayerischen Landkreise haben sich freiwillig zu diesem kommunalen Spitzenverband zusammengeschlossen,<br />
<strong>der</strong> gleichzeitig e<strong>in</strong>e Körperschaft <strong>des</strong> öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft ist. Wesentliches Ziel <strong>des</strong> Bayerischen<br />
Landkreistags ist es, die kommunale Selbstverwaltung auf <strong>der</strong> Kreisebene zu sichern <strong>und</strong> zu stärken: Nach außen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
gegenüber dem Gesetzgeber <strong>und</strong> den M<strong>in</strong>isterien, werden die geme<strong>in</strong>samen Interessen <strong>der</strong> bayerischen Landkreise vertreten, nach<br />
<strong>in</strong>nen werden die Mitglie<strong>der</strong> <strong>in</strong>formiert <strong>und</strong> beraten.<br />
Bayerischer Landkreistag<br />
Kard<strong>in</strong>al-Döpfner-Straße 8 - 80333 München<br />
Telefon: +49 (0) 89/286615-0 - Telefax: +49 (0) 89/282821<br />
<strong>in</strong>fo@bay-landkreistag.de - www.bay-landkreistag.de<br />
118