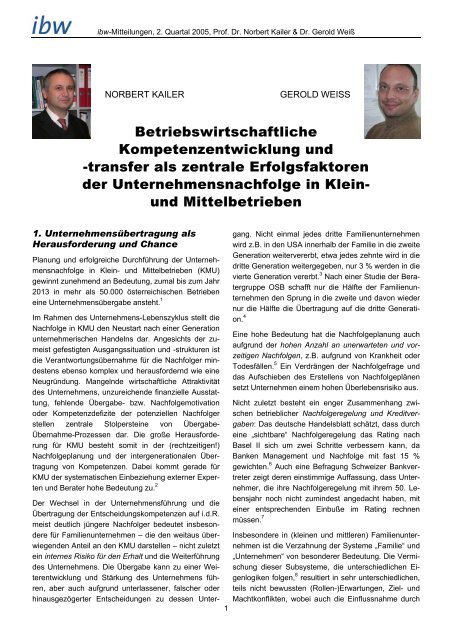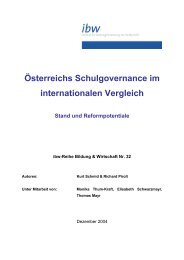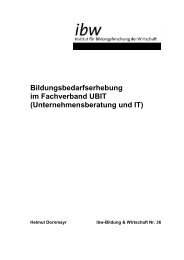transfer als zentrale Erfolgsfaktoren der ... - ibw
transfer als zentrale Erfolgsfaktoren der ... - ibw
transfer als zentrale Erfolgsfaktoren der ... - ibw
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
NORBERT KAILER<br />
GEROLD WEISS<br />
Betriebswirtschaftliche<br />
Kompetenzentwicklung und<br />
-<strong>transfer</strong> <strong>als</strong> <strong>zentrale</strong> <strong>Erfolgsfaktoren</strong><br />
<strong>der</strong> Unternehmensnachfolge in Kleinund<br />
Mittelbetrieben<br />
1. Unternehmensübertragung <strong>als</strong><br />
Herausfor<strong>der</strong>ung und Chance<br />
Planung und erfolgreiche Durchführung <strong>der</strong> Unternehmensnachfolge<br />
in Klein- und Mittelbetrieben (KMU)<br />
gewinnt zunehmend an Bedeutung, zumal bis zum Jahr<br />
2013 in mehr <strong>als</strong> 50.000 österreichischen Betrieben<br />
eine Unternehmensübergabe ansteht. 1<br />
Im Rahmen des Unternehmens-Lebenszyklus stellt die<br />
Nachfolge in KMU den Neustart nach einer Generation<br />
unternehmerischen Handelns dar. Angesichts <strong>der</strong> zumeist<br />
gefestigten Ausgangssituation und -strukturen ist<br />
die Verantwortungsübernahme für die Nachfolger mindestens<br />
ebenso komplex und herausfor<strong>der</strong>nd wie eine<br />
Neugründung. Mangelnde wirtschaftliche Attraktivität<br />
des Unternehmens, unzureichende finanzielle Ausstattung,<br />
fehlende Übergabe- bzw. Nachfolgemotivation<br />
o<strong>der</strong> Kompetenzdefizite <strong>der</strong> potenziellen Nachfolger<br />
stellen <strong>zentrale</strong> Stolpersteine von Übergabe-<br />
Übernahme-Prozessen dar. Die große Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
für KMU besteht somit in <strong>der</strong> (rechtzeitigen!)<br />
Nachfolgeplanung und <strong>der</strong> intergenerationalen Übertragung<br />
von Kompetenzen. Dabei kommt gerade für<br />
KMU <strong>der</strong> systematischen Einbeziehung externer Experten<br />
und Berater hohe Bedeutung zu. 2<br />
1<br />
Der Wechsel in <strong>der</strong> Unternehmensführung und die<br />
Übertragung <strong>der</strong> Entscheidungskompetenzen auf i.d.R.<br />
meist deutlich jüngere Nachfolger bedeutet insbeson<strong>der</strong>e<br />
für Familienunternehmen – die den weitaus überwiegenden<br />
Anteil an den KMU darstellen – nicht zuletzt<br />
ein internes Risiko für den Erhalt und die Weiterführung<br />
des Unternehmens. Die Übergabe kann zu einer Weiterentwicklung<br />
und Stärkung des Unternehmens führen,<br />
aber auch aufgrund unterlassener, f<strong>als</strong>cher o<strong>der</strong><br />
hinausgezögerter Entscheidungen zu dessen Untergang.<br />
Nicht einmal jedes dritte Familienunternehmen<br />
wird z.B. in den USA innerhalb <strong>der</strong> Familie in die zweite<br />
Generation weitervererbt, etwa jedes zehnte wird in die<br />
dritte Generation weitergegeben, nur 3 % werden in die<br />
vierte Generation vererbt. 3 Nach einer Studie <strong>der</strong> Beratergruppe<br />
OSB schafft nur die Hälfte <strong>der</strong> Familienunternehmen<br />
den Sprung in die zweite und davon wie<strong>der</strong><br />
nur die Hälfte die Übertragung auf die dritte Generation.<br />
4<br />
Eine hohe Bedeutung hat die Nachfolgeplanung auch<br />
aufgrund <strong>der</strong> hohen Anzahl an unerwarteten und vorzeitigen<br />
Nachfolgen, z.B. aufgrund von Krankheit o<strong>der</strong><br />
Todesfällen. 5 Ein Verdrängen <strong>der</strong> Nachfolgefrage und<br />
das Aufschieben des Erstellens von Nachfolgeplänen<br />
setzt Unternehmen einem hohen Überlebensrisiko aus.<br />
Nicht zuletzt besteht ein enger Zusammenhang zwischen<br />
betrieblicher Nachfolgeregelung und Kreditvergaben:<br />
Das deutsche Handelsblatt schätzt, dass durch<br />
eine „sichtbare“ Nachfolgeregelung das Rating nach<br />
Basel II sich um zwei Schritte verbessern kann, da<br />
Banken Management und Nachfolge mit fast 15 %<br />
gewichten. 6 Auch eine Befragung Schweizer Bankvertreter<br />
zeigt <strong>der</strong>en einstimmige Auffassung, dass Unternehmer,<br />
die ihre Nachfolgeregelung mit ihrem 50. Lebensjahr<br />
noch nicht zumindest angedacht haben, mit<br />
einer entsprechenden Einbuße im Rating rechnen<br />
müssen. 7<br />
Insbeson<strong>der</strong>e in (kleinen und mittleren) Familienunternehmen<br />
ist die Verzahnung <strong>der</strong> Systeme „Familie“ und<br />
„Unternehmen“ von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. Die Vermischung<br />
dieser Subsysteme, die unterschiedlichen Eigenlogiken<br />
folgen, 8 resultiert in sehr unterschiedlichen,<br />
teils nicht bewussten (Rollen-)Erwartungen, Ziel- und<br />
Machtkonflikten, wobei auch die Einflussnahme durch
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
Familienangehörige ohne formelle Rolle im Unternehmen<br />
in Betracht zu ziehen ist. 9 Daraus resultieren einige<br />
typische Nachfolgeprobleme: Wenn z.B. trotz fehlen<strong>der</strong><br />
Nachfolgemotivation ausschließlich auf die Variante<br />
Nachfolge aus <strong>der</strong> Familie gesetzt wird, o<strong>der</strong><br />
wenn trotz erkennbarer Kompetenzdefizite <strong>der</strong> potenziellen<br />
Nachfolger keine entsprechenden Maßnahmen<br />
zur Kompetenzentwicklung noch vor <strong>der</strong> Übernahme<br />
eingeleitet werden, kann dies eine große Bedrohung für<br />
das Überleben des Unternehmens darstellen.<br />
Ein Großteil <strong>der</strong> Familienunternehmen weist aufgrund<br />
<strong>der</strong> geringen Mitarbeiterzahl eine einfache Struktur<br />
ohne tiefe vertikale und horizontale Glie<strong>der</strong>ung auf.<br />
Aufbau- und Ablauforganisation sind mit sowie um den<br />
Unternehmer gewachsen. Trotz Routine und Erfahrung<br />
ist auch die operative Aufgabenbelastung <strong>der</strong> Unternehmer<br />
sehr hoch, Führungsaufgaben und strategische<br />
Planung werden aufgrund <strong>der</strong> „Dominanz des Tagesgeschäftes“<br />
nicht selten vernachlässigt o<strong>der</strong> aufgeschoben.<br />
Unbürokratisches, flexibeles Agieren kann<br />
durchaus <strong>als</strong> wesentliche Stärke von KMU gesehen<br />
werden. Der damit häufig verbundene Mangel an Delegation<br />
und die fehlende Klärung von Kompetenz- und<br />
Aufgabenverteilung stellen beim Ausscheiden <strong>der</strong> (Pionier)-Unternehmer<br />
jedoch eine Problem dar. 10 Insbeson<strong>der</strong>e<br />
stellt sich dabei die Herausfor<strong>der</strong>ung, die<br />
Branchenerfahrung, das in jahrelanger Zusammenarbeit<br />
bewährte soziale und wirtschaftliche Netzwerk<br />
sowie das in <strong>der</strong> Person des Übergebers begründete<br />
Vertrauen und Reputation auf Nachfolger zu übertragen.<br />
2. Ergebnisse einer Befragung potenzieller<br />
ÜbergeberInnen<br />
Der Übergabe-Übernahme-Prozess in oberösterreichischen<br />
KMU wurde 2004 durch eine schriftliche Befragung<br />
potenzieller Übergeber mit über 49 Jahren untersucht<br />
(n = 191). 11 Dabei standen die Bedeutung externer<br />
Personen bzw. Institutionen im Übergabeprozess,<br />
die Gestaltung des Nachfolgeprozesses sowie <strong>der</strong> Informations-<br />
und Beratungsbedarf <strong>der</strong> zu übergebenden<br />
Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses.<br />
Größte Problemfel<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Unternehmensübergabe<br />
Nachfolger-Aufbau<br />
Recht/Steuern<br />
Zusätzliche Belastung<br />
Verbindung neu/alt<br />
Strukturell./technolog. Wandel<br />
Zu späte Planung<br />
Bereitschaft Führung abzugeben<br />
Beratungskosten<br />
Unterschiedl. Kaufpreisvorstellung<br />
Konflikte mit Nachfolger<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%<br />
Übergabe nicht begonnen<br />
Übergabe begonnen<br />
Abb.1: Problemfel<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Unternehmensübertragung<br />
2
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
Der Großteil <strong>der</strong> befragten Unternehmer (ca. 90%)<br />
berichtet von Problemen im Nachfolgeprozess (Abb. 1):<br />
Die Hälfte <strong>der</strong> übergabeinteressierten Unternehmer<br />
bezeichnet den Nachfolgeraufbau <strong>als</strong> Schwierigkeit.<br />
Ein Drittel berichtet von rechtlichen und steuerlichen<br />
Problemen. Jeweils knapp 30% sehen die administrative<br />
Belastung bzw. generell den strukturelltechnologischen<br />
Wandel <strong>als</strong> große Probleme. Jeweils<br />
knapp mehr <strong>als</strong> ein Fünftel nennen Probleme im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> Verbindung mit neuen Strategien,<br />
unterschiedliche Preisvorstellungen, zu späte Nachfolgeplanung,<br />
die mangelnde Bereitschaft, Kompetenzen<br />
an den Nachfolger abzugeben, sowie die Höhe <strong>der</strong><br />
Beratungskosten.<br />
Wichtigste externe Unterstützungseinrichtungen<br />
Steuerberater<br />
79%<br />
Wirtschaftskammer<br />
57%<br />
Anwalt/Notar<br />
31%<br />
Unternehmensberater<br />
31%<br />
Kreditinstitute<br />
30%<br />
Finanzamt<br />
25%<br />
Stadt/Gemeinde/Magistrat<br />
8%<br />
An<strong>der</strong>e Unternehmer<br />
8%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%<br />
Abb. 2: Unterstützungseinrichtungen bei <strong>der</strong> Unternehmensübergabe<br />
Das Beiziehen externer Berater stellt aus Unternehmersicht<br />
einen wesentlichen Erfolgsfaktor für Unternehmensnachfolgen<br />
dar. Fast alle Befragten (92%)<br />
nehmen externe Hilfe beim Übergabeprozess in Anspruch.<br />
Am häufigsten wurden Steuerberater beigezogen,<br />
gefolgt von Wirtschaftskammer, Rechtsanwälten<br />
und Notaren. Der Erfahrungsaustausch mit an<strong>der</strong>en<br />
Unternehmern wird hingegen (noch) selten genannt<br />
(Abb. 2).<br />
3
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
Wichtigste Informations- und Beratungsbedarfe zur Nachfolgefrage aus<br />
Übergebersicht<br />
Infos zu organisat. Nachfolgeabwicklung<br />
54%<br />
Steuerrecht<br />
37%<br />
Finanzierung und Haftung<br />
36%<br />
Alternative Nachfolgemodelle<br />
34%<br />
Gewerbe-/Gesellschaftsrecht<br />
32%<br />
Sozialversicherung<br />
27%<br />
Hilfe bei Nachfolgersuche<br />
23%<br />
Öffentliche För<strong>der</strong>mittel<br />
17%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%<br />
Abb.3: Informations- und Beratungsbedarfe aus Übergebersicht<br />
Bei Unternehmen, in denen <strong>der</strong> Nachfolgeprozess bereits<br />
im Gange ist, stehen konkrete Informations- und<br />
Beratungsbedarfe hinsichtlich <strong>der</strong> organisatorischen<br />
Abwicklung von Unternehmensnachfolgen sowie steuerliche<br />
Fragen im Vor<strong>der</strong>grund. Bedarfe hinsichtlich<br />
alternativer Nachfolgemodelle werden deutlich seltener<br />
genannt. Dies zeigt, dass gerade in KMU die familieninterne<br />
Nachfolge bevorzugt wird und bei vielen Unternehmern<br />
ein Unternehmensverkauf (vorerst) nicht in<br />
Betracht gezogen wird. Ist dagegen eine Übergabe an<br />
Externe beabsichtigt, liegt die Beratungsbedarf hinsichtlich<br />
alternativer Nachfolgemodelle, organisatorischer<br />
Abwicklung und Unterstützung bei <strong>der</strong> Nachfolgersuche<br />
deutlich höher (Abb. 3). Deshalb wird im Folgenden<br />
speziell auf ausgewählte Problemfel<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Unternehmensübertragung eingegangen. Diese geäußerten<br />
Bedarfe gewinnen noch an Bedeutung, wenn<br />
man sich vor Augen führt, dass <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> außerfamiliären<br />
Unternehmensübertragung seit Jahren<br />
kontinuierlich steigt.<br />
3. Alternative Nachfolgemodelle in<br />
<strong>der</strong> Praxis<br />
4<br />
Wird das Unternehmen nicht in <strong>der</strong> Familie übertragen,<br />
stehen alternativ u.a. die unternehmensinterne Übergabe<br />
an Mitarbeiter, <strong>der</strong> Verkauf des Unternehmens,<br />
die unentgeltliche Übertragung gegen laufende Zahlungen<br />
in <strong>der</strong> Zukunft, die Betriebsverpachtung, die<br />
Fusion und die Einbringung in eine Stiftung zur Verfügung.<br />
Im Folgenden wird dabei auf die in KMU am häufigsten<br />
gewählten Alternativen <strong>der</strong> unternehmensinternen<br />
Übergabe sowie des Verkaufes des Unternehmens<br />
eingegangen.<br />
3.1. Unternehmensinterne Übernahme<br />
durch Mitarbeiter<br />
Vielfach wird seitens <strong>der</strong> Firmeninhaber eine Übernahme<br />
durch kompetente Mitarbeiter des Unternehmens<br />
bevorzugt, z.B. um eine (Konzern-) Unabhängigkeit<br />
des Unternehmens zu gewährleisten. 12 Da Mitarbeiter<br />
<strong>als</strong> potenzielle Eigentümer nur selten über genügend<br />
Eigenkapital verfügen, wird in vielen Fällen die<br />
Finanzierung darauf gegründet, dass sich <strong>der</strong> Kaufpreis<br />
durch das Unternehmen im Laufe <strong>der</strong> Jahre selbst a-<br />
mortisiert (Leverage-Buyout). Die Finanzierung wird<br />
durch Vermögen und zukünftige Erträge des Unternehmens<br />
gedeckt.<br />
Für eine unternehmensinterne Übergabe stehen dem<br />
Unternehmer <strong>als</strong> Möglichkeiten ein Management Buy
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
Out (MBO), Buy In Management Buy Out (BIMBO),<br />
Owner Buy Out (OBO) und Employee Buy Out (EBO)<br />
zur Verfügung.<br />
3.2. Unternehmensverkauf an Dritte<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Übernehmensübertragung ist für beide<br />
Parteien eine Reihe von Problemen zu lösen:<br />
Das Finden von Käufern, die den bestmöglichen Preis<br />
zu zahlen bereit sind, ist nicht nur für Unternehmen mit<br />
Problemen und schlechter Rentabilität schwierig. 13 In<br />
Frage kommen in vielen Fällen zunächst strategische<br />
Käufer, welche ihre eigene Marktposition verbessern<br />
wollen. Üblicherweise stammen diese aus <strong>der</strong>selben<br />
o<strong>der</strong> einer ähnlichen Branche und erhoffen sich dadurch<br />
positive Synergieeffekte, zusätzliche Marktanteile<br />
o<strong>der</strong> verbesserte Umstrukturierungsmöglichkeiten <strong>der</strong><br />
Unternehmensteilbereiche. 14 Attraktive Synergien können<br />
etwa im Einkauf, Vertrieb, Produktion, Verwaltung<br />
o<strong>der</strong> Unternehmensführung entstehen.<br />
Zunächst stellt sich – abgesehen von <strong>der</strong> Suche nach<br />
potenziell geeigneten Käufern, Kontaktherstellung und<br />
Explorierung des Kaufinteresses – das Problem <strong>der</strong><br />
Kaufpreisfindung. Häufig existiert gerade in KMU nur<br />
eine sehr rudimentäre Vorstellung über den erzielbaren<br />
Verkaufspreis. Zweckmäßig ist in diesem Falle die<br />
Durchführung einer exakten Unternehmensbewertung.<br />
Dabei werden bei KMU in <strong>der</strong> Praxis die Substanzwertermittlung,<br />
die Ertragswertermittlung, die Discounted-<br />
Cash-Flow-Methode und die Multiplikatormethode am<br />
häufigsten angewendet. 15<br />
Ein weiteres Problem entsteht im Zuge <strong>der</strong> Verkaufsverhandlungen,<br />
sobald beide Parteien die geeignete<br />
Form <strong>der</strong> Übertragung zu bestimmen haben. Üblicherweise<br />
wird <strong>der</strong> Verkäufer einen Anteilsverkauf (Share<br />
Deal), <strong>der</strong> Käufer hingegen einen Vermögensverkauf<br />
(Asset Deal) bevorzugen.<br />
Zu berücksichtigen sind auch die einkommenssteuerliche<br />
Belastung sowie durch die Übertragung entstehende<br />
Haftungsrisken (z.B. Geschäftsverbindlichkeiten,<br />
Steuer, Sozialversicherung, Arbeitnehmeransprüche).<br />
Der Ablauf einer Unternehmensveräußerung unterliegt<br />
keinen festen gesetzlichen Bestimmungen, folgt jedoch<br />
in vielen Fällen folgendem Muster: 16<br />
potenzielle Erwerber zunächst, keine Informationen an<br />
Dritte weiterzugeben bzw. im eigenen Interesse auszunutzen.<br />
Vertrauliche betriebsinterne Daten werden<br />
seitens des Verkäufers zunächst eher spärlich bekannt<br />
gegeben, da im Falle gescheiterter Verhandlungen u.U.<br />
Konkurrenten davon profitieren könnten.<br />
Im Letter of Intent (LOI) werden wesentliche Basispunkte<br />
des geplanten Verkaufs bzw. Kaufs festgehalten.<br />
Diese vorvertragsähnliche und i.d.R. einseitige<br />
Erklärung ist verhandlungspsychologisch wichtig und<br />
zeigt das ernsthafte Interesse, einen Vertragsabschluss<br />
herbeiführen zu wollen. Die Heads of Agreement<br />
(HOA) und das Memorandum of Un<strong>der</strong>standing (MOU)<br />
sind weitere rechtlich unverbindliche Nie<strong>der</strong>schriften.<br />
Ihr Hauptzweck liegt darin, dass jene Punkte, in denen<br />
während <strong>der</strong> langwierigen Verhandlungen bereits eine<br />
Einigung erzielt wurde, festgehalten sowie offene Themengebiete<br />
aufgezeigt werden.<br />
Optionen und Vorverträge sind rechtlich verbindliche<br />
Gestaltungsmittel. Im Rahmen einer Option hat <strong>der</strong><br />
Vertragspartner das Recht, den Vertragsabschluss<br />
durch einseitige Erklärung herbeizuführen. Der Vorvertrag<br />
führt zum Abschluss des Hauptvertrages. Es sollte<br />
jedoch beachtet werden, dass Optionen und Vorverträge,<br />
welche zu einem sehr frühen Zeitpunkt <strong>der</strong> Verhandlungen<br />
abgeschlossen werden, im weiteren Verlauf<br />
etwaige Zwischenvereinbarungen sehr einschränken<br />
können. 17<br />
Die Due Diligence Prüfung stellt mittlerweile einen wesentlichen<br />
Bestandteil einer sorgfältig durchgeführten<br />
Unternehmenstransaktion dar. Der Begriff Due Diligence<br />
stammt ursprünglich aus dem anglo-amerikanischen<br />
Rechtswesen und bedeutet wörtlich „mit gebühren<strong>der</strong><br />
und angemessener Sorgfalt.“ 18 Für das Due Diligence<br />
Verfahren gibt es keine rechtlichen Grundlagen. Viele<br />
Anwen<strong>der</strong> orientieren sich an Checklisten und vorgefertigten<br />
Formularen. 19 Dem potenziellen Übernehmer<br />
wird im Rahmen <strong>der</strong> Due Diligence Prüfung die Möglichkeit<br />
eingeräumt, systematisch Chancen und Risiken<br />
des zu übernehmenden Unternehmens während <strong>der</strong><br />
laufenden Kaufverhandlungen zu untersuchen. Der<br />
Verkäufer verpflichtet sich, dem Kaufinteressenten alle<br />
wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um<br />
Informationsasymmetrien zu beseitigen.<br />
In einem ersten Schritt – <strong>der</strong> Vertraulichkeits- o<strong>der</strong><br />
Geheimhaltungsvereinbarung – verpflichtet sich <strong>der</strong><br />
5
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
Strategic Due Diligence<br />
Basic Due Diligence<br />
Grundsätzliche Unternehmensdaten<br />
Geschichte<br />
Allgemeines<br />
Geschäftspolitische Ziele und Gesamtstrategie<br />
External Due Diligence<br />
Volkswirtsch. Analysen<br />
rechtl. und polit. Rahmenbedingungen<br />
Sozio-demografische Daten<br />
Financial<br />
Environmental<br />
Due<br />
Due<br />
Diligence<br />
Human<br />
Legal &<br />
Diligence<br />
Resource<br />
Tax<br />
Due<br />
Due<br />
Marketing<br />
Diligence<br />
Diligence<br />
Organizational & IT<br />
Due<br />
Due<br />
Diligence<br />
Diligence<br />
Abb. 5: Formen <strong>der</strong> Due Diligence Prüfung<br />
Da <strong>der</strong> Veräußerer des Unternehmens nach dem Verkauf<br />
in <strong>der</strong> Regel keine Einflussmöglichkeiten auf den<br />
künftigen Unternehmenserfolg mehr hat, muss er den<br />
von ihm geschaffenen Unternehmenswert festlegen,<br />
um eine adäquate Gegenleistung zu erhalten. Ausgehend<br />
von einem rechnerischen Unternehmenswert<br />
werden im Zuge von Verhandlungen zwischen Käufer<br />
und Verkäufer Preisän<strong>der</strong>ungen vorgenommen. 20 Entdeckte<br />
Risiken werden in die Kaufpreisverhandlungen<br />
miteinbezogen und Unsicherheitsfaktoren durch Garantien<br />
abgesichert. 21<br />
Bei <strong>der</strong> Vertragsgestaltung und somit beim Vertragsabschluss<br />
ist die Konsultierung eines Rechtsanwalts zu<br />
empfehlen, da bereits im Vorfeld des Vertragsabschlusses<br />
vorvertragliche Schutz-, Aufklärungs- und<br />
Sorgfaltspflichten, welche bei Verletzung zu Schadenersatzansprüchen<br />
führen können, existieren. Dies erklärt<br />
auch, warum Rechtsanwälte und Notare aus Ü-<br />
6<br />
bergebersicht zu den wichtigsten externen Experten<br />
gehören (Abb. 2).<br />
4. Gestaltung <strong>der</strong> Kompetenzentwicklung<br />
<strong>als</strong> <strong>zentrale</strong>r Erfolgsfaktor<br />
in Übergabe-Übernahme-Prozessen<br />
Die hohe Bedeutung <strong>der</strong> Unternehmerkompetenz für<br />
den Unternehmenserfolg ist vielfach durch Studien<br />
belegt. Damit stellt sich <strong>als</strong> <strong>zentrale</strong> Frage: Wie sind<br />
Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung für (potenzielle)<br />
Übergeber und Übernehmer zu gestalten, dass sie<br />
konkrete Planungs- und Umsetzungsaktivitäten för<strong>der</strong>n?<br />
In Kap. 3 wurde eine Reihe betriebswirtschaftlichpsychologischer<br />
Fragestellungen aufgezeigt, die sich<br />
im Zuge einer Nachfolgeplanung sowohl Übergeber <strong>als</strong><br />
auch potenziellen Übernehmern stellen. Das Problem<br />
wird dadurch verschärft, dass ein großer Anteil dieser<br />
Fragen nur im Zuge <strong>der</strong> Nachfolgeplanung auftritt, d.h.
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
dass i.d.R. kaum auf unternehmensinterne Erfahrungen<br />
zurückgegriffen werden kann. Dies unterstreicht die<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Einbeziehung externer Fach- und Prozessexperten<br />
und damit <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Beratungs-<br />
und Beteiligungskompetenz: Geht man vom<br />
einem Beratungsmodell <strong>der</strong> individuellen Prozessbegleitung<br />
über den gesamten mehrjährigen Nachfolgeprozess<br />
hinweg aus, gewinnen beratungsmethodische,<br />
sozial-kommunikative und personale Kompetenzen<br />
markant an Bedeutung. Gerade in diesen Bereichen<br />
werden aber bei KMU-Beratern deutliche Defizite festgestellt.<br />
22 Deshalb werden entsprechende Kompetenzentwicklungsmaßnahmen<br />
für Trainer und Berater <strong>als</strong><br />
zentral wichtig erachtet. 23 Zur Erhöhung des Beratungserfolges<br />
müssen quasi spiegelbildlich auch Maßnahmen<br />
bei <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Beteiligungskompetenz<br />
24 <strong>der</strong> Übergeber und Übernehmer ansetzen.<br />
Die Planungs- und Entscheidungsprozesse bei Unternehmensübertragungen<br />
verteilen sich (idealerweise)<br />
über einen mehrjährigen Zeitraum. Dabei stehen phasenspezifisch<br />
unterschiedliche unternehmerische Fragestellungen<br />
im Vor<strong>der</strong>grund, die entsprechende Kompetenzen<br />
erfor<strong>der</strong>n. 25<br />
4.1. Phase <strong>der</strong> Planung und Vorbereitung<br />
bis zur erfolgten Übernahme<br />
Da die persönliche Entscheidung, die Unternehmerlaufbahn<br />
einzuschlagen und ein Unternehmen zu übernehmen<br />
bzw. die Nachfolge im Familienunternehmen<br />
anzutreten, <strong>als</strong> langdauern<strong>der</strong> Entscheidungsprozess<br />
angesehen werden kann, dient personzentriertes Coaching<br />
in dieser Phase <strong>der</strong> Reflexion <strong>der</strong> persönlichen<br />
Nachfolgeentscheidung, <strong>der</strong>en Auswirkungen auf das<br />
mikrosoziale Umfeld, <strong>der</strong> Klärung persönlicher und<br />
geschäftlicher Ziele, <strong>der</strong> realistischen Einschätzung<br />
eigener Kompetenzen und dem Erkennen und Bearbeiten<br />
potenzieller Konfliktfel<strong>der</strong> in Familie und Unternehmen.<br />
26 Seminaristische Weiterbildungsangebote dienen<br />
zur Vorbereitung auf die Ablegung notwendiger Zulassungsprüfungen.<br />
Über Fachlehrgänge hinaus (bzw. in<br />
diese integriert) sind insbeson<strong>der</strong>e Angebote zur Weiterentwicklung<br />
von „soft skills“ (Verhandlungs- und<br />
Präsentationstechnik, Selbstorganisation, Führung von<br />
Mitarbeitern, Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit<br />
stakehol<strong>der</strong>s, Selbstmarketing) von Bedeutung.<br />
Von hoher Bedeutung ist externe Unterstützung insbeson<strong>der</strong>e<br />
im Zuge <strong>der</strong> Unternehmensbewertung und <strong>der</strong><br />
7<br />
Vertragsverhandlungen bis hin zur konkreten Ausgestaltung<br />
<strong>der</strong> Verträge.<br />
Da ein erheblicher Teil <strong>der</strong> Nachfolger beabsichtigt,<br />
deutliche Verän<strong>der</strong>ungen in Geschäftskonzept, maschineller<br />
Ausstattung, Produktpalette usw. vorzunehmen,<br />
27 sind bereits in dieser Phase Unterstützungsangebote<br />
hinsichtlich Marktforschung, Strategieentwicklung<br />
und Kontakten zu Kapitalgebern von Bedeutung.<br />
4.2. Entwicklungsphase nach erfolgter<br />
Übernahme<br />
Gerade die Phase nach <strong>der</strong> Übernahme birgt ein erhebliches<br />
betriebswirtschaftliches Gefahrenpotenzial.<br />
Die auftretenden Übergangsprobleme sind oft psychologisch<br />
begründet (kein echtes „Loslassen“ <strong>der</strong> Übergeber,<br />
Vermeiden klarer Kompetenzregelungen, fehlende<br />
Akzeptanz <strong>der</strong> Übernehmer im Unternehmen,<br />
Verunsicherung langjähriger Mitarbeiter durch geän<strong>der</strong>ten<br />
Führungsstil etc.). 28 Es kann auch eine notwendige<br />
Neuorientierung des Unternehmens und seiner Beziehungen<br />
zu langjährigen Kunden und Lieferanten unterbleiben<br />
o<strong>der</strong> umgekehrt zu radikal durchgeführt werden.<br />
Trotz <strong>der</strong> aufgrund <strong>der</strong> Dominanz des Tagesgeschäftes<br />
zu beobachtenden Seminarabstinenz <strong>der</strong> Nachfolger ist<br />
diese Phase <strong>als</strong> äußerst lernintensiv zu bezeichnen. So<br />
werden für die Zukunft des Unternehmens <strong>zentrale</strong><br />
Entscheidungen getroffen, Strukturen, Routinen und<br />
Kontaktnetze werden verän<strong>der</strong>t, und aus den Auswirkungen<br />
<strong>der</strong> täglich zu treffenden geschäftlichen Entscheidungen<br />
wird gelernt (o<strong>der</strong> auch nicht!). Im laufenden<br />
Geschäftsbetrieb tauchen aufgrund von „Lernen<br />
aus Fehlern“ und „learning by doing“ neue Perspektiven<br />
und Problemfel<strong>der</strong> auf: Kundensuche und -<br />
bindung, die persönliche Work-Life-Balance, 29 die Suche<br />
nach geeignetem neuen Personal, die Führung von<br />
übernommenen und neuen Mitarbeitern, sowie <strong>der</strong><br />
Sicherung des Lebensunterhaltes werden weitaus häufiger<br />
<strong>als</strong> bei Neugrün<strong>der</strong>n <strong>als</strong> Probleme genannt. 30 Es<br />
besteht die Gefahr „strategischer Kurzsichtigkeit“: 31<br />
Anstatt erfolgversprechende(re) Handlungsfel<strong>der</strong> und<br />
Entscheidungsalternativen systematisch zu explorieren,<br />
werden bisher erfolgreiche Strategien perpetuiert, was<br />
langfristig zu einer suboptimalen Strategie führt. Reflexionssitzungen<br />
mit Coaches dienen hier dazu, die<br />
Auswirkungen unterschiedlicher Entscheidungen und<br />
<strong>der</strong>en Ursachen klarer herauszuarbeiten, um zukünftige<br />
Entscheidungen fundierter treffen zu können. Dies
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
weist auf die hohe Bedeutung von längerfristig angelegten<br />
integrierten Trainings- und Beratungsprogrammen<br />
hin. 32<br />
Literatur:<br />
BALLARINI, K./KEESE, D.: Generationenwechsel in<br />
Baden-Württemberg – Zum richtigen Zeitpunkt den<br />
richtigen Nachfolger ins Spiel bringen, L-Bank Staatsbank<br />
für Baden-Württemberg (Hrsg.), Mannheim 2002.<br />
BIRLEY, S.: Succession in the family firm: The inheritor`s<br />
view, in: Aronoff C./Ward, J. (eds): Family Business<br />
Sourcebook, Detroit (3 rd ed.), 2002.<br />
BMWA - EUROPÄISCHES FORUM IM RAHMEN DER<br />
KONZERTIERTEN AKTION: BMwA – Bundesministerium<br />
für wirtschaftliche Angelegenheiten (Hrsg.), "Unterstützungsmaßnahmen<br />
für KMU" - KMU in <strong>der</strong><br />
Wachstumsphase - Schlüsselfaktoren zur Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit, Wien 1998.<br />
BÖHM-BEZING, C.: Unternehmensnachfolge aus <strong>der</strong><br />
Sicht <strong>der</strong> Bank, in: Kappler, E./Laske, S. (Hrsg.), Unternehmernachfolge<br />
im Familienbetrieb, Freiburg,<br />
1999.<br />
BRUG, J. VAN DER/LOCHER, K.: Unternehmen Lebenslauf,<br />
Stuttgart 1997.<br />
HALTER, F.: Kreditvergabe und Bankenrating in <strong>der</strong><br />
Schweiz, in: IGA – Zeitschrift für Klein- und Mittelunternehmen<br />
(Internationales Gewerbearchiv), 51. Jg., Heft<br />
2/2003, S. 95 – 108.<br />
HEIDINGER, F./ALBESEDER, W.: Due Diligence, ein<br />
Handbuch für die Praxis, Wien 2001.<br />
HEINTEL, P.: Managementprobleme eines Familienunternehmens,<br />
in: Nagel R. (Hrsg.), Consulting 1994,<br />
Wien 1993, S. 128 – 145.<br />
HENNERKES, B.H.: Familienunternehmen sichern und<br />
optimieren, Frankfurt 1998.<br />
HEYSE, V./SCHEPANSKI, N.: Kompetenzsicherung in<br />
<strong>der</strong> Unternehmensnachfolge – Erkenntnisse, Probleme<br />
und Perspektiven, in: Kailer, N./Walger, G. (Hrsg.),<br />
Perspektiven <strong>der</strong> Unternehmensberatung für kleine und<br />
mittlere Betriebe, Wien 2000, S. 327 - 360.<br />
HOFBAUER, E.: Wachablöse, in: Unternehmer, Heft<br />
1/2001, S. 9 – 12.<br />
IFGH – ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR GE-<br />
WERBE- UND HANDELSFORSCHUNG: Unternehmensübergaben<br />
und –nachfolgen in Österreich (Autoren:<br />
Gavac, K./Kanov, H./Kamptner, I./Mandl,<br />
I./Voithofer, P.), Wien 2002.<br />
DUH, M.: Family Enterprises – Basic Characteristics<br />
and Typology, in: MER Revija za management in razvoj/MER<br />
Journal für Management und Entwicklung,<br />
Vol. 4, Nr. 2002/1, S. 16 – 25.<br />
FACHSENAT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT UND<br />
ORGANISATION DES INSTITUTS FÜR BETRIEBS-<br />
WIRTSCHAFT:Unternehmensbewertung (KFS BW 1 v.<br />
20.12.1989), Wien 1998, S. 1 – 19.<br />
FRANK, H./KORUNKA, C./LUEGER, M.: För<strong>der</strong>nde<br />
und hemmende Faktoren im Gründungsprozess, Wirtschaftsministerium<br />
(Hrsg.), Wien 1999.<br />
GIBB, A.: Training the Trainers for Small Business, in:<br />
Journal of European Industrial Training, Vol. 14,<br />
1990/1, pp. 17 –25.<br />
GLASL, F./LIEVEGOED, B.:Dynamische Unternehmensentwicklung,<br />
Bern u.a. 1993.<br />
HAESELER, H./KROS, F.: Unternehmensbewertung,<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Bewertung von Unternehmen und Beteiligungen,<br />
Wien 2002.<br />
8<br />
KAILER, N.: Unterstützung von Familienunternehmen:<br />
Problembereiche, Bedarfslage und Ansatzpunkte zur<br />
Erhöhung von Effizienz und Effektivität von För<strong>der</strong>maßnahmen,<br />
in: IGA – Zeitschrift für Klein- und Mittelunternehmen<br />
(Internationales Gewerbearchiv), 51. Jg.,<br />
Heft 3, Berlin und St. Gallen 2003, S. 182 – 195.<br />
KAILER, N./FALTER, C.: Sicherung <strong>der</strong> Qualität von<br />
Beratungsprozessen in kleinen und mittleren Unternehmen<br />
– Ergebnisse einer Qualitätsmessung, in: Kailer,<br />
N./Walger, G. (Hrsg.), Wien 2000, S. 129 – 168.<br />
KAILER, N./MERKER, R.: Kompetenzbarrieren und –<br />
defizite in <strong>der</strong> Beratung von Klein- und Mittelunternehmen,<br />
in: Kailer, N./Walger, G., Perspektiven <strong>der</strong> Unternehmensberatung<br />
für kleine und mittlere Betriebe,<br />
Wien 2000, S. 233 – 274.<br />
KAILER, N./WALGER, G. (Hrsg.): Perspektiven <strong>der</strong><br />
Unternehmensberatung für kleine und mittlere Betriebe,<br />
Wien 2000.<br />
KAILER, N./WEISS, G.: Unternehmensnachfolge in<br />
kleinen und mittleren Familienunternehmen in Oberös-
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, 2. Quartal 2005, Prof. Dr. Norbert Kailer & Dr. Gerold Weiß<br />
terreich in: Kailer, N., Schauer, R., Feldbauer-<br />
Durstmüller, B. (Hrsg.), Mittelständische Unternehmen<br />
– Probleme <strong>der</strong> Unternehmensnachfolge, Linz 2005, S.<br />
9-117.<br />
WIMMER, R./DOMAYER, E./OSWALD, M./VATER, G.:<br />
Familienunternehmen – Auslaufmodell o<strong>der</strong> Erfolgstyp?,<br />
Wiesbaden 1996.<br />
KICKINGER, P.: M&A in Österreich – eine empirische<br />
Analyse, Wien 1994.<br />
KMU FORSCHUNG AUSTRIA: Pressemitteilung: Ein<br />
Viertel <strong>der</strong> heimischen Betriebe sucht neue Führung,<br />
Wien, 2004.<br />
KRIENER B., NEUDORFER, E., KÜNZEL, D., AI-<br />
CHINGER, A.: Gesund durchs Arbeitsleben – Empfehlungen<br />
für eine zukunfts- und alternsorientierte betriebliche<br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung in Klein- und Mittelunternehmen,<br />
Wien 2004.<br />
MINETTI, M./BYGRAVE, W.: A dynamic model of enterpreneurial<br />
learning, in: Entrepreneurship Theory and<br />
Practice, Spring 2001, Vol. 25, Issue 3, pp. 5 – 23.<br />
PACK, H.: Due Diligence in: Picot, G. (Hrsg.): Handbuch<br />
Mergers & Acquisitions, Stuttgart 2002, S. 267-<br />
299.<br />
PICHLER, J.H./BORNETT, W.: Wirtschaftliche Bedeutung<br />
<strong>der</strong> kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in<br />
Österreich, in: Kailer, N., Schauer, R., Feldbauer-<br />
Durstmüller, B. (Hrsg.), Mittelständische Unternehmen<br />
– Probleme <strong>der</strong> Unternehmensnachfolge, Wien 2005,<br />
S. 117 – 150.<br />
PICOT, G.: Wirtschaftsrechtliche Aspekte <strong>der</strong> Durchführung<br />
von Mergers & Acquisitions, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
Gestaltung des Transaktionsvertrages, in: Picot, G.<br />
(Hrsg.), Handbuch Mergers & Acquisitions, Stuttgart<br />
2002.<br />
PLEITNER, H. J.: Unternehmerpersönlichkeit und Unternehmensentwicklung,<br />
in: Belak, J./Kajzer, S./Mugler,<br />
J./Senjur, M./Sewing, N./Thommen, J.-P. (Hrsg.), Unternehmensentwicklung<br />
und Management, Zürich<br />
1997, S. 181 – 196.<br />
ROEDL, CHR., ROEDL, B.: Nachfolgeregelung sichert<br />
Finanzierung, in Handelsblatt – Seite R 3, Nr.<br />
234/2004.<br />
SEILER, K.: Unternehmensverkauf, Landsberg/Lech<br />
2000.<br />
VOß, S.: Warranties in Unternehmenskaufverträgen,<br />
Tübingen 2002.<br />
9<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
vgl. KMU Forschung, 2004, S. 1; Pichler/Bornett, 2005,<br />
S. 146ff.<br />
vgl. Kailer/Walger, 2000.<br />
vgl. Birley, 2002.<br />
vgl. Hofbauer, 2001, S. 9.<br />
vgl. IfGH, 2002.<br />
vgl. Rödl/Rödl, 2004, S. R 3.<br />
vgl. Halter, 2004, S. 101.<br />
vgl. Heintel, 1993, 128ff.<br />
vgl. Wimmer u.a., 1996; S. 12ff.; Duh, 2002.<br />
Zur Beschreibung <strong>der</strong> typischen Merkmale <strong>der</strong> Pionierphase<br />
von Unternehmen und ihrer Krisenerscheinungen<br />
anlässlich des Überganges in ihre Organisationsphase<br />
siehe Glasl/Lievegoed, 1993.<br />
vgl. Kailer/Weiß, 2005, S. 25ff.<br />
vgl. Hennerkes, 1998, S. 432.<br />
vgl. Seiler, 2000, S. 10.<br />
vgl. Kickinger, 1994, S. 36.<br />
vgl. Haeseler/Kros, 2002, S. 9; Fachgutachten KFS BW1,<br />
1989, S. 5f.<br />
vgl. Voß, 2002, S. 5ff.<br />
vgl. Picot, 2002, , S. 121.<br />
vgl. Pack, 2002, S. 297.<br />
vgl. Heidinger/Albese<strong>der</strong>, 2001, S. V.<br />
vgl. Boehm-Bezing, 1999, S. 106.<br />
vgl. Voß, 2002, S. 14.<br />
vgl. Kailer/Falter, 2000, S. 129ff.<br />
vgl. Gibb, 1990, S. 20ff.; Hythi, 2002, S. 145ff; Levinson,<br />
1996, S. 527ff.<br />
Zum Konzept <strong>der</strong> Beraterkompetenz und <strong>der</strong> (quasi spiegelbildlichen)<br />
Beteiligungskompetenz <strong>der</strong> Beratungsklienten<br />
vgl. Kailer/Merker, 2000.<br />
vgl. Pleitner, 1997, S. 185ff.; Thommen/Behler, 2002, S.<br />
155ff.<br />
vgl. Frank/Korunka/Lueger, 1999, S. 121ff.<br />
vgl. Ballarini/Keese, 2002, S. 29.<br />
vgl. Heyse/Schepanski, 2000.<br />
vgl. Kriener u.a., 2004; van <strong>der</strong> Brug,/Locher, 1997.<br />
vgl. Kailer, 2003.<br />
vgl. Minetti/Bygrave, 2001, S. 5ff.<br />
vgl. BMwA, 1998.