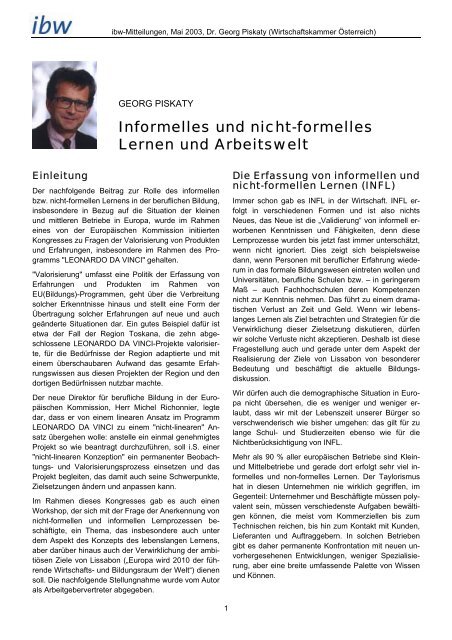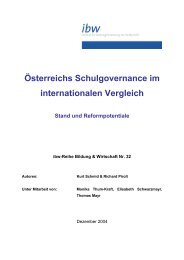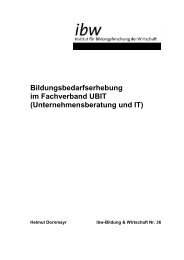GEORG PISKATY - ibw
GEORG PISKATY - ibw
GEORG PISKATY - ibw
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, Mai 2003, Dr. Georg Piskaty (Wirtschaftskammer Österreich)<br />
<strong>GEORG</strong> <strong>PISKATY</strong><br />
Informelles und nicht-formelles<br />
Lernen und Arbeitswelt<br />
Einleitung<br />
Der nachfolgende Beitrag zur Rolle des informellen<br />
bzw. nicht-formellen Lernens in der beruflichen Bildung,<br />
insbesondere in Bezug auf die Situation der kleinen<br />
und mittleren Betriebe in Europa, wurde im Rahmen<br />
eines von der Europäischen Kommission initiierten<br />
Kongresses zu Fragen der Valorisierung von Produkten<br />
und Erfahrungen, insbesondere im Rahmen des Programms<br />
"LEONARDO DA VINCI" gehalten.<br />
"Valorisierung" umfasst eine Politik der Erfassung von<br />
Erfahrungen und Produkten im Rahmen von<br />
EU(Bildungs)-Programmen, geht über die Verbreitung<br />
solcher Erkenntnisse hinaus und stellt eine Form der<br />
Übertragung solcher Erfahrungen auf neue und auch<br />
geänderte Situationen dar. Ein gutes Beispiel dafür ist<br />
etwa der Fall der Region Toskana, die zehn abgeschlossene<br />
LEONARDO DA VINCI-Projekte valorisierte,<br />
für die Bedürfnisse der Region adaptierte und mit<br />
einem überschaubaren Aufwand das gesamte Erfahrungswissen<br />
aus diesen Projekten der Region und den<br />
dortigen Bedürfnissen nutzbar machte.<br />
Der neue Direktor für berufliche Bildung in der Europäischen<br />
Kommission, Herr Michel Richonnier, legte<br />
dar, dass er von einem linearen Ansatz im Programm<br />
LEONARDO DA VINCI zu einem "nicht-linearen" Ansatz<br />
übergehen wolle: anstelle ein einmal genehmigtes<br />
Projekt so wie beantragt durchzuführen, soll i.S. einer<br />
"nicht-linearen Konzeption" ein permanenter Beobachtungs-<br />
und Valorisierungsprozess einsetzen und das<br />
Projekt begleiten, das damit auch seine Schwerpunkte,<br />
Zielsetzungen ändern und anpassen kann.<br />
Im Rahmen dieses Kongresses gab es auch einen<br />
Workshop, der sich mit der Frage der Anerkennung von<br />
nicht-formellen und informellen Lernprozessen beschäftigte,<br />
ein Thema, das insbesondere auch unter<br />
dem Aspekt des Konzepts des lebenslangen Lernens,<br />
aber darüber hinaus auch der Verwirklichung der ambitiösen<br />
Ziele von Lissabon („Europa wird 2010 der führende<br />
Wirtschafts- und Bildungsraum der Welt“) dienen<br />
soll. Die nachfolgende Stellungnahme wurde vom Autor<br />
als Arbeitgebervertreter abgegeben.<br />
Die Erfassung von informellen und<br />
nicht-formellen Lernen (INFL)<br />
Immer schon gab es INFL in der Wirtschaft. INFL erfolgt<br />
in verschiedenen Formen und ist also nichts<br />
Neues, das Neue ist die „Validierung“ von informell erworbenen<br />
Kenntnissen und Fähigkeiten, denn diese<br />
Lernprozesse wurden bis jetzt fast immer unterschätzt,<br />
wenn nicht ignoriert. Dies zeigt sich beispielsweise<br />
dann, wenn Personen mit beruflicher Erfahrung wiederum<br />
in das formale Bildungswesen eintreten wollen und<br />
Universitäten, berufliche Schulen bzw. – in geringerem<br />
Maß – auch Fachhochschulen deren Kompetenzen<br />
nicht zur Kenntnis nehmen. Das führt zu einem dramatischen<br />
Verlust an Zeit und Geld. Wenn wir lebenslanges<br />
Lernen als Ziel betrachten und Strategien für die<br />
Verwirklichung dieser Zielsetzung diskutieren, dürfen<br />
wir solche Verluste nicht akzeptieren. Deshalb ist diese<br />
Fragestellung auch und gerade unter dem Aspekt der<br />
Realisierung der Ziele von Lissabon von besonderer<br />
Bedeutung und beschäftigt die aktuelle Bildungsdiskussion.<br />
Wir dürfen auch die demographische Situation in Europa<br />
nicht übersehen, die es weniger und weniger erlaubt,<br />
dass wir mit der Lebenszeit unserer Bürger so<br />
verschwenderisch wie bisher umgehen: das gilt für zu<br />
lange Schul- und Studierzeiten ebenso wie für die<br />
Nichtberücksichtigung von INFL.<br />
Mehr als 90 % aller europäischen Betriebe sind Kleinund<br />
Mittelbetriebe und gerade dort erfolgt sehr viel informelles<br />
und non-formelles Lernen. Der Taylorismus<br />
hat in diesen Unternehmen nie wirklich gegriffen, im<br />
Gegenteil: Unternehmer und Beschäftigte müssen polyvalent<br />
sein, müssen verschiedenste Aufgaben bewältigen<br />
können, die meist vom Kommerziellen bis zum<br />
Technischen reichen, bis hin zum Kontakt mit Kunden,<br />
Lieferanten und Auftraggebern. In solchen Betrieben<br />
gibt es daher permanente Konfrontation mit neuen unvorhergesehenen<br />
Entwicklungen, weniger Spezialisierung,<br />
aber eine breite umfassende Palette von Wissen<br />
und Können.<br />
1
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, Mai 2003, Dr. Georg Piskaty (Wirtschaftskammer Österreich)<br />
Beispiele wie jenes einer Autowerkstätte, in welcher<br />
der Mechaniker nicht nur die Reparatur durchführt, sondern<br />
mit dem Kunden selbst in Kontakt tritt, dessen<br />
Wünsche feststellt bzw. auch die entsprechenden Vorschläge<br />
für die Reparatur macht, daneben aber auch<br />
mit dem Lieferanten in Kontakt treten muss u.ä. zeigen<br />
diesen Unterschied deutlich. Man muss sich nur die<br />
Situation des Automechanikers in einer großen Autofabrik<br />
mit seiner hohen Spezialisierung auf ganz spezifische<br />
Arbeitsvorgänge als Gegenbeispiel vor Augen<br />
führen.<br />
Aber auch die Lehrlingsausbildung in den mitteleuropäischen<br />
Staaten ist ein gutes Beispiel: In den Firmen<br />
findet sehr viel INFL statt, also traditionelles „learning<br />
by doing“ bzw. „learning on the job“ unter der Aufsicht<br />
eines Meisters bzw. einer hoch qualifizierten Fachkraft,<br />
die ihr Können und Wissen praxisnah weitergibt.<br />
Ergänzt wird dieses non-formale Lernen in der Berufsschule<br />
durch formelles Lernen des "theoretischen Unterbaus".<br />
Wir sehen bei der Lehrlingsausbildung auch die Bedeutung<br />
von nicht-formellen Lernprozessen für spezielle<br />
Gruppen, etwa Lernschwache oder Behinderte:<br />
Diesen Gruppen kann vielfach über solche Lernprozesse<br />
eher ein Zutritt zum Fachwissen gewährt werden<br />
als über die im Schulwesen vorherrschende formelle,<br />
intellektuelle Lernvermittlung.<br />
Dass die Sozialpartner in all diesen Systemen eine<br />
wichtige Rolle spielen, soll nicht unerwähnt bleiben.<br />
Mobilitätsprogramme, wie sie durch LEONARDO DA<br />
VINCI ermöglicht werden, führen ebenfalls zu informellem<br />
Lernen. Nach Meinung des Autors allerdings vor<br />
allem im Bereich der europäischen bzw. staatsbürgerlichen<br />
und kulturellen Bildung: Erkennen verschiedener<br />
Problemlösungstechniken in unterschiedliche Arbeitsund<br />
Lernkulturen, Verstehen differenzierter Lösungsansätze,<br />
aber auch anderer Lebensstile. Das ist für die<br />
Entwicklung einer europäischen Bürgergesellschaft ein<br />
besonders wichtiger Beitrag und dürfte wohl der wichtigste<br />
Effekt der Mobilitätsprogramme von LEONARDO<br />
DA VINCI sein.<br />
Das große Problem liegt darin, wie man nun INFL „in<br />
den Griff“ bekommt: Ist es die französische "Kompetenzbilanz",<br />
ist es ein System der Modularisierung von<br />
Lernstoffen, weil man bei einem modularisierten Lernstoff<br />
naturgemäß eher jene Bereiche definieren kann,<br />
die informell gelernt wurden, als bei großen umfassenden<br />
Bildungsblöcken, ist es "Selbstevaluation" des Einzelnen<br />
und die Konfrontation einer solchen Selbstevaluation<br />
mit einem vorhandenen Curriculum (wie dies<br />
z.B. in Vermont/USA für den Collegezutritt erfolgt).<br />
Die Sozialpartner in Europa haben ein Programm<br />
"PROTEIN" (www.academyavignon.net) durchgeführt,<br />
um den Fragen des INFL in Klein- und Mittelbetrieben,<br />
seiner Bedeutung für die Betriebe, seinem Umfang und<br />
seiner Feststellung auf die Spur zu kommen. Die Ergebnisse<br />
zeigen, dass das Lernen in Klein- und Mittelbetrieben<br />
jedenfalls anders vor sich geht als in den<br />
Großbetrieben, dass die Träger der Bildung (also die<br />
Facharbeiter, aber auch die Unternehmer) oft selbst<br />
nicht wissen, woher ihre konkreten Kenntnisse und<br />
Fähigkeiten stammen und dass insgesamt die in- und<br />
non-formalen Lernprozesse bislang weit unterschätzt<br />
wurden.<br />
Die Grundfrage stellt sich und wird zu beantworten<br />
sein: Wer wird wann sein Geld- und/oder Zeitbudget für<br />
lebenslanges Lernen zur Verfügung stellen. Vielleicht<br />
kann die Berücksichtigung von nicht-formellem und informellem<br />
Lernen hiebei helfen, da sie zu einer beachtlichen<br />
Reduktion der erforderlichen Bildungszeiten für<br />
Erwachsene führen müsste.<br />
Offene Fragen<br />
Es bleiben uns zahlreiche offene Fragen zur Diskussion:<br />
! Noch ist die Definition von informellem und nonformellem<br />
Lernen nicht klar. Wo endet die Berücksichtigung<br />
dieser Lernprozesse?<br />
! Die Berücksichtigung von INFL beginnt erst und ist<br />
sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern,<br />
vor allem auch durch die unterschiedlichen<br />
Bildungssysteme veranlasst.<br />
! Die spezielle Rolle der Firmen in diesem Kontext<br />
muss berücksichtigt werden.<br />
! Das Lernen in der Freizeit wird immer bedeutender,<br />
insbesondere auch das Lernen im Rahmen von<br />
Aktivitäten in der Bürgergesellschaft (z.B. das<br />
Erlernen von Managementfähigkeiten durch Aktivitäten<br />
in Vereinen u.ä.). Schließlich sind auch die<br />
Bildungseffekte der Familienphase von Frauen<br />
(managen eines Haushalts) zu sehen und in dieses<br />
Konzept zu integrieren.<br />
Letztlich brauchen wir aber neue und möglichst unbürokratische<br />
Instrumente, um diese Lernprozesse zu<br />
erfassen, sichtbar und messbar zu machen und in die<br />
kommende "Lerngesellschaft" zu integrieren.<br />
2