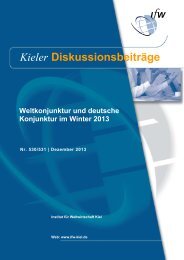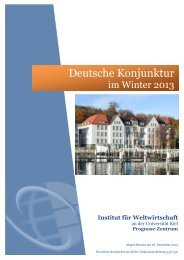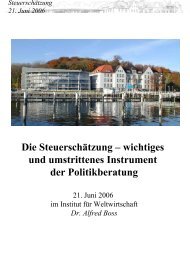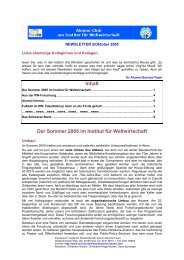Kumm-Oelerich
Kumm-Oelerich
Kumm-Oelerich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Flensburg<br />
Institut für Geschichte und ihre Didaktik<br />
Seminar Struktureller Wandel in Schleswig-Holstein 1945-2000<br />
Dozenten: Prof. Dr. Uwe Danker, Claudia Ruge<br />
Wintersemester 2012/2013<br />
Der Weg Groß Rheides:<br />
Vom ‚Kartoffeldorf‘ zum Wohndorf<br />
Sara <strong>Kumm</strong> (540184) sara_kumm@web.de<br />
Laura <strong>Oelerich</strong> (539882) laura.oelerich@web.de
Gliederung<br />
1 Konzept ............................................................................................................................... 3<br />
1.1 Thema .......................................................................................................................... 3<br />
1.2 Literatur ....................................................................................................................... 3<br />
1.3 Definition Strukturwandel ........................................................................................... 4<br />
1.4 Fragestellung ............................................................................................................... 4<br />
1.5 Untersuchungsobjekt: Die Gemeinde Groß Rheide .................................................... 5<br />
1.6 Methodik und Vorgehen .............................................................................................. 6<br />
2 Plakat ................................................................................................................................... 7<br />
3 Agrarischer Strukturwandel in Groß Rheide ...................................................................... 9<br />
3.1 Verlauf ......................................................................................................................... 9<br />
3.1.1 1945 – 1959 Die Kartoffel bringt den Aufschwung ............................................ 9<br />
3.1.2 1961 – 1969 Aufschwung und „Gesundschrumpfung“..................................... 10<br />
3.1.3 1970 – 1979 Schneller. Größer. Weiter? ............................................................ 11<br />
3.1.4 1980 – -1989 Aufgabe der Meierei - Strukturen ändern sich ............................ 12<br />
3.1.5 1990 – -2012 Wird der Landwirt Energiewirt? ................................................ 12<br />
3.2 Ergebnis und Folgen .................................................................................................. 13<br />
4 Dörflicher Wandel............................................................................................................. 14<br />
4.1 Dörfliche Entwicklung .............................................................................................. 14<br />
4.2 Bevölkerungszahlen und Siedlungen ......................................................................... 14<br />
4.3 Betriebe ...................................................................................................................... 16<br />
4.4 Freizeitgestaltung ....................................................................................................... 17<br />
5 Fazit ................................................................................................................................... 19<br />
6 Literatur-/Quellenverzeichnis ........................................................................................... 21<br />
Seite | 2
1 Konzept<br />
1.1 Thema<br />
Unternimmt man heute einen Spaziergang durch das ländliche Idyll der Dorfstraße in Groß<br />
Rheide, fühlt man sich gleich heimatlich. Es grünt an allen Ecken und es reihen sich hohe,<br />
schattenspendende Bäume aneinander die Straße entlang. Hinter ihnen sind neuere Häuser<br />
neben umgebauten Handwerkshäusern zu sehen, besonders fallen die vielen alten Bauernhöfe<br />
ins Auge, die mit ihren großen Hofplätzen und Vorgärten den Charme des Bauerndorfes perfekt<br />
machen. Wirft man jedoch einen zweiten Blick auf das Idyll wird klar, dass kaum einer<br />
dieser Höfe noch Landwirtschaft betreibt. Es ist ruhig geworden im Dorf Groß Rheide. War<br />
es in den goldenen Zeiten als das ‚Kartoffeldorf‘ bekannt, mit der modernsten Kartoffelsortier-<br />
und –dämpfanlage Schleswig-Holsteins, sogar nach Spanien, Portugal, Nordafrika und<br />
Brasilien wurde die Groß Rheider Kartoffel gebracht. Von diesen glanzvollen Zeiten ist nicht<br />
mehr viel übrig. Die Bauern, die noch aktiv sind betreiben vorwiegend Milchwirtschaft, und<br />
bauen Mais für Biogasanlagen an. Sobald Land verpachtet werden soll, geht eine wahre Hetzjagd<br />
der noch übrig gebliebenen Landwirte los. Alles muss größer, besser und schneller gehen,<br />
um auf dem Markt zu bestehen.<br />
Sprachen die Groß Rheider Mitte der sechziger Jahre noch von einer „Gesundschrumpfung<br />
der Höfe“ 1 , änderte sich die Formulierung während des drastischen Rückgangs der Landwirtschaft<br />
zum „Großen Höfesterben“ 2 . Bereits dieser Wandel der Bezeichnung lässt auf die tiefgreifenden<br />
landwirtschaftlichen und schmerzhaften innerdörflichen Veränderungen schließen.<br />
1.2 Literatur<br />
Die Grundlage unseres Forschungsprojekts bildet die verwendete Fachliteratur, dazu gehört:<br />
„Wirtschaftsstruktur und Strukturwandel: Gesamtwirtschaft.“ von Gerold Ambrosius 3 , sowie<br />
„Sektoraler Wandel und internationale Verflechtung. Die bundesdeutsche Wirtschaft im<br />
Übergang zu einem neuen Strukturmuster“ ebenfalls von Gerald Ambrosius 4 , auch „Landwirtschaft<br />
und Schwerindustrie Schleswig-Holsteins seit 1960: Schlaglichter auf sektoralen<br />
1 Vollstedt, Karl-Heinz „Groß Rheide, Chronik der Gemeinde“ Eckernförde 1995. S. 153.<br />
2 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 155.<br />
3 Ambrosius, Gerold: Wirtschaftsstruktur und Strukturwandel: Gesamtwirtschaft. In: Ambrosius, Gerold/Petzina,<br />
Dietmar/ Plumpe, Werner (Hrsg.): Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen,<br />
München 1996, S. 175 - 191.<br />
4 Ambrosius, Gerold: Sektoraler Wandel und internationale Verflechtung. Die bundesdeutsche Wirtschaft im<br />
Übergang zu einem neuen Strukturmuster. In: Raithel, Thomas/ Wirsching, Andreas (Hrsg.): Auf dem Weg in<br />
eine neue Moderne? Die Bundesrepublik in den siebziger und achtziger Jahren, München 2009, S. 17 - 30.<br />
Seite | 3
Strukturwandel.“ von Uwe Danker 5 , sowie „Beständigkeit und Veränderung. Konstanz und<br />
Wandel traditioneller Orientierungs- und Verhaltensmuster in Landwirtschaft und ländlicher<br />
Gesellschaft in Westfalen 1919-1996.“ von Peter Exner 6 und „Agrarstrukturwandel und<br />
agrarpolitische Krisenbewältigung in Deutschland.“ von Karen Strehlow 7 .<br />
1.3 Definition Strukturwandel<br />
Mithilfe der genannten Literatur können wir eine geeignete Definition für den Strukturwandel<br />
finden. Um allerdings Strukturwandel definieren zu können, sollte erst die Bedeutung des<br />
Wortes Struktur in diesem Zusammenhang geklärt werden. Eine Struktur teilt eine Gesamtgröße<br />
in Teilgrößen, wobei die dabei entstehenden Teilgrößen homogener sind als die Gesamtgröße.<br />
Beim Strukturwandel tritt eine langfristige Veränderung dieser Teilgrößen ein. 8<br />
Das Kennzeichen des Strukturwandels unserer Volkswirtschaft ist andauernde Veränderung<br />
der Relationen zwischen dem primären, dem sekundären und dem tertiären Sektor. Groß<br />
Rheide, als typisches Bauerndorf, ohne Hafen und ohne Bundesbahnstation, ohne direkte<br />
Verbindung zur Bundesautobahn und ohne Gewerbebetriebe von überörtlicher Bedeutung,<br />
hatte in den schnellen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg keine Chance, den Rückgang<br />
der landwirtschaftlichen Betriebe durch Ansiedlung von Gewerbeunternehmen auszugleichen<br />
und mit ihnen den Verlust von Arbeitsplätzen aufzufangen.<br />
1.4 Fragestellung<br />
Wir wollen klären, wie der Strukturwandel in Groß Rheide stattgefunden hat. Außerdem wollen<br />
wir den Einfluss dieses Wandels auf das dörfliche Leben klären. Die Fragen nach den Ursachen,<br />
dem Verlauf und den Folgen des Strukturwandels stehen im Mittelpunkt dieses Projekts.<br />
Die Wahl des Forschungszeitraumes fiel bedeutend schwerer: Zunächst hatten wir die<br />
Jahre 1950 bis 1980 ausgewählt, mussten aber feststellen, dass die Quellenlage leider nicht<br />
ausreichend für eine derartige Forschung war. Die Daten für das Jahr 1960 waren vollständig<br />
und verwertbar. Als Abschlussjahr beschlossen wir 2012 zu nehmen, da hier die Daten zuver-<br />
5 Danker, Uwe: Landwirtschaft und Schwerindustrie Schleswig-Holsteins seit 1960: Schlaglichter auf sektoralen<br />
Strukturwandel. In: Demokratische Geschichte: Jahrbuch für Schleswig-Holstein 18 (2007), S. 166-210.<br />
6 Exner, Peter: Beständigkeit und Veränderung. Konstanz und Wandel traditioneller Orientierungs- und Verhaltensmuster<br />
in Landwirtschaft und ländlicher Gesellschaft in Westfalen 1919-1969. In: Frese, Matthias, Prinz:<br />
Michael: Politische Zäsuren und gesellschaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert. Regionale und vergleichende<br />
Perspektiven. Paderborn 1996, S. 279-326.<br />
7 Strehlow, Karen: Agrarstrukturwandel und agrarpolitische Krisenbewältigung in Deutschland. Baden-Baden<br />
1992.<br />
8 Ambrosius, Gerold: Wirtschaftsstruktur und Strukturwandel: Gesamtwirtschaft. In: Ambrosius u.a.: Moderne<br />
Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen, München 1996, S. 175 - 191.<br />
Seite | 4
lässig zu erforschen waren. So bildeten wir Fragen nach dem Verlauf des agrarischen Strukturwandels<br />
in Groß Rheide im Zeitraum von 1960 bis 2012. Desweiteren soll der Einfluss des<br />
agrarischen rischen Strukturwandels auf das dörfliche Leben im selben Zeitraum geklärt werden.<br />
1.5 Untersuchungsobjekt: Die Gemeinde Groß Rheide<br />
Die Gemeinde Groß Rheide befindet sich im Kreis Schleswig-Flensburg und ist dort nördlich<br />
im Amt Kropp-Stapelholm zu finden (siehe<br />
Abbildung 9 ). Groß Rheide liegt auf dem<br />
Geestrücken im Dreieck Husum-<br />
Schleswig-Rendsburg, wobei Husum<br />
circa 28 km 10 , Schleswig circa 17 km 11<br />
und Rendsburg circa 25 km 12 entfernt<br />
sind. In der näheren Umgebung befinden<br />
sich also drei Städte, die potentielle Ar-<br />
und<br />
beitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten<br />
Bildungseinrichtungen bereit halten.<br />
Erste Siedlungen an der Rheider Au sind<br />
auf ca. 1250 13<br />
zurückzuführen. Heute<br />
Geographische Lage Groß Rheides<br />
umfasst die Gemeinde eine Fläche von<br />
ca. 1536 ha und ist „typisch ländlich struk-<br />
turiert mit Landwirtschaft und Wohnsiedlungen“ 14 . In der Gemeinde Groß Rheide gibt es neben<br />
der Landwirtschaft keine gewerblichen oder kaufmännischen Betriebe, darum kann sie im<br />
Allgemeinen als Agrargemeinde bezeichnet werden. Besorgungen sowie der Schulbesuch<br />
können von den Groß Rheidern im nahegelegenen Kropp erledigt werden.<br />
Im Jahr 2011 wur-<br />
9 Wikipedia: Lage Groß Rheides im Kreis Schleswig-Flensburg (2012), URL:<br />
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gross_Rheide_in_SL.PNG&filetimestamp=20080112110122<br />
(Stand: 08.01.2013).<br />
10 Google maps: Entfernung Groß Rheide – Husum (o.J.), URL: http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=ll<br />
(Stand:20.01.2013).<br />
11 Google maps: Entfernung Groß Rheide – Schleswig (o.J.), URL: http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=ll<br />
(Stand: 20.01.2013).<br />
12 Google maps: Entfernung Groß Rheide – Rendsburg (o.J.), URL: http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=ll<br />
(Stand: 20.01.2013).<br />
13 Amt Kropp-Stapelholm: Groß Rheide (2013), URL: http://www.kropp.de/de/gross-rheide.html rheide.html (Stand:<br />
08.01.2013) .<br />
14 Amt Kropp-Stapelholm: Groß Rheide (2013), URL: http://www.kropp.de/de/gross-rheide.html rheide.html (Stand:<br />
08.01.2013).<br />
Seite | 5
den 927 15 Groß Rheider gezählt, von denen die meisten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde<br />
Kropp angehören. Im Dorf selbst befindet sich eine Kapelle mit einem anliegenden<br />
Friedhof.<br />
1.6 Methodik und Vorgehen<br />
Für unsere Untersuchung zogen wir die Methode der Statistik zum Auswerten von Tabellen<br />
und Grafiken hinzu. Bei unseren Forschungen wendeten wir die historisch-kritische Methode<br />
und Oral History an. Die historisch-kritische Methode beschreibt den Weg vom Verstehen<br />
eines Vorgangs über die Bestimmung seiner Aussage hin zum Einordnen dessen in einen Gesamtzusammenhang.<br />
16 Dabei ist es wichtig, einen Zweifel an der Echtheit der Quelle, ihrer<br />
Entstehungszeit und dem Wortlaut zu haben (philologisch-hermeneutische Textkritik), die<br />
überlieferten Fakten zu überprüfen (historische Kritik) und zuletzt den Standpunkt des Verfassers<br />
in Betracht zu ziehen (Ideologiekritik). 17 Bei Oral History handelt es sich um die Befragung<br />
von Zeitzeugen zu einem Ereignis oder einer Entwicklung in der Vergangenheit. Bei<br />
dieser Methode muss allerdings beachtet werden, dass Zeitzeugen nur zu der Zeit befragt<br />
werden können, in der sie gelebt, viel mehr erlebt haben, und auch dann ist die Anzahl an<br />
Themen, zu denen gefragt werden kann, begrenzt. 18 Auch bei dieser Art von Quellenerhebung<br />
muss die historisch-kritische Methode angewandt werden. Dabei sollte man beachten, dass die<br />
Befragten immer aus ihrer subjektiven Sicht erzählen, ihre Erinnerungen meist lückenhaft<br />
sind und eventuell durch persönliche oder äußere Einflüsse verändert sein könnten 19 .<br />
Nach dem Einlesen in die Sekundärliteratur und den ersten Nachforschungen im Groß<br />
Rheider Archiv sowie dem Lesen der beiden Dorfchroniken von Heinrich Jürgensen/ Hellmuth<br />
Sierts und Karl Heinz Vollstedt entschlossen wir uns zu Zeitzeugenbefragungen, um<br />
mehr Informationen zu dem sich wandelnden Dorf zu erhalten. Dabei wollten wir möglichst<br />
viele Sichtweisen abdecken, weshalb wir mehrere Zeitzeugengespräche mit ganz unterschiedlichen<br />
Geschichten führten. Anne Christel Ohm, die 1929 in Groß Rheide geboren und den<br />
größten Teil ihres Lebens dort verbracht hatte, ist heute pensionierte Lehrerin und stammt von<br />
15 WiREG: Groß Rheide (o.J.), URL: http://www.wireg.de/die-region/die-gemeinden/staedte-und-gemeinden-inflensburgschleswig/gemeindeid-52/<br />
(Stand: 19.01.2013).<br />
16 „Wege der Materialbeschaffung“ aus: Peter Borowski, Barbara Vogel, Heide Wunder: Einführung in die Geschichtswissenschaft<br />
I, Opladen 1989, S. 157<br />
17 Borowski, Peter u.a. 1989, S. 157-158<br />
18 Siegfried, Detlef: Zeitzeugenbefragung. Zwischen Nähe und Distanz, in: Dittmer, Lothar und Siegfried, Detlef<br />
(Hg.), Spurensucher. Ein Praxisbuch für historische Projektarbeit, Weinheim 1997, S.67<br />
19 Siegfried,Detlef, 1997, S.68<br />
Seite | 6
einem landwirtschaftlichen Betrieb, der seit 1962 nicht mehr besteht. Sie schrieb 1952 ihre<br />
Diplomarbeit 20 über die Verkoppelung in Groß Rheide, die uns ebenfalls vorliegt.<br />
Des Weiteren befragten wir das pensionierte Ehepaar Thies und Annelene Lohmann, beide<br />
1933 geboren, die 1972 nach Aufgabe ihres Hofes in Hahnenkamp nach Groß Rheide übersiedelten.<br />
Dort betrieben sie einen Hof, der heute noch von ihrem Sohn geführt wird, mit dem<br />
wir auch ein Gespräch führten. Die Gespräche wurden am 19.12.2012 geführt.<br />
Um einen Bezug oder einen Vergleich zur landwirtschaftlichen Entwicklung Schleswig-<br />
Holsteins herstellen zu können, werteten wir einige statistische Jahrbücher aus. Nach Gesprächen<br />
mit dem Amt Kropp-Stapelholm, dem Kreisarchiv und dem Ortvorsitzenden des Bauernverbandes,<br />
Klaus Lohmann, wurde immer deutlicher, dass die Quellenlage in Bezug auf<br />
Zahlen und Daten über die Landwirtschaft in Groß Rheide sehr schwach ist. Da auch die<br />
Zeitzeugen keine genauen Zahlen sondern nur Tendenzen nennen konnten, entschieden wir<br />
uns, unseren Forschungszeitraum auf 2012 auszuweiten, um so gesicherte Daten zu erlangen.<br />
Wir erhielten eine Liste der Landwirte in Groß Rheide, welche wir dann telefonisch um Hilfe<br />
baten. Man machte uns allerdings nicht besonders große Hoffnungen von den einzelnen<br />
Landwirten Daten über ihre Höfe zu erlangen, da sie sich diese nicht einmal gegenseitig verrieten.<br />
Wider unsere Erwartungen bekamen wir, mit der Bitte um Verschwiegenheit über genaue<br />
Angaben, von jedem Auskunft über Hektarzahl, Tierbestände, Angestellten- und<br />
Trekerzahl sowie der Frage nach Zusammenarbeit mit anderen Höfen.<br />
Um den dörflichen Wandel zu untersuchen, betrachteten wir in der Chronik Vollstedts die<br />
Betriebs-, Einwohner- und Bauzahlen und fragten nach Mitgliederzahlen der drei größten<br />
Vereine. Die Freiwillige Feuerwehr, der TSV und die Schützengilde konnten uns allerdings<br />
nur mit ihren Protokollen unterstützen, die wir auswerteten, um die Entwicklung der Mitgliederzahlen<br />
beurteilen zu können. Das verwendete Bildmaterial stammt größtenteils aus den<br />
Sammlungen Klaus Lohmanns und Sönke Brumms.<br />
2 Plakat<br />
Unsere Forschungsergebnisse fassten wir auf unserem Plakat zusammen. Uns war wichtig mit<br />
einem Blick zu verdeutlichen, wie sich das Dorf Groß Rheide wandelte: Vom agrarisch geprägten<br />
Dorf, hin zum Wohndorf. Dazu wählten wir aussagekräftige Bilder. Für das Jahr 1960<br />
entschieden wir uns für das Bild der Kartoffelsortier- und dämpfanlage, um die Spezialsierung<br />
20 Sierts, Anne Christel: Durchführung und Auswirkung der Verkoppelung in Gross Rheide, Zur ersten Lehrerprüfung<br />
vorgelegt, 1952.<br />
Seite | 7
des Dorfes zu verdeutlichen. Dem gegenüber stellten wir das Bild „Groß Rheide aus der<br />
Luft“, da heute die vielen Einfamilienhäuser das Dorfbild prägen. Auch die Dimensionen der<br />
Landwirtschaft von 1960 im Vergleich zu 2012 wollten wir zeigen, so wählten wir das Bild<br />
eines Hofes in Groß Rheide um 1960 und das eines Hofes in 2012. Durch die dargestellten<br />
Grafiken sollen die Forschungsergebnisse in Zahlen auf einen Blick zu fassen sein, sie zeigen<br />
die Mitgliederzahlentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr von 1960 bis heute, die Entwick-<br />
lung der Betriebe und Einrichtung in Groß Rheide, die Teilnehmerentwicklung am Gildefest<br />
und die Entwicklung der Einwohnerzahl von 1939 bis 2012.<br />
Seite | 8
3 Agrarischer Strukturwandel in Groß Rheide<br />
3.1 Verlauf<br />
3.1.1 1945 – 1959 Die Kartoffel bringt den Aufschwung<br />
Nach dem Krieg kam es zu einem Großen Zusammenbruch, der in ganz Schleswig-Holstein<br />
zu einer Ernährungskrise führte, auch Groß Rheide war davon betroffen. Die vormals 510<br />
Einwohner Groß Rheides mussten sich 1949 gezwungenermaßen mit ca. 450 Flüchtlingen<br />
und Vertriebenen ‚Tisch und Bett‘ teilen. 21 Aber auch die Lebensmittel mussten mit den Vertriebenen<br />
geteilt werden, der schlimmste Hunger konnte allerdings gestillt werden, da fast<br />
jedes Haus „ein bisschen Landwirtschaft“ besaß, zumeist eine Kuh, ein Schwein und einen<br />
Garten. 22 Doch die Zeiten waren hart, vier von fünf Personen waren unterernährt. 23 Noch dazu<br />
kam, dass viele Städter mit dem Bus nach Groß Rheide kamen, um Habseligkeiten gegen Eier,<br />
Speck, Gemüse und Äpfel einzutauschen, so entstand ein wahrer Schwarzmarkthandel. 24<br />
Bis 1948 verschlimmerte sich der Mangel an allem Lebensnotwendigen und auch der<br />
Schwarzmarkthandel nahm ein katastrophales Ausmaß an. 25 Mit der Währungsreform im Juni<br />
1948 beruhigte sich die Lage. 1950 gab es wieder Baumaterialen und auch die Geschäfte füllten<br />
ihre Regale wieder, es gab wieder Arbeit im Dorf, allerdings nicht für alle. Durch die unzureichenden<br />
Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten, kam es ab 1953 zu einer zunehmenden<br />
Abwanderung vieler Flüchtlinge, aber auch viele Landarbeiter suchten das Weite, um in den<br />
großen erneuerten oder neu aufgebauten Fabriken besser bezahlte Arbeit zu finden. Sogar die<br />
1953 errichteten Landarbeiterhäuser konnten die landwirtschaftlichen Angestellten nicht aufhalten.<br />
26<br />
Die Groß Rheider erkannten, dass sich die Geestböden besonders für den Anbau von Ess-,<br />
Futter- und Saatkartoffeln eigneten. So entstand ein florierender, ja sogar internationaler Handel<br />
der Groß Rheider Erdäpfel - Nach Spanien, Portugal, Nordafrika und Brasilien wurde das<br />
gewinnbringende Produkt exportiert. 27 Der Handel gedieh und so konnten sich alle Höfe in<br />
Groß Rheide bereits 1957 einen PS-starken Unterstützer leisten: Der Traktor<br />
21 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
22 Ebd.<br />
23 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 123.<br />
24 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.12<br />
25 Ebd.<br />
26 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S.129.<br />
27 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 130<br />
Seite | 9
‚eroberte‘ die Gemeinde. 28 Auch Melkmaschinen waren keine Seltenheit mehr auf den Höfen,<br />
machte es dies die Arbeit doch viel leichter, schneller und ertragreicher.<br />
Dass damit ein bereits revolutionärer Schritt in Richtung Technisierung und auch Strukturwandel<br />
gemacht wurde, „konnte noch kein Groß Rheider ahnen“ 29 .<br />
3.1.2 1961-1969 Aufschwung und „Gesundschrumpfung“<br />
Groß Rheide begann sich stark zu wandeln. Die Kartoffel hatte eine „Blütezeit“ 30 des Dorfes<br />
eingeläutet, Groß Rheide besaß die modernste Kartoffelsortier- und -dämpfanlage Schleswig-<br />
Holsteins 31 . Die Finanzen besserten sich und so erholte sich die Gemeinde von den Folgen des<br />
Krieges. Insbesondere die Vollerwerbsbetriebe galten als „gesund“. Schwieriger hatten es die<br />
Zu- und Nebenerwerbsbetriebe. 1966 stieg die Tendenz zur Aufgabe des Hofes. Zunächst<br />
wurde hier von einer „Gesundschrumpfung in den Dörfern“ 32 gesprochen, sie wurde nicht als<br />
ein besonderes Übel angesehen, da die Landwirte nun die Möglichkeit hatten in einem Industriebetrieb<br />
mit einem besseren Lohn zu arbeiten. 33 Die Nebenerwerbshöfe standen schon bald<br />
vor der Entscheidung: „Wachsen oder Weichen“. 34 Die Aufgabe der Höfe wurde durch staatliche<br />
Sozialmaßnahmen gefördert, es wurde eine Landabgaberente eingeführt und eine Gewährung<br />
von Zuschüssen durch nachträgliche Zahlung von Beiträgen zur Rentenversicherung<br />
eingerichtet, um die Aufgabe zu erleichtern. 35 Aber auch die größeren Vollerwerbsbetriebe<br />
hatten Mühe „bei der Stange“ 36 zu bleiben. Durch Zupacht und Zukauf von Ländereien, Vergrößerung<br />
des Viehbestandes und der Ställe und Scheunen konnten die meisten Vollerwerbshöfe<br />
erhalten werden. 37 Allerdings mussten von 1960 bis 1965 drei Vollerwerbshöfe „den<br />
Dienst quittieren“. 38 Trotzdessen verdreifachte sich das Haushaltseinkommen beinahe von<br />
1961 bis 1969 von 46.400 auf 154.000 DM. 39 Die Arbeitslosigkeit ging zurück, es herrschte<br />
zeitweilig sogar ein Mangel an Arbeitskräften in den bäuerlichen Betrieben. 40 Die Flüchtlinge<br />
28 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 129.<br />
29 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
30 Ebd.<br />
31 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 131.<br />
32 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
33 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 153.<br />
34 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
35 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 154.<br />
36 Ebd.<br />
37 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 155.<br />
38 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 154<br />
39 Vollstedt, Karl-Heinz:, 1995. S. 132.<br />
40 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
Seite | 10
hatten das Dorf wieder verlassen: Die Einwohnerzahl lag 1961 bei 592. 41 Der Mangel an<br />
landwirtschaftlichen Angestellten wurde deutlich spürbar, so kam es zu steigenden Investitionen<br />
in Maschinen. Die Spezialisierung auf technisierungswürdige Betriebszweige war rentabler,<br />
folglich sank die für den Kartoffelanbau genutzte Fläche von 1960 bis 1966 von 132 ha<br />
auf 44. 42 Allmählich löste die ertragreichere Milchwirtschaft den Kartoffelanbau ab.<br />
3.1.3 1970-1979 Schneller. Größer. Weiter?<br />
1971 fand der Handel mit Kartoffeln ein jähes Ende. Der Absatz innerhalb tragbarer Entfernungen<br />
und die Abnahmekapazitäten waren rückläufig, aber auch die wachsende Konkurrenz<br />
aus Niedersachen und Holland machte den Anbau unrentabel. 43 Er musste aufgegeben werden.<br />
Mit den Kartoffeln ging auch die Kreisbahn 44 , die durch die Erdfrucht ebenfalls eine<br />
„Blütezeit“ erreicht hatte. 45 Das Bahngelände wurde in diesem Zuge zu einer befestigten Straße<br />
umgebaut und es entstand ein neues Baugelände. Auch das Kartoffelsortiergebäude wurde<br />
zum Umbau für Wohnungen frei gegeben. 46 Nicht nur hier wurde Wohnraum geschaffen.<br />
1972 kamen immer mehr Bauwillige nach Groß Rheide. 47 Die niedrigen Quadratmeterpreise,<br />
aber auch das ländliche Idyll lockte. Auch in den folgenden Jahren wurden neue Baugebiete<br />
geschaffen. Die Einwohnerzahl stieg ab 1970 stetig an.<br />
Mit dem Ende der Kartoffelzeit, brach die der Spezialisierung ein. Der Fokus wurde nun auf<br />
die Milchwirtschaft gelegt. Landwirte mussten nun viel über qualitativ gutes Futter, eine Auslastung<br />
moderner Stallungen und die benötigte Rinderzahl lernen. 48 Die Rindviehhaltung zur<br />
Erzeugung von Milch, Fleisch, Zuchttieren und der dazu notwendige Futteranbau wurden zum<br />
tragenden Betriebszweig. 49<br />
Die sogenannte „Gesundschrumpfung“ in den Dörfern veränderte sich allmählich zu einem<br />
Höfesterben: Immer mehr Landwirte „warfen das Handtuch“ 50 , besonders in den Siebzigern,<br />
41 Amt Kropp-Stapelhom<br />
42 Vollstedt, Karl-Heinz ,1995. S. 153<br />
43 Vollstedt, Karl-Heinz , 1995. S. 23.<br />
44 Von 1905 fuhr die Kreisbahn durch Groß Rheide. 1950 wurde der Personenverkehr gänzlich aufgegeben werden.<br />
Seitdem wurden nur noch landwirtschaftliche Produkte, insbesondere die Groß Rheider Kartoffeln transportiert.<br />
1970 wurde der Betrieb gänzlich eingestellt, der Kartoffelhandel wurde aufgegeben.<br />
45 Vollstedt, Karl-Heinz , 1995. S. 139.<br />
46 Ebd.<br />
47 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
48 Amt Kropp-Stapelholm<br />
49 Vollstedt, Karl-Heinz , 1995. S. 155<br />
50 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
Seite | 11
Achtzigern und Neunzigern war ein deutlicher Rückgang zu beobachten. 51 Infolge dessen<br />
waren auch die kaufmännischen und handwerklichen Betriebe in Groß Rheide bedroht. 52<br />
Ab 1977 gingen die Geburten stark zurück, aber auch bildungspoltische Hintergründe führten<br />
dazu, dass die Groß Rheider Grundschule schließen musste. 1978 hatten die Schüler ihren<br />
letzten Schultag an der Groß Rheider Grundschule. 53<br />
3.1.4 1980-1989 Aufgabe der Meierei - Strukturen ändern sich<br />
Ein weiterer harter Schlag für die Groß Rheider Landwirtschaft, aber auch die Dorfgemeinschaft,<br />
war die Aufgabe der Meierei im Jahr 1987. Mit ihr verlor man auch den ‚Dorfmittelpunkt‘<br />
54 . Durch die stetig fallende Mitgliederzahl und die Aufgabe der eigenen Butterherstellung<br />
schmälerten die Umsätze bis die Meierei 1987 gar nicht mehr zu halten war.<br />
Bei den Erwerbstätigen in Groß Rheide war nun ein deutlicher Wandel wahrzunehmen: Hatten<br />
1970 noch 95 Personen (etwa 40% der Erwerbstätigen davon 51 Männer und 40 Frauen)<br />
ihren Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, waren es 1987 nur noch 56 Personen (knapp 20%<br />
davon 40 Männer und 16 Frauen): Die Frauen verließen die Landwirtschaft, um einer Nebentätigkeit<br />
nachzugehen. 55<br />
3.1.5 1990-2012 Wird der Landwirt Energiewirt?<br />
Auch in den neunziger Jahren hielt das Höfesterben noch an. Wo es 1965 noch 75 Voll- und<br />
Nebenerwerbsbetriebe gab, waren es 1994 nur noch ca. 20 Höfe. 56<br />
Ende der Neunziger kam dann eine weiterer technische Innovation: die Biogasanlage.<br />
Deutschlandweit wuchs die Zahl der Anlagen stetig. Mit einer Zeitverzögerung von zehn Jahren<br />
ging die erste Biogasanlage in Groß Rheide ans Netz, die zweite folgte zwei Jahre später.<br />
57 Vier der neun aktiven Landwirte in Groß Rheide sind Teilhaber einer Biogasanlage.<br />
Diese Teilhaber haben vertraglich festgelegte Einspeisemengen (gemessen in Hektar) die sie<br />
erfüllen müssen. 58 Bei einigen nähert sich diese vertraglich festgelegte Menge von 80 ha der<br />
Gesamthektarzahl des Hofes an, hat man doch in Groß Rheide 2012 im Durchschnitt etwa 134<br />
ha Land. Die zwei konkurrierenden Anlagen lösen im Dorf eine Schlacht um freiwerdende<br />
51 Zeitzeugin Annelene Lohmann am 19.12.2012<br />
52 Ebd.<br />
53 Vollstedt, Karl-Heinz,1995. S. 140.<br />
54 Beim „Milch wegbringen“ war dies der Ort an dem man sich traf und austauschte, aber auch amtliche Ankündigungen<br />
am Schwarzen Brett konnte man hier lesen.<br />
55 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S.30.<br />
56 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S.157.<br />
57 Zeitzeugin Annelene Lohmann am 19.12.2012<br />
58 Ebd.<br />
Seite | 12
Flächen aus, denn je mehr Land zur Verfügung steht, desto mehr Mais kann angebaut werden.<br />
Der wiederum steigert die Energiemenge und diese schließlich die Erträge. 59<br />
3.2 Ergebnis und Folgen<br />
Die Mechanisierung, der Rückgang und die Vergrößerung der Höfe, die Spezialisierung und<br />
die voranschreitende Landflucht bilden in Groß Rheide die Veränderungsindikatoren des<br />
Strukturwandels. Die Mechanisierung begann schon 1957, als sich, durch die gute finanzielle<br />
Lage, jeder Landwirt in Groß Rheide einen Traktor leisten konnte. Diese beinahe revolutionäre<br />
Veränderung machte die Arbeit effektiver. Nach und nach folgten dem Traktor dann auch<br />
Melkmaschine und Mähdrescher. 60 Aber nicht nur die Arbeit der Landwirte veränderte sich,<br />
auch in den Fabriken in den größeren Gemeinden war ein Fortschritt zu beobachten. Das sogenannte<br />
bundesdeutsche Wirtschaftswunder schaffte bis 1960 Vollbeschäftigung. 61 Für viele<br />
Landbewohner bot die Arbeit in einem gewerblichen Betrieb die Möglichkeit mehr Geld als<br />
in der Landwirtschaft zu verdienen. Die Höfe, die nun ohne Hilfe auskommen mussten, standen<br />
vor dem Problem die Arbeitskräfte zu ersetzten. Allerdings reichten die landwirtschaftlichen<br />
Erträge nicht aus, um den Lohn für einen Landarbeiter auf das Niveau der Löhne in den<br />
gewerblichen Betrieben anzupassen. Die zweite Option bestand darin, sich auf technisierungswürdige<br />
Betriebszweige zu spezialisieren. Bis 1965 waren die Landarbeiter gänzlich von<br />
den Groß Rheider Höfen verschwunden. 62 Ab 1966 standen bereits viele Landwirte, vor allem<br />
die im Nebenerwerb, vor der Wahl: „Wachsen oder Weichen?“ 63 Im Zuge dessen kam es zu<br />
einer „Gesundschrumpfung der Höfe“, wie die Reduktion der landwirtschaftlichen Betriebe in<br />
Groß Rheide genannt wurde. Durch das zunehmende Ausmaß der geschlossenen Höfe kursierte<br />
dann bald eine andere Bezeichnung: „Das große Höfesterben“ hatte begonnen 64 . Gab es<br />
1965 noch 76 Voll- und Nebenerwerbsbetriebe in Groß Rheide, sank die Zahl 1994 auf ca. 20<br />
Höfe und bis heute gibt es nur noch 9 Vollerwerbshöfe. 65 Sobald ein Hof starb, waren die<br />
anderen Landwirte bereits zur Stelle, um das Land zu pachten oder zu kaufen, auch eine Vergrößerung<br />
des Viehbestandes, der Ställe und Scheunen konnten einen Hof retten. 66 Die Spezialisierung<br />
auf Milchwirtschaft im Dorf nahm immer mehr Form an. Von 1960 bis 1966 sank<br />
59 Zeitzeugin Annelene Lohmann am 19.12.2012<br />
60 Ebd.<br />
61 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S.155.<br />
62 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
63 Ebd.<br />
64 Ebd.<br />
65 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S.157.<br />
66 Zeitzeugin Annelene Lohmann am 19.12.2012<br />
Seite | 13
die für Kartoffeln genutzte Hektarfläche von 132 ha auf 44 ha. 67 Und noch etwas änderte sich<br />
ab 1970: Die Frauen verließen die Höfe, um als Angestellte zu arbeiten. Waren 1970 noch 40<br />
Frauen auf den Höfen beschäftigt, sank die Zahl bis 1987 auf 16. 68 Dagegen stieg die Zahl im<br />
Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Betriebe (dazu gehörte auch das Angestelltenverhältnis)<br />
von 17 Frauen im Jahr 1970 auf 60 Frauen im Jahr 1987. 69 Bis heute hat sich noch einmal<br />
alles gewandelt: Die neun Höfe, die noch übrig sind, führen einen unterschwelligen Konkurrenzkampf.<br />
Keiner möchte dem anderen sagen, wieviel Land oder Vieh er genau hat und sobald<br />
Land verpachtet werden soll, geht eine wahre ‚Hetzjagd‘ um die Hektar los. 70 Auch die<br />
Biogasanlage hat einige Veränderungen nach Groß Rheide gebracht: Heute wird im großen<br />
Stil Mais angebaut, um die Anlagen „in Gang“ zu halten. 71 Wo früher eine unterstützende<br />
Hand gereicht wurde, falls „Not an Mann“ war, zum Beispiel wurde sich gegenseitig bei der<br />
Ernte unterstützt. Heute gibt es so gut wie keine Zusammenarbeit ohne wirtschaftliches Interesse.<br />
72<br />
4 Dörflicher Wandel<br />
4.1 Dörfliche Entwicklung<br />
Um den Einfluss des landwirtschaftlichen Strukturwandels auf das Dorfleben in der Gemeinde<br />
Groß Rheide zu bestimmen, muss zunächst die Frage nach dem Leben in den Fünfzigern,<br />
Sechzigern und den Siebziger Jahren geklärt werden, zudem wird ein Ausblick auf Heute<br />
gegeben.<br />
Bei diesen Untersuchungen sollen uns die Bevölkerungszahlen, die steigende Siedlungszahl,<br />
die Arbeitsplatzsituation im Dorf sowie die Freizeitgestaltung als Indikatoren dienen.<br />
4.2 Bevölkerungszahlen und Siedlungen<br />
Vollstedt berichtet in der Chronik davon, dass der „natürliche Bevölkerungsüberschuss“ 73<br />
Groß Rheides zwischen 1905 und 1963 nicht in Groß Rheide geblieben sei. 74 Einige seien<br />
nach Kropp gezogen, andere zog es weiter fort, teilweise sogar bis nach Amerika. 75 Wahr-<br />
67 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 153.<br />
68 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 30<br />
69 Ebd.<br />
70 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Ortsbauernverbandes am 19.12.2012<br />
71 Ebd.<br />
72 Zeitzeuge Klaus Lohmann am 19.12.2012<br />
73 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 26<br />
74 Ebd.<br />
75 Ebd.<br />
Seite | 14
scheinlich wäre dieser Trend anhaltend gewesen, wenn Kropp nicht zum Garnisonsstandort<br />
geworden wäre. Davon profitierten neben Kropp auch die umliegenden Gemeinden, wie Groß<br />
Rheide. Es wurde vermehrt gebaut. Besonders in den Siebzigern und Achtzigern gab es einen<br />
Anstieg der bebauten Grundstücke. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe lagen aufgrund<br />
des fruchtbaren Landes an der nördlichen Seite der Dorfstraße, an der heutigen Hauptstraße<br />
entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Wohnhäuser mit Werkstätten, Kaufmannsläden,<br />
Gastwirtschaften, Meierei und Schule. 76 Auch einige Landwirte ließen sich an<br />
ihr nieder. 77<br />
Durch die neuen Siedlungen kamen neue Straßen hinzu, der Kropper Weg, der Bennebeker<br />
Weg, der Börmer Weg, der Weider Weg und 1968 dann die Bahnstraße. Sie verläuft teilweise<br />
auf der ehemaligen Kreisbahnstrecke und parallel zur Dorf- sowie zur Hauptstraße, so dass<br />
Groß Rheide immer mehr von einem ‚Straßen- zum Haufendorf‘ wurde.<br />
Noch heute ist diese Struktur erkennbar, denn die großen Höfe lassen sich wie eingangs beschrieben<br />
noch immer in der Dorfstraße erkennen. Der Ortskern ist die Hauptstraße, an ihr<br />
findet man die meisten Gebäude öffentlichen Lebens. In den restlichen Straßen sind fast ausschließlich<br />
Ein- und Zweifamilienhäuser zu finden.<br />
Die neuen Bauten spiegeln sich auch in einigen Zahlen wider, 1961 gab es in Groß Rheide<br />
181 Privathaushalte, 1970 waren es 204 und 1987 bereits 262. 78 Ebenfalls stieg die Bevölkerungszahl<br />
wieder an, bis sie 1970 642 Einwohner erreicht hatte. 1980 lebten 684 Menschen in<br />
Groß Rheide und 1990 waren es dann schon 775 79 . Im selben Jahr entstanden in einem Teilstück<br />
der Bahnstraße erneut neue Eigenheime, 2000 kam ein neues Wohngebiet, der<br />
Hoverkamp, hinzu, sodass sich die Bevölkerungszahl auf 974 80 erhöhte.<br />
Betrachtet man diese Zahlen insgesamt, so lässt sich sagen, dass in Groß Rheide zwischen<br />
1960 und 2000 eine durchweg positive Bevölkerungsentwicklung stattgefunden hat. Im neuen<br />
Jahrtausend stieg die Zahl zunächst noch an, fällt dann aber leicht unter den Wert von 2000,<br />
auf 927 Einwohner im Jahr 2011. 81<br />
76 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 31<br />
77 Ebd.<br />
78 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 33<br />
79 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 27<br />
80 Amt Kropp-Stapelholm<br />
81 Ebd.<br />
Seite | 15
4.3 Betriebe<br />
Schon seitdem die ersten Menschen auf dem Gebiet des heutigen Groß Rheides siedelten,<br />
spielte die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Was aber passierte mit dem zweiten, dem dritten<br />
oder gar dem vierten Sohn, der den Hof des Vaters nicht übernehmen konnte?<br />
Einige wanderten aus Groß Rheide ab, andere pendelten in nahgelegene Gemeinden und wieder<br />
andere erlernten ein Handwerk und übten dieses in Groß Rheide aus. Schaut man in die<br />
1950er/1960er Jahre zurück, so werden in Groß Rheide 21 Handwerks- und Einzelhandelsbetriebe<br />
(u.a. Sattler Hellmuth Sierts, Schmied Thies Kühl, Schmied Heinrich Schmidt und<br />
Schneider Johann Kühl), 10 Dienstleistungsbetriebe (u.a. Friseur Jürgen Jansen), drei Gastwirtschaften<br />
(Westend, Johannes Sievers und J. Musfeldt) und eine öffentliche Einrichtung,<br />
der Kindergarten, gezählt 82 . Die meisten der ansässigen Betriebe seien allerdings Ergänzungsgewerbe<br />
zur Landwirtschaft 83 gewesen, weshalb mit dem „Höfesterben“ viele Gewerbetreibende<br />
ihre Geschäfte aufgaben, sodass es zu einer Verringerung der Betriebe und damit zu<br />
einem schrumpfenden Arbeitsmarkt außerhalb der Landwirtschaft kam.<br />
Einige Daten belegen dies recht eindeutig, denn die Zahl der Betriebe beziehungsweise Einrichtungen<br />
verringerte sich bis 1994 von insgesamt 35 auf 20. 84 Bis 2012 verringerte sich die<br />
Zahl erneut. Heute bieten 11 Handwerks- und Einzelhandelsbetriebe ( u.a. Möller und Tams<br />
Baugeschäft), ein Dienstleistungsbetrieb (Physiotherapie Dell-Missier) und drei Sozialeinrichtungen<br />
(Brücke Land, Ibeg, Gemeindekindergarten) den Groß Rheidern, neben der Landwirtschaft,<br />
einen Arbeitsplatz. Auffällig ist, dass von ehemals drei Gastwirtschaften und drei Lebensmittelgeschäften<br />
keines mehr übrig ist.<br />
Da Groß Rheide über keine nennenswerten Standortfaktoren, wie Lage an einer Bundesstraße<br />
oder gar eine Autobahnanbindung und weder einen Hafen oder Bahnanschluss verfügte, gab<br />
und gibt es keine Möglichkeit „den Rückgang landwirtschaftlicher [und anderer] Betriebe<br />
durch die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen auszugleichen“ 85 .<br />
Sieht man nun die sinkende Zahl an innerdörflichen Arbeitsplätzen sowie die steigende Bevölkerungszahl<br />
und vergleicht diese mit der geringen Arbeitslosenquote, wird deutlich, dass<br />
ein Großteil der Einwohner zu ihren Arbeitsplätzen pendelt. Viele finden dabei sicherlich einen<br />
Arbeitsplatz in Kropp, sei es bei der Bundeswehr, der Diakonie oder den dort ansässigen<br />
82 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 130<br />
83 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 29<br />
84 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 130<br />
85 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 29<br />
Seite | 16
Handwerksbetrieben. Viele pendeln allerdings noch weiter als in das sieben Kilometer entfernte<br />
Kropp, zum Beispiel nach Husum, Flensburg, Schleswig, Rendsburg oder Kiel.<br />
4.4 Freizeitgestaltung<br />
Zuerst einmal sei gesagt, dass sich die Freizeitstruktur in Groß Rheide in den letzten Jahren<br />
verändert hat, allerdings nicht in dem Maße, wie wir es vor unseren Untersuchungen vermuteten.<br />
Wir wollten anhand der Zahl der Vereine und ihrer Stärke zeigen, dass einen Rückzug aus<br />
dem Dorfleben stattgefunden hat. Tatsächlich konnten wir den erwarteten starken Rückzug<br />
aus dem Vereinsleben nicht feststellen, stattdessen können wir sagen, dass es noch heute ein<br />
reges Vereinsleben gibt.<br />
Nach dem Krieg nahmen die Freiwillige Feuerwehr 86 , die Schützengilde 87 , der TSV (Turnund<br />
Sportverein) 88 und der Gesangsverein den Betrieb wieder auf und bestehen bis heute: Sie<br />
sind somit die ältesten Vereine Groß Rheides. 1965 ist neben den eben aufgeführten auch der<br />
Ortsbauernverband als Verein eingetragen. 89 Mit dem Anwachsen der Gemeinde kamen mehr<br />
Vereine hinzu, 1994 führt Vollstedt folgende Vereine auf: Es sind die Schützengilde, die<br />
Freiwillige Feuerwehr, der DRK-Ortsverein (mit Kartenklub und „Häkelbüdelklub“), der Gesangverein<br />
(Männer- und Frauenchor), der TSV Groß Rheide, die Jagdgenossenschaft und der<br />
Jagdverein “Hubertus“, der Wasser- und Bodenverband „Rheider Au“, der Bauernverband,<br />
der Vdk-Ortsverein, die Laienspielergruppe, der Jugendsing- und spielkreis und die Flötengruppe<br />
Korte. 90 Ein Anstieg der Vereine ist in diesen 30 Jahren deutlich zu erkennen: Von<br />
fünf Vereinen im Jahr 1965 auf 14 Vereine 1997.<br />
Betrachtet man nun die drei großen Vereine, so zeigen auch die Mitgliederzahlen, dass man in<br />
Groß Rheide noch rege am Vereinsleben teilnimmt, wobei es sicherlich auch ein Anzahl an<br />
Groß Rheidern gibt, die in mehreren Vereinen tätig sind. Das ist allerdings nicht als neuere<br />
Entwicklung zu betrachten, denn beim Durchsehen der Vereinsprotokolle seit den fünfziger<br />
Jahren und wahrscheinlich auch schon früher ließen sich einige mehrfache Beteiligungen feststellen.<br />
86 Freiwillige Feuerwehr Groß Rheide: Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 21. März 1947, Groß Rheide<br />
1947<br />
87 nach Auskunft Dieter Tams (Ältermann), da Protokolle der Gilde Groß Rheide bis 1955 verbrannt sind<br />
88 Nach Auskunft, da Protokollbuch von 1920-1953 verloren gegangen ist<br />
89 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 38<br />
90 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 39<br />
Seite | 17
Die Freiwillige Feuerwehr verzeichnet in ihren Protokollen einen Anstieg der Zahl der aktiven<br />
und passiven Mitglieder von 1954 bis 1995, 1954 waren es 46 91 , 1970 zählte man 85 92<br />
und 1994 bereits 144 93 Mitglieder. In den letzten Jahren stagnierte die Mitgliederzahl jedoch,<br />
so dass die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2012 138 Mitglieder 94 zählte. Die Feuerwehr hält<br />
für die Groß Rheider Bevölkerung, ob Mitglieder oder nicht, einige Veranstaltungen bereit.<br />
So gibt es jährlich den Feuerwehrball, ein Osterfeuer und Laterne laufen, die bei guter Wetterlage<br />
auch gut besucht werden.<br />
Der TSV Groß Rheide wurde 1920 gegründet und bot in den letzten knapp 100 Jahren eine<br />
Vielzahl an Sportarten an. Die Zeiten von Schlagball, Schießen, Turnen und Leichtathletik,<br />
die vor allem bis in die 1970er und 1980er Jahren beliebt waren, sind allerdings vorbei. Größerer<br />
Beliebtheit erfreuen sich heutzutage andere oder neuere Sportarten, wie Fußball, Tanzen,<br />
Zumba, Flexibar oder Bodyworkout. Gruppen mit gemischtem Angebot zur sportlichen<br />
Betätigung vom Mutter-Kind-Turnen, über verschiedene Kinder- und Jugendgruppen, bis hin<br />
zur Männer- und Frauensportgruppe bestehen ebenfalls. 95 Eine ganze Bandbreite an Sportarten<br />
kann der TSV auch dank seines 1956 eingeweihten Sportplatzes 96 und seiner 1971 97 von<br />
der Gemeinde erbauten Sporthalle anbieten. Anne Ohm bezeichnete den Bau dieser Halle als<br />
großes Glück für die Gemeinde 98 , da diese für viele Veranstaltungen von der Gemeinde und<br />
verschiedenen Vereinen genutzt wird. Der TSV hat, wie auch die Freiwillige Feuerwehr, steigende<br />
Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Noch um 1956 lag die Zahl bei 90 Mitgliedern, 1988<br />
habe man allerdings bereits um die 350 Mitglieder gezählt. 99 Heute hat der TSV 405 Mitglieder<br />
100 und bietet einige Möglichkeiten für das dörfliche Zusammenkommen, wie zum Beispiel<br />
das Sportfest, die Weihnachtsfeier mit Weihnachtsbasar oder das Kickerturnier.<br />
Die Schützengilde Groß Rheide diente der Gemeinschaft und dem Zusammenhalt. In den Jahren<br />
von 1955 bis heute hat sie eine relativ konstante Teilnehmerzahl von ca. 87 101 Personen.<br />
Jedes Jahr feiern die Mitglieder einige fröhliche Feste miteinander. Thies Lohmann, Ältermann<br />
von 1978 bis 1996, wünscht sich, „dass es uns in der modernen Zeit der Hektik, des<br />
91 Freiwillige Feuerwehr Groß Rheide: Protokolle der Jahreshauptversammlung vom 21. März 1947, Groß<br />
Rheide 1947<br />
92 Entnommen aus der Mitgliederliste von 1970 der Freiwilligen Feuerwehr Groß Rheide<br />
93 Vollstedt, Karl-Heinz,1995. S. 195<br />
94 Entnommen aus der Mitgliederliste von 2012 der Freiwilligen Feuerwehr Groß Rheide<br />
95 Aussage von Volker <strong>Kumm</strong> (1. Vorsitzender des TSV) am 20.01.2013<br />
96 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 197<br />
97 Ebd..<br />
98 Zeitzeugin Anne Christel Ohm am 19.12.2012<br />
99 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 197-198<br />
100 Entnommen aus der Mitgliederliste 2012 des TSV Groß Rheide<br />
101 Entnommen aus den Protokollen der Groß Rheider Schützengilde 1955-2012<br />
Seite | 18
Jagens, und Hastens gelingen möge, unser schönes Gildefest mit einigen frohen, geselligen<br />
Stunden in jedem Jahr mit dem Gedanken der Gemeinschaft zu erhalten“ 102 .<br />
Seit einigen Jahren gibt es außerdem eine ‚Junge-Leute-Gilde‘ der Gemeinden Groß Rheide,<br />
Börm und Dörpstedt, an der Jugendliche ab 16 Jahren teilnehmen können. Wie bei den drei<br />
oben genannten Vereinen lassen sich auch bei vielen anderen immer wieder Zuwächse verzeichnen.<br />
So hat der Musikzug Groß Rheide/Dörpstedt seit einigen Jahren eine große Zahl an<br />
Neubeitritten im Jugendbereich zu notieren. Dort sind ca. 20 Kinder zwischen 9 und 15 Jahren<br />
in der musikalischen Ausbildung 103 , das sind fast doppelt so viele, wie es zurzeit an aktiven<br />
Erwachsenen gibt. Aufgrund von Interessensverschiebungen wird es auch immer wieder<br />
solche Vereine geben, die sich auflösen müssen. Hier wäre zum Beispiel der Gesangverein zu<br />
nennen, der aufgrund fehlenden Nachwuchses, bald verschwunden sein wird. Aber es gibt<br />
auch solche Vereine, die sich neu gründen, wie zum Beispiel die Kindertheatergruppe.<br />
Die Vereine und die Gemeinde bieten den Bewohnern Groß Rheides immer wieder Veranstaltungen<br />
an, zu denen jeder im Dorf kommen kann, um so mit anderen in Kontakt zu treten.<br />
Dazu gehören neben den bereits aufgezählten der Feuerwehrball, das Osterfeuer, das<br />
Kickerturnier und das Laterne laufen, auch das Kinderfest, das Boßeln und das „Schiet sammeln“<br />
104 , wenngleich letzteres nicht dem Vergnügen, sondern dem Dorfbild dient.<br />
Abschließend lässt sich sagen, dass in Groß Rheide dank vieler aktiver Einwohner das Vereinsleben<br />
auch heute noch sehr floriert.<br />
5 Fazit<br />
„Vom Kartoffeldorf zum Wohndorf.“ - Unsere Untersuchungen ergaben, dass Groß Rheide<br />
während der Zeit von 1950 bis 2012 einen großen Wandel sowohl in der Landwirtschaft, als<br />
auch in den dörflichen Strukturen erlebte. Von vormals 74 Voll- und Nebenerwerbsbetrieben<br />
sind heute noch 9 aktive Vollerwerbsbetriebe in Groß Rheide. Neben der Reduktion der Höfe<br />
sank die Zahl der handwerklichen und gewerbetreibenden Betriebe deutlich. Diese Veränderung<br />
führte allerdings kaum zu einer Abnahme der dörflichen Aktivitäten, denn die Vereine<br />
sind noch immer gut besucht.<br />
Trotz der Landflucht steigt die Einwohnerzahl seit den 1970ern deutlich an: Die Bauwelle<br />
brachte neue Einwohner. Selbst wo ehemals der rettende Kartoffelhandel florierte, leben heute<br />
102 Vollstedt, Karl-Heinz, 1995. S. 194<br />
103 Entnommen aus den Mitgliederlisten 2012 des Musikzuges Groß Rheide/Dörpstedt<br />
104 Beim „Schiet sammeln“ handelt es sich, wie es der Name schon sagt, um einen Tag, an dem die Dorfbewohner<br />
durch das Dorf und die umliegenden Straßen ziehen und diese von achtlos Weggeworfenem zu befreien.<br />
Seite | 19
viele Hinzugezogene, denn mit dem Ende des Kartoffeldorfes wurde das Gebäude der Dämpfund<br />
Sortieranlage zu Wohnungen umgebaut. Viele neue Wohngebiete wurden geschaffen, um<br />
Platz für neue Groß Rheider zu machen. Das Gesicht des Dorfes wandelte sich von der ehemals<br />
ausschließlich agrarisch, bäuerlich geprägten Gemeinde hin zum Familienidyll mit Ein-<br />
Familienhäusern.<br />
Seite | 20
6 Literatur-/Quellenverzeichnis<br />
Verwendete Literatur<br />
• Ambrosius, Gerold: Sektoraler Wandel und internationale Verflechtung. Die bundesdeutsche<br />
Wirtschaft im Übergang zu einem neuen Strukturmuster. In: Raithel, Thomas/ Wirsching,<br />
Andreas (Hrsg.): Auf dem Weg in eine neue Moderne? Die Bundesrepublik in den<br />
siebziger und achtziger Jahren, München 2009.<br />
• Ambrosius, Gerold: Wirtschaftsstruktur und Strukturwandel: Gesamtwirtschaft. In: Ambrosius,<br />
Gerold/Petzina, Dietmar/ Plumpe, Werner (Hrsg.): Moderne Wirtschaftsgeschichte.<br />
Eine Einführung für Historiker und Ökonomen, München 1996.<br />
• Danker, Uwe: Landwirtschaft und Schwerindustrie Schleswig-Holsteins seit 1960:<br />
Schlaglichter auf sektoralen Strukturwandel. In: Demokratische Geschichte: Jahrbuch für<br />
Schleswig-Holstein 18, 2007.<br />
• Exner, Peter: Beständigkeit und Veränderung. Konstanz und Wandel traditioneller Orientierungs-<br />
und Verhaltensmuster in Landwirtschaft und ländlicher Gesellschaft in Westfalen<br />
1919-1969. In: Frese, Matthias/Prinz: Michael: Politische Zäsuren und gesellschaftlicher<br />
Wandel im 20. Jahrhundert. Regionale und vergleichende Perspektiven. Paderborn<br />
1996.<br />
• Strehlow, Karen: Agrarstrukturwandel und agrarpolitische Krisenbewältigung in Deutschland,<br />
Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, Baden-Baden 1992.<br />
Verwendete Quellen<br />
• Bilder aus der Sammlung von Sönke Brumm und Klaus Lohmann<br />
• Daten des Amtes Kropp-Stapelholm<br />
• Protokolle der Freiwilligen Feuerwehr<br />
• Protokolle der Groß Rheider Schützengilde<br />
• Mitgliederlisten des Musikzug Groß Rheide/Dörpstedt<br />
• Vollstedt, Karl-Heinz „Groß Rheide, Chronik der Gemeinde“ Eckernförde 1995.<br />
• Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch Schleswig-Holstein<br />
1954, Statistisches Bundesamt, Kiel-Wik 1954.<br />
• Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch Schleswig-Holstein<br />
1969, Statistisches Bundesamt, Kiel 1969.<br />
Seite | 21
• Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch Schleswig-Holstein<br />
1980, Statistisches Bundesamt, Kiel 1980.<br />
• Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.): Statistisches Taschenbuch Schleswig-Holstein<br />
2003, Statistisches Bundesamt, Kiel 2003.<br />
• Zeitzeugen Anne Christel Ohm, Annelene Lohmann, Thies Lohmann und Klaus Lohmann<br />
Internetquellen<br />
• Amt Kropp-Stapelholm: Groß Rheide (2013), URL: http://www.kropp.de/de/grossrheide.html<br />
(Stand: 08.01.2013) .<br />
• Google maps: Entfernung Groß Rheide – Husum (o.J.), URL:<br />
http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=ll (Stand:20.01.2013).<br />
• Google maps: Entfernung Groß Rheide – Schleswig (o.J.), URL:<br />
http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=ll (Stand: 20.01.2013).<br />
• Google maps: Entfernung Groß Rheide – Rendsburg (o.J.), URL:<br />
http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=ll (Stand: 20.01.2013).<br />
• Wikipedia: Lage Groß Rheides im Kreis Schleswig-Flensburg (2012), URL:<br />
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gross_Rheide_in_SL.PNG&filetimestam<br />
p=20080112110122 (Stand: 08.01.2013).<br />
• WiREG: Groß Rheide (o.J.), URL: http://www.wireg.de/die-region/diegemeinden/staedte-und-gemeinden-in-flensburgschleswig/gemeindeid-52/<br />
(Stand:<br />
19.01.2013).<br />
Seite | 22
Eidesstattliche Versicherung<br />
Wir versichern, dass wir die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt und keine anderen als<br />
die angegebenen Hilfsmittel verwendet haben. Wörtlich oder dem Sinn nach aus gedruckten<br />
oder elektronischen Quellen entnommene oder entlehnte Textstellen sind von uns durchweg<br />
eindeutig als solche gekennzeichnet worden.<br />
Uns ist bekannt, dass auch kleinere Verstöße gegen diese Erklärung nicht nur die Annullierung<br />
dieser Arbeit und den Ausschluss aus der betreffenden Lehrveranstaltung zwingend nach<br />
sich ziehen, sondern darüber hinaus zu weiteren Sanktionen der Universität Flensburg führen<br />
können. 105<br />
Flensburg den 23.01.12<br />
105 http://www.uni-flensburg.de/geschichte/linksmaterialien/materialien/wissenschaftliches-arbeiten/<br />
(23.12.2012 18:52 Uhr)<br />
Seite | 23