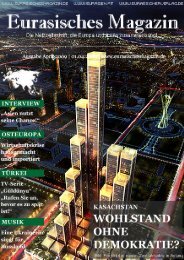Eurasisches Magazin 12-11
Eurasisches Magazin 12-11
Eurasisches Magazin 12-11
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zur neuen Ausgabe <strong>12</strong>-20<strong>11</strong><br />
Von EM Redaktion<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Liebe Leserinnen und Leser des Eurasischen <strong>Magazin</strong>s,<br />
Mit „Trommelwirbel aus dem Reich der Mitte“ und „Nationalcircus auf den Spuren der<br />
Seidenstraße“ bringen wir zwei farbenprächtige Berichte über Exportschlager Chinas im<br />
Showgeschäft und in der Artistik. Unser Beitrag „Der schwierige Nachbar im Meer“ berichtet<br />
über Macht und Widerstand in den Beziehungen Chinas zu den ASEAN-Ländern und die<br />
Gründe, weshalb der Versuch eines friedlichen Aufstiegs der Region vielleicht schon an seine<br />
Grenzen stößt. Schließlich erfahren Sie von Wilfried Arz alles Wichtige über „Chinas<br />
Milliardenprojekt in Birma/Myanmar“. Hier werden Investitionen aus westlichen<br />
Industriestaaten durch Sanktionen verhindert, während sich China, Thailand und Südkorea
längst den Zugriff zu den Erdgasvorkommen des Landes gesichert haben. China baut gleich<br />
zwei Pipelines vom Indischen Ozean quer durch Birma in die Provinz Yunnan.<br />
Alexander Rahr hat kürzlich ausführlich mit Russlands starkem Mann Wladimir Putin<br />
gesprochen. Im EM-Interview geht es um die Frage „Welche Absichten hat Putin mit der<br />
Eurasischen Union?“ Die wichtigsten Aussagen Putins lauten: „Die Eurasische Union ist<br />
zunächst nur eine Wirtschaftsgemeinschaft“ und „die Eurasische Union ist keine neue<br />
Sowjetunion“.<br />
Das Thema „Eurasische Spiritualität“ ist in dieser letzten Ausgabe des Jahres auch mit zwei<br />
Beiträgen vertreten. Zum einen berichten wir über 15.000 Jahre alte Steinmalereien, die in<br />
einer Höhle auf der Schwäbischen Alb gefunden wurden, über deren unglaublichen Reichtum<br />
an vorzeitlicher Kunst („Venus von Schelklingen“) wir bereits mehrere Beiträge<br />
veröffentlichen konnten. Hier wurde jetzt auch die älteste Tradition von Malerei in<br />
Mitteleuropa entdeckt. Zum anderen geht es auch in einer Buchrezension um „Eurasische<br />
Spiritualität“: „Die Externsteine – eine Wanderung durch Mythos und Geschichte“ von Heiko<br />
Petermann. „Die Externsteine sind ein in Stein gemeißeltes Geheimnis unserer Kultur“ heißt<br />
es in der Verlagsmitteilung auf der Umschlagseite des Buches. Das dürfte unumstritten sein.<br />
Am Ende des Beitrags verweisen wir noch auf eine umfangreiche Linksammlung zum Thema<br />
„Eurasische Spiritualität“.<br />
Das EM-Team wünscht allen Lesern ein schönes Weihnachtsfest und einen ebensolchen<br />
Jahresausklang – und dass sie mit dieser Ausgabe möglichst viele neue Erkenntnisse<br />
gewinnen und viel Freude an den erlangten Einsichten haben mögen.<br />
Termine <strong>12</strong>-20<strong>11</strong><br />
Von EM Redaktion<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Berlin bis 07.<strong>12</strong>: Filmfest „Russische Filmwoche in Berlin“ – Infos hier<br />
Berlin bis 02.01.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Ai Weiwei. Teehaus, 2009“ – Infos hier<br />
Berlin bis 30.09.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ – Infos<br />
hier<br />
Berlin, Ende offen: Ausstellung „Antike Welten. Griechen, Etrusker und Römer im Alten<br />
Museum“ – Infos hier<br />
Berlin, Ende offen: Ausstellung „Wir sind ein Volk. Gemeinsame Münzthemen im Geteilten<br />
Deutschland“ – Infos hier<br />
Bonn bis 08.01.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Anime! High Art – Pop Culture” – Infos hier<br />
Dresden bis 31.<strong>12</strong>: Ausstellung „Das Dresdner Damaskus-Zimmer. Ein Kleinod osmanischer<br />
Innenarchitektur in Dresden“ – Infos hier
Dresden bis 08.01.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Indien suchen – Werte finden. Zeichnungen von<br />
Rainer Schoder. Hommage an Rabindranath Tagore (1861-1941)“ – Infos hier<br />
Köln bis 15.01.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Ichundichundich. Picasso im Fotoportrait“ – Infos hier<br />
Köln bis 04.03.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Japanische Malerei“ – Infos hier<br />
Köln bis 05.03.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Goldene Impressionen: Japanische Malerei 1400 – 1900“<br />
– Infos hier<br />
München bis 29.04.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Oya. Von osmanischer Mode zu türkischer<br />
Volkskunst“ – Infos hier<br />
Oettingen bis 05.02.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Gesichter des Buddha. Kunst des Buddhismus in<br />
Asien“ – Infos hier<br />
Wien bis 08.01.20<strong>12</strong>: Ausstellung „Wintermärchen. Winter-Darstellungen in der<br />
europäischen Kunst von Bruegel bis Beuys“ – Infos hier<br />
Eurasien-Ticker <strong>12</strong>-20<strong>11</strong><br />
Höhlenmalereien zeigen die Realität · Der Hunger in der Welt ist eine<br />
gemachte Katastrophe · Neue Potenziale für Europas Erdgasversorgung ·<br />
Kohle in der Mongolei · Weißbuch für PR und Medienarbeit in China ·<br />
Bewerbungen für das ASA-Programm 20<strong>12</strong> · Belarussischer Abend bei Kultur<br />
· Aktiv am 16.Dezember · „Die Zukunft der Geopolitik wird in Asien<br />
bestimmt“ · Rödl & Partner schafft Russian-Desk in Nürnberg<br />
Von EM Redaktion<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Höhlenmalereien zeigen die Realität<br />
EM - Anhand von Gentests konnte ein internationales Forscherteam erstmals beweisen, dass<br />
eiszeitliche Pferde tatsächlich auch gescheckt waren, wenn prähistorische Menschen sie so an<br />
die Felsen gezeichnet haben. „Das Ergebnis zeigt, wie die Umwelt der Menschen im<br />
Pleistozän war und wie sich die Tiere seit damals entwickelt haben“, sagt Arne Ludwig vom<br />
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (http://www.izw-berlin.de) gegenüber der<br />
Agentur pressetext. Die genaue Beobachtung der Menschen in der Steinzeit bildete die<br />
Grundlage für deren Jagderfolg und die spätere Domestikation der Pferde und Rinder.<br />
Bisher glaubten viele Forscher, dass in prähistorischer Zeit eine gefleckte Fellfarbe bei<br />
Pferden unwahrscheinlich war und interpretierten Abbildungen solcher Tiere als symbolische<br />
Repräsentation im Sinne abstrakter Kunst. Forscher aus Deutschland, England, den USA,<br />
Spanien, Russland und Mexiko analysierten nun die Farbvariabilität von 31 prädomestizierten<br />
(halb wilden, halb zahmen) Pferden, deren Überreste bis zu 35.000 Jahre alt sind. Die<br />
untersuchte DNA wurde aus Knochen und Zähnen gewonnen.
Die Fundstücke stammen von 15 verschiedenen Standorten aus Sibirien, Ost- und Westeuropa<br />
und der Iberischen Halbinsel. „Unsere Ergebnisse stützen die Vorstellung, dass die<br />
Höhlenmalerei ein Abbild der natürlichen Umwelt des Menschen ist und weniger einen<br />
symbolischen oder transzendentalen Hintergrund hat, wie oft vermutet wird“, sagt Michi<br />
Hofreiter von der University of York.<br />
Mehr über Höhlenfunde und weitere Links zu „Eurasische Spiritualität“ finden Sie hier.<br />
(Beachten Sie bitte die Linksammlung am Ende des empfohlenen Beitrags)<br />
Der Hunger in der Welt ist eine gemachte Katastrophe<br />
EM – Die Hungerkatstrophe in vielen Ländern wäre vermeidbar. So die zentrale These der<br />
neuen „Edition Le Monde diplomatique“ in ihrem Beitrag „Cola, Reis & Heuschrecken“.<br />
(Erschienen am 29. November 20<strong>11</strong>).<br />
In dieser zehnten Ausgabe der halbjährlich vom taz Verlag veröffentlichten Themenhefte<br />
beschäftigen sich die Autoren mit einer Frage, von der viele einmal glaubten, sie werde im 21.<br />
Jahrhundert längst gelöst sein: mit der Ernährung der Welt. Auf 1<strong>12</strong> Seiten untersuchen<br />
Katharina Döbler, Jean Ziegler und viele weitere, warum rund eine Milliarde Menschen<br />
immer noch hungern.<br />
„Investoren aller Art profitieren von der Spekulation mit Nahrungsmitteln“, so der Verlag.<br />
„Agrarkonzerne zerstören die Lebensgrundlage von Kleinbauern. Auf Äckern, die einst der<br />
lokalen Bevölkerung Kartoffeln, Bohnen und Mais lieferten, wachsen heute Biospritpflanzen<br />
und Viehfutter für den weltweit steigenden Fleischkonsum.“<br />
In 24 Beiträgen zeichnet das Heft ein detailliertes Bild der Ernährungsindustrie und schildert,<br />
wie wirtschaftliche Interessen und politische Fehlentscheidungen die Krise<br />
verschlimmern. Die neue Ausgabe der „Edition Le Monde diplomatique“ ist für 8,50 Euro<br />
bundesweit im Handel erhältlich.<br />
Neue Potenziale für Europas Erdgasversorgung<br />
EM - Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und<br />
Rohstoffe (BGR) schätzt, dass das Levantinische Becken im östlichen Mittelmeer ein großes<br />
Potenzial für Erdgasfirmen bietet. Im vergangenen Jahr hat die BGR während einer<br />
Forschungsfahrt in der Region geophysikalische Daten aufgezeichnet, die derzeit ausgewertet<br />
werden und eine wichtige Grundlage zur Einordnung von Kohlenwasserstofflagerstätten in<br />
der Region bilden. „Nach unseren Erkenntnissen und aufgrund der kürzlich entdeckten<br />
Lagerstätten könnte das Levantinische Becken in Zukunft eine wichtige Rolle bei der<br />
Energieversorgung Europas spielen“, sagt Dr. Harald Andruleit, Energierohstoffexperte der<br />
BGR.<br />
Das Levantinische Becken befindet sich nordostwärts des Nil-Deltas und wurde in der<br />
Vergangenheit aufgrund politischer Spannungen zwischen den Anrainerstaaten von der Erdölund<br />
Erdgasindustrie vernachlässigt. Mittlerweile gilt es jedoch als Hoffnungsträger. Immer<br />
wieder stoßen Explorationsfirmen auf neue Lagerstätten. 2009 war es das „Tamar-Feld“ mit<br />
einem geschätzten Inhalt von 238 Milliarden Kubikmeter. Im vergangenen Jahr entdeckte die<br />
US-Explorationsfirma „Noble Energy“ etwa 130 Kilometer westlich vom israelischen Haifa,<br />
in 1634 Meter Tiefe, das weltweit größte Erdgasvorkommen im Tiefstwasser des vergangenen
Jahrzehnts, das „Leviathan-Feld“. Nach vorläufigen Schätzungen soll dieses „Giant“-Feld<br />
rund 453 Milliarden Kubikmeter enthalten. Aber nicht nur größere, sondern auch kleinere<br />
Vorkommen werden exploriert. Erst kürzlich haben Geologen das „Dalit-Feld“ entdeckt. Sein<br />
Inhalt beträgt nach ersten Berechnungen etwa 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas.<br />
Neben den zum Teil noch offenen Territorialfragen erschweren technische Herausforderungen<br />
und unklare Regularien die weitere Nutzbarmachung der Ressourcen dieser Regi-on.<br />
Die Offshore-Grenzen der betroffenen Mittelmeerstaaten waren in der Vergangenheit<br />
unzureichend definiert. Erst 2006 haben Ägypten und Zypern eine Vereinbarung für eine<br />
exklusive Wirtschaftszone in ihren angrenzenden Gewässern im Mittelmeer geschlossen; das<br />
Gleiche gilt für den Libanon und Zypern (2007) sowie Israel und Zypern (2010). Zudem sind<br />
die Gasvorkommen von einer mehrere Kilometer mächtigen Salzschicht, den Messinischen<br />
Evaporiten überdeckt, was die Exploration und die Förderung erschwert.<br />
Weitere Informationen: http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/energie_node.html<br />
Kohle in der Mongolei<br />
EM - Die Mongolei verfügt neben bedeutenden mineralischen Rohstoffen wie beispielsweise<br />
Kupfer und Gold auch über große Vorkommen an Kohle. Darunter befinden sich beachtliche<br />
Lagerstätten an Kokskohle, die für die Stahlerzeugung unverzichtbar ist. Bei der Gewinnung<br />
der Rohstoffe sind bereits in zunehmender Zahl ausländische Unternehmen beteiligt. Auch<br />
deutsche Bergbaumaschinen und Ingenieurdienstleistungen sind gefragt.<br />
Bislang wurde nur ein relativ geringer Teil der immensen Kohlevorräte der Mongolei<br />
detailliert erkundet. Bekannt sind heute etwa 40 große Kohlevorkommen, von denen aber<br />
aufgrund mangelnder Infrastruktur bis heute nur wenige Lagerstätten bis zur Produktionsreife<br />
gebracht wurden. Die wichtigsten Steinkohleprovinzen liegen in den nördlichen, westlichen<br />
und südlichen Landesteilen. Braunkohle ist in den übrigen Kohlebecken im Osten und im<br />
Zentrum des Landes verbreitet.<br />
Während sich die wirtschaftlich gewinnbaren Reserven an Steinkohle auf rund 1,2 Milliarden<br />
Tonnen (Ressourcen: 39,8 Milliarden Tonnen) belaufen, fallen die Braunkohlevorräte mit<br />
Reserven von rund 1,4 Milliarden Tonnen (Ressourcen: <strong>11</strong>9,4 Milliarden Tonnen) noch<br />
wesentlich höher aus. Dank der günstigen Lagerungsverhältnisse kann der Abbau der<br />
mächtigen und oberflächennahen Flöze sowohl der Steinkohle als auch der Braunkohle<br />
vorrangig im Tagebau erfolgen.<br />
Weitere Informationen: Investorenhandbuch Nichtmetall- und ausgewählte Metallrohstoffe<br />
der Mongolei:<br />
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Projekte/Rohstoffwirtschaftlaufend/Investorenhandbuch_Mongolei.html<br />
Weißbuch für PR und Medienarbeit in China<br />
EM - Der Aufstieg Chinas zu einem der wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands stellt<br />
Kommunikatoren und Marketing-Verantwortliche deutscher Unternehmen vor komplexe<br />
Herausforderungen. Wie kommuniziert man im Dreieck zwischen Medien, Politik und<br />
Unternehmen? Worauf baut man seine Kommunikationsstrategie in China auf? Wie schützt,
fördert und positioniert man seine Marken in einem der am schnellsten wachsenden Märkte<br />
der Welt?<br />
Einen Überblick über Public Relations in China bietet das neue Weißbuch „PR and the Party<br />
– the Truth about Media Relations in China“, das von Eastwei MSL vorgestellt wurde.<br />
Eastwei MSL gehört zur MSLGROUP, der weltweit viertgrößten PR- und<br />
Reputationsagentur. Die MSLGROUP ist seit 20<strong>11</strong> die größte PR-Agentur in China und<br />
verfügt auch über Erfahrung in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit. MSL Germany<br />
koordiniert für zahlreiche deutsche Unternehmen die PR-Arbeit im chinesischen Markt und<br />
hatte in den vergangenen Jahren das Kommunikationsmandat für den offiziellen<br />
Manageraustausch zwischen der Europäischen Union und China (EU-China Managers<br />
Exchange and Training Programme) inne.<br />
„PR and the Party“ untersucht und erklärt die komplexe, dynamische und häufig<br />
widersprüchliche Kommunikationslandschaft in China. Ob der Einfluss der Partei auf die<br />
Medien, die Herausforderungen eines zunehmend saturierten Marktes oder das Thema<br />
Medien und Korruption: „PR and the Party“ bietet einen aktuellen Einblick in die<br />
Herausforderungen für Kommunikatoren. Der Marktanalyse folgt ein Teil mit den wichtigsten<br />
Empfehlungen der Experten von Eastwei MSL. Kurzprofile der wichtigsten chinesischen<br />
Medien runden das Kompendium ab.<br />
Das Weißbuch „PR and the Party “ können Sie hier einsehen und lesen.<br />
Bewerbungen für das ASA-Programm 20<strong>12</strong><br />
EM - Am 10. November hat die Bewerbungsphase für das ASA-Programm 20<strong>12</strong> begonnen<br />
und läuft noch bis zum 10. Januar 20<strong>12</strong>. Junge Menschen zwischen 21 und 30 Jahren aus fast<br />
allen Berufszweigen und Studienrichtungen können sich dann für die Teilnahme 20<strong>12</strong><br />
bewerben. Das ASA-Programm richtet sich an alle, die in Deutschland leben und hier<br />
studieren oder eine duale oder schulische Berufsausbildung abgeschlossen haben.<br />
Bewerbungen sind bis zum 10. Januar 20<strong>12</strong> unter www.asa-programm.de möglich. Das<br />
ASA-Programm arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).<br />
Seit über fünfzig Jahren fördert ASA Menschen, die sich für globale Zusammenhänge<br />
interessieren, sich engagieren und etwas bewegen wollen. Das Programm bietet eine<br />
Kombination aus Seminaren, einem Praxisaufenthalt in einem Land Afrikas, Asiens,<br />
Lateinamerikas oder Südosteuropas und unterstützt die Teilnehmenden anschließend bei der<br />
Umsetzung einer Aktion oder Kampagne in Deutschland.<br />
Weitere Informationen zum ASA-Programm und zum Online-Bewerbungsverfahren finden<br />
Sie unter www.asa-programm.de<br />
Belarussischer Abend bei Kultur Aktiv am 16.Dezember<br />
Am Freitag, den 16.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong> veranstaltet der Kultur Aktiv auf der Bautzner Straße. 49 in<br />
01099 Dresden einen belarussischen Abend, der sich künstlerisch und thematisch mit dem<br />
unentdeckten Land an Europas östlicher Peripherie auseinandersetzt und zugleich auf die<br />
Weihnachtszeit einstimmt. Wir freuen uns auf eine spannendes Programm und einen schönen<br />
Abend mit Performance, Präsentation, Filmen, Vernissage, Büffet, Konzert und Party
Mit den renommierten belarussischen Fotografen/Fotokünstlern Artur Klinau, Igor Savchenko<br />
und Andrei Liankevich konnte die Galerie neuer Osten drei international anerkannte Künstler<br />
gewinnen, die ihren persönlichen, differenzierten Blick auf die Terra Incognita Belarus und<br />
deren öffentliche und private Räume zur Diskussion stellen. Ergänzt wird diese Troika durch<br />
einen Blick von außen des Fotografen Matthias Schumann, der mit der Postkartenmotivserie<br />
„Schöne Grüße aus Drensk“ tradierte Sehgewohnheiten hinterfragt.<br />
Mit dem belarussischen Abend möchte Kultur Aktiv alle einladen, gemeinsam zu feiern und<br />
der Frage zu stellen: Was wissen wir über Weißrussland?! Andauernde<br />
Menschenrechtsverletzungen in der letzten Diktatur Europas unter dem Regime des<br />
ehemaligen Kolchosvorsitzenden Lukaschenko. Rückzugsraum für die letzten freilebenden<br />
Wisente und Wildpferde am westlichen Rand der Republik. Ein riesiges Sumpfgebiet mit der<br />
Hauptstadt Minsk im Zentrum. Durch Tschernobyl verstrahlte Weiten im Süden des<br />
Landes. Viel wissen wir nicht über das Land am Rande Europas. Das möchten wir ein Stück<br />
weit ändern! (Eintritt frei).<br />
Programmüberblick hier<br />
„Die Zukunft der Geopolitik wird in Asien bestimmt“<br />
EM - Das ist das Leitmotiv eines Artikels der US-Außenministerin Hillary Clinton, der in der<br />
November-Ausgabe des <strong>Magazin</strong>s „Foreign Policy“ erschien. Der Titel des Artikels<br />
beeindruckt – „Amerikas pazifisches Jahrhundert“. Auf der Titelseite heißt es nur– „Unser<br />
pazifisches Jahrhundert“.<br />
In dem Artikel wird der Region nicht nur ein enormes Wirtschaftswachstum eingeräumt, das<br />
den Schwerpunkt der Weltwirtschaft nach Asien verschoben hat, sondern auch die<br />
Wichtigkeit der US-Führungsrolle und -Dominanz im Asiatisch-Pazifischen Raum<br />
hervorgehoben. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Präsidentenwahlen fühlen sich jetzt<br />
die US-Oppositionellen herausgefordert, die der Ansicht sind, dass die USA bei der<br />
Wirtschaftskrise und finanzieller Instabilität zurückkehren sollen.<br />
Mehr dazu lesen Sie hier<br />
Rödl & Partner schafft Russian-Desk in Nürnberg<br />
EM - mit der Einrichtung eines Russian Desk in Nürnberg schafft die internationale<br />
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner eine direkte Anlaufstelle für deutsche<br />
Unternehmen, die in Russland und den GUS-Staaten investieren. Der Russian Desk wird<br />
geleitet von der russischen Rechtsanwältin und Steuerberaterin Daria Pfeiler.<br />
Informationen hier<br />
EM-INTERVIEW<br />
„Die ägyptische Revolution ist eine<br />
dreiköpfige Schlange“
In Ägypten wird eine Art islamischer Sozialismus mit liberaler Tendenz<br />
geprobt. Auf dem Tahrir-Platz waren die treibenden Kräfte hauptsächlich<br />
Nasseristen, Muslimbrüder und Kommunisten. Im Gespräch mit dem<br />
Schriftsteller Ildar Abusjarow zur Situation in Ägypten und den Ländern des<br />
arabischen Frühlings werden überraschende Aspekte und weitgehend<br />
unbekannte Zusammenhänge aufgezeigt.<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Zur Person: Ildar Abusjarow<br />
Ildar Abusjarow ist einer der interessantesten Schriftsteller der jüngeren Generation<br />
Russlands. In seinen Texten spiegelt sich die beeindruckende kulturelle und religiöse<br />
Vielfalt Russlands. Er wurde 1975 in Nischnij Nowgorod (damals Gorki) geboren.<br />
Heute lebt und arbeitet Ildar Abusjarow in Balaschicha bei Moskau. Zahlreiche<br />
seiner Erzählungen wurden in den bedeutendsten Literaturzeitschriften veröffentlicht.<br />
Seine Romane „Chusch“, „Mutabor“ und „Agrablenije po-Olbanski“ riefen in<br />
Russland kontroverse Debatten hervor.<br />
Der Sammelband „Trolleybus nach Osten“ mit Erzählungen Abusjarows in<br />
Übersetzung von Hannelore Umbreit erschien in Deutschland 20<strong>11</strong> im Weissbooks<br />
Verlag. Während der Unruhen in Ägypten Anfang 20<strong>11</strong> berichtete Abusjarow aus<br />
Ägypten für russische Medien, und für die deutsche FAZ.<br />
Siehe auch die Rezension zu Abusjarows „Trolleybus nach Osten“ im Eurasischen<br />
<strong>Magazin</strong> 10/20<strong>11</strong>.<br />
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong>: Revolutionen gingen früher von einzelnen Gehirnen aus, die man alle<br />
noch heute kennt, von der Französischen Revolution über Marxismus, Leninismus bis<br />
Nationalsozialismus. Was ist im sogenannten Arabischen Frühling anders. Wo sind die<br />
Köpfe? Woher hatten die Menschen ihr revolutionäres Gedankengut und wodurch wussten<br />
sie, dass es Zeit war, loszuschlagen?<br />
Ildar Abusjarow: Hier sind es eher die Erinnerungen als die Köpfe, die die Menschen<br />
bewegen. Die Erinnerung daran, dass das Volk sich bereits in den Jahren 1919 bis 1921, zur
Zeit der ägyptischen Aufstände, und 1952, zur Zeit der Revolution, erhob. Solche Perioden<br />
der nationalen Erhebung sind als Marksteine äußerst wichtig für das Volk. Für sein<br />
Selbstbewusstsein und seine Selbstachtung. Diese Erinnerungen können vieles ersetzen.<br />
Ägypten ist ein sehr traditionelles Land, und solche Perioden der nationalen Erhebung werden<br />
von Mund zu Mund in Form von Legenden überliefert. Die Köpfe aber, denke ich, sind<br />
dieselben: der Prophet Mohammed mit der Idee der Gerechtigkeit und der Prophet der<br />
Revolution Marx und vielleicht jemand von den Ideologen des Liberalismus.<br />
EM: Wie würden Sie diese revolutionäre Mischung nennen?<br />
Abusjarow: Das ist eine Art islamischer Sozialismus mit liberaler Tendenz. Denn auf dem<br />
Tahrir-Platz waren, abgesehen vom Volk, die hauptsächlichen treibenden Kräfte die<br />
Nasseristen, die Muslimbrüder und die Kommunisten. Wenn man in der metaphorischen<br />
Sprache der Sagen und Märchen spricht, ist die Revolution eine dreiköpfige Schlange, die in<br />
der Dunkelheit an der Kette sitzt und auf ihre Chance wartet. Man schlägt einen Kopf ab,<br />
während ein anderer erscheint.<br />
„Auf dem Tahrir-Platz hat die Leute ein bürgerlicher Gott<br />
geführt“<br />
EM: Ist das jetzt ein Mangel, dass nicht eine erkennbare Ideologie, eine revolutionäre Theorie<br />
oder ein Programm wie das Kommunistische Manifest o. ä. am Anfang dieser Bewegung<br />
stand?<br />
Abusjarow: Das ist eher ein Plus, als ein Minus. Denn das Volk fühlt intuitiv vieles besser<br />
als die Politiker, wenn sie währenddessen niemand manipuliert und Gehirnwäsche betreibt. Es<br />
gibt so eine Wahrheit: was das Volk will, das will Gott. Die Menschen sind Gottes Statthalter<br />
auf Erden, das glauben sowohl die ägyptischen Christen als auch die Muslime.<br />
In Ägypten auf dem Tahrir-Platz hat die Leute eine Art bürgerlicher Gott geführt, ein<br />
universaler Verstand oder Geist, und die Menschen selbst spürten intuitiv, was sie tun und<br />
wohin sie gehen mussten. Sie konnten sich wunderbar selbst organisieren. Im alten Ägypten<br />
nannte man diese Kraft „Tarikon“.<br />
„Wird das Land unter Einflussgruppen aufgeteilt und<br />
werden mittels Bestechung und Erpressung für ein paar<br />
Pfennig alle Ressourcen abgepumpt?“<br />
EM: Sie waren im Sommer in Ägypten und haben dort die Proteste auf dem Tahrir-Platz<br />
miterlebt. Mit welchen Gefühlen haben Sie den Aufbruch in Ägypten damals verfolgt, und<br />
was fühlen Sie angesichts der aktuellen Meldungen aus Ägypten?<br />
Abusjarow: Zur Zeit des „arabischen Frühlings“ erfüllte mich, wie auch die gesamte Nation,<br />
eine Welle der Begeisterung. Dieses trunken machende Gefühl der Freiheit, dieser emotionalmoralische<br />
Schwung hat vieles ersetzt. Doch bereits damals stellte ich mir Fragen und konnte<br />
mir nicht recht klar werden über die grundsätzlichen Ursachen und möglichen Folgen der<br />
arabischen Revolutionen. Für mich ist bis heute quälend unklar, ob diese Revolutionen einen<br />
Tag des Zorns darstellen, ein Ergebnis starker Proteststimmung, die die Welt überrumpelte?<br />
Oder war das bekannte Chaos, mit dessen Hilfe das Land zu solch einem Zustand des
Bruderkampfes herabgewürdigt wird, dass die Gesellschaft sich nicht konsolidieren kann,<br />
sondern mit endloser innerer Demontage beschäftigt ist, den Neokolonisatoren und den von<br />
ihnen Beherrschten nützlich? Wird das Land unter Einflussgruppen aufgeteilt und werden<br />
mittels Bestechung und Erpressung für ein paar Pfennig alle Ressourcen abgepumpt?<br />
Wenn ich darauf blicke, was derzeit auf den Straßen Kairos geschieht und mich an die<br />
Teilung des Sudans erinnere, dann neige ich zur zweiten Variante. Die Neokolonisten<br />
benutzen zu ihren Zwecken das gleiche Instrumentarium, mit dessen Hilfe sowohl Muammar<br />
Gaddafi als auch die ägyptischen Generäle sie einmal ihrer Macht beraubt und aus ihren<br />
Ländern verjagt haben. Das heißt, sie benutzen die Revolution mit dem Ziel der<br />
Unterjochung.<br />
„Eine der möglichen Varianten ist eine Teilung Ägyptens<br />
nach konfessionellen Kriterien“<br />
EM: Wie lief das damals im Sudan, wie sieht das Muster aus?<br />
Abusjarow: Um sich den möglichen weiteren Verlauf der Entwicklung der<br />
Ereignisse auszumalen, reicht es, auf die benachbarten Länder Sudan und Somalia zu<br />
schauen. Einst stand der Sudan unter dem Protektorat Ägyptens, doch als Konsequenz von<br />
Druck oder „Wind aus dem Westen“ war Nasser gezwungen, diesen Teil des Landes<br />
abzugeben. Das heißt, einmal wurde Ägypten praktisch schon geteilt.<br />
EM: Was heißt das für die Zukunft des heutigen Ägyptens?<br />
Abusjarow: Eine der möglichen Varianten ist eine Teilung Ägyptens nach konfessionellen<br />
Kriterien. Kurz vor der Revolution gab es bereits Provokationen gegen die Kopten in Nag<br />
Hammadi, als aus vorbeifahrenden Autos sechs junge Ägypter erschossen wurden, die nach<br />
dem Weihnachtsgottesdienst aus der Kirche kamen. Gleich nach den blutigen Ereignissen traf<br />
in Ägypten eine Delegation der Kommission der USA für internationale Religionsfreiheit ein,<br />
um lautstarke Stellungnahmen abzugeben und eine Reihe von Treffen mit Menschenrechtlern<br />
und Geistlichen abzuhalten. Doch der Patriarch der Koptisch-Orthodoxen Kirche Shenouda<br />
III. lehnte ein Treffen ab und beschuldigte die Delegation, sich in innere<br />
Angelegenheiten Ägyptens einzumischen.<br />
EM: Das Jahr 20<strong>11</strong> begann in Ägypten mit einem Bombenanschlag auf eine koptische<br />
Kirche. Im Zuge der Proteste gegen das Regime von Mubarak schienen die religiösen<br />
Konflikte auf einmal vergessen. Im Herbst folgten neue Spannungen zwischen Christen und<br />
Muslimen, jetzt richten sich die Demonstrationen wieder gegen das Militär. Wo verlaufen die<br />
Konfliktlinien in der ägyptischen Gesellschaft wirklich?<br />
Abusjarow: Das ist eben eine Frage von mangelnder Verantwortung, von Unreife der<br />
Gesellschaft. Die Kopten waren lange eine Minderheit. Doch die Revolution berauscht sie mit<br />
den Möglichkeiten, die sich öffneten. Sie entschieden, dass es Zeit sei, volle<br />
Gleichberechtigung zu fordern. In diesem Wunsch unterstütze ich sie natürlich. Doch<br />
andererseits gibt es eine Masse bestehend aus einer zornigen, hungernden, armen<br />
muslimischen Bevölkerung, unter der der Mythos umgeht, dass die Kopten die wohlhabendste<br />
und einflussreichte Gruppe sind, dass die Kopten das profitable Bankengeschäft und die<br />
Tourismusbranche an sich gezogen haben. Unter den Bedingungen, dass die<br />
Verbraucherpreise steigen, wird diese Bevölkerung noch zorniger. Daher sehe ich, dass die
größten Gräben in Ägypten nicht zwischen Christen und Muslimen verlaufen, sondern<br />
zwischen Armen und Reichen. Denn Ägypten ist ein Land mit einer kolossalen sozialen<br />
Ungleichheit. Ein Land, in dem einige alles können, andere sich aus der Mülltonne ernähren.<br />
„Die gegenwärtige Generation erscheint mir doppelt<br />
egoistisch“<br />
EM: Und was wäre Ihrer Meinung nach eine Perspektive für Ägypten, um die Gräben in der<br />
Gesellschaft zu überwinden?<br />
Abusjarow: Jede Generation lebt ihr Leben, und ist leider nicht geneigt, aus den Fehlern ihrer<br />
Vorgänger zu lernen. Jede Generation genügt sich selbst, man kann auch sagen, ist egoistisch.<br />
Sie will in der Jugend lieben, sich vergnügen, berauschende Mittel ausprobieren, ihr<br />
Bewusstsein erweitern und die eigene Wahrheit suchen. Und jede Generation glaubt, dass ihre<br />
Wahrheit besonders ist, anders als die Wahrheiten der anderen und besonders der<br />
vorangegangenen Generation.<br />
Doch die gegenwärtige Generation, scheint mir, ist doppelt egoistisch. Sie strebt danach, alles<br />
zu erreichen und ist gierig auf das Leben. Doch das Ego des Menschen ist so aufgebaut, dass<br />
er dazu neigt, die Schuld an allen seinen Misserfolgen seinen Nächsten oder der Regierung zu<br />
geben. Das Ego ist immer bereit, auf Kosten anderer zu leben, wenn es um eigene Interessen<br />
geht. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: je mehr Rechte eine Minderheit hat, desto aggressiver<br />
wird sie. Einerseits ist es gut, dass jede neue Generation eine Verbesserung der<br />
Lebensbedingungen und politischen Freiheiten fordert. Darin ist auch ein Fortschritt<br />
enthalten. Sind andererseits aber die jungen Menschen bereit, die volle Verantwortung für<br />
diese Freiheiten auf sich zu nehmen und die Situation zu kontrollieren?<br />
„Die „Twitter-Revolutionen“ sind Volksrevolutionen“<br />
EM: Und wie verhält es sich damit heute in Ägypten, wie in den Ländern des arabischen<br />
Frühlings?<br />
Abusjarow: Mit der heutigen Generation ist eine wichtige Sache passiert. Sie lebt in der<br />
Epoche eines nie dagewesenen Booms der Internetkommunikationsmittel. Schon jetzt werden<br />
die Revolutionen in Ägypten und Tunesien Twitter-Revolutionen genannt. Doch man kann sie<br />
mit vollem Recht auch Volksrevolutionen nennen. Denn die Bevölkerung wurde durch Armut<br />
und Demütigung, die die Persönlichkeit zerstörten, zu quälender Ausweglosigkeit gebracht.<br />
Im Islam wird das „Ego“ Nafs genannt. Und der große Djihad besteht im Kampf des Geistes<br />
Ruch mit Nafs. Doch es ist sehr schwer, mit dem Ego zu kämpfen, wenn es sich an einem<br />
Konsumkult aufheizt, in dem man täglich Luxus, Überfluss und Permissivität sieht. Das<br />
menschliche „Ich“ braucht äußerlichen Glanz, schnellen Erfolg, ein teures Telefon, ein Auto<br />
der neuesten Super-Marke. Es muss sich selbst in der Gesellschaft beweisen. Wenn dies nicht<br />
gelingt, ist es zu Gewalt gegenüber den Nächsten bereit. Grundlose Emotionen können<br />
entstehen, wenn es das Bedürfnis gibt, die Verantwortung auf jemanden abzuwälzen. Die<br />
„Gräben“ kann man in dieser Situation nur durch Anerkennung seiner persönlichen<br />
Verantwortung und durch allgemeine Konsolidierung im Namen hoher gesellschaftlicher<br />
Ziele oder bodenständigen gesunden Menschenverstands überwinden.
„In Russland haben die Herrschenden eine manische<br />
Angst vor allem, was mit der Revolution verbunden ist“<br />
EM: Wie ist die Stimmung in Russland angesichts des arabischen Frühlings? Gibt es ein<br />
Gefühl, dass dies eine größere Protestwelle sein könnte, die einmal auch Russland erfasst,<br />
oder erleben die Menschen die Proteste als etwas, das weit weg ist?<br />
Abusjarow: In Russland haben die Herrschenden eine manische Angst vor allem, was mit der<br />
Revolution verbunden ist. Andererseits unterstützt Russland traditionell die arabischen<br />
Verbündeten. Daher ist die Position des offiziellen Moskau in diesem Sinne<br />
voreingenommen und vorhersehbar. Sie ist auf der Seite der herrschenden Regimes, mit<br />
denen sie günstige Geschäftsbeziehungen entwickelt hatte.<br />
Was die Stimmung in der russischen Bevölkerung angeht, so ist diese sehr freiheitsliebend.<br />
Man muss nur daran denken, wie der ewige Präsident Putin bei der Siegerehrung des<br />
Kämpfers Fedorov beim „Kampf ohne Regeln“ in der Olimpijskij-Sportarena kürzlich<br />
ausgepfiffen wurde. Die politische Situation in Russland und die bevorstehenden Wahlen in<br />
Russland kann man auch mit einem „Kampf ohne Regeln“ vergleichen. Doch die Menschen<br />
verstehen und fühlen. Und revolutionäre Gedanken und Proteststimmung werden, wie in<br />
Ägypten und Tunesien, über das Internet und Mund-zu-Mundpropaganda verbreitet.<br />
EM-INTERVIEW<br />
Das Interview führte Robert Kalimullin<br />
Welche Absichten hat Putin mit der<br />
Eurasischen Union?<br />
Sie ist territorial gesehen zehnmal größer als die EU und sie wird den großen<br />
östlichen Teil des europäischen Kontinents mit Asien verflechten. Welche<br />
Absichten stecken dahinter? Alexander Rahr hat sie erkundet. Er ist vor<br />
kurzem vom Jahrestreffen des Waldai-Klubs aus Russland zurückgekommen,<br />
auf dem er mit dem russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin sprechen<br />
konnte, der 20<strong>12</strong> wohl als Präsident in den Kreml zurückkehrt.<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong>: Bis Jahresende soll durch Betreiben Putins auf dem Territorium der<br />
ehemaligen Sowjetunion eine Eurasische Union entstehen. Sie haben den Initiator im Waldai-<br />
Klub darüber ausgefragt. Was haben Sie von ihm erfahren?<br />
Alexander Rahr: Das Treffen mit Putin hat drei Stunden gedauert und war der Höhepunkt<br />
meiner Gespräche. In der Tat wird - exakt 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion - auf<br />
80 Prozent des ehemaligen UdSSR-Territoriums eine neue Union entstehen, unter dem<br />
Namen Eurasien. Diesem Staatenbund, der Ähnlichkeit mit der früheren Europäischen Union<br />
der fünfziger Jahre haben soll, werden die Länder Russland, Kasachstan, Belarus, Kirgisistan<br />
und Tadschikistan beitreten.
Die Eurasische Union ist zunächst nur<br />
Wirtschaftsgemeinschaft<br />
EM: Plant Putin die Wiedererrichtung der Sowjetunion?<br />
Rahr: Das sicher nicht. Die Eurasische Union ist zunächst nur eine Wirtschaftsgemeinschaft,<br />
eine Freihandelszone. Sie wird noch keinen eigenen Präsidenten und kein Parlament besitzen.<br />
Aber an ihrer Spitze werden, nach Brüsseler Vorbild, Eurasien-Kommissare stehen, die eine<br />
Vereinheitlichung der Rechts- und Wirtschaftssysteme der integrationswilligen Ex-<br />
Sowjetrepubliken herbeiführen sollen.<br />
EM: Aber in einer solchen Union dominiert doch Russland über alle anderen Staaten. Wollen<br />
diese tatsächlich ihre gerade erworbene Souveränität wieder aufgeben?<br />
Rahr: Die Integration wird vorsichtig vonstattengehen. Russland will die integrationswilligen<br />
Länder nicht verschrecken. Natürlich spielt Moskau aber seine finanzielle Macht in der<br />
Finanzkrise aus. Russland ist bereit, den Staaten, die der Eurasischen Union beitreten, billiges<br />
Gas zu liefern, Kredite zu verteilen und den eigenen Markt zu öffnen. Doch ein inzwischen<br />
ebenfalls mächtiges Land wie Kasachstan wird sich kaum von Moskau so einfach<br />
vereinnahmen lassen.<br />
Putin wollte eine Freihandelszone von Brest bis<br />
Wladiwostok<br />
EM: Was genau hat Ihnen Putin auf Ihre direkte Frage nach den Zielen des neuen<br />
Integrationsmodells geantwortet?<br />
Rahr: Ich habe Putin direkt gefragt, ob die Eurasische Union eine Art Brücke für<br />
postsowjetische Staaten in die EU sei, eine Art Zwischenweg zur Vereinigung West - und<br />
Osteuropas in ein gemeinsames Europäisches Haus, wie es Michail Gorbatschow vor 20<br />
Jahren vorgeschlagen hat. Immerhin hat Putin vor genau einem Jahr auf dem Forum der<br />
Süddeutschen Zeitung in Berlin den Vorschlag einer Freihandelszone von Brest bis<br />
Wladiwostok gemacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat damals abgelehnt - Russland<br />
müsse zunächst der WTO beitreten.<br />
EM: Und was hat er geantwortet? Die letzte Barriere für den Beitritt Russlands zur WTO,<br />
nämlich das georgische Veto, ist ja vom Tisch. Kann damit Eurasien nach russischen Plänen<br />
entstehen?<br />
Rahr: Putins Antwort hat mich ein wenig verwirrt. Einerseits sagte er, alle Staaten der<br />
Eurasischen Union müssten der WTO beitreten und sich gemeinsam der EU annähern.<br />
Andererseits sagte er, die Traditionen der postsowjetischen Staaten seien mit dem<br />
westeuropäischen Aquis – dem verbindlichen gemeinschaftlichen Besitzstand - nicht<br />
vereinbar. In einen westeuropäischen Werteklub wolle sich die Eurasische Union nicht<br />
verwandeln. Auch sei die Eurasische Union keine Brücke, sondern ein autonomes Bündnis.<br />
Aber dann ließ er sozusagen die Katze doch aus dem Sack.<br />
Die Eurasische Union ist keine neue Sowjetunion
EM: Nämlich? Verriet Putin Ihnen Einzelheiten darüber, was er mit der Gründung der<br />
Eurasischen Union vorhat?<br />
Rahr: Er sagte, die Eurasische Union würde sich sowohl Richtung EU als auch Richtung<br />
China orientieren. Der Handel mit China würde intensiver und „strategischer“. Man verkaufe<br />
den Chinesen inzwischen viel Öl, Gas, Waffen und auch Atomreaktoren. Die EU dagegen<br />
würde Russland vom westlichen Gasmarkt verdrängen. Russland würde sich das nicht bieten<br />
lassen. Es würde seine Pipelines jetzt von West nach Ost umfunktionieren.<br />
EM: Wie soll man das verstehen?<br />
Rahr: Ganz einfach. Die Eurasische Union, territorial gesehen zehnmal größer als die EU,<br />
würde den großen östlichen Teil des europäischen Kontinents mit Asien verflechten. Falls die<br />
Westeuropäer Russland in ihrem Europa nicht haben wollen, wird Putin die wirtschaftliche<br />
Integration mit Asien suchen, obwohl diese Idee im Westen heute als völlig unrealistisch und<br />
als reine Putin-Propaganda bezeichnet wird.<br />
EM: Und wie ist es wirklich? Ist diese Eurasische Union mehr als nur Propaganda? Geht es<br />
doch in Richtung auf eine neue Sowjetunion, wenn auch mit asiatischer<br />
Schwerpunktverlagerung?<br />
Rahr: Die Eurasische Union ist keine neue Sowjetunion. Wer ein russisches Imperium<br />
zurückhaben möchte, ist irre, hat Putin im Waldai Klub gesagt. Es geht aber um die<br />
historische Findung einer Rolle für Russland und die anderen postsowjetischen Staaten in der<br />
neuen Weltwirtschaftsordnung des 21. Jahrhunderts. Diese Staaten werden von uns nicht in<br />
die EU aufgenommen, die EU ist durch die Euro-Krise auf Jahrzehnte geschwächt. Also<br />
suchen sie nach anderen Überlebensformen in einer Weltwirtschaft, die sich regional überall<br />
integriert. Wenn es EU, NAFTA, MERCASUR, ASEAN, Afrikanische Union und die<br />
Islamische Wirtschaftsunion gibt - warum sollten sich die ehemaligen Sowjetrepubliken nicht<br />
in ein eigenes Regionalbündnis zusammenschließen? So wird es laufen.<br />
*<br />
Siehe auch EM-Interview „Wir können die Herausforderungen der Zukunft nur zusammen<br />
mit Russland meistern“ in EM 10-20<strong>11</strong> und die Buchrezension zu Alexander Rahr „Der kalte<br />
Freund – Warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“ in EM 10-20<strong>11</strong>.<br />
ENERGIEVERSORGUNG<br />
Das Interview führte Hans Wagner<br />
Chinas Milliardenprojekt in<br />
Birma/Myanmar<br />
Im rohstoffreichen Birma werden Investitionen aus westlichen<br />
Industriestaaten durch Sanktionen verhindert. Zugriff zu den<br />
Erdgasvorkommen des Landes haben sich derweil China, Thailand und<br />
Südkorea gesichert. China baut gleich zwei Pipelines vom Indischen Ozean<br />
quer durch Birma in die Provinz Yunnan.
Von Wilfried Arz<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
eit China 1993 zum Netto-Erdölimporteur und 2003 nach den USA weltweit<br />
zweitgrößter Erdölverbraucher wurde, betreibt Beijing eine global angelegte Politik der<br />
Energiesicherung. Für einen Späteinsteiger auf dem internationalen Erdölmarkt, der<br />
weitgehend von westlichen Konzernen dominiert wird, keine einfache Aufgabe. Die<br />
verschärfte Konkurrenz um Zugriff und Kontrolle von Rohstoffen fand in den US-Kriegen in<br />
Afghanistan 2001, im Irak 2003 und der US-Militärpräsenz in Zentralasien sichtbaren<br />
Ausdruck. Chinas Staatspräsident Hu Jintao schlug 2003 deshalb Alarm: Chinas<br />
Ölversorgung sei eine Frage nationaler Sicherheit!<br />
Chinas Erdölimporte werden zu achtzig Prozent über das Meer abgewickelt: durch den<br />
Indischen Ozean und das Südchinesische Meer. Die maritimen Transportrouten verlaufen<br />
dabei durch zwei Meerengen von geostrategischer Bedeutung: die Straßen von Hormuz<br />
(Oman, Iran) und Malakka (Indonesien, Malaysia, Singapur). Im Konfliktfall mit den USA<br />
befürchtet China eine Seeblockade und Unterbrechung seiner Energieimporte. Doch bieten an<br />
Chinas südlicher Peripherie zwei Länder einen Transitkorridor zum Indischen Ozean:<br />
Pakistan und Birma.<br />
Eine besondere Rolle hat China seinem Nachbarn Birma zugedacht. Dort wird seit 2009 eine<br />
Gas- und seit 2010 eine parallel verlaufende Erdöl-Pipeline bis in die Provinz Yunnan verlegt.<br />
Die Malakka-Straβe wird damit als maritimer Transportweg vermieden und die Versorgung<br />
von Chinas Südwesten mit Energie verbessert. Gleichzeitig erfolgt unter Hochdruck der<br />
Ausbau des Straßen- und Schienennetzes in Birma. Mit dem Zugang zu Tiefseehäfen am Golf<br />
von Bengalen wird somit auch die Abwicklung chinesischer Im- und Exporte verkürzt.<br />
Yunnan: Brückenkopf nach Südostasien<br />
Der fehlende Zugang zum Pazifik galt für Chinas Provinz Yunnan (394.000 Quadratkilometer<br />
Fläche, 46 Millionen Menschen) lange als Standortnachteil. Yunnans Außenhandel litt unter<br />
hohen Transportkosten und einer überlasteten Verkehrsinfrastruktur zur chinesischen<br />
Ostküste. Wirtschaftlich war Yunnan auf seine beiden Nachbarprovinzen Guizhou und<br />
Guangxi orientiert, ohne deren Entwicklungsniveau auch nur annähernd zu erreichen. Vor<br />
diesem Hintergrund hat Yunnan seine Wirtschaftspolitik nach Süden ausgerichtet, um<br />
sich als Drehscheibe und Brücke nach Südostasien zu positionieren.<br />
Traditionell war Yunnan ohnehin stets enger mit seinen Nachbarn im Westen und Süden<br />
verflochten gewesen als mit Ost-China! Am Endpunkt der Südlichen Seidenstraβe gelegen,<br />
im Zweiten Weltkrieg durch die Burma-Road mit Lashio/Birma und die Stilwell-Road mit<br />
Assam/Indien verbunden, bot die Bahnverbindung Hanoi-Kunming eine gute Anbindung<br />
auch nach Indochina. Mit den Nachbarn Birma, Laos und Vietnam pflegt Yunnan bereits<br />
schwunghaften Handel und tritt dort als bedeutender Investor auf. Seit 1992 Mitglied der<br />
„Greater Mekong Subregion“ (GMS), einem Zusammenschluss der Mekong-Anrainer, ist<br />
Yunnan auch eingebunden in Infrastrukturplanungen von Festland-Südostasien.<br />
Energieversorgung für Chinas Südwesten
Yunnan wird seit 2005 durch eine von Chinas Energiekonzern SINOPEC betriebene Pipeline<br />
aus Maoming in der Küstenprovinz Guangdong mit raffinierten Ölprodukten versorgt. Deren<br />
Preisniveau liegt in Yunnan gut dreiβig Prozent höher als im restlichen China. Die neue<br />
Pipeline vom Indischen Ozean nach Kunming wird somit eine bessere Versorgung für<br />
Yunnan bewirken. Als künftiger Raffineriestandort wird Yunnan zudem ein Verteiler für Öl<br />
und petrochemische Produkte in Südwest-China (Sichuan, Guizhou) werden.<br />
Chinas Provinzen konkurrieren um Investitionen und Produktionsstandorte, beeinflussen diese<br />
doch Wirtschaftsleistung und Steuereinnahmen. Enge Interessenverflechtungen zwischen<br />
Provinzkadern und Unternehmen sind deshalb keine Seltenheit. Auch Chinas transnationales<br />
Pipeline-Projekt mit Birma wurde hinter den Kulissen von Rivalitäten auf Provinzebene<br />
(Yunnan, Chongqing/Sichuan) und den beiden halbstaatlichen Energie-Konzernen CNPC und<br />
SINOPEC bestimmt. Gegenstand konkurrierender Interessen: Trassenführung der Pipeline<br />
und Standortentscheidung für die geplante Erdölraffinerie.<br />
Allianz zwischen Partei und Wirtschaft<br />
In Südwest-China bestehen seit Jahren zwei konkurrierende strategische Allianzen: Yunnan/<br />
CNPC und Chongqing/SINOPEC. Yunnan spielte bei den Planungen des transnationalen<br />
Pipeline-Projektes mit Birma von Beginn an eine führende Rolle: in der akademischen<br />
Diskussion, den sicherheits- und wirtschaftspolitischen Bewertungen, sowie den Studien zur<br />
technischen Durchführbarkeit. Entscheidenden Einfluss auf die politische Umsetzung des<br />
Pipeline-Projektes hatten jedoch Yunnans amtierender KP-Chef Bei Enpai und CNPC-Chef<br />
Jiang Jiemian. Beide bekleideten zuvor hohe politische Ämter in der Provinz Qinghai: Enpai<br />
als Parteisekretär, Jiemian als zweiter Gouverneur. Beide unterzeichneten im Dezember 2007<br />
das Abkommen zwischen der Provinz Yunnan und dem Energiekonzern CNPC.<br />
Chinas Pipeline-Projekt in Birma<br />
Chinas Pipeline wird Kyaukpyu am Golf von Bengalen mit Kunming in Yunnan/China in<br />
2.000 Meter Höhe verbinden. Ein Blick auf die 1.250 Kilometer lange Trassenführung: beide<br />
Leitungen verlaufen von der Küste über das Arakan-Yoma-Gebirge, durchqueren Zentral-<br />
Birma (Magwe, Maiktila, Kyaukse) und gehen dann über in das Shan-Hochland (Kyaukme,<br />
Lashio, Kutkai) bis zur Grenze Chinas. Von der Grenzstadt Ruili (eine Sonderwirtschaftszone)<br />
führen die Pipelines weiter bis Kunming. Aus logistischen Gründen werden<br />
die Leitungen offenbar weitgehend entlang bestehender Straßentrassen verlegt. Anlieferungen<br />
der Röhren, Wartungsarbeiten und militärische Bewachung werden damit erleichtert.<br />
Die Erdölleitung ist auf eine Durchlaufkapazität von 22 Millionen Tonnen/Jahr ausgelegt.<br />
Erdöl soll aus Afrika (Angola, Sudan) und dem Nahen Osten (Saudi-Arabien, Iran) per Schiff<br />
nach Kyaukpyu/Birma am Golf von Bengalen geliefert werden. Pipeline-Betreiber sind China<br />
National Petroleum Corporation (CNPC) und Myanmar Oil & Gas Enterprise (MOGE).<br />
Die parallel verlaufende Gasleitung wird eine Kapazität von <strong>12</strong> Milliarden Kubikmeter/Jahr<br />
haben. Das Gas wird im Golf von Bengalen aus küstennahen Vorkommen im Block A-1 und<br />
A-3 gefördert. Ein Konsortium unter Führung von Daewoo International/Südkorea wickelt<br />
den Betrieb ab. Gasexporte werden Birma auf Jahrzehnte hinaus immense Deviseneinnahmen<br />
bescheren: das Land verfügt über die zehntgrößten Erdgasreserven der Erde (BP World<br />
Energy Outlook 2010).
Projektkosten offiziell nicht bekannt<br />
Für Chinas Pipeline-Projekt in Birma liegen von den Betreibern keine Kostenkalkulationen<br />
vor. Schätzungen beziffern die Investitionskosten auf zusammen rd. 2,5 Milliarden US-Dollar<br />
- 1,5 Milliarden US-Dollar für die Erdölröhre und etwa eine Milliarde US-Dollar für die<br />
Gasleitung. Hinzu kommen Kosten für projektbezogene Infrastruktur im Hafen Kyaukpyu:<br />
einen Ölterminal mit 600.000 Kubikmeter Kapazität und ein Hafenbecken für Riesentanker<br />
bis 300.000 BRT. Nicht inbegriffen sind ferner Kosten einer Erdölraffinerie in Kunming,<br />
sowie ein Leitungsnetz in der Provinz Yunnan. Schlieβlich sind für den Transport von Erdöl<br />
und Gas Transitgebühren zu entrichten. Birmas Einnahmen dürften sich auf insgesamt rund<br />
eine Milliarde US-Dollar/Jahr belaufen.<br />
Menschenrechtsverletzungen befürchtet<br />
Beide Energieleitungen führen durch politisch unruhige Regionen (Arakan- und Shan-Staat).<br />
Dort kämpfen Rebellen ethnischer Minderheiten seit Jahrzehnten gegen<br />
Regierungstruppen. Die Trassenführung wird vermutlich mit einer Umsiedlung von<br />
Bevölkerungsgruppen verbunden sein, die nach gängiger Praxis des birmanischen Militärs mit<br />
Vertreibung und Landraub ohne faire Entschädigung durchgesetzt werden dürfte. Gewaltsame<br />
Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und Menschenrechtsverletzungen sind zu befürchten. Zu<br />
erwarten ist bewaffneter Widerstand insbesondere seitens der Shan-Minderheit. Deshalb soll<br />
die Pipeline, auch nach Inbetriebnahme 2013 vom Militär gesichert werden. Birmanische<br />
Exilgruppen in Thailand sprechen von bis zu <strong>12</strong>.000 Soldaten.<br />
Ein weiteres Energieprojekt Chinas ist ebenfalls in das kritische Visier internationaler<br />
Menschenrechtsgruppen geraten: im Sudan finanzierte China (CNPC) eine Erdöl-Pipeline und<br />
unterstützte das Regime in Khartum mit Waffen, die vermutlich in der Provinz Darfur zum<br />
Einsatz gekommen sind. Dort tobt seit 2003 ein blutiger Bürgerkrieg. 2004 verhinderte China<br />
mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen den Sudan.<br />
Weltweit fehlt es nicht an weiteren Beispielen von Energieprojekten, die mit Verletzungen<br />
von Menschenrechten in Verbindung stehen: u.a. Aceh-Sumatra/ExxonMobil, Nigeria/Royal<br />
Dutch-Shell, Kolumbien/BPAmoco, Angola/TotalFinaElf und Ecuador/Chevron. Auch die<br />
Menschenrechtsbilanz westlicher Energiekonzerne ist somit keineswegs makellos!<br />
In der Kritik auch westliche Energiekonzerne<br />
Kritik sollte den Blick auf zwei westliche Energiekonzerne lenken: Unocal/USA (seit 2005<br />
Chevron) und Total/Frankreich. Deren Yadana-Gasprojekt in Birma war in der Bauphase<br />
ebenfalls von Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen begleitet gewesen. Beide<br />
Konzerne wurden deshalb in den USA 1996 und Frankreich 2003 angeklagt. Beistand erhielt<br />
das Unternehmen Total von Bernard Kouchner, dem prominenten Menschenrechtler und<br />
späteren Außenminister Frankreichs (2007-2010). In einem für Total erstellten Gutachten<br />
rechtfertigte Kouchner die Investitionen des halbstaatlichen Konzerns in Birma.<br />
Seit es 2003 (Total) und 2005 (Unocal) zu außergerichtlichen Einigungen gekommen ist,<br />
herrscht zum Thema auffallende Stille - auch von Seiten birmanischer Exilgruppen. Könnte<br />
der Grund darin zu suchen sein, dass führende exilbirmanische Dissidenten und Medien<br />
(Irrawaddy-<strong>Magazin</strong>, Democratic Voice of Burma) von US-Organisationen (Burma Project,
Open Society Institute) finanziert werden, die dem politisch aktiven Megainvestor George<br />
Soros bzw. dem US-Außenministerium (National Endowment for Democracy) nahestehen?<br />
Pipeline-Projekt und Umwelt<br />
Sorgen bereiten neben projektbegleitenden Menschenrechtsverletzungen auch Fragen der<br />
Umweltverträglichkeit des Energieprojektes. Grundsätzlich bergen Leckagen und Rohrbrüche<br />
an der Erdölleitung erhebliche Risiken von Umweltschäden. Zudem verläuft die Pipeline<br />
durch eine erdbebengefährdete Region. Yunnan wurde zuletzt 2009 von schweren Erdstöβen<br />
(Stärke 6,0) erschüttert, Birma 20<strong>11</strong> (Stärke: 6,8). Erdrutsche und Schlammlawinen kommen<br />
als sicherheitsgefährdende Einflussfaktoren hinzu. Wie wenig Rücksicht bei Energieprojekten<br />
in Birma auf Umweltbelange genommen wird, belegt die Yadana-Gas-Pipeline: diese wurde<br />
1995-1998 durch eines der letzten geschlossenen Regenwaldgebiete des Landes verlegt.<br />
Chinas transnationale Pipelines<br />
Wird die Trans-Birma-Pipeline Chinas Versorgungssicherheit mit Erdöl und Gas erhöhen?<br />
Sicher ist eine Verkürzung der maritimen Transportrouten um rd. eine Woche und damit die<br />
Einsparung von Tankerkapazitäten. So verkürzt sich der Seeweg von Angola nach Birma von<br />
20.000 auf 15.000 Seemeilen und von Saudi-Arabien nach Birma von <strong>12</strong>.000 auf 7.000<br />
Seemeilen. Kosteneinsparungen sind zu bezweifeln. Logistikexperten kalkulieren den<br />
Seetransport von Afrika in Chinas Pazifikhäfen mit rd. zwei US-Dollar/Barrel Rohöl. Auf<br />
mindestens vier US-Dollar/Barrel sollen sich die Kosten via Pipeline von Kyaukpyu nach<br />
Kunming belaufen.<br />
Der Anteil des durch Birma geführten Erdöls ist bezogen auf Chinas gesamte<br />
Erdölimporte bescheiden. Sollte Chinas Erdölbedarf weiterhin exponentiell steigen, wird<br />
dieser Anteil 2020 bei unter fünf Prozent liegen. Wird die Birma-Leitung mit anderen<br />
transnationalen Pipeline-Projekten Chinas (betriebsbereit, im Bau befindlich bzw. geplant) in<br />
Zentralasien (Kasachstan, Turkmenistan) und Russland (Sibirien) aggregiert, ergibt sich ein<br />
anderes Bild: dann liegt der Anteil an Chinas gesamten Erdölimporten bei rd. elf Prozent.<br />
Nicht vergessen werden sollte: die Birma-Pipeline dient nur der Versorgung Südwest-Chinas!<br />
China befürchtet Blockade der Malakka-Meerenge<br />
Allen transnationalen Pipeline-Projekten zum Trotz bleiben Chinas Energieimporte auch<br />
weiter dem Risiko potenzieller Unterbrechungen ausgesetzt. Die beiden Meerengen von<br />
Hormuz (Oman, Iran) und Malakka (Indonesien, Malaysia, Singapur) gelten als neuralgische<br />
maritime Knotenpunkte. In beiden Regionen ist die US-Marine mit Flugzeugträgergruppen<br />
präsent. Aus sicherheitspolitischer Perspektive Beijings bleibt besonders in der Malakka-<br />
Straße das Risiko einer Blockade durch die US-Marine virulent.<br />
Am Arabischen Golf haben die USA ihre Fünfte Flotte in Bahrain stationiert und in Qatar<br />
einen ihrer gröβten überseeischen Militärstützpunkte etabliert. Hinzu kommt die Insel Diego<br />
Garcia im Indischen Ozean, eine weitere Basis von hoher strategischer Bedeutung. Der<br />
westliche Zugang zur Malakka-Straße und die Ausweichrouten für Öltanker durch die<br />
indonesischen Meerengen der Sunda-, Lombok und Makassar-Straßen stehen unter<br />
amerikanischer Kontrolle (Siebte Flotte). Auf Sumatra wird die Sultan Iskander-<br />
Luftwaffenbasis in Aceh vom US-Militär genutzt, in Singapur die neue Changi-Marinebasis.
Und China? China wird auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, seine Tankerflotte<br />
militärisch zu schützen! Auch die stolze Übernahme des ersten Flugzeugträgers durch<br />
Chinas Marine im August 20<strong>11</strong> wird daran nichts ändern. China bleibt ohne militärische<br />
Kapazitäten zur Sicherung seiner maritimen Energieimporte.<br />
Asien-Pazifik-Region: Schauplatz neuer<br />
Ressourcenkonflikte?<br />
Japans Besetzung der chinesischen Mandschurei 1931 und die Invasion Südostasiens zielte<br />
auf die Kontrolle seiner Rohstoffversorgung. Japans Angriff auf Pearl Harbor 1941 war<br />
Reaktion auf ein Öl-Embargo der USA. Damit sollte die Achillesferse des rohstoffarmen<br />
Japan getroffen werden. Die asiatisch-pazifische Region wurde zum Schauplatz eines blutigen<br />
Krieges, der erst 1945 durch den Abwurf von US-Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki<br />
beendet wurde.<br />
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir Zeugen eines sich anbahnenden Konfliktes zwischen<br />
zwei Wirtschaftsmächten: China und USA. Die eine Macht ist im Aufstieg begriffen, die<br />
andere bemüht, ihren Abstieg zu verhindern. Wieder stehen sich in der Asien-Pazifik-Region<br />
zwei (militärisch nicht ebenbürtige!) Konkurrenten gegenüber. Zeichnet sich Südostasien als<br />
Konfliktzone eines militärischen Schlagabtausches zwischen China und USA ab?<br />
Energieversorgung ist Chinas Achillesferse<br />
Im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzungen um geostrategische Positionsgewinne in<br />
Südostasien stehen zwischen China und den USA auch nationale Interessen der Energie- und<br />
Rohstoffversorgung. Wird es China gelingen, sich den Zugriff zu vermutlich ressourcenreichen<br />
(Gas, Erdöl) Seegebieten im Südchinesischen Meer zum eigenen Vorteil zu sichern?<br />
Jenseits konkurrierender Ansprüche auf maritime Souveränitätsrechte stellt sich die Frage, ob<br />
dem Wirtschaftsmodell China langfristig konfliktfreie Überlebensperspektiven eingeräumt<br />
werden können. Noch wird der Zusammenhalt des 1,3 Milliarden-Volkes durch jährliche<br />
wirtschaftliche Zuwachsraten in einer Gröβenordung von über neun Prozent sichergestellt.<br />
Sinkt die Wachstumsrate unter die kritische Grenze von acht Prozent, gelten soziale Stabilität<br />
von Chinas Gesellschaft und damit die Legitimation des Herrschaftsmonopols der<br />
Kommunistischen Partei als gefährdet.<br />
Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird China 2030 rd. 75 Prozent<br />
seines Energiebedarfs importieren müssen. Chinas Pipeline-Projekt in Birma ist nur ein<br />
Mosaikstein einer global angelegten Politik der Ressourcensicherung, die sich für Beijing<br />
zunehmend schwieriger gestaltet. Energie ist für Chinas wirtschaftliches Wachstum und<br />
gesellschaftliche Stabilität unverzichtbar. Eine sichere Energieversorgung bleibt die<br />
Achillesferse des Wirtschaftsmodells China.<br />
Wilfried Arz ist Politikwissenschaftler in Bangkok/Thailand. Südostasien, den Indischen<br />
Subkontinent und die Himalaya-Region bereist der Autor regelmäβig<br />
CHINA<br />
*
Der schwierige Nachbar im Meer<br />
Über Macht und Widerstand in den Beziehungen Chinas zu den ASEAN-<br />
Ländern und die Gründe, weshalb der Versuch eines friedlichen Aufstiegs der<br />
Region vielleicht schon an seine Grenzen stößt.<br />
Von Vu Truong<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Vu Truong<br />
Vu Truong wurde am 17.05.1984 in Ho-Chi-Minh Stadt, Vietnam, geboren. Seit<br />
2005 studiert er in Deutschland: European Studies an der Universität Siegen, und<br />
Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Seit Juni 2010 ist er Doktorand<br />
an Center for Global Studies, Universität Bonn. Truong arbeitet als freier Journalist<br />
für vietnamesische Print- und Online-Medien und hat bereits 150<br />
Hintergrundberichte, Analysen und Kommentare über die Politik und Wirtschaft<br />
Vietnams, der ASEAN-Staaten, Chinas und Deutschlands veröffentlicht.<br />
China probt eine neue außenpolitische Strategie im Umgang mit den Nachbarstaaten mit<br />
denen es Streitigkeiten im Südchinesischen Meer hat. Im Vergleich zu der Periode vor 2009,<br />
in der Chinas „New Diplomacy in Asia” zu beobachten war, kann man seit 2009 diese<br />
„Kursänderung“ chinesischer Außenpolitik erkennen. Die „New Diplomacy in Asia“ vor 2009<br />
war nach dem Urteil des amerikanischen Politikwissenschaftlers David Shambaugh durch vier<br />
Merkmale bestimmt: Die aktive Teilnahme an regionalen Organisationen, die Festigung<br />
strategischer Partnerschaften sowie eine Vertiefung bilateraler Beziehungen, den Ausbau der<br />
regionalen Wirtschaftsbeziehungen und die Reduzierung des Misstrauens vor<br />
einer „chinesischen Bedrohung“ im Bereich der Sicherheit.<br />
Die Kursänderung ist auf einige Entwicklungen im Laufe der Jahre 2009-20<strong>11</strong><br />
zurückzuführen, die die Chinafrage wieder stärker in den Fokus der internationalen<br />
Aufmerksamkeit rückten. Beispielhaft wären hier die offizielle Veröffentlichung eines großen<br />
Entwurfs für das Staatsgebiet im Südchinesischen Meer, die fortschreitende Modernisierung
der chinesischen Streitkräfte im Marinebereich sowie der wiederholte militärische und<br />
politische Druck auf Anrainer zur Durchsetzung maritimer Territorialansprüche zu nennen.<br />
Machtpolitik und Hegemoniestreben Chinas<br />
In den letzten Jahren hat China sich bemüht, seinen maritimen Einflussbereich im<br />
Südchinesischen Meer zu festigen. Das Ausmaß der territorialen Ambitionen Chinas wurde<br />
völkerrechtlich durch die Vorlage der u-förmigen „9-Striche-Linie“ . Demnach gehören 80<br />
Prozent des Südchinesischen Meeres und die kompletten Spratly-Inseln zu Chinas<br />
Souveränitätsgebiet. Der Anspruch wurde bei der United Nations Commission on the Limit of<br />
the Continental Shelf (CLCS) geltend gemacht. Dieser Plan hat zum ersten Mal offiziell die<br />
Ansprüche Chinas im Südchinesischen Meer erklärt. Als Beleg hierfür dient die Landkarte<br />
Chinas, die nicht nur alle Inselgruppen und Meergebiete in der Region beansprucht, sondern<br />
ebenfalls die übliche Anerkennung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ, 200-Meilen-<br />
Zone ab der Basislinie) im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) in<br />
Frage stellt.<br />
Nach UNCLOS kann ein Küstenstaat – in diesem Fall China - verschiedene seerechtliche<br />
Zonen beanspruchen, in denen er auch verschiedene Souveränitätsrechte wahrnehmen kann<br />
(für innere Gewässer ist das Souveränitätsrecht absolut, für Hoheitsgewässer sind hoheitliche<br />
Befugnisse vorgesehen). In der AWZ kann der Küstenstaat jedoch nur eine beschränkte<br />
Souveränität ausüben. Andere Staaten haben die Freiheit der Schifffahrt, des Überflugs, der<br />
Verlegung unterseeischer Kabel und Rohrleitungen, sowie der wissenschaftliche Erforschung<br />
unter der Bedingung, dass sie die besonderen Rechte des Küstenstaates beachten.<br />
Nach dem neuen Verständnis Chinas sollte der Küstenstaat allerdings nicht nur das<br />
Souveränitätsrecht auf wirtschaftliche Aktivitäten wie Fischerei, Ausbeutung von Ressourcen<br />
und alle Formen der wissenschaftlichen Meeresforschung besitzen, sondern auch im vollen<br />
Umfang souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse wahrnehmen, und zwar sowohl in Bezug<br />
auf die inneren Gewässer als auch auf die Hoheitsgewässer. Danach müsste jedes Schiff mit<br />
einem Forschungsauftrag von Küstenstaat zugelassen werden, wenn es seine AWZ vermessen<br />
möchte.<br />
China lässt die Muskeln spielen<br />
Um die u-förmige „9-Striche-Linie“ zu verwirklichen, lässt China mit Schiffen der maritimen<br />
Vollzugsbehörden die militärischen Muskeln spielen. Die Zahl der Zwischenfälle mit<br />
Nachbarländern, insbesondere philippinischen und vietnamesischen Fischern, ist in den<br />
letzten zwei Jahren rapid angestiegen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2010 gab es<br />
allein 30 Fälle, in denen vietnamesische Fischer von chinesischen Schiffen vertrieben,<br />
Mannschaften festgenommen und wegen „unbefugtem Eindringen“ in chinesisches<br />
Territorium bestraft wurden.<br />
Seit ein paar Jahren wendet die chinesische Regierung (genauer the Haikou Municipal<br />
Government, Hainan province) eine unilaterale Fischfangverbotsvorschrift im nördlichen<br />
Gebiet des Südchinesischen Meeres an. Anfang April 2010 sollten zwei Patrouillenboote der<br />
Fischereivollzugsbehörde zu den Spratly-Inseln geschickt werden, um chinesische<br />
Fischerboote zu schützen und gleichzeitig die Fischfangverbotsvorschrift einzuhalten.<br />
In der ersten Hälfte des Jahres 20<strong>11</strong> wurden sechs Zwischenfälle zwischen philippinischen<br />
Fischern und chinesischen Schiffen der maritimen Vollzugsbehörden festgestellt. Alleine im
Februar 20<strong>11</strong> wurden drei philippinische Fischereifahrzeuge, die in den Gewässern 140<br />
nautische Meilen westlich von Palawan (eine Insel im Westen der Philippinen) tätig waren,<br />
von China durch Anwendung militärischer Mittel gezwungen, die Region zu verlassen.<br />
Nicht nur die willkürliche Verteilung, Bestimmung und Regelung von Fischereizonen<br />
verdeutlicht eine Erhöhung der Präsenz und Verstärkung der Kontroll- und<br />
Überwachungsfunktion der chinesischen Marine in den gesamten „jurisdiktionellen<br />
Territorialgewässern“ Chinas, sondern auch der Anstieg an Zwischenfällen zwischen China<br />
und vietnamesischen und philippinischen Öl- und Gas-Exploratoren zeigt diese Tendenz.<br />
Dabei haben diese lediglich in der vietnamesischen und philippinischen AWZ nach neuen<br />
Ressourcen gesucht.<br />
Daneben startete die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) im März ein<br />
Projekt, um eine Mega-Öl- und Gasdrilling-Plattform einzurichten, die im Südchinesischen<br />
Meer eingesetzt werden soll. Hierfür wurden am 26. Mai die Kabel eines vietnamesischen<br />
Vermessungsschiffes, der Binh Minh 02, von einem chinesischen „Fischereifahrzeug“<br />
vorsätzlich überlaufen und durchtrennt. Die Binh Minh 02 ließ den Schaden reparieren und<br />
wurde danach von acht Schiffen bei der Arbeit „begleitet“. Zehn Tage später hatte,<br />
vietnamesischen Medienberichten zufolge, wieder ein chinesisches „Fischereifahrzeug“ ein<br />
anderes Vermessungsschiff Vietnams behindert und seine Kabel gekappt.<br />
Ausländische Beobachter sehen in Chinas Außenverhalten den Versuch, dank seiner<br />
militärischen Überlegenheit in der Region die AWZ und die noch umstrittenen Gewässer de<br />
facto zu inneren Gewässern (also als Binnenmeer mit der absoluten Souveränität) zu<br />
transformieren und danach de jure zu legitimeren.<br />
Gegenmachtbildung durch Aufrüstung<br />
Die ASEAN-Staaten reagieren auf die zunehmende Neigung zu militärischen Muskelspielen<br />
in Beijing mit einer Mischung aus verschiedenen Strategien von unterschiedlichen<br />
Balancierungs-Politiken bis hin zu zahlreichen Versuchen, die umstrittensten Territorien<br />
durch regionale Organisationen, internationale Verfahren und das Völkerrecht zu regeln.<br />
Sie haben mit der Wiederaufrüstung angefangen und ihren militärischen<br />
Modernisierungsprozess in der jüngsten Vergangenheit beschleunigt. Aus diesem Grund<br />
haben Vietnam, Malaysia und die Philippinen ihre konventionellen Rüstungsapparate<br />
erheblich ausgebaut und versuchen damit die bestehenden Machtasymmetrien in ihren<br />
Regionen teilweise zu reduzieren. Exemplarisch ist Vietnam zu nennen, das seinen<br />
Verteidigungshaushalt im Jahr 20<strong>11</strong> im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent erhöht hat. In<br />
Zukunft konzentriert sich die Regierung auf die Modernisierung der Streitkräfte, insbesondere<br />
der Marine und der Luftwaffe. Darunter fällt eine Bestellung für zwanzig Kampfflugzeuge<br />
vom Typ Sukhoi SU30MK2 und sechs U-Booten der Kiloklasse (Wert: 1,8 Milliarden US-<br />
Dollar) aus Russland, die im Jahr 2014 geliefert werden sollen.<br />
In sicherheitspolitischer und militärischer Hinsicht kann sagen, dass sich die vietnamesischamerikanische<br />
Beziehung man in den letzten Jahren fast zu einer „stillschweigenden“ Allianz<br />
entwickelt hat. Die reparaturbedingte Anwesenheit eines US-Kriegsschiffes in dem<br />
strategisch wichtigen Tiefseehafen Cam Ranh Bay, der aufgrund seiner geostrategischen Lage<br />
in der Vergangenheit von den Franzosen, Amerikanern und nach dem Vietnamkrieg 1975 von<br />
den Russen als Marinestützpunkt genutzt wurde, ist ein wichtiges Signal dafür. Ein anderes
Zeichen war die Einladung der USA an Vietnam zur gemeinsamen multilateralen<br />
militärischen Ausbildung.<br />
Manöver mit den USA und internationalen Institutionen<br />
Neben Vietnam habe auch die Philippinen im Haushaltsjahr 2010/<strong>11</strong> das Verteidigungsbudget<br />
erhöht. Daneben hat Präsident Benigno Aquino zusätzliche 255 Millionen US-Dollar für The<br />
Armed Forces of the Philippines (AFP) für den Verteidigungshaushalt 20<strong>11</strong> versprochen. Die<br />
AFP haben darum gebeten, dass das zusätzliche Geld verwendet wird, um für die<br />
Luftverteidigung Radarsysteme, Kommunikationseinrichtungen, Langstrecken-Patrouillen-<br />
Flugzeuge und Schnellboote zu kaufen. Offenbar aus Unsicherheit über das chinesische<br />
Verhalten im Südchinesischen Meer hat die philippinische Regierung die Wichtigkeit einer<br />
Bündnispartnerschaft mit den USA betont. Fünf Monaten nach den militärischen Operationen<br />
von chinesischen Schiffen in den umstrittenen Gewässern haben die Philippinen und die<br />
Vereinigten Staaten ein gemeinsames Marinemanöver im Südchinesischen Meer<br />
durchgeführt, das 22 Tage dauerte.<br />
Darüber hinaus haben sich die ASEAN-Staaten durch die Institution der Vereinten Nationen<br />
und basierend auf der Grundlage der Seerechtsübereinkommen der Vereinten<br />
Nationen (UNCLOS) bemüht, die im Jahr 2009 von China vorgelegte u-förmige „9-Striche-<br />
Linie“ in Zweifel zu ziehen. Die philippinische Regierung hat dazu ausdrücklich kritisiert,<br />
dass diese Politik mit Verfahren und Prinzipien im Sinn von „no basis under international law,<br />
specifically UNCLOS“ kollidiert, die die internationale Gesellschaft jahrzehntelang<br />
unterstützt hat.<br />
Indonesien und Vietnam haben die u-förmige Landkarte und die Ansprüche Chinas ebenfalls<br />
heftig kritisiert. Zuletzt im August 20<strong>11</strong> forderte die philippinische Regierung dazu auf, die<br />
umstrittenen Fragen bezüglich der Inselgruppen und das aggressive Verhalten Chinas dem<br />
Internationalen Seegerichtshof vorzulegen. Im Rahmen des ASEAN Regional Forum (ARF)<br />
2010 wird berichtet, dass der Gastgeber Vietnam, der auch den ASEAN Vorsitz dieses Jahres<br />
übernahm, die Vereinigten Staaten und anderen Teilnehmern ermutigen, um auf die aktuellen<br />
Geschehen aufmerksam zu machen.<br />
Hanoi hat zum einen anhand der von China und den ASEAN-Ländern unterschriebenen<br />
Vereinbarungen UNCLOS und DOC die anderen Parteien aufgerufen, die Einhaltung des<br />
Völkerrechts und der gemeinsamen Erklärung im Südchinesischen Meer zu gewährleisten.<br />
Zum anderen wurden Staaten, die zwar keine territorialen Ansprüche in dem Meeresgebiet<br />
haben, aber aufgrund einer Konfrontationslage wirtschaftlich sehr schwer betroffen wären<br />
(Seehandelsrouten und Transport), ein Signal gegeben, dass aus Sicht der kleinen ASEAN-<br />
Länder eine „Internationalisierung“ bzw. Multilateralisierung der Gebietskonflikte nötigt ist.<br />
Die ASEAN setzen weiterhin im Rahmen der ASEAN-Organisation den Plan fort, die DOC<br />
in die Wirklichkeit umzusetzen und sich hin zu einem formalen Code of Conduct (COC) zu<br />
bewegen, der eine rechtsverbindliche Verhaltensregel für die Territorialkonflikte darstellen<br />
würde.<br />
Der „friedliche Aufstieg“ vor dem Aus?<br />
Über fünfzehn Jahren nach dem Kalten Krieg zeichnete sich ein Bild ab, das anscheinend die<br />
pessimistischen Einschätzungen zum Teil widerlegt: Der weitere Aufstieg Chinas scheint sich<br />
friedlich zu vollziehen und statt einer Konfrontation findet ein intensiver Kooperationsprozess
zwischen den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum statt. Die Regierung Beijings hat seit<br />
einigen Jahren den Versuch unternommen, durch verschiedene Konzepte wie “good<br />
neighborly relations”, “new concept of security” oder “peaceful rise“ die Angst vor der<br />
chinesischen Bedrohung zu reduzieren und die regionalen Kooperationsprozesse unter seiner<br />
Führung voranzutreiben.<br />
Doch das positive Bild wandel sich: Statt „Charme Offensiven“ hat China im Zeitraum von<br />
2009-20<strong>11</strong> die ASEAN-Länder durch eine Kombination des Einsatzes seiner<br />
Machtressourcen, der Ausübung von militärischen Zwängen und der Entwicklung neuer<br />
Überzeugungsmuster dazu bewegt, eine neue marine Ordnung in seinem Sinne zu<br />
akzeptieren. Dadurch wird das Misstrauen gegenüber den „peaceful rise“-Versprechungen<br />
verstärkt.<br />
So bleiben die Südostasien-Staaten zum einen skeptisch, ob China wirklich bereit ist, einen<br />
Mechanismus für die Konflikteindämmung in der Region mit aufzubauen und auch die<br />
vereinbarten Regeln zu befolgen, selbst wenn sie chinesischen Interessen widersprechen. Zum<br />
anderen ist es auch fraglich, wie lange die „Stabilisierung des regionalen Umfeldes“ die erste<br />
Präferenz der Außenpolitik Chinas in Südostasien bleibt. Denn die künftige Großmachtrolle<br />
Chinas, verbunden mit einer angestrebten Hegemonialstellung in der Region, ist das<br />
komplette Gegenteil einer Stabilisierungspolitik.<br />
Dass sich Chinas Ansätze und Bereitschaft zu einer friedlichen Konfliktlösung Anfang des<br />
Jahres 2009 verändert haben, könnte auf verschiedene Gründe zurückgehen: Von<br />
innenpolitischer Unruhe innerhalb Chinas bis hin zu einer qualitativen Veränderung der<br />
globalen Machtkonstellation nach der Finanzkrise 2008, die die Wahrnehmung schürte, dass<br />
China bereits zu einer neuen Supermacht im asiatischen Pazifik geworden ist.<br />
Die wiederholten militärischen Machtdemonstrationen und die Stärke Chinas haben bis dahin<br />
keinen Einfluss auf die Politikergebnisse in seinem Sinn ausgeübt, sondern im Gegenteil zu<br />
verschiedenen Versuchen auf Seiten der ASEAN-Länder geführt, sich gegen die zunehmende<br />
Bedrohung Chinas zu wehren und ihre Emanzipationspolitik auf unterschiedliche Art und<br />
Weise fortzuführen. Dies wird vor allem durch die Gegenmachtbildungsstrategie der ASEAN-<br />
Staaten deutlich. Das Experiment eines „friedlichen Aufstiegs“ ohne die vorhandene<br />
internationale Ordnung in Frage zu stellen, scheint an seine Grenzen zu stoßen.<br />
BERLIN-MOSKAU<br />
Agenten-Skandal passt nicht zu den guten<br />
Beziehungen<br />
Dass die offiziellen Stellen in Berlin und Moskau zu einem angeblichen<br />
russischen Agenten-Paar aus Hessen schweigen, ist nach Meinung russischer<br />
Medien ein Zeichen dafür, dass an den Vorwürfen etwas dran ist.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
wei mutmaßliche russische Agenten, Heidrun A. und Andreas A., wurden Mitte Oktober
in Baden-Württemberg und Hessen durch ein Einsatzkommando des GSG 9 festgenommen.<br />
Heidrun A. soll in dem Haus des Paares in Marburg-Michelbach gerade dabei gewesen sein,<br />
mit einem Kurzwellenempfänger Nachrichten aus Moskau zu empfangen.<br />
Der leitende Mitarbeiter der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Hans-Henning<br />
Schröder, erklärte gegenüber der Moscow Times, er sei nicht erstaunt über den neuesten<br />
Spionage-Fall. Moskau konzentriere sich auf Industriespionage. Die Spionageaktivitäten<br />
würden fortgesetzt, hätten aber keinen Einfluss auf die deutsch-russischen Beziehungen.<br />
Die russischen Zeitungen gehen davon aus, dass es sich bei den Festgenommenen tatsächlich<br />
um Agenten handelt. Allerdings seien die beiden nicht mehr im aktiven Einsatz gewesen. Die<br />
Moskauer Tageszeitung „Kommersant“ zitierte einen russischen Beamten, der seinen Namen<br />
nicht nennen wollte. „Wenn man nicht unsere festnimmt, dann sagen wir klar: Das sind nicht<br />
unsere.“<br />
Die Bundesanwaltschaft hält sich bedeckt<br />
Die Pressestelle des Generalbundesanwaltes beschränkte sich bisher auf eine kurze<br />
Mitteilung, nach der die beiden Personen „dringend verdächtigt“ werden, „seit längerer Zeit<br />
in der Bundesrepublik Deutschland für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu<br />
sein.“<br />
Andreas A., ein Maschinenbauer, hatte angeblich beim hessischen Automobilzulieferer<br />
Schunk gearbeitet. Dass die Generalbundesanwaltschaft den dienstlich benutzten Computer<br />
eines Mitarbeiters der Firma Schunk beschlagnahmte, steht offenbar mit der Verhaftung von<br />
Andreas A. in Zusammenhang.<br />
Das verdächtige Paar soll schon seit 20 Jahren für Moskau spioniert haben. Angeblich standen<br />
Heidrun A. und Andreas A. in Kontakt mit der Spionin Anna Chapman, die im Juni letzten<br />
Jahres in New York verhaftet wurde und in westlichen und russischen Medien als<br />
verführerische Top-Agentin „90-60-90“ Schlagzeilen machte. (EM 08-2010, EM <strong>12</strong>-2010,<br />
EM 08-20<strong>11</strong>) Einige Mitglieder des Agentenrings um Anna Chapman kamen aus Südamerika.<br />
Die beiden in Süddeutschland verhafteten sollen 1990 mit österreichischen Pässen aus<br />
Mexiko nach Deutschland eingereist sein.<br />
Wohnhaus angeblich leergeräumt<br />
Das von dem verdächtigen Paar gemietete Haus in Marburg-Michelbach wurde von den<br />
Sicherheitskräften durchsucht. Einer der Nachbarn erklärte gegenüber dem Kommersant, das<br />
Haus sei von den Sicherheitskräften bis auf die Blumentöpfe leergeräumt worden. Der<br />
Bungalow sei jetzt „völlig leer und versiegelt“.<br />
Nach den Recherchen des Kommersants, der selbst einen Mitarbeiter vor Ort hat, ist Andreas<br />
A. 45 bis 46 Jahre und Heidrun A. 51 bis 52 Jahre alt. Nach Angaben der Nachbarn hätten die<br />
beiden Deutsch mit einem leichten russischen oder polnischen Akzent gesprochen. Als ein<br />
Nachbar sie ansprach, ob sie aus Osteuropa seien, hätten die beiden das aber verneint. Das<br />
Paar soll auch eine Tochter haben, die in Marburg Medizin studiert.<br />
Laut Kommersant können die Bewohner des Ortsteils Michelbach es nicht glauben, dass es<br />
sich bei dem festgenommenen Paar um Agenten handelt. Besondere Antennen habe man auf
ihrem Wohnhaus nicht gesehen. „Heute haben wir mit den Russen partnerschaftliche<br />
Beziehungen, warum sollen sie bei uns spionieren“, zitiert das Blatt einen Nachbarn.<br />
Kurzwellenempfänger angeblich nicht mehr im Einsatz<br />
Der frühere hohe KGB-Mitarbeiter Wladimir Rubanow erklärte gegenüber der Moskauer<br />
Tageszeitung „Iswestija“, Kurzwellenempfänger würden heute nicht mehr verwandt. Das<br />
seien „archaische Methoden“. Der Redakteur des Journals „Nationale Verteidigung“, Igor<br />
Korotschenko, erklärte gegenüber dem Blatt, die Nachrichtenübermittlung laufe heute über<br />
Satellitentelefone. Dabei werde das Signal schon beim Abschicken an den Satelliten<br />
verschlüsselt.<br />
Die Iswestija vermutet, dass es sich bei den Festgenommenen um sogenannte „Schläfer“<br />
handelte, Agenten, die nicht mehr im aktiven Einsatz sind. Ein namentlich nicht genannter<br />
Mitarbeiter des russischen Auslandsgeheimdienstes erklärte gegenüber dem Blatt, die<br />
„Schläfer“ hätten schon für die UdSSR gearbeitet und würden aus Altersgründen heute nur<br />
noch als „Briefkästen“ dienen. Ein guter Agent, so der russische Geheimdienst-Mitarbeiter,<br />
sei „wie ein Familienmitglied“, das man nicht einfach „abschreibt“.<br />
Tipp von der CIA<br />
Die Iswestija fragt, warum die deutschen Behörden, gerade jetzt öffentlich zwei Agenten<br />
enttarnten, „von denen kein Schaden ausging“. Offenbar hänge der Spionage-Skandal mit der<br />
Rückkehr von Putin in das Präsidenten-Amt zusammen, zitiert das Blatt den Leiter des<br />
Berthold-Beitz-Zentrums in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Alexander<br />
Rahr. Russische Medien berichten, den Hinweis auf die beiden Verdächtigen, habe das<br />
Bundeskriminalamt von der CIA erhalten. Angeblich hätten Heidrun A. und Andreas A. auf<br />
derselben Kurzwellenfrequenz gefunkt, wie die letztes Jahr in New York verhaftete russische<br />
Spionin Anna Chapman.<br />
Der von der Iswestija interviewte Mitarbeiter der russischen Auslandsspionage ist sich sicher,<br />
dass die beiden in Deutschland Festgenommenen Opfer eines Verrats wurden. Ohne Hilfe<br />
wäre es dem deutschen Geheimdienst nicht gelungen, die russischen „Nicht-Legalen“<br />
aufzuspüren.<br />
SCHWEIZ<br />
Ende einer Dienstfahrt – attraktive Russin<br />
wird dem Kripo-Chef Michael Perler<br />
beruflich zum Verhängnis<br />
Weil er seine russische Freundin mit auf eine Dienstreise nach St. Petersburg<br />
nahm, wurde der Chef der Schweizer Bundeskriminalpolizei, Michael Perler,<br />
beurlaubt. Russischen Medien gefällt das nicht.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong>
ie waren ein ungewöhnliches Paar. Wie der Kontakt zwischen dem ehemaligen Chef der<br />
Schweizer Bundeskriminalpolizei Michael Perler und der in St. Moritz tätigen<br />
russischen Ski-Lehrerin Jelena T. genau zustande kam, ist nicht überliefert. Nur so viel ist<br />
bekannt: Der 44jährige Perler sprach die sechs Jahre jüngere, attraktive Russin in einem Café<br />
an. Man lernte sich kennen. Das war im Januar 2010. Die beiden wurden ein Paar, sahen sich<br />
vor allem am Wochenende.<br />
Jelena, die aus Puschkino bei St. Petersburg stammt, lebt zu diesem Zeitpunkt schon seit 13<br />
Jahren in der Alpenrepublik und hatte nach einer Heirat in ihrer neuen Heimat auch einen<br />
Schweizer Pass. Im Ski-Urlaubsort St. Moritz arbeitet die gelernte Textil-Technologin als<br />
Ski-Lehrerin und Modeberaterin für gut betuchte Russen.<br />
Dunkle Wolken über dem Flitter-Pärchen<br />
Doch dann, im Sommer 2010 brauten sich dunkle Wolken über dem Flitter-Pärchen Michael<br />
und Jelena zusammen. Weil der Kripo-Chef seine russische Freundin mit auf eine Dienstreise<br />
nach St. Petersburg nahm, zu einem Anti-Mafia-Kongress, musste Perler Ende September<br />
seinen Posten räumen. Wegen der Reisekosten gab es keine Beanstandungen. Jelena T. reiste<br />
nicht auf Kosten des Schweizer Staates nach St. Petersburg.<br />
Perler hatte seine Freundin vor der Reise sogar vom behördeneigenen Sicherheitsdienst<br />
überprüfen lassen. Doch die Überprüfung durch die Untergebenen sei nichts wert gewesen,<br />
bemängelte ein Gericht in der Schweiz.<br />
Perlers Dienstreise „staatsgefährdend“<br />
Gegen seine Beurlaubung legte Perler Widerspruch ein. Doch nach der Reise wurde der<br />
Kripo-Chef selbst überprüft. Und die Fachstelle für Personensicherheitsprüfung im Schweizer<br />
Verteidigungs-Department kam zu dem Schluss, das Perler in seiner Funktion ein<br />
„Sicherheitsrisiko“ darstelle.<br />
Dieser Einschätzung widersprach Kripo-Chef und legte auch hiergegen Beschwerde ein.<br />
Doch das Schweizer Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Zwangsbeurlaubung. Perlers<br />
Entscheidung, seine russische Freundin auf eine Dienstreise mitzunehmen, sei „höchst<br />
problematisch, risikoreich und im weitesten Sinne staatsgefährdend“ gewesen, so das Gericht.<br />
Perler, der sein Amt als Chef der Bundeskriminalpolizei, erst vor zwei Jahren angetreten hatte<br />
wurde in den bezahlten Urlaub geschickt. Der Ex-Kripo-Chef will seine Beurlaubung nun vor<br />
dem Schweizer Bundesgericht anfechten.<br />
Der Tipp kam aus dem Umfeld des Kripo-Chefs<br />
Den Skandal um den Schweizer Kripo-Chef schob die rechtskonservative „Weltwoche“ im<br />
Juni letzten Jahres mit einer Kurznotiz über die umstrittene Reise nach St. Petersburg an.<br />
Offenbar hatte das Blatt aus der Gruppe der Schweizer, die an dem Anti-Mafia-Kongress in<br />
St. Petersburg teilnahmen, einen Tipp bekommen. Reißerisch titelte die „Weltwoche“: „Bei<br />
der Bundeskriminalpolizei (BKP) geht Liebe über Sicherheit.“ Eine „handverlesene BKP-<br />
Delegation“ unter Leitung ihres Chefs Michael Perler studiere in St. Petersburg mit russischen<br />
Amtskollegen die Aktivitäten der Mafia. „Höchst irritiert“ seien die Mitarbeiter, dass nicht
nur Schweizer Polizisten mit von der „hochsensiblen Partie“ sind, „sondern auch Perlers neue<br />
Freundin, eine Russin.“<br />
Internet-User haben Verständnis für Perler<br />
Seitdem beschäftigt der Fall Perler die Medien der Alpenrepublik. Internet-User in der<br />
Schweiz haben Verständnis für Perler - er sei eben ein Mann –, sorgen sich aber, das Ansehen<br />
der Bundeskriminalpolizei könne unter dem Skandal leiden.<br />
Wie nicht anders zu erwarten wurde der Fall Perler zum Medien-Hype. Journalisten des<br />
Boulevardblatts „Blick“ lauerten Jelena T. auf, fotografierten sie und wollten ein Interview<br />
erzwingen. Doch Jelena T. weigerte sich, die Haustür zu öffnen. Durch den Türspalt tat sie<br />
lediglich kund, dass sie für die Schweiz kein Sicherheitsrisiko darstelle.<br />
Es gab keine Reisevorschriften<br />
Ob der Chef der Schweizer Kriminalpolizei überhaupt Regeln verletzt hat, darüber gehen die<br />
Meinungen bei den Schweizer Medien auseinander. Perler sei „über fehlendes<br />
Risikobewusstsein und mangelnde Einsicht gestolpert“, kommentierte die „Neue Züricher<br />
Zeitung“. Die Wochenzeitung „Der Sonntag“ dagegen zitierte einen Vertreter des Schweizer<br />
Bundesamtes der Polizei (fedpol), der erklärte, es gäbe „keine internen Vorschriften, welche<br />
die Begleitung von Privatpersonen regeln“.<br />
Russisches Staatsfernsehen greift den Fall auf<br />
Der Fall Michael Perler/Jelena T. beschäftigt nun auch die russischen Medien. Gegenüber<br />
dem staatlichen Fernsehsender „Pervi Kanal“ erklärte der Sprecher des Schweizer<br />
Bundesverwaltungsgerichts, Andrea Arcidiacono, „natürlich“ könne sich auch ein Polizist<br />
verlieben. Er werde jedoch zum Sicherheitsrisiko „wenn die privaten Interessen über die<br />
beruflichen Interessen gestellt werden.“<br />
Die Moskauer Wochenzeitung „Argumenti Nedeli“ meinte, das „Herz von Europa“ sei voller<br />
Vorurteile gegenüber Russland. In Europa „passieren manchmal Dinge, die nicht häufig in<br />
totalitären Staaten passieren“. In der Schweiz könne man offenbar „wegen einer Beziehung zu<br />
einem Ausländer seine Karriere verlieren. Insbesondere wenn dieser Ausländer eine<br />
sympathische Russin ist.“<br />
„Jede Russin im Westen eine Anna Chapmann“<br />
Auch in der russischen Internet-Gemeinde wird der Fall Perler debattiert. Nach einem Bericht<br />
der Internetzeitung Fontanka.ru kommtierte scherzte User Arnor, „eine russische Frau – das<br />
ist gut! Aber gefährlich. Da braucht man einen russischen Muschik (Bauern, U.H.)“. User<br />
Sersch78 schrieb: „Nun sieht man in jeder russischen Frau im Westen die Spionin Anna<br />
Chapman.“<br />
Russische Behörden haben sich zu dem Fall bisher nicht geäußert. Der stellvertretende<br />
Pressesprecher des russischen Innenministeriums, Oleg Jelnikow, erklärte auf Anfrage, „ich<br />
weiß nichts von dem Thema“. Deshalb könne er die Angelegenheit auch nicht kommentieren.<br />
Kabinettsmitglieder mit ausländischen Ehepartnern
Unterdessen sorgt sich aber die russische Gemeinde in der Schweiz um das Ansehen der<br />
eigenen Landsmannschaft. Die Russen, die in der Schweiz leben, lässt der Skandal um Perler<br />
und seinen Freundin nicht kalt. Die russischsprachige Schweizer Internetzeitung<br />
NashaGazeta.ch kommentierte, offenbar werde bei der Behandlung von Ausländern mit<br />
zweierlei Maß gemessen, denn es gäbe in der Schweiz sogar Kabinettsmitglieder, mit<br />
Partnern bzw. Partnerinnen aus dem Ausland. Das werde allerdings nicht an die große Glocke<br />
gehängt. Die Ehefrau des Schweizer Verteidigungsministers Ueli Maurer komme aus Ghana.<br />
Der bisherige Chef der Schweizer Migrationsbehörde, Alard du Bois-Reymond sei mit einer<br />
Kongolesin verheiratet. Und die Schweizer Außenministerin Micheline Calmy-Rey mit einem<br />
Mann, der Anfang der 1950er Jahre aus Rumänien in die Schweiz geflüchtet sei.<br />
„Putin habe ich nie getroffen“<br />
Jelena T. hält sich gegenüber Medien bedeckt. Trotz mehrerer Anfragen war sie nicht bereit,<br />
meine Fragen zu beantworten. Gegenüber der Schweizer Wochenzeitung „Der Sonntag“<br />
erklärte die Russin, dass sie keinen Kontakt mehr mit Michael Perler habe. Perler sei für sie<br />
„ein Mann“ gewesen „und kein Polizist.“ Die Medienberichte über ihr Verhältnis zu dem<br />
Schweizer Kripo-Chef findet Jelena T. „nicht fair“. Freimütig erzählt die Russin in dem<br />
Interview, dass ihr Vater Berufsoffizier war. Er sei bei einer Bau-Division an einer<br />
militärischen Hochschule tätig gewesen. Derartige Lebensläufe sind in Russland mit seiner<br />
Riesen-Armee nichts Ungewöhnliches. Nein, Putin hab sie nie in der Schweiz getroffen,<br />
erklärte Jelena auf die bohrenden Fragen des Journalisten.<br />
RUSSLAND<br />
Schmierenkomödie mit Gastarbeitern<br />
Durch die Festnahme von dreihundert Arbeits-Immigranten aus<br />
Tadschikistan hat der Kreml die Freilassung von zwei in Zentralasien wegen<br />
Schmuggels verurteilten Piloten durchgesetzt.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
an schreibt das Jahr 20<strong>11</strong>. Doch die Methoden erinnern an das Mittelalter. Russland<br />
hat durch die Festnahme von über 300 Gastarbeitern aus dem zentralasiatischen<br />
Nachbarland Tadschikistan faktisch durchgesetzt, dass zwei in Tadschikistan wegen<br />
Schmuggels verurteilte Piloten freigelassen wurden.<br />
Die beiden Piloten, der Russe Wladimir Sadownitschi und sein Kollege Aleksej Rudenko –<br />
eine Este – wurden direkt im Gerichtssaal der süd-tadschikischen Stadt Kurgan-Tjube<br />
freigelassen. Die beiden Piloten waren Ende März mit ihrem Transportflugzeug vom Typ<br />
Antonow-72 in Kurgan-Tjube gelandet. Es war eine Notlandung ohne offizielle<br />
Genehmigung. Das Frachtflugzeug, welches ein Ersatz-Triebwerk an Bord hatte, kam aus<br />
Kabul und hatte nicht mehr genug Sprit, um nach Russland weiter zu fliegen. Nach der<br />
Landung wurden die Piloten wegen illegalen Grenzübertritts und Schmuggels festgenommen.<br />
Russisches Außenministerium wurde erst spät aktiv
Nach Meinung von Lew Ponomarjow, dem Leiter der russischen Organisation „Bewegung für<br />
Menschenrechte“ wurde das russische Außenministerium zu spät für die Befreiung der beiden<br />
Piloten aktiv. Erst Anfang November, nachdem die beiden Piloten von einem Gericht in<br />
Tadschikistan zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden waren, hätten sich russische<br />
Diplomaten wirklich in den Fall eingeschaltet. Der russische Botschafter wurde zu<br />
Beratungen nach Moskau bestellt. Gleichzeitig begann die Moskauer Polizei mit einer Jagd<br />
auf tadschikische Gastarbeiter. Über 300 Arbeits-Immigranten aus Tadschikistan wurden<br />
festgenommen und in Auffanglagern festgehalten. Die russische Migrationsbehörde erklärte,<br />
die Festgenommenen hätten keine gültigen Aufenthaltspapiere und würden demnächst in ihre<br />
Heimat abgeschoben.<br />
„Stimmung gegen Immigranten aufgepeitscht“<br />
Der Menschenrechtler Lew Ponomarjow verurteilte die Kampagne gegen tadschikische<br />
Gastarbeiter, weil dadurch „die Stimmung gegen Immigranten aufgepeitscht werde“. Um die<br />
Piloten zu befreien, hätte man Konten des tadschikischen Staates beschlagnahmen können,<br />
erklärte Ponomarjow. Aber wenn einfach Bürger unter solchen Bestrafungs-Maßnahmen<br />
leiden, sei das „schlecht“. Der Menschrechtler erklärte, die anti-tadschikische Kampagne<br />
erinnere an die anti-georgische Kampagne im Jahre 2006. Damals waren mehrere hundert<br />
Georgier aus Moskau ausgewiesen worden. Das war die Antwort Moskaus auf die Verhaftung<br />
von angeblichen russischen Spionen in Georgien.<br />
Familien in Tadschikistan leben von Überweisungen der<br />
Väter<br />
Ein Vertreter des russischen Außenministeriums erklärte gegenüber dem Moskauer<br />
„Kommersant“, eine Kampagne gegen Gastarbeiter habe es nicht gegeben. Nur habe man die<br />
Festnahme von Tadschiken ohne gültige Aufenthaltsberechtigung diesmal unter Einschaltung<br />
der Medien durchgeführt. Damit habe man psychologischen Druck auf die Regierung in<br />
Duschanbe ausgeübt.<br />
Die Gastarbeiter aus Tadschikistan, die in den russischen Großstädten auf dem Bau und in der<br />
Gebäudereinigung tätig sind, haben im letzten Jahr 2,2 Milliarden Dollar an ihre Familien in<br />
Tadschikistan überwiesen. Diese Summe entspricht 39,3 Prozent des Inlandsproduktes der<br />
zentralasiatischen Republik.<br />
Urteil „zu hart“<br />
Formal reagierte das Gericht im süd-tadschikischen Kurgan-Tjube mit der Freilassung der<br />
beiden Piloten auf eine Einlassung der tadschikischen Staatsanwaltschaft. Diese hatte erklärt,<br />
dass das Urteil gegen die beiden Piloten „zu hart“ war. Unter Anrechnung der Zeit, welche die<br />
Piloten schon im Gefängnis verbracht hatten und einer Amnestie konnten die Piloten<br />
freigelassen werden.<br />
Vieles an dem Fall der beiden Piloten ist mysteriös. Der Moskauer Kommersant berichtete<br />
unter Berufung auf Aussagen russischer Diplomaten, dass Tadschikistan sich mit dem harten<br />
Urteil gegen die beiden Piloten an dem Urteil an gegen einen hochgestellten Tadschiken<br />
rächen wollte. 2009 war Rustam Chukumow, der Sohn des Leiters der tadschikischen
Eisenbahn, im Moskauer Umland wegen Drogenhandel festgenommen und zu einer Haftstrafe<br />
verurteilt worden.<br />
Gastarbeiter – kriminell und „infiziert“?<br />
Die Kampagne gegen die tadschikischen Arbeits-Immigranten, die ohne Visum nach<br />
Russland einreisen können, hatte in den letzten Wochen skurrile Ausmaße angenommen. Der<br />
Leiter der russischen Migrationsbehörde Konstantin Romodanowski erklärte, die<br />
Kriminalitätsrate unter den Gastarbeitern sei besonders hoch. Und der russische Oberarzt<br />
Gennadi Onistschenko erklärte, man dürfe keine tadschikischen Gastarbeiter mehr einreisen<br />
lassen, denn ein Großteil der Tadschiken sei mit HIV und Tuberkulose infiziert. Die<br />
Moskauer Tageszeitung Moskowski Komsomolez hält die Zahlen jedoch für übertrieben.<br />
Die „Gastarbeitery“ aus Zentralasien, wie die Arbeits-Immigranten in Anlehnung an den<br />
deutschen Begriff heißen, sind überall dort im Einsatz, wo es harte Arbeit zu geringem Lohn<br />
gibt. Zusammen mit ihren Kollegen aus Kirgistan und Usbekistan leben sie in Container-<br />
Dörfern am Rande der Baustellen oder zu acht in Zwei-Zimmer-Wohnungen in Plattenbauten,<br />
Wand an Wand mit russischen Familien.<br />
Offiziell arbeiten 700.000 Tadschiken in Russland. Doch die wirkliche Zahl dürfte weit<br />
darüber liegen. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2009 arbeiten in Russland insgesamt 7,2<br />
Millionen Gastarbeiter aus Zentralasien, dem Kaukasus, der Ukraine und Moldau, davon fünf<br />
Millionen nicht legal. Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen können die „Gastarbeitery“, ,<br />
für Schmiergelder bei obskuren Vermittler-Firmen kaufen.<br />
Kein Thema für die Gewerkschaften<br />
Dass die Männer aus Zentralasien harte Arbeit für wenig Geld machen, weckt bei den Russen<br />
ungute Gefühle. Viele sehen in den „Gastarbeitery“ nichts weiter als Lohndrücker. Doch der<br />
russische Dach-Gewerkschaftsverband FNPR kümmert sich nicht um die Arbeits-<br />
Immigranten. Nur ein paar linke Duma-Abgeordnete und Menschenrechtler bringen in der<br />
Öffentlichkeit zur Sprache, wenn mal wieder Reinigungs- oder Baufirmen den Migranten den<br />
Lohn vorenthalten oder die Pässe einbehalten.<br />
Duschanbe pokert<br />
Bei dem Tauziehen zwischen Moskau und Duschanbe geht es möglicherweise jedoch um<br />
mehr als nur um die beiden Piloten. Der Moskauer Kommersant berichtete unter Berufung auf<br />
russische Diplomaten, Tadschikistan habe sich mit dem Vorgehen gegen die Piloten für das<br />
Urteil gegen den Tadschiken Rustam Chukumow rächen wollen. Der Vater von Chukumow<br />
ist immerhin der Leiter der tadschikischen Eisenbahn. 2009 war Rustam Chukumow im<br />
Moskauer Umland wegen Drogenhandel festgenommen und zu einer Haftstrafe verurteilt<br />
worden.<br />
Ein weiterer Grund für den Konflikt zwischen Moskau und Duschanbe ist möglicherweise das<br />
selbstbewusstere Auftreten von Tadschikistan gegenüber Russland. Tadschikistan gehört zu<br />
den Staaten, mit denen Russland ab Januar 20<strong>12</strong> eine eurasische Freihandelszone und<br />
mittelfristig eine Eurasische Union bilden will. Duschanbe möchte – so der russische Duma-<br />
Abgeordnet Semjon Bagdasorow - „gegenüber seinen Partnern USA, dem Iran und China zu<br />
demonstrieren, dass man von Russland unabhängig ist“. Auch versuche Duschanbe die
ussische Militärbasis aus Tadschikistan zu verdrängen. Doch tatsächlich ist es wohl so, dass<br />
Duschanbe gegenüber Moskau einfach nur pokert um günstige Bedingungen für zukünftige<br />
eurasische Staatenbündnisse durchzusetzen.<br />
ZWEITER WELTKRIEG<br />
Als Leningrad verhungerte<br />
Am 6. Dezember 1941 – kürzlich jährte sich das Ereignis zum 70. Mal – wurde<br />
der belagerten Stadt Leningrad mitten im eiskalten Winter die Heizung<br />
gekappt und es gab kein Trinkwasser mehr. Deutsche und finnische Truppen<br />
hatten die Stadt im Zweiten Weltkrieg 900 Tage lang eingekesselt. Rund eine<br />
Million Einwohner starben an Kälte, Hunger und Entkräftung.<br />
Von Mandy Ganske<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
in enger, dunkler Raum empfängt den Besucher. Er befindet sich hinter einer Tür mit<br />
der Aufschrift „Museum“. Zu ihr gelangt man direkt an dem von zwei hoch aufragenden<br />
Gebäuden flankierten Eingangsportal des Piskarjowskoje-Friedhofs im Norden St.<br />
Petersburgs. Das Licht in dem Raum ist gedämpft und er hat schwarze Wände. Bilder des<br />
Elends, des Leids und des Todes sind aufgehängt: Bis auf die Knochen herunter gehungerte<br />
Gesichter und Leiber. Darunter sind viele Aufnahmen aus dem Winter 1941 und 1942. Es war<br />
der härteste während der 900 Tage dauernden Blockade St. Petersburgs, das damals noch<br />
Leningrad hieß und seit September 1941 von deutschen und finnischen Soldaten eingekesselt<br />
war.<br />
Diese Bilder erzählen die Geschichte dieses Winters, in dem 40 Grad unter null herrschten<br />
und die Menschen systematisch ausgehungert wurden. Die Schlinge um die Stadt hatte sich<br />
zugezogen, zwei Monate später war die Stromversorgung am Ende. Am 6. Dezember 1941 –<br />
in diesen Tagen vor 70 Jahren – wurde die Heizung gekappt und es gab kein Trinkwasser<br />
mehr.<br />
Der langwierige Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung begann, ohne eine Kugel zu<br />
verschießen. Hitler sah die Newa-Metropole beim Versuch, die Sowjetunion einzunehmen,<br />
mehr und mehr als Nebenkriegsschauplatz. Sie sollte nebenbei fallen, wie der Bauer auf dem<br />
Schachbrett, und die Menschen darin gleich mit. Hauptsache sie würde fallen.<br />
Leningrad sollte fallen, wie der Bauer auf dem<br />
Schachbrett<br />
Der Historiker Jörg Ganzenmüller von der Universität Jena spricht von „einem Genozid an<br />
der Leningrader Zivilbevölkerung“. Für die Einwohner, von denen in den 900 Tagen eine<br />
Million ums Leben kam, war die Blockade jeden Tag ein grauenhafter Überlebenskampf. Das<br />
kann der Besucher auf dem großen Gedenkfriedhof im heutigen St. Petersburg nicht mehr<br />
nachfühlen, nur erahnen. Bild- und auch Tondokumente im Museum, das erst 2010 nach<br />
Restaurierung wiedereröffnet worden war, vermitteln dürftige Eindrücke des Unvorstellbaren:<br />
Fluglärm, Glockengeläut, Fußmärsche, Schüsse. Einem Flachbildschirm gegenüber liegt ein
Stück Brot in einer kleinen Glasvitrine. Es sind genau <strong>12</strong>5 Gramm. Das war die tägliche<br />
Ration für jeden Leningrader im Hungerwinter. So nimmt das Erinnern Form an. Durch das<br />
kleine Mädchen Tanja an der Schautafel daneben erhält es ein Gesicht. Immer wenn einer<br />
ihrer Verwandten starb, notierte Tanja sich das Datum auf einem Zettel: Ihre Mutter starb am<br />
13. Mai 1942 um 7.30 Uhr. Sie notierte immer weiter, bis auf einem letzten Zettel steht: Ich<br />
bleibe als einzige...<br />
Wer aus diesem finsteren Raum zurück an die Sonne und an das Gräberfeld tritt, fühlt sich<br />
klein. Klein vor der Tragödie, die über diese Stadt und ihre Menschen gekommen war. Davon<br />
zeugen 186 Gräberhügel. Darunter liegen auf dem gesamten Friedhof die Gebeine von 470<br />
000 Menschen und 50 000 Soldaten begraben.<br />
Die Blockade hat nach Schätzungen insgesamt 800 000 bis 1,2 Millionen Menschen das<br />
Leben gekostet. Etwa eine Million Menschen konnte evakuiert werden und nur noch 700 000<br />
Leningrader lebten in der Stadt, als die Befreiung endgültig gelang.<br />
Die Klänge der Siebten Symphonie von Schostakowitsch<br />
Auf dem hinteren Teil des Friedhofs stehen wenige Namen und Daten von Armeeangehörigen<br />
auf Grabsteinen: Sehr viele von ihnen waren, wie man lesen kann, gerade Anfang oder Mitte<br />
zwanzig, als sie ihr Leben ließen. Ihnen und den zivilen Opfern zu Ehren brennt eine ewige<br />
Flamme.<br />
Es ist still, nur die Siebte Symphonie von Dimitri Schostakowitsch dringt aus Lautsprechern<br />
ans Ohr. Schostakowitsch hatte das Stück dem Kampf gegen den Faschismus sowie seiner<br />
Heimatstadt gewidmet. Es erinnert an eines der wenigen Hoffnung spendenden Erlebnisse für<br />
die Bewohner dieser damals Stück für Stück regelrecht aussterbenden Stadt:<br />
Im August 1942 hatte das das Symphonieorchester im großen Saal der Leningrader<br />
Philharmonie gespielt. Auch zur zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich des Überfalls der<br />
Deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion erklang Schostakowitschs Siebte im Sommer<br />
dieses Jahres in Berlin. An ihr nahmen Kulturstaatsminister Bernd Neumann sowie die<br />
Botschafter der Russischen Förderation, der Ukraine und Belarus teil. Es spielte das RIAS<br />
Jugendorchester.<br />
Still und leise plätschert sie auf dem St. Petersburger Gedenkfriedhof aus den Lautsprechern,<br />
die das Gräberfeld säumen. Soweit sie zu hören ist, füllt sie die bedrückende Weite auf<br />
diesem 28 Hektar großen Areal, welche nur von Bäumen sowie von einer hoch aufragenden<br />
Bronzestatue durchbrochen wird, der „Mutter Heimat“. Die Statue steht am Ende einer von<br />
Grabhügeln gesäumten Allee.<br />
Vier Befreiungsschläge der Roten Armee misslangen<br />
Bis zum 27. Januar 1944 sollten die Leningrader durchhalten und ertragen müssen, dass die<br />
Deutschen sich vor der Stadt festgesetzt hatten. Denn Hitlers Pläne sahen vor, die Newa-<br />
Metropole gerade nicht einzunehmen, sondern die Menschen in der Stadt Peters des<br />
Großen einfach sterben zu lassen. Die Vernichtung Leningrads war laut Ganzenmüller fest in<br />
den Germanisierungsplänen einkalkuliert und in der Zukunft eines<br />
„großgermanischen Konlonialraum(s) nicht mehr vorgesehen“ gewesen.
Vier Befreiungsschläge der Roten Armee misslangen bis 1943, so dass für die Leningrader<br />
immer mehr Tage ins Land zogen, in denen oft nichts anderes galt, als Krankheiten und den<br />
quälenden Hunger entkräftet auszuhalten, zur Not Ölkuchen zu essen und immer wieder<br />
Wasser aus Eislöchern in der Newa zu schöpfen.<br />
Wer in der Lebensmittelindustrie arbeitete, zweigte ab, was er konnte. Erst das letzte Jahr<br />
dieser Blockade hatte den Menschen Erleichterungen gebracht, denn der Roten Armee war es<br />
im fünften Anlauf gelungen, den Belagerungsgürtel zu sprengen – die vor der Stadt liegende<br />
Festung Schlüsselburg wurde im Januar 1943 befreit. Außerdem war der Ladogasee zur<br />
Rettung geworden; über ihn hinweg war es möglich, die Stadt mit Gütern zu versorgen - wenn<br />
auch beschwerlich über holprige und schwer zugängliche Wege bis zum See.<br />
Die menschenverachtende Politik Stalins passt nicht zum<br />
Pathos<br />
Dem gewaltigen Kraftakt der Menschen und der Armee setzt der Petersburger Friedhof ein<br />
Denkmal. Worüber dieses Denkmal aber nichts erzählt, ist, dass auch Machthaber Stalin<br />
während dieser Blockade seine eigene menschenverachtende Politik fortsetzte. Er<br />
veranlasste, Industrieanlagen zu retten, aber als der Diktator Menschen evakuierte, ließ er<br />
zunächst nur diejenigen aus der Newa-Metropole herausbringen, die ihm nützlich erschienen,<br />
zum Beispiel Arbeiter-Familien ganz im Sinne der Ideologie.<br />
Staatlich ausgeübter Terror blieb an der Tagesordnung – gegenüber „Volksfeinden“<br />
sowie der finnisch- und deutschsprachigen Minderheit. Die einen wurden verhaftet, die<br />
anderen nach Kasachstan oder Sibirien deportiert. Aber diese Details werden in der<br />
Gedenkstätte verschwiegen, wahrscheinlich weil sie am Heldenmythos des russischen Volkes<br />
und seiner Machthaber insgesamt nagen könnten, der fest im historischen Gedächtnis<br />
verankert ist und heute wieder für den Aufbau nationalen Selbstbewusstseins herhält.<br />
Gerade die Blockade steht als leuchtendes Beispiel der heldenhaften Verteidigung<br />
einer Millionen-Metropole und die Inschrift an der Decke des Gedenkmuseums in goldenen<br />
Lettern will das dem Besucher mit auf den Weg geben: „Ruhm denen, die ihr Leben für die<br />
Stadt geopfert haben – den Helden Leningrads.“<br />
Kein Wort von den gescheiterten Befreiungsversuchen der Roten Armee, deren Einheiten<br />
teilweise schlecht ausgestattet und schlecht koordiniert waren. Kein Wort davon, dass der<br />
Machtstratege Stalin das letzte Jahr verstreichen ließ, weil die Versorgungslage sehr viel<br />
besser geworden war. Dabei litt die Stadt auch in dieser Zeit unter Artilleriebeschuss. Zu gut<br />
machte sich das belagerte Leningrad offenbar in Verhandlungen gegenüber westlichen<br />
Alliierten, in denen Stalin darauf verwies, welche Lasten man zu tragen habe.<br />
Kein Wort auch von Verfolgung und Deportation. Stattdessen neben den Massengräbern ein<br />
See, mit einer Bauminsel in der Mitte. Bänke unter Bäumen laden am Ufer zum Verweilen<br />
ein. Alles ist friedvoll. Es ist die alte Kunst, die Russland so gut beherrscht, die<br />
Festveranstaltungen zu Nationalfeiertagen sowie die vielen Gedenkstätten für den „Großen<br />
Vaterländischen Krieg“ mit Pathos aufzuladen, und dabei die eigenen Fehler und Gräuel<br />
vergessen zu machen. So wie dieser Gedenkfriedhof eben solches Pathos verströmt, auf dem<br />
für den Besucher jeder kritische Geist erlöschen und dem reinen Mitgefühl Platz machen soll.<br />
*
Die Autorin Mandy Ganske-Zapf ist Redakteurin der „Volksstimme“ in Sachsen-Anhalt. Sie<br />
hat 2003/2004 für ein Jahr in St. Petersburg gelebt und reist seitdem regelmäßig dorthin.<br />
VERKEHRSWEGE<br />
Kaliningrad weiträumig umfahren!<br />
In den fast siebzig Jahren ihrer Herrschaft über das ehemalige Nord-<br />
Ostpreußen haben die Russen so gut wie nichts für den Straßenbau getan.<br />
Autoverkehr und Straßenbau in Russlands „westlichem Vorposten“ sind eine<br />
Katastrophe. Jetzt wird gebaut, aber die Kaliningrader verzweifeln an der<br />
russischen Bürokratie.<br />
Von Wolf Oschlies<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Am Königsberger Dom.<br />
Foto: EM<br />
m russischen Original war Nikolaj Gogols legendärer Stoßseufzer ein launiger Stabreim:<br />
„Duraki i dorogi“ seien Russlands Hauptübel, „Dummköpfe und Straßen“.<br />
Seither vergingen 180 Jahre, doch das Verdikt gilt nach wie vor, in Kaliningrad, dem ehemals<br />
deutschen Königsberg, vor allem für Straßen. Laut russischen Statistiken zur Sicherheit von<br />
Verkehrswegen belegen Stadt und Umgebung unter 81 geprüften Regionen Platz 72 – nur im<br />
nordkaukasischen Tschetschenien und in zentralrussischen Rückzugsgebieten ist Autoverkehr<br />
noch mörderischer als in Kaliningrad, das bei Verkehrsunfällen mit Toten und Verletzten etc.<br />
das Gros russischer Regionen überbietet.<br />
Bei der Verkehrsdichte aber steht Kaliningrad auf Platz sechs! Die 143 Millionen Russen<br />
fahren derzeit über 34 Millionen PKWs, wovon über die Hälfte älter als zehn Jahre sind. Das<br />
will der Gesetzgeber in den nächsten Jahren ändern, was die Kaliningrader wenig betrifft.<br />
Denn hier in diesem kleinen Gebiet (15.<strong>12</strong>5 Quadratkilometer) kommen auf je 1.000
Einwohner 284 meist neue Autos. Vergleichsmaßstäbe nannte Premier Putin im Oktober 2009<br />
in Kaliningrad: „Hier hat jeder Dritte ein Auto, im russischen Durchschnitt besitzt nur jeder<br />
Zehnte seinen eigenen PKW“.<br />
„Seine meisten Straßen hat das Gebiet von Deutschland<br />
bekommen“<br />
„Welcher Russe liebt nicht skoraja voshnja (rasende Fahrt)?“, fragte ebenfalls Gogol, aber<br />
russisches Fahrvergnügen wird immer häufiger durch „probki“ (Staus) gemindert oder<br />
amtlich vermiest, zumal in Kalinigrad, wo 70 Stundenkilometer die erlaubte<br />
Höchstgeschwindigkeit sind, statt 90, wie in Russland üblich.<br />
Das spezifisch russische Problem ist, dass viele neue Autos sich auf wenigen alten Straßen<br />
bewegen. Das sorgt für exorbitant hohe Zahlen von Unfällen, allein in Moskau 600.000<br />
jährlich. Kaliningrad liegt relativ höher, was die Folge dessen ist, dass die Russen in fast<br />
siebzig Jahren ihrer Herrschaft über das ehemalige Nord-Ostpreußen so gut wie nichts für den<br />
Straßenbau getan haben. Oder wie sonst ist Putins gewundene Äußerung zu verstehen, die er<br />
2009 in Kaliningrad tat: „Seine meisten Straßen hat das Gebiet von Deutschland bekommen“.<br />
Jetzt soll neugebaut werden, wie Putin 2009 dozierte: „Wo Straßen entstehen, da siedeln sich<br />
sofort auch kleine, mittlere und große Unternehmen an. Das gilt vor allem für diese Region,<br />
sie liegt am offenen Meer und will Tourismus und Erholung fördern“. Die Rede ist von<br />
4.614,4 Kilometer Straßen, davon nur 203,8 Kilometer von „föderalem Rang“, der Rest von<br />
regionalem. Es trifft zu, dass Kaliningrads Wirtschaftsplanung seit einigen Jahren auf<br />
Tourismus abzielt. Aber bevor nur eine Kopeke verdient ist, sind Dutzende Rubel-Milliarden<br />
für Reparatur und Neubau von 700 Kilometer Straßen nötig, was 38,3 Milliarden Rubel<br />
kostet.<br />
In den Straßen von Kaliningrad.<br />
Foto: EM<br />
Seit Januar 2008 wird nun gebaut
Solche Rechnungen erscheinen Kaliningradern als „von Phantasten und Märchenonkeln“<br />
erdacht, nämlich unrealistisch niedrig. 60 Milliarden Rubel sollen allein die 178 Kilometer<br />
des „Küstenrings“ kosten, dessen Südteil um Kaliningrad herum führt (42,2 Kilometer),<br />
während der Nordteil die Badeorte an der Ostsee verbindet.<br />
Seit Januar 2008 wird nun gebaut, derzeit am vierten Teilstück Selenogradsk (Cranz)-<br />
Pionerskij (Neukuhren)-Svetlogorsk (Rauschen). Im Juli hat Präsident Medwedjew sich<br />
beifällig geäußert, was Kaliningrads Gouverneur Zukanow hoffen lässt, dass Moskau seinen<br />
Baukostenanteil von <strong>12</strong> Milliarden Rubel aufstocken wird. Geld fehlt überall, beginnend mit<br />
der Entschädigung von über 100 Grundeigentümern, von denen einige „nicht in der Region<br />
leben“. Meinte er Deutsche?<br />
Anderswo stocken Straßenreparaturen, weil kleinere Orte sie verweigerten: Die Staatshilfen<br />
waren ihnen zu schäbig! Generell aber kann sich niemand vor dem Programm „Entwicklung<br />
des Gebiets Kaliningrad bis 2015“ drücken, da der Straßenbau die Region in internationale<br />
Verkehrswege und europäische Korridore einbindet: Kaliningrad—Mamonovo<br />
(Heiligenbeil)–polnische Grenze, Kaliningrad-Nesterov (Stallupönen)-litauische Grenze,<br />
Umgehung Bagratianovsk (Preußisch Eylau) samt LKW-Übergang nach Polen,<br />
transeuropäischer Korridor Riga – Kaliningrad-Gdansk (Danzig), Zubringer zum Flughafen<br />
„Chrabrovo“ (24 Kilometer nördlich von Kaliningrad) als vierspurige Schnellstraße für <strong>12</strong>0<br />
Stundenkilometer.<br />
Verkehrspolitische Sünden in Serie<br />
An Programmen und Projekten ist kein Mangel. Vorrang hat wie jedes Jahr das „Föderale<br />
Straßennetz“, an dem allein 20<strong>11</strong> rund 5.700 Kilometer Straßen reparieren werden sollen.<br />
Dabei fallen auch 2,5 Milliarden Rubel für die A-229 Kaliningrad –Nesterov ab, die einzige<br />
Föderalstraße der Region. Für andere Projekte blieb nur eine Milliarde, wie Gouverneur<br />
Zukanow im Mai klagte, dabei steckt hinter manchem planerische Weitsicht.: Neue Badeorte<br />
neben bereits bestehenden, eine neue Brücke in West-Kaliningrad, die dessen Nord- und<br />
Südumgehung verbessert, damit der Autoverkehr zu den Häfen Baltijsk (Pillau) und Svetlyj<br />
(Zimmerbude) bzw. zu dem geplanten Tiefwasserhafen Primorsk (Fischhausen) führt.<br />
Die Russen merken eben (oder kriegen es von Polen aufs Butterbrot geschmiert), dass sie in<br />
„ihrem“ Teil Ostpreußens verkehrspolitische Sünden in Serie begangen haben. So befahl im<br />
April und Juni 1945 Stalins „Verteidigungskomitee“ als erste Maßnahme die „Demontage von<br />
Schmalspurbahnen auf dem Gebiet Ostpreußens“ und das tut bis heute weh. Ähnlich steht es<br />
um die „Berlinka“, die legendäre Autobahn Berlin-Königsberg, von der die Polen ein<br />
Teilstück seit den 1990-er Jahren modernisierten, während die Russen 2010, als sie den<br />
Grenzübergang Mamonovo II zu Polen öffneten, parallel zur alten Betonpiste eine neue<br />
Asphaltbahn legten.
Seebad Rauschen (Swetlogorsk) bei Kaliningrad, Uferpromenade.<br />
Foto: EM<br />
Die Bürger von „Kjonig“ wünschten sich die alte<br />
„Berlinka“<br />
Das hielten die Bürger von „Kjonig“ (wie Russen Königsberg nennen) für zweifach falsch:<br />
Warum wurde die alte „Berlinka“ nicht „reanimiert“, die Teil des „europäischen<br />
Schnellstraßensystems“ war? Und warum Asphalt, mit dem man nur schlechte Erfahrungen<br />
machte – er verträgt Temperaturschwankungen von etwa 40 Grad, wo Russland solche von 80<br />
Grad kennt. Dabei reißt Asphalt, was die berüchtigten russischen Schlaglöcher von Metertiefe<br />
und Quadratmeter-Ausdehnung bewirkt.<br />
Das sind Momente, wo sich Russen seufzend an Gogols Diktum von „duraki i dorogi“<br />
erinnern. Prof. Aleksandr Brechman, Direktor des Instituts für Transportmittel an der<br />
Atrchitekturhochschule Kasan, rechnet vor, dass russische Straßen fünf bis maximal sieben<br />
Jahre vorhalten, wo doch zehn bis zwölf Jahre „Normfrist“ sind. Die Normer haben<br />
offenkundig nicht mitgekriegt, dass das russische Straßennetz in Vorzeiten konzipiert wurde,<br />
als man sechs bis sieben Tonnen Belastung pro LKW-Achse zugrunde legte. Inzwischen<br />
bringen LKWs 14 Tonnen auf die Waage, und da sind es die Straßen, die nachgeben müssen.<br />
Liebend gern wird aber den „Wetterverhältnissen“ die Schuld in die Schuhe<br />
geschoben. Straßenbauer führen sie immer wieder gern als Entschuldigung an. Mal sind die<br />
Temperaturen über, dann wieder unter Null, mal schmilzt der Schnee, Schmelzwasser dringt<br />
in den Straßenbelag ein, dann friert es plötzlich wieder und so etwas zerreißt den Asphalt.<br />
Auf jeden Fall russischen Asphalt, höhnte die populäre Wochenzeitung „Argumenty i Fakty“<br />
(AiF), die sich (zu Recht) als medialer Ombudsman der Russen versteht. In Skandinavien, im<br />
Norden der USA und in Kanada sind die klimatischen Verhältnisse wie in Russland, aber die<br />
Straßen sind weit besser als russische. Weil sie besser überwacht, gewartet, gepflegt werden,<br />
ließ sich „AiF“ von ihren Auslandskorrespondenten berichten. Die warteten mit exakten<br />
Zahlen auf, wie viele Zehntausende Wetterfühler es entlang amerikanischer und westlicher<br />
Straßen gibt, wegen derer sich „niemand vor Frösten fürchtet“. Wenn die kommen, stoßen sie<br />
auf Verkehrswege, die bereits im Sommer mit allem bautechnischen Know how winterfest<br />
gemacht worden sind.
Sommertag an der Samländischen Steilküste bei Rauschen (Swetlogorsk).<br />
Foto: EM<br />
Beläge, die gerade noch für Fußgänger mit Sandalen<br />
taugen<br />
In Russland werden Straßen mit einem Asphalt-Schotter-Gemisch der Gruppen A,B,V,G,.D<br />
„und so weiter“ belegt, wobei der G-Belag gerade noch für Fußgänger mit Sandalen taugt,<br />
nicht aber für Fernstraßen in Sibirien. Dennoch wird er bevorzugt, weil er leichter zu verlegen<br />
ist und weniger kostet, was aber „rausgeschmissenes Geld ist“, wie die Straßenbauer meinen.<br />
Wenn auf westlichen Fernstraßen Glatteis droht, warnen die „Wetterfühler“ rechtzeitig und<br />
geben exakte Hinweise, welches Streusalz in welcher Menge eingesetzt werden soll. In<br />
Russland wird das Salz so bedenkenlos in die Gegend gestreut, dass „sich der Straßenbelag<br />
einfach auflöst“. Inzwischen wird im Westen mit dem Bau von betonierten Trassen<br />
experimentiert, was zwar „teurer ist, aber dafür bis zu 25 Jahren vorhält“. - sagen russische<br />
Kommentare, die wohl wissen, dass derartige Novitäten in Russland einstweilen noch<br />
unvorstellbar sind. Dort bleibt es dabei, so „AiF“, dass „vse dorogi vedut v jamu – alle<br />
Straßen in die Grube führen“.<br />
Können die Russen es nicht?<br />
Es gibt in Russland respektable Straßenbaufirmen, allen voran der Konzern „Dorservis“<br />
(Straßendienst), der eine Filiale auch in Kaliningrad betreibt (ul. Lomonosova d.101) und in<br />
dem Gebiet an der erwähnten Föderalstraße A-229 tätig ist, daneben an den Umgehungen von<br />
Kaliningrad, Sovetsk (Tilsit), Cernjachovsk (Insterburg) und weiteren Projekten.<br />
Neben Branchenführer „Dorservis“ stehen andere, die Gouverneur Zukanow zornig machen:<br />
Drei Unternehmen bekommen einen Auftrag, nur zwei leisten reelle Arbeit, und so bleiben<br />
Teile der Strecke unerledigt liegen. Oder es bewerben sich „Brezelbäcker“, die im Straßenbau<br />
den großen Reibach wittern, und ähnliche Gauner mehr.
Russland braucht ein „einheitliches Straßennetz, ganzjährig der Bevölkerung zugänglich, das<br />
eine Autoverbindung mit allen Regionen und Siedlungen erlaubt und ständige<br />
Transportströme sichert“. Für Straßen mit fester Decke werden 20<strong>11</strong> 5 Milliarden Rubel<br />
bereitgestellt, 20<strong>12</strong> 6. Milliarden, danach alljährlich sieben Milliarden So verkündet es<br />
Russlands Verkehrsminister Igor Lewitin, der aus internationalen Vergleichen um russische<br />
Rückstände weiß. In Indien baute man mit weniger Aufwand und Hilfe von der Weltbank<br />
binnen fünf Jahren 24.200 Kilometer Straßen. Die Ukraine schaffte im selben Zeitraum<br />
immerhin 1.014 Kilometer, aber „Russland bleibt hinter Indien zurück, wird sogar von der<br />
Ukraine überholt“. Nicht ganz Russland: Das kleine Tatarstan im Osten des europäischen<br />
Russlands (67.847 Quadratkilometer, 3,8 Millionen Einwohner) gehört zwar zur russischen<br />
Föderation, hat aber seine bekannte Eigenständigkeit gerade durch den Bau Hunderter<br />
Straßenkilometer bezeugt. Können die Russen es nicht?<br />
Die Kaliningrader Russen könnten es sehr wohl, wenn die „Duraki“ der Moskauer Bürokratie<br />
sie nur ließen! Gouverneur Zukanow hat es im Mai wütend vorgerechnet: Wenn die<br />
Föderation Bauaufträge ausschreibt und die Finanzierung ungenügend kontrolliert, dann soll<br />
sie sich nicht wundern, wenn „kolossale Summen“ spurlos versickern. Verlagert alles auf<br />
„regionale Ebene“, und es wird besser!<br />
„Kaliningrad heute zu Europa zu zählen, ist lachhaft.<br />
Königsberg war das Herz Europas, als Kant hier lebte.“<br />
Aus Moskauer Sicht ist Kalningrad „Russlands westlicher Vorposten“, was Zukanow nur als<br />
geographische Angabe goutiert: Für ihn ist die Stadt nicht nur „russische Exklave“ am EU-<br />
Ostrand, sondern ein Feld, auf dem alles geprobt und probiert wird, was EU und Russland<br />
einander bieten können. Beide besiegelten 1994 ein Partnerschaftsabkommen und<br />
konkretisierten es 2003 in einer „Roadmap“, die Zukanow nun als infrastrukturellen und<br />
verkehrspolitischen Anschub nutzen will. Details verriet er am 15. August der Agentur „RIA<br />
Nowosti“: Kaliningrad wird 2018 die Fußball-WM mit ausrichten, wofür Russland vor allem<br />
Verkehrsprojekte finanzieren soll: „Moderner Flughafen, Seehafen, Busbahnhof, gute<br />
Straßen. Transportverbindungen, neue Brücken über den Pregel und dessen Uferbefestigung,<br />
neues Stadion für 44.000 Zuschauer, modernes Gesundheitswesen“ und was eine Region<br />
sonst noch braucht, die nach Jahrzehnten der Zurückstellung die Chance sieht, sich Europa<br />
bestens zu empfehlen. Dass sie von „Europa“ immer mehr an ihrer nichtrussischen<br />
Vergangenheit gemessen wird, nimmt sie als Ansporn hin, selbst wenn es so ätzend formuliert<br />
ist wie jüngst von Toomas Ilves, Präsident des benachbarten Estlands: „Kaliningrad heute zu<br />
Europa zu zählen, ist lachhaft. Königsberg war das Herz Europas, als Kant hier lebte.<br />
MOSKAU<br />
Riesenrad der Superlative mitten im<br />
Akademiker-Viertel<br />
Mit aller Macht will Moskau zum Touristen-Magnet werden. Geplant ist der<br />
Bau des welthöchsten Riesenrades mit 220 Meter Höhe.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong>
is zur Winter-Olympiade 2014 soll in Moskau das mit 220 Meter Höhe größte Riesenrad<br />
der Welt gebaut werden. Das sei möglich, wenn die Stadt das von der Moskauer Firma<br />
„Group <strong>12</strong>“ vorgestellte Projekt tatkräftig unterstütze, erklärte Firmenvertreter Vitali<br />
Kusnezow gegenüber der Iswestija. Die Pläne für das Mega-Projekt „Moscow View“ gehen<br />
auf einen entsprechenden Beschluss der Stadtverwaltung aus dem Jahre 2002 zurück und<br />
sollen nun realisiert werden, berichtete der Kommersant.<br />
Ein Rad ohne Speichen<br />
Die architektonische Grundidee des Projektes „Moscow View“ sind zwei Kreise, einmal ein<br />
Riesenrad ohne Speichen, sowie ein kreisförmiges Gebäude am Boden, in dem Restaurants,<br />
Läden und eine Standesamt untergebracht sein sollen. Zu dem Ensemble gehört auch eine 320<br />
Meter hohe Spindel. Die 48 Besucher-Kabinen fahren auf der Innenseite des Riesenrades auf<br />
speziellen Verankerungen in die Höhe.<br />
Hoffnung auf Touristen-Ströme<br />
Die Baukosten von 300 Millionen Dollar sollen sich nach den Plänen der Stadtverwaltung<br />
schon bald auszahlen, wenn wie geplant nicht vier sondern sieben Millionen Touristen<br />
jährlich nach Moskau kommen. Dafür will die Stadt ein finanzstarkes Tourismus-Programm<br />
auflegen.<br />
Das Projekt „Moscow View“ wurde von dem in San Franzisco beheimateten Architektenbüro<br />
Gensler entwickelt, welches auch den noch im Bau befindlichen Shanghai Tower (632 Meter)<br />
entworfen hat. Ob das Projekt angenommen wird, soll über eine Ausschreibung entschieden<br />
werden.<br />
Kaum wurde die erste Projekt-Skizze im Internet veröffentlicht gab es allerdings schon<br />
Proteste von Denkmal-Schützern. Denn die Firma „Group <strong>12</strong>“ will das Mega-Riesenrad am<br />
Vernadski-Prospekt bauen. Der Prospekt liegt in einem gutsituierten Wohngebiet, südlich des<br />
Stadtzentrums, nicht weit von der berühmten Lomonossow-Universität. Die Häuser in dem<br />
Wohnbezirk wurden in den 1950er Jahren für Akademiker gebaut und werden heute in der<br />
obersten Preisklasse verkauft.<br />
Streit um Standort<br />
Die Stadtverwaltung hat sich jedoch noch nicht entschieden wo das Riesenrad nun endgültig<br />
stehen, wie von der „Group <strong>12</strong>“ vorgeschlagen, südlich des Stadtzentrums in Uni-Nähe, im<br />
legendären Gorki-Park direkt im Stadtzentrum oder im WWZ-Ausstellungsgelände im<br />
Norden der Stadt.<br />
Vertreter des Moskauer Architekten-Rates, der den Bürgermeister berät, sprachen sich<br />
kategorisch gegen den Bau des Riesenrades am Vernadski-Prospekt aus. Das Riesenrad wäre<br />
eine „Katastrophe“, für den Wohnbezirk, erklärte Präsidiumsmitglied Aleksej Klimenko. Zum<br />
einen würde das Riesenrad das gewachsene Wohngebiet zerstören, zum anderen seien die<br />
Bewohner des Bezirks bei starken Winden einer realen Gefahr ausgesetzt. Überhaupt sei<br />
Moskau nicht geeignet für Mega-Riesenräder, denn im Gegensatz zu New York habe Moskau<br />
zu wenig hohe Gebäude, die man aus der Luft bestaunen könne.
Hier geht’s zur Projektskizze: www.moscowview.ru<br />
WEIßRUSSLAND<br />
Widerstand im Exil<br />
Unterdrückung und Verhaftung von Oppositionellen sind in Weißrussland an<br />
der Tagesordnung. Viele Dissidenten emigrieren deswegen in den Westen. Die<br />
Mitarbeiterin der oppositionellen Website „Charter 97“, Natalia Radzina, ist<br />
über Russland und die Niederlande nach Litauen geflohen, wo sie politisches<br />
Asyl bekommen hat. Von dort kämpft sie für ein freies Belarus.<br />
Von Birgit Johannsmeier<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
ngestört durch die Stadt spazieren, Kaffee trinken, im Netz surfen und in Ruhe einen<br />
Artikel schreiben: Für Natalia Radzina ist das nicht selbstverständlich. Immer wieder hebt die<br />
Belarussin ihren Blick, wenn ein neuer Gast das Lokal betritt. Die junge Frau ist auf der<br />
Flucht vor dem belarussischen Geheimdienst KGB in der litauischen Hauptstadt Vilnius<br />
gestrandet. Zuhause wurde ihr Telefon abgehört, auf der Straße wurde sie verfolgt. „In<br />
Belarus war ich ständig unter Beobachtung. Hier in Litauen bin ich plötzlich ganz frei. Das<br />
ist toll, aber es fällt mir auch sehr schwer, mich daran zu gewöhnen.“<br />
Eine Bleibe hat Natalia Radzina bei anderen Regimegegnern in Vilnius gefunden. Aus dem<br />
Exil wollen die Oppositionellen die Regierung in Belarus bekämpfen. Von hier aus schreibt<br />
sie für das Internetportal „Charter 97“, eine Website von Oppositionellen, die sich 1997<br />
zusammentaten, um gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zu<br />
protestieren und über die Willkür im Heimatland zu berichten. Der KGB habe fünf Mal ihr<br />
Büro gestürmt, sagt Natalia. Computer wurden konfisziert und Druck auf ihre Mitarbeiter<br />
ausgeübt. „Ich habe zwei Teams verloren, weil die Leute Angst hatten, zu arbeiten.“<br />
Am 19. Dezember 2010 hatte Natalia über die Fälschung und die Proteste bei der<br />
Präsidentenwahl berichtet. Daraufhin wurde sie verprügelt und inhaftiert. Viele<br />
Oppositionelle sitzen bis heute im Gefängnis, unter ihnen auch Andrej Sannikow, der als<br />
Präsidentschaftskandidat gegen Alexander Lukaschenko angetreten war.<br />
Über das Internet behält sie Verbindung zur Heimat<br />
Natalia hatte mehr Glück. Nach sechs Wochen im KGB-Untersuchungsgefängnis durfte sie zu<br />
ihren Eltern in die Kleinstadt Kobrin und stand dort unter Hausarrest. Auf dem Weg zum<br />
Verhör nach Minsk konnte sie mit Hilfe ihrer Freunde im Auto nach Moskau fliehen. „Wie<br />
durch ein Wunder“, sagt Natalia, „hat mich der russische Geheimdienst dort nicht auf offener<br />
Straße verhaftet“. Im Laufe von vier Monaten wurde sie in Moskau als Flüchtling anerkannt<br />
und durfte Ende Juli in die litauische Hauptstadt Vilnius ausreisen. Über das Internet steht sie<br />
mit ihren Freunden in Belarus in Kontakt und sammelt neueste Informationen für ihre<br />
Website „Charter 97“.
In Minsk hoffen die Lukaschenko-Gegner auf die Opposition im Ausland. „Wir werden<br />
siegen, wir werden siegen“, rufen wenige hundert Demonstranten im Chor. Anfang Oktober<br />
haben sie sich in Minsk versammelt, um gegen Lukaschenko zu demonstrieren. Kurz darauf<br />
verbietet der Präsident jede Versammlung von mehr als drei Personen. Auf Transparenten<br />
fordern sie die Freilassung inhaftierter Dissidenten und warnen vor einem wirtschaftlichen<br />
Kollaps. „ Der Präsident ist gegen uns“, sagt eine ältere Frau erbost. „Wir wollen einen<br />
Wechsel. Es gibt kluge Politiker, aber sie sind im Gefängnis. Wir hoffen auf Natalia Radzina,<br />
wir lesen ihre Website. Sie ist im Exil und kann uns vielleicht helfen.“<br />
Die Leute in der Provinz wissen nicht, dass es Gegenkräfte<br />
gibt<br />
Auch die 35-jährige Dana liest regelmäßig auf „Charter 97“, wie es um die Oppositionellen in<br />
der Haft steht. Die Journalistin, die ihren eigentlichen Namen nicht nennen will, schreibt für<br />
eine Zeitung in der Provinz. Einen Job hat sie bereits verloren, weil sie die Politik von<br />
Lukaschenko kritisiert hat. Allerdings fühlt sich Dana von niemandem in Belarus vertreten<br />
weder von den Oppositionellen vor Ort noch von den Dissidenten in Litauen. „ In unsere<br />
Kleinstadt hat sich bis heute kein Regimegegner verirrt“, klagt sie. Die Leute in der Provinz<br />
wüssten nicht, dass es Gegenkräfte gebe. „Und die Dissidenten im litauischen Exil müssen<br />
zwar keinen KGB mehr fürchten“, sagt Dana, „aber Macht haben sie keine.“<br />
Genau das will Natalia Radzina ändern. Die litauische Hauptstadt Vilnius liegt nur 20<br />
Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Hier trifft sie sich Tag für Tag mit den<br />
anderen Dissidenten zur Lagebesprechung. Was können die Oppositionellen gegen<br />
Lukaschenko ausrichten? „Brüssel sollte endlich wirtschaftliche Sanktionen einführen“, sagt<br />
Natalia. „Dann fällt der Diktator in Tagen oder Wochen.“ Aber dafür benötigt die Opposition<br />
Unterstützung. Natalia will in der EU und in den USA dafür werben. Ihre lange Reise ist erst<br />
beendet, wenn in ihrer Heimat Belarus Demokratie herrscht.<br />
Lesen Sie dazu auch: „Lukaschenko will, dass alle schweigen“ in EM 06-20<strong>11</strong><br />
Die Autorin ist Korrespondentin von n-ost. Das Netzwerk besteht aus über 50 Journalisten in<br />
ganz Osteuropa und berichtet regelmäßig für deutschsprachige Medien aus erster Hand zu<br />
allen Themenbereichen. Ziel von n-ost ist es, die Wahrnehmung der Länder Mittel- und<br />
Osteuropas in der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen<br />
unter www.n-ost.de.<br />
KOSOVO<br />
Wahrheitsliebe ist Mangelware seit 100<br />
Jahren<br />
Ist Albanien eine Gefahr für den Frieden auf dem Balkan? Im Jahr 20<strong>12</strong><br />
werden die Albaner lautstark den 100. Jahrestag ihrer „Unabhängigkeit“<br />
begehen. Anlass genug, um geschichtliche Hintergründe des „unabhängigen<br />
Kosovo“ und der albanischen Mentalität zu beleuchten.<br />
*
Von Wolf Oschlies<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Als Kosovaren Tito noch im Herzen trugen: Ein junger Albaner präsentiert stolz den<br />
Tito-Schriftzug auf seinem Oberarm.<br />
Foto: Wolf Oschlies.<br />
udiatur et altera pars“, gebot ein Rechtsgrundsatz im alten Rom: Auch der andere Teil<br />
möge gehört werden! Diese Pflicht zu rhetorisch-argumentativer Ausgewogenheit ist<br />
von vielen Völkern übernommen worden, beispielsweise von den mittelalterlichen Deutschen,<br />
denen das eigene Recht befahl: „Eines Mannes Rede ist nur die halbe Rede/ man soll sie billig<br />
hören beede“. Auch wir Heutigen kennen den Grundsatz, sogar in doppelter Version – einmal<br />
als Prinzip auf rechtliches Gehör vor Gericht und zweitens als presserechtlichen Anspruch auf<br />
Abdruck einer Gegendarstellung.<br />
Das „Audiatur et altera pars“ geht zu Recht davon aus, dass die einseitige Rede zumindest<br />
desinformierend ist, im Konfliktfall sogar direkt verfälschend: Wer nur den eigenen<br />
Standpunkt verficht, neigt zu Lügen und Betrug. Das ist per se gefährlich und kann höchste<br />
Brisanz entfalten, wenn z.B. in der Politik notorische Lügner es schaffen, aufgrund von<br />
Lügen, Erfindungen und falschen Beschuldigungen internationale Unterstützung und<br />
Förderung zu fordern und zu erhalten.<br />
Kosovarische Kunstfertigkeit im Umgang mit der<br />
Wahrheit<br />
Ich spreche von den Kosovo-Albanern, bei denen ich seit Jahrzehnten unschlüssig bin, ob ich<br />
mehr über die Primitivität ihrer Lügen staunen soll oder über die Unverschämtheit, mit<br />
welcher sie das Falschgeld ihrer Lügen in bare Münze einwechseln wollen. Und wie die Alten<br />
sungen, so zwitschern die Jungen von der terroristischen Bewegung „Vetëvendosje“<br />
(Selbstbestimmung), wenn sie Gräuelmärchen über serbische Politik verbreiten (Orthographie<br />
nach dem Original): „Diese Politik führte zum Tod von mehr als 14.000 Menschen, zur<br />
Vergewaltigung der mehr als 20.000 Frauen, zum Brennen von mehr als <strong>12</strong>0.000 Häusern,<br />
und zur Vertreibung von ungefähr 1 Mio. Albaner“.
Im ganzen Kosovo gibt es keine <strong>12</strong>0.000 albanische Häuser, geschweige denn so viele<br />
angeblich von Serben abgefackelte. Dort ist auch kein einziger Albaner getötet worden, es sei<br />
denn bei der Abwehr von UCK-Angriffen, keine Albanerin vergewaltigt, es sei denn von<br />
albanischen Menschenhändlern. Erst recht wurden keine Million Albaner vertrieben, nur sind<br />
ca. 400.000 ab Mai 1999 vor NATO-Bomben nach Makedonien geflüchtet, von wo sie nach<br />
wenigen Wochen zurückkehrten, im Schlepptau <strong>12</strong>0.000 „Plünderungstouristen“ aus Nord-<br />
Albanien.<br />
Albanische Untaten sind verbürgt<br />
Die Kosovaren haben Jahrzehnte lang die Volkszählungen boykottiert, die Serbien in seiner<br />
Südprovinz Kosovo unternahm. Als die Kosovaren 20<strong>11</strong> selber eine Volkszählung<br />
ausrichteten, geriet die zum plumpen Fälschungsmanöver, denn es wurden alle albanischen<br />
Verbrechen unterschlagen: 230.000 Nicht-Albaner vertrieben. 700 verschleppt, über 1.000<br />
ermordet, rund 1.000 serbische Kirchen und Klöster zerstört etc.<br />
Albanische Untaten sind verbürgt und wurden von Belgrad der internationalen Öffentlichkeit<br />
präsentiert, aber der Westen glaubte den Serben kein Wort, den Kosovaren aber jede Lüge. So<br />
zählte der österreichische Diplomat Albert Rohan 2008 angebliche Fakten serbischer<br />
„Unterdrückungspolitik“ auf: „Unterdrückung der Kosovaren und schwere<br />
Menschenrechtsverletzungen in den neunziger Jahren; die weder von Belgrad noch von der<br />
Internationalen Gemeinschaft honorierte Politik der friedlichen Mittel der Kosovaren, (...) die<br />
ethnische Säuberungsoperation durch die jugoslawisch-serbischen Sicherheitskräfte und<br />
paramilitärischen Gruppen im Jahre 1998, in deren Verlauf zehntausende Menschen getötet<br />
und mehr als achthunderttausend vertrieben wurden“.<br />
Internationale Kosovo-Politik verbreitet UCK-Lügen<br />
Bereits im Februar 2001 haben die WDR-Journalisten Mathias Angerer und Jo Werth in<br />
ihrem Kosovo-Film „Es begann mit einer Lüge“ detailliert dokumentiert, dass restlos alle<br />
angeblichen serbischen „Menschenrechtsverletzungen“ zynische Inszenierungen der<br />
kosovarischen UCK waren. Aber das half gar nichts, Rohan war stärker.<br />
Rohan ist, wie jeder brave „Habsburger“, ein Serbien-Hasser, für den sich jede Brüsseler<br />
Konzession an Belgrad rundheraus verbietet, „denn die EU kann sich nicht die Sabotage ihrer<br />
Mission im Kosovo auch noch selbst finanzieren“. Ausgerechnet er wurde von der UN<br />
ausersehen, zusammen mit dem Finnen Martti Ahtisaari einen Plan für die Lösung des<br />
Kosovo-Konflikts auszuarbeiten. Dafür wurden beide Ende November 2009 im Kosovo mit<br />
der „Goldenen Medaille der Freiheit“ dekoriert, denn ihr Plan zwang Serbien zum Verzicht<br />
auf 15 Prozent seines Territoriums, woraus die „unabhängige Republik Kosova“ geschneidert<br />
wurde.<br />
Ich bitte um Pardon für meinen Vergleich, aber ein passenderer fällt mir nicht ein. Das<br />
Kosovo ist so „staatlich“ und „unabhängig“ wie das „Protektorat Böhmen und Mähren“,<br />
welches das nationalsozialistische Deutschland im März 1939 erzwang. Dieses „Protektorat“<br />
verschwand so spurenlos, wie hoffentlich auch die „Republik Kosova“ verschwinden wird,<br />
denn erstens sind Verträge völkerrechtlich ungültig, die unter Zwang geschlossen wurden,<br />
und zweitens ist laut Kant jeder „Friede“ ein Unding, der den Keim künftiger Konflikte in<br />
sich trägt. Bis dahin bleibt allerdings alles beim schlimmen Alten: Die Kosovaren bleiben<br />
„Europameister“ in international organisierter Kriminalität – vor allem bei Menschen-,
Drogen- und Waffenhandel -, die USA decken ihre Verbrechen, die NATO beschützt diesen<br />
„Staat“ und die EU bezahlt dieses lebensunfähige Gebilde.<br />
Sind Albaner Nachfahren prähistorischer Urvölker?<br />
Das massive Engagement des Westens für das Kosovo und seine Blindheit für kosovarische<br />
Eigenwilligkeit im Umgang mit der Wahrheit sind neuesten Datums. Albaner selber haben<br />
sich immer so verhalten, was bereits im 19. Jahrhundert Verwunderung erregte über das<br />
Ensemble verfeindeter Bergstämme, die sich untereinander mit wüsten Schimpf- und<br />
Spottnamen belegten und nur von den Europäern allgemein „Albanesen“ - „Arberi, Arnauten,<br />
Arbanassen, Shqiptaren“ etc. - genannt wurden.<br />
Der deutsche Volkstumsforscher Otto von Reinsberg-Düringsfeld (um 1810-1876) hat das<br />
Nichtverhältnis der Albaner untereinander mit zahlreichen Beispielen dokumentiert, während<br />
sich Jakob Grimm und sein slowenischer Briefpartner Jernej Kopitar bereits 1829 weidlich<br />
über die albanische Sucht lustig machten, als Nachfahren prähistorischer Urvölker<br />
aufzutreten. Eine albanisches „Nation“ wurde erstmals 1595 von einem Italiener erwähnt,<br />
aber albanisches Selbstverständnis behauptet bis zur Gegenwart, dass Albaner die „einzigen<br />
authentischen Ureinwohner von ganz Europa“ sind, die „vor mehr als 4.000 Jahren den<br />
Balkan besiedelten und hier eine vor-hellenistische Zivilisation ausbildeten, von der alle<br />
späteren Neuankömmlinge profitierten“.<br />
Vor anderthalb Jahrhunderten waren Albaner bescheidener und solidarischer mit ihren<br />
balkanischen Nachbarn. 1876 entstand beispielsweise in Mailand ein „Italienischarbanasisches<br />
Komitee“, das sich vorgenommen hatte, „die tapferen Brüder in Makedonien,<br />
Epirus und Albanien aufzurufen, den Jugoslawen die Hand gegen den gemeinsamen<br />
Unterdrücker zu reichen“. Einstweilen, so das Komitee weiter, „entbietet es dem großherzigen<br />
Slavenvolk seinen brüderlichen Gruß und seine Anerkennung“. Kurz danach kehrten sie sich<br />
gegen die Slaven, forderten über die 1878 gegründete „Liga von Prizren“ eine ethnische und<br />
politische Vorzugsbehandlung vom osmanischen Sultan, territoriale Autonomie und politische<br />
Selbstverwaltung, und bezeichneten sich „nie anders denn als Türken“, wie 1914 der Serbe<br />
Dimitrije Tucovic erläuterte.<br />
Die Türken haben die Albaner und ihr Treiben damals nicht ernstgenommen, andere auch<br />
nicht, denn Albaner schienen vorzivilisatorische Wesen zu sein. 1927 leitete der deutsche<br />
Geograph Herbert Louis (1900-1985) sein Buch über Albanien mit der Feststellung ein, allein<br />
der Landesname erwecke „Vorstellungen von einem wilden Gebirgslande mit einer rauhen,<br />
kriegerischen Bevölkerung, mit Blutrachesitten und unaufhörlichen inneren Streitigkeiten“.<br />
Für Hermann Wendel (1884-1936), Reichstagsabgeordneter und bester Balkankenner, den<br />
Deutschland und Westeuropa je hatten, waren Albaner „dreiviertelwilde Indianer Europas“,<br />
„von Serbien, Bulgarien und Griechenland um eines vollen Jahrtausends Entwicklungsspanne<br />
getrennt“, und Europa solle sich bloß nicht „für die ‚Freiheit‘ der Albaner erhitzen“.<br />
Im Jahre 20<strong>12</strong> werden die Albaner mit großem Getöse den 100. Jahrestag ihrer<br />
„Unabhängigkeit“ begehen, was gewiss nicht friedfertig ablaufen wird. Wollten die Albaner<br />
damals überhaupt „unabhängig“ werden? Ihr „Staat“ entstand, weil Österreich, Italien und<br />
andere den gerade im ersten Balkankrieg siegreichen Serben den Zugang zur Adria versperren<br />
wollten. Der antiserbische Affekt ist den Albanern gewissermaßen schon in die Wiege der<br />
Staatlichkeit gelegt worden.
Zeitbombe Groß-Albanien<br />
Die Albaner sind, wie die meisten Balkanvölker, über mehrere Länder zerstreut. Während die<br />
Makedonen, von denen etwa die Hälfte nicht in der Republik Makedonien lebt, sich in der<br />
Diaspora ruhig und friedlich verhalten, sorgen die Albaner allenthalben für Unruhe, Unfrieden<br />
und Unrecht. Christopher Dell, in den späten 1990-er Jahren US-Botschafter in Makedonien,<br />
hat damals bereits gewarnt: „Das neue Jahrhundert beginnt für uns mit Sorgen um das Groß-<br />
Albanien“. Seither verging mehr als ein Jahrzehnt, und diese „Sorge“ wurde noch gesteigert .<br />
Zwar sprechen die Albaner nicht mehr von „Groß-Albanien“, wohl aber vom „natürlichen,<br />
integralen, ethnischen“ Albanien, was aber keinen Unterschied macht. Die Bedrohung, die in<br />
dem groß-albanischen Konzept steckt, ist nach wie vor existent und betrifft den ganzen<br />
Balkan. Rexhep Qosja (Jahrgang 1936) gilt im Kosovo als „Intellektueller“, weil er 1974 ein<br />
paar Geschichten von 1974 veröffentlichte, sich generell aber als groß-albanischer Trommler<br />
betätigt. Ihn freut, dass „Albanien nie seine aktuellen Grenzen anerkannt hat, weil diese<br />
ungerecht sind“. „Gerechte“ Grenzen wird erst „Groß-Albanien“ erreichen, die ersten Schritte<br />
zu diesem sind die „Unabhängigkeit Kosovas“ und die „Einheit zwischen Kosova und<br />
Albanien“. So ließ sich Qosja im November 2006 vernehmen, und die immanente Gefahr<br />
seines Groß-Albanientraums, den laut Umfragen von 70 bis 90 Prozent aller Albaner<br />
mitträumen, hat offenkundig kein westlicher Politiker je ermessen können. Man wird es<br />
spätestens dann spüren, wenn ein Groß-Albanien Staaten wie Montenegro und Makedonien<br />
auslöschen und von Serbien und Griechenland große Gebiete abtrennen würde. Und das wäre<br />
erst der Anfang, dem sicher eine pogromartige „ethnische Säuberung“ dieser Regionen<br />
folgte. Der Begriff „ethnische Reinheit“ ist eine albanische Wortprägung, in den frühen 1980-<br />
er Jahren im Umkreis eines kosovarischen Filmfestivals aufgebracht, und von der Praxis der<br />
„ethnischen Säuberung“ gaben die Pogrome gegen Nicht-Albaner in der zweiten Jahreshälfte<br />
1999 und im März 2004 einen grausigen Vorgeschmack.<br />
Albanische Großstaat-Projekte wären nur durch gewaltsame Verletzung staatlicher<br />
Integritäten von Nachbarn zu realisieren, wozu Albaner bereit waren und weiter sind. Noch<br />
am 5. Februar 2009 zog die (in Makedonien erscheinende) albanische Zeitung „Fakti“ eine<br />
historische Linie von 1878 über albanische Unruhen in Jugoslawien (1968, 1981 und 1984)<br />
und den UÇK-Krieg gegen Makedonien (2001) - alle interpretiert als Kampf für „das Recht<br />
der albanischen Nation, ihre verlorenen, usurpierten Territorien einzufordern“, also die von<br />
Albanern bewohnten Regionen Montenegros, Serbiens, Makedoniens und Griechenlands.<br />
Wer soll die „Hausaufgaben“ der Albaner machen?<br />
Normal ist, dass voll entwickelte Nationen einen Staat bilden. Balkanische Eigenheit ist, dass<br />
in ihrer Identität wenig ausgebildete Volksgruppen Staaten einfordern, da sie sich von diesen<br />
ihre nationale Entwicklung und Reife versprechen. Spezifika von Albanern sind schließlich,<br />
dass sie erstens einen „ethnisch reinen Staat“ erstreben, um ihre Tradition der tribalen<br />
Zersplitterung zu überwinden, und dass sie zweitens immer internationale Erfüllungsgehilfen<br />
ihrer ethnostaatlichen Aspirationen zu benennen wussten: 1878 war es der türkische Sultan,<br />
19<strong>12</strong> die Londoner Botschafterkonferenz der europäischen Großmächte, ab 1926 Mussolinis<br />
Italien, ab 1943 Hitlers Deutschland, ab 1991 die damalige EG und seit 1999 NATO und<br />
USA.<br />
Die am 17. Februar 2008 zu Lasten Serbiens proklamierte „Republik Kosova“ ist<br />
völkerrechtlich ein Unding. Sie wurde bis zum <strong>11</strong>. Oktober 20<strong>11</strong> von 85 der insgesamt 193
UN-Mitgliedern anerkannt, darunter nicht einmal alle EU-Staaten. geschweige denn eine<br />
Großmacht wie Russland, die ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist. Russland<br />
verhindert, dass die US-Kolonie Kosovo in die Vereinten Nationen kommt, was einer<br />
verdienten Brandmarkung gleichkommt: Das Kosovo kann nicht einmal Mitglied der<br />
International Telecommunication Union (ITU) werden und muss weiterhin den serbischen<br />
Country Code 381 nutzen, obwohl die internationale Übergangsverwaltung des Kosovo<br />
(UNMIK) bereits 2005 einen eigenen Code forderte. Und das ist symptomatisch: Das Kosovo<br />
wird regional gespalten, politisch zerrissen und ökonomisch verelendet bleiben und eines<br />
nahen Tages an inneren Unruhen eingehen.<br />
„Friedfertige“ Albaner?<br />
Wie bei Albert Rohan zitiert, unterstellen westliche Kosovo-Regisseure den Albanern<br />
„Friedfertigkeit“, den Serben aber „Menschenrechtsverletzung“. Beweis für das eine wie für<br />
das andere hat noch niemand erbracht, denn es gibt sie nicht. Bezeugt ist jedoch hinreichend,<br />
dass Albaner willfährig waren, wenn man sie auf Südslawen hetzte. Am 7. April 1939 hatte<br />
Italien Albanien endgültig annektiert und augenblicklich albanische Terrorbanden<br />
losgeschickt, um „Jugoslawien ein Messer in den Rücken zu stoßen“, wie es Mussolinis<br />
Außenminister Graf Ciano formulierte.<br />
Der deutsch-italienische Überfall auf Jugoslawien am 6. April 1941 und dessen rasche<br />
Kapitulation wurden von den Kosovo-Albanern mit Begeisterung aufgenommen, zumal der<br />
italienische Faschismus aus den annektierten Teilen Serbiens, Montenegros und Makedoniens<br />
ein „Groß-Albanien“ schuf, ausgenommen die nordkosovarischen Gebiete um Mitrovica, die<br />
der deutschen Besatzungszone in Serbien zufielen. Fürs erste waren die Albaner damit<br />
zufrieden, da Hitler und Mussolini ihnen „versprochen“ hatten, dass ihnen alle einstigen<br />
türkischen Regionen auf dem West-Balkan ausgeliefert würden. Zur Beschleunigung<br />
veranstalteten albanische Extremisten am 28. November 1941 gewaltsame Demonstrationen<br />
im makedonischen Skopje, das sie als „albanische Stadt“ einforderten.<br />
Vertreiben, Morden, Brandschatzen waren Alltag in „Groß-Albanien“. Dessen „Premier“<br />
Mustafa Merlika-Kruja (1887-1958) befahl Ende Juni 1942, wie mit Serben zu verfahren sei:<br />
Serbische „Altsiedler“ sollten in KZs in Albanien verschleppt, serbische „Zuwanderer“<br />
ermordet werden, wie es auch hunderttausendfach geschah.<br />
In Wirtschaft, Sozialpolitik, Bildungswesen etc. taten die Albaner im Kosovo praktisch gar<br />
nichts, wie eine Bestandsaufnahme von 1947 beschrieb: „Im Kosovo gab es nur einen<br />
Kilometer asphaltierte Straße, und lediglich neun Mittelschulen, drei Gymnasien und sechs<br />
Berufsschulen. Vom vierjährigen Grundschulunterricht waren nur (...) 36.200 Kinder des<br />
Kosovo erfasst. (...) Im ersten Nachkriegsjahr gab es im Kosovo bloß 21 Ärzte, einen<br />
Zahnarzt und sechs ausgebildete Krankenschwestern. Lokale Krankenhäuser hatten eine<br />
Gesamtkapazität von 390 Betten. 90 Prozent der Menschen lebten von ihrer eigenen<br />
Landwirtschaft, rund 75 Prozent von ihnen waren Analphabeten. In ganz Jugoslawien gab es<br />
nur 15 Studenten aus dem Kosovo. In der gesamten Industrie des Kosovo waren knapp 9.000<br />
Arbeiter beschäftigt“.<br />
Dieses albanische Armutszeugnis nachträglich zu beschönigen, ist eine Hauptaufgabe<br />
kosovarischer Geschichtsklitterer. Eines ihrer Lieblingsmärchen fabuliert vom albanischen<br />
„Widerstand“ gegen Italiener und Deutsche und entsprechende Artikel beginnen zumeist so:<br />
„Bekanntlich kämpften rund 50.000 albanische Partisanen aus Kosova gegen den<br />
Hitlerfaschismus...“
Tja - bekanntlich gab es aber im Kosovo kaum Widerstand oder Partisanen, hat der Belgrader<br />
Historiker Dimitrija Bogdanovic (1930-1986) in seinem „Buch über das Kosovo“<br />
nachgewiesen. Erst 1944 formierten sich ein paar „größere“ Partisanengruppen,<br />
die mehrheitlich von Serben oder Montenegrinern gebildet waren. Ali Shukrija (1919-2005),<br />
in den 1960-er Jahren Premier des Kosovo, wusste schon im November 1941, warum die<br />
Albaner unfähig und unwillig zu jeglichem Widerstand waren: Der war ausschließlich eine<br />
Sache von Titos Partisanen und Mihajlovics „Cetniks“, „für die arnautischen Massen bleiben<br />
Serben Serben, also Feinde der Arnauten“, die ihr Leben im „befreiten Kosovo“ bedrohten.<br />
Der Mythos von Bujan<br />
Zu den Legenden der Kosovaren gehört die „Konferenz von Bujan“, die an der Jahreswende<br />
1943/44 stattgefunden und beschlossen haben soll: „Wenn das albanische Volk in Kosova<br />
sich am antifaschistischen Widerstandskampf beteiligt, wird es das Recht erhalten, sich nach<br />
dem Sieg mit seiner Mutter Albanien zu vereinigen“. Rührend, aber Unsinn! Damals fand in<br />
dem nordalbanischen Dorf Bujan eine „Konferenz“ über das Kosovo statt, an der 49<br />
Delegierte teilnahmen, die wenigsten aus dem Kosovo und nur sieben kosovarische Serben<br />
oder Montenegriner. Die „Konferenz“ war schon mit Blick auf die regionale und/oder<br />
ethnische Repräsentativität ein Unding. Es war eine Tagung albanischer Chauvinisten, die<br />
ihre Resolutionen wortwörtlich von Stalins Komintern abschrieben. Ein Anschluss des<br />
Kosovo an Albanien wurde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben: „Das Kosovo ist<br />
größtenteils von Albanern besiedelt, die seit jeher und auch heute eine Vereinigung mit<br />
Albanien fordern. Aber der einzige Weg, dass sich Kosovaren mit Albanien vereinigen, ist der<br />
gemeinsame Kampf mit den anderen Völkern Jugoslawiens gegen den Okkupator und seine<br />
Helfershelfer. Nur so erringen wir die Freiheit und zusammen mit anderen Völkern die<br />
Möglichkeit auf Selbstbestimmung und Abtrennung“.<br />
Das war ein Affront gegen Titos Partisanen, die im November 1943 im bosnischen Jajce die<br />
Grundsätze einer künftigen jugoslawischen Föderation festgelegt hatten. Dass die albanischen<br />
Genossen sofort mit „Abtrennung“ liebäugelten, empfanden sie selber als „Fehler“, für den<br />
sie sich ausdrücklich entschuldigten. Tito, der damals noch eine „Föderation der balkanischen<br />
Völker“ als sicherste Zukunftsoption sah, ließ es gut sein: „Selbstbestimmung der Völker“<br />
solle man jetzt nicht diskutieren, da dieses Thema von den Chauvinisten totgeritten würde.<br />
Nach Kriegsende und unter Abstimmung mit der Anti-Hitler-Koalition könne man das Thema<br />
angehen.
Zwei neugierige Serben am Wagenfenster fragen den Autor bei einer Reise ins<br />
Kosovo nach dem Woher und Wohin.<br />
Foto: Wolf Oschlies.<br />
Titos Kosovo-Politik<br />
Die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo am 17. Februar 2008 hat einen (vorläufigen)<br />
Schlusspunkt hinter die „jugoslawische“ Vergangenheit des Kosovo gesetzt. Laut jüngeren<br />
Umfragen breitet sich aber gerade jetzt im Kosovo eine ausgesprochene Tito-Nostalgie aus,<br />
da die Kosovaren unter Tito alles hatten, was ihnen seit 1999 abgeht: Jobs, Sozialhilfen,<br />
Reisepässe, anerkannte Diplome und Zeugnisse etc. Diese Nostalgie ist verständlich, wiewohl<br />
irreführend. Titos staatsbildendes Konzept, im November 1943 verkündet, war von<br />
mechanistischer Simplizität: Ein Volk – eine Republik (für Slowenen, Kroaten, Bosnier,<br />
Montenegriner, Serben und Makedonen); eine Minderheit – eine Autonome Provinz (Ungarn<br />
in der Vojvodina, Albaner im Kosovo). Aus dieser Überhöhung von Ethnizität und ethnischen<br />
Gruppenrechten – unter Negierung von Demokratie und individuellen Menschenrechten –<br />
resultierten alle intra-jugoslawischen Konflikte bis hin zum Bürgerkrieg der 1990-er Jahre.<br />
In Jajce war im November 1943 noch keine Rede von Autonomie-Regelungen gewesen.<br />
Sechs Länder – Slowenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro und<br />
Makedonien – würden eine Föderation bilden und basta! Es bestand sogar die Neigung, mit<br />
Albanern und Ungarn so zu verfahren, wie Polen und die Tschechoslowakei mit Deutschen<br />
verfahren waren: Illoyale Verräter haben keine Nachsicht von ihren ehemaligen Opfern und<br />
jetzigen Siegern zu erwarten. Aber das war natürlich nicht durchzusetzen, wenn in<br />
Jugoslawien, Albanien und Ungarn (nominell) ideologische und politische Eintracht unter<br />
„Genossen“ und kollektiver Gehorsam vor Moskau herrschten.<br />
Jugoslawien ist den Kosovo-Albanern bis zur Selbstaufgabe entgegengekommen.<br />
Beispielsweise wurde 1945 und danach das Gesetz über die Agrarreform, d.h. über<br />
Enteignungen, mehrfach geändert und verschleppt, weil die Kosovo-Albaner behaupteten, sie<br />
würden gegenüber den Serben und Montenegrinern „benachteiligt“. Die Spannungen<br />
eskalierten derart, dass das jugoslawische Innenministerium die Rückkehr serbischer und<br />
montenegrinischer Vertriebener ins Kosovo verbot. Die gestrigen Vertriebenen mussten<br />
draußen bleiben, weil ihre albanischen Vertreiber die serbischen Kriegssieger manipulierten!
Jugoslawien hat das Kosovo binnen weniger Jahre zivilisiert, industrialisiert, sein<br />
Bruttoinlandsprodukt gesteigert, in der Region, wo vor Kriegsbeginn über 80 Prozent der<br />
Albaner Analphabeten waren, bis 1952 rund 350 Schulen aller Stufen und Fachrichtungen<br />
gebaut. Geholfen hat das nur wenig: 1952 war Slowenien - in Größe und Einwohnerzahl dem<br />
Kosovo vergleichbar, dabei längst nicht so rohstoffreich wie dieses – viermal „reicher“ als das<br />
Kosovo, 1981 fünfeinhalbmal, 1984 über sechsmal. Die Ursache dieses zunehmenden<br />
Entwicklungsrückstands war vor allem die immense Natalität der Kosovaren – 42,1Promille,<br />
fast das Doppelte von ganz Jugoslawien -, obwohl diese durch eine unvorstellbar hohe<br />
Säuglingssterblichkeit (<strong>12</strong>5,9 Fälle pro 1.000 Geburten) noch „künstlich“ gemindert wurde.<br />
Kosovo und Jugoslawiens „brüderliche Eintracht“<br />
Jugoslawien war viel zu lange bereit, den Kosovaren ein „schweres Erbe der Rückständigkeit“<br />
nachzusehen, ohne zu bemerken, dass die Rückständigkeit vor allem ein Resultat albanischer<br />
Reformunwilligkeit und Reformunfähigkeit war. Von Jugoslawien wurden bereits wenige<br />
Jahre nach Kriegsende gewaltige Entwicklungsmittels ins Kosovo und andere Gebiete<br />
gelenkt, 1957 folgte das „System garantierter Investitionen“, 1965 entstand der „Bundesfonds<br />
für Kredite an unterentwickelte Regionen“ und ähnliche Maßnahmen mehr, bei denen das<br />
Kosovo stets mindestens 33 Prozent der Leistungen bekam. Im März 2007 fand in Belgrad<br />
eine Expertentagung statt, bei welcher Dokumente vorlagen, nach denen Serbien „Hunderte<br />
Milliarden Dollar für die Entwicklung des Kosovo“ aufgewendet habe, Dutzende Milliarden<br />
Dollar hat die internationale Gemeinschaft seit 1999 ins Kosovo gepumpt, und alle diese<br />
jahrzehntelangen Riesenleistungen hatten so gut wie keinen Effekt.<br />
Bereits 1984 kamen auf jeweils zehn berufstätige Albanerinnen sieben berufstätige Serbinnen,<br />
obwohl es im Kosovo siebenmal mehr Albanerinnen als Serbinnen in der Gesamtbevölkerung<br />
gab. Hinzu kam die unterschiedliche Mobilität beider Volksgruppen: 55,8Prozent der Serben,<br />
aber 68,2Prozent der Albaner lebten in ihrem Geburtsort. In den 1980-er Jahren war das<br />
Kosovo extrem dicht besiedelt ist (30Prozent mehr als Jugoslawien, 28Prozent mehr als<br />
Serbien), war seine Einwohnerschaft überwiegend agrarisch (die in den Jahren 1953 - 1981<br />
um 55Prozent zunahm, während sie im selben Zeitraum in Jugoslawien um zehn Prozent<br />
zurückging), herrschte eine enorme Arbeitslosigkeit (die 1983 bereits 43,4Prozent betrug;<br />
1980 waren von jeweils 100 Jugoslawen 25,9 beschäftigt, von 100 Kosovo-Einwohnern aber<br />
nur <strong>11</strong>,1).<br />
Das schwerste Problem war, wie bereits erwähnt, die immense Natalität der Kosovo-Albaner,<br />
die seit Jahrzehnten verdächtigt wurden, die „Demographie als Waffe“ einzusetzen.<br />
Symptomatisch war für die Kosovaren auch ihr extrem hoher Grad an Analphabetentum. 1961<br />
machte er 41,1 Prozent aus, aber 1969 schenkte Belgrad den Kosovaren die Universität<br />
Prishtina. 1971 lag die Analphabetenrate immer noch bei 32,2 Prozent, aber das Kosovo<br />
bekam 1978 eine eigene „Akademie der Wissenschaften und Künste“ (ANUK).<br />
„Tod den serbischen Unterdrückern!“<br />
Das Nebeneinander von Bevölkerungsdichte und Unterentwicklung, potenziert durch<br />
Traditionalismus und Reformfeindschaft, musste Friktionen hervorbringen, sichtbar an den<br />
bürgerkriegsartigen „Demonstrationen“ von 1968, 1981 etc. Man forderte in unverhüllter<br />
Aggressivität Dinge, die man im Grunde längst hatte – etwa „Kosovo Republik“, die das
Kosovo seit der unglücklichen Tito-Verfassung von 1974 faktisch war, oder Verbesserungen<br />
im Bildungswesen, was lachhafter Unsinn war.<br />
Die Demonstrationen waren erste Manifestationen einer „Los von Serbien“-Mentalität, die der<br />
einzige Konsens in der heillos zerstrittenen kosovarischen Politkaste war. Das Kosovo wurde<br />
zum Kampflatz mediokrer und dogmatischer Eliten, wobei die herkömmliche ethnische<br />
Dominanz und Distanz auf den Kopf gestellt wurde. Die Albaner, begünstigt durch die neue<br />
Verfassung und die ab 1987 einsetzende Agonie von Titos „Bund der Kommunisten“ (SKJ),<br />
übernahmen alle relevanten Posten im Kosovo und nutzten sie zur Drangsalierung der Serben<br />
und der anderen elf nicht-albanischen Minderheiten. Das konnten sie straffrei tun, nachdem<br />
die jugoslawische Praxis früherer Jahre endete, Kosovaren als „konterrevolutionäre<br />
Irredentisten“ zu verdächtigen und bei jedem denkbaren Anlass exemplarisch hart zu<br />
bestrafen.<br />
Serbien hat das Kosovo ab 1974 aufgegeben<br />
Serbiens Grundfehler war, dass es mit den Kosovaren entweder zu milde oder zu hart umging,<br />
aber keine rationale Linie besaß und reale Gefahren nicht sehen wollte. Am 29./30. Mai 1968<br />
hielt das Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten Serbiens (SKS) sein 14. Plenum ab,<br />
auf welchem der berühmte Schriftsteller Dobrica Cosic darauf hinwies, dass „im Kosovo eine<br />
gefährliche Eskalation von albanischem Nationalismus, Antiserbentum und<br />
Antijugoslawismus“ passiert – er wurde heftig als „Nationalist“ kritisiert und aus dem ZK<br />
geworfen.<br />
Ein paar Monate später kam es am serbischen Nationalfeiertag, dem 27. November, in<br />
Prishtina und weiteren kosovarischen Städten zu den erwähnten gewalttätigen<br />
Demonstrationen, bei denen man auf Transparenten ablesen konnte, dass Cosic vollauf Recht<br />
gehabt hatte: „Tod den serbischen Unterdrückern“, „Es lebe die Befreiungsbewegung des<br />
Kosovo“. „Wir sind Albaner, keine Jugoslawen“, „Es lebe die Brüderlichkeit des albanischen<br />
Volks“ etc.<br />
Serbien hat das Kosovo 1974 politisch aufgegeben, in den 1980-er Jahren auch ökonomisch,<br />
in den 1990-ern auch demographisch: Serben flüchteten aus dem Kosovo, serbische<br />
Flüchtlinge aus Kroatien wurden nicht mehr im serbischen Kosovo untergebracht. Bis dahin<br />
wäre jede Option denkbar und möglich gewesen, von einer neuen „Regionalisierung“<br />
Serbiens bis hin zum „Kosovo als Republik minus“ in der jugoslawischen Föderation (ohne<br />
das Recht zum Austritt aus dieser). Realiter war gar nichts mehr möglich, da sich auf beiden<br />
Seiten unendlicher Hass aufstaute, der durch spektakuläre Vorkommnisse noch anstieg. Am 3.<br />
September 1987 hat der albanische Soldat Aziz Kelmendi in der Kaserne von Paračin, einer<br />
Kleinstadt 150 Kilometer südlich Belgrads, vier slavische Soldaten erschossen und sechs<br />
weitere verwundet. Das war kein Einzelfall, und die Armee sprach offen von Hunderten<br />
terroristischen „Zellen“ unter albanischen Soldaten.<br />
Die Albaner drehten den Spieß um, tauchten Ende der 1980-er Jahre zu Hunderten in<br />
Deutschland auf, verlangten Asyl mit der Begründung, sie würden einberufen und in der<br />
Armee „ermordet“. Damals wurde ich um ein Gutachten gebeten, welches ich in Kenntnis<br />
Armee-interner Unfalllisten in dem Sinne anfertigte, dass es in der JNA so gut wie nie<br />
Todesfälle bei Albanern gegeben hatte. Mit meinem Gutachten hörte der Asyl-Spuk dann<br />
auch bald auf.
In jenen bewegten Zeiten erinnerte sich Serbien wieder an den Historiker Vasa Ćubrilović<br />
(1897-1990), der 1937 und 1944, d.h. im jugoslawischen Königreich und bei Titos Partisanen,<br />
in zwei umfangreichen Memoranden die Vertreibung aller Albaner aus Jugoslawien gefordert<br />
hatte. Das war natürlich nicht möglich, aber als Vorstellung erschien es vielen sehr<br />
wünschenswert.<br />
Boykottierte Volkszählungen<br />
Wenigstens ein „albanisches“ Problem gab es im Kosovo nicht, dafür umso nachhaltiger im<br />
benachbarten Makedonien. Die dort lebenden Albaner behaupteten, sie stellten, 40, 48, 60<br />
Prozent der Bevölkerung, boykottierten Volkszählungen, stellten aber Maximalforderungen<br />
auf und beklagten „Diskriminierung“, wenn diesen (natürlich) nicht genügt wurde. Als die<br />
Kosovo-Albaner die Volkszählung von 1991 boykottierten, ernten sie nur Hohngelächter –<br />
samt der Vermutung, dass ohnehin alle früheren Angaben zur numerischen Stärke des<br />
albanischen Ethnikums falsch waren.<br />
Eine harte Kritik der Verfassung von 1974 („Serbien wurde faktisch dreigeteilt“) und der<br />
Zustände im Kosovo nach 1981 („dem serbischen Volk wurde der totale Krieg erklärt“)<br />
enthielt das „Akademie-Memorandum“ von 1986, das angeblich die erste Kriegsfanfare und<br />
die Magna Charta eines „Groß-Serbiens“ war. Ein solches Memorandum hat es nie gegeben.<br />
Es gab nur den Entwurf eines Diskussionspapiers von zwölf Mitgliedern der Serbischen<br />
Akademie der Wissenschaften und Künste (SANU), das ob seiner harschen Kritik an den<br />
politischen und ethnischen Zuständen im posttitoistischen Jugoslawien entsetzt abgelehnt, in<br />
westeuropäischen Medien aber begeistert gelobt und zitiert wurde. Erst später und<br />
fortwirkend bis heute setzte das Gerede um das „berüchtigte groß-serbische<br />
Akademiememorandum“ ein, das Unsinn war.<br />
Umgekehrt nahm kaum jemand die „Memoranden“ und „Plattformen“ wahr, in denen<br />
albanische „Intellektuelle“ 1996, 1998, 2004 usw. in Kooperation zwischen Prishtina und<br />
Tirana ein ethnisch reines Groß-Albanien forderten.<br />
Slavenfeindschaft und Serbenhass<br />
Es ist mittlerweile vergessen, dass Restriktionen im Kosovo in den 1980-er Jahren, etwa die<br />
Verhängung des Ausnahmezustands am 27. Februar 1989, von der jugoslawischen Führung<br />
verhängt wurden, und dass Serbien vollste jugoslawische Unterstützung hatte, als es am 28.<br />
März 1989 dem Kosovo die politische Autonomie wegnahm. Dieser Akt hatte ein Fünkchen<br />
von Legitimität, da Belgrad kosovarische Schulbücher geprüft und diese als Pamphlete voller<br />
Slavenfeindschaft und Serbenhass entdeckt hatte.<br />
Die nachfolgenden Reaktionen waren beiderseits ein Austausch von Überreaktionen, gipfelnd<br />
in dem von Rugova verkündeten Totalboykott aller „serbischen“ Institutionen – Schulen,<br />
Universität, Krankenhäuser etc. – und die Einrichtung von „Parallelstrukturen“ im<br />
Untergrund. In jugoslawischen Zeiten gab es im Kosovo 400.000 Schüler und mit 197<br />
Studenten pro 10.000 Einwohner die höchste Rate Jugoslawiens. Von Rugovas<br />
„Parallelstrukturen“ wurden bestenfalls 100.000 Kinder und Jugendliche erfasst, was<br />
internationale Mutmaßungen zu einem exorbitant hohen Analphabetismus im gegenwärtigen<br />
Kosovo erklären könnte.
1993 bis 1996 mühten sich Rugova und Milošević, mit Unterstützung des Vatikans sogar<br />
erfolgreich, um einen Vertrag zur Wiedereröffnung der Schulen, scheiterten damit aber an den<br />
Radikalen beider Lager. Damals war das Kosovo längst unter die Fuchtel der UÇK geraten,<br />
einer von der internationalen albanischen Drogenmafia finanzierten Terrortruppe, und in<br />
dieser Lage befindet es sich noch.<br />
Der jugoslawische Politiker Edvard Kardelj (1910-1979) erzählte in seinen Memoiren, er<br />
habe 1947 bei der Pariser Friedenskonferenz den griechischen Premier Konstantin Tsaldaris<br />
getroffen, der ihn vor Albanern warnte: „Ich sage Ihnen: Auch wenn sie derzeit Eure Freunde<br />
sind – Albaner haben in der Geschichte noch jeden verraten, sie werden auch Euch verraten“.<br />
RUMÄNIEN<br />
Nokia wandert ab<br />
Drei Jahre nachdem Nokia seine Produktion aus Bochum nach Rumänien<br />
verlagerte, zieht der Konzern schon wieder weiter – dieses Mal nach Asien.<br />
Jetzt trifft es die rund 2.200 rumänischen Arbeiter im siebenbürgischen Jucu.<br />
Bis zum Jahresende dürfen sie noch im Unternehmen arbeiten. Doch anders<br />
als die Bochumer damals halten die Rumänen ihren Unmut zurück.<br />
Von Annett Müller<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Nokia Werk in der Nähe von Cluj (Klausenburg) vor der Schließung, 20<strong>11</strong>.<br />
Foto: Dagmar Gester / n-ost<br />
ogdan Colceriu lebt in einer Ein-Raum-Wohnung. Gleich neben seinem Bett steht die<br />
Herdplatte für warme Mahlzeiten. Ein großzügiges Leben kennt der junge Mann nicht,<br />
auch ein Auto kann er sich nicht leisten. Wenn er zur Arbeit fährt, wird er in der<br />
siebenbürgischen Stadt Cluj (Klausenburg) vom firmeneigenen Nokia-Bus aufgesammelt. Für<br />
den Hin- und Rückweg braucht er knapp zwei Stunden, hinzu kommt eine zwölfstündige<br />
Arbeitsschicht. Seit knapp drei Jahren verdient der 25-Jährige auf diese Weise sein Geld: rund
200 Euro netto monatlich. „Wir hatten uns ursprünglich das Doppelte erhofft, weil Nokia ein<br />
Weltkonzern ist“, sagt Colceriu, „aber immerhin kam das Gehalt regelmäßig“.<br />
Wir sind gewohnt, Enttäuschungen einfach zu schlucken<br />
Ende Dezember ist es damit vorbei, dann will der finnische Handyhersteller einen Teil seiner<br />
Produktion weiter nach Asien verlagern. Wie „ein Schock“ traf Ende September die rund<br />
2.200 rumänischen Beschäftigten die Entscheidung, „doch wird kaum jemanden darüber<br />
öffentlich darüber klagen, weil wir gewohnt sind, Enttäuschungen einfach zu schlucken“, sagt<br />
Colceriu.<br />
Erst vor rund drei Jahren hatte der finnische Konzern seine Produktion von Bochum in die<br />
rumänische Gemeinde Jucu verlagert. Auf einer Ackerfläche entstand für 60 Millionen Euro<br />
die neue Niederlassung. Für Nokia-Gewerkschaftschef Cristian Copil war bei dieser<br />
Investitionssumme klar, „dass der Konzern mindestens ein Jahrzehnt bleiben wird“. Doch<br />
kam es anders als gedacht. Der 35-jährige Gewerkschaftsführer steht jetzt wie viele andere<br />
Beschäftigte vor denselben Dilemma: Die Produktionsverlagerung hatte für<br />
Goldgräberstimmung gesorgt. Viele nahmen Kredite auf, um sich eine Wohnung zu kaufen<br />
oder ein Auto. Nun geht Nokia, die Privatschulden bleiben.<br />
Als es noch aufwärtsging: Nokia-Wegweiser an der Baustelle der Handyfabrik von<br />
Cluj (Klausenburg), 2008.<br />
Foto: Lorand Vakarcs / n-ost<br />
Die Firma von Weltruf wirkte auf Arbeiter wie ein Magnet<br />
Existenzangst - das Gefühl kennen die früheren Nokia-Beschäftigten aus Bochum nur zu gut.<br />
Den Weggang hatten die deutschen Angestellten mit monatelangen Protesten begleitet. In<br />
Jucu herrscht hingegen Betriebsamkeit, als stünde kein Ende bevor. Wie eine fleißige<br />
Ameisenschar strömt das rumänische Nokia-Team ins graue Werksgebäude - im Vier-<br />
Schicht-System. Viele hatten die Ansiedlung des Konzerns einst als ausgleichende<br />
Gerechtigkeit interpretiert, dass sie nun endlich für einen Weltmarktführer produzieren<br />
dürfen. „Nokia hat die Arbeitskräfte wie ein Magnet angesaugt“, sagt Ludger Thol vom
Vorstand der deutsch-rumänischen Außenhandelskammer, „für die Leute zählte mehr, für<br />
eine Firma mit Weltruf zu arbeiten und als das Gehalt, das sie dabei verdienten“.<br />
Umso bitterer ist für die Angestellten die Nokia-Entscheidung, die ihnen zeigt, dass auch sie<br />
nur austauschbar sind. Bei Frust sollten sie mit der Presse sprechen, empfahl ihnen die<br />
Unternehmensleitung bei der Bekanntgabe der Hiobsbotschaft. Interna zu erzählen, sei aber<br />
verboten, schränkte der Konzern zugleich ein. Um nichts falsch zu machen, schweigen die<br />
meisten lieber. „Nokia hat erst die Bochumer verhöhnt und jetzt sind wir an der Reihe“, sagt<br />
ein Zeitarbeiter, der mit Bogdan Colceriu auf den Schichtbus wartet. Seine Meinung will der<br />
52-Jährige sagen, nicht aber seinen Namen. Protestieren wie einst die deutschen<br />
Beschäftigten? Der Mann schüttelt entschieden den Kopf: „Womöglich werden wir beim<br />
Protest gesehen und erhalten noch vor Jahresende die Entlassungspapiere von Noika?“<br />
Im Tarifvertrag war von Abfindungen keine Rede<br />
Als Trostpflaster bleibt den Beschäftigten lediglich, dass Nokia bis Ende März weiterhin<br />
Gehälter zahlt, auch wenn das Werk dann schon geschlossen ist. Zudem erhalten die<br />
Beschäftigten als Abfindung mindestens drei monatliche Bruttogehälter, hinzugerechnet<br />
werden Arbeitsjahre. Bogdan Colceriu kommt für seine dreijährige Nokia-Zeit damit auf eine<br />
Abfindung von rund 2.600 Euro. „Wenig“, findet junge Mann, doch muss er sagen<br />
„immerhin“. Im Tarifvertrag war von Abfindungen keine Rede, da der Gewerkschaft eine<br />
Abwanderung des Konzerns gar nicht erst in den Sinn gekommen war. Eine<br />
Arbeitnehmervertretung, „die versagt hat“, findet Colceriu. Gewerkschaftschef Copil gibt sich<br />
hingegen pragmatisch: Statt zum Klagen spornt er zu mehr Arbeit an, „denn wer jetzt noch<br />
einmal seine Leistung steigert, könnte sich durch Prämien weitere Zusatzhonorare bis<br />
Jahresende erarbeiten.“<br />
Ums Geld geht es derzeit auch den Kreisrat von Cluj. Der hatte den Handyhersteller einst mit<br />
dem Versprechen geködert, in der Region einen großzügigen Industriepark anzulegen, dort<br />
wo einst schlammige Ackerflächen waren. Strom- und Wasserleitungen wurden gebaut, die<br />
Zugangsstraßen asphaltiert. Insgesamt investierte der Staat rund 24 Millionen Euro in die<br />
Infrastruktur. Ob Nokia jedoch Versprechen für die Millionen-Subventionen gegeben hat,<br />
bleibt vorerst ein Rätsel, denn der Vertrag ist unter Verschluss, bis Nokia das Werk schließt.<br />
Dass sich der Handyhersteller in Rumänien aber auf Auflagen eingelassen hat, kann sich<br />
Valentin Cuibus von der sozialdemokratischen Opposition im Kreisrat nicht vorstellen, „dazu<br />
sei der Konzern viel zu mächtig gewesen“.<br />
Bogdan Colceriu diskutiert mit den Kollegen, während sie auf den Schichtbus warten, ob sie<br />
nicht doch lieber streiken sollten. „Unsinn“, winken die ab, „gegen die globale<br />
Wirtschaftskrise, die Nokia erfasst hat, kommen auch wir nicht an“. Colceriu will wieder als<br />
Installateur jobben, wie schon vor der Ansiedlung von Nokia. Der junge Mann fingert an<br />
seinem Handy. Ein Nokia-Modell, „Made in Romania“. Er hat vor Jahren im Fernsehen<br />
gesehen, wie in Deutschland Nokia-Handys aus Frust über den Weggang des Konzerns<br />
zerstört worden sind. Colceriu schmunzelt über die Frage, ob er das jetzt auch tun will?<br />
„Meines muss noch eine Weile halten“, antwortet er. Das Telefon hat ihn schließlich fast die<br />
Hälfte seines Monatslohnes gekostet.<br />
Die Autorin ist Korrespondentin von n-ost. Das Netzwerk besteht aus über 50 Journalisten in<br />
ganz Osteuropa und berichtet regelmäßig für deutschsprachige Medien aus erster Hand zu<br />
*
allen Themenbereichen. Ziel von n-ost ist es, die Wahrnehmung der Länder Mittel- und<br />
Osteuropas in der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen<br />
unter www.n-ost.de.<br />
FUSSBALL<br />
Polnisch-ukrainischer Streit um ein<br />
Eröffnungsspiel<br />
Im nächsten Jahr sind Polen und die Ukraine EM-Austragungsland. Und in<br />
welchem der beiden Länder fand das historisch erste Fußballspiel statt? Das<br />
will man jetzt wissen. Unbestritten ist nur eins: 1894 fand im Stryjski-Park in<br />
Lemberg (damals Österreich-Ungarn, heute Lviv, Ukraine) ein Fußballspiel<br />
gegen eine Auswahl aus Krakau statt. Doch wer sich dieses „Eröffnungsspiel“<br />
zwischen beiden Ländern auf seine Fahnen schreiben darf, ist in dem<br />
aktuellen EM-Austragungsort weniger als ein Jahr vor dem Turnier<br />
umstritten: war es das erste polnische Fußballspiel? Oder das erste<br />
ukrainische? Der bizarre Geschichtsstreit führt ein in die komplizierte<br />
Geschichte einer Stadt, die im Laufe des 20. Jahrhunderts fünf verschiedenen<br />
Herrschaftsgebieten angehörte.<br />
Von Martin Brand und Robert Kalimullin<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
Denkmal im Stryjski-Park von Lemberg (heute Lviv) für das hier 1894 ausgetragene<br />
Fußballspiel.<br />
Foto: Martin Brand<br />
anze sechs Minuten dauerte das erste polnische Fußballspiel vor über einhundert Jahren.<br />
So steht es in den Geschichtsbüchern. In der Ukraine indes sieht man das völlig anders<br />
und beansprucht das Match für die eigene Sportgeschichte. Die Folge ist ein bizarrer Streit
zwischen den beiden Gastgeberländern der Fußball-Europameisterschaft 20<strong>12</strong> – die mit dem<br />
sportlichen Großereignis eigentlich „Gemeinsam Geschichte schreiben“ wollten.<br />
Ein Blick zurück ins Jahr 1894: An einem warmen Samstagnachmittag treten im galizischen<br />
Lemberg zwei Mannschaften zum Fußballspielen an. Vor gut zehntausend Zuschauern eines<br />
Turnfestes beginnt am 14. Juli im Stryjski-Park um 17.00 Uhr das erste offizielle Fußballspiel<br />
der Stadt. Zu Gast sind junge Sportsfreunde aus Krakau. Teilnehmer berichten von einem<br />
chaotischen Spiel. Weder Zuschauer noch Spieler kennen sich recht mit den Regeln aus. Die<br />
Spieler wissen nur eins: der Ball muss irgendwie zwischen den Fahnenstangen des Gegners<br />
untergebracht werden. Es geht wild hin und her beim Kampf um den Ball, doch nach sechs<br />
Minuten erzielt Włodzimierz Chomicki – aus abseitsverdächtiger Position – das 1:0 für die<br />
Gastgeber. Trotz des Protests des Schiedsrichters und der Krakauer Mannschaft wird die erste<br />
Fußballpartie der Stadt nach dem Tor jedoch beendet und Platz gemacht für die nächsten<br />
Sportler – Gymnasten, die dem Publikum ihre Gruppenübungen demonstrieren.<br />
Ein Denkmal des ukrainischen Fußballs?<br />
Heute erinnert im Lemberger Stryjski-Park ein Denkmal an das historische Match. Ein Falke,<br />
Symbol der slawischen Sportbewegungen Ende des 19. Jahrhunderts, thront dort auf einem<br />
Fußball. Darunter die Inschrift: „Lviv – Heimat des ukrainischen Fußballs“. Lviv,<br />
Austragungsort der Euro 20<strong>12</strong>, zu Deutsch Lemberg, heißt auf Polnisch Lwów. Und da die<br />
heute ukrainische Stadt im vorvergangenen Jahrhundert mehrheitlich von Polen bewohnt war,<br />
betrachten diese jenes Spiel eben als Beginn der polnischen Fußballgeschichte.<br />
So schreibt denn auch der Warschauer Sportjournalist Stefan Szczepłek, das Fußballspiel von<br />
1894 habe auf polnischem Boden stattgefunden. Und sein Lemberger Kollege Oleksander<br />
Pauk stimmt ihm zu: „Es war ein polnisches Fußballspiel!“. Mitglieder der Sokol-Bewegung<br />
aus Lemberg und Krakau haben die Partie bestritten. Und diese Sokol-Bewegung – Sokół ist<br />
das polnische Wort für Falke – war eine populäre Turnvereinigung, die neben der<br />
körperlichen Ertüchtigung vor allem das polnische Nationalbewusstsein pflegte. „Vom<br />
Beginn des ukrainischen Fußballs am 14. Juli 1894 kann man deshalb gewiss nicht sprechen.<br />
Bestenfalls war es das erste Lemberger Fußballspiel“, erläutert Pauk.<br />
Von einem polnischen Spiel aber will Yaroslav Hryso nichts wissen. „Es konnte gar kein<br />
polnisches Spiel sein, denn zu dieser Zeit existierte Polen überhaupt nicht“, sagt der Präsident<br />
des Ukrainischen Fußballverbands in Lemberg. Die Ukraine gab es zwar auch nicht. „Aber<br />
die Stadt war und ist ethnisch ukrainisches Gebiet, und deshalb war die Begegnung im<br />
Stryjski-Park das erste ukrainische Fußballspiel“, meint Hryso. Dieses Verdikt entspricht der<br />
offiziellen Sichtweise in der Ukraine: Das Spiel von 1894 gilt dem ukrainischen<br />
Fußballverband als Geburtsstunde des nationalen Fußballs, was der Verband so bereits 1999<br />
der Uefa mitgeteilt hat. 2004 zog das ukrainische Parlament nach und verordnete offizielle<br />
Feierlichkeiten zum <strong>11</strong>0. Jahrestag des ersten Fußballspiels. Die Geschichtsinterpretationen<br />
auf die Spitze trieb allerdings eine große Brauerei des Landes. Eigens zum <strong>11</strong>5-jährigen<br />
Jubiläum des Fußballs in der Ukraine brachte sie ein Bier auf den Markt. In der<br />
entsprechenden Werbung hieß es, „die Ukraine“ habe 1894 Polen mit 1:0 besiegt.<br />
Streit zweier Länder, die es seinerzeit gar nicht gab<br />
Der Streit zwischen Polen und der Ukraine um das erste Fußballspiel lässt ein wenig von der<br />
komplizierten Geschichte beider Länder erahnen. Tatsächlich gibt es Ende des 19.
Jahrhunderts weder Polen noch die Ukraine auf der europäischen Landkarte. Lemberg ist<br />
damals Hauptstadt des Kronlandes Galizien und Lodomerien, einer Provinz der<br />
österreichisch-ungarischen k. und k. Monarchie. Es ist eine multikulturelle, vielsprachige<br />
Stadt. Ein bunter Fleck im Osten Europas, eine kleine Filiale der großen Welt, schwärmt der<br />
österreichische Schriftsteller Joseph Roth von der ostgalizischen Stadt. Jeder zweite<br />
Einwohner ist Pole, neben Juden und Ukrainern leben auch Armenier, Deutsche und<br />
Angehörige zahlloser anderer Nationalitäten in Lemberg.<br />
Zwischen den beiden Weltkriegen gehört die Stadt zum wieder unabhängig gewordenen<br />
polnischen Staat. Sie ist zu jener Zeit ein Zentrum der polnischen Kultur, aber auch Hort des<br />
ukrainischen Nationalbewusstseins und Wiege der ukrainischen Nation. Als der Berliner<br />
Schriftsteller Alfred Döblin die Stadt 1924 besucht, trifft er auf einen „furchtbar intensiven<br />
Völkerkampf“ zwischen Polen und Ukrainern. Er schreibt: „Diese Stadt liegt in den Armen<br />
zweier Gegner, die sich darum reißen. Im Hintergrund und unterirdisch wühlen Feindschaft<br />
und Gewalt.“ Und weiter konstatiert Döblin: „Hier lassen sich Land und Volk nicht<br />
voneinander abgrenzen; sie sind ineinander verschoben.“<br />
Am Ende des Zweiten Weltkriegs aber geschieht genau das: die Grenzen Polens werden nach<br />
Westen verrückt. Aus dem polnisch dominierten Lwów wird das ukrainische Lviv. Die<br />
meisten Polen müssen Lemberg verlassen, unter ihnen auch Włodzimierz Chomicki, der<br />
Torschütze aus dem Stryjski-Park.<br />
Wie für so viele andere Nationen galt auch für Polen und Ukrainer lange Zeit, dass ihre<br />
gemeinsame Geschichte ebenso verbindet wie sie trennt. Doch gerade seit der „Orangen<br />
Revolution“ in der Ukraine 2004, die in Polen auf warme Sympathie und Unterstützung traf,<br />
ist Bewegung in das Verhältnis der beiden Länder gekommen. Polen gilt innerhalb der EU als<br />
größter Anwalt seines östlichen Nachbarn. Mit der Bewerbung für die Europameisterschaft<br />
20<strong>12</strong> entschieden sich die beiden Länder für ein gemeinsames Projekt, das in die Zukunft<br />
weist. Und wenn alljährlich im Lemberger Stryjski-Park an das Fußball-Spiel von 1894<br />
erinnert wird, dann sind heute ganz selbstverständlich immer auch Sportsfreunde aus Polen<br />
zugegen.<br />
Die Autoren erreichen Sie unter den Adressen http://www.robertkalimullin.de/ sowie<br />
http://www.martin-brand.de/<br />
Dieser Beitrag wurde gefördert durch ein Recherchestipendium der Stiftung für Deutsch-<br />
Polnische Zusammenarbeit.<br />
Lesen Sie dazu auch: „Lemberg – Wo ist hier der Hafen?“ in EM 06-<strong>11</strong>.<br />
EURASISCHE SPIRITUALITÄT<br />
15.000 Jahre alte Steinmalereien entdeckt<br />
In einer Höhle auf der Schwäbischen Alb wurde die älteste Tradition von<br />
Malerei in Mitteleuropa entdeckt. Die eiszeitliche Kunst wird nun in einer<br />
Sonderausstellung der Universität Tübingen präsentiert.<br />
*
Von Hans Wagner<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
ie bunt betupften Steine aus der Höhle „Hohle Fels“ bei Schelklingen auf der<br />
Schwäbischen Alb waren möglicherweise Schamanen-Utensilien. Aber genau weiß es<br />
(bislang) niemand. Die Steine wurden vor rund 15.000 Jahren mit parallelen Reihen roter<br />
Punkte bemalt. Es sind die ältesten Funde eiszeitlicher Malerei in Mitteleuropa.<br />
Die neuen Funde aus der „Hohle Fels“ Höhle stehen im Mittelpunkt einer Sonderausstellung<br />
im Museum der Universität Tübingen (MUT) auf Schloss Hohentübingen. Titel der Schau:<br />
„Bemalte Steine – das Ende der Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb“. Die Ausstellung<br />
wird seit dem 10. November 20<strong>11</strong> und noch bis zum 29. Januar 20<strong>12</strong> gezeigt. Sie präsentiert<br />
die neuen Funde und zeigt auch bedeutende Vergleichsgegenstände von derselben Fundstelle<br />
und von anderen Ausgrabungen der Universität Tübingen.<br />
Kalender oder „Notizen“ von Jagerfolgen?<br />
Die „Doppelreihen roter Punkte auf Kalksteingeröllen“, wie sie von Nicholas Conard, dem<br />
Archäologen und Chef-Ausgräber der Universität Tübingen, genannt werden, geben noch<br />
viele Rätsel auf. Vermutet wird nicht nur, dass es sich um Schamanenzauber gehandelt haben<br />
könnte, sondern auch dass Steinzeitmenschen möglicherweise so ihre Jagdbeute gezählt<br />
haben. Für jedes Mammut oder jeden Hirsch ein Punkt oder so. Andere Überlegung gehen in<br />
Richtung Kalender. Vielleicht, so die Theorie, hätten die Punkte für Tage oder Jahre<br />
gestanden. Sogar die Idee, es sei vielleicht ein Menstruationskalender gewesen, ist schon<br />
aufgetaucht.<br />
In einem Punkt gibt sich Nicholas Conard absolut sicher: „Diese Punkte sind gewollt, und sie<br />
haben einen relevanten Inhalt.“ Es sei als keineswegs ein Zufall, dass diese Steine punktiert<br />
seien. Sogar die Farbquelle der Maler aus der „Hohle Fels“ Höhle wurde entdeckt: Die<br />
Eiszeitmenschen hätten eine Mischung aus Hämatit und Rötel mit kalkhaltigen Wassertropfen<br />
aus den Höhlen angerührt, erläuterte die Grabungstechnikerin Maria Malina nach einer<br />
Untersuchung der gefundenen Materialien. Damit habe man die rotbraunen Punkte erzielt. Sie<br />
haben jeweils einen Durchmesser von etwa vier bis sieben Millimeter. Das Kunstwerk gibt<br />
den Forschern weiter Rätsel auf.<br />
Der Tübinger Archäologe Conard hat in der idyllisch gelegenen Höhle „Hohle Fels“ im<br />
Aachtal schon eine ganze Reihe spektakulärer Entdeckungen gemacht. „Egal, wo wir graben“<br />
sagt Conard, „in dieser Höhle machen wir immer fantastische Funde. So wurde im „Hohle<br />
Fels“ bei früheren Grabungen bereits die „Venus vom Hohle Fels“ zutage gefördert. Dabei<br />
handelt es sich um eine Miniatur-Plastik aus Elfenbein, die eine sechs Zentimeter große<br />
Frauenfigur darstellt und rund 35.000 Jahre alt ist. Sie gilt als die älteste Menschendarstellung<br />
weltweit. Außerdem gruben die Archäologen in der Karsthöhle eine mehr als 35.000 Jahre<br />
alte Flöte aus dem Knochen eines Gänsegeiers aus. Die Flöte ist das bisher älteste<br />
Musikinstrument der Welt.<br />
Mehr über Höhlenfunde und weitere Links zu „Eurasische Spiritualität“ finden Sie hier.<br />
(Beachten Sie bitte die Linksammlung am Ende des empfohlenen Beitrags).<br />
*
CHINA<br />
Trommelwirbel aus dem Reich der Mitte<br />
China ist eine Supermacht der großen Show. Auf diesem Gebiet muss das<br />
Reich der Mitte nicht abkupfern, sondern hier macht ihnen so schnell kein<br />
anderes Land etwas vor. Das zeigte sich bei der Eröffnung der Olympischen<br />
Spiele im Jahr 2008. Welche Kreativität Chinesen bei Massenshows entfalten<br />
können, erfuhr man auch durch den Mao-Kult während der Kulturrevolution<br />
und den Inszenierungen der „Viererbande“. Seit rund zehn Jahren hat China<br />
zusätzlich zu seinem „Nationalcircus“ auch einen musikalischen<br />
Exportschlager mit dem es gerade Europa erobert: Die „MANAO - Drums of<br />
China“.<br />
Von Barbara Gutmann<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
„MANAO – Drums of China“ - mit Professionalität und enormer Ausdauer an die<br />
Weltspitze getrommelt.<br />
Foto: Rainer Hackl<br />
2008 eröffneten 16 junge Chinesinnen mit einem gewaltigen Trommelwirbel die<br />
Olympischen Spiele in Peking. Schön, selbstbewusst und überaus kraftvoll präsentierte sich<br />
die Gruppe auf der Bühne. Die faszinierende Darbietung dauerte knapp zwölf Minuten, aber<br />
sie begeisterte ein Milliarden-Publikum in aller Welt.
„MANAO – Drums of<br />
China“ - eine der<br />
besten Trommel-<br />
Formationen der Welt.<br />
Foto: Rainer Hackl<br />
Das Ensemble „MANAO - Drums of China“ steht bereits seit zehn<br />
Jahren auf der Bühne, aber mit Olympia 2008 kam der internationale<br />
Durchbruch. Nachdem sie in ihrer Heimat bereits enthusiastisch<br />
gefeiert wurden, spielten die Musikerinnen auch in Kanada, den<br />
USA, Singapur, Südafrika und Australien. Seit letztem Jahr bringen<br />
sie den Zauber dieser fernöstlichen Kultur auch nach Europa.<br />
Sechzehn zierliche Wesen traktieren<br />
riesige Trommeln<br />
Frauen an traditionellem Schlagwerk - ein Bild, das lange<br />
unvorstellbar schien. Mit einer beeindruckend exakten Synchronität<br />
schlagen die zierlichen Frauen auf bis zu 350 Kilo schwere<br />
Trommeln. Als hätten sie nie etwas anderes gemacht, traktieren sie<br />
die straff gespannten Felle in temperamentvollen Rhythmen mit Leidenschaft und Feuer.<br />
Laut und imposant, aber auch zart und gedämpft. Alte, chinesische Trommelkunst verpackt in<br />
eine Bühnenshow, welche die musikalischen Themen durch modernste Lichttechnik und<br />
gezielt eingesetzte Effekte eindrucksvoll in Szene setzt. Diese Komposition regt die Fantasie<br />
an und lässt uns eintauchen in eine mystische, fremde Welt.<br />
Inwieweit diese Inszenierung noch wirklich mit alten Traditionen zu tun hat, ist<br />
unklar. Bislang war diese traditionelle Kunst den Männern vorbehalten, insofern ist die<br />
Tradition aufgehoben. Der rhythmische Auftritt ist sinnlich, erotisch komponiert und von<br />
einer beeindruckenden Choreografie. Der Name MANAO ist den Veranstaltern zufolge ein<br />
reiner Show-Titel, klangvoll aber ohne tiefere Bedeutung.<br />
Tradition und Moderne in einer kunstvollen Bühnenshow<br />
„Die 16 Musike<br />
rinnen stehen für eine junge, chinesische Generation, die sich<br />
zunehmend an westlichen Werten orientiert, ihr Traditionsbewusstsein<br />
aber pflegt und es damit schafft, Brücken zu schlagen zwischen einer<br />
alten Kultur und der Moderne“, heißt es in den Ankündigungen zu ihren<br />
Live-Auftritten. Das Publikum werde begeistert durch traditionelle<br />
Klänge in Verbindung mit einer kunstvoll, modernen Bühnenshow und<br />
bekomme ein überwältigendes Erlebnis geboten.<br />
Mit<br />
beeindruckender<br />
Synchronität<br />
schlagen die<br />
zierlichen Frauen<br />
die bis zu 350 Kilo<br />
schweren<br />
Trommeln.<br />
Foto: Rainer Hackl<br />
Neben verschiedenen Schlagwerken werden während der Show auch<br />
seltene Saiteninstrumente vorgestellt, die einen lieblich, melodischen<br />
Kontrast bilden. Klang und Rhythmus entführen in eine traumhafte<br />
Welt und erzählen von wilden Tieren und unberührten Landschaften.<br />
MANAO – die sechzehn hübschen jungen chinesischen<br />
Trommlerinnen verwirbeln in ihrer Performance traditionelle<br />
chinesische Rhythmen mit weltbekannten Melodien zu einem<br />
akustischen Trommelfeuerwerk. Seit den ersten Auftritten im Jahre<br />
2001 in China haben sie mehr als 1.000 Auftritte in China in aller Welt<br />
bestritten.
Eine der besten Trommel-Formationen der Welt<br />
Spannungsgeladene<br />
Darbietung, körperliche<br />
Höchstleistung,<br />
Trommeln mit Leib<br />
und Seele.<br />
Foto: Rainer Hackl<br />
Mit unglaublicher Disziplin, die sich in ihren konzentrierten<br />
Gesichtern spiegelt, mit Professionalität und enormer Ausdauer<br />
haben sie sich an die Weltspitze getrommelt. MANAO gilt<br />
international als eine der besten Trommel-Formationen. Am 22.<br />
Oktober 20<strong>11</strong> waren „MANAO – Drums of China“ auch schon live<br />
im deutschen Fernsehen zu sehen: bei der Carmen Nebel-Show im<br />
ZDF.<br />
Die spannungsgeladene Darbietung der jungen Trommlerinnen ist<br />
körperliche Höchstleistung, ist Trommeln mit Leib und Seele.<br />
Dabei stilvoll und mitreißend in Szene gesetzt, eine durchgestylte<br />
Show voller zeitgenössischer Ästhetik, kombiniert mit modernster<br />
Lichttechnik und Bühneneffekten sowie imposantem Bühnenbild.<br />
Die 16 Wirbelwinde aus dem Reich der Mitte verstehen es, ihr<br />
Publikum zu faszinieren und aus dem Alltag zu entführen.<br />
Die ersten Termine bei ihrer „Flying Dragon Tour 20<strong>12</strong>“ in Deutschland bestreiten die<br />
MANAO-Drums im Monat Februar in Fürth, Hannover, Berlin, Dessau, Frankfurt/Main,<br />
Dresden, Chemnitz, Halle, Rostock, Karlsruhe, Ulm.<br />
Weitere Informationen und den aktuellen Trailer finden Sie hier.<br />
CHINA<br />
Nationalcircus auf den Spuren der<br />
Seidenstraße<br />
*<br />
Die Seidenstraße quer durch Eurasien fasziniert die Menschen in Ost und<br />
West seit Jahrtausenden und regt ihre Phantasie an. „Seidenstraße“ nennt der<br />
„Chinesische Nationalcircus“ seine neue Show, mit der er sich als offizieller<br />
Bestandteil des China Kulturjahres 20<strong>12</strong> in Deutschland präsentiert.<br />
Von Eberhart Wagenknecht<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
ine tolle Marketingidee ist es allemal, eine Zirkusshow nach dem legendären und<br />
geheimnisumwitterten Weg durch Länder und Zeiten zu nennen. Die Seidenstraße hat<br />
bis heute eine hohe Symbolkraft für die Einheit des eurasischen Kontinents und steht für die<br />
kulturelle Befruchtung seiner östlichen und westlichen Zonen und Kulturen.<br />
Der Veranstalter führt dazu aus: „Getreu der alten Zen-Weisheit, dass ein Weg nur ein Weg<br />
wird, wenn einer ihn geht, haben ganze Scharen von Generationen diesen Weg genutzt, um<br />
Güter, Religionen, Kunst und Ideen von hier nach dort und dort nach hier zu transportieren.“
Und die neue Show des Chinesischen Nationalcircus nehme „so auch den Zuschauer mit auf<br />
eine Reise über diesen alten Karawanenstrom ins Reich der Mitte und biete“ eingebunden<br />
in „Weltklasseakrobatik, die Ansicht von unbekannten Kulturen und Traditionen des Fernen<br />
Ostens mit einer neuen Perspektive“. Damit zeige sie seinerseits die interessanten<br />
Kulturunterschiede auf und unterstreiche andererseits gekonnt „Leidenschaft und Humor und<br />
die tiefen menschlichen Gemeinsamkeiten der Völker an diesem Weg.“<br />
Der Status des Unglaublichen<br />
In Szene gesetzt sieht das so aus: Eine Artistin jongliert fünf Teller an ihrer linken Hand und<br />
fünf Teller an ihrer rechten Hand während sie sich mit dem ganzen Körper um ihre eigene<br />
Achse dreht, um mit dem Mund eine Rose aufzuheben, die an ihrer Ferse liegt. Dieser<br />
außergewöhnliche Trick einer Akrobatin des Chinesischen Nationalcircus erscheint dem<br />
europäischen Zuschauer unerreichbar für einen normalen menschlichen Körper. Und doch<br />
wird diese Pose, wie auch weitere Darbietungen, die unsere Vorstellung von Schwerkraft<br />
aufheben, täglich mit einem Lächeln, graziös und fehlerfrei präsentiert. Diese Akrobaten<br />
überschreiten Grenzen und erreichen so einen Status des Unglaublichen.<br />
Jahr für Jahr präsentiert der Chinesische Nationalcircus ein neues Bühnenspektakel, das dem<br />
Publikum faszinierende Einblicke in die fremde Kultur Chinas gewährt. Auch in der neuen<br />
Show „Seidenstraße – Akrobatik am Puls der Menschheit“ repräsentieren die phantastischen<br />
Artisten die vollkommene Einheit aus Geist, Körper, Seele und traditioneller Musik. – In der<br />
Vergangenheit hat der Chinesische Nationalcircus mehr als neun Millionen Besuchern<br />
eindrucksvoll bewiesen, dass eine solche Einheit von Körper, Geist und Seele möglich ist.<br />
In jeder Saison präsentiert der Chinesische Nationalcircus aufs Neue als offizieller<br />
Kulturbotschafter dem europäischen Publikum komplett neue Shows, und das in mehr als<br />
160 Städten. Im Mittelpunkt stehen, quasi als geistiger Leitfaden, Geschichte<br />
und Geschichten aus und über China, über chinesische Helden und deren spirituelle<br />
Fundamente, auf denen sie fußen. (Die Veranstaltungen beinhalten ca. zwei Stunden reines<br />
Programm, Tickets kosten etwa 30 bis 60 Euro).<br />
Akrobaten – ausgebildet in tausend Zirkusschulen<br />
China macht 20<strong>12</strong> zum deutsch-chinesischen Kulturjahr. Anlass ist der 40. Jahrestag der<br />
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China. Die Idee eines<br />
deutsch-chinesischen Kulturjahres gründet auch auf den positiven Erfahrungen mit der<br />
deutschen Veranstaltungsreihe „Deutschland und China - Gemeinsam in Bewegung“. Der<br />
Chinesische Nationalcircus mit seiner neuen Produktion präsentiert sich als offizieller<br />
Bestandteil dieses Kulturjahres.<br />
In ihren Veröffentlichungen streichen die Veranstalter heraus, „dass die chinesischen<br />
Akrobaten international einen uneingeschränkt guten Ruf genießen und sicherlich zu den<br />
Besten Ihrer Zunft weltweit gehören“. Das habe unter anderem damit zu tun, dass man bei der<br />
chinesischen Akrobatik auf eine 2000 jährige Geschichte zurückblicken kann und somit von<br />
diesem Erfahrungsvorsprung im technischen, mentalen und sogar spirituellen Bereich immer<br />
noch profitiere. In den über 1000 Circusschulen, die in der ganzen Volksrepublik verteilt sind,<br />
werde Akrobatik in höchster Vollendung gelehrt: „In diesen angesehenen Leistungszentren<br />
werden die angehenden Akrobaten in den verschiedensten Sparten ausgebildet bis sie nach
zehn Jahren die Bühnenreife erlangt haben und dann als professionelle Artisten ein weltweites<br />
Publikum begeistern dürfen.“<br />
Der „Chinesische Nationalcircus“ sei „kein physisch existenter Circus“. Es handele sich<br />
hierbei vielmehr um ein Qualitätssiegel und ein Label, welches verliehen werde „für<br />
außerordentlich gute, talentierte und erfolgreiche chinesische Akrobatiktruppen, die diese<br />
immerhin 2000 Jahre alte Kultur im westlichen Ausland präsentieren.“<br />
Jahr für Jahr finden sich aus diesen Talentschmieden die Besten zu den neuen Programmen<br />
des Chinesischen Nationalcircus zusammen. Sie tun dies seit zehn Jahren unter der Obhut des<br />
deutschen Regisseurs und Produzenten Raoul Schoregge, der einst selbst als Clown Correggio<br />
in der Manege vieler bekannter Zirkusunternehmen auftrat.<br />
Wurzeln in der Kriegsstrategie der Antike<br />
„Zaji“ nennen die Chinesen die Kunst der Akrobaten, deren Ursprünge uralt sind. Sie haben<br />
zum Teil religiös- philosophische Wurzeln, die im Bereich der Spiritualität Chinas liegen, im<br />
Buddhismus, im Konfuzianismus und im Taoismus. Die exzellente Darstellung der<br />
angestrebten Einheit von Körper, Geist und Seele durch die Akrobaten machen diese<br />
Kunstform zu einem idealen Medium hierfür.<br />
Es gibt auch Wurzeln die in die Welt des Krieges und der Soldaten hineinreichen. „Wie schon<br />
so häufig in der Menschheitsgeschichte trifft es auch hier zu, dass der Vater vieler Dinge der<br />
Krieg ist“, heißt es in einem Text den die Veranstalter über den Nationalcircus verbreiten. „So<br />
benutzten die chinesischen Feldherren schon in grauer Vorzeit bei ihren gigantischen<br />
Heeresaufmärschen eine Art Vorhut, die aus Akrobaten bestand. Die Aufgabe dieser bestand<br />
darin durch eine virtuose Präsentation spektakulärer Sprünge, Menschenpyramiden,<br />
Handstände und Salti den Gegner einzuschüchtern.“<br />
Etwas davon teilt sich auch dem modernen Zirkusbesucher noch mit. So sind Gänsehaut und<br />
ein beschleunigter Puls und auch eine gewisse Bangigkeit durchaus auch unter der<br />
Zirkuskuppel noch Bestandteile des staunend erlebten Akrobatenzaubers.<br />
Weitere Informationen: www.chinesischer-nationalcircus.eu<br />
GELESEN<br />
„Die Externsteine – eine Wanderung durch<br />
Mythos und Geschichte“ von Heiko<br />
Petermann<br />
„Die Externsteine sind ein in Stein gemeißeltes Geheimnis unserer Kultur“<br />
heißt es in der Verlagsmitteilung auf der Umschlagseite des Buches. Das<br />
zumindest dürfte unumstritten sein. Ansonsten gehen die Ansichten über<br />
kultische Bedeutung und mythologische Vergangenheit ziemlich auseinander.<br />
*
Heiko Petermann bietet mit seinem Taschenbuch eine sorgfältig aufbereitete<br />
Darstellung all dessen, was über diese geheimnisvolle Steinformation gesagt<br />
werden kann.<br />
Von Arnulf H. Clarenbach<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
„Die Externsteine – eine Wanderung durch<br />
Mythos und Geschichte“ von Heiko<br />
Petermann<br />
mpfehlenswert wäre, sich das Buch in<br />
die Jackentasche zu schieben und selbst<br />
hinzufahren, nach Horn-Bad Meinberg<br />
im Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen), in<br />
den Teutoburger Wald, wo die markante<br />
Sandstein-Felsformation „Externsteine“<br />
aufragt. Sie gehört zu den eindrucksvollsten<br />
Natursehenswürdigkeit Deutschlands und<br />
verdient es, besucht zu werden. Ihre<br />
geologische Bedeutung wurde am <strong>12</strong>. Mai<br />
2006 mit der Auszeichnung als „Nationales<br />
Geotop“ durch die Akademie für<br />
Geowissenschaften zu Hannover von Amts<br />
wegen gewürdigt.<br />
Über dem Geheimnis der Externsteine liegt<br />
der Schleier der Zeit. Die wahre Geschichte<br />
bleibt dem Auge des modernen Menschen<br />
verborgen. Steinzeitliche Großskulpturen,<br />
keltisch-germanische Kultstätte und<br />
Sternwarte, vielleicht sogar der Ausgangspunkt für den Aufstand unter dem Germanenfürsten<br />
Arminius, das rätselhafte christliche Kreuzabnahmerelief, die Zeichen der Tempelritter und<br />
die Suche nach dem Gral - die Geschichte der Externsteine geht viel tiefer, als wir es ahnen.<br />
Ein Weltkulturerbe<br />
War an den Externsteinen die erste Klostergründung der Mönche von Corby, bevor sie das<br />
Kloster Corvey an der Weser gründeten? Warum wollte Ferdinand II. de Medici, Großherzog<br />
der Toskana, 1654 die Externsteine kaufen? Er soll dort eine Reliquie gesucht haben den<br />
Heiligen Gral der Tempelritter?<br />
Heiko Petermanns praktischer Wegführer erzählt die überlieferte Geschichte der Externsteine<br />
und leitet den Besucher zu Betrachtungen, die weit in die Geschichte unserer Vorfahren und<br />
dieses einmaligen Naturdenkmals reichen.<br />
Die Externsteine ein Weltkulturerbe? Fragen die Gestalter des Buches. Natürlich, möchte man<br />
sagen. Sie hätten es wahrlich verdient, auch auf dieser Liste der Vereinten Nationen zu<br />
stehen!<br />
Ein mythischer und geschichtsträchtiger Ort
Vom Besucher bestaunt und bewundert, sind die Externsteine im Teutoburger Wald abseits<br />
aller Schwärmereien und Deutungen bis zum heutigen Tag ein mythischer und<br />
geschichtsträchtiger Ort, der alljährlich Hunderttausende in seinen Bann schlägt.<br />
Heiko Petermann, Jahrgang 1954, ist als Sach- und Hörbuchautor sowie als Regisseur<br />
zahlreicher TV-Dokumentationen und Filme bekanntgeworden. In seinem Buch über die<br />
Externsteine geht er der erdgeschichtlichen Entstehung des Naturdenkmals nach. Er erläutert<br />
die frühe Siedlungsgeschichte im Teutoburger Wald, König Gylfis Reise nach Asgard,<br />
berichtet über Rom und die Eroberung Germaniens. Aufregende Ereignisse wie die<br />
Varusschlacht und ihre Folgen, der Kampf der Sachsen gegen die Franken und warum<br />
Ferdinand de' Medici 1654 die Externsteine kaufen wollte, werden ausführlich dargestellt.<br />
Petermann führt nicht nur fundiert und unterhaltend durch die Epochen, er geht vor allem mit<br />
dem Leser von Fels zu Fels und schärft das Auge für das Besondere. Dabei bietet er<br />
verschiedene Möglichkeiten der Interpretation, ohne sie jedoch für gültig zu erklären. Allein<br />
die Sinnfälligkeit seiner Argumentationen schafft beim Leser die Bereitschaft, gewohnte<br />
Denkwege zu verlassen.<br />
Ein Kraftort der Vorzeit<br />
Nachgewiesen ist, so Petermann, dass an den Externsteinen vor 7000 Jahren erste<br />
astronomische Beobachtungen zur Bestimmung der Sommer- und Wintersonnenwende<br />
gemacht wurden. So wird die im Mai 20<strong>11</strong> von Heiko Petermann entdeckte prähistorische<br />
Sternkarte in den nächsten Jahren sicher die Archäo-Astronomen beschäftigen und<br />
wissenschaftliche Diskussionen auslösen.<br />
Der Informative und praktische Wegbegleiter zu den geheimnisumwitterten Externsteinen ist<br />
wirklich gelungen. Das mit ausdrucksstarken Bildern reich illustrierte Buch, versehen mit<br />
einem ausführlichen und äußerst praktischen Register, zeigt überraschende Perspektiven auf<br />
diesen frühen Kultplatz, die so bislang noch nicht zu sehen waren.<br />
Mehr über Kraftorte der Vorzeit und weitere Links zu „Eurasischer Spiritualität“ finden Sie<br />
hier. (Beachten Sie bitte die Linksammlung am Ende dieses empfohlenen Beitrags).<br />
Rezension zu: „Die Externsteine – eine Wanderung durch Mythos und Geschichte“ von<br />
Heiko Petermann, Felicitas Hübner Verlag Lehrte 20<strong>11</strong>, 176 Seiten, 18,80 Euro, ISBN-13:<br />
978-3927359710.<br />
GELESEN<br />
„Ehrenmord – ein deutsches Schicksal“ von<br />
Matthias Deiß und Jo Goll<br />
Dreiundzwanzig Jahre alt ist die kurdisch-stämmige Deutsche Hatun Sürücü,<br />
als sie von ihrem eigenen Bruder erschossen wird. Sie starb, weil sie ein<br />
selbstbestimmtes Leben führen wollte.<br />
*
Von Johann von Arnsberg<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
atun Sürücü war Deutsche. Sie kam in<br />
Deutschland zur Welt. 23 Jahre wurde<br />
sie alt. Am 7. Februar 2005 hat einer ihrer<br />
Brüder sie an einer Bushaltestelle in Berlin-<br />
Tempelhof mit drei Schüssen in den Kopf<br />
hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt, zum<br />
Zeitpunkt des Mordes an seiner Schwester<br />
Hatun, war der Täter, ihr jüngster Bruder<br />
Ayhan, 19 Jahre alt. Er hat die Tat gestanden<br />
und alle Schuld auf sich genommen.<br />
„Ehrenmord – ein deutsches Schicksal“ von<br />
Matthias Deiß und Jo Goll<br />
Beweisen freigesprochen.<br />
Das Gericht hatte drei ihrer Brüder im<br />
Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu<br />
sein. Doch nachdem der Jüngste gestanden<br />
hatte und mit einer Jugendstrafe von neun<br />
Jahren und drei Monaten davongekommen<br />
war, schien der Fall geklärt. Die beiden<br />
mitangeklagten älteren Brüder, Alpaslan und<br />
Mutlu Sürücü, wurden aus Mangel an<br />
Es gab eine Kronzeugin, die vor Gericht aussagte, Ayhans älterer Bruder Mutlu habe die<br />
Waffe besorgt, Alpaslan habe Schmiere gestanden, als Ayhan die Schwester erschoss.<br />
Keine Reue<br />
Über den Fortgang des Falles und Bruder Mutlu schreiben Deiß und Goll: „Zum Zeitpunkt<br />
des Mordes an seiner Schwester Hatun ist Mutlu Sürücü fünfundzwanzig Jahre alt und<br />
deutscher Staatsbürger. Als der Bundesgerichtshof im August 2007 seinen Freispruch<br />
kassiert, ist er bereits in der Türkei. Gibt bald darauf die deutsche Staatsbürgerschaft zurück.<br />
Sein Kalkül geht auf. Obwohl die Türkei das europäische Auslieferungsabkommen von 1957<br />
ratifiziert hat können die Behörden dort die Auslieferung türkischer Staatsangehöriger ohne<br />
nähere Angaben ablehnen.“<br />
Das ist von den Autoren nüchtern beschrieben die juristische Situation im Fall der der<br />
Mittäterschaft verdächtigen Brüder. Mutlu Sürücü soll die Waffe besorgt haben. Auch dessen<br />
Bruder Alpaslan – geboren 1981 – soll in den Fall verwickelt sein und in Tatortnähe Schmiere<br />
gestanden haben. Alpaslan lebt heute ebenfalls in der Türkei. Von keinem in diesem Trio<br />
wurden bisher auch nur kleinste Anzeichen von Reue bekannt.<br />
Ein deutsches Schicksal<br />
„Die Tat“, so resümieren Mattias Deiß und Jo Goll, „gilt bis heute als der bekannteste<br />
Ehrenmord-Fall in Deutschland. Sie hat unser Land verändert. Der Mord wurde über Nacht<br />
zum Fanal für misslungene Integration.“
Diese Familientragödie, dieser Geschwistermord, ist ein deutsches Schicksal. Hatun war<br />
Deutsche. Sie ist in Deutschland geboren. Als ihr Bruder sie mit drei Schüssen in den Kopf<br />
an einer Bushaltestelle in Berlin-Tempelhof hinrichtete, stand sie kurz vor ihrer<br />
Gehilfenprüfung zur Elektroinstallateurin. Ihr Bruder Mutlu Sürücü, der die Waffe besorgt<br />
haben soll, war ebenfalls Deutscher, bis zu dem Tag als er seine Staatsbürgerschaft<br />
zurückgegeben hat.<br />
Und doch waren die Brüder nicht damit einverstanden, dass ihre Schwester ein<br />
selbstbestimmtes Leben führte, in einer eigenen kleinen Wohnung. Der Deutsche Mutlu und<br />
seine Brüder wussten, dass ihre aus Ostanatolien stammende Familie dieses Leben nicht<br />
tolerierte. Nicht dass Tochter Hatun sich von ihrem Ehemann scheiden ließ, mit dem man sie<br />
zwangsverheiratet hatte, nicht dass sie das Kopftuch ablegte, nicht dass sie ihrem Sohn<br />
Deutsch beibrachte und anstatt Türkisch. Und vor allem nicht, dass Hatun auch nach<br />
deutschen Moralvorstellungen lebte.<br />
Ob ihr Tod von der Familie geplant wurde, ist ungeklärt. Ayhan Sürücü hat dies bestritten,<br />
und alle Schuld allein auf sich genommen. Er habe nicht mehr richtig denken können, in ihm<br />
habe etwas ausgesetzt, als seine Schwester Hatun ihm ins Gesicht geschrien hätte, „Ich<br />
schlafe mit jedem, mit dem ich will!“<br />
Die beiden Autoren haben es geschafft, an Ayhan den Mörder von Hatun Sürücü<br />
heranzukommen. Sie haben lange Gespräche mit ihm im Gefängnis geführt. Reue habe er<br />
nicht gezeigt, sagt Jo Goll: „Er hat in diesen ganzen stundenlangen Gesprächen, die wir mit<br />
ihm hatten, nicht einmal ihren Namen in den Mund genommen. Und es ist uns sehr stark<br />
aufgefallen, er hat den Schritt nicht vollziehen können, dass er heute sagt, so wie sie gelebt<br />
hat, wäre das für mich heute in Ordnung.“<br />
Matthias Deiß und Jo Goll haben Jahre an ihrem Buch recherchiert. Sie sind auch mit<br />
Freunden von Hatun Sücürü in Kontakt gestanden und haben Kollegen aufgesucht, um mit<br />
ihnen zu reden, vielleicht etwas über die Hintergründe zu erfahren.<br />
Ehrbegriffe in der Fremde konserviert<br />
Bei ihren Recherchen konnten Matthias Deiß und Jo Goll den Mord und seine<br />
Vorgeschichte rekonstruieren. Sie erzählen die Geschichte der Familie Sürücü, so wie die<br />
Fakten liegen, die sie in Erfahrung brachten. Sie erzählen spannend, feinfühlig, aber ohne<br />
unzulässige Spekulationen zu verbreiten. Eine ihrer Beobachtungen ist, dass der Ehrbegriff<br />
aus dem abgelegenen Gebiet, aus dem die Menschen kommen, in der Familie nie überwunden<br />
wurde: „Die Sürücüs haben diesen Ehrbegriff, diesen Wertekanon vor 35 Jahren<br />
mitgenommen und leben diesen hier ganz streng aus. Während in dem Dorf, das sehr, sehr<br />
rückständig ist, man heute nach links und nach rechts schaut und wirklich eine Entwicklung<br />
durchgemacht hat.“<br />
Besonders bedrückend ist, wie fremd sich die Familie Sürücü nach der langen Zeit in<br />
Deutschland noch immer fühlte, wie sehr sie von den überkommenen Traditionen bestimmt<br />
war, die sie in Deutschland stets als Fremde kennzeichneten. Die Familie hat sich nie<br />
integriert. Deutsche Bekanntschaften gab es – außer bei Tochter Hatun – in dieser Familie<br />
nicht. Seinen ersten deutschen Freund soll der wegen des Mordes verurteilte Ayhan Sürücü<br />
im Gefängnis kennengelernt haben.
Der türkische Staat spielt eine ganz eigene Rolle. Sie ist eher zwielichtig. Wer an die Reden<br />
Erdogans denkt, kann leicht erkennen, dass sie nicht hilfreich sind.<br />
Im Fall des türkischen EU-Beitritts hätten deutschen<br />
Stellen Zugriff<br />
Über den von der deutschen Justiz wegen Mittäterschaft gesuchten Mutlun Sürücü halten<br />
türkische Stellen noch immer schützend die Hand. Wie es mit ihm weitergehen könnte, weist<br />
in die Zukunft. Die Autoren schreiben: „Mutlu Sürücü lebt in der Ungewissheit, ob er nicht<br />
irgendwann doch noch an die deutschen Behörden überstellt wird.“<br />
„Wenn Deutschland Druck machen würde, würde die Türkei mich sicherlich abschieben“,<br />
zitieren die Autoren den in der Türkei lebenden Mutlu. „Ich denke, Deutschland macht aber<br />
nicht genügend Druck“, sagt der Gesuchte.<br />
Und dann machen die Autoren in ihrem spannenden und sehr zu empfehlenden Buch, das<br />
tiefe Einblicke in die sogenannte Integration gibt, noch eine Rechnung auf mit interessanter<br />
Perspektive: „Tatsächlich hat bis heute niemand einen Auslieferungsantrag an die Türkei<br />
gestellt. Wegen Aussichtslosigkeit. Die Behörden glauben, dass die Zeit auf ihrer Seite ist.<br />
Mord verjährt nicht. Und im Fall eines EU-Beitritts der Türkei würde Mutlu Sürücü ein neuer<br />
Prozess drohen. Dann hätten die deutschen Ermittler wieder Zugriff. Deshalb warten sie ab.“<br />
Rezension zu: „Ehrenmord – ein deutsches Schicksal“ von Matthias Deiß und Jo Goll,<br />
Hoffmann und Campe, Hamburg 20<strong>11</strong>, 255 Seiten, 18,99 Euro, ISBN-13: 978-3455502374.<br />
LESETIPP<br />
Ägypten in der Reformkrise: Politischer<br />
Umbruch ohne wirtschaftliches Konzept<br />
Wie ist die Lage in dem von Unruhen gebeutelten Land am Nil wirklich?<br />
Kommen zu der Reformkrise und den politischen Unwägbarkeiten auch noch<br />
wirtschaftliche Probleme hinzu?<br />
Von EM Redaktion<br />
EM <strong>12</strong>-<strong>11</strong> · <strong>12</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>11</strong><br />
*<br />
Juliane Brach hat die wirtschaftliche Lage in Ägypten analysiert. Sie lässt eingangs<br />
den Finanzminister Kairos, Hazem al-Beblawy zu Wort kommen. Der wurde in der<br />
Tageszeitung Al-Masry al-Youm mit den Worten zitiert: „Wir erleiden keine Wirtschafts-,<br />
sondern eine Finanzkrise. Der Körper ist in Ordnung, er ist nur am verbluten“. Resümee der<br />
Autorin: „ Die politischen Akteure unterschätzen die Bedeutung der wirtschaftlichen<br />
Dimension und haben weder eine Vision noch ein Konzept für den wirtschaftlichen Wiederund<br />
Neuaufbau ihres Landes.“
Die Analyse von Juliane Brach finden Sie in GIGA-Focus Ausgabe 10-20<strong>11</strong>.