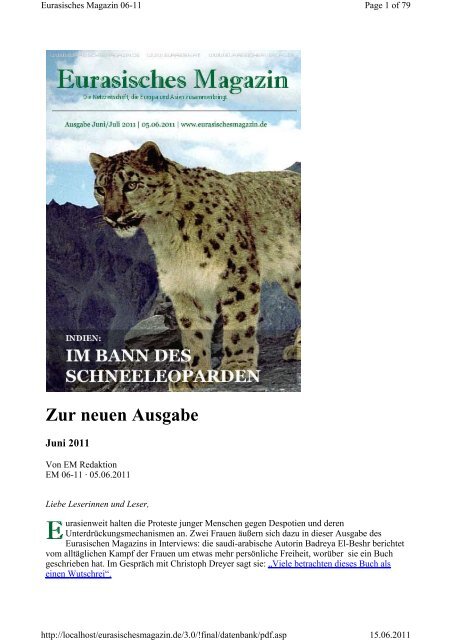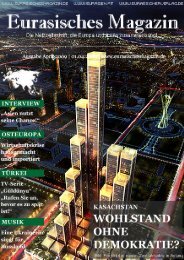Zur neuen Ausgabe - Eurasisches Magazin
Zur neuen Ausgabe - Eurasisches Magazin
Zur neuen Ausgabe - Eurasisches Magazin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 1 of 79<br />
15.06.2011<br />
<strong>Zur</strong> <strong>neuen</strong> <strong>Ausgabe</strong><br />
Juni 2011<br />
Von EM Redaktion<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
urasienweit halten die Proteste junger Menschen gegen Despotien und deren<br />
Unterdrückungsmechanismen an. Zwei Frauen äußern sich dazu in dieser <strong>Ausgabe</strong> des<br />
Eurasischen <strong>Magazin</strong>s in Interviews: die saudi-arabische Autorin Badreya El-Beshr berichtet<br />
vom alltäglichen Kampf der Frauen um etwas mehr persönliche Freiheit, worüber sie ein Buch<br />
geschrieben hat. Im Gespräch mit Christoph Dreyer sagt sie: „Viele betrachten dieses Buch als<br />
einen Wutschrei“.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 2 of 79<br />
15.06.2011<br />
Olga Karatsch, eine 32-Jährige aus Witebsk in Weißrussland, ist Vorsitzende der Bürgerinitiative<br />
„Nasch Dom“ (Unser Haus). In der Zeitung „Witebskij Kurier“, die sie herausgibt, prangern sie<br />
und ihre Mitstreiter das Fehlverhalten von Politikern und Beamten an. Sie selbst wurde in ihrem<br />
Leben bereits fünfzig Mal verhaftet. Im Gespräch mit Diana Laartz berichtet Olga Karatsch über<br />
Schläge während des Polizeiverhörs, die Schauprozesse gegen Oppositionelle, aber auch über<br />
neue Möglichkeiten für die vom „letzten Diktator Europas“ unterdrückte Opposition in ihrem<br />
Land: „Lukaschenko will, dass alle schweigen“.<br />
Aus Aserbaidschan, wo die Jugend ebenfalls gegen das allmächtige System rebelliert, berichtet<br />
Rail Safiyev. Allerdings sind dort erst zaghafte Anfänge zu erkennen. Sein Beitrag trägt die<br />
Überschrift: „Demokratiebemühungen bleiben auf der Strecke“.<br />
In dieser <strong>Ausgabe</strong> gibt es auch einen Bericht von der Verhaftung des serbischen Ex-Generals<br />
Ratko Mladic und einen Steckbrief des Gefassten: „Serbien hat Wort gehalten: Kriegsverbrecher<br />
Mladic gefasst“.<br />
Außerdem Beiträge über die Vorbereitungen auf Russlands Wahlen im Dezember. Ulrich Heyden<br />
berichtet dazu aus Moskau: Bei den Duma-Wahlen im Dezember will der Unternehmer Michail<br />
Prochorow eine liberale Klein-Partei zur drittstärksten Kraft in der Duma machen. „Drittreichster<br />
Oligarch geht in die Politik“. Und er informiert über die Gründung einer „Volksfront“ durch den<br />
Ministerpräsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin. Was hat das zu bedeuten? „Was<br />
will Putin mit einer Volksfront?“<br />
Exotisch und farbenfroh geht es zu in der Reportage von Thomas Bauer, der in Ladakh war, im<br />
äußersten Norden Indiens. Dort leben in unzugänglichen Bergregionen noch Schneeleoparden.<br />
Wie es gelang, einen davon in freier Wildbahn zu beobachten, erzählt diese Geschichte einer<br />
Suche im Himalaya: „Im Bann des Schneeleoparden“.<br />
Das EM-Team wünscht allen Lesern viele neue Erkenntnisse und Freude an den gewonnenen<br />
Einsichten.<br />
Eurasien-Ticker 6-2011<br />
Neue Anträge für China-Visum seit 1. Juni · Artenschutz in Kirgisien für<br />
weitere zehn Jahre gesichert · Erdgas: Deutschland führende Speichernation<br />
der EU · Stipendien für Elite-Programm in Asien · Kommission will<br />
Zusammenarbeit mit EU-Nachbarn verstärken · EU verbietet giftiges Metall<br />
Cadmium für Schmuck · Schnee in Samarkand – Ansichten aus dem<br />
Hinterland der Kriege · Neue Buchreihe editionBalkan im Dittrich Verlag ·<br />
Deutsches Theaterstück im Jugendtheater in Baku<br />
Von EM Redaktion<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Neue Anträge für China-Visum seit 1. Juni<br />
EM - Seit dem 1. Juni 2011 ist für Visaanträge zur Einreise nach China ein neues<br />
Antragsformular vorgeschrieben. Dieses kann bereits ab sofort auf der Webseite der Botschaft der<br />
VR China heruntergeladen werden: http://www.chinabotschaft.de/det/lsfw/P020110303806339434773.pdf
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 3 of 79<br />
15.06.2011<br />
Artenschutz in Kirgisien für weitere zehn Jahre gesichert<br />
EM – Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) und die kirgisische Regierung haben einen<br />
gemeinsamen Vertrag insbesondere zum Schutz des stark bedrohten Schneeleoparden<br />
unterzeichnet. NABU-Vizepräsident Thomas Tennhardt und der kirgisische Umweltminister<br />
Bijmyrsa Toktoraliev haben den Fortgang laufender Projekte für die kommenden zehn Jahre<br />
beschlossen. Dazu gehören die Anti-Wilderer-Einheit „Gruppa Bars“ zum Schutz von<br />
Schneeleoparden, das Rehabilitationszentrum „Schneeleopard“ und das Monitoring seltener<br />
Tierarten im Projektgebiet.<br />
Im kommenden Jahr soll außerdem ein vom NABU imitiertes internationales Forum zum<br />
Schneeleopardenschutz stattfinden. In Kirgisien begrüßt man die Initiative für eine gemeinsame<br />
Schneeleopardenkonferenz mit Vertretern aller verantwortlichen Staaten. Zum Verbreitungsgebiet<br />
der Großkatze gehören Zentralasien, der Himalaya, China und Russland. Der NABU betreibt seit<br />
über zehn Jahren Projekte zum Schutz der seltenen Großkatze in Kirgisien und konnte bereits<br />
einen Rückgang der Wilderei erzielen.<br />
Lesen Sie dazu auch die Reportage von Thomas Bauer „Im Bann des Schneeleoparden“ in dieser<br />
<strong>Ausgabe</strong>.<br />
Erdgas: Deutschland führende Speichernation der EU<br />
EM – Deutschland speichert am meisten Erdgas innerhalb der Europäischen Union. 2010 ist das<br />
Arbeitsgasvolumen um 0,5 Milliarden Kubikmeter auf 21,3 Milliarden Kubikmeter gestiegen. In<br />
den kommenden Jahren soll es um weitere 11,3 Milliarden Kubikmeter vergrößert werden, so das<br />
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in seinem kürzlich erschienenen Bericht<br />
„Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland 2010“.<br />
„Niedersachsen ist ein Energieland und die Energiedrehscheibe von Deutschland“, sagt Lothar<br />
Lohff, Präsident des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie. „Mit dem Ausbau der<br />
Speicherkapazitäten will die Industrie flexibler auf neue Marktentwicklungen und potenzielle<br />
Abhängigkeiten reagieren. Erdgasspeicher erfüllen eine klassische Pufferfunktion, um saisonale<br />
und tageszeitliche Verbrauchsschwankungen abzufangen. Zudem haben sie eine strategische<br />
Bedeutung für Krisenzeiten“, so Lohff.<br />
Weitere Informationen: http://bit.ly/l2gbIE<br />
Stipendien für Elite-Programm in Asien<br />
EM - An Auslandserfahrung führt kein Weg vorbei. Erste Berufserfahrungen sollte man da<br />
sammeln, wo die Wirtschaft große Dynamik entfaltet - in Asien. Seit mehr als 15 Jahren bietet die<br />
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH jungen Berufstätigen,<br />
Absolventen und Studierenden die Möglichkeit, in acht asiatischen Ländern praxisorientiert zu<br />
arbeiten. Das sechsmonatige Praktikum ermöglicht ihnen Einblicke in die fremden Wirtschaftsund<br />
Bildungssysteme und trägt zu globalem Denken und zur Mobilität bei.<br />
Rund 50 junge Deutsche können auch im nächsten Jahr wieder in China, Indien, Indonesien,<br />
Japan, Malaysia, Südkorea, Vietnam oder Taiwan diese wertvollen Qualifikationen erwerben.<br />
Sprachkurse in Deutschland und im Zielland sowie interkulturelle Seminare bereiten auf das<br />
Praktikum vor. Aus Mitteln der Heinz Nixdorf Stiftung erhalten die Teilnehmer darüber hinaus ein<br />
Stipendium zur Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten. Interessenten mit einer technischen oder<br />
kaufmännischen Hochschulbildung können sich online vom 1. Juni bis zum 30. September 2011<br />
bewerben.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 4 of 79<br />
15.06.2011<br />
Kontakt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Friedrich-Ebert-<br />
Allee 40, 53113 Bonn T + 49 228 4460-1293, www.giz.de/hnp<br />
Kommission will Zusammenarbeit mit EU-Nachbarn<br />
verstärken<br />
EM - Die EU-Kommission will die Nachbarstaaten der Europäischen Union, etwa in Nordafrika<br />
und Osteuropa, künftig noch stärker als bisher in ihrem Streben nach Demokratie, politischer<br />
Stabilität und wirtschaftlichem Wohlstand unterstützen. Die finanzielle Hilfe im Rahmen der<br />
Nachbarschaftspolitik soll um 1,24 Milliarden Euro auf rund sieben Milliarden Euro für die<br />
nächsten beiden Jahre aufgestockt werden. Dazu kommen noch Milliardenkredite durch die<br />
Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.<br />
Aber es gehe bei der <strong>neuen</strong> Nachbarschaftsstrategie, über die nun EU-Staaten und Europäisches<br />
Parlament beraten werden, um viel mehr als nur um Geld, sagte Kommissionspräsident José<br />
Manuel Barroso: „Es zeigt, wie ernst es uns ist, denen zu helfen, die politische Freiheit und eine<br />
bessere Zukunft anstreben.“<br />
<strong>Zur</strong> wirtschaftlichen Entwicklung sollen unter anderem Freihandelsabkommen,<br />
Kooperationsprogramme in bestimmten Branchen, Reiseerleichterungen und eine gesteuerte<br />
Migration von Arbeitskräften beitragen. Das nütze auch der EU, sagte Barroso.<br />
Informationen: http://bit.ly/mw2oBt<br />
EU verbietet giftiges Metall Cadmium für Schmuck<br />
EM - Das krebserregende und hochgiftige Metall Cadmium darf ab Dezember in der EU nicht<br />
mehr in Schmuck, PVC oder Lötstoffen enthalten sein. Vor allem in importiertem Modeschmuck<br />
seien wiederholt sehr hohe Cadmiumwerte festgestellt worden, begründete die Kommission das<br />
Verbot. Verbraucher nähmen den Schadstoff über die Haut auf und Kinder auch dadurch, dass sie<br />
das Metall ableckten.<br />
Schnee in Samarkand – Ansichten aus dem Hinterland der<br />
Kriege<br />
EM – Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin vom 23. Juni bis 12. September 2011<br />
zeigt Fotografien von Daniel Schwartz. Die Ausstellung konfrontiert mit brisanter Gegenwart. Sie<br />
führt nach Afghanistan und Zentralasien und zeigt Geschichte, Geografie und Gegenwart einer<br />
Region, die vom Kaspischen Meer bis über die Wüsten Westchinas hinausreicht und von<br />
Kasachstan im Norden bis Pakistan und Iran im Süden. Diese Region ist in den Nachrichten als<br />
Herd andauernder Kriege und latenter Konflikte präsent.<br />
Der international renommierte Schweizer Fotograf und Autor Daniel Schwartz untersucht in<br />
seinem Werk das geografisch heterogene und machtpolitisch komplexe Gebilde Zentralasien<br />
sowohl von innen her als auch aus europäischer, chinesischer und persisch-arabischer Perspektive.<br />
Die Vermittlerrolle Zentralasiens zwischen Ost und West reicht bis in die prähistorische Zeit<br />
zurück. Schon immer war sie ein entscheidender machtpolitischer Faktor. Und nicht erst seit dem<br />
Anschlag auf das World Trade Center am 09.11.2001 und der darauf folgenden militärischen<br />
Intervention in Afghanistan besitzt diese Region geostrategische und geo-ökonomische<br />
Bedeutung.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 5 of 79<br />
15.06.2011<br />
Der ausgestellte Werkzyklus entstand zwischen 1995 und 2007 in den fünf zentralasiatischen<br />
Republiken sowie in Afghanistan und den angrenzenden Regionen. Seit 14 Jahren bereist<br />
Schwartz dieses Gebiet und hat dabei ebenso betörende wie bestürzende Bilder geschaffen – etwa<br />
die zeitlos anmutende Aufnahme afghanischer Flüchtlinge aus dem Hungergebiet oder das Bild<br />
der iranischen Ruinenstadt Bam.<br />
Weitere Informationen: http://bit.ly/kiopxk<br />
Neue Buchreihe editionBalkan im Dittrich Verlag<br />
EM – Schon im letzten Herbst erschienen vier Romane aus Bulgarien in der <strong>neuen</strong> editionBalkan.<br />
Im März 2011 wurde die Reihe mit drei serbischen Autoren fortgesetzt. Ziel dieses ehrgeizigen<br />
Projekts ist es, zeitgenössische Literatur aus dem Balkan hierzulande zugänglich zu machen und<br />
die intelligenten, anspruchsvollen und melancholischen Texte aus Südosteuropa über die Grenzen<br />
des Balkans hinaus zu verbreiten.<br />
Die editionBalkan erscheint als Gemeinschaftsproduktion mit CULTURCONmedien und wird<br />
getragen von der S. Fischer Stiftung sowie traduki. Durch den Fokus auf Serbien bei der Leipziger<br />
Buchmesse war eine große Medienresonanz erzielt worden. Im September werden weitere<br />
Romane aus Bulgarien erscheinen.<br />
Weitere Informationen zur editionBalkan unter http://editionbalkan.twoday.net<br />
Deutsches Theaterstück im Jugendtheater in Baku<br />
EM – „Lauf mir nach, dass ich dich fange“ so hieß das Theaterstück, das Constanze Baruschke<br />
und Jörg Herwegh, als deutsche Gäste am 19. April 2011 vor dem voll besetzten Gənc<br />
Tamaşaçılar Teatrı (staatliches Jugendtheater) in Baku, Aserbaidschan aufgeführt haben. Dieses<br />
ironisch erotische Puzzle haben die beiden aus Texten von Shakespeare bis Goethe, und von<br />
Ringelnatz, Morgenstern, Erich Fried bis hin zu Robert Gernhardt zusammengestellt.<br />
Unter den Zuschauern waren viele Germanistikstudentinnen und eben Deutschkundige. Die Texte<br />
wurden aber mit Hilfe einer Simultanübersetzungsanlage auch den Deutschunkundigen per<br />
Kopfhörer umschrieben. Dafür war die Dolmetscherin Semira Kazimova zuständig.<br />
Es gab Szenenbeifall, was nach Aussage einer Gastprofessorin aus Berlin selten vorkommen<br />
würde. Theaterdirektor Hamidov war selbst zugegen. Er empfing die Schauspieler und sorgte für<br />
die Auszahlung einer Gage.<br />
Das Gastspiel der Schauspieler aus Rosenheim ist Teil eines sich entwickelnden Kulturaustauschs.<br />
Dazu gab es im Pantomimentheater schon einmal vier Kostproben. Vorgestellt wurde ein<br />
Schumannscher Liederzyklus, der vom 17. Oktober bis 23. Oktober in Rosenheim, Wasserburg<br />
und München aufgeführt werden soll. Der international bekannte Komponist Azimov überträgt<br />
den Klavierpart dieser Lieder auf zusätzlich drei Musikinstrumente. Die Lieder werden<br />
pantomimisch von einer Balletttänzerin und zwei Balletttänzern ausgedeutet. Es wird also eine<br />
ungewöhnliche Aufführung.<br />
Am dritten Tag des Aufenthaltes wurde den deutschen Gästen eine Ausstellung des Malers Eli<br />
Aga präsentiert. Der Künstler selbst führte durch sein Lebenswerk. Er lässt sich beim Malen, so<br />
verriet er, durch Musik von Beethoven inspirieren.<br />
EM-INTERVIEW
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 6 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Viele betrachten dieses Buch als einen<br />
Wutschrei“<br />
In ihrem Roman „Der Duft von Kaffee und Kardamom“ erzählt die saudiarabische<br />
Autorin Badreya El-Beshr vom alltäglichen Kampf der Frauen um<br />
etwas mehr persönliche Freiheit. Hier ein Gespräch mit der in Dubai lebenden<br />
Schriftstellerin und Kolumnistin.<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
<strong>Zur</strong> Person: Badreya El-Beshr<br />
Die saudi-arabische Schriftstellerin studierte Literatur- und Sozialwissenschaften an<br />
der König-Saud-Universität, Riad und der libanesischen Universität in Beirut. Sie<br />
arbeitet als Journalistin und schreibt literarische und sozialkritische Kolumnen für<br />
mehrere saudische Zeitungen, zurzeit hauptsächlich für die Tageszeitung „Al-Hayat“.<br />
urasisches <strong>Magazin</strong>: Hat es Sie überrascht, dass Ihr Buch in Saudi-Arabien überhaupt<br />
zugelassen wurde?<br />
Badreya El-Beshr: Ja, das war wirklich eine Überraschung. Aber unter dem jetzigen König<br />
Abdullah hat es einige Veränderungen in Saudi-Arabien gegeben, und man rechnete mit dem<br />
Beginn einer <strong>neuen</strong> Reformbewegung. Deshalb wurden einige Bücher genehmigt, wodurch auch<br />
mein Roman diese Chance bekam.<br />
EM: Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr Buch in der saudischen Öffentlichkeit?<br />
El-Beshr: Gegen das Buch wurden drei Vorwürfe erhoben. Erstens, dass es gegen den Islam<br />
verstoße, weil die Protagonistin einen Roman mit dem Titel „Jesus wird wieder gekreuzigt“ liest<br />
(während es laut dem Koran überhaupt nicht zur Kreuzigung kam, Anm. d. Red.). Zweitens dass<br />
ich jeden, der sich meinen lüsternen Wünschen widersetze, als Moralpolizei anprangere. Und<br />
drittens warf man mir vor, dass ich in dem Roman meine Mutter schlechtmache. Diese Kritiker<br />
halten das Buch nämlich für autobiografisch.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 7 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Es gibt die Liebe, aber wenn man darüber spricht, ist das<br />
ein Skandal“<br />
EM: Ist es nicht erstaunlich, dass sich die Kritik gerade daran festmacht und nicht daran, dass Sie<br />
zum Beispiel offen über sexuelle Belästigung sprechen oder sich über die Religionspolizei lustig<br />
machen?<br />
El-Beshr: Viele betrachten dieses Buch als einen Wutschrei. Aber das Problem liegt auch bei<br />
diesen konservativen Gesellschaften, die immer alles unter der Decke halten wollen. In solchen<br />
Gesellschaften ist alles ein Skandal, worüber man schreibt, sogar die Liebe. Mehr als die Hälfte<br />
der Frauen in Saudi-Arabien heiratet meines Erachtens aus Liebe: die junge Frau, die den<br />
Nachbarssohn liebt, die einen Cousin oder sonst einen Verwandten liebt. Es gibt die Liebe also,<br />
aber wenn man darüber spricht, ist das ein Skandal. Und genau das ist das Problem. Nicht was<br />
tatsächlich passiert, gilt als Skandal, sondern dass man darüber spricht.<br />
EM: Glauben Sie, dass die meisten Menschen in Saudi-Arabien ihre Sicht der Dinge teilen?<br />
El-Beshr: Ein Teil oder vielleicht die Hälfte meiner Generation stimmt mit mir überein, aber die<br />
nächste Generation wird das, was ich schreibe, schon banal finden. Für die Jugend von heute, die<br />
mit Satellitenfernsehen, Handys und Internet aufwächst, ist mein Roman wahrscheinlich nur noch<br />
eine Sammlung von Geschichten alter Frauen. Beziehungen zwischen jungen Männern und Frauen<br />
sind mittlerweile etwas ganz Normales geworden. Es ist sogar umgekehrt: Wer keine Beziehung<br />
hat, wird schon als rückständig betrachtet.<br />
„Es findet ein schneller Wandel statt“<br />
EM: Könnte man also sagen, dass das Buch die Kämpfe einer bestimmten Generation von Frauen<br />
beschreibt?<br />
El-Beshr: Meine Großmutter und meine Mutter sind nicht einmal zur Schule gegangen, während<br />
ich promovieren konnte. Das ist ein gewaltiger Sprung, da klafft eine Lücke zwischen den<br />
Generationen. Und dann gibt es einen weiteren Sprung zur Generation der Globalisierung, des<br />
Satellitenfernsehens und des Mobiltelefons. Es findet ein schneller Wandel statt, der ein Stück<br />
weit beunruhigend ist, der aber auch Fenster der Hoffnungen aufstößt. Von einem Beobachter der<br />
Revolution in Ägypten habe ich einen schönen Satz gehört: Die Jugend kann revoltieren, weil sie<br />
im Zeitalter des Internets genau wieß, was Freiheit bedeutet - anders als die Generation davor, die<br />
die Freiheit nicht gekannt hat.<br />
EM: Wie schwerwiegend sind die wütenden Reaktionen auf ihr Buch, von denen sie sprachen?<br />
El-Beshr: Eine andere Frau würde sich an meiner Stelle vielleicht bedrängt oder in Gefahr fühlen,<br />
aber für mich gehört das zum Beruf des Schreibens und der Veränderung dazu. Deshalb akzeptiere<br />
ich, dass viele das ablehnen, was ich schreibe, denn ich schaue einfach auf diejenigen, die es<br />
annehmen. Mir persönlich genügt es, wenn die Hälfte der Leute oder weniger als die Hälfte<br />
akzeptieren, was ich schreibe. Das ist doch schon etwas, finde ich.<br />
„Frauen haben mehr Mut, und mehr Wut“<br />
EM: Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Rolle von Frauen bei den Veränderungen in der<br />
saudischen Gesellschaft oder auch in anderen arabischen Gesellschaften?<br />
El-Beshr: Ich glaube, die Frauen leisten einen realen und aktiven Beitrag. Ihr Problem ist, dass sie<br />
in der zweiten Reihe bleiben müssen und nicht an vorderster Front stehen dürfen. Aber die Frauen
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 8 of 79<br />
15.06.2011<br />
haben mehr Mut, mehr Wut und ein genauso ausgeprägtes Bewusstsein. Wann immer Frauen<br />
heute die Chance bekommen, machen sie die schnelleren Fortschritte.<br />
EM: Ist das auch so, weil auf den Frauen mehr Druck lastet, weil sie mehr unter den<br />
Verhältnissen leiden?<br />
El-Beshr: Natürlich. Es gibt ein gemeinsames Leiden von Frauen und Männern, es mangelt<br />
insgesamt an Rechten. Aber es ist die Art von Druck, wie ihn die Frauen ertragen müssen, der<br />
diese Art von Ausbruch hervorbringt. Deshalb werden Frauen auch stärker die Initiative ergreifen.<br />
„Der Weg kann nur nach vorne gehen“<br />
EM: Wie wird die saudi-arabische Gesellschaft nach ihrer Einschätzung in fünf oder zehn Jahren<br />
aussehen?<br />
El-Beshr: Ich wieß nicht, wie weit unsere Fortschritte gehen werden. Aber der Weg kann nur<br />
nach vorne gehen. Es kann nicht rückwärtsgehen oder so bleiben wie bisher.<br />
EM: Wie schätzen Sie die politischen Ereignisse in Saudi-Arabien in letzter Zeit ein - zum<br />
Beispiel die Demonstrationen und die Petitionen an das Königshaus?<br />
El-Beshr: Ich glaube nicht, dass es eine Revolution geben wird. Aber es gibt einen starken Drang<br />
nach Veränderungen von innen. Doch niemand wieß, inwieweit dem entsprochen werden wird.<br />
EM: Aber irgendetwas wird sich ändern müssen?<br />
El-Beshr: Sicher, absolut - das muss einfach geschehen.<br />
EM: Frau El-Beshr, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch.<br />
Zuerst erschienen in Qantara.<br />
© Qantara.de 2011<br />
http://de.qantara.de/wcsite.php?wc_c=16183&wc_id=16417<br />
EM-INTERVIEW<br />
*<br />
Das Interview führte Christoph Dreyer<br />
„Lukaschenko will, dass alle schweigen“<br />
Sie sitzen in Käfigen vor Gericht: Oppositionelle in Weißrussland (Belarus),<br />
die wegen ihrer Proteste gegen die unfreie Präsidentenwahl im Dezember 2010<br />
protestiert hatten. Nach dem Anschlag auf die Minsker Metro gerieten weitere<br />
Bürgerrechtler ins Visier der Sicherheitsbehörden. Unter Ihnen auch Olga<br />
Karatsch. Die 32-Jährige aus Witebsk ist Vorsitzende der Bürgerinitiative<br />
„Nasch Dom“ (Unser Haus). In der Zeitung „Witebskij Kurier“, die Karatsch<br />
herausgibt, prangern sie und ihre Mitstreiter das Fehlverhalten von Politikern<br />
und Beamten an. Sie selbst wurde in ihrem Leben bereits fünfzig Mal<br />
verhaftet. Im Interview spricht Olga Karatsch über Schläge während des
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 9 of 79<br />
15.06.2011<br />
Polizeiverhörs, die Schauprozesse gegen Oppositionelle, aber auch über neue<br />
Möglichkeiten für die unterdrückte Opposition.<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
<strong>Zur</strong> Person: Olga Karatsch<br />
Olga Karatsch wurde 1979 im weißrussischen Wittebsk geboren. Sie ist freie<br />
Journalistin und leitet die Bürgerrechtsbewegung „Nasch Dom“ (Unser Haus) in<br />
Witebsk. Dabei handelt es sich eine der wenigen Nichtregierungsorganisationen in<br />
Weißrussland überhaupt. Sie informiert Bürger über ihre Rechte. Außerdem hilft sie<br />
bei Alltagsproblemen von hohen Mieten bis hin zur Trinkwasserqualität.<br />
Olga Karatsch gibt als freie Journalistin die unabhängige Zeitung „Witebskij Kurer“<br />
heraus. Sie ist Mitglied der weißrussischen Oppositionspartei „UCP“ und deren<br />
Vorsitzende in der Region Witebsk.<br />
urasisches <strong>Magazin</strong>: In Minsk stehen wieder Oppositionelle vor Gericht, unter ihnen auch<br />
der ehemalige Präsidentschaftskandidat Andrej Sannikow. Wegen des Aufrufs zu einer<br />
Großdemonstration nach der Wahl im Dezember wird ihm massive Störung der öffentlichen<br />
Ordnung vorgeworfen. Was glauben Sie, wie wird der Prozess enden?<br />
Olga Karatsch: Wie meistens mit einer Gefängnisstrafe. Ich rechne mit mehr als fünf Jahren.<br />
Und das nicht etwa, weil Sannikow ein so großer Held der Opposition wäre, sondern weil<br />
Lukaschenko immer die Schuld für Unruhen bei anderen sucht. Er ist ein sehr emotionaler<br />
Politiker. (Anmerkung der Redaktion: Inzwischen wurde wießrussische Oppositionsführer Andrej<br />
Sannikow wegen seiner Proteste zu fünf Jahren Haft verurteilt.)<br />
EM: Bei den Präsidentenwahlen etliche wurden auch andere Protestierer verhaftet. Im April<br />
kamen bei einem Bombenanschlag auf die Minsker Metro 14 Menschen ums Leben und die<br />
Sicherheitsbehörden nahmen die Bürgerrechtler ins Visier. Wie ist jetzt die Stimmung unter den<br />
Oppositionellen?<br />
Karatsch: Der endlose Strom der Verdächtigungen und Verhaftungen erzeugt natürlich eine<br />
gewisse Depression. Ich würde sagen, wir haben alte Möglichkeiten verloren, aber auch neue<br />
gewonnen.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 10 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Die Bevölkerung ist heute mehr bereit, uns zuzuhören“<br />
EM: Welche sind das?<br />
Karatsch: Die Menschen glauben Lukaschenko nicht mehr alles, sie schauen nach links und<br />
rechts, suchen Alternativen. Ja, es gibt ungeheure Repressalien, aber die Bevölkerung ist heute<br />
mehr bereit, uns zuzuhören.<br />
EM: Sie selbst wurden als Bürgerrechtlerin und als Herausgeberin einer oppositionellen Zeitung<br />
insgesamt 50 Mal verhaftet. Nach dem Anschlag auf die Minsker Metro gerieten Sie wieder ins<br />
Visier der Sicherheitsbehörden und wurden am 19. April festgenommen. Wie kam es dazu?<br />
Karatsch: Wir hatten uns in der Wohnung des bekannten Bürgerrechtlers Walerij Schtschukin<br />
getroffen, wo wir über eine neue Kampagne berieten. Es klingelte es an der Tür. Draußen standen<br />
zwei Polizisten und ein paar Männer in Zivil, so treten gewöhnlich die Leute vom Geheimdienst<br />
auf. Sie forderten uns auf, die Türen zu öffnen. Sie sagten, es handele sich um eine planmäßige<br />
Überprüfung der Pässe. So etwas gibt es in Belarus nicht, also haben wir nicht geöffnet.<br />
EM: Aber wenig später wurden sie dennoch festgenommen?<br />
Karatsch: Etwa nach 40 Minuten wollten Oleg und Pawel, zwei Männer unserer Gruppe,<br />
losfahren. Vor der Tür standen Polizisten. Sie sagten, die beiden müssten mitkommen. Oleg hat<br />
mich angerufen. Ich bin sofort heraus und habe gesagt, dass ich die beiden als Verteidigerin<br />
begleiten möchte, so wie es Artikel 62 unserer Verfassung garantiert. Uns wurde erklärt, wir<br />
würden verdächtigt, etwas mit dem Anschlag auf die Metro in Minsk zu tun zu haben.<br />
„Man brachte mich allein in ein Verhörzimmer. Dort wurde<br />
ich geschlagen“<br />
EM: Sie sind freiwillig mitgegangen?<br />
Karatsch: Ja, dass ich verhaftet worden bin, habe ich erst realisiert, als man mich allein in ein<br />
Verhörzimmer brachte und ich geschlagen wurde.<br />
EM: Wer hat Sie geschlagen?<br />
Karatsch: Ein Polizist sprang auf und beschimpfte mich aufs Übelste. Er drohte, dass er mich auf<br />
der Toilette vergewaltigen wird. Und dabei schlug er mich mit voller Kraft ins Gesicht. Ich stand<br />
vollkommen unter Schock. Umso mehr, weil er gar nichts von mir wissen wollte. Er wollte von<br />
mir kein Geständnis, dass ich den Anschlag auf die Metro begangen habe oder etwas Ähnliches.<br />
Er wollte nur meine Angst sehen.<br />
EM: Waren Sie allein mit dem Polizisten in einem Raum?<br />
Karatsch: Da waren noch sechs andere Männer. Sie haben gelacht, niemand hat etwas<br />
unternommen.<br />
EM: Wie ging es weiter?<br />
Karatsch: Am frühen Abend wurden wir alle in ein kleines Gefängnis gebracht. Wir hatten kein<br />
Essen, kein Wasser, es war bitterkalt, nur Beton, kein Schlafplatz. Dort haben wir die Nacht<br />
verbracht. Alle zwei Stunden kam ein Wärter vorbei und hat kontrolliert, dass wir nicht schlafen.<br />
Am nächsten Tag hat man uns ins Gericht gefahren. Das spottet eigentlich jeder Beschreibung.<br />
Alle meine Rechte waren schließlich verletzt worden. Ich wurde zu einer Geldstrafe von
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 11 of 79<br />
15.06.2011<br />
umgerechnet 160 Euro verurteilt. Die Männer mussten acht bis zehn Tage ins Gefängnis. Wir<br />
durften die Dokumente nicht einsehen, Zeugen gab es nicht.<br />
„Ich werde die Strafe nicht bezahlen. Wenn nötig, gehe ich<br />
damit bis zum Gerichtshof der UNO“<br />
EM: Wofür wurden Sie verurteilt, was stand im Urteil?<br />
Karatsch: Wir sollen die Polizisten vor Schtschukins Haus beschimpft und geschlagen haben.<br />
EM: Haben Sie die Geldstrafe bezahlt?<br />
Karatsch: Nein, und ich werde auch nicht bezahlen für etwas, das ich nicht getan habe. Wenn<br />
nötig, gehe ich damit bis zum Gerichtshof der UNO.<br />
EM: Glauben Sie, all das wäre auch ohne den Anschlag auf die Metro passiert?<br />
Karatsch: Die Anschuldigung, wir hätten etwas mit dem Anschlag zu tun, war nur ein Vorwand.<br />
Wir sind gegen den Bau eines Atomkraftwerkes. Man wollte einfach verhindern, dass wir an der<br />
Tschernobyl-Demonstration am 26. April teilnehmen.<br />
EM: In zwei offenen Briefen haben Sie Alexander Lukaschenko vorgeworfen, er habe zumindest<br />
vorher von dem Anschlag auf die Minsker Metro gewusst, wenn ihn nicht sogar geplant. Wie<br />
kommen Sie zu dieser Auffassung?<br />
Karatsch: Man muss einfach nur schauen, wem dieser Terrorakt hilft. Er bringt der Opposition<br />
überhaupt nichts, den einfachen Leuten auch nicht, das ist klar. Keine islamistische Gruppe hat<br />
sich zu dem Anschlag bekannt.<br />
„Wer Gerüchte über Lebensmittelknappheit und<br />
Währungskrise verbreitet, wird strafrechtlich verfolgt“<br />
EM: Was bringt Alexander Lukaschenko der Terrorakt?<br />
Karatsch: Er rechtfertigt damit zum Beispiel, dass Menschen, die Gerüchte über<br />
Lebensmittelknappheit und Währungskrise verbreiten, nun strafrechtlich verfolgt werden können.<br />
Im Namen des Anschlages schränkt er die Menschenrechte weiter ein. Er will, dass alle<br />
schweigen, und so seine Macht sichern.<br />
EM: Haben sie Beweise, dass Lukaschenko etwas mit dem Anschlag zu tun hat?<br />
Es mag sein, dass er ihn nicht persönlich befohlen hat. Vielleicht handelt es sich um einen<br />
Machtkampf innerhalb der staatlichen Strukturen. Dass der Anschlag von Lukaschenkos<br />
Anhängern geplant wurde, ist für mich eine unverrückbare Tatsache.<br />
EM: Frau Karatsch, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch.<br />
*<br />
Die Autorin ist Korrespondentin von n-ost. Das Netzwerk besteht aus über 50 Journalisten in ganz<br />
Osteuropa und berichtet regelmäßig für deutschsprachige Medien aus erster Hand zu allen<br />
Themenbereichen. Ziel von n-ost ist es, die Wahrnehmung der Länder Mittel- und Osteuropas in<br />
der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen unter www.n-ost.de.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 12 of 79<br />
15.06.2011<br />
Das Interview führte Diana Laartz<br />
RUSSLAND<br />
Was will Putin mit einer Volksfront?<br />
In Russland sinkt das Vertrauen in die Parteien. Nun soll eine „Volksfront“<br />
der Kreml-Partei „Einiges Russland“ <strong>neuen</strong> Schub geben.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
ie Gründung einer Volksfront durch den<br />
Ministerpräsidenten der Russischen Föderation, was<br />
hat das zu bedeuten? Selbst gestandene Kreml-<br />
Beobachter konnten sich die Sache nicht gleich erklären.<br />
Volksfronten hatte es zuletzt unter Gorbatschow gegeben,<br />
in der stürmischen Zeit der Perestroika. Doch von einer<br />
stürmischen Umbruchzeit ist im heutigen Russland nichts<br />
zu spüren. Wozu also der martialische Begriff?<br />
Nun ja, auch in Russland wissen die Polit-Technologen,<br />
dass Wahlen viel mit Gefühlen zu tun haben. Warum also<br />
nicht auf einen positiv besetzten Begriff aus der<br />
Gorbatschow-Zeit zurückgreifen?<br />
Nach Putins Plänen soll die Volkfront die Partei Einiges<br />
Russland bei den Duma-Wahlen unterstützen. Im<br />
Gegenzug sollen parteilose Volksfront-Unterstützer<br />
Listenplätze bei der Kreml-Partei bekommen. <strong>Zur</strong><br />
Teilnahme an der Volksfront lud der Premier den<br />
Unternehmerverband, die Gewerkschaften, Jugend-, Frauen<br />
- und Rentnerverbände ein. Insgesamt 40 Organisationen<br />
haben sich schon für die Teilnahme an dem <strong>neuen</strong> Bündnis<br />
angemeldet.<br />
Wortkarger Medwedew<br />
Information zu den Wahlen in<br />
Russland<br />
Im März 2012, also in weniger als<br />
einem Jahr, wird in Russland ein<br />
neuer Präsident gewählt. Doch ist<br />
noch immer nicht klar, ob<br />
Medwedew und Putin ins Rennen<br />
gehen und ob es möglicherweise<br />
noch einen dritten Kandidaten des<br />
Kremls geben wird. Medwedew tritt<br />
als Präsident immer selbstsicherer<br />
auf. Trotzdem sind viele Experten<br />
der Meinung, dass Putin nach wie<br />
vor der starke Mann in Russland sei.<br />
Wie die Pläne von Medwedew und<br />
Putin auch aussehen werden, es ist<br />
offensichtlich, dass sie die<br />
Entscheidung, wer für die<br />
Präsidentschaftswahlen kandidiert,<br />
versuchen bis zum letztmöglichen<br />
Zeitpunkt hinausschieben. Man<br />
möchte offenbar vermeiden, dass<br />
einer der beiden Hauptfiguren als<br />
„lahme Ente“ dasteht.<br />
Präsident Medwedew reagierte auf Putins Volksfront-Gründung zurückhaltend. Das Projekt<br />
bewege sich „im Rahmen des Wahlgesetzes“, meinte der Präsident. Konkurrenz sei jedoch<br />
„lebenswichtig für die politische Stabilität im Land“. Medwedews Chef-Berater Igor Jurgens vom<br />
Reform-Institut INSOR erklärte klipp und klar, die Volksfront-Gründung sei „Unsinn“.<br />
Auch Putins-Ex-Berater Gleb Pawlowski, der 1999 den Weg Putins zur Macht organisierte,<br />
kritisierte das Volksfront-Projekt. Pawlowski der kürzlich erklärte, er unterstützte den amtierenden<br />
Präsidenten, meinte „im System der Volksfront gibt es keinen Platz für Medwedew.“
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 13 of 79<br />
15.06.2011<br />
Ansehen der Parteien sinkt<br />
Den Grund für die Bildung der Volksfront sieht Pawlowski in dem Ansehensverlust der Parteien.<br />
Pawlowski meinte gegenüber der „Nesawisimaja Gazeta“, die Macht habe Angst, dass das<br />
„Parteimodell bei den Wahlen nicht funktioniert.“<br />
Bei den bei den Kommunalwahlen im März hat Einiges Russland seine Stimmenanteile zwar<br />
halten können und durchschnittlich 50 Prozent der Stimmen erreicht, aber es gab auch zahlreiche<br />
Meldungen über Manipulationen bei der Wahl und Verstöße gegen das Wahlgesetz. Selbst das<br />
führende Mitglied von Einiges Russland, Konstantin Kosatschow, zeigte sich besorgt über die<br />
Meldungen, dass von der Partei Druck auf die Wähler ausgeübt wurde. Die Wahlergebnisse<br />
spiegeln also nicht völlig die Stimmung in der Bevölkerung wieder.<br />
„Partei der Betrüger und Räuber“<br />
Nach einer Umfrage des Lewada-Meinungsforschungsinstituts sind 31 Prozent der Befragten<br />
sogar der Meinung, Einiges Russland sei „die Partei der Betrüger und Räuber“. Experten<br />
vermuten, die Menschen seien enttäuscht, dass sich die Überwindung der Wirtschaftskrise so<br />
lange hinzieht. Nach einer Meinungsumfrage des Lewada-Zentrums würden, wenn jetzt Duma-<br />
Wahlen stattfänden, nur 39 Prozent der Russen – im Vorjahr 46 Prozent -, die Kreml-Partei<br />
Einiges Russland wählen. Der Popularitätswert der Kommunisten stieg dagegen auf zwölf auf 18<br />
Prozent.<br />
Weiter im Tandem?<br />
Ex-Putin-Berater Pawlowski, meinte, die ideale Lösung für Russland sei, wenn Medwedew<br />
Präsident bleibe und von Putin unterstützt werde. Putin bleibe „Architekt unserer Macht“,<br />
Medwedew komme als jüngerem Politiker die Aufgabe zu, „die Unternehmerkreise und die<br />
Mittelschicht zu festigen“. Die russische Gesellschaft sei offener und bunter geworden und nicht<br />
mehr so „versessen“ auf Sicherheit wie 2000, als der Tschetschenienkrieg noch lief. Damals<br />
hatten die Bürger Putin vor allem deshalb zum Präsidenten gewählt, er Sicherheit und Ordnung<br />
versprach.<br />
BALKAN<br />
Serbien hat Wort gehalten: Kriegsverbrecher<br />
Mladic gefasst<br />
Zeit und Ort des Schlussakts: 5.30 Uhr am Morgen des 26. Mai in Lazarevo<br />
nördlich von Belgrad. Schwerbewaffnete Polizei- und Sicherheitskräfte<br />
stürmen den Bauernhof des 59-jährigen Branislav Mladic, ein Cousin des seit<br />
15 Jahren gesuchten Generals Ratko Mladic.<br />
Von Wolf Oschlies<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
ie Szene ist filmreif. Im Haus wird ein gewisser Milorad Komadic gefunden, alt und<br />
gebrechlich, wegen einer gelähmten Hand unfähig zum Ankleiden. Komadic zeigt einen seit<br />
1999 ungültigen Personalausweis vor, der auf Ratko Mladic ausgestellt ist. Und er fügt
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 14 of 79<br />
15.06.2011<br />
hinzu: „Ich bin der, den ihr sucht“. Bei seinem Bett werden zwei Pistolen gefunden, aber Mladic<br />
hat keine Anstalten gemacht, sie zu ergreifen, nach einem oder mehr Schlaganfällen ist er dazu<br />
nicht mehr fähig.<br />
Die Sicherheitsleute waren in fünf Jeeps angerückt und hatten sich um die Häuser von Branislav<br />
Mladic und seiner Söhne gruppiert. Gegen die und andere wurde Strafanzeige erstattet, und in<br />
Belgrad begann am 27. Mai ein Berufungsverfahren gegen zehn „Mladicevi jataci“ (Mladic-<br />
Helfer), dem allerdings nach der Dingfestmachung Mladics keine große Bedeutung mehr zukam.<br />
Mladic war noch im Laufe des 26. Mai von den Profis der serbischen „Sicherheits- und<br />
Informationsagentur“ ans „Sondergericht“ der Hautpstadt überstellt wurde. Dort informierte<br />
Bruno Vekaric, Stellvertreter des Chefanklägers gegen Kriegsverbrecher, dass Ratko Mladic wohl<br />
binnen einer Woche ans Haager Kriegsverbrecher-Tribunal (ICTY) überstellt werden könnte. Am<br />
Morgen des 27. Mai konnten Mladics Ehefrau und Sohn, Bosiljka und Darko, den Inhaftierten<br />
besuch, trafen ihn aber nicht an, da er gerade auf „setnja“ war, auf Freigang.<br />
„Ein Stigma wurde Serbien genommen“<br />
Am Vormittag des 26. Mai hatte Staatspräsident Boris Tadic auf einer außerordentlichen<br />
Pressekonferenz das Ereignis bekannt gemacht, den Häschern vom „Aktionsteam des nationalen<br />
Sicherheitsrates“ gratuliert und weitere Aktionen angekündigt. Noch steht die Verhaftung des<br />
letzten großen Kriegsverbrechers aus, Goran Handzic, der seinerzeit als Präsident der<br />
sezessionistischen „Republik Serbische Krajina“ in Kroatien schwere Verbrechen zu verantworten<br />
hat. Und es werden intensive Untersuchungen in staatlichen Institutionen Serbiens folgen, in<br />
denen ungezählte Unterstützer Mladics vermutet werden.<br />
Zunächst aber überwog die Erleichterung: „Skinuta ljaga sa Srbije“, seufzte Tadic erleichtert: Ein<br />
Stigma wurde von Serbien genommen. Dazu kamen zahllose Glückwünsche: EU-<br />
Erweiterungskommissar Stefan Füle, EU-Außenrepräsentatin Catherine Ashton, ICTY-<br />
Chefankläger Serge Brammertz, Europarats-Generalsekretär Thorbjørn Jagland, UN-<br />
Greneralsekretär Ban Ki-moon, EU-Präside José Manuel Barroso, Frankreichs Präsident Nicolas<br />
Sarkozy und ungezählte weitere gratulierten den Serben, immer im Tonfall dessen, was Tadic<br />
gesagt und der slowenische Premier Borut Pahor und viele andere wiederholt hatten: „Die<br />
Verhaftung von Mladic ist ein Schritt zur Versöhnung in dieser Region Europas!“<br />
Gefragteste Person bei Belgrader Medien war die Journalistin Ljiljana Smailovic, langjährige<br />
Berichterstatterin aus dem Haag. Sie begrüßte die Verhaftung, der nun bald „die Anberaumung<br />
eines Termins für den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen“ folgen könnte. Dass Mladic wegen<br />
„Völkermord“ verurteilt werde, bezweifelte sie, denn für einen so schwer zu definierenden und zu<br />
bestimmenden Tatbestand ist vom ICTY noch nie jemand verurteilt worden, da sich immer<br />
genügende andere Strafgründe fanden. Unbeeindruckt zeigte sie sich von den Resultaten einer<br />
Blitzumfrage, nach der die Mehrheit der Bürger Serbiens und der Republika Srpska in Bosnien<br />
gegen die Verhaftung Mladics sei. Das sei nicht ernst zu nehmen, sagte Frau Smailovic, „denn es<br />
besteht sehr wohl ein Bewusstsein seiner Verantwortung für Verbrechen“.<br />
Berlin: Gegen Serbien, für kroatische Kriegsverbrecher<br />
Irgendwann am 26. Mai kam auch eine lustlose Reaktion aus Berlin, was die Serben nicht anders<br />
erwartet hatten. Frau Merkel hat seit Monaten postuliert, man solle schleunigst Kroatien in die EU<br />
aufnehmen und dann den Brüsseler Laden dichtmachen. Diesen Verrat an dem EU-Credo, die<br />
„europäische Perspektive stehe allen offen“, hat man in Brüssel peinlich berührt überhört, und<br />
inzwischen stehen die deutsche Kanzlerin und ihr Hätschelkind Kroatien ziemlich belämmert da:<br />
Serbien ist plötzlich ein seriöser EU-Bewerber, der mit aller Berechtigung seine Wiedereinsetzung
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 15 of 79<br />
15.06.2011<br />
in bestätigte EU-Ansprüche gefordert, nachdem Brüssel diese Mladics wegen „auf Eis gelegt“<br />
hatte.<br />
Was hingegen das überschuldete, ökonomisch nahezu bankrotte und chauvinistisch verhetzte<br />
Kroatien betrifft, so urteilte dieser Tage die regierungsnahe Berliner „Stiftung Wissenschaft und<br />
Politik“, Kroatiens eventueller „verfrühter EU-Beitritt würde dem Land, den anderen Kandidaten<br />
und der EU schaden“. Berlin und Zagreb haben am 26. Mai kaum verhehlt, dass ihnen ein Serbien<br />
in EU-Ächtung lieber gewesen wäre. Kroatiens Präsident Ivo Josipovic mahnte sofort am 26. Mai<br />
an, man müsse Serbien wegen weiter Opfer, „besonders“ kroatischer, zur Rechenschaft ziehen.<br />
Wo lebt der? Brüssel rechnet Kroatien derzeit alte Sünden von 1995 vor, Vertreibungen von<br />
Serben, Kriegsverbrechen und Defizite beim Schutz von Menschenrechten. Das ICTY hat am 15.<br />
April den „kroatischen Patrioten und Helden“ Ante Gotovina und weitere kroatische Killer zu 24<br />
Jahren Haft verurteilt. Daraufhin zündeten Kroaten die Fahnen von EU-Ländern an und die<br />
kroatische Zustimmung zur EU fiel auf 23 Prozent. Wer auf solche Fakten verweist, sieht sich von<br />
der deutschen EP-Abgeordneten Doris Pack, einer notorischen Serbenhasserin, als „Feind<br />
Kroatiens“ denunziert.<br />
Moralisch sind diese Typen alle gleich verwerflich<br />
Sagen wir es so: Mladic ist das serbische Exemplar des menschlichen und militärischen<br />
Abschaums, der auf dem West-Balkan seit über anderthalb Jahrzehnten sein Unwesen treibt. Der<br />
serbische Kriegsverbrecher Mladic ist ein „Bruder im Geiste“ von Verbrechern wie dem<br />
kroatischen General Slobodan Praljak, dem kosovarischen Schlächter Hashim Thaci und<br />
Dutzenden anderer. Moralisch sind diese Typen alle gleich verwerflich. Differenziert ist allein der<br />
Umgang aktueller politischer Führungen mit ihnen: Serbien jagt seit 2000 die Verbrecher und<br />
liefert sie aus, Kroatien umgibt sie mit hysterisch-heroischem Massenwahn, im Kosovo sitzen sie<br />
in der Regierung, nachdem sie alle potentiellen Belastungszeugen beseitigten.<br />
Ratko Mladic: Steckbrief eines Verbrechers<br />
Vor einem Jahr haben Bosiljka und Darko Mladic, Ehefrau und Sohn von Ratko Mladic, beim 1.<br />
Amtsgericht Belgrad eine amtliche Todeserklärung für den flüchtigen General verlangt, von dem<br />
sie „sieben Jahre lang nichts gesehen oder gehört hatten“. Das war ein Trick der Familie, den ihr<br />
niemand abnahm. Vielmehr fand und beschlagnahmte die Polizei bereits Ende Februar 2010 bei<br />
einer Hausdurchsuchung eine große Geldsumme, da es sich allem Anschein nach um Hilfsmittel<br />
für Mladic handelte.<br />
Darauf verklagten Mutter und Sohn Mladic die Republik Serbien wegen Diebstahls, ein weiteres<br />
Verfahren strengte Schwiegertochter Biljana an, weil sie „widerrechtlich“ von ihrem Arbeitgeber<br />
Telekom gefeuert worden war. Die Familie macht sich seit Jahren über die Behörden lustig. Bei<br />
Bosilka Mladic wurden Anfang Juni 2010 Waffen aus dem Besitz ihres Mannes gefunden,<br />
weswegen ein Strafverfahren gegen sie läuft. Sohn Darko besitzt eine Firma und finanziert mit<br />
seinen Partnern, den Gebrüdern Vujic, größte Fensterhersteller Serbiens, die Flucht seines Vaters.<br />
In den bosnischen Orten Vojkovici und Kasindol leben weitere Verwandte Mladics, die ihn<br />
mehrfach beherbergten. Das Nachsehen hatten stets internationale Fahnder, die im Laufe der Jahre<br />
Mladic mindestens sechsmal dicht auf den Fersen waren, aber immer zu spät kamen.<br />
Wer ist überhaupt dieser Ratko Mladic, der vom Haager ICTY des Völkermords, der Verbrechen<br />
gegen die Menschlichkeit, schwerer Verstöße gegen die Genfer Konvention und weiterer Untaten<br />
angeklagt ist?<br />
Er wurde am 12. März 1943 in dem winzigen Flecken Bozanovici – 1991: 66 Einwohner – im<br />
Südosten der bosnischen Republika Srpska geboren. Nach der Grundschule erlernte er den Beruf
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 16 of 79<br />
15.06.2011<br />
eines Drehers und war in dem Metallwerk „Tito“ tätig, das später ein Partner von Volkswagen<br />
Sarajevo war. Anfang der 1960er Jahre entschied er sich für eine militärische Laufbahn und<br />
besuchte in Belgrad eine „Militärindustrielle Schule“, danach eine „Kommandeurs- und<br />
Stabsakademie“, die er als Jahrgangsbester beendete. 1965 bis 1991 war er als Offizier der<br />
Jugoslawischen Volksarmee (JNA) in Makedonien, im Kosovo und in Kroatien aktiv. 1991 wurde<br />
er Kommandant der 9. Armee im kroatischen Knin, 1992 beförderte man ihn zum Generaloberst<br />
und machte ihn zum Stabschef des 2. Wehrbezirks in Sarajevo. Im Mai 1992 wurde er oberster<br />
Militär der Republika Srpska in Bosnien und blieb bis 1996 auf diesem Posten.<br />
Die unvollständige Geschichte von Srebrenica<br />
In diesen Jahren soll er Kriegsverbrechen begangen oder solche seiner Untergebenen toleriert<br />
haben, etwa wiederholte Geiselnahmen bei ausländischen Einheiten oder die 44 Monate währende<br />
Belagerung und Beschießung Sarajevos und die schwerste Untat im Juli 1995, als Mladics<br />
Soldaten die Stadt Srebrenica angriffen und dort etwa 7.000 muslimische Männer umbrachten.<br />
So wird es seit anderthalb Jahrzehnten geschildert, aber die Schilderung ist unvollständig: Vor den<br />
Serben haben in der Region Srebrenica muslimische „Milizen“ unter Naser Oric in serbischen<br />
Dörfern gewütet, und als die Serben angriffen, befanden sich niederländische „Blauhelme“ in der<br />
Stadt, die tatenlos verharrten. Dazu hat später das Niederländische Institut für<br />
Kriegsdokumentation (NIOD) im Regierungsauftrag einen akribischen Bericht veröffentlicht, der<br />
aber nur vage Angaben zu einem „Massenmord an Tausenden Muslimen“ (massamoord op<br />
duizenden Moslimannen) macht. Serbien hat offiziell eingeräumt, dass Mladic und seine Soldaten,<br />
die alle von Belgrad besoldet und bewaffnet wurden, schwere Verbrechen begangen haben. Dabei<br />
hat es auch die international kolportierte Opferzahl von 7.000 akzeptiert, obwohl diese nie<br />
bestätigt worden ist.<br />
Karadzic und Mladic: schlechte Politiker und feige Militärs<br />
Aber wie viele es auch immer waren – in Srebrenica sind Muslime ermordet worden, von Mladics<br />
Soldateska, wofür er nach dem Rechtsgrundsatz des „command responsibility“ verantwortlich ist.<br />
Er und sein politischer Chef Radovan Karadzic waren schlechte Politiker und „feige“ Militärs (so<br />
1997 die Belgrader „Vreme“), die zur Taktik der verbrannten Erde übergingen, als sie ihre<br />
Vorhaben scheitern sahen. Mladic ließ in seinem Herrschaftsbereich KZs einrichten, Karadzic<br />
zwang nach dem Friedensabkommen von Dayton (November 1995) 50.000 Serben zum Exodus<br />
aus Sarajevo, und beide wurden samt ihrer Machtclique im August 1994 von Belgrad fallen<br />
gelassen. Im Juli 1995 klagte das Haager ICTY beide des Völkermords an, ein Jahr später begann<br />
im Haag ein Prozess gegen sie und daheim wurden sie von der <strong>neuen</strong> „Herrin“, der couragierten<br />
Biljana Plavsic, aus allen Machtpositionen gefeuert.<br />
Zu diesem Zeitpunkt war Mladics Glückssträhne längst abgerissen. 1994 beging seine Tochter<br />
Ana, eine 23-jährige Medizinstudentin, Selbstmord mit seiner Dienstpistole. Seit 1996 war er auf<br />
der Flucht, 1997 endete offiziell seine Offizierslaufbahn, obwohl der damalige Präsident Vojislav<br />
Kostunica noch bis 2002 zu ihm hielt. Ab November 2005 wurde es „eng“ um ihn: Seine Pension<br />
durfte nicht mehr ausgezahlt werden, seine Konten waren (wie die aller flüchtigen ICTY-<br />
Angeklagten) gesperrt. 2006 zerschlug die Polizei bei einer massiven Aktion das Netz seiner<br />
„jataci“. Gleichzeitig erlitt er den ersten Schlaganfall, wozu Nieren-, Herz- und Magenprobleme<br />
kamen, die alle konstante ärztliche Aufsicht erforderten. Dennoch ist Mladic heute bei weitem<br />
nicht so hinfällig, wie er, seine Familie und sein Anwalt MiLos Saljic vorgeben.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 17 of 79<br />
15.06.2011<br />
Übeltäter mit Rentenberechtigung<br />
Carla del Ponte, frühere ICTY-Chefanklägerin, ist darüber fast wahnsinnig geworden: Mindestens<br />
zehnmal hat Belgrad die vom ICTY gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher aufgefordert, sich<br />
freiwillig zu stellen, und ebenso oft hat es dementiert, dass Mladic sich in Serbien oder sogar in<br />
Belgrad aufhielte. Dabei war es kaum ein Geheimnis, dass Mladic lange Jahre in seinem Haus in<br />
der Blagoja Parovic-Straße im Stadtteil Banovo Brdo lebte, häufig bei Wettkämpfen seines<br />
geliebten Fußballvereins „Crvena zvezda“ (Roter Stern) zugegen war und nicht selten in<br />
exklusiven Belgrader Restaurants gesehen wurde. Später hat er sich dann in Kasernen der<br />
Milosevic-Armee versteckt, was erst endete, als 2002 Boris Tadic Verteidigungsminister des<br />
„Staatenbundes Serbien-Montenegro“ (SCG) wurde. Ab Mai 2002 ist Mladic fast ganz aus dem<br />
Gesichtskreis von Armee, Polizei und Sicherheitsdiensten verschwunden.<br />
Nur der „Fonds für soziale Sicherung der Soldaten des Verteidigungsministeriums“ (SOVO) hatte<br />
noch Kontakt zu ihm, da er ihm von Februar 2002 bis Dezember 2005 seine Pension von 70.000<br />
Dinar (RSD) monatlich auszahlte. Ende 2005 stoppte Verteidigungsminister Zoran Stankovic die<br />
Auszahlung. Mittlerweile schuldet die Regierung dem Ex-General 4,45 Mio. Dinar (100 RSD = 1<br />
€) aufgelaufene Pensionen.<br />
Die Regierung stellt andere Rechnungen auf. Danach verliert jeder Bürger Serbiens seit Jahren<br />
monatlich 159 Euro, weil Mladic nicht gefasst wurde, was Serbien als Land hinstellte, das für<br />
Kriminelle attraktiv, für ausländische Investoren aber abschreckend ist. Weil Mladics wegen<br />
Serbiens Beitritt zu EU blockiert war, verzeichnete das Land pro Jahr 1,2 Milliarden Euro<br />
entgangener Hilfen und Zahlungen.<br />
Solange Mladic nicht gefasst war, bewies Serbien nach Ansicht Brüssels ungenügende<br />
Kopperation mit dem ICTY und erfüllte somit eine wesentliche Voraussetzung für den EU-Beitritt<br />
nicht. Darunter litt am meisten Rasim Ljajic, Vorsitzender des „Nationalrats für Zusammenarbeit<br />
mit dem Haager Tribunal“ und ein makelloser Demokrat. Auch er konnte die schlechte Meinung<br />
Brüssels nicht ändern, dabei hat Serbien spätestens seit August 2008, als der „Nationalrat für<br />
Sicherheit“ geschaffen wurde, unausgesetzt Mladic gejagt – sagte Präsident Tadic auf seiner<br />
Pressekonferenz am 26. Mai. 10.000 Verfolger waren Tag für Tag aktiv, was bis zu 12 Millionen<br />
Euro jährlich kostete. Damit nicht genug, hat es laufend die Belohnungen für die Ergreifung<br />
Mladics heraufgesetzt, von 1 Million Euro im Oktober 2007 auf 10 Millionen im Oktober 2010.<br />
Und die werden vermutlich nie ausgezahlt werden müssen, da die staatlichen Sicherheitsorgane<br />
Mladic ohne Hinweise der Öffentlichkeit fassten – was dessen „jataci“ als Beweis für den<br />
„Patriotismus“ der Serben, die sich nicht durch Geld „kaufen“ lassen, interpretierten.<br />
Serbien: Alte Bedingungen erfüllt – neue Erpressungen<br />
eingehandelt?<br />
Zoran Dragisic, Professor für Sicherheitspolitik in Belgrad, ist überzeugt, dass die Regierung seit<br />
langem wusste, wo sich Mladic aufhielt und wann sie ihn greifen könnte. So etwas hört man in<br />
Regierungskreisen nicht gern, dabei dürfte es zutreffen, zumal nicht nur Dragisic dieser Meinung<br />
ist.<br />
Es ist vermutlich so, dass Belgrad nach 12 Jahren Betrug und Erpressung durch die EU meint, die<br />
EU hätte eine serbische Lektion verdient, damit sie nicht auf die Idee kommt, Neuauflagen alter<br />
Spielchen zu inszenieren.<br />
Es begann im Herbst 1999, als Bodo Hombach, damals Chef des Stabilitätspakts Südosteuropa,<br />
den Serben „noch dieses Jahr 4 Milliarden Mark“ versprach, wenn sie Milosevic abwählten. Das<br />
hätten sie auch ohne dieses Versprechen getan, und als sie es taten, gab es natürlich keinen<br />
Pfennig dafür. Wie auch nichts von den Dollar-Miliarden in Belgrad eintraf, die man den Serben
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 18 of 79<br />
15.06.2011<br />
für die Auslieferung Milosevics zugesagt hatte. Statt geleistete Versprechen einzulösen, stellte die<br />
EU immer neue Bedingungen in immer drohenderem Tonfall, etwa die nach der Verhaftung von<br />
Radovan Karadzic. Als diese am 21. Juli 2008 erfolgte, machte man in Brüssel „Freudensprünge“,<br />
um dann umgehend neue Pressionen zu präsentieren: Bevor Serbien an einen EU-Beitritt denken<br />
könne, müsse es erst enger mit dem ICTY kooperieren und zum Zeichen dessen Mladic greifen<br />
und ausliefern.<br />
Das ist nun am 26. Mai auch geschehen. Wie es jetzt weitergehen soll, haben bekannte<br />
Serbenhasser und Brachialschwätzer längst angekündigt. Um nur einmal die abschreckendsten<br />
Beispiele zu zitieren:<br />
• Albert Rohen (Österreich, Frühjahr 2008): „Serbien (hat) durch die systematischen und<br />
massiven Menschenrechtsverletzungen in den neunziger Jahren das Recht auf Herrschaft im<br />
Kosovo verwirkt“, muss also kosovarische „Unabhängigkeit“ anerkennen, wenn es in Europa<br />
noch angesehen werden will.<br />
• Ursula Plassnik (Außenministerin Österreichs, Sommer 2008): „Wir erwarten nicht, dass<br />
Serbien in nächster Zukunft das Kosovo anerkennt. Dennoch muss klar sein, dass ein Staat, der die<br />
europäische Integration für eine seiner fundamentalen Prioritäten ansieht, sich keine Einstellung<br />
erlauben kann, die in diametralem Widerspruch zur Politik der EU steht“. Also stehen wohl auch<br />
fünf EU-Länder – Rumänien, Zypern, Griechenland, Slowakei und Spanien –, die das<br />
„unabhängige“ Kosovo nicht anerkennt haben und es vermutlich nie anerkennen werden, „im<br />
Widerspruch zur Politik der EU“.<br />
• Doris Pack (deutsche EP-Abgeordnete, Oktober 2009): „Kein EU-Beitritt für Serbien ohne<br />
Lösung des Problems mit dem Kosovo“. Und analog kein EU-Beitritt für Tschechien ohne<br />
Anerkennung des Münchner Abkommens von 1938 (das sich in nichts von der Kosovo-<br />
Unabhängigkeit vom Februar 2008 unterscheidet)?<br />
• Guido Westerwelle (deutscher Außenminister, August 2010): „Serbien (kann) nur dann mit<br />
einer Aufnahme in die EU rechnen, wenn es sich mit der Unabhängigkeit des Kosovo abfindet“.<br />
Beim Pokern verliert der, der zuerst blinzelt<br />
Und so weiter: Prominente oder Hinterbänkler fühlten sich berufen, Serbien Vorschriften zu<br />
machen und Strafen anzudrohen, falls es nicht pariert. Serbien hat sich wenig darum gekümmert,<br />
auf die Unvereinbarkeit von EU-Positionen vertrauend: Kosovarische „Unabhängigkeit“ plus UN-<br />
Resolution 1244, die das Kosovo als integralen Bestandteil Serbiens definiert. Die Kosovaren<br />
selber sind schon erheblich weiter, wie EU-Außenrepräsentantin Ashton am 27. Mai von<br />
Vizepremierin Edita Tahiri erfuhr: Das Kosovo muss sofort den Kandidatenstatus erhalten, weil es<br />
„nicht durch eigene Schuld“ in vielen Fragen verspätet ist.<br />
Beim Pokern verliert der, der zuerst blinzelt. Belgrads Außenminister Vuk Jeremic, im Zivilberuf<br />
Mathematiker, ist ein eiskalter Pokerspieler, der mit der Verhaftung Mladics bis zur letzten<br />
Minute wartete, als Brüssel bereits überlegte, ob es mit seinen Erpressungen nicht zu weit<br />
gegangen sei. Damit obsiegte er. Am 20. Mai war EU-Präside Barroso in Belgrad, wo er nach<br />
Gesprächen mit Präsident Tadic die Fraktion Pack, Westerwelle & Co. Lügen strafte: „Ich<br />
bestätige, dass weder der Prozess der Verhandlungen zwischen Belgrad und Prishtina noch die<br />
Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo von Belgrad Bedingung gestellt werden“. Noch<br />
Fragen?
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 19 of 79<br />
15.06.2011<br />
In Russland kennt man seine Brüsseler Pappenheimer<br />
EU in die Schranken gewiesen, Russland einmal fest an die eigene Seite geholt. Moskau nutzt<br />
jetzt die Verhaftung Mladics, um einige Dinge klarzustellen. Michail Margelov, Chef des<br />
Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat, sieht Brüssel der Lüge überführt: Es<br />
werde Serbien hintergehen oder hinhalten, weil es überhaupt keine „Neulinge“ vom Balkan<br />
wünscht. Konstantin Kosacov, Chef des Auswärtigen Ausschusses der Duma, erklärte der EU und<br />
anderem, dass Russland nicht der „Advokat“ des „Ex-Generals Mladic“ sein wolle, aber einen<br />
fairen Prozess verlange und keine endlose Verlängerung des faktisch ausgelaufenen ICTY-<br />
Mandats wünsche.<br />
Russland will Fakten und Termine, im Umgang mit Mladic, aber auch mit Untätern wie Hashim<br />
Thaci aus dem Kosovo, deren Verbrechen der Schweizer Anwalt Dick Marty zu Jahresende 2010<br />
im Auftrag des Europarats bloßgelegt hat. „Die internationale Gemeinschaft hat schon aus<br />
geringerem Anlass Strafverfahren gestartet. In diesen Fragen darf es keine doppelten Standards<br />
geben“, verlangte Moskaus Außenminister Sergej Lavrov, der offenkundig seine Brüsseler<br />
Pappenheimer kennt.<br />
ASERBAIDSCHAN<br />
Demokratiebemühungen bleiben auf der<br />
Strecke<br />
Dass Aserbaidschan nicht als ein von der „Arabellion“ erfasstes Land in die<br />
Schlagzeilen der europäischen Medienberichte gelangte, ist nicht<br />
verwunderlich: Es gab keine Toten, keine Schusswechsel, keine Scharfschützen<br />
und keinen Regierungswechsel. Dennoch kann man das dortige politische<br />
Klima als von scharfen Gegensätzen erfüllt betrachten. Die Lage bleibt<br />
weiterhin angespannt.<br />
Von Rail Safiyev<br />
EM 06-11 · 05.06.2011
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 20 of 79<br />
15.06.2011<br />
Allgegenwärtiger Präsident: Riesige Plakate mit dem Porträt des Staatsoberhauptes<br />
Ilham Aliyev „zieren“ selbst die Schaufenster der Geschäfte, wie hier in der<br />
Hauptstadt Baku. „Vorwärts mit Ilham“ (Ilhamla Ireli) lautet der simple Text auf dem<br />
Bild. Foto: Rail Safiyev<br />
s war überraschend, dass den Anstoß zu den jüngsten Protesten diesmal nicht die Länder des<br />
postsowjetischen Raums gegeben haben, sondern die bis vor einigen Jahrzehnten in<br />
Aserbaidschan als fremdes Ausland angesehene arabisch-islamische Welt.<br />
Die Ähnlichkeiten mit Tunesien, Ägypten, Syrien und dem Jemen fallen ins Auge, wenn man<br />
bedenkt, dass, ähnlich wie in Nordafrika und in den Ländern des Nahen Ostens, die Gesellschaft<br />
in Aserbaidschan stark polarisiert ist, zwischen wenigen Reichen und der verarmenden Mehrheit.<br />
Aserbaidschan ist ein Land in dem kaum eine staatliche Dienstleistung ohne Schmiergelder<br />
geboten wird. Die Zivilgesellschaft ist bis auf ihr Existenzminimum geschrumpft. In die versuchte<br />
politische Teilhabe wird mit dem Knüppel dreingeschlagen. Ähnlich wie in Baschar Al-Assad's<br />
Syrien bestieg der Sohn Ilham Alijews unmittelbar nach dem Tod seines Vaters den<br />
Präsidententhron. Das war die Möglichkeit für die Sippenmitglieder, sich den Ölreichtum des<br />
Landes einzuverleiben.<br />
Den langsam anschwellenden Unmut in der Bevölkerung hat das diktatorisch geführte Regime<br />
selbst mitverschuldet. Die im Fernsehen täglich laufende Warnpropaganda über<br />
menschenfeindliche Wirkungen des Internets und sozialer Netzwerke, die vermeintlich von<br />
fremden, feindseligen Mächten ferngesteuert werden, um die unbeschwerte Ruhe der Bevölkerung<br />
in Aserbaidschan zu stören, erzeugte eine Gegenwirkung. Bald schlug diese ständige staatliche<br />
Kritik an den <strong>neuen</strong> Medien in Widerstand gegen das Regime um, dessen Angst vor einer einzigen<br />
kleinen Manifestation des freien Willens von Menschen ganz offensichtlich wurde.<br />
Der 2003 verstorbene Heydar Aliyev, Vater des jetzigen Staatsoberhauptes, grüßt<br />
noch immer von Plakaten. Nach ihm ist auch der Flughafen der Hauptstadt Baku<br />
benannt.<br />
Foto: Andrea Weiss
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 21 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Korruptionsbekämpfung“ als Beruhigungsmittel - der<br />
Sumpf bleibt<br />
Zu Beginn der Protest in Aserbaidschan glich die Besorgnis der politischen Elite einer<br />
apokalyptischen Angst. Man konnte dies an der plötzlichen Verkündung eines<br />
Antikorruptionskampfes erkennen. Die Ursachen für den Schmiergeldsumpf schob der Präsident<br />
seinem Beamtenstab zu. Die „unerwünschten Elemente“ hätten bei der Ausübung ihrer Dienste<br />
ein schlechtes Licht auf die Erfolge der „an sich reformorientierten und erfolgreichen“ Regierung<br />
geworfen. Diese rein rhetorische Ansage verwandelte sich schließlich in eine Jagd auf die<br />
Mitarbeiter der Ministerien.<br />
Jedes Ministerium pries sich, es habe eine besonders hohe Zahl an Entlassungen vorgenommen<br />
um die Korruptionsbekämpfung umzusetzen. Es kann wohl nicht anders als ein versuchter<br />
rhetorischer Trick genannt werden, wenn „der Präsident sich Unterstützung von der Bevölkerung<br />
wünsche“, während der Volksmund weiß und beständig davon spricht, dass gerade jene<br />
Korruptionsbekämpfer, die auch des Präsidenten Umgebung bilden, im Sumpf der Bestechung<br />
versinken.<br />
Das Regime ist der Netztechnologie oft nicht gewachsen<br />
In der Bevölkerung herrschte große Anspannung und man hoffte durch massenhafte Proteste und<br />
einen großen Volksauftand das Regime zu Fall zu bringen. Für eine Steigerung der nahezu<br />
revolutionären Atmosphäre sorgten die Fernsehbilder aus Tunesien und nachträglich aus Ägypten,<br />
die Aserbaidschans Realitäten haargenau widerspiegelten. Dort gelang es der protestierenden<br />
Masse einen lange Jahre festsitzenden Herrscher in die Knie zu zwingen so dass er sich mitsamt<br />
seiner bewaffneten Garde in sein Schicksal ergeben musste. In den Augen der Aserbaidschaner<br />
war es ein Moment des Triumphs über das böswillige Herrschaftssystem. Daran sieht man, welch<br />
einem Bedrohungsdruck die faktisch totalitär regierenden Führungen unterliegen, wenn von einem<br />
kleinen Revolutionsfunken ein ganzer Brand ausgelöst wird.<br />
Durch die Bilder von den Ereignissen aus Tunesien und Ägypten setzte sich in Regierungskreisen<br />
in Baku die Meinung fest, dass das Internet zu dem unkontrollierten Bereich gehört, wo die<br />
Umwälzung der Unzufriedenheit in eine Widerstandsbereitschaft am wahrscheinlichsten ist.<br />
Fernsehen und politische Presse unterliegen dagegen konventionellen medialen Kontrollapparaten<br />
des Regimes. In alle Regionen dürfen ausschließlich regierungsfreundliche TV Sender<br />
ausstrahlen. Dagegen bleibt das Internet angesichts der geringen Popularität relativ zensurfrei. Oft<br />
auch aus dem einfachen Grund, dass viele Regimetreue der Internettechnologie gar nicht<br />
gewachsen sind und sich ihrer nicht bedienen können.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 22 of 79<br />
15.06.2011<br />
Unterführung mit Propaganda-Spruch: An allen Durchgängen werden den Passanten<br />
die Parolen von Ilham Aliyev eingetrichtert. „Die erfolgreiche Entwicklung<br />
Aserbaidschans ist schon Realität“ (Azerbaycanin ugurlu inkishafi artiq realliqdir)<br />
heißt es an dieser hier. Foto: Andrea Weiss<br />
Frustrierte Jugend<br />
Diejenigen, die die ersten Schritte gemacht haben, waren die informell organisierten jungen<br />
Aktivisten beiderlei Geschlechts. Man kann nicht von einer zusammengeschlossenen Gruppe<br />
sprechen, denn ihre Mitglieder sind in der ganzen Welt verstreut. Und ihre Aktivität entfaltet sich<br />
unter sehr eingeschränkten Bedingungen, und zwar lediglich im Internet, in Blogs und in sozialen<br />
Netzwerken.<br />
Ausgesucht wurde für den Zeitpunkt des Protestes der 11. März, im Gedenken an den<br />
Rücktritttags von Hüsnü Mubarak einen Monat zuvor. Die Grundidee bestand im Aufruf zum<br />
zivilen Ungehorsam. Jeder entscheide selbst, wie er sein Missfallen am „Volkstag“ zum Ausdruck<br />
bringe. Blitzschnell war die Nachricht einer angekündigten Demonstration überall verbreitet. Die<br />
kühnen, ganz unabhängig organisierten Studenten verbreiteten Flugblätter; in YouTube und<br />
Facebook wurden die Solidaritätsgefühle unter Jugendlichen in Aserbaidschan ausgetauscht.<br />
Die beachtliche Mehrheit der Protestierenden bildeten die Stadtbewohner und Studenten,<br />
wenngleich Straßenaktionen auch Menschen aus ärmeren Verhältnissen sehr gelegen kamen. Die<br />
tragende Kraft der Demonstration sollten die ersten Jungpolitiker der Facebook-Generation bilden.<br />
Ihr Markenzeichen ist eine prowestliche Orientierung und der Wunsch nach beschleunigter<br />
Integration in Europa, im Sinne der wirklichen Angleichung an europäische Werte, etwas, was<br />
dem Alijew Regime schwerfällt. Es will in die Gegenrichtung steuern.<br />
Die Jugend fühlt sich verletzt, wenn ihre Ideale der Demokratie und republikanischer Traditionen<br />
missachtet werden. Wie zum Beispiel schon vor ein paar Jahren, als die Behörden auf einem<br />
Platz, auf dem ursprünglich ein Denkmal für Resulzade, den ersten Staatsführer der<br />
Aserbaidschanischen Demokratischen Republik von 1918 errichtet werden sollte, eine belanglose<br />
Vergnügungsfontäne installierten.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 23 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Bestechlichkeit und nicht Bildungskompetenz sind die<br />
Faktoren, die die Jobchancen auf dem aserbaidschanischen<br />
Arbeitsmarkt bestimmen“<br />
Andererseits entgeht kein Erstbesucher in Aserbaidschan den allgegenwärtigen Bildern, Porträts<br />
und überdimensionalen Statuen des Präsidentenvaters. Die Jugendlichen verärgert außerdem die<br />
unbefriedigende Situation in der Lehre, die an Universitäten herrscht, wo das<br />
Unterrichtsschwänzen mit Geldaufwendungen an die Lehrenden kompensiert werden kann. Die<br />
Loyalität dem Vorsitzenden gegenüber, die Bestechlichkeit und nicht die Bildungskompetenz sind<br />
die Faktoren, die die Jobchancen auf dem aserbaidschanischen Arbeitsmarkt bestimmen. Dass der<br />
Bildungssektor trotz des verhältnismäßig größeren Budgets den benachbarten Staaten<br />
hinterherhinkt, belegen die Universitätsrankings, wonach aserbaidschanische Hochschulen die<br />
allerletzten Plätze einnehmen.<br />
Die Jugend verlangt nach einer Öffnung des Landes und dem Ende der mafiösen Art der<br />
Regierungsführung, die den Menschen den autoritären Stil vorschreibt. Als 2010 die<br />
engagiertesten Vertreter der jungen Generation um Stimmen bei den Parlamentswahlen warben –<br />
ein harter Test für politisches Engagement in Aserbaidschan - wurden ihre Wählerstimmen<br />
zugunsten der regimetreuen Kandidaten gezählt.<br />
In einer solchen von Unfreiheit geplagten Gesellschaft fühlt sich jeder, ungeachtet seiner<br />
politischen Zugehörigkeit, in die Ecke gedrängt. Das Regime wendet sich mit allen Mitteln gegen<br />
die Versammlungsfreiheit und erstickt jede politische Bewegung im Keim. Trotz der<br />
Mitgliedschaft im Europarat zählt Aserbaidschan zu den Ländern mit den größten<br />
Einschränkungen, was die Versammlungsfreiheit anlangt. Bislang wurden sogar Aktionen<br />
untersagt wie das gemeinsame Zeitungslesen im Stadtzentrum, das sich so harmlose Ziele steckt,<br />
wie Menschen in ihrer sozialen Verantwortung aufzuklären. Sogar solche Gemeinschaftsaktionen<br />
wurden mit roher Polizeigewalt auseinander getrieben.<br />
Blick vom „Qiz qalasi“, dem Jungfrauenturm aus dem 11. Jahrhundert auf die Baku<br />
Werft. Foto: Andrea Weiss
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 24 of 79<br />
15.06.2011<br />
Proteste – aber keine Großdemonstration<br />
Zu einer Großdemonstration, wie es viele erwartet hatten, ist es bislang nicht gekommen. Vorab<br />
wurden schon einige Protestorganisatoren von der Polizei inhaftiert, mit der Absicht, jeglicher<br />
Ausbreitung der Erhebungswelle vorzubeugen. Oppositionelle Parteien wurden eines illegalen<br />
Umsturzversuches bezichtigt. Auch der journalistisch aktive Elnur Mejidli, der mittlerweile seinen<br />
Wohnort nach Frankreich verlegt hat, wurde von der Drohgebärde nicht verschont. Ihm wurde<br />
eine Straftat unterstellt, da er angeblich über soziale Netzwerke zum Staatsstreich aufgerufen<br />
habe.<br />
Wie übliche haben sich die Provokateure des Regimes unter die Menge gemischt, Angriffe auf<br />
die Straßenläden angestiftet, um die ehrlichen Zielsetzungen der Demonstranten zu diskreditieren.<br />
Mittlerweile stieg die Proteststimmung in der Bevölkerung jedoch soweit an, dass lange völlig aus<br />
dem öffentlichen Leben ferngehaltene und jeglicher legaler (elektoraler) Unterstützung<br />
entbehrende Opposition den Mut zusammennehmen konnte, Forderungen an das Regime zu<br />
richten. Sie betrafen die Durchführung demokratischer Wahlen, die Entscheidungsfähigkeit in der<br />
Korruptionsbekämpfung bis hin zu einem Regimewechsel.<br />
Das war wahrscheinlich der Moment, als junge Leute und einfache Menschen, ihre aufgestaute<br />
Enttäuschung und Wut den führungsschwachen Oppositionsparteien überantworteten. Aber deren<br />
Enttäuschung kam während der Demonstrationen gar nicht zur Sprache. Das war auch ein Faktor,<br />
warum der Schwung in der Protestbewegung gebremst wurde. Der Opposition fehlte Leitungskraft<br />
und Organisationsmoral. Deshalb weitete sich der mit kleineren Gruppen beginnende Widerstand<br />
chaotisch aus und es gelang nicht, eine Brücke zwischen den moderaten Kräften der ohnehin<br />
marginalisierten Zivilgesellschaft und breiteren Massen zu schlagen.<br />
In den letzten zehn Jahren hat sich die Bevölkerungszahl von Baku durch Arbeitsmigranten und<br />
Bevölkerungszuwanderung aus den besetzten, in und um Bergkarabach liegenden Territorien<br />
verdreifacht. Dass diese Bevölkerungsmasse unterschiedlicher Herkunft auch unterschiedlich<br />
denkt, ist ein weiterer Grund für den Mangel am solidarisierendem Bewusstsein.<br />
„Die Oppositionsparteien sind dem politischen Leben<br />
entfremdet“<br />
Das Regime verstärkte dagegen seinen Erpressungsdruck auf Oppositionsmitglieder und zwang<br />
sie zur Schweigsamkeit oder sogar öffentlichen Fehlereingeständnissen. Wie manipulativ das<br />
Regime mit Versammlungsfreiheit umgeht, machte ihre eigens gelenkte, auf die Diffamierung der<br />
Oppositionsführer zielende Demo-Maskerade evident, die in schauspielerischer Art und Weise<br />
von der Polizei „aufgelöst“ wurde.<br />
Als politische Kraft hat die Opposition ihre Rolle längst verspielt. Die völlig dem politischen<br />
Leben entfremdeten oppositionellen Parteien sind eher ein Gefügeelement in dem autoritären<br />
Herrschaftssystem, das sich mit wenig offener Kritik dem Manipulationsdruck des Regimes<br />
unterwirft.<br />
In den auf die Proteste folgenden Monaten zielte die Regierung mittels fördernder Maßnahmen<br />
auf Bedürfnisse breiter sozialer Schichten ab, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der<br />
Protestierer steigt, möglichst zu eliminieren. Außerdem bemühte sie sich den sozial bedingten<br />
Ausbruch als von außen gesteuerte Aktion hinzustellen. So lauteten die unpräzisen<br />
Anschuldigungsworte des Staatsanwalts, der ohne Namen zu nennen behauptete, es wäre das<br />
Werk ausländischer Unterstützer gewesen.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 25 of 79<br />
15.06.2011<br />
Die letzte Wortmeldung zu den Vorgängen kam nach langem Stillschweigen vom Präsidenten. Er<br />
bagatellisierte die Demos und machte damit klar, dass die Anliegen der Bevölkerung auch künftig<br />
kein Gehör finden werden.<br />
Noch sind es in Aserbaidschan der korrumpierende Präsident und seine Umgebung, die das letzte<br />
Wort haben. Es wird noch dauern sein, bis sich das Volk unüberhörbar mit seiner eigenen Stimme<br />
zu Wort meldet.<br />
OSZE<br />
Hat die Organisation für Sicherheit und<br />
Zusammenarbeit in Europa noch eine<br />
Daseinsberechtigung?<br />
Auf den ersten Blick scheint sich die OSZE in einer Sackgasse zu befinden.<br />
Gegründet, um die Sicherheit in Europa zu gewährleisten, kann sie heute<br />
wenig greifbare Erfolge bei der Lösung regionaler Konflikte vorweisen. Und<br />
auch in ihrer humanitären Dimension, bei der Förderung von Demokratie und<br />
Menschenrechten, sind die Fortschritte in einer Reihe von Mitgliedsstaaten<br />
begrenzt geblieben.<br />
Von Manfred Grund MdB<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
<strong>Zur</strong> Person: Manfred Grund MdB<br />
Manfred Grund ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestags (MdB). Außerdem<br />
gehört der 1955 in Zeitz geborene Politiker dem Auswärtigen Ausschusses des<br />
Bundestags an und ist Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-<br />
Bundestagsfraktion. Seit 2010 bekleidet Grund das Amt des Vorsitzenden der<br />
Deutsch-Kasachischen Gesellschaft und des Deutsch-Moldauischen Forums.<br />
uf Initiative Kasachstans, das 2010 den Vorsitz innehatte, ist es im Dezember zum ersten<br />
OSZE-Gipfel seit mehr als einem Jahrzehnt gekommen. Doch auch dabei blieben viele
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 26 of 79<br />
15.06.2011<br />
Wünsche offen. Erwartungen, die Staats- und Regierungschefs könnten sich auf einen Aktionsplan<br />
zur Reform der OSZE und zur Überwindung der sogenannten eingefrorenen Konflikte um Berg<br />
Karabach, Transnistrien, Abchasien und Südossetien verständigen, erfüllten sich nicht. Stattdessen<br />
blieb es bei einer Erklärung, die die bestehenden Ziele der Organisation bekräftigte. Infolgedessen<br />
waren die Reaktionen in den meisten westlichen Medien ausgesprochen kritisch. Hat die OSZE<br />
mittlerweile ihre Daseinsberechtigung verloren?<br />
Die OSZE verbindet Europa auch mit Zentralasien<br />
Doch die Defizite der OSZE sind lediglich die Defizite der euroatlantischen Sicherheitsarchitektur<br />
insgesamt, die nach wie vor durch sehr unterschiedliche Zonen von Sicherheit gekennzeichnet ist.<br />
NATO und EU haben ein hohes Maß an Integration, gegenseitigem Vertrauen und kollektiver<br />
Sicherheit geschaffen, das jenseits ihrer Grenzen fehlt. Die OSZE verbindet Europa auch mit<br />
Zentralasien, das wirtschaftlich und strategisch von großer Bedeutung ist. Doch dessen Integration<br />
in andere internationale Institutionen – wie die Shanghai Organisation – orientiert sich sonst eher<br />
nach Asien. Dass Kasachstan der OSZE mit dem Gipfel von Astana neues Gewicht verleihen<br />
wollte, ist deshalb grundsätzlich nur zu begrüßen. Solange die OSZE die einzige umfassende<br />
Sicherheitsorganisation im euroatlantischen Raum ist, bleibt sie unverzichtbar.<br />
Allerdings gehen diese Unterschiede innerhalb des OSZE-Raums auch mit grundsätzlichen<br />
Differenzen einher. Für Russland und zentralasiatische Staaten steht stärker die militärische<br />
Sicherheit im Vordergrund, für EU und NATO die humanitäre Dimension, also demokratische<br />
und menschenrechtliche Standards.<br />
Vor diesem Hintergrund sollte der Gipfel von Astana nicht einfach als Misserfolg verstanden<br />
werden. Immerhin: Der bestehende gemeinschaftliche Besitzstand (Acquis) einschließlich der<br />
humanitären Forderungen wurde ausdrücklich bestätigt. Auch die Absicht, einen Aktionsplan zu<br />
erarbeiten, ist nicht gescheitert, sondern soll vom litauischen Vorsitz 2011 fortgeführt werden. Es<br />
waren vor allem die Auseinandersetzungen über den Status von Abchasien und Südossetien, die<br />
eine weitergehende Einigung in Astana verhindert haben.<br />
Die OSZE bietet ein alternativloses Forum zur Bewältigung<br />
von Konflikten<br />
Doch von diesem Beispiel abgesehen, kann die OSZE mehr zur Bewältigung von Konflikten<br />
beitragen als oft sichtbar wird. So hat der kasachische Vorsitz dazu beigetragen, dass die Krise in<br />
Kirgisistan nicht weiter eskaliert. Mit den Madrider Prinzipien hat die OSZE bereits Grundsätze<br />
für eine Lösung des Berg Karabach-Konflikts formuliert. Ob sie umgesetzt werden oder es<br />
schlimmstenfalls zu einer erneuten Eskalation des Konfliktes kommt, hängt jetzt davon ab, mit<br />
welchem Nachdruck die Mitgliedstaaten diesen Prozess unterstützen. Die OSZE bietet ein<br />
alternativloses Forum zur Bewältigung von Konflikten an, aus eigener Kraft lösen kann sie sie<br />
nicht.<br />
Welche Zukunftsperspektiven ergeben sich nach dem Gipfel? Wegweisend kann das ausdrücklich<br />
bekräftigte Ziel wirken, zu Fortschritten bei Abrüstung und Rüstungskontrolle vor allem durch<br />
neue Verhandlungen über den angepassten Vertrag über konventionelle Streitkräfte zu gelangen.<br />
Bislang haben die NATO-Staaten eine Ratifizierung des Vertrages mit der Erfüllung der 1999 auf<br />
dem letzten OSZE-Gipfel von Russland eingegangenen Verpflichtung zum Abzug von Truppen<br />
aus Moldau und Georgien verknüpft.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 27 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Große Strategie manifestiert sich manchmal in scheinbar<br />
kleinen Konfliktfeldern.“<br />
Ohne solche Fortschritte dürfte aber auch Russland seinem Interesse an einer umfassenden<br />
euroatlantischen Sicherheitsarchitektur – mit größeren eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten – kaum<br />
näher kommen. Denn dabei würden EU und NATO nur mitmachen, wenn damit nicht nur die<br />
russische Vetomacht gestärkt würde, sondern eine konstruktive Zusammenarbeit absehbar wäre.<br />
Wo anders ließe sich das erforderliche Vertrauen schaffen, wenn nicht bei der gemeinsamen<br />
Bewältigung bestehender Konflikte? Allerdings ist eine Verständigung über Abchasien und<br />
Südossetien seit dem Georgien Krieg zunächst unrealistisch geworden. Wer Fortschritte will,<br />
muss sie woanders suchen. Umso wichtiger kann daher Transnistrien werden. Auch deshalb<br />
engagiert sich die Bundeskanzlerin für diesen Konflikt. Ein Erfolg in Transnistrien würde eine<br />
substanzielle Chance nicht nur für eine Stärkung des Abrüstungsregimes in Europa bieten,<br />
sondern auch dazu, über den heute bestehenden OSZE-Rahmen hinaus schrittweise zu einer<br />
effektiveren Sicherheitsorganisation zu gelangen. Große Strategie manifestiert sich manchmal in<br />
scheinbar kleinen Konfliktfeldern.<br />
EINWANDERUNG<br />
„Bei bestimmten Migrantengruppen ist die<br />
Integration gescheitert“<br />
Von Importbräuten und geschäftstüchtigen Moschee-Betrieben, von türkischer<br />
Opfermythologie und der Macht der Familien. Ein Vortragsabend der<br />
Publizistin Dr. Necla Kelek.<br />
Von Wolf Oschlies<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Dr. Necla Kelek<br />
Foto aus Wikipedia/ Medienmagazin
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 28 of 79<br />
15.06.2011<br />
nd so eine beschimpft der Futterneid der Islam-Versteher als „Hasspredigerin“,<br />
„Panikmacherin“ und was der Verwünschungen mehr sind. Eigentlich ist sie kleiner, als<br />
man sie sich vorstellt, auch erheblich attraktiver, als manche süßlichen Porträts von Fotografen<br />
ahnen lassen: Die Publizistin Dr. Necla Kelek, 1957 in Istanbul geboren, seit 1966 in Deutschland<br />
ansässig und inzwischen deutsche Staatsbürgerin, Verfasserin mehrerer Bestseller über das Leben<br />
und die Weltanschauung türkischer „Migranten“. Diese Frau lässt sich gern den Wind ins Gesicht<br />
wehen, aber feuilletonistische Windmacher nehmen inzwischen lieber vor ihr Reißaus.<br />
Selbst ihr in der Polemik zu unterliegen, ist noch ehrenvoll<br />
Neclas Kelek als Mitstreiterin zu haben, ist die „halbe Miete“ - spürbar beispielsweise im August<br />
2010, als sie Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ mit größter Zustimmung<br />
(„Befreiungsschlag“) vorstellte. Selbst ihr in der Polemik zu unterliegen (was bislang der<br />
natürliche Lauf der Dinge war), ist noch ehrenvoll. Dabei ist Frau Kelek das Hassobjekt aller<br />
„Integrations-Schönredner“, gegen die sie eine scharfe Klinge führt, wie Ende Februar ihr<br />
Streitgespräch mit Patrick Bahners, Autor des Pamphlets „Die Panikmacher“, in einem<br />
Hamburger <strong>Magazin</strong> zeigte.<br />
<strong>Zur</strong> Begegnung mit Necla Kelek am 6. April in einem Kölner Hotel kam man nur über persönliche<br />
Einladung durch die „Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit“, welchen Vorzug etwa 90<br />
Personen hatten. Die Publizistin referierte über „Integration und Integrationspolitik in<br />
Deutschland“ - versteht sich, mit besonderem Blick auf Türken und eigeleitet mit Blicken auf<br />
jüngste Entwicklungen in Nahost, die viele mit Sympathie betrachten, Necla Kelek aber mit<br />
größtem Misstrauen:.<br />
„Wird der Islam total wie im Iran herrschen?“<br />
„Die ägyptische Gesellschaft z. B. ist nicht nur von Mubarak, sondern seit dem 7. Jahrhundert von<br />
Grund auf durch den Islam geprägt“, führte sie aus. Und weiter: „ Der Artikel 2 der Verfassung<br />
der seit 1952 bestehenden Republik Ägypten bestimmt den Islam zur Staatsreligion. Es gibt dort<br />
keine Gesetze, die den Vorgaben der Scharia widersprechen. (…) Wenn wir über den Aufstand in<br />
der arabischen Welt sprechen, müssen wir deshalb über das System sprechen, das die Gesellschaft<br />
bestimmt. Es ist der Islam, und zwar nicht nur als sinnstiftende Institution, sondern als den Alltag<br />
prägende Kraft. Denn noch hat diese Kraft nirgends bewiesen, dass mit ihr eine Trennung von<br />
Staat und Religion zu machen sein wird (…) Oder wird gar der Islam total wie im Iran<br />
herrschen?“<br />
Der Islam mit zweifelhafter Integrationswilligkeit exemplifiziert sich seit Jahren und immer<br />
stärker auch an Türken in Deutschland. Das hat Necla Kelek bereits im Juli 2007 mit<br />
dankenswerter Offenheit gesagt, als es um einen von vornherein sinnlosen „Integrationsgipfel“ im<br />
Kanzleramt ging: „Die türkischen Verbände machen ohnehin nichts für die Integration in<br />
Deutschland. Sie treten jetzt zurück, weil sie nur im vermeintlichen Interesse ihrer Klientel, der<br />
Türken und der Türkei, handeln, anstatt konkret für Integration in Deutschland zu kämpfen“.<br />
Fünf Jahre später sieht sie keinen Grund, ihr harsches Urteil zu mildern: „Die Integration ist bei<br />
bestimmten Bevölkerungsgruppen gescheitert und dies belastet und verändert das Gemeinwesen in<br />
besonderer Weise“. Speziell Türken haben Deutschland nicht als Heimat akzeptiert, sie verachten<br />
Deutsche als „Ungläubige“ und verdammen deren Sitten. „Ehrenmorde“ an türkischen Mädchen<br />
wurden von den Tätern gerechtfertigt mit der Feststellung. „Sie lebte wie eine Deutsche“.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 29 of 79<br />
15.06.2011<br />
Eine Opfermythologie mit Deutschen als Tätern kultivieren<br />
In dieser Verweigerung werden Türken von Politikern wie Ministerpräsident Erdogan unterstützt,<br />
selbst „türkischstämmige“ Politiker in deutschen Parteien sind als „Türkei-Lobbyisten“ keine<br />
Anwälte der Integration. Deutsche Anstrengungskultur und Leistungsbereitschaft prallt an Türken<br />
ab, die lieber eine Opfermythologie mit Deutschen als Tätern kultivieren.<br />
Die Muslimin Kelek pries den Sozialstaat als Verkörperung christlicher Nächstenliebe und Garant<br />
von allgemeinen Menschenrechten, wo der Islam solche Rechte nur Muslimen gewährt.<br />
Undenkbar für Türken, dass sie für diese Rechte dankbar, auf sie gar stolz seien und bereit, sie zu<br />
verteidigen, obwohl sie von ihnen zählbaren Gewinn hatten. Sie kamen seit den 1950er Jahren,<br />
anfangs verhalten, dann massiert: 1961 lebten in Deutschland 6.800 Türken, 1971 waren es<br />
650.000, die ihr nahezu bankrottes Heimatland retteten – sagt Neclas Kelek:<br />
„Die Türkei durchlebte seit 1960 eine große wirtschaftliche und politische Depression. Das Militär<br />
putschte und versuchte die Wirtschaft weiter zentralistisch zu kontrollieren. Folge der<br />
Automatisierung der Landwirtschaft war eine Verarmung und eine nachhaltige Landflucht der<br />
anatolischen Bevölkerung. Millionen zogen in die Städte und über eine halbe Million<br />
Arbeitssuchende nach Almanya.<br />
Diese über 500.000 Menschen weniger in der Türkei waren ein Segen für das arme Land. Denn<br />
die Almancis entlasteten den türkischen Arbeitsmarkt und schickten monatlich ihren Lohn aus<br />
dem kalten Norden nach Hause und glichen zudem das Haushaltsbilanzdefizit aus. Das war<br />
ökonomisch ein warmer Regen für Anatolien und jede Familie. Manches Haus, manches Dorf<br />
entstand oder überlebte so. Rechnet man die Zahlen hoch, kann man davon ausgehen, dass in den<br />
siebziger Jahren fast zehn Prozent der 30 Millionen Menschen in der Türkei von Überweisungen<br />
aus Deutschland lebten“.<br />
Zustrom durch eine wenig beachtete gesetzliche Regel<br />
Inzwischen sind es nahezu 1,6 Millionen, die sich die Deutschland durch eigene Kurzsichtigkeit<br />
auf Dauer aufgeladen hat: „1973 wurde ein Anwerbestopp verkündet und viele Arbeitsverträge<br />
liefen aus. Von den insgesamt 14 Millionen Gastarbeitern, die bis 1973 nach Deutschland kamen,<br />
kehrten die Italiener, Spanier und Griechen in ihre Länder zurück. Insgesamt elf Millionen, auch<br />
weil inzwischen in ihren Ländern die Wirtschaft ins Rollen kam. Die meisten Türken blieben in<br />
Deutschland, denn die wirtschaftliche Situation in der Türkei hatte sich nicht entscheidend<br />
verbessert. Finanziell war es auch besser, in Deutschland als in der Türkei arbeitslos zu sein. Die<br />
Zahl der Türken erhöhte sich trotz des Anwerbestopps bis 1980 um 42,4 Prozent auf über 1,4<br />
Millionen. Der Grund dafür war eine im Ausländergesetz zunächst wenig beachtete Regelung, die<br />
im Rahmen der Familienzusammenführung Ehepartnern und Kindern den Nachzug erlaubte. Sie<br />
entwickelte eine Eigendynamik. (…) Wer konnte, holte seine Familie nach. Insgesamt kamen so<br />
jährlich bis zu 100.000 Menschen“.<br />
Jede zweite türkische Mutter aus Deutschland ist eine<br />
Importbraut<br />
Es wurden nicht nur Familienmitglieder nachgeholt, vielmehr immer häufiger „Importbräute“. Mit<br />
diesen befasst sich ein eigenes Buch von Necla Kelek und das Problem selber nannte sie bereits<br />
2007 deutlich beim Namen: “Jede zweite türkische Mutter aus Deutschland ist eine Importbraut,<br />
was bedeutet, dass sie ihr Kind nicht in die Schule begleiten kann, weil sie kein Deutsch spricht.<br />
Wir haben wahrlich nichts zu feiern. Und nach einer <strong>neuen</strong> Umfrage sagen 50 Prozent aller<br />
befragten türkischen Männer in Deutschland, dass sie eine Braut aus der Türkei wollen. Sind die
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 30 of 79<br />
15.06.2011<br />
Frauen, die in Deutschland groß geworden sind, nicht gut genug? Ich bin mittendrin in der<br />
anatolischen Community, und ich kenne keine einzige Familie, die keine Braut geholt hat“.<br />
In diesem Zusammenhang ist „Integration“ ein absolutes Fremdwort: „Über eine halbe Million -<br />
meist Frauen - kamen im Laufe der Jahre so nach Deutschland. Sie konnten meist weder die<br />
Sprache, noch mussten sie Deutsch lernen, denn in den Familien war vom Essen bis zur<br />
Kindererziehung alles türkisch. Ihre Kinder lernten kein Deutsch. Es kamen nicht nur die Frauen<br />
und Kinder, sondern mit ihnen auch eine andere Kultur, eine andere Art zu leben, andere<br />
Traditionen und Sitten, eine Religion, auch der Islam, das anatolische Dorf und die Moschee. Die<br />
türkischen Migranten begannen, sich in Deutschland einzurichten, wie sie es aus ihrem<br />
anatolischen Dorf kannten. Und die deutsche Politik verschloss die Augen vor den Problemen,<br />
denn Deutschland wollte kein Einwanderungsland sein. Während die erste und auch die zweite<br />
Generation der Migranten meist als Einzelpersonen oder als Kleinfamilien kamen und selbständig<br />
Anpassungsleistungen erbrachten und Bildungschancen nutzten, änderte sich dies mit der<br />
massenhaften Familienzusammenführung grundlegend. Großfamilienstrukturen entstanden und<br />
ganze Clans zogen vor allem in die Großstädte und Ballungsräume. <strong>Zur</strong> mitgebrachten Tradition<br />
gehörte auch, dass man die Söhne und Töchter mit Verwandten aus der Türkei verheiratete und<br />
über Familienzusammenführung nach Deutschland holte.“<br />
Die einstige türkische Parallelgesellschaft hat sich zur<br />
feindseligen, muslimischen Gegengesellschaft transformiert<br />
In ihrem Kölner Vortrag hat Necla Kelek die Folgen dessen bilanziert. Jede weitere<br />
Türkengeneration wurde abgeschotteter, unnahbarer als die vorherige. Die einstige türkische<br />
Parallelgesellschaft hat sich zur feindseligen, muslimischen Gegengesellschaft zwecks<br />
Unterwanderung der deutschen Gesellschaft transformiert, deren archaische Regeln<br />
Drogenkartelle, Kriminalität und Mafiagruppen begünstigten.<br />
Die türkischen Arbeitskräfte finden immer schwerer Arbeitsplätze, da sie zumeist unqualifiziert<br />
sind und ihr Bildungs- und Sprachniveau ins Bodenlose absackt: „Die soziale Realität von<br />
Importbräuten, Schulverweigerung, schlechten Bildungsergebnissen, hohen Kriminalitätsraten,<br />
Ghettoisierung, Parallelgesellschaften, Zuwanderung in die Sozialsystem haben die Menschen und<br />
die Politik alarmiert. Dazu nahm durch die technologische Entwicklung und Automatisierung (seit<br />
1980) in der Industrie in der Bundesrepublik die Zahl der einfachen Arbeitsstellen zunehmend ab.<br />
(…) Viele wurden so arbeitslos und zu Empfängern von Sozialleistungen. Knapp 42 Prozent aller<br />
in Berlin lebenden Türken im erwerbsfähigen Alter sind z.B. heute erwerbslos und ihre Familien<br />
leben von Transferleistungen“.<br />
Allenthalben entsteht eine „türkische Nischenökonomie“, die Necla Kelek ironisch beschrieb:<br />
„Allein in Duisburg-Marxloh gibt es 60 türkische Hochzeitsläden, und von A (wie<br />
Abschleppdienst) bis Z (wie Zahnarzt) kann man alles bei Türken erledigen“. Handwerks- oder<br />
gar Industriebetriebe sucht man bei Türken vergebens, sie unterhalten zumeist kleine Geschäfte, in<br />
denen Familienangehörige ohne Versicherung und Lohn arbeiten, „in vollständiger Abhängigkeit<br />
vom Inhaber, der auch die Heirat mit einer Cousine aus der Türkei arrangiert“.<br />
Moscheen und islamische Vereinigungen sind auch<br />
ökonomische Netzwerke<br />
Anders als das Christentum hat sich der Islam nicht aus der Wirtschaft zurückgezogen, vielmehr<br />
sind Moscheen und islamische Vereinigungen auch ökonomische Netzwerke und Ausgangspunkt<br />
von Milliardenunterschlagungen, die vor allem der islamistischen „Milli Görüs“ zur Last gelegt<br />
werden.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 31 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Das ist aber nicht der Islam“, lautet das häufige Gegenargument, wenn man mit Türken über<br />
Auswüchse ihres Alltags – Zwangsheiraten, Ehrenmorde, Gewalt – spricht. Necla Kelek hat es oft<br />
gehört, ließ es aber nie gelten, auch nicht 2011 in Köln: „Ich weise in meinen Büchern auf die<br />
Missstände innerhalb der muslimischen Community hin und versuche zu erläutern, warum der<br />
Islam eben nicht nur ein Glaube, sondern eine Weltanschauung und politische Ideologie darstellt,<br />
die sich anders als das Christentum nicht säkularisiert hat. Der Islam ist gelebte Kultur und diese<br />
Kultur hat ein anderes Menschen- und Weltbild als das einer aufgeklärten Bürgergesellschaft. Ich<br />
möchte Ihnen auseinandersetzen worin diese „Kulturdifferenz“ besteht und worum es im Kern<br />
geht: den Umgang mit Freiheit. Und warum Muslime sich so schwer tun, in der Freiheit<br />
anzukommen“.<br />
„Die Hierarchie ergibt sich nicht aus einer natürlichen<br />
Autorität, sondern wird über Alter und Geschlecht definiert,<br />
und dies ist gottgegeben“<br />
Das liegt zu einen daran, dass der Islam türkischer Lesart keinen absoluten Wert des Menschen<br />
anerkennt: „Im türkischmuslimischen Wertekanon spielt der Begriff Respekt eine große Rolle.<br />
Respekt vor dem Älteren, dem Stärkeren, vor der Religion, vor der Türkei, vor Vater, Onkel,<br />
Bruder. Wenn ein Abi, ein älterer Bruder, von einem Jüngeren oder Fremden Respekt einfordert,<br />
fordert er eine Demutsgeste ein. Auch erwachsene Söhne reden z.B. In Gegenwart ihrer Väter<br />
oder Onkel nicht unaufgefordert, sie ordnen sich unter, erweisen so dem Älteren Respekt. Das ist<br />
die absolute Orientierung auf einen hierarchisch Höherstehenden, auf ein patriarchalisches<br />
System. (…) Die Mitglieder der Gruppe, der Familie, des Clans usw. sind nicht gleich, sondern<br />
nach Geschlechtern, Alter und Rang abgestuft zu respektieren. Gegen einen Älteren<br />
aufzubegehren ist in diesem religiös kulturellen System deshalb so, als würde man gegen die<br />
göttliche Ordnung aufbegehren. Ich habe beobachtet, dass Söhne im Alter von vielleicht 12 Jahren<br />
mit ihren Müttern zum Einkaufen gingen und das Portemonnaie in der Hand hielten und zahlten,<br />
weil der Junge während der Abwesenheit des Vaters als ältester Mann im Haus das Sagen hatte.<br />
Die Hierarchie ergibt sich nicht aus einer natürlichen Autorität, sondern wird über Alter und<br />
Geschlecht definiert, und dies ist gottgegeben“.<br />
Das Individuum steht vor der Familie wie vor einem<br />
„Volksgerichtshof“<br />
Die Türken waren ein aufstrebendes Volk, das durch den fundamentalistischen Islam<br />
zurückgeworfen wurde, patriarchalische Strukturen von unbedingter Autorität und unbedingtem<br />
Gehorsam gingen mit dem Islam ein Verhältnis wechselseitiger Legitimierung und Verfestigung<br />
ein. Das Individuum steht vor der Familie wie vor einem „Volksgerichtshof“, der seine<br />
Möglichkeiten willkürlich begrenzt. Allgemein anerkannte Werte erfahren ihre Verkehrung ins<br />
Gegenteil, aus „frei“ wird „vogelfrei“ und „schutzlos“, das Kopftuch ist ein Symbol der Freiheit,<br />
wo es doch ein Verstoß gegen die Menschenwürde ist. Sogar ein besonders perfides, wie Necla<br />
Kelek kritisiert: „Ich bin deshalb vehement dafür, dass Kinder, ganz gleich woher sie kommen,<br />
erst lernen sich selbst auszuprobieren, dass sie schwimmen, auf Berge klettern, Wandern gehen,<br />
ein Naturbewusstsein entwickeln. Genauso die Chance bekommen das kulturelle Leben kennen zu<br />
lernen, Museen und Theater gehen, dass sie möglichst vieles selbst machen, dass man verhindert,<br />
dass sie ‚freiwillig‘ ein Kopftuch aufsetzen. Mädchen vor dem 14. Lebensjahr mit dem Kopftuch<br />
in die Schule zu schicken, hat für mich nichts mit Religionsfreiheit oder dem Recht der Eltern auf<br />
Erziehung zu tun, sondern ist ein Verstoß der durch das Grundgesetz garantierten Menschenwürde<br />
und des Diskriminierungsverbots. Das Kopftuch qualifiziert das Kind als Sexualwesen, das seine<br />
Reize vor den Männer zu verbergen hat, weniger darf als ihre Brüder und die anderen<br />
Schulkameradinnen. Jede erwachsene Frau mag für sich selbst entscheiden, ob sie sich verhüllt,
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 32 of 79<br />
15.06.2011<br />
aber Kinder mit diesem Stigma aufwachsen zu lassen, ist für mich ein Zeichen von religiöser<br />
Apartheit“.<br />
Deutsche Politik trägt Mitschuld<br />
Die „Migranten“ wollen nicht in der deutschen Gesellschaft oder für sie aktiv sein, deutsche<br />
Gerichte geben ihnen Recht – deutsche Politik trägt „Mitschuld“ am Chaos, das Migranten<br />
anrichten. Integrationsverweigerung wächst parallel zum Einfluss der Moscheenvereine, türkische<br />
staatliche Organisationen wie die religiöse Überwachungsanstalt DITIB mit derzeit 896<br />
Ortsgruppen in Deutschland arbeiten mit allen Mitteln gegen die Integration der Türken.<br />
Deutschland duldet das und nimmt auch das Heer ungebildeter und des Deutschen kundiger<br />
Hodschas hin, deren einzige Aufgabe es ist, türkische Frauen und Kinder von Kontakten mit<br />
Deutschen fernzuhalten. Warum verzichtet Deutschland leichten Herzens auf die Kontrolle<br />
dessen, was unter dem religiösen Deckmantel gegen seine freiheitliche Gesellschaftsordnung<br />
unternommen wird? Werden die Deutschen demnächst einzelne Ortschaften, Bundesländer oder<br />
gar ihr ganzes Land den islamistischen Hetzern aus der Türkei überlassen müssen? Zitat eines<br />
FDP-Politikers, das Necla Kelek nicht absichtslos in einer FDP-Veranstaltung fallen ließ.<br />
Postskriptum:<br />
*<br />
Ein gutes Referat regt zu Fragen an. Nach Frau Keleks Ausführungen gab es zahlreiche Fragen<br />
und Kommentare aus dem Publikum, und es wären vermutlich noch weit mehr gewesen, hätten<br />
die gastgebenden Liberalen nicht zu einem freundlichen Umtrunk gebeten. Auch der Chronist<br />
hätte gern noch etwas gefragt, aber das ist ihm zu spät eingefallen. Eine seiner Fragen wäre<br />
gewesen, angeregt durch Necla Keleks Buch „Die fremde Braut“, wie hoch wohl die weibliche<br />
Mittäterschaft bei der Unterdrückung türkischer Frauen sein mag. Was die Autorin da von<br />
Müttern, Schwiegermüttern etc. berichtet, lässt einem mitunter die Haare zu Berge stehen – wobei<br />
in der Türkei die rituellen Genitalverstümmelungen von Frauen und Mädchen entfallen, die in<br />
anderen islamischen Ländern praktiziert werden.<br />
Und eine weitere Frage wäre, warum Türken mehrheitlich einen Bogen um die <strong>neuen</strong><br />
Bundesländer machen, wo man so gut wie keine Kopftücher zu sehen bekommt. Das fällt einem<br />
schon in Ost-Berliner Stadtteilen auf, und mit angeblicher Ausländerfeindlichkeit der „Ossis“ hat<br />
das nichts zu tun, wie ungezählte Russen, Polen, Vietnamesen etc. „drüben“ beweisen. Also muss<br />
es wohl an identischen Abneigungen liegen: Was dem Türken das Hassbild des „Deutschländers“<br />
(wozu Necla Kelek in ihren Büchern prachtvolle Beispiele berichtet), das ist dem „Ossi“ der<br />
verhasste „Wessi“ (woraus eine bestimmte Partei ihr politisches Kapital schlägt).<br />
Türken in Deutschland sind mehrheitlich überzeugt (und werden in dieser Überzeugung von<br />
Türkei-Premier Erdogan bestärkt), dass ihre Arbeitskraft der eigentliche Motor des deutschen<br />
Wirtschaftswunders war – „Ossis“ glauben fest daran, dass die bösen „Wessis“ ihre schöne DDR<br />
vernichtet haben, die doch zu den „zehn größten Industriemächten der Welt“ gehörte. Weil sich<br />
Aversionen gegen „deutsche Ungläubige“ bzw. „westdeutsche Ausbeuter“ nur getrennt pflegen<br />
lassen, bleiben Türken und „Ossis“ unter sich – in Almanya West und Almanya Ost.<br />
SÜDOSTASIEN
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 33 of 79<br />
15.06.2011<br />
Strategische Neuausrichtung in der<br />
Energiepolitik?<br />
Nach dem Super-GAU von Fukushima werden Pläne über den Bau von<br />
Atomkraftwerken auch im energiehungrigen Südostasien neu überdacht. Dort<br />
sehen wachstumsverwöhnte Eliten in steigenden Energiepreisen die<br />
Konkurrenzfähigkeit ihrer Länder gefährdet. Im Kontext des globalen<br />
Klimawandels wird jedoch deutlich: Umwelt und Klima werden die Zukunft<br />
der Region ganz entscheidend mit beeinflussen.<br />
Von Wilfried Arz<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
ie Architektur der Weltwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten eine nachhaltige<br />
Schwerpunktverlagerung vom transatlantischen zum asiatisch-pazifischen Raum erfahren.<br />
Neben China als neuem Aufsteiger hat auch Südostasien maßgeblich von einem<br />
dynamischen Wirtschaftsboom profitiert, der mit anhaltend hohen Wachstumsraten beeindruckt.<br />
Jede rasante wirtschaftliche Entwicklung ist jedoch untrennbar verbunden mit einer hohen<br />
Nachfrage nach Rohstoffen und Energie. Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA)<br />
zufolge wird die Energienachfrage weltweit bis 2030 um durchschnittlich vierzig Prozent steigen.<br />
Eine besonders starke Zunahme des Energiebedarfs ist in China, Indien und den Schwellenländern<br />
Südostasiens zu erwarten.<br />
Der globale Wettlauf um Ressourcen hat bereits begonnen. USA und EU, China und Indien stehen<br />
seit Jahren in Konkurrenz zu knapper werdenden Rohstoffen und fossilen Energieträgern. Auch<br />
vor militärischer Gewalt wird bei Versuchen, sich den Zugang und die Kontrolle zu Ressourcen zu<br />
sichern, nicht zurückgeschreckt. Rohstoffreiche Regionen werden zu Schauplätzen gewaltsamer<br />
Konflikte.<br />
Wohin steuert die Energiepolitik in Südostasien?<br />
Das durch Erdbeben und Tsunami verursachte Reaktorunglück in Japan hat global ein Überdenken<br />
energiepolitischer Konzepte ausgelöst. Atomkraft, lange als eine Alternative zu fossilen<br />
Brennstoffen wie Kohle, Erdgas und Erdöl gepriesen, ist auch in Asien in den Mittelpunkt einer<br />
<strong>neuen</strong>, kritischen Bewertung gerückt. Japan, Südkorea, China und Taiwan betreiben seit Jahren<br />
Atomkraftwerke. Auch in Vietnam, Indonesien und Thailand halten die politischen Eliten den Bau<br />
von AKWs für die Energieversorgung und damit die Funktionsfähigkeit ihrer exportabhängigen<br />
Ökonomien für unverzichtbar.<br />
In Teilen der Öffentlichkeit dieser Länder regt sich jedoch Unbehagen und manifestiert sich<br />
zunehmend Widerstand gegen diese Pläne. Gleichwohl geht es nicht nur um das kontrovers<br />
diskutierte Thema Atomenergie. Es geht um nicht weniger als eine langfristig zukunftsfähige, d.h.<br />
umwelt- und sozialverträgliche Versorgung der Region mit Energie schlechthin.<br />
Die Zukunft der Energieversorgung ist auch in Südostasien eine Schlüsselfrage des 21.<br />
Jahrhunderts. Nicht nur Importabhängigkeiten bei Energieträgern haben in den vergangenen<br />
Jahren deutlich zugenommen. Auch Konflikte um Ressourcen haben sich in Südostasien deutlich<br />
verschärft. Ist der Streit um die Spratley- und Paracel-Inselgruppen im Südchinesischen Meer ein<br />
erster Vorgeschmack auf künftige geopolitische Rivalitäten um Rohstoffe? In den<br />
energiepolitischen Strategieplanungen wurde die Fixierung auf fossile Brennstoffe bislang kaum
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 34 of 79<br />
15.06.2011<br />
hinterfragt. Ressourcenkonflikte, globaler Klimawandel und der Super-GAU von Fukushima<br />
lassen jedoch an einer Fortsetzung bisheriger energiepolitischer Konzepte zweifeln. Politischer<br />
Handlungsbedarf ist gefragt - nicht nur in Südostasien.<br />
Indonesien - Tanz auf dem Vulkan<br />
Südostasiens größte Wirtschaft liegt auf dem pazifischen Feuerring, einer seismisch recht<br />
unruhigen Region aktiver Vulkane, Erdbeben und Tsunamis. Dennoch sind in Indonesien zwei<br />
Atomkraftwerke in Planung. Südkoreas Korean Electric Power Corporation (KEPC) soll die<br />
beiden Druckwasser-Atommeiler bis 2025 bauen. Als Standort war bislang Muria an der<br />
Nordküste Zentral-Javas auserkoren worden. Allerdings liegt dort ein aktiver Vulkan nur 30<br />
Kilometer vom geplanten Standort entfernt.<br />
Politischer Widerstand gegen Jakartas AKW-Projekte regen sich bei Umweltverbänden<br />
(Greenpeace, WWF) und der indonesischen Umweltorganisation WAHLI wie auch auf religiöser<br />
Seite: muslimische Geistliche hatten sich 2007 durch eine Fatwa (islamisches Rechtsgutachten)<br />
grundsätzlich gegen den Bau des Atommeilers bei Muria ausgesprochen. Anhaltende Proteste<br />
zwangen Indonesiens Regierung im April, einen <strong>neuen</strong> Standort zu bestimmen. An den<br />
Atomplänen wird jedoch weiter festgehalten.<br />
Das rohstoffreiche Indonesien ist in Südostasien größter Produzent von Erdgas und Kohle,<br />
aufgrund gesunkener Förderquoten jedoch seit 2002 Netto-Erdölimporteur. Der Energiemix des<br />
Landes wird von Kohle und Erdgas bestimmt. Indonesien beabsichtigt, sein immenses Potenzial<br />
an geothermischer Energie in Zukunft verstärkt zu nutzen. Nach Berechnungen der Weltbank<br />
sollen rund 80 Millionen Indonesier noch nicht am Stromnetz angeschlossen sein.<br />
Philippinen - Vorreiter bei alternativen Energien<br />
Ein Leichtwasser-Reaktor (620 MW Leistung) wurde von dem US-Konzern Westinghouse auf der<br />
Insel Luzon in der Zeit von Ferdinand Marcos gebaut, 1986 jedoch von Corazon Aquino nach dem<br />
Reaktorunfall von Tschernobyl aus Sicherheitsgründen gestoppt. Der Standort Bantaan wird von<br />
Vulkanen umrahmt, u.a. dem Pinatubo, der 1991 weite Gebiete durch glühende Lava und Asche<br />
zerstörte, zur Evakuierung von zehntausenden Menschen zwang und 875 Todesopfer forderte.<br />
Seitdem ist das Thema Atomkraft auf den Philippinen ein politisches Tabu.<br />
Großprojekte stoßen auf den Philippinen seit Jahrzehnten auf scharfe Kritik bei betroffenen<br />
Bevölkerungskreisen. Anhaltender militanter Widerstand indigener Volksgruppen gegen den Bau<br />
des Chiko-Staudamms auf der Insel Luzon hatten die Weltbank bereits 1975 veranlasst, sich aus<br />
dem Projekt vollständig zurückzuziehen.<br />
Die Philippinen sind stark von Energieimporten abhängig. Das Energiemix-Profil des Landes:<br />
Kohle (27 Prozent), Wasser (21 Prozent), Erdöl (20 Prozent), Erdgas (18 Prozent), Geothermie<br />
(12 Prozent) und zu 34 Prozent regenerierbare Energiequellen. In diesem Sektor nehmen die<br />
Philippinen eine führende Rolle in Südostasien ein.<br />
Malaysia - Atomkraft ist vorerst kein Thema mehr<br />
Obwohl im Januar 2011 die Malaysia Nuclear Power Corporation (MNPC) gegründet wurde,<br />
scheint das Thema Atomkraft in Kuala Lumpur nach dem Super-GAU von Fukushima vorerst<br />
vom Tisch energiepolitischer Optionen. Diskussionen über den Bau von zwei AKWs mit einer<br />
Leistung von je 1.000 Megawatt sind bislang nicht in eine konkrete Planungsphase übergegangen.<br />
Eine Standortsuche ist bisher nicht in die Wege geleitet worden.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 35 of 79<br />
15.06.2011<br />
Malaysia ist Südostasiens größter Erdöl-Exporteur und nach Indonesien zweitgrößter Erdgas-<br />
Produzent. Neue Erdölvorkommen wurden vor der Küste von Sabah und Sarawak (Kalimantan)<br />
von Royal Dutch Shell (Niederlande/GB) und BHP Billiton (Australien) entdeckt. Der Energiemix<br />
des Landes setzt sich zusammen aus Erdgas, Wasserkraft und Öl.<br />
Vietnam - an Atomkraft wird festgehalten<br />
In Vietnam ist der Bau von zwei Druckwasser-Reaktoren in der Küstenprovinz Ninh Thuan im<br />
Süden des Landes in Planuing. Bis 2020 sollen diese mit einer Leistung von 4.000 Megawatt ans<br />
Netz gehen. Der staatliche Konzern Rosatom (Russland) konnte sich den Auftrag 2010 sichern.<br />
Eine Machbarkeitsstudie ist in Arbeit. Zwei weitere AKWs sollen von einem japanischen<br />
Konsortium unter Führung von Toshiba, Hitachi und Mitsubishi errichtet werden. An den<br />
Bauplänen wird in Hanoi festgehalten. Vietnams staatliche Presse meldete „große Zustimmung“<br />
unter der Bevölkerung an den Standorten der geplanten Atomkraftwerke.<br />
Wasserkraft steht in Vietnam als Energieträger mit 38 Prozent Anteil an erster Stelle, gefolgt von<br />
Erdgas (30 Prozent), Kohle (18 Prozent) und Erdöl (5 Prozent). Vietnam verfügt über<br />
Anthrazitkohle (ca. fünf Milliarden Tonnen) und sehr ergiebige Offshore-Erdölvorkommen im<br />
Golf von Bac Bo sowie vor der Küste Südvietnams. Weitere Erdöl- und Erdgaslagerstätten werden<br />
im Gebiet der Paracel- und Spratley-Inseln im Südchinesischen Meer vermutet. Allerdings<br />
verhindern dort überlappende Territorialansprüche zwischen China, Vietnam und anderen ASEAN<br />
-Staaten noch deren Erschließung und Förderung.<br />
Kambodscha - Ein neues Erdöl-Dorado?<br />
Atomare Ambitionen bestehen in Phnom Penh derzeit nicht. Bislang wird der Energiebedarf des<br />
Landes fast vollständig durch Erdölimporte aus Vietnam abgedeckt. Kambodschas<br />
Stromproduktion erfolgt weitgehend durch Dieselgeneratoren. Die Strompreise des Landes gelten<br />
als die höchsten aller ASEAN-Staaten. Fast sechzig Prozent der Bevölkerung hat noch keinen<br />
Stromanschluss. Um die hohe Abhängigkeit von Energieimporten zu vermindern, setzt die<br />
Regierung verstärkt auf Wasserkraft: einige Staudämme sind in Kambodscha bereits im Bau,<br />
weitere in Planung. China und Vietnam haben die Finanzierung übernommen.<br />
Kambodschas Chancen, sich künftig zu einem Selbstversorger bei Erdöl und Kohle zu entwickeln,<br />
werden im Land optimistisch eingeschätzt. Im Golf von Siam war ein Konsortium unter Führung<br />
des US-Konzerns Chevron bereits 2005 bei Probebohrungen fündig geworden. Die dortigen<br />
Erdölvorkommen werden auf eine Größenordnung zwischen 500 Millionen und zwei Milliarden<br />
Barrel geschätzt. 2012 soll die Förderung in Angriff genommen werden. Im Norden Kambodschas<br />
wurden zudem Kohlevorkommen (150 Millionen Tonnen) entdeckt.<br />
Laos - Die Batterie Südostasiens<br />
Atomkraft ist in Laos kein Thema. Das kleine Land mit nur knapp sechs Millionen Einwohnern<br />
wird gern als „Batterie Südostasiens“ bezeichnet, weil dessen Energiepotenzial seine<br />
Nachbarländer ausreichend mit Strom versorgen könne. Laos nutzt Wasserkraft zur<br />
Energieproduktion, die durch eine Reihe von Staudämmen an den Zuflüssen zum Mekong erzeugt<br />
wird, der Laos auf einer Länge von über 2.000 Kilometern durchfließt. Die Wasserkraftprojekte<br />
werden u.a. von der Weltbank (USA), EGAT (Thailand) und EDF (Frankreich) finanziert und sind<br />
ganz auf die Bedürfnisse des energiehungrigen Thailand zugeschnitten, das den größten Teil des<br />
Stroms aufkauft. In Laos selbst ist nur rund ein Drittel der Bevölkerung an das Stromnetz<br />
angeschlossen.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 36 of 79<br />
15.06.2011<br />
Die Mega-Dammprojekte in Laos standen und stehen auch heute im Mittelpunkt scharfer Kritik.<br />
Deren Umwelt- und Sozialverträglichkeit wird von internationalen Umweltverbänden in Zweifel<br />
gezogen. Trotzdem sind in Laos weitere große Staudammprojekte in Planung. Die Eingriffe in das<br />
Mekong-Fluss-System haben bereits zu erheblichen Veränderungen des Wasserhaushaltes geführt.<br />
Betroffen sind nicht nur der Fischfang in Laos und dem Tonle Sap-See in Zentral-Kambodscha,<br />
der in der Regenzeit durch den Mekong gespeist wird. Gefahren drohen auch dem Reisanbau im<br />
Mekong-Delta Südvietnams durch reduzierte Wasserzufuhr.<br />
Thailand - Die Regierung zieht AKW-Pläne zurück<br />
Prognosen erwarten im Königreich bis 2022 eine Verdoppelung des Energiebedarfs und<br />
begründen damit den Bau von fünf Atomreaktoren. Diese sollen mit einer Gesamtleistung von<br />
5.000 Megawatt ab 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Machbarkeitsstudien des US-Unternehmens<br />
Burns & Roe liegen vor. Nach dem Fukushima-GAU in Japan kündigte Thailands Regierung eine<br />
Überprüfung der AKW-Projekte an. Als Alternative liegen Pläne für den Bau von zwei<br />
erdgasbetriebenen Kraftwerken mit je 800 MW-Leistung in der Schublade bereit. Sollten sich die<br />
Atompläne Bangkoks in absehbarer Zeit politisch nicht durchsetzen lassen, sollen weitere<br />
Kohlekraftwerke folgen.<br />
Politischer Widerstand gegen Staudämme, Kraftwerke und Erdgasleitungen hat in Thailand eine<br />
lange Tradition und verursachte in der Vergangenheit wiederholt Projektverzögerungen und<br />
Kostensteigerungen. Energie-Großprojekte werden von der Regierung künftig als politisch nur<br />
schwer durchsetzbar eingeschätzt. Thailand importiert deshalb auf Grundlage langfristiger<br />
Lieferverträge Erdgas aus Burma und Malaysia sowie Strom aus Wasserkraft aus dem<br />
Nachbarland Laos.<br />
Thailands Energiemix wird derzeit zu knapp 70 Prozent von Erdgas dominiert. An zweiter und<br />
dritter Stelle folgen Kohle mit 18 Prozent und Wasserkraft (3,4 Prozent). Braunkohle-Vorkommen<br />
im Norden des Landes dienen dem Eigenverbrauch. Nach Regelung der strittigen maritimen<br />
Grenzziehung mit Kambodscha ist zu erwarten, dass auch Thailand Nutznießer der<br />
Erdölvorkommen im Golf von Siam werden wird.<br />
Myanmar - Rohstoffreiches Land am Irrawaddy<br />
Meldungen über Pläne des burmesischen Militärregimes, einen Leichtwasser-Reaktor (zehn MW<br />
Leistung) zu Forschungszwecken mit russischer Unterstützung zu bauen, hatten 2007 weltweit für<br />
Aufsehen gesorgt. Von exilburmesischen Oppositionsgruppen gestreute Informationen, Burmas<br />
Militärs strebten mit Unterstützung Nord-Koreas die Entwicklung von Atomwaffen an, haben sich<br />
bislang nicht bestätigt.<br />
Burma gilt als eines der rohstoffreichsten Länder Asiens. Unter dem Meeresboden seiner<br />
maritimen Wirtschaftszone schlummern riesige Erdgas- und Ölvorkommen. Wirtschaftlichen<br />
Sanktionen zum Trotz sind westliche Energiekonzerne, u.a. Chevron (USA) und Total<br />
(Frankreich), aber auch PTT (Thailand), Daewoo International (Süd-Korea) und Petronas<br />
(Malaysia) seit vielen Jahren groß im Geschäft. Im Golf von Martaban wird Erdgas gefördert, das<br />
via Pipeline nach Ratchaburi in Thailand transportiert wird. Bangkok überweist den burmesischen<br />
Militärs dafür jährlich rund eine Milliarde US-Dollar. Die Röhren der Erdgasleitung wurden von<br />
der Mannesmann AG in Deutschland geliefert.<br />
Die Erdölvorkommen Burmas werden auf eine Größenordnung von 3,2 Milliarden Barrel<br />
geschätzt. Aktiv im Fördergeschäft sind bereits China National Petroleum (CNPC) und<br />
Sarubesneft (Russland). Eine Erdöl-Pipeline von Burma nach Yunnan in Südwest-China ist im<br />
Bau. China und Thailand wollen in den kommenden Jahren zudem Wasserkraftwerke am Salween<br />
-Fluss bauen, dessen Strom in ihre eigenen Netze eingespeist werden soll.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 37 of 79<br />
15.06.2011<br />
Singapur - Importe sichern Energieversorgung<br />
Der dichtbesiedelte Stadtstaat Singapur mit knapp 4,6 Millionen Einwohnern besitzt keine eigenen<br />
Rohstoffvorkommen. Erdgasimporte aus Malaysia und Indonesien stellen die Versorgung<br />
Singapurs mit Energie zu achtzig Prozent sicher. Weitere fünfzehn Prozent werden durch<br />
Erdölimporte abgedeckt. 2010 ließ die Regierung eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines<br />
Atomkraftwerkes in Auftrag geben.<br />
Brunei - Ein Sultan schwimmt in Erdöl<br />
Das kleine Sultanat Brunei an der Westküste der Insel Kalimantan ist Energieselbstversorger. Die<br />
reichen Erdgas- und Erdölvorkommen werden von einem Gemeinschaftsunternehmen unter<br />
Beteiligung von Royal Dutch-Shell (Niederlande/Großbritannien) gefördert und nach Japan, Süd-<br />
Korea, Taiwan und die USA exportiert. Trotz sinkender Förderquoten seiner fossilen Rohstoffe ist<br />
Kernenergie in Brunei (noch?) keine Option.<br />
Timor-Leste - Kleines Land mit großen Energievorkommen<br />
Vielversprechende Perspektiven für das nach Afghanistan zweitärmste Land in Asien: die Erdölund<br />
Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden im Gebiet zwischen Timor-Leste (Ost-Timor)<br />
und Australien zählen zu den größten im asiatisch-pazifischen Raum. Ein Streit um<br />
konkurrierende Souveränitätsansprüche scheint zwischen beiden Ländern vorerst beigelegt zu<br />
sein. Die Förderung ist von Royal Dutch-Shell in Angriff genommen worden. Gewinne aus dem<br />
Verkauf sollen zwischen beiden Staaten aufgeteilt werden. Noch erfolgt die Stromproduktion auf<br />
der kleinen Insel durch Dieselgeneratoren. 2008 wurde ein erstes von Norwegen erbautes<br />
Wasserkraftwerk in Betrieb genommen. Das Stromnetz befindet sich im Aufbau.<br />
Tendenzen in der Energiepolitik<br />
Eine kurze Bestandsaufnahme verdeutlicht: die Länder Südostasiens sind unterschiedlich mit<br />
fossilen Brennstoffen ausgestattet. Einem steigenden Energiebedarf steht eine tendenziell sinkende<br />
Eigenförderung (bei Erdöl und Kohle) gegenüber. Noch konzentrieren sich Energieexporte auf<br />
nachfragestarke Märkte in Japan, Südkorea und Taiwan, zunehmend auch China. In zehn Jahren<br />
schon könnte ganz Südostasien jedoch zum Netto-Erdölimporteur werden. Regenerierbare<br />
Energieträger (Wasser, Geothermie, Sonne, Wind) spielen eine insgesamt untergeordnete Rolle.<br />
Nur Indonesien und die Philippinen nutzen Dank ihrer vulkanischen Geologie bereits in<br />
nennenswertem Umfang geothermische Energie.<br />
Derzeit sind in Südostasien keine energiepolitischen Strategien erkennbar, die sich mit der<br />
Energieversorgung jenseits des Kohle- und Ölzeitalters befassen. Eine zumindest schrittweise<br />
Ablösung fossiler Energieträger ist nicht in Sicht. Energiepolitik bleibt auf den Einsatz von Erdöl,<br />
Kohle und Gas fixiert. Das Geschäftsmodell der Energiekonzepte beruht weiterhin auf<br />
zentralisierten Großkraftwerken. Eine Subventionspolitik hält die Energiepreise künstlich niedrig<br />
und belastet die Staatshaushalte. In Indonesien absorbierten Subventionen im Energiebereich 2010<br />
fast 13 Prozent des Budgets. Gleichwohl können hohe Treibstoffpreise auch soziale Unruhen<br />
auslösen (Indonesien 1998, Burma 2007). In Thailand sind die gegenwärtigen Subventionen für<br />
Diesel und Benzin eindeutig innenpolitisch motiviert: im Juli 2011 sollen im Königreich<br />
Parlamentswahlen erfolgen. Energiesparsamkeit gilt bei konsumverwöhnten Städtern zudem als<br />
unpopulär.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 38 of 79<br />
15.06.2011<br />
Konflikte um knappe Rohstoffe<br />
Eine sichere Energieversorgung ist schon lange nicht mehr nur eine Frage wirtschaftlicher<br />
Wettbewerbsfähigkeit, sondern vielmehr auch eng verbunden mit nationaler Sicherheit. Der<br />
Wettlauf um den Zugriff und die Kontrolle von Rohstoffen hat bereits begonnen und in Ost- und<br />
Südostasien erste Spannungen und zwischenstaatliche Konflikte ausgelöst: im Ostchinesischen<br />
Meer um die Senkaku/Daioyu-Inseln (China/Japan), im Südchinesischen Meer um die<br />
Inselgruppen von Spratley und Paracel (China/Vietnam und weitere ASEAN-Staaten), im Golf<br />
von Bac Bo (China/Vietnam), im Golf von Siam (Thailand/Kambodscha) und schließlich in der<br />
Timor-See (Timor-Leste/Australien). Das Objekt der Begierde? Fossile Energierohstoffe!<br />
Klimawandel soll Südostasien besonders treffen<br />
Modellberechnungen zufolge werden Indonesien, die Philippinen, Thailand und Vietnam die<br />
Folgen des globalen Klimawandels ganz besonders stark zu spüren bekommen. Sollte es zu einem<br />
prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels kommen, dann würden dichtbesiedelte Küstengebiete<br />
langfristig zunehmend unter Wasser gesetzt und Millionen von Menschen zur Umsiedlung<br />
gezwungen werden. Klimaforscher sehen jedoch nicht nur Millionenmetropolen wie Bangkok,<br />
Jakarta, Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) und Manila im Wasser versinken. Auch das Mekong-Delta<br />
in Süd-Vietnam, heute das bedeutendste Reisanbaugebiet für 90 Millionen Vietnamesen, wird<br />
dann nicht mehr die Bevölkerung versorgen können. Schon heute nimmt im Delta eine Versalzung<br />
zu, ganz abgesehen von dem schleichenden ökologischen Kollaps durch den massiven Einsatz<br />
chemischer Input-Leitungen. Ernteausfälle, Hungersnöte und soziale Unruhen würden die Folge<br />
sein. Trotz dieser (langfristig!) dramatischen Prognosen ist Klimawandel in Südostasien kein<br />
Thema.<br />
Indonesien (Bevölkerung 2010: 240 Millionen Menschen) ist mit fast 400 Millionen Tonnen<br />
Südostasiens größter CO2-Produzent. Der Grund dafür liegt insbesondere im Raubbau seiner<br />
tropischen Regenwälder. Diese dienen eigentlich als Kohlendioxid-Speicher, da sie Treibhausgase<br />
filtern und CO2-Emissionen binden. Mit Abholzung und Brandrodung gelangt gespeichertes<br />
Kohlendioxid jedoch wieder in die Atmosphäre und verstärkt den globalen Treibhauseffekt. Vor<br />
diesem Hintergrund ist somit auch der weiträumige Anbau von Ölpalmen auf der Insel Sumatra<br />
zur Gewinnung von Biosprit als ein Schritt in die falsche Richtung zu bewerten. Gleichwohl<br />
verlagern auch Emissionshandel, unterirdische CO2-Deponierung & andere scheinbar kreative<br />
Ideen ein globales Problem, das einschneidende Veränderungen verlangt - im Denken und in der<br />
politischen Praxis.<br />
Energie, Sicherheit und Klima - Problemfelder der Zukunft<br />
Trotz medienwirksam begleiteter UN-Klimakonferenzen von Kyoto, Bali und Kopenhagen findet<br />
ein öffentlicher Diskurs über den Zusammenhang von Energiepolitik, Klimawandel und einer neu<br />
zu definierenden Sicherheitspolitik in Südostasien nicht statt.<br />
Fast alle Länder Südostasiens haben das Kyoto-Protokoll zum internationalen Klimaschutz (1997)<br />
der UN-Klima-Rahmenkonvention von 1992 zwar ratifiziert, sich aber nicht zu einer<br />
verbindlichen Reduzierung ihrer CO2-Emissionen verpflichtet. Einigkeit bestand darin, einen<br />
globalen Temperaturanstieg von maximal zwei Prozent zuzulassen. „Es bleibt zu hoffen, dass sich<br />
auch das Klima daran hält“ - so Harald Welzer, Verfasser des Buches „Klimakriege“. Eine<br />
strategische Neuausrichtung in der Energiepolitik ist in Südostasien nicht in Sicht.<br />
*
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 39 of 79<br />
15.06.2011<br />
Literatur:<br />
Claus Leggewie/Harald Welzer: Das Ende der Welt, wie wir sie kennen - Klima, Zukunft und<br />
Chancen der Demokratie.<br />
Frankfurt/Main: Fischer Verlag, (3. Auflage) 2009. 278 Seiten. ISBN 3100433114.<br />
Harald Welzer: Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird.<br />
Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 2008. 300 Seiten. ISBN 3100894332.<br />
Michael T. Klare: Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict.<br />
New York: Henry Hott, 2002. 304 Seiten. ISBN 978-0805055764.<br />
INDIEN<br />
Im Bann des Schneeleoparden<br />
In Ladakh, dem äußersten Norden Indiens, leben noch Schneeleoparden. Wie<br />
es gelang, einen davon in freier Wildbahn zu beobachten erzählt diese<br />
Geschichte einer Suche im Himalaya.<br />
Von Thomas Bauer<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Im Bann des Schneeleoparden – eine Begegnung, die unvergessen bleibt.<br />
Foto Bauer.<br />
st er das, Jigmet?“ - Ich starre auf die Felswand, die sich sechzig Meter vor uns jäh erhebt. An<br />
einer Stelle scheint sich plötzlich der Boden zu bewegen. Die Umrisse eines großen Tieres<br />
schälen sich aus dem schneebedeckten Hintergrund. Dann stehe ich einem ausgewachsenen<br />
Schneeleoparden gegenüber.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 40 of 79<br />
15.06.2011<br />
Sein buschiger Schwanz, beinahe so lang wie sein Körper, zuckt nervös. Er dreht den massigen<br />
Kopf in unsere Richtung und wittert, als wolle er herausfinden, welche Absichten wir hegen, ehe<br />
er sich würdevoll in höhere Lagen zurückzieht und schließlich in einem Felsspalt verschwindet.<br />
Niemals zuvor habe ich ein anmutigeres Tier gesehen.<br />
Begegnung mit dem „Phantom der Berge“<br />
Die Hoffnung, einen der verbliebenen dreihundert Schneeleoparden Ladakhs in den rauen<br />
Berghängen des Himalaya zu entdecken, ließ mich gemeinsam mit fünf weiteren Abenteurern zu<br />
einer Reise der besonderen Art aufbrechen. Zwei auf außergewöhnliche Tierreisen spezialisierte<br />
Anbieter, die Berliner Planeta Verde (www.planeta-verde.de) und das in Kalifornien beheimatete<br />
KarmaQuest (www.karmaquest.com), haben sich zusammengetan, um Gästen in Ladakh ein selten<br />
gewordenes Naturereignis zu bieten: die Beobachtung von Schneeleoparden in freier Wildbahn.<br />
Das „Phantom der Berge“ – die letzten verbliebenen Schneeleoparden unseres<br />
Planeten leben in den Bergen des Himalayas.<br />
Foto Bauer.<br />
Die beiden wissen, was sie tun. Seit Jahren kooperieren sie mit der in Ladakhs Hauptstadt Leh<br />
ansässigen Umweltschutzorganisation Snow Leopard Conservancy. Deren Programmleiter, Jigmet<br />
Dadul, hat in seinem Leben vermutlich mehr Schneeleoparden gesehen als jeder andere. Er weiß,<br />
dass die scheuen Jäger ihrer Beute im Winter hinab in die Täler folgen. Dann kann man sie in<br />
Höhen zwischen drei- und fünftausend Metern beobachten. Außerdem, vertraut er mir zu Beginn<br />
unserer Reise mit einem Augenzwinkern an, sind die ansonsten einzelgängerischen Katzen dann<br />
auf Partnersuche und insofern etwas abgelenkt.<br />
Geduld muss man dennoch aufbringen. Jeden Tag verlassen wir mit Sonnenaufgang unser<br />
Zeltlager auf knapp viertausend Metern Höhe, folgen dem Verlauf mehrerer Täler, überwinden<br />
Hügel und Felsspalten und tasten uns auf vereisten Flüssen voran. Bei minus fünfzehn Grad beißt<br />
jeder Atemzug in der Nase, das Wasser in den Trinkflaschen gefriert zu Eisklumpen. In der<br />
ungewohnten Höhe setze ich langsam und konzentriert einen Schritt vor den anderen. „Genau wie<br />
eine Schildkröte“, bemerkt Jigmet taktvoll. Regelmäßig gehöre ich zu den Letzten, die eine<br />
Bewegung in der bizarren Mondlandschaft ausmachen. Jigmets Augen dagegen sind geübt darin,<br />
das Terrain abzusuchen. Beinahe stündlich läuft ein Blauschaf, ein Steinbock oder ein Fuchs vor<br />
die Linse seines Teleskops.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 41 of 79<br />
15.06.2011<br />
Der Gedanke, dass der rauchgraue Räuber, den wir so innig herbeisehnen, ganz in der Nähe ist<br />
und sich keine unserer Bewegungen entgehen lässt, macht unsere Suche zur Obsession. Nach<br />
einigen Tagen halten wir jeden von der Erosion verformten Felsen für einen Schneeleopardenkopf<br />
und vermuten den Gefleckten hinter jedem noch so kleinen Gebüsch. Nachts besucht er unsere<br />
Träume. Tatsächlich verschmilzt die Bergkatze zuweilen so gekonnt mit ihrer Umgebung, dass<br />
man ihr in Teilen Ladakhs magische Kräfte zuschreibt. In Liedern und Erzählungen ist vom<br />
„Phantom der Berge“ die Rede, dessen klagendes Rufen den Menschen nachts den Schlaf raubt<br />
und Kindern die Haare zu Berge stehen lässt. Es ist dieses Heulen, der Paarungsruf des<br />
Schneeleoparden, das bei westlichen Bergsteigern immer wieder Gerüchte über den Yeti befeuert.<br />
In keinem anderen Land der Welt drückt sich der Buddhismus so überzeugend und<br />
farbenfroh aus wie in Ladakh. Auf Dächern und Brücken wehen Gebetsfahnen.<br />
Foto Bauer.<br />
Das Erbe Tibets<br />
Dr. Rodney Jackson von der Snow Leopard Conservancy lächelt, wenn er solche Geschichten<br />
hört. Die Faszination, die von den letzten verbliebenen Schneeleoparden unseres Planeten ausgeht,<br />
führt ihn seit über dreißig Jahren auf die Spur der Tiere. Er hat früh erkannt, welches Potenzial der<br />
Schneeleopard für die Entwicklung ländlicher Gebiete in Ladakh besitzt. Und dass es sich lohnt,<br />
sich gemeinsam einzurichten, statt einander als Konkurrenten zu bekämpfen.<br />
„Wir setzen dabei vor allem auf die Zusammenarbeit mit dörflichen Gemeinschaften. In Ladakh<br />
haben wir ein Bildungsprogramm initiiert, das Schulkindern die Vorteile eines funktionierenden<br />
Ökosystems nahe bringt. Farmern gegenüber argumentieren wir, dass der langfristige Nutzen<br />
durch den aufkommenden Tourismus größer ist als der kurzfristige Schaden, den ein<br />
Schneeleopard anrichten kann. Gleichzeitig arbeiten wir darauf hin, dass die Gehege, in denen das<br />
Nutzvieh nachts untergebracht ist, durch Elektrozäune verstärkt werden. Auf diese Weise wird<br />
von vornherein ausgeschlossen, dass ein Schneeleopard ein Schaf oder eine Kuh reißt.“
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 42 of 79<br />
15.06.2011<br />
Autor Thomas Bauer vor dem Bergdorf Rumbak in 4.000 Metern Höhe.<br />
Foto Bauer.<br />
Tierkunde als Unterrichtsfach und ein modernes elektronisches Abwehrsystem: Dr. Jackson und<br />
sein Team haben verstanden, welch kostbaren Schatz die rauen Hänge des Himalaya beherbergen.<br />
Dabei wissen sie sich auf einer Linie mit den Grundüberzeugungen eines Volksglaubens, der das<br />
Töten von Lebewesen nur im äußersten Notfall erlaubt und langfristig sinnvolle Lösungen<br />
favorisiert.<br />
In keinem anderen Land der Welt drückt sich der Buddhismus so überzeugend und farbenfroh aus<br />
wie in Ladakh, das nach der Vertreibung des Dalai Lama durch die Chinesen das religiöse Erbe<br />
Tibets verwaltet. Auf Dächern und Brücken wehen Gebetsfahnen. Stupas in immer <strong>neuen</strong><br />
Ausformungen zieren Anhöhen. Bäche treiben Gebetsmühlen an. Klosteranlagen wie jene in<br />
Hemis und Thikse scheinen aus Felsen und auf Hügeln zu wachsen, so harmonisch fügen sie sich<br />
in die Umgebung ein. Hunderttausende Steine sind mit der Formel verziert, die Gläubige mit<br />
unendlicher Geduld wiederholen: Om Ma Ni Pad Me Hum – ein Segensgebet für Körper, Geist<br />
und Seele. Im äußersten Norden Indiens, der im Winter ausschließlich per Flugzeug erreichbar ist,<br />
fühlt sich der Gast auch heute noch in eine andere Welt versetzt.<br />
Das gilt an diesem Abend umso mehr, da wir unseren Triumph in Rumbak feiern. Alle zwanzig<br />
Bewohner des Dorfes, das sich zwischen mehreren Sechstausendern in einer Falte des Himalaya<br />
versteckt, sind zusammengekommen. Während sich „unser“ Schneeleopard längst in ein einsames<br />
Versteck zurückgezogen hat, singen und tanzen wir bis Mitternacht zu ladakhischer Volksmusik.<br />
Jigmet lächelt mir zu, und ich weiß, dass ich die Ereignisse der vergangenen Tage nie mehr<br />
vergessen werde.<br />
Thomas Bauers Ladakh-Reisebuch „Nurbu – Im Reich des Schneeleoparden“ erscheint 2012 im<br />
Wiesenburg Verlag. Mehr zum Autor: www.literaturnest.de<br />
Weiterführende Informationen zu Ladakh:<br />
Anreise:<br />
Von Delhi in knapp anderthalb Stunden mit Air India, Go Air, Jet Airways oder Kingfisher<br />
Airlines nach Leh.<br />
Organisation:<br />
*
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 43 of 79<br />
15.06.2011<br />
Die Reise in den Hemis-Nationalpark wird von Planeta Verde (www.planeta-verde.de) und<br />
KarmaQuest (www.karmaquest.com) jeden Winter (Ende Februar / Anfang März) angeboten.<br />
Voraussetzungen:<br />
Warme Kleidung („Zwiebelprinzip“), Stirnlampe und Sonnenschutz unerlässlich, Höhen- und<br />
Trekkingerfahrung von Vorteil.<br />
Unterkunft:<br />
In Leh im modernen Mittelklassehotel Omasila, unterwegs in Ein- oder Zweimannzelten sowie bei<br />
Gastfamilien in Rumbak. Vollpension während der gesamten Reise.<br />
Sonstiges:<br />
Obwohl keine Sichtungsgarantie gegeben werden kann, ist es Jigmet Dadul und seinem Team<br />
bislang immer gelungen, einen Schneeleoparden zu entdecken.<br />
RUMÄNIEN - SLOWAKEI<br />
Schlechtere Qualität von Lebensmitteln für<br />
Osteuropa?<br />
Lebensmittelkonzerne verkaufen in Osteuropa Produkte minderer Qualität<br />
mit der gleichen Verpackung wie im Westen. Dies ergab eine Studie des<br />
slowakischen Verbraucherschutzdienstes. Produkte wie Coca-Cola, Jacobs<br />
Krönung, Tchibo Espresso, Nescafé Gold sowie zwei Kotanyi-Pfeffersorten<br />
haben auf den Märkten in Mittel- und Osteuropa minderwertigere Qualität als<br />
in Westeuropa. Die Firmen schweigen oder führen die schlechten Ergebnisse<br />
auf „unterschiedliche Herstellungsdaten“ zurück.<br />
Von Ruxandra Stanescu<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
affee hat in Rumänien noch heute eine besondere Bedeutung. Im Kommunismus war er<br />
Mangelware. Für viele Rumänen ist es deswegen noch immer nicht ganz selbstverständlich,<br />
dass heute in den Regalen Produkte wie Jacobs Krönung oder Nescafé stehen.<br />
Doch viele Rumänen lassen sich lieber Kaffee und Schokolade von Verwandten oder Bekannten<br />
aus Deutschland oder Österreich schicken. Denn die westlichen Markenprodukte, die in Rumänien<br />
erhältlich sind, halten oft nicht das, was sie versprechen. Immer mehr Rumänen klagen, dass die in<br />
ihrem Land gekaufte Coca-Cola nicht so gut schmeckt wie in Wien oder München.<br />
Eine Studie offenbart minderwertige Zutaten<br />
Eine im April veröffentlichte Studie des slowakischen Verbraucherschutzdienstes, die von der EU<br />
-Vertretung in Bratislava finanziert wurde, weist nun darauf hin, dass an dem Verdacht etwas dran<br />
sein könnte. Die Studie behauptet, dass Coca-Cola, Jacobs Krönung, Tchibo Espresso, Nescafé<br />
Gold sowie schwarzer und roter Pfeffer des Herstellers Kotányi auf dem osteuropäischen Markt<br />
eine minderwertigere Qualität haben. Die Konsumentenschützer hatten in Supermärkten in<br />
Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien und Ungarn<br />
die gleichen Produkte eingekauft und miteinander verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass<br />
lediglich die Qualität von Milka-Schokolade unabhängig vom Absatzmarkt gleich war. Alle<br />
anderen Lebensmittel hatten in Deutschland und Österreich eine weitaus bessere Qualität.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 44 of 79<br />
15.06.2011<br />
Die Konsumentenschützer stellten zum Beispiel fest, dass Coca-Cola in Osteuropa mit Isoglucose<br />
gesüßt wird, die aus Maisstärke gewonnen wird und billiger ist. In Deutschland und Österreich<br />
dagegen werden Saccharose und Kristallzucker verwendet. Coca-Cola zeigt sich von den<br />
Vorwürfen überrascht. Ibolya Szabo, Senior Communication Manager Coca-Cola Europe, sagte,<br />
dass die Firma in vielen Ländern der Welt, einschließlich den USA, Stärkezucker benutze. In<br />
Deutschland und Österreich würde man genauso wie in Rumänien Raffinade benutzen. Man sei<br />
folglich „erstaunt über die angeblichen Laborbefunde bezüglich der in Rumänien verkauften Coca<br />
-Cola“ und werde diese eingehend prüfen, um zu eruieren, wie es zu dieser „Konfusion“ kommen<br />
konnte. Ein Sprecher der deutschen Coca-Cola-Zentrale erklärte, dass die in Deutschland<br />
verwendete „125 Jahre alte Rezeptur“ sich nicht von denen in anderen Staaten unterscheide.<br />
Die Studie wurde zwar von der EU-Kommission finanziert, doch der für den Verbraucherschutz<br />
zuständige Kommissar John Dalli, der bei einem Besuch in der Slowakei die Ergebnisse erhielt,<br />
reagiert verhalten. „Die Studie bezieht sich nur auf eine begrenzte Anzahl von Produkten,<br />
außerdem weiß ich nichts über die tatsächliche Verlässlichkeit der Ergebnisse“, sagte ein Sprecher<br />
des Kommissars. „Es ist durchaus üblich, dass Produkte der gleichen Marke in verschiedenen<br />
Ländern unterschiedlich hergestellt werden. Es ist Aufgabe der Unternehmen, die Qualität zu<br />
garantieren.“<br />
Geschäfte mit Importen aus Deutschland und Österreich<br />
In Osteuropa profitieren derweil findige Geschäftsleute vom angeblichen Qualitätsmangel der<br />
Produkte. Einer nennt sich beispielsweise Marius Popescu, will seinen richtigen Namen nicht<br />
nennen, fährt einmal pro Woche zur deutsch-österreichischen Grenze und kauft ein, was in<br />
Supermärkten gerade im Angebot ist. Im rumänischen Hermannstadt hält jede Woche ein Bus aus<br />
Deutschland und Österreich, voll mit Kaffee, Schokolade und Waschmittel. Am besten verkaufen<br />
sich in Hermannstadt Öl und Kaffee, vor Feiertagen Süßigkeiten.<br />
Dass dieses Geschäft nicht unbedingt legal ist, weiß Popescu. Denn Steuern zahlt er auf die<br />
verkauften Produkte nicht. Die Idee, den Handel mit Westprodukten zu intensivieren, kam ihm<br />
nach einem Deutschland-Besuch, von dem er für alle Nachbarn Kaffee mitbringen musste.<br />
Als er eines Tages seinen Job verlor, blieben die Fahrten, um Einkommen zu erzielen. Inzwischen<br />
hat er für seine Familie ein Haus gebaut und auch seine Geschwister ins „Geschäft“ gebracht. Von<br />
der slowakischen Studie weiß er zwar nichts, es kümmert ihn auch nicht. Denn er ist sicher, dass<br />
noch viel Zeit vergehen wird, bis die Rumänen die gleiche Qualität bekommen. Und sein Business<br />
floriert, denn inzwischen nimmt er auch Bestellungen für teurere Produkte wie Parfum entgegen.<br />
*<br />
Die Autorin ist Korrespondentin von n-ost. Das Netzwerk besteht aus über 50 Journalisten in ganz<br />
Osteuropa und berichtet regelmäßig für deutschsprachige Medien aus erster Hand zu allen<br />
Themenbereichen. Ziel von n-ost ist es, die Wahrnehmung der Länder Mittel- und Osteuropas in<br />
der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen unter www.n-ost.de.<br />
KULT-FISCH<br />
Wobla – gut zum Bier<br />
Statt Chips isst man in Russland zum Gerstensaft den Trockenfisch „Wobla“.<br />
Ein Selbstversuch in Astrachan.<br />
Von Ulrich Heyden
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 45 of 79<br />
15.06.2011<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Wobla-Verkauf auf einem Markt in Astrachan.<br />
(Foto: Heyden)<br />
s war ein gemütlicher Abend in einer russischen Küche. Ich befand mich gerade in<br />
Astrachan. Bei Nina, meiner Gastgeberin, gab es Hühnersuppe mit Nudeln. Plötzlich fragte<br />
mich die Hausherrin, ob ich einen Wobla probieren wolle. Wobla – zu Deutsch „kaspisches<br />
Rotauge“ – ist ein getrockneter Fisch, etwas größer als eine Männerhand und nicht dicker als ein<br />
Ringfinger. Ich hatte den salzigen Wobla schon in Moskau probiert, zum Bier in Künstlerateliers<br />
oder nach dem Banja-Schwitzbad. Aber einen Wobla direkt an der Fangstelle zu verspeisen, das<br />
wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.<br />
Fischer ziehen Rutilus caspicus aus der zugefrorenen Wolga<br />
Der Rutilus caspicus – so der lateinische Fachausdruck für den Wobla - zieht im März aus dem<br />
Kaspischen Meer zum Laichen in die Wolga, die zu dieser Zeit noch zugefroren ist. So sieht man<br />
im März auf der Wolga bei Astrachan ganze Trauben von Fischern, die auf Klappstühlen durch<br />
Eislöcher mit einer kleinen Angel die ersten Woblas fischen. Der kleine Delikatessen-Fisch wird<br />
dann mit den Innereien drei Tage in Salzlauge eingelegt und anschließend eine Woche an der<br />
frischen Luft getrocknet. Danach kann man das hart gewordene Flossen-Tier, welches zur Familie<br />
der Karpfenfische gehört, überall in Russland auf Freiluftmärkten oder an Kiosken kaufen, je nach<br />
Größe 25 bis 60 Rubel (1,5 Euro) das Stück.<br />
Nina fragte mich also, ob ich einen Wobla wolle. Meine Augen leuchteten bei diesem Angebot<br />
besonderes hell, denn ich konnte es kaum erwarten, den eigenartigen Geschmack des Rutilus<br />
caspicus zu kosten. Ich bekam die Delikatesse gereicht und meine Gastgeberin beobachtete, wie<br />
ich etwas unentschlossenen den trockenen Fisch-Schwanz abbrach. Nina ging mein Gefinger<br />
irgendwie zu langsam. Sie nahm mir das Schuppentier wieder aus der Hand. „Den Ausländern<br />
muss man aber auch alles zeigen“, dachte sie sich wohl und brach den silber-grauen Fisch<br />
entschlossen in der Mitte durch, so dass es krachte. Nun war es einfacher, die trockene Fischhaut<br />
vom Fleisch abzuziehen, das ebenfalls trocken und hart war.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 46 of 79<br />
15.06.2011<br />
So gut wie nichts wird übriggelassen<br />
Wir unterhielten uns über dies und das und dabei verschwand immer wieder ein Stück des<br />
salzigen Fleisches in meinem Mund. Zu meiner Freude fand ich meinem Wobla auch leuchtendgelben<br />
Rogen. Er war krümelig-trocken und hatte einen intensiven Geschmack. Irgendwann war<br />
die Prozedur für mich beendet und ich schob meinen Teller beiseite, doch Nina schaute streng auf<br />
den kleinen Berg von Haut, Gräten und Teilen der Wirbelsäule. Mit unwirschem Gesicht trat<br />
meine Gastgeberin wieder in Aktion. In dem was ich als Abfall hinterlassen hatte, fand Nina noch<br />
viele essbare Fisch-Stücke.<br />
Der Wobla ist ein Kult-Fisch. Maler haben ihn in ihre Stilleben integriert. Man findet ihn in jeder<br />
russischen Stadt auf Freiluftmärkten und in den Kiosken. Der Wobla, eingewickelt in<br />
Zeitungspapier, eignet sich vorzüglich zum Verzehr unterwegs. Dabei dient das Zeitungspapier als<br />
Tischdecke auf der Parkbank oder auf dem Klapptisch im Zug. Das kaspische Rotauge schätzen<br />
alle, die lange unterwegs sind, nicht nur Bahnreisende, sondern auch Piloten und sogar<br />
Kosmonauten.<br />
Protestaktionen wegen Kommerzialisierung des Fangs<br />
Die russischen Männer sind wahre Angel-Fanatiker. Sie stellen sich an jedes Gewässer und halten<br />
seelenruhig ihre Ruten raus. Doch die Jagd nach dem Wobla und anderen Schuppentieren wird<br />
nun Schritt für Schritt begrenzt. In Astrachan dürfen Hobbyangler pro Tag nicht mehr als fünf<br />
Kilogramm Fisch angeln. Schon 2010 unterzeichnete Präsident Dmitri Medwedew ein Gesetz,<br />
nachdem der Fischfang zum Teil kostenpflichtig wird. Findige Unternehmer wollen die besten<br />
Fangplätze zu Sport-Areals ausbauen und Angel-Lizenzen verkaufen.<br />
Doch nun fürchten die Hobby-Angler, dass man sie vom kostenlosen Fischfang ausschließen will.<br />
Nachdem im März 6.000 Fangplätze an Flüssen und Seen im ganzen Land an Angelsport-<br />
Unternehmen ausgelost wurden, kam es in vielen russischen Städten zu Protestaktionen. Dem<br />
russischen Tandem - Putin und Medwedew – kommen diese Proteste kurz vor den Wahlen sehr<br />
ungelegen und so verkündeten die beiden, man werde das Gesetz so ändern, dass genug freie<br />
Plätze für kostenloses Angeln erhalten bleiben.<br />
POLEN<br />
Warschaus kostbare Quellen<br />
In der Millionenstadt Warschau holen sich viele Bewohner ihr Trinkwasser am<br />
Brunnen. In nahezu jedem Wohnviertel stehen sie. Aus ihnen fließt kaltes,<br />
klares, kostenloses Wasser. Es stammt aus unterirdischen Quellen und kann<br />
bedenkenlos getrunken werden. Das Wasser aus den Rohren dagegen ist braun<br />
und riecht nach Chlor. Denn das Leitungssystem der Stadt ist veraltet und<br />
überfordert, die Rohre in vielen Häusern sind nicht saniert.<br />
Von Elisabeth Lehmann<br />
EM 06-11 · 05.06.2011
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 47 of 79<br />
15.06.2011<br />
Der Gang zum Brunnen gehört für den Warschauer Tadeusz Trzcinski zur<br />
Alltagsroutine.<br />
Foto: Elisabeth Lehmann<br />
er Gang zum Brunnen gehört für den Warschauer Tadeusz Trzcinski zur Alltagsroutine.<br />
Vier leere Plastikkanister hat er auf seinen Bollerwagen geladen. Gemächlich schlurft er an<br />
den Plattenbauten seines Viertels vorbei zu einem kleinen Brunnenhäuschen. Hier macht er<br />
halt, dreht die Wasserhähne auf und lässt klares Quellwasser in die Kanister fließen.<br />
Bequemer wäre es für Trzcinski, einfach das Leitungswasser aus dem Hahn zu nehmen. So hat er<br />
es jahrzehntelang gemacht. Doch seit 1996 der Brunnen gebaut wurde, boykottiert er die<br />
bräunliche, chlorversetze Brühe, die aus dem Hahn kommt.<br />
107 Brunnen stehen den Warschauern zur Verfügung<br />
Für viele Warschauer – vom Manager bis zur Hausfrau – ist der Brunnen eine Alternative zum<br />
Leitungswasser. Aus insgesamt 107 Brunnen schöpfen die Stadtbewohner täglich ihr Trinkwasser.<br />
Die unterirdischen Quellen sind ein Schatz, auf den sie und Millionen anderer Einwohner des<br />
Gebiets Masowien rund um die polnische Hauptstadt kostenlos zugreifen. Ursprünglich waren die<br />
unterirdischen Quellen als Notreserve gedacht, um im Fall von Naturkatastrophen oder Krieg<br />
Wasservorräte zu haben. In den 1990er Jahren begann die Stadt, Löcher zu bohren, um das<br />
Quellwasser an die Oberfläche zu befördern. Inzwischen gehört der Gang zum Brunnen für viele<br />
Bewohner zum Alltag.<br />
Der Rentner Trzcinski ist überzeugt von der Qualität des Wassers: „Das Tiefenwasser kommt aus<br />
300 Metern unter der Erde.“ Dort lagert es schon rund 30 Millionen Jahre. Auch Dariusz Rudas<br />
von der staatlichen Hygienebehörde Sanepid versichert: Das lange Lagern zwischen den<br />
Gesteinsschichten hat dem Wasser gut getan. „Dadurch enthält es heute jede Menge Mineralien<br />
wie Eisen oder Mangan.“<br />
In den Häusern: Verdreckte Kupferrohre, verrostete Hähne<br />
Das sind Stoffe, die dem normalen Leitungswasser in Warschau erst noch hinzugefügt werden<br />
müssen. Weil das Quellwasser allein für die Zweimillionen-Metropole nicht reicht, bereitet das<br />
Wasserwerk im Zentrum Warschaus das Weichselwasser auf. Doch die Wege, die das Wasser bis<br />
in die heimischen Küchen und Bäder zurücklegen muss, sind oft weit. Außerdem sind die
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 48 of 79<br />
15.06.2011<br />
Leitungsnetze, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, veraltet. So kommt das<br />
Wasser oft in schlechter Qualität in den Häusern an. „Wenn es unser Werk verlässt, entspricht es<br />
allen von der EU vorgeschriebenen Normen. Das wird regelmäßig vom Gesundheitsministerium<br />
überprüft und kann bedenkenlos getrunken werden. Aber wir können natürlich nicht für die<br />
Leitungen in den Häusern garantieren“, sagt Izabela Jezowska von den Warschauer<br />
Wasserwerken. Und hier gibt es vielfach verdreckte Kupferrohre und vorrostete Wasserhähne. Im<br />
Sommer mischen die Werke dem Wasser deshalb Chlor bei, erklärt Izabela Jezowska. Die Menge<br />
ist für Menschen zwar nicht gesundheitsschädigend, aber geschmacklich wahrnehmbar.<br />
Filter gegen zu viel Eisen und Mangan<br />
Doch kürzlich gab es auch Probleme mit dem ansonsten so klaren Brunnenwasser. Die staatliche<br />
Hygienebehörde bemängelte, dass das Quellwasser zu viel Eisen und Mangan enthalte. Die Werte<br />
seien zwar unbedenklich, versichert Sprecher Dariusz Rudas. Doch sie entsprächen nicht den<br />
Vorgaben des Ministeriums. So müssen viele der alten Brunnen nachgerüstet werden. Neue Filter<br />
sollen dem Wasser einen Teil der Mineralien entziehen. In die <strong>neuen</strong> Brunnen werden sie sofort<br />
eingebaut. Die Kosten trägt die Stadtteilverwaltung, in deren Bezirk der Brunnen steht. Die<br />
Einwohner Warschaus zahlen keinen Cent.<br />
*<br />
Die Autorin ist Korrespondentin von n-ost. Das Netzwerk besteht aus über 50 Journalisten in ganz<br />
Osteuropa und berichtet regelmäßig für deutschsprachige Medien aus erster Hand zu allen<br />
Themenbereichen. Ziel von n-ost ist es, die Wahrnehmung der Länder Mittel- und Osteuropas in<br />
der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen unter www.n-ost.de.<br />
ZEITGESCHICHTE<br />
Die Räumung von Karlshorst<br />
Eine Berliner Zeitzeugin erzählt vom Mai 1945. Die Karlshorster mussten ihre<br />
Wohnungen für die siegreichen Russen räumen. „Die Zeit war ein ständiges<br />
Wechselbad der Gefühle“, erinnert sie sich. Letztlich aber habe sie in den<br />
Russen trotz aller Übergriffe und erlittener Schikanen doch mehr die Befreier<br />
als die Besatzer gesehen.<br />
Von Juliane Inozemtsev<br />
EM 06-11 · 05.06.2011
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 49 of 79<br />
15.06.2011<br />
Zeitzeugin Lotti Reitschert aus Karlshorst.<br />
(Foto: Juliane Inozemtsev)<br />
iografien, wie die von Charlotte „Lotti“ Reitschert sind selten geworden heutzutage. Die fast<br />
90-jährige Berlinerin hat ihr Leben lang im östlich gelegenen Stadtteil Karlshorst gewohnt,<br />
der heute zum Doppelbezirk Lichtenberg-Hohenschönhausen gehört. „In meiner Kindheit in<br />
den zwanziger und dreißiger Jahren ging es hier noch recht ländlich zu, es gab kaum Verkehr und<br />
jeder kannte den Anderen“, erzählt die alte Dame mit den kurzen wießen Locken und den braunen<br />
Augen.<br />
Als Mädchen besuchte Lotti das Karlshorster Lyzeum. Von den Schrecken des Krieges blieb sie in<br />
den folgenden Jahren verschont, obwohl auch in Karlshorst Bomben fielen. „Ab 1941 stand ich in<br />
engem Briefkontakt mit einem jungen Soldaten an der Front. Er wurde später mein Mann.“ Auf<br />
dem Hochzeitsbild vom Mai 1944 sieht man ein glückliches junges Paar vor dem Karlshorster<br />
Standesamt – heute befindet sich an diesem Ort, weniger romantisch, die Hochschule für Technik<br />
und Wissenschaft.<br />
Wir hatten große Angst vor den Russen<br />
Doch das Glück der Beiden währte nicht lange. Lottis Mann kehrte nicht aus dem Krieg heim, den<br />
letzten Brief erhielt sie im April 1945, unmittelbar bevor die Befreiung Berlins durch die<br />
sowjetische Rote Armee begann. Karlshorst wird damals zum Hauptsitz der sowjetischen<br />
Militärführung und bereits in jenen Tagen macht erstmals das Gerücht die Runde, der Stadtteil<br />
solle für die Befreier, die zugleich neue Besatzer sind, geräumt werden.<br />
„Die meisten, auch ich, hatten große Angst vor den Russen“, erzählt Lotti. „Die Nazis hatten sie in<br />
ihrer Propaganda als Menschenfresser dargestellt. Wir glaubten das, weil wir es nicht besser<br />
wussten, denn in Karlshorst hatte es bis dato so gut wie keine Ausländer gegeben.“ Lotti selbst<br />
hatte zuvor nur einmal in ihrem Leben Ausländer gesehen, das war während der Olympischen<br />
Spiele 1936 gewesen.<br />
Die einrückenden Soldaten der Roten Armee sind keine Menschenfresser, aber viele von ihnen<br />
sind wegen des Erlittenen getrieben von Bitterkeit und Rachegefühlen. Und so kommt es kurz<br />
nach Kriegsende sehr häufig zu Plünderungen, Brandschatzungen und Vergewaltigungen. Einmal<br />
wird auch Lotti verfolgt, ein russischer Soldat feuert Salven aus seiner Pistole ab und brüllt: „Frau<br />
komm!“ Lotti rennt in Todesangst in den nächstbesten Hauseingang, stößt dort mit einem<br />
russischen Offizier zusammen. Der fragt sie, was passiert sei. Sie erzählt von dem Verfolger, der
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 50 of 79<br />
15.06.2011<br />
Offizier sagt, sie solle keine Angst mehr haben, sie stehe von jetzt an unter seinem Schutz. „Später<br />
erfuhr ich, dass die Deutschen seine Frau und seine kleine Tochter Lisa vor seinen Augen<br />
erschossen hatten“, sagt Lotti. „Und doch hasste dieser Mann uns Deutsche nicht. Das hat mich<br />
tief beeindruckt. Ich wieß nicht, ob ich an seiner Stelle so großherzig hätte sein können.“<br />
„Jeder Karlshorster durfte einen Koffer mitnehmen sowie<br />
einen Beutel mit Lebensmitteln. Bis spätestens 18 Uhr sollten<br />
alle ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben“<br />
Am 3. Mai kommt der offizielle Räumungsbefehl von der sowjetischen Führung. Lotti arbeitet zu<br />
dieser Zeit als Sachbearbeiterin in der neu gegründeten Karlshorster Bürgermeisterei unter dem<br />
kommissarisch eingesetzten jüdischen Bürgermeister Salomon, einem Überlebenden aus dem<br />
Konzentrationslager. Nachdem die junge Dolmetscherin Tatjana Bredow den Befehl ins Deutsche<br />
übersetzt hat, diktieren ihn der Bürgermeister und sein Stellvertreter den Schreibkräften, zu denen<br />
auch Lotti gehört. „Wir haben die ganze Nacht vom 3. Zum 4. Mai durchgearbeitet und den<br />
Befehl hundertfach mit Durchschlag an der Schreibmaschine abgetippt“, erzählt Lotti.<br />
Die Zettel werden an Bäumen und Hauswänden angeschlagen und außerdem über Megafone<br />
durch die Straßen getragen. „Jeder Karlshorster durfte einen Koffer mitnehmen sowie einen<br />
Beutel mit Lebensmitteln“, erinnert sich Lotti. „Bis spätestens 18 Uhr sollten alle ihre Wohnungen<br />
und Häuser verlassen haben. Viele wussten auf die Schnelle gar nicht, wohin.“<br />
Zunächst habe es geheißen, die Bevölkerung dürfe in einem halben Jahr zurückkehren, so Lotti.<br />
„Viele Leute nahmen deshalb nur Sommersachen mit.“ Kaum jemand habe geahnt, dass die<br />
Sowjets bis in die 60er Jahre in den Wohnungen bleiben würden. „Ich wieß noch, dass meine<br />
Mutter als erstes die schmutzige Wäsche einpackte, weil sie befürchtete, die Russen könnten<br />
schlecht über sie denken, wenn sie diese in der Wohnung vorfänden. Eigentlich verrückt, nicht<br />
wahr?“, sagt Lotti. Sie und ihre Eltern bezogen eine kleine Wohnung im sogenannten Fuchsbau,<br />
einem Teil von Karlshorst, der außerhalb der Sperrzone lag. „Anfangs war das geräumte Gebiet<br />
nur mit Schlagbäumen und vereinzelten Wachposten markiert, erst später wurde es mit Zäunen<br />
abgeriegelt“, so Lotti.<br />
„Mir tat es in der Seele weh, dass sie nun alles einfach so<br />
zurücklassen sollten“<br />
In der Nacht vom 8. Auf den 9. Mai 1945 wird die bedingungslose Kapitulation durch die<br />
deutschen Nationalsozialisten und die Alliierten in Karlshorst ratifiziert. „Ich war froh, dass der<br />
Krieg endlich vorbei war, aber auch ärgerlich darüber, wie die Räumung von Karlshorst<br />
vonstattengegangen war“, sagt Lotti. „Meine Eltern hatten sich erst 1936 komplett neu<br />
eingerichtet und dafür hatten sie viele Jahre hart gespart. Mir tat es in der Seele weh, dass sie nun<br />
alles einfach so zurücklassen sollten.“<br />
Und so beschließt Lotti, noch einmal mit ihren Eltern in die Sperrzone zu fahren, um noch<br />
Einiges aus der Wohnung zu holen. Sie spricht einen Fuhrwerkbesitzer an, der mit seiner Familie<br />
aus den Ostgebieten geflohen ist. Dieser ist bereit zu helfen, will das Fuhrwerk aber selbst lenken.<br />
„Er wollte es nicht aus der Hand geben, weil es alles war, was er noch besaß“, sagt Lotti.<br />
Es gelingt ihr, in der Bürgermeisterei einen der wenigen „propuski“ (Passierscheine) zu<br />
bekommen. Er ist genau einen Tag lang gültig und berechtigt dazu, durch das Sperrgebiet zu<br />
fahren. Er berechtigt jedoch keinesfalls zum Abholen von Möbeln aus der alten Wohnung. Das ist<br />
streng verboten. Doch dieses Risiko gehen alle Beteiligten ein. Aber dann hat der Fahrer des<br />
Fuhrwerks ausgerechnet an dem Tag, wo der Passierschein gültig ist, keine Zeit. Und so fahren sie
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 51 of 79<br />
15.06.2011<br />
einen Tag später, als geplant. Dass sie nun illegal im Sperrgebiet unterwegs sind, wieß nur Lotti,<br />
nicht aber ihre Eltern und der Fahrer des Fuhrwerks. “Rückblickend war das ziemlich leichtsinnig,<br />
ich wusste, dass uns allen eine harte Strafe drohen könnte. Aber als junger Mensch geht man doch<br />
davon aus, dass alles gut geht“, sagt sie.<br />
„Persönliche Sachen, wie die Fotoalben der Familie, hatten<br />
die <strong>neuen</strong> Bewohner bereits entsorgt“<br />
Das Hineinkommen in das Sperrgebiet ist zu dieser Zeit noch kein Problem. Es ist ein russischer<br />
Feiertag, an dem nur die wichtigsten Wachposten besetzt sind und es gibt genügend<br />
Schleichwege. Lotti hat noch einen Schlüssel zur Wohnung, damit kommen sie rein. Dann laden<br />
sie so schnell wie möglich auf: zwei Betten, zwei Nachttische, ein Liegesofa, eine Nähmaschine,<br />
einen Schrank. „Persönliche Sachen, wie die Fotoalben der Familie, hatten die <strong>neuen</strong> Bewohner<br />
bereits entsorgt“, sagt Lotti. „Aber praktische Dinge hatten auch Vorrang.“ Gerade als sie<br />
abfahren wollen, werden sie vor dem Haus von einem bewaffneten Wachposten entdeckt und zur<br />
Rede gestellt: „Stoj stoj – nix fahren!“ ruft er. Er sieht sofort, dass der Passierschein abgelaufen ist<br />
und schickt Lotti zu seinem Vorgesetzten in die „Kommandantura“. Ihre Eltern und der Fahrer<br />
warten indessen angsterfüllt mit dem beladenen Fuhrwerk am Schlagbaum.<br />
Lotti erzählt dem Offizier, dass sie nur ein paar Kleinigkeiten holen wollte. „Natürlich habe ich<br />
nicht verraten, dass am Schlagbaum ein voll bepacktes Fuhrwerk steht“, sagt sie, „und zum Glück<br />
hat er meine Angaben nicht überprüft.“ Der Offizier stellt ihr einen gültigen Passierschein aus,<br />
will aber als Gegenleistung, dass sie um 18 Uhr zu einem Stelldichein wieder kommt. Lotti ahnt,<br />
was das heißt. Doch zum Schein willigt sie ein. „Danach hatte ich eine ganze Weile Angst, dass er<br />
mich ausfindig macht.“ Doch sie hatte wieder Glück, nichts dergleichen passierte.<br />
„Diese Zeit war ein ständiges Wechselbad der Gefühle“, sagt Lotti. „Einerseits haben uns die<br />
Russen von den Nazis befreit. Doch dann haben sie uns bei der Räumung von Karlshorst alles<br />
genommen. Einiges haben wir später zurückbekommen, anderes nie wieder gesehen. Manche<br />
haben uns bedroht, wieder andere beschützt.“ Lotti denkt einen Moment nach. Dann sagt sie:<br />
„Aber insgesamt habe ich die Russen doch weniger als Besatzer gesehen, denn als Befreier.“<br />
ZWEITER WELTKRIEG<br />
Juni 1941: Angriff auf die Sowjetunion<br />
Vor 70 Jahren, im Morgengrauen des 22. Juni 1941griffen mehr als 120<br />
deutsche Divisionen die Sowjetunion an. Auf einer Front von 2130 Kilometern<br />
Länge, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, rückte die deutsche<br />
Wehrmacht vor. Sie nannte ihren Überfall „Unternehmen Barbarossa“. Vom<br />
8. auf den 9.Mai 1945, nachdem Millionen von Soldaten und Zivilisten elend<br />
umgekommen waren, endete die europäische Tragödie mit der<br />
bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches. – Versuch einer Analyse<br />
zur Rolle Hitlers und Stalins, 70 Jahre danach.<br />
Von Leonid Luks<br />
EM 06-11 · 05.06.2011
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 52 of 79<br />
15.06.2011<br />
<strong>Zur</strong> Person: Leonid Luks<br />
Prof. Dr. Leonid Luks wurde 1947 in Sverdlovsk (heute Ekaterinburg) geboren. Er<br />
studierte Slavische Philologie, Osteuropäische und Neuere Geschichte in Jerusalem<br />
und München. Seine Promotion (1973) und auch seine Habilitation (1981) erfolgten<br />
an der Ludwig- Maximilians-Universität München.<br />
Luks war danach Hochschullehrer an den Universitäten München, Bremen und<br />
Köln. Seit 1995 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Mittel- und Osteuropäische<br />
Zeitgeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.<br />
Außerdem ist Luks Mitherausgeber der Zeitschriften „Forum für osteuropäische<br />
Ideen- und Zeitgeschichte“ (http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/index.htm)<br />
sowie „Forum novejšej vostočnoevropejskoj istorii i kul'tury“ (http://www1.kueichstaett.de/ZIMOS/forumruss.html)<br />
s war Hitlers und Stalins Krieg. Als Hitler am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, befand<br />
sich die sowjetische Bevölkerung bereits seit zwölf Jahren im Krieg. Dieser Krieg wurde ihr<br />
im Jahre 1929 – im „Jahr des großen Umbruchs“ – von Josef Stalin erklärt.<br />
Damals entschloss sich der sowjetische Diktator zu einem waghalsigen und aus der Sicht vieler<br />
Zeitzeugen undurchführbaren Unternehmen – nämlich zur gänzlichen Enteignung der russischen<br />
Bauernschaft, die Stalin als die „letzte kapitalistische Klasse“ Russlands bezeichnete. Mehr als<br />
100 Millionen Menschen – etwa 80 Prozent der Bevölkerung – sollten ihres Hab und Guts beraubt<br />
werden. Auf diese Kriegserklärung antworteten die Bauern mit einem verzweifelten Widerstand.<br />
Die wehrlose Landbevölkerung Russlands hatte keine Chance<br />
Einer der scharfsinnigsten Beobachter der damaligen Entwicklung, der russische Exilhistoriker<br />
Georgij Fedotow, schrieb 1931: „Nun entscheidet sich das Schicksal Russlands für die nächsten<br />
Jahrhunderte. Sollte das Volk diese entscheidende Schlacht verlieren, wird es aufhören, Subjekt<br />
der Geschichte zu sein“.<br />
Die wehrlose Landbevölkerung hatte keine Chance, diesen Krieg gegen den totalitären Leviathan<br />
zu gewinnen, der in seinen Händen so viele Machtmittel kumuliert hatte, von denen Thomas<br />
Hobbes nicht einmal hätte träumen können. Aber noch wirksamer als die direkten
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 53 of 79<br />
15.06.2011<br />
Terrormaßnahmen lähmte die Hungersnot von 1932/33 den Widerstand der Bauern, die größte<br />
Hungersnot in der Geschichte des Landes, die infolge der brutalen Enteignungspolitik des<br />
Regimes ausbrach.<br />
Wurde der Hunger von der Stalin-Clique als Waffe benutzt, um das aufsässige Bauerntum zu<br />
bestrafen? Solche Vermutungen werden in Ost und West wiederholt geäußert. Wie dem auch sei,<br />
eine direkte Verbindung zwischen der Kollektivierung der Landwirtschaft und der damaligen<br />
Hungerkatastrophe steht für die Mehrheit der Kenner der Thematik außer Zweifel. Der<br />
sowjetische Agrarhistoriker Viktor Danilow schrieb zur Zeit der Gorbatschowschen Perestroika<br />
(1988): „Der Hunger von 1932–33 stellte das schrecklichste Verbrechen Stalins dar. Dies war eine<br />
Katastrophe, die die gesamte künftige Entwicklung des sowjetischen Dorfes entscheidend prägte.“<br />
Parteitag der Sieger – Parteitag der Selbstmörder<br />
Mitte der 1930er Jahre – nach der Bezwingung des sowjetischen Bauerntums – gebärdete sich die<br />
bolschewistische Partei wie ein allmächtiger Demiurg, der imstande sei, über Nacht eine neue<br />
Welt zu kreieren. Der 17. Parteitag der Bolschewiki, der im Januar 1934, also unmittelbar nach<br />
der endgültigen Niederlage der sowjetischen Bauern stattfand, wurde von den<br />
Parteipropagandisten sogar als „Parteitag der Sieger“ bezeichnet. In einer gleichgeschalteten<br />
Gesellschaft stellte indes eine derart selbstbewusste Partei einen Fremdkörper dar. Einige Jahre<br />
später – zur Zeit des „Großen Terrors“ von 1936–1938 – wurde die sowjetische Machtelite, die<br />
unangefochten alle Machthebel im Staat kontrollierte und die wichtigste Grundlage des Regimes<br />
darstellte, enthauptet. Der „Fremdkörper“ wurde in den gesamtgesellschaftlichen Organismus<br />
integriert.<br />
Anders als die sowjetische Bauernschaft hat sich die sowjetische Oligarchie gegen den<br />
Vernichtungsfeldzug, den Stalin gegen sie richtete, kaum gewehrt. Nicht zuletzt deshalb hat der<br />
Moskauer Historiker Michail Gefter den „Parteitag der Sieger“ von 1934 in „Parteitag der<br />
Selbstmörder“ umbenannt.<br />
„Stalin führt einen Krieg gegen ganz Russland“<br />
Im April 1938 – auf dem Höhepunkt des „Großen Terrors“ – schrieb Fedotow: „Stalin führt einen<br />
Krieg gegen ganz Russland, wenn man ein einseitiges Abschlachten von […] wehrlosen<br />
Gefangenen einen Krieg nennen kann […] Ein Mann gegen das ganze Land. Noch nie war die<br />
Lage Russlands derart verzweifelt. “<br />
Zu den verhängnisvollsten Folgen dieses Krieges gehörte die Enthauptung der Roten Armee,<br />
ausgerechnet am Vorabend des deutsch-sowjetischen Krieges. Die Ausmaße dieser Gewaltorgie<br />
demonstrieren z.B. folgende Zahlen: Im deutsch-sowjetischen Krieg fielen etwa 600 sowjetische<br />
Generäle. Im Krieg Stalins gegen die Rote Armee von 1937–39 fielen dreimal so viele Generäle<br />
bzw. Dem Generalsrang Gleichgestellte zum Opfer. Während Stalin im Krieg gegen das eigene<br />
Volk beträchtliche Erfolge verbuchen konnte, versagte er bei der Aufgabe der Verteidigung des<br />
Landes gegen außenpolitische Feinde beinahe gänzlich. Auf diesem Gebiet war er, wie Fedotow<br />
mit Recht betont, ein hoffnungsloser Stümper.<br />
Als sich die Westmächte nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Hitler im März 1939<br />
von ihrer kurzsichtigen und selbstzerstörerischen Appeasementpolitik abwandten und sich<br />
bereiterklärten, gemeinsam mit Moskau die Aggressionsgelüste Hitlers einzudämmen, entschloss<br />
sich Stalin aus einem kurzsichtigen machiavellistischen Kalkül zu einem Bündnis mit dem<br />
gefährlichsten Feind, mit dem Russland je konfrontiert worden war.<br />
Die sowjetische Rückendeckung ermöglichte Hitler nach seinem Überfall auf Polen beispiellose<br />
militärische Erfolge. Da er im Osten nichts zu befürchten hatte, unterwarf er innerhalb von etwa
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 54 of 79<br />
15.06.2011<br />
20 Monaten beinahe den gesamten außerrussischen Teil des europäischen Kontinents. Immense<br />
demographische und industrielle Ressourcen standen jetzt dem NS-Staat und seinen Vasallen zur<br />
Verfügung. Nun hielt Hitler die Zeit für gekommen, um seinen bereits in Mein Kampf<br />
entworfenen Plan der Eroberung des Lebensraums im Osten zu realisieren.<br />
Das „Unternehmen Barbarossa“<br />
Am 31. Juli 1940 fand auf dem Obersalzberg ein Treffen Hitlers mit der Führung der Wehrmacht<br />
statt. Hitlers Worte wurden vom Generalstabschef des Heeres Halder folgendermaßen<br />
zusammengefasst: „Im Zuge einer Auseinandersetzung muss Russland erledigt werden […]<br />
Operation hat nur Sinn, wenn wir [den russischen Staat] in einem Zuge zerschlagen. Gewisser<br />
Raumgewinn allein genügt nicht“.<br />
Hitlers Absicht, eine neue Front zu eröffnen, bevor der Krieg gegen England zu Ende ging, rief<br />
bei einigen Vertretern des konservativen Establishments des Reiches Skepsis hervor. Indes blieben<br />
alle Versuche der konservativen Verbündeten Hitlers, dem abenteuerlichen Vorgehen des<br />
„Führers“ Einhalt zu gebieten, erfolglos. Die Konservativen gaben, ähnlich wie bei früheren<br />
Konfliktsituationen, letztendlich nach, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie, trotz aller<br />
Vorbehalte, mit vielen Punkten des außenpolitischen Programms Hitlers übereinstimmten. Der<br />
Militärhistoriker Manfred Messerschmidt spricht in diesem Zusammenhang von einer<br />
„Teilidentität der Ziele“.<br />
Der Krieg gegen die Sowjetunion wurde von Hitler bewusst als Krieg neuer Art, als<br />
weltanschaulicher Vernichtungskrieg konzipiert.<br />
Auch Heinrich Himmler dachte damals über die Zukunft Russlands nach: „Zweck des<br />
Russlandfeldzugs [ist] die Dezimierung der slawischen Bevölkerung um 30 Millionen“.<br />
Deutsche Generäle zum Vernichtungskrieg bereit<br />
Die Äußerungen Hitlers und Himmlers überraschen nicht. Massenmorde sind für das Vorgehen<br />
totalitärer Herrscher beinahe konstitutiv. Wichtiger ist die Frage, wie die deutschen Generäle auf<br />
solche Pläne reagierten, auf Gedankengänge also, die all ihre bisherigen Vorstellungen vom Krieg<br />
aus den Angeln hoben. Dabei darf man nicht vergessen, dass es sich bei diesen Generälen nicht<br />
selten um die gleichen Militärs handelte, die noch in den 1920er und zu Beginn der 30er Jahre mit<br />
dem künftigen Kriegsgegner – der Roten Armee – eng zusammengearbeitet hatten. Dessen<br />
ungeachtet konnte man, wenn man von einigen Ausnahmen absieht, so gut wie keinen<br />
vernehmbaren Widerstand gegen die von der NS-Führung konzipierte Vorgehensweise<br />
registrieren.<br />
Ernst Nolte bezeichnete seinerzeit das von Hitler im Dezember 1940 endgültig bewilligte<br />
„Unternehmen Barbarossa“ als den „ungeheuerlichsten Eroberungs-, Versklavungs- und<br />
Vernichtungskrieg, den die moderne Geschichte kennt“.<br />
Dass dieser Krieg ausgerechnet von einem Land geführt wurde, dem viele außenstehende<br />
Beobachter eine übertriebene Russophilie, eine maßlose Verklärung der rätselhaften russischen<br />
Seele vorwerfen, erstaunt.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 55 of 79<br />
15.06.2011<br />
Seit Herbst 1940 wurde Moskau fortwährend vor einem<br />
bevorstehenden Überfall Hitlers gewarnt.<br />
Am 15. Juni 1941 berichtete der sowjetische Top-Spion Richard Sorge aus Tokio, dass der<br />
deutsche Angriff am 22. Juni erfolgen werde. Stalin versah diesen Bericht mit dem Kommentar:<br />
„Eine deutsche Desinformation“.<br />
Angesichts dieser Stalinschen Vogel-Strauß-Politik stellt sich nun die Frage, ob die<br />
propagandistische These der NSDAP, der deutsche Angriff auf die Sowjetunion sei lediglich ein<br />
Präventivkrieg gewesen, vertreten werden kann. Diese These wurde nämlich 1985 vom<br />
ehemaligen Offizier des sowjetischen Nachrichtendienstes und Amateurhistoriker Viktor Suvorov<br />
(V. Rezun) wieder aufgewärmt. Von der überwältigenden Mehrheit der Militärhistoriker, wenn<br />
man von einigen Ausnahmen absieht (Joachim Hoffmann), wird diese These als wissenschaftlich<br />
nicht haltbar verworfen.<br />
Stalin hatte panische Angst vor Hitler. Generalstabschef der Roten Armee Zhukow berichtet zum<br />
Beispiel über die erste Reaktion Stalins, nachdem ihm der deutsche Überfall gemeldet wurde:<br />
„Das ist eine Provokation der deutschen Militärs. Man soll kein Feuer eröffnen, um eine<br />
Eskalation zu vermeiden“.<br />
Erst drei Stunden nach dem Beginn des deutschen Angriffs sei von Stalin die Erlaubnis erteilt<br />
worden, zurückzuschießen.<br />
Der „erste deutsch-sowjetische Krieg“ und sein Ende - vom<br />
Hitlerschen Überfall auf die UdSSR bis zur Schlacht von<br />
Moskau<br />
Das stalinistische Regime, das seit Anfang der 30er Jahre einen grausamen Krieg gegen imaginäre<br />
Volksfeinde geführt hatte, wurde am 22. Juni 1941 mit wirklichen Feinden konfrontiert. Vieles<br />
sprach dafür, dass es diese harte Bewährungsprobe nicht überstehen würde. Das Debakel der<br />
Roten Armee in den ersten Monaten des Krieges gehört zu den größten Katastrophen in der<br />
gesamten Militärgeschichte.<br />
Der deutsch-sowjetische Krieg bestand praktisch aus zwei Kriegen, die sich grundlegend<br />
voneinander unterschieden. Und im „ersten“ Krieg, der sich im Sommer und im Herbst 1941<br />
abspielte, erlitt die Rote Armee eine verheerende Niederlage. Am 3. Juli 1941 schrieb der<br />
Generalstabschef Halder: „Es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass der Feldzug<br />
gegen Russland innerhalb von vierzehn Tagen gewonnen wurde.“<br />
Die verheerenden Niederlagen der Roten Armee im Sommer und im Herbst 1941 lassen sich nicht<br />
allein auf Stalins Verbot zurückführen, rechtzeitig wirksame militärische Gegenmaßnahmen zu<br />
ergreifen, oder auf den Überraschungseffekt des deutschen Angriffs. Nicht weniger wichtig war<br />
auch die Tatsache, dass der Roten Armee 1941 Tausende von Offizieren fehlten, die Stalin 1937–<br />
39 hatte ermorden lassen.<br />
Das Debakel der Roten Armee war wohl auch durch die erschreckend niedrige Kampfmoral vieler<br />
sowjetischer Soldaten zu Beginn des Krieges bedingt. Der brutale Terror der 30er Jahre, der sich<br />
praktisch gegen alle Schichten der Gesellschaft gerichtet hatte, musste sich zwangsläufig<br />
verheerend auf die Moral der Bevölkerung auswirken.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 56 of 79<br />
15.06.2011<br />
Um Hitler zu begreifen, war ein erst Lernprozess nötig<br />
Die defätistische Stimmung, die einige Teile der sowjetischen Bevölkerung und sogar der Armee<br />
erfasste, war nicht zuletzt dadurch bedingt, dass diese Gegner des sowjetischen Regimes sich<br />
zunächst über die Absichten der nationalsozialistischen Führung nicht im Klaren waren. Sie<br />
mussten, ähnlich wie früher viele westliche und sowjetische Verfechter der Appeasementpolitik<br />
Hitler gegenüber, aber auch wie viele deutsche Konservative, einen Lernprozess durchlaufen, um<br />
zu begreifen, dass eine partielle Identifizierung mit dem Nationalsozialismus nur Hitler nutzt, für<br />
seine Verbündeten aber verheerende Folgen nach sich zieht.<br />
In den Monologen Hitlers im Führerhauptquartier kann man nachlesen, wie der deutsche Diktator<br />
sich die Zukunft des eroberten Ostens vorstellte. Ein Beispiel sollte genügen: Am 17. Oktober<br />
1941 führte Hitler aus:<br />
„Die Eingeborenen? Wir werden dazu übergehen, sie zu sieben. Den destruktiven Juden setzen<br />
wir ganz aus […] In die russischen Städte gehen wir nicht hinein, sie müssen vollständig<br />
ersterben. Wir brauchen uns da gar keine Gewissensbisse zu machen … [Wir] haben überhaupt<br />
keine Verpflichtungen den Leuten gegenüber“.<br />
Als sich die Brutalität des deutschen Besatzungsregimes in voller Deutlichkeit zeigte, nahm die<br />
defätistische Stimmung in der sowjetischen Bevölkerung eindeutig ab. Immer weniger Soldaten<br />
der Roten Armee sahen es als Ausweg an, in deutsche Kriegsgefangenschaft zu geraten. Es blieb<br />
ihnen nicht verborgen, was sie dort erwartete. Und dieser Umschwung im gesellschaftlichen<br />
Bewusstsein trug nicht unwesentlich zum späteren Sieg der UdSSR über das Dritte Reich bei.<br />
Durch den Krieg kam es in der Sowjetunion zu einer Art<br />
Kompromiss zwischen der bis dahin drangsalierten<br />
Gesellschaft und den Machthabern<br />
Um vom Dritten Reich nicht hinweggefegt zu werden, musste die stalinistische Clique, die sich<br />
bis dahin auf die Terrorisierung der eigenen Bevölkerung konzentriert hatte, das bestehende<br />
Unterdrückungssystem modifizieren, es etwas flexibler machen. Der Krieg war paradoxerweise<br />
mit einer gewissen Lockerung des Regimes verbunden. Es kam zu einer Art Kompromiss<br />
zwischen der bis dahin drangsalierten Gesellschaft und den Machthabern. Viele Offiziere,<br />
Ingenieure und Wissenschaftler, die während der Säuberungen von 1936-38 verhaftet worden<br />
waren, wurden nun aus den Gefängnissen und Straflagern entlassen und erhielten nicht selten<br />
erneut führende Positionen in der Armee oder Industrie.<br />
Einige bis dahin offiziell abgelehnte Schriftsteller und Dichter durften wieder publizieren, die<br />
Zensur wurde gelockert. Die bis dahin brutal verfolgte Russisch-Orthodoxe Kirche erhielt nun<br />
neue Betätigungsmöglichkeiten.<br />
Der bereits erwähnte Michail Gefter spricht im Zusammenhang mit den damaligen Entwicklungen<br />
sogar von einer „spontanen Entstalinisierung“, die sich 1941 ereignete.<br />
Der sowjetische Schriftsteller Konstantin Simonow bezeichnete viele Jahrzehnte später – zur Zeit<br />
der sogenannten Breschnewschen „Stagnation“ – den Krieg als den einzigen lichten Fleck in der<br />
sowjetischen Geschichte der letzten Jahrzehnte. Wie grauenhaft muss die sowjetische Wirklichkeit<br />
vor dem 22. Juni 1941 gewesen sein, wenn einer der brutalsten Kriege in der Geschichte der<br />
Menschheit als ein lichter Fleck, als eine Art innere Befreiung empfunden wurde!
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 57 of 79<br />
15.06.2011<br />
Kriegsgefangene wurden als Landesverräter betrachtet<br />
Man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, dass auch nach dem Ausbruch des Krieges<br />
Millionen von Menschen sich weiterhin im „Archipel Gulag“ befanden. Ganze Völker wurden ins<br />
Innere der Sowjetunion deportiert, weil man sie der Kollaboration mit dem Feind bezichtigte,<br />
wobei Tausende von Menschen von den Terrororganen ermordet wurden. Mit äußerster Härte<br />
wurden auch die eigenen Soldaten von der Kremlführung behandelt. Dies betraf vor allem die<br />
sowjetischen Kriegsgefangenen, die als Landesverräter betrachtet wurden. Die sowjetischen<br />
Industriearbeiter, vor allem in den rüstungsrelevanten Sektoren, wurden ihrerseits einer<br />
außerordentlich scharfen Arbeitsdisziplin unterworfen. Mit dem Dekret vom 26. Dezember 1941<br />
wurden die Arbeiter in der Rüstungsindustrie zwangsmobilisiert und wie Soldaten behandelt. Das<br />
eigenmächtige Verlassen der Betriebe galt als Fahnenflucht.<br />
Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in den unbesetzt gebliebenen Teilen der<br />
Sowjetunion fand sich mit der Verschärfung der Arbeitsdisziplin und mit den zusätzlichen<br />
Bürden, die das Regime ihr nach dem Ausbruch des Krieges auferlegte, in der Regel ab.<br />
Angesichts der tödlichen Gefahr, die das russische Staatswesen als solches bedrohte, sah man die<br />
Notwendigkeit dieser verschärften Maßnahmen im Wesentlichen ein. Sie waren durch reale und<br />
nicht durch imaginäre Gefahren wie in den 30er Jahren verursacht. Das stalinistische System<br />
wiederum – diese Verkörperung des Absurden – musste gewisse Konzessionen an die Realität<br />
machen, und schon das allein machte es in den Augen der Bevölkerung etwas erträglicher.<br />
Kurz vor Moskau wurde der deutsche Vormarsch gestoppt<br />
Dieser Kompromiss zwischen Regime und Bevölkerung wurde zur wichtigsten Ursache dafür,<br />
dass der „erste“ deutsch-sowjetische Krieg im Dezember 1941 zu Ende ging. Am 5. Dezember<br />
1941 wurde der deutsche Vormarsch kurz vor Moskau gestoppt und zurückgeschlagen.<br />
Der „zweite“ deutsch-sowjetische Krieg hatte nun begonnen, der im Mai 1945 im zertrümmerten<br />
Berlin sein Ende fand. Nach der verlorenen Luftschlacht über England erlitt Hitler im Dezember<br />
1941 die zweite große Niederlage in seiner Karriere seit 1930. Denn seit dem Triumph bei den<br />
Reichstagswahlen vom September 1930 hatte er im Grunde nur noch Siege gekannt. Er hatte es in<br />
der Regel mit demoralisierten, innerlich unschlüssigen Gegnern zu tun gehabt, die scharenweise<br />
vor ihm kapitulierten – bis er auf zwei Kräfte traf, die nicht zur Selbstaufgabe bereit waren: die<br />
Freiheitsliebe der angelsächsischen Nationen und den russischen Patriotismus. An diesen beiden<br />
Kräften sollten Hitler und sein Regime auch zerbrechen.<br />
Die Tragik Russlands bestand allerdings darin, dass es durch die Bezwingung seines äußeren<br />
Feindes lediglich seinen inneren Feind – die stalinistische Tyrannei – stärkte. Bereits einige<br />
Monate nach der Schlacht von Moskau begann das zunächst verunsicherte Regime, das verlorene<br />
innenpolitische Terrain wiederzugewinnen. Damit erschöpft sich aber nicht die Bedeutung des<br />
sowjetischen Sieges über das Dritte Reich: „Der stumme Streit zwischen dem siegreichen Volk<br />
und dem siegreichen Staat setzte sich fort. Von diesem Streit hing das Schicksal des Menschen,<br />
seine Freiheit ab“, schreibt der russische Schriftsteller Wassili Grossman in seinem Buch „Leben<br />
und Schicksal“, das zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts zählt. (Deutsch bei<br />
Claasen, 2007).<br />
Der nach innen gerichtete Kontrollzwang der stalinistischen Tyrannei band einen beträchtlichen<br />
Teil ihrer Kräfte und hinderte sie daran, so uferlos nach außen zu expandieren, wie dies bei der<br />
nationalsozialistischen Diktatur der Fall gewesen war.<br />
Die Übergänge zwischen Regime und Volk waren natürlich fließend. Die Stalinsche Despotie<br />
wäre ohne die partielle oder gänzliche Identifizierung beträchtlicher Teile der Gesellschaft mit ihr<br />
nicht lebensfähig gewesen. Trotz alledem bestand sie doch, diese Trennlinie zwischen Regime und
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 58 of 79<br />
15.06.2011<br />
Volk, dem die herrschende Clique bis zuletzt misstraute. Sie unternahm außerordentliche<br />
Anstrengungen, um es lückenlos zu kontrollieren. Dieser nach innen gerichtete Kontrollzwang der<br />
stalinistischen Tyrannei band einen beträchtlichen Teil ihrer Kräfte und hinderte sie daran, so<br />
uferlos nach außen zu expandieren, wie dies bei der nationalsozialistischen Diktatur der Fall<br />
gewesen war.<br />
Die „spontane Entstalinisierung“ der Kriegszeit verhallte übrigens nicht ohne Resonanz. Denn<br />
unmittelbar nach dem Tode Stalins knüpfte der reformorientierte Teil der Parteiführung an einige<br />
ihrer Postulate an. Und so begann in der UdSSR eine immer schärfer werdende<br />
Auseinandersetzung mit dem stalinistischen Terrorregime, die trotz mancher Rückschläge und<br />
Restaurationsversuche der Machthaber bis zur Auflösung der Sowjetunion dauern sollte. Die<br />
Entmachtung der KPdSU im August 1991 war nicht zuletzt die Folge dieser russischen Variante<br />
der Vergangenheitsbewältigung.<br />
NATO - RUSSLAND<br />
Ein steiniger Pfad<br />
Schon seit dem Untergang des Warschauer Paktes und der Auflösung der<br />
Sowjetunion steckt die NATO in einer Identitätskrise. Wie sollen die<br />
Beziehungen zum <strong>neuen</strong> Russland aussehen? Inwieweit ist die Gründungsidee<br />
der NATO mit einer partnerschaftlichen Beziehung Russland vereinbar? Ist<br />
für die Mehrheit der politischen Kräfte in Russland eine solche<br />
partnerschaftliche Beziehung mit der NATO annehmbar? Welche Fakten<br />
sprechen für eine Mitgliedschaft Russlands in der NATO und welche dagegen?<br />
Fragen von globaler Bedeutung, auf die hier Antworten gesucht werden.<br />
Von Kenan Engin<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
<strong>Zur</strong> Person: Kenan Engin<br />
Kenan Engin, geboren 1974 im türkischen Pertek, hat Politikwissenschaften und<br />
Europäische Kunstgeschichte an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg<br />
studiert. <strong>Zur</strong>zeit ist er Doktorand im Fach Politikwissenschaften, Bereich
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 59 of 79<br />
15.06.2011<br />
Internationale Beziehungen an der Ruprecht-Karls- Universität und arbeitet als<br />
Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg, FH Worms und FH Mainz. Seine<br />
Forschungsschwerpunkte: Türkei, Irak, Kurden und Mittlerer Osten. Neben seinen<br />
zahlreichen Essays und Gedichten ist er Verfasser von mehreren Büchern. Zuletzt<br />
erschienen: „Untersuchung zur Konfliktbewältigung im Irak: Ein föderalistisches<br />
Konzept.“<br />
ie Kooperation zwischen NATO und Russland in unterschiedlichen institutionellen Formen<br />
begann im Dezember 1991 und führte 2002 zur Gründung des NATO-Russland-Rats<br />
(NRC). Dieser Rat sollte gegenseitige Konsultationen ermöglichen, gemeinsame<br />
Entscheidungsfindungen und Aktivitäten erleichtern und regeln (Klein:2010). Dies spielte nach<br />
dem Anschlag auf das Word Trade Center 9/11 eine sehr wichtige Rolle. Damals, nach dem<br />
September 2001 erarbeiteten die beiden Seiten gemeinschaftlich Maßnahmen gegen den<br />
internationalen Terrorismus. Dies war zwar ein wichtiger Schritt vereinten Handelns, aber andere<br />
Fragen blieben strittig. Der NATO-Russland-Rat war nicht in der Lage, bei den hochbrisanten<br />
Themen wie Rüstungskontrolle und militärischer Kooperation einen Konsensus zu finden.<br />
Die Ineffektivität der partnerschaftlichen Kooperation lag und liegt daran, dass die Beziehungen<br />
zwischen Russland und der NATO außer durch die Erblasten des Kalten Krieges noch von zwei<br />
großen Krisen belastet wurden. Zuerst erreichte das gegenseitige Verhältnis während des Kosovo-<br />
Krieges 1999 seinen historischen Tiefstand, nachdem die NATO serbische Territorien aus der<br />
Luft angegriffen hatte. Die russische Regierung fror daraufhin die Beziehungen und jede<br />
Zusammenarbeit für ein halbes Jahr ein.<br />
Georgienkrieg: Russische Machtdemonstration gegen die<br />
NATO<br />
Auslöser der zweiten Krise war der Georgienkrieg im Sommer 2008. Eigentlich hatten sich die<br />
Beziehungen zwischen Russland und der NATO schon ab 2004 verschlechtert, nachdem Polen,<br />
Tschechien, Ungarn und acht weitere osteuropäische Staaten in die NATO aufgenommen wurden.<br />
Durch die sukzessiv näher rückenden NATO-Grenzen und den Beitrittswunsch von Georgien und<br />
der Ukraine in die NATO fühlte sich Russland bedroht (Bidder: 2010). Russland sah und sieht die<br />
Versuche der NATO unter der Führung der USA, im Kaukasus Einfluss auszuüben, als Versuch,<br />
eine unipolare Welt unter amerikanischer Dominanz zu konsolidieren. Dies wurde vom russischen<br />
Ministerpräsident Medwedew scharf kritisiert: „Die Welt muss multipolar sein. Eine unipolare<br />
Welt ist inakzeptabel. Vorherrschaft ist inakzeptabel. Wir können keine Weltordnung akzeptieren,<br />
in der alle Entscheidungen von einem einzigen Land getroffen werden. (…) Eine solche Welt ist<br />
instabil und birgt das Risiko von Konflikten.“ (Mellenthin:2008) Deshalb wird der Georgienkrieg<br />
von unterschiedlichen Expertenkreisen als die erste russische militärische Machtdemonstration<br />
interpretiert, die sich gegen die Ausdehnungspolitik der NATO richtete.<br />
Mit dem Ausbruch des Krieges im Sommer 2008 hatten beide Partner die Zusammenarbeit im<br />
NATO-Russland-Rat beendet. Die Beziehungen wurden auf Eis gelegt, bis die US-<br />
Außenministerin Hillary Clinton und ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow den Neustart<br />
angekündigt haben, welcher von den europäischen Ländern wie Deutschland ein positives Echo<br />
fand. Der NATO-Generalsekretär Rasmussen begrüßte ebenfalls den Neustart der Beziehungen,<br />
den er als das Ende der „kleinen Eiszeit“ bewertete (Tagesspiegel: 04.11.2010).<br />
Die zweite Krise zeigte abermals, dass der NATO-Russland-Rat seine Rolle nicht effektiv spielen<br />
konnte. Insbesondere gelang es ihm nicht, gegenseitige Ängste und Bedenken durch konstruktive<br />
Zusammenarbeit abzubauen, weshalb die Basis einer (sicherheits)politischen, auf gemeinsamen<br />
Interessen beruhenden Partnerschaft nicht entstehen konnte (Rühe:2010, Klein:2010). Die<br />
Ankündigung von Rasmussen zu einem „Neustart“ 2009 in den Beziehungen und sein Besuch in
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 60 of 79<br />
15.06.2011<br />
Moskau, bei dem er sich für eine „wahre“ Partnerschaft aussprach, stabilisierten gewissermaßen<br />
die schwankenden Verhältnisse zwischen beiden Seiten.<br />
Erblasten des Kalten Krieges: Vertrauenskrise und<br />
Hindernisse<br />
Auch nach dem Ende des Kalten Krieges glauben viele russische Politiker, dass die NATO als<br />
eine ursprünglich gegen die Sowjetunion gerichtete Allianz, auch weiterhin feindliche Absichten<br />
gegen Russland hegt und seine Macht einzudämmen versucht. In der russischen Bevölkerung gibt<br />
es ebenfalls ein großes Misstrauen. Laut einer Studie sehen etwa 60 Prozent der Russen die<br />
heutige NATO immer noch als Rivalen (Bidder/Puhl/Schmitz/Volkery/Wittrock: 2010). Diese<br />
misstrauische Haltung findet auch in der Wissenschaft große Unterstützung. Der<br />
Außenpolitikexperte Lukjanow bestätigt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland einer<br />
amerikanischen Vorherrschaft in diesem Block so zustimmt, wie das Europäer gemacht<br />
haben.“ (zitiert nach Bidder/Puhl/Schmitz/Volkery/Wittrock: 2010)<br />
Des Weiteren kann man von zwei wesentlichen Problemfeldern sprechen: die NATO-<br />
Osterweiterung und der Streit über die Pläne zum Bau eines Raketenabwehrsystems. Das erste<br />
Problem leitet sich partiell von traditionellen Feindbildern des Kalten Krieges sowie von<br />
Erfahrungen im Umgang miteinander seit der Auflösung der Sowjetunion her. In den<br />
osteuropäischen und baltischen Staaten assoziiert man heute noch Russland mit vormaliger<br />
sowjetischer Herrschaft und betrachte es als Quelle der Gefahr. Demgegenüber herrscht in<br />
Moskau die Stimmung, dass die NATO als eine aggressive und expansionistische Allianz mit ihrer<br />
Osterweiterungspolitik die russische Schwäche ausnutze, um dessen Macht in der Weltpolitik zu<br />
minimalisieren (Antonenko/Giegerich:2009, Klein:2010).<br />
Russland sieht die Rolle der NATO als beendet an<br />
Das zweite Problem rührt von unterschiedlichen und konträren ordnungspolitische Vorstellungen<br />
der NATO und Russlands her. Insbesondere zeigte sich dies während der Ära George W. Bushs.<br />
Er unterschätzte Russlands Rolle für die Weltsicherheitspolitik und sah es als „eine<br />
vernachlässigbare Größe der europäischen Sicherheitspolitik“ (Klein: 2010). Dies erweckte in<br />
Russland den Eindruck, man sei den USA nur willkommen, um bei gemeinsamen Interessen<br />
zusammenzuarbeiten, nicht aber, sobald man Einwände äußerte oder eigene Vorschläge machte<br />
(Rühe: 2010). Dagegen sieht Russland die Rolle der NATO mit der Auflösung des Warschauer<br />
Paktes als beendet an und fordert ein neues Sicherheitssystem, um die Bedeutung und Rolle der<br />
NATO in der Weltsicherheitspolitik zu reduzieren (Antonenko/Giegerich: 2009).<br />
Braucht die NATO Russland?<br />
Die NATO sollte sich in naher Zukunft entscheiden, ob sie Russland innerhalb oder außerhalb der<br />
Allianz sieht. Diese Kernfrage sollte auch von der russischen Seite geklärt werden und beide<br />
Seiten sollen und müssen sich in diesem Kontext einigen.<br />
Heute kommen immer mehr Politiker und Experten sowohl aus NATO-Staaten als auch aus<br />
Russland zu der Einschätzung, dass angesichts der globalen Herausforderungen eine gemeinsame<br />
Sicherheitspolitik nötig sei. Denn in vielen Regionen der Welt haben Europa, die USA und<br />
Russland gemeinsame Interessen, die durch den internationalen Terrorismus, die Proliferation von<br />
Waffen und Massenvernichtungsmitteln und instabile Regierungen im Nahen Osten, in<br />
Zentralasien und der Kaukasusregion gefährdet sind (Antonenko/Giegerich:2009). Diese<br />
Herausforderungen können nur durch eine breit angelegte Strategie, die anstatt militärischer
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 61 of 79<br />
15.06.2011<br />
Angriffe bzw. Interventionen die Rolle der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Faktoren<br />
besonders hervorhebt, und eine gut organisierte Zusammenarbeit gemeistert werden (Rühe: 2010).<br />
<strong>Zur</strong> Notwendigkeit einer gemeinsamen Sicherheitspolitik<br />
Im Folgenden sollen nun einige Problemfelder betrachtet werden, die die Notwendigkeit einer<br />
gemeinsamen Sicherheitspolitik untermauern. Erstens der Krieg gegen die Taliban in Afghanistan.<br />
Russland beobachtet den Verlauf des Krieges mit Besorgnis. So Russlands Botschafter Dmitrij<br />
Rogosin bei der Nato: “Heute kämpfen in Afghanistan Seite an Seite mit den Taliban auch<br />
Tausende freiwillige Kämpfer aus anderen Ländern. Siegen die Aufständischen, fürchte ich, dass<br />
die Kämpfer in andere zentralasiatische Länder einsickern, um dort eine islamische Revolution<br />
anzuzetteln. Das ist ein Problem auch für Russland, denn in der Region leben viele<br />
Russen.“(zitiert nach Bidder: 2010).<br />
Die Instabilität des Landes könnte tatsächlich dazu führen, dass Zentralasien insgesamt in ein<br />
ökonomisches, politisches und militärisches Chaos geriete. Das würde die Interessen auch von<br />
Russland beeinträchtigen würde. Eine noch intensivere logistische bzw. militärische<br />
Unterstützung durch Russland, die durch den Lissaboner Vertrag, (ermöglicht den Transit von<br />
Truppenmaterial durch Russland), schon eine gewisse Kooperationsbasis besitzt, wäre für den<br />
Afghanistan-Krieg von enormer Bedeutung.<br />
Zweitens ist die Stabilisierung der Krisenregionen, die sich in der „Einflusszone“ (Halbach: 2009)<br />
von Russland befinden, enorm wichtig. Ein effektives und diplomatisches Vorgehen ohne<br />
Polarisierungspolitik von Seite Russlands würde das Konfliktrisiko im Kaukasus und in<br />
Zentralasien reduzieren, wo in Zukunft aufgrund der dortigen Energiereserven Spannungen<br />
wahrscheinlicher werden.<br />
Drittens ist es das iranische Atomprogramm, das den Westen relativ beunruhigt. Eine<br />
zufriedenstellende Lösung dieser Problematik ohne aktive Beteiligung von Russland lässt sich<br />
kaum vorstellen. Dies zeigt sich offen bei den gegen den Iran verhängten Sanktionen, die ihre<br />
Wirksamkeit nur durch multilaterales Handeln unter Einbeziehung der russischen Vetomacht im<br />
UN-Sicherheitsrat entfalten können (Deep/Seifert: 2010). Allerdings beteiligt sich Russland am<br />
iranischen Atomprogramm bis dato aufgrund seiner wirtschaftlichen Interessen im Iran – Öl, Gas,<br />
Rüstungsexporte- nicht engagiert (Finger: 2007).<br />
Die NATO wird auf die Wertegemeinschaft verweisen<br />
Aus dieser Perspektive betrachtet, sollte die NATO ihre neue Strategie an diese globalen<br />
Herausforderungen anpassen. Deswegen sollte die NATO ihre Türen zu Russland als Mitglied<br />
bzw. zu einer wahren Partnerschaft öffnen. Nur dadurch würden Energiesicherheit, Abrüstung<br />
bzw. Ausrüstungskontrolle, Kampf gegen internationalen Terrorismus und illegalen Handel sowie<br />
die Entschärfung von Konfliktrisiken im Nahen Osten, in Zentralasien und im Kaukasus<br />
geschaffen werden.<br />
Während sich die NATO auf die Mitgliedschaft bzw. effektive Partnerschaft umstellt, sollte<br />
Russland auch grundlegende Voraussetzungen zum Beitritt erfüllen. Obwohl der Washingtoner<br />
Nato-Vertrag nicht ausdrücklich und detailliert definiert, was die Voraussetzungen eines Beitrittes<br />
sind, liegt auf jeden Fall noch ein weiter Weg vor Russland. Es wird erwartet, dass Russland den<br />
Schutz der Menschenrechte, die Einhaltung der Prinzipien des Rechtsstaates, zu denen politischer<br />
Pluralismus, freie Marktwirtschaft, Pressefreiheit und andere Grundrechte gehören, gewährleistet.<br />
Diese Kriterien sind sowohl innerhalb der NATO-Mitgliedstaaten als auch der EU-Zone die<br />
eigentliche Grundlage von Stabilität und Sicherheit. Die NATO wird deshalb darauf verweisen,<br />
dass die Nordatlantische Allianz eine Wertegemeinschaft sei und alle Mitglieder und<br />
Beitrittskandidaten diese Werte vertreten und in der Praxis umsetzen sollten (Schlotter: 2011).
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 62 of 79<br />
15.06.2011<br />
Dieser Prozess kann in Russland noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Jedoch hat die Aussicht<br />
einer Mitgliedschaft bislang bei allen Beitrittskandidaten eine Dynamik ausgelöst, die schließlich<br />
zum Wertekonsens führte (Rühe/Naumann/Elbe/Weisser: 2010).<br />
Der Weg zur erfolgreichen Zusammenarbeit<br />
Trotz der sicherheitspolitischen und geostrategischen Fakten, die eine effektive Zusammenarbeit<br />
zwischen der NATO und Russland wünschenswert erscheinen lassen, soll nicht außer Acht<br />
gelassen werden, dass es zwischen beiden Polen eine tiefe Vertrauenskrise und grundlegende<br />
ordnungspolitische Antagonismen gibt, die die gegenseitigen Beziehungen beeinträchtigen. Um<br />
diese Gegensätze abzubauen, sollten die folgenden Schritte unternommen werden.<br />
Abbau der Vertrauenskrise<br />
Vor allem sollte ab jetzt ein diplomatisches Vorgehen bevorzugt werden, das keine <strong>neuen</strong><br />
Divergenzen hervorruft. Deswegen sollte darauf geachtet werden, dass die NATO ihre politische<br />
Erklärung zur Osterweiterung, die 2008 in Bukarest verabschiedet wurde, mit großer Sensibilität<br />
umsetzt (Bidder/Puhl/Schmitz/Volkery/Wittrock: 2010). Dabei sollte Russland zwar kein<br />
Vetorecht zugestanden werden, aber andererseits könnte eine rasche Aufnahme Georgiens und der<br />
Ukraine ohne Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen die Beziehungen zwischen Russland<br />
und der NATO verschlechtern und die politische Glaubwürdigkeit der NATO beeinträchtigen<br />
(Dox: 2010).<br />
Vertrauensbildende Maßnahmen<br />
Um die bisherige Vertrauenskrise zu überbrücken, sollten vertrauensbildende Maßnahmen<br />
gestärkt werden. Im Dezember 2009 vereinbarten beide Seiten, die <strong>neuen</strong> globalen<br />
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gemeinsam zu bewerten und zu erarbeiten, was als<br />
wichtiger vertrauensbildender Schritt betrachtet werden kann. Dies sollte durch einen intensiven<br />
Dialog zu Fragen der Militärreform ergänzt werden. Ferner sollte die Rolle des NATO-Russland-<br />
Rates gestärkt werden, damit die gegenseitigen Kommunikationskanäle nicht von einer Seite<br />
geschlossen werden können(Klein: 2010).<br />
Intensivierung der praxisbezogenen Arbeit<br />
Für die Verbesserung der Beziehungen kann auch eine praxisbezogene Kooperation einen Beitrag<br />
leisten. Eine praktische Zusammenarbeit in Afghanistan in Fragen wie Transit, Ausbildung und<br />
Ausrüstung der afghanischen Streitkräfte sowie der Bekämpfung des Drogenhandels wäre ein<br />
wichtiger Schritt, der durch ein formelles Abkommen zwischen der NATO und der Organisation<br />
des Vertrages für gemeinsame Sicherheit (OVKS) ¬– der Russland, Belarus, Kirgistan, Armenien,<br />
Usbekistan und Kasachstan angehören – abgeschlossen werden kann. Dabei sollte darauf geachtet<br />
werden, dass man dem regionalen Dominanzstreben Russlands keinen Vorschub leistet. Um das<br />
vermeiden zu können, dürften solche formelle Übereinkünfte die bilaterale Zusammenarbeit der<br />
Nordatlantischen Allianz mit den OVKS-Staaten nicht ersetzen. Darüber hinaus bietet die<br />
Bekämpfung der Piraterie und gemeinsames Handeln gegen den Drogenschmuggel in Afghanistan<br />
und in der benachbarten Regionen nach einem einheitlichen Plan eine weitere günstige<br />
Kooperationsmöglichkeit an.<br />
Abschwächung der konträren Positionen<br />
Die bisherigen erwähnten Maßnahmen zielen darauf, die Zusammenarbeit zu erweitern, was<br />
allerdings für eine etablierte und gut funktionierende Partnerschaft nicht ausreichend ist. Diese<br />
muss durch Abschwächung der grundlegenden ordnungspolitischen Divergenzen gestützt werden,<br />
damit konträre Positionen eine Entwicklung der Partnerschaftsbeziehungen nicht verhindern.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 63 of 79<br />
15.06.2011<br />
Dafür wäre der erste Schritt der Abbau der konträren Standpunkte zur Gestaltung des euroatlantischen<br />
Sicherheitsgefüges.<br />
Dafür bieten trotz der obenerwähnten Schwierigkeiten die Ankündigung eines „Neustarts“ seitens<br />
der NATO 2009, und Medwedews kompromissbereite Haltung nach dem Lissabon Gipfel eine<br />
halbwegs günstige Lage. Medwedew signalisierte Offenheit gegenüber der EU und der NATO<br />
und distanzierte sich damit vom konfrontativen Habitus seines Vorgängers (Katsioulis:<br />
2010/Kornelius:2010). Diese neue Annäherung sieht Timofei Bordatschew vom Zentrum für<br />
Europäische und Internationale Studien an der Moskauer Wirtschaftsuniversität als das „formale<br />
Ende der schwierigen Beziehungen zwischen Russland und der NATO“ (Dox:2010).<br />
Unterschiedliche Positionen in den NATO-Staaten<br />
Trotz des allmählich steigenden Optimismus und Umdenkens sollte nicht vergessen werden, dass<br />
es noch eine große Zahl von Skeptikern in den NATO-Staaten gibt, die einen raschen Eintritt in<br />
konkrete Verhandlungen erschweren. Während beispielsweise die partnerschaftliche Beziehung in<br />
amerikanischen Regierungskreisen ein mehr oder weniger positives Echo findet, herrscht in<br />
Wissenschaftskreisen eher eine skeptische Stimmung.<br />
Einerseits plädiert Charles Kupchan, Professor an der Georgetown University und unter Clinton<br />
Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates, dafür, dass es überfällig sei, ernsthaft über eine russische<br />
Mitgliedschaft in der NATO nachzudenken. Andererseits hält Dan Hamilton, NATO-Experte und<br />
Direktor des Transatlantikzentrums an der Johns Hopkins University, eine Mitgliedschaft<br />
Russlands für verfrühat und sagt: „Außerdem müssten die Parlamente aller Mitgliedstaaten einer<br />
Neuaufnahme zustimmen, auf Basis bestimmter Kriterien wie Demokratieverständnis,<br />
Menschenrechte und Respekt für die Souveränität anderer europäischer Nationen.<br />
Viele Staaten glauben, dass Russland diese Vorgaben nicht erfüllt.“ (zitiert nach:<br />
Bidder/Puhl/Schmitz/Volkery/Wittrock: 2010). Auch William Drozdiak, Präsident des American<br />
Council on Germany in New York, äußert sein Skepsis, obwohl er gewisse Fortschritte bei der<br />
Zusammenarbeit zum Umgang mit Irans Atompolitik sieht: „Russland ist nach wie vor nur schwer<br />
zu überzeugen, dass seinen eigenen Sicherheitsinteressen eine bessere Beziehung mit dem Westen<br />
hilft.“(Bidder/Puhl/Schmitz/Volkery/Wittrock: 2010).<br />
Die „roten Linien“<br />
Die Skepsis bzw. ablehnende Position der amerikanischen Seite rühren daher, dass sie eine<br />
Schwächung der Handlungsfähigkeit er NATO befürchten (Kamp: 2010). Diese skeptische<br />
Haltung wird auch von Großbritannien und osteuropäischen Staaten geteilt. Um diese Skepsis zu<br />
vermindern, sollten sich NATO-Mitglieder im Vorfeld auf gemeinsame Hauptpunkte einigen.<br />
Dazu gehören so genannte „rote Linien“, die in den Beitrittsverhandlungen nicht aufgegeben<br />
werden sollen, wie das Prinzip der freien Bündniswahl und die Ablehnung exklusiver<br />
Einflusszonen (Rodionow: 2009). Dagegen sollte Russland ebenfalls darauf verzichten, seine<br />
Forderungen zu maximieren. Der am 29. November 2009 veröffentlichte Entwurf für einen euroatlantischen<br />
Sicherheitsvertrag (Klein: 2009) entspricht dem Versuch, ein Vetorecht gegen<br />
zukünftige Operationen der NATO zu erhalten, um Russlands Machtbasis in seiner Einflusszone<br />
auszubauen.<br />
Obwohl eine Mitgliedschaft von Russland in der NATO mit großen Schwierigkeiten verbunden<br />
wäre, spricht nichts dagegen, einen Verhandlungsprozess zu starten. Die Komplexität der<br />
Probleme deutet nur darauf hin, dass der Weg ein sehr langer Weg sein wird und mit bestimmten<br />
Voraussetzungen verbunden sein muss. Dabei ist es wichtig, dass man bei den<br />
Verhandlungsprozessen die ordnungspolitischen Fragen nicht ausgeklammert lässt, sonst würden<br />
die Beziehungen zwischen den beiden Seiten zwischen selektiver Kooperation und prinzipiellem
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 64 of 79<br />
15.06.2011<br />
Interessenkampf schwanken. Dies würde eine Lösung der internationalen Herausforderungen wie<br />
Terrorismus und Fundamentalismus erschweren. Ferner würde das bisherige traditionelle<br />
Verhältnis zwischen beiden Polen gespannt bleiben, was bisher ständig eine Quelle von<br />
Irritationen und Konflikten war.<br />
Literaturverzeichnis:<br />
Anne Finger: Russland und das iranische Atomprogramm, SWP-Diskussionspapier, Juli 2007.<br />
Benjamin Seifert, Rana Deep: Russland gehört in die Nato, aus:<br />
http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-11/nato-russland?page=2 , Zugriff: 09.04.2011.<br />
Benjamin Bidder: „Russlands Hilfe in Afghanistan hat ihren Preis“, Interview mit Dmitrij<br />
Rogosin, aus: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,674295,00.html, Zugriff: 24.05.2011.<br />
Benjamin Bidder, Jan Puhl, Gregor Peter Schmitz, Carsten Volkery: NATO-Planspiele lassen<br />
Russen kalt, in: Der Spiegel, 08.03.2008.<br />
Christos Katsioulis: Die neue NATO-Strategie Kompromiss auf Zeit, FES-Politikanalyse,<br />
November 2010.<br />
Georg Dox: Neustart von NATO und Russland? Realistische Erwartungen, pragmatisches<br />
Handeln, aus: http://oe1.orf.at/artikel/262134, Zugriff: 07.04.2011.<br />
Uwe Halbach: Die Georgienkrise als weltpolitisches Thema, in: Aus Politik und Zeitgeschichte<br />
(APuZ 13-23.03/2009).<br />
Iwan Rodionow: Russland und die NATO: Grenzen der Gemeinsamkeit, in: Aus Politik und<br />
Zeitgeschichte (APuZ 15-16/2009).<br />
Karl-Heinz Kamp: Die NATO nach dem Jubiläumsgipfel, in: Die politische Meinung, 05/2009.<br />
Margarete Klein: Medwedews Vorschlag für einen euroatlantischen Sicherheitsvertrag, in:<br />
Russlands-Analysen, Nr.193, vom 04.12.2009.<br />
Margarete Klein: Neustart in den Beziehungen zwischen Russland und der Nato<br />
Anlauf zur strategischen Partnerschaft?, in: SWP-Aktuell 2010/A 01<br />
Knut Mellenthin: Für eine multipolare Welt: Russland nimmt außenpolitische Neubestimmung<br />
vor: USA sollen laut Moskau „Realität einer postamerikanischen Welt“ anerkennen,aus:<br />
http://www.agfriedensforschung.de/regionen/Russland/weltordnung.html, Zugriff: 06.04.2011.<br />
Oksana Antonenko, Bastian Giegeric: Rebooting NATO-Russia Relations, in: Survival: Global<br />
Politics and Strategy, vol. 51, no. 2, April–May 2009, S. 13–21.<br />
Peter Schlotter: Russland in die NATO!?, Vortrag: 21. Frühjahrsakademie Sicherheitspolitik:<br />
Europa - Russland - USA , Lambrecht, 17.03.2011.<br />
Stefan Kornelius: Neue Töne aus Moskau, aus: http://www.sueddeutsche.de/politik/russland-unddie-nato-neue-toene-aus-moskau-1.1014728,<br />
Zugriff: 13.04.2011.<br />
Volker Rühe, Ulrich Weisser: Russland in die NATO, aus: http://www.rponline.de/politik/deutschland/Russland-in-die-Nato_aid_919077.html,<br />
Zugriff: 10.04.2011.<br />
*
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 65 of 79<br />
15.06.2011<br />
RUSSLAND<br />
Drittreichster Oligarch geht in die Politik<br />
Bei den Duma-Wahlen im Dezember will der Unternehmer Michail Prochorow<br />
eine liberale Klein-Partei zur drittstärksten Kraft in der Duma machen.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
um ersten Mal seit der Verhaftung von Michail Chodorkowski im Jahr 2003 will wieder ein<br />
russischer Oligarch in die Politik. Michail Prochorow, mit 18 Milliarden Dollar Vermögen<br />
laut Forbes der drittreichste Russe. Er erklärte Mitte Mai auf einer Pressekonferenz, er wolle<br />
Vorsitzender der liberalen Partei „Rechte Sache“ werden. Freunde und Bekannte hätten ihn<br />
gedrängt. Der Moskauer Tageszeitung „Kommersant“ berichtete, Prochorow wolle die Klein-<br />
Partei aufmöbeln und bei den Duma-Wahlen im Dezember zur drittstärksten Partei - nach der<br />
Kreml-Partei „Einiges Russland“ und den Kommunisten - machen.<br />
Der ehemalige Yukos-Chef Michail Chodorkowski musste seine politischen Ambitionen mit<br />
einem zweifelhaften Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung teuer bezahlen. Der heute 47<br />
Jahre alte Chodorkowski hatte 2003 Oppositionsparteien finanziell unterstützt und sitzt seitdem in<br />
Haft, mit ungewissem Ende.<br />
Mit dem Kreml hat sich der 46jährige nie angelegt<br />
Michail Prochorow geht nun einen anderen Weg. Dem Unternehmer mit dem Gardemaß von 204<br />
Zentimetern gehört das Finanzunternehmens Onexim sowie Unternehmen in der Aluminium- und<br />
Goldproduktion. Mit dem Kreml hat sich der 46jährige nie angelegt.<br />
So groß Prochorow, so klein die Partei, deren Chef er werden will. „Rechte Sache“ wurde 2008<br />
von der russischen Präsidialadministration als Auffangbecken aus den Überresten von drei<br />
liberalen Klein-Parteien gegründet. Mit der Neugründung wollte die Präsidialadministration<br />
Kreml-kritischen Angehörigen der Mittelschicht eine Alternative zu der radikalen liberalen<br />
Opposition um den Ex-Ministerpräsidenten Michail Kasjanow und dem Ex-Schachweltmeister<br />
Garri Kasparow bieten. Doch die Klein-Partei kommt nicht voran.<br />
Seit der Duma-Wahl 2003 gibt es keine liberalen Parteien mehr in der Duma. Damals scheiterten<br />
die Parteien Jabloko und die später aufgelöste „Union der rechten Kräfte“ an der Fünf-Prozent-<br />
Hürde. Nach den chaotischen Jahren unter Präsident Boris Jelzin haben es die russischen<br />
Liberalen schwer in breiteren Bevölkerungskreisen Fuß zu fassen. Selbst ihren traditionellen<br />
Wählern in der Mittelschicht trauen den Liberalen politisch nicht viel zu, weil sie seit Jahren<br />
zerstrittenen sind.<br />
Prochorow wurde 2007 der Zuhälterei verdächtigt: Er ließ 20<br />
junge Russinnen in einen französischen Nobel-Skiort<br />
einfliegen<br />
Prochorow ist in Russland bekannt. Er könnte es schaffen, zum liberalen Zugpferd zu werden,<br />
hofft man in der Klein-Partei Rechte Sache. Der Unternehmer sorgte schon häufig für<br />
Schlagzeilen. Allerdings nicht mit politisch brisanten Äußerungen sondern durch seine ständige<br />
Querelen mit Geschäftspartnern.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 66 of 79<br />
15.06.2011<br />
Schwer angeschlagen wurde das Ansehen des Oligarchen als er 2007 in den französischen Ski-<br />
Kurort Chourchevel zwanzig junge russische Frauen einfliegen ließ, worauf der Unternehmer von<br />
der französischen Polizei wegen dem Verdacht auf Zuhälterei vier Tage hinter Schloss und Riegel<br />
gesetzt wurde.<br />
Seit diesem Vorfall geht Prochorow den Weg des aufgeklärten Industrie-Magnaten. 2008 wurde er<br />
Präsidenten des russischen Biathlon-Verbandes. Im letzten Jahr stellte der Großunternehmer den<br />
Prototypen des ersten russischen Autos mit Hybrid-Antrieb vor, das sogenannte Jo-Mobil. Es soll<br />
2012 in Serienproduktion gehen.<br />
Wählerenttäuschung durch Forderung nach 60-Stunden-<br />
Woche<br />
Für die breite Masse bleibt Prochorow trotzdem kaum wählbar, seit er sich für die Einführung der<br />
60-Stunden-Arbeitswoche und die Lockerung des Kündigungsschutzes ausgesprochen hat.<br />
Fest steht nach Meinung aller Beobachter, dass die Duma-Wahl im Dezember der Vorbereitung<br />
für die Präsidentschaftswahl im März nächsten Jahres dient.<br />
Einer der möglichen Präsidentschafts-Kandidaten, Wladimir Putin, sammelt bereits seine<br />
Anhänger. Er gründete die „Allgemein Russische Volksfront“, welche vom Beamtenfilz und<br />
Korruption enttäuschte Wähler wieder für die Kreml-Partei „Einiges Russland“ einfangen soll.<br />
Und Medwedew? Auch er werde sich irgendwann einer Partei anschließen, erklärte Russlands<br />
Präsident kürzlich. Aber noch sei die Zeit nicht reif dafür.<br />
KREML<br />
Die geheimnisvollen Einkünfte russischer<br />
Minister<br />
Putins Kabinettsmitglieder verdienen gut bis sehr gut. Woher sie ihre<br />
Einkünfte beziehen weiß Niemand so genau.<br />
Von Ulrich Heyden<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
enn es stimmt, was Präsident Dmitri Medwedew und Ministerpräsident Wladimir Putin in<br />
ihrer Einkommenserklärung für das Jahr 2010 angegeben haben, leben sie im Verhältnis<br />
zu den Mitarbeitern der Präsidialverwaltung und der Minister bescheiden. Medwedew<br />
verdiente nach eigenen Angaben im letzten Jahr 83.000 Euro und hat in der Garage nur ein<br />
Raritäten-Auto stehen, einen „Pobeda“, Baujahr 1948. Putin konnte sein Einkommen im letzten<br />
Jahr dagegen von 95.000 (2009) auf 125.000 Euro steigern. Der Premier hat zwei Oldtimer-Wolga<br />
-Limousinen, einen Niva-Geländewagen und ein Wohnmobil in der Garage.<br />
Einkommenserklärungen im Internet<br />
Seit Montag können die Russen schwarz auf weiß lesen, was Präsidialamtsmitarbeiter und<br />
Minister sowie deren Frauen so verdienen. Die Angaben wurden zeitgleich auf den Websites der<br />
Präsidialverwaltung und der Regierung veröffentlicht.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 67 of 79<br />
15.06.2011<br />
Wovon Putin und Medwedew sich ihre teuren Armbanduhren kaufen und ihre Ehefrauen<br />
einkleiden, bleibt bei den angegebenen Einkommen ein Rätsel. Präsidentengattin Swetlana<br />
Medwedewa, die im Wohltätigkeitsbereich aktiv ist, hat 2010 keinen einzigen Rubel verdient.<br />
Ljudmilla Putina konnte ihr Jahres-Einkommen von 2009 auf 2010 immerhin von 14,5 Euro (!)<br />
auf 3655 Euro steigern. Womit jedoch die öffentlichkeitsscheue Premiers-Gattin ihr Geld<br />
verdiente, ist unbekannt. Immerhin, Miete müssen Putin und Medwedew nicht bezahlen. Der<br />
Präsident besitzt zusammen mit seiner Frau eine Wohnung mit 367 Quadratmetern, Putin hat<br />
sogar zwei Wohnungen mit 77 und 153 Quadratmetern.<br />
Reiche Minister-Frauen<br />
Gegenüber dem, was die Minister in der russischen Regierung verdienen, sind die Einkommen<br />
von Putin und Medwedew bescheiden. Reichstes Kabinettsmitglied ist der Minister für Natur-<br />
Ressourcen, Juri Trutnew, obwohl er offenbar durch die Finanzkrise hat bluten müssen. 2010 hatte<br />
Trutnew ein Jahreseinkommen von 2,8 Millionen Euro. 2009 hatte Trutnew noch 3,8 Millionen<br />
Euro verdient.<br />
Noch wohlhabender als der Minister für Natur-Ressourcen ist jedoch Olga Schuwalowa, die<br />
Ehefrau von Vize-Ministerpräsident Igor Schuwalow. Olga, die ihren Beruf als Hausfrau angibt,<br />
erzielte 2010 ein Einkommen von 9,3 Millionen Euro. Doch auch Frau Schuwalowa musste<br />
zurückstecken. 2009 hatte sie noch 16 Millionen Euro verdient. Nach Angaben der Wirtschafts-<br />
Zeitung Wedomosti verwaltet Frau Schuwalowa die Wertpapiere ihres Mannes. Auch der<br />
Ehemann verdient nicht schlecht. Igor Schuwalow konnte sein Einkommen von 162.000 Euro<br />
(2009) auf 365.000 Euro (2010) steigern. Außerdem hat das Ehepaar Schuwalow ein Haus in<br />
Österreich (1.479 Quadratmeter) und eine Wohnung in Großbritannien (424 Quadratmeter)<br />
gemietet. Der Fuhrpark des Vizepremiers kann sich ebenfalls sehen lassen. Bei Schuwalow stehen<br />
ein Jaguar sowie drei Mercedes der S-Klasse in der Garage.<br />
825 Euro Monatseinkommen für einen Geschäftsführer<br />
Verglichen mit den Vermögen der russischen Oligarchen, die Milliarden Euro ihr Eigentum<br />
nennen, sind die Einkommen der Minister und Präsidialamtsmitarbeiter aber immer noch<br />
bescheiden, verglichen mit dem durchschnittlichen Einkommen der Beschäftigten in der<br />
Privatwirtschaft jedoch erheblich.<br />
Nach Angaben des Staatlichen Statistik-Komitees verdiente ein Geschäftsführer eines russischen<br />
Unternehmens im Jahr 2009 – neuere Zahlen liegen nicht vor – monatlich 825 Euro. Ein Arbeiter<br />
mit abgeschlossener Berufsausbildung verdient monatlich im Schnitt 609 Euro. Real liegen die<br />
durchschnittlichen Einkommen der abhängig Beschäftigten jedoch höher. Um die Sozialabgaben<br />
zu umgehen, zahlen viele Unternehmen ein Teil der Gehälter im Briefumschlag. Dieser Teil des<br />
Einkommens geht nicht in die offizielle Buchhaltung eines Unternehmens ein.<br />
Das Unrechtsbewusstsein der abhängig Beschäftigten wegen der „grauen“ Gehaltszahlungen ist<br />
nur schwach entwickelt. Das Geld im Briefumschlag sei nur ein Klacks im Vergleich zu dem, was<br />
Spitzenbeamte und Geschäftsleute gegenüber dem Finanzamt verschweigen, so die landläufige<br />
Meinung.<br />
Das „Gefühl von Transparenz“<br />
Dass die Einkommen der Minister, Präsidialamtsmitarbeiter und Gouverneure veröffentlicht<br />
werden, ist sicher ein Fortschritt. Präsident Medwedew hatte die Veröffentlichung vor drei Jahren<br />
angeordnet. Doch die Anti-Korruptions-Expertin Jelena Panfilowa meint, die Veröffentlichung<br />
vermittle nur „ein Gefühl von Transparenz“, denn die Aussagekraft der Angaben sei begrenzt. Die
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 68 of 79<br />
15.06.2011<br />
hohen Beamten sind nicht verpflichtet anzugeben, woher sie ihr Geld haben und wofür sie es<br />
ausgegeben haben. Nur wenn diese Angaben gefordert werden, könne der Kampf gegen die<br />
Korruption einigermaßen erfolgreich sein, meinen Experten.<br />
Nur Einer wurde bestraft<br />
2009 wurden 6.000 Beamte wegen falscher Einkommensangaben von der Staatsanwaltschaft<br />
getadelt. Aber nach Angaben der „Moscow Times“ wurde nur ein Beamter, Armee-General Viktor<br />
Gaidukow, bestraft.<br />
LEMBERG<br />
Wo ist hier der Hafen?<br />
Schnittpunkt aller Handelswege zu sein bedeutet nicht, daran reich zu werden.<br />
Vor allem dann nicht, wenn du jedes Jahrhundert zwölfmal von einer Hand in<br />
eine andere gerätst und diese Hände nichts Besseres zu tun haben, als dir auch<br />
den letzten Faden vom Leib zu reißen. – Lemberg, mein Lemberg.<br />
Von Juri Andruchowytsch<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Lemberg – Blick über die Altstadt<br />
Foto aus Wikipedia - Lestat (Jan Mehlich)<br />
ur nach Lemberg!“ wiederholte ich mit 15 wie mit 16 Jahren, als handle es sich um den<br />
leicht veränderten Refrain des süßlichen polnischen Liedes, von dessen Existenz ich jedoch<br />
keine Ahnung hatte. „Nur nach Lemberg“ war meine Antwort auf die Frage, wohin ich nach<br />
der Schule zum Studieren gehen wollte.<br />
Wieso Lemberg? Damals hatte ich nur eine sehr vage Vorstellung von dieser Stadt. Sie war für<br />
mich vor allem der Bahnhof, von dem aus wir Jahre zuvor nach Prag aufgebrochen waren. Ich<br />
wollte also offenbar deshalb nach Lemberg, weil es mir als Prager Vorortbahnhof erschien. Was,<br />
fürchte ich, gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 69 of 79<br />
15.06.2011<br />
Bis heute freue ich mich, dass es den Engländern 1944 nicht gelungen ist, Stalin die Stadt für die<br />
Polen abzuhandeln. Wäre es ihnen gelungen, dann hätte Lemberg im Ausland gelegen – und ade!,<br />
meine Hoffnungen. Die Staatsgrenze zwischen der UdSSR und Polen wäre irgendwo bei Vynnyki<br />
verlaufen, dahinter hätte der Westen begonnen. Und uns hätte man dort nicht hingelassen.<br />
Die Geschichte kennt keine Möglichkeitsform, und daraus resultierten nicht nur fünf meiner<br />
dichtesten und intensivsten Jahre, sondern auch alles, was ich bisher geschrieben habe. Und wenn<br />
es für mich ein Dublin gibt, dann ist es Lemberg.<br />
Beim Schreiben über Lemberg muss ich mich einfach wiederholen. Doch werde ich versuchen,<br />
aus jeder unausweichlichen Wiederholung wenigstens eine Überraschung zu gewinnen. Ohne<br />
Überraschungen, vor allem auch für den Autor selbst, hört das Schreiben auf, Schreiben zu sein,<br />
und wird zum Abschreiben. Wenn ich jedoch beim Wiederholen ganz andere Worte wähle, dann<br />
ist es schon kein Wiederholen mehr.<br />
Um Taras Prochasko zu paraphrasieren – aus Lemberg kann man mehrere Romane machen. Mehr<br />
noch: Ich glaube, man kann daraus immer wieder viele Romane machen. Es ist eine Roman-Stadt<br />
in dem Sinne, dass ihre Romane noch nicht geschrieben sind. Ja, Sie haben Recht, es wurden<br />
schon welche geschrieben, darunter ein paar ganz wunderbare. Aber undenkbar, alle möglichen<br />
Bedeutungen dieser Stadt mit ihren wechselnden Eigenschaften zu erfassen.<br />
So blättere ich nach dem Zufallsprinzip einzelne Bedeutungen auf und merke dabei, dass sie<br />
unerschöpflich sind.<br />
Die Hafenstadt<br />
Ich habe sie einmal Stadt-Schiff genannt, jetzt soll sie Hafen sein. Küste also, vielleicht die<br />
Mündung eines großen Flusses, ein Aquatorium, Kais, Güter- und Passagierdocks, Kräne, Kähne<br />
und 24-Stunden-Spelunken.<br />
In „Das Hohe Schloss“ erwähnt Stanisław Lem das Büro der Schifffahrtsgesellschaft „Cunard<br />
Line“ und die Modelle der Ozeanriesen („Lusitania“, „Mauretania“) in jedem Schaufenster. Es<br />
befand sich im Lemberg der Zwischenkriegszeit, ich glaube, in der Słowacki-Straße. Wann es<br />
wohl verschwunden ist – 1939?<br />
Kakaniens Eisenbahnknotenpunkt<br />
Jedenfalls hörte Lemberg genau dann auf, ein offener Hafen zu sein, und wurde zum geheimen.<br />
Überhaupt kein Hafen sein kann es nicht – gemäß dem Willen seiner Gründer, die<br />
jahrhundertelang nach diesem Platz genau zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer gesucht<br />
haben.<br />
Deswegen gibt es so viele Delfine an den Häusern. Nach dem Löwen ist der Delfin das<br />
zweithäufigste Attribut der alten städtischen Dekoration. Vielleicht ist er es, der der Stadt ihre<br />
besondere kühle Glitschigkeit verleiht. Jedenfalls könnte man den Lemberger Delfinen einen<br />
ganzen Bildband widmen.<br />
Die Atlantikaale im unterirdischen Fluss der städtischen Kanalisation sind einen eigenen Roman<br />
wert: Der Weg der Aale aus der Sargasso-See bis zu den Schatzki-Seen und in die Wasser des Bug<br />
und der Poltwa, dann wieder zurück in den Ozean, das ist eine zweite „Odyssee“, noch ein<br />
„Ulysses“.<br />
Manchmal hat es den Anschein, als wäre Lemberg vor allem eine unterirdische Stadt. Dass also<br />
das Wesentliche sehr mächtig tief unter uns weiter existiert. Der Orchestergraben der Oper wäre
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 70 of 79<br />
15.06.2011<br />
dann eine Art Raum des Übergangs, Warte- oder Empfangszimmer, unter dem nur noch die<br />
Wasser des Styx liegen.<br />
Wer nach zwei Meeren jagt, wird keines je zu fassen kriegen. Lembergs Lage zwischen den<br />
Meeren resultierte in seiner Meerlosigkeit.<br />
Die Kreuzungsstadt<br />
Dahinter verbirgt sich nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche Überschneidung. Eine<br />
Kreuzung ist auch eine Anhäufung von Schichten. Die Liste der alten Handelswege, die auf die<br />
eine oder andere Weise Lemberg berührten, würde diesen Text sprengen. Lemberg wurde nicht<br />
nur als Mitte der Zeiten, sondern auch als Mitte von Ländern erdacht. Kaufleute aus Europa<br />
durchquerten es in Richtung Asien, Kaufleute aus Asien in Richtung Europa, obwohl man damals<br />
weder Europa und noch weniger Asien kannte, sondern ausschließlich die Alte Welt. So<br />
bestimmte die Existenz Lembergs die spätere Teilung des Kontinents in Europa und Asien voraus.<br />
Die Stadt lag so günstig, dass weder Karawanen aus Britannien nach Persien, noch solche aus<br />
Korea nach Portugal sie umgehen konnten. Aus Moskau nach Rom gelangen, wie auch aus<br />
Amsterdam nach Bombay, konnte man nur über Lemberg. Aber nicht alle Reisenden machten<br />
einfach nur Station an diesem Schnittpunkt. Einige entschlossen sich, für immer hierzubleiben.<br />
Darunter nicht nur Kaufleute, sondern auch fahrende Musikanten, Prediger, Deserteure fast aller<br />
Armeen, Spione, Seher, Gelehrte, Lehrer, Heiler, geflohene Unfreie und freie Flüchtlinge. Ich<br />
wollte einmal eine Liste erstellen, musste aber aufhören, als ich mir ihrer Unendlichkeit bewusst<br />
wurde.<br />
Als die österreichische höchste Ingenieursinstanz Mitte des 19. Jahrhunderts einen geeigneten<br />
Eisenbahnknotenpunktsuchte, entschloss sie sich ohne Zögern. Der Hauptbahnhof wurde auf der<br />
Linie der europäischen Wasserscheide errichtet, was eine Höhe von 316 Metern über der Höhe der<br />
beiden hiesigen Meere bedeutete. Obwohl im Wort „Wasser-Scheide“ die zweite Wurzel auf<br />
„scheiden“ und „trennen“ verweist, möchte ich noch einmal vom Gegenteil ausgehen. Eine<br />
Wasserscheide, diese geografische Falte auf der Erdoberfläche, kann man sich nicht nur als<br />
Schnitt, sondern auch als Naht vorstellen. Weil sie zusammennähat, zusammenhält, vereint.<br />
Deshalb ist Lemberg eine gemeinsame Anstrengung von West und Ost. Aber auch von Süd und<br />
Nord.<br />
Die Schieberstadt<br />
Lemberg und Geld, ein ewiges Thema. Das Geld folgt den Verlockungen. Füllt sich eine Stadt mit<br />
Verlockungen, dann tritt auch das Geld in sie ein. Je mehr Verlockungen – Schenken, Bordelle,<br />
Zirkusse und Casinos –, umso mehr Geld. Ist aber ein gewisser Höhepunkt erreicht, dann wirkt es<br />
auch umgekehrt. Die Verlockungen gebären Geld – und das Geld Verlockungen. So gleichen sich<br />
die Verlockungen und das Geld an. Die Anhäufung von Geld bedeutet nichts mehr und wird<br />
Selbstzweck, von dem einen weder der Tod noch die Inflation abbringen können. Genau das ist<br />
mit Lemberg passiert. Das Geld trennte sich vom Sein und erhob sich darüber, als das Absolute.<br />
Natürlich ist Lemberg infolge seiner Lage im unglücklichen Teil der Welt eine vor allem arme<br />
Stadt. Schnittpunkt aller Handelswege zu sein bedeutet, wie wir gesehen haben, nicht, daran reich<br />
zu werden. Vor allem dann nicht, wenn du jedes Jahrhundert zwölfmal von einer Hand in eine<br />
andere gerätst und diese Hände nichts Besseres zu tun haben, als dir auch den letzten Faden vom<br />
Leib zu reißen.<br />
Armut und Geldkult, das ist eine sehr unerwünschte Verbindung. Aus diesem Grunde verschoben<br />
sich in Lemberg die Werte, und man begann, das für Verlockungen zu halten, was in Wirklichkeit
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 71 of 79<br />
15.06.2011<br />
grundlegende menschliche Bedürfnisse sind – ein Dach über dem Kopf, Wasser im Hahn,<br />
Heizung, ein minimaler Wohlstand. Mit diesen Bedürfnissen zu spekulieren wurde zur<br />
Lieblingsbeschäftigung vieler Generationen. So entstand in Lemberg eine ganze Klasse von<br />
Stadtbewohnern, die nur durch Betrug an anderen, ebensolchen armen Schweinen überlebte. Die<br />
hohen Preise Lembergs, frech und durch nichts gerechtfertigt, sind das Leitmotiv ausnahmslos<br />
aller Briefe, Depeschen und Berichte, die schockierte Neuankömmlinge immer und bis heute noch<br />
überallhin schicken.<br />
Ich kann mir nicht vorstellen, was los wäre, hätte Lemberg mehr zu bieten. Wären ihm nur ein<br />
Hundertstel der Sehenswürdigkeiten von Venedig gegeben, ein Zwanzigstel von Prag oder ein<br />
Zehntel von Wien!<br />
Die Opferstadt<br />
In Lemberg wurde immer gemordet. Manchmal auch massenhaft. In Wirklichkeit ist diese<br />
leichtfertig-nette, Kaffeehaus-gemütliche und bierselig-berauschte Stadt eine Grube voller<br />
menschlicher Leichen. In den alten Vierteln müsste eigentlich jeder einzelne Stein schreien.<br />
Anhäufung von Antikulturen<br />
Lemberg ist ein Schnittpunkt der Sprachen, Religionen und Ethnien. Eine Aufschichtung von<br />
Kulturen. Das haben Sie schon gelesen.<br />
In viel größerem Maße aber ist Lemberg eine Anhäufung von Antikulturen. Und Verständigung<br />
herrschte hier niemals. Zwar gab es relativ friedliche Perioden, aber alles hing am seidenen Faden.<br />
Oder sogar am Spinnweb. Und die Spinnen saßen nicht in Lemberg.<br />
Der gegenseitige ethnisch-konfessionelle Hass, den nur Österreich-Ungarn niederhielt, geriet mit<br />
dessen Zerfall außer Kontrolle. Infolge der sozialen Revolutionen und Umstürze in Russland und<br />
Europa kam zum ethnisch-konfessionellen noch der Klassenhass.<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrscht in Lemberg der Krieg aller gegen alle. Das<br />
Anderssein (der Sprachen oder Gebräuche) wird Grund für die bis zur völligen Vernichtung<br />
reichende Repression der anderen. Auge um Auge, Zahn um Zahn war die einzige gültige Losung,<br />
die einzige Motivation der Verhältnisse im Dreieck zwischen Polen, Juden und Ukrainern. Jede<br />
der Seiten des Dreiecks fordert Säuberungen unter den anderen beiden. Wenn schon nicht<br />
Assimilierung, so doch wenigstens Marginalisierung. Eine Form der Säuberung von den<br />
Andersartigen wurde in den zwei Weltkriegen und im Zusammenhang mit ihnen das entschlossene<br />
Verdrängen und sogar Vertreiben hinter die Grenzen der Stadt: der Ukrainer durch die Polen; der<br />
Juden durch die Deutschen und die Ukrainer; der Polen durch die sowjetischen Russen, Ukrainer<br />
und Juden; der Westukrainer ebenfalls durch diese.<br />
Die Ereignisse im Innern des Dreiecks wurden natürlich von außen manipuliert. Vergessen wir<br />
nicht, dass Lemberg, wie der gesamte Teil der Welt, zu dem es gehört, zwischen Deutschland und<br />
Russland liegt. Beide Imperialismen spielten ihr Spiel. Mitte des Jahrhunderts hatte die Stadt fast<br />
ihre gesamte frühere Bevölkerung verloren. Dadurch schien sich der Hass zu verringern. Aber<br />
gleichzeitig verringerten sich die Sprachen, die Kulturen, die Kontinuität. Letztere verringerte sich<br />
in katastrophalem Maße.<br />
Alle, die mir in der Stadt fehlen, wurden ermordet, sind geflohen, haben es nicht ausgehalten oder<br />
wurden nicht geboren.<br />
*
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 72 of 79<br />
15.06.2011<br />
Der Text von Juri Andruchowytsch entstammt dem Band „Kakanien – Neue Republik der<br />
Dichter“, herausgegeben von Plinio Bachmann, Rita Czapka und Knut Neumayer und erscheint<br />
am 26. September 2011 im Paul Zsolnay Verlag Wien. http://bit.ly/m4vMW6<br />
DOKUMENTARFILM<br />
Deutscher Streifen „The Other Chelsea“ stößt<br />
kontroverse Debatte in der Ukraine an<br />
Schachtjor Donezk ist der ganze Stolz der Fußballfans im Osten der Ukraine.<br />
Bergarbeiter und Spitzenpolitiker strömen ins Stadion, wenn die<br />
brasilianischen Stars von Schachtjor auf europäischem Spitzenniveau kicken.<br />
Mit der finanziellen Unterstützung des Oligarchen Rinat Achmetow gewann<br />
der Verein 2009 sogar den Uefa-Pokal. Ein junger deutscher<br />
Dokumentarfilmer hat die Menschen im ostukrainischen Kohlerevier Donbass<br />
und ihre Leidenschaft für ihre Fußballmannschaft porträtiert – und mit<br />
seinem Film eine kontroverse Debatte in der Ukraine ausgelöst.<br />
Von Martin Brand und Robert Kalimullin<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
Mit dem UEFA-Pokalsieg von Schachtjor erfüllte sich ein Traum für den<br />
Bergmannssohn und Milliardär Achmetow. Foto Preuss.<br />
wei Lebenswelten stehen sich in dem Film „The Other Chelsea“ gegenüber. Da sind einmal<br />
die Vertreter aus der einfachen Bevölkerung, die sich ihr täglich Brot mühsam unter Tage, in<br />
den maroden Kohlegruben verdienen und sich vom wenigen Ersparten einen Stehplatz im<br />
Stadion leisten können.<br />
Ihnen gegenüber steht Nikolai Lewtschenko, aufstrebender Nachwuchspolitiker in Donezk. Seine<br />
Stadtwohnung ist in einem Stil ausgestattet, den man als neobarock klassifizieren könnte, den<br />
morgendlichen Grießbrei bekommt er von einer Hausangestellten serviert. In seinem Büro hängt<br />
ein Bildnis Stalins.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 73 of 79<br />
15.06.2011<br />
Der treue Fan Sascha bekam vom Verein als Reaktion auf den Film ein<br />
Jahresabonnement geschenkt. Foto Preuss.<br />
„Es gibt eine Verbindung zwischen Wirtschaft, Politik und<br />
Sport“<br />
Lewtschenko dürfte inzwischen bereuen, dem Berliner Regisseur Jakob Preuss derartig intime<br />
Einblicke in seine Verhältnisse gewährt zu haben. Denn der Film, dessen Untertitel lautet „Es gibt<br />
immer eine Verbindung zwischen Wirtschaft, Politik und Sport“, wurde inzwischen auch in der<br />
Ukraine gezeigt. In Lewtschenkos Heimatland also, wo er die Rolle des politischen Scharfmachers<br />
auf Seiten der „blauen“ Gegenkräfte zum „orangenen“ Lager kultiviert, wenn er beispielsweise für<br />
Russisch und gegen Ukrainisch als Amtssprache eintritt.<br />
Da ist es für seine Ambitionen nicht gerade förderlich, wenn die Zuschauer im Kino dabei sind,<br />
wie er während seiner Arbeitszeit Gardinen für seine Luxuswohnung aussucht. Oder wenn er laut<br />
darüber sinniert, dass Wahlverlierer in der Ukraine eine Verfolgung durch die Justiz zu befürchten<br />
hätten. Seit der „orangenen Revolution“ von 2004 hat sich das Ruder schließlich gedreht, jetzt<br />
sitzen seine „Blauen“ mit Präsident Viktor Janukowitsch in Kiew an den Schalthebeln der Macht.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 74 of 79<br />
15.06.2011<br />
Vom Bergbau geprägt: die ostukrainische Metropole Donezk. Foto Preuss.<br />
Milliardenschwerer Klubpräsident<br />
Zum blauen Lager gehört auch Boris Kolesnikow, der stellvertretende Ministerpräsident der<br />
Ukraine. Als Reaktion auf den Film empfahl dieser Lewtschenko nun öffentlich, seine politische<br />
Tätigkeit am besten an den Nagel zu hängen und eine Bäckerei aufzumachen, wenn er dem Land<br />
dienen wolle. Anders dagegen Lewtschenkos politischer Ziehvater, der milliardenschwere Rinat<br />
Achmetow, der jüngst Schlagzeilen machte, als sein Unternehmen SCM die mit geschätzten 150<br />
Millionen Euro wohl teuerste Wohnung Londons erwarb.<br />
Achmetow ist Klubpräsident bei Schachtjor und so etwas wie der Übervater des Donbass. Aus<br />
Regionalpatriotismus investiert er auch hier, in seiner Heimat. Im Gegensatz zu Milliardärskollege<br />
Roman Abramowitsch, der sich den Londoner Klub Chelsea als Spielzeug leistete, schenkte<br />
Achmetow Donezk ein Stadion für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Auch er<br />
hat den Film gesehen. Gefallen hat dem ukrainischen Unternehmer tatarischer Herkunft, wie<br />
Preuss gezeigt habe, dass der Fußball die Region verbinde. Und an Lewtschenko lobt der Oligarch<br />
dessen Ehrlichkeit – wenigstens habe er sich nicht eine Wohnung gemietet, um dem Filmteam<br />
vorzugaukeln, dass er in einfachen Verhältnissen lebe.<br />
Was hat Lewtschenko bewogen, sich von Preuss porträtieren zu lassen? Eine Vorstellung<br />
bekommt, wer Preuss erlebt, der zu seinen Filmvorführungen in Berlin, Warschau, Kiew oder<br />
Donezk stets persönlich anreist, um mit den Zuschauern zu diskutieren. Es muss so etwas wie eine<br />
Anziehung gegeben haben zwischen dem Regisseur und seinem Protagonist.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 75 of 79<br />
15.06.2011<br />
Nachwuchspolitiker Lewtschenko: „Wahlverlierer müssen in der Ukraine die Justiz<br />
fürchten.“ Foto Preuss.<br />
Ein Hauch von Skandal<br />
Mit Mitte 30 sind sie beide in etwa gleichaltrig. Beide lieben sie den öffentlichen Auftritt, stehen<br />
gerne im Rampenlicht. Und sicherlich fühlte Lewtschenko sich auch etwas geschmeichelt von der<br />
Aufmerksamkeit durch das Filmteam. Nach der Filmvorführung, die in Donezk vom Hauch eines<br />
Skandals umgeben ist, gibt der Jungpolitiker eine Pressekonferenz und verkündet, natürlich sei der<br />
Film unvorteilhaft für ihn. Doch einen Grund zum Rücktritt sieht Lewtschenko nicht. Und wenn<br />
er sich für etwas schäme, dann für die im Film gezeigten katastrophalen Arbeitsbedingungen in<br />
den Kohleschächten und nicht für seinen Auftritt. Für deren Verbesserung, so der Jungpolitiker,<br />
wolle er 24 Stunden am Tag arbeiten.<br />
So ganz mag man Lewtschenko diese zur Schau gestellte Gelassenheit allerdings nicht abnehmen.<br />
Preuss wieß zu berichten, dass der Held seines Filmes die Rechte an ebendiesem kaufen wollte –<br />
für die Ukraine, Russland und Wießrussland. Sie haben sich auch nach der Filmpremiere<br />
gesprochen, Lewtschenko und Preuss, den der Politiker öffentlich immer noch als seinen Freund<br />
bezeichnet. Stalin ist inzwischen aus dem Büro verschwunden. Etwas zynisch, so Preuss, habe<br />
Lewtschenko ihm für die Hilfe bei seiner Karriere gedankt. „Das kann absurderweise sogar<br />
stimmen“ meint Preuss, schließlich habe Achmetow der Film ja gefallen – und dessen Wort hat<br />
Gewicht in Donezk.<br />
*
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 76 of 79<br />
15.06.2011<br />
The Other Chelsea – Kinotrailer:<br />
Die Autoren im Netz:<br />
http://www.robertkalimullin.de/<br />
http://martin-brand.de/<br />
GELESEN<br />
„Aeroflot bis Zar – Ein heiteres Sachbuch zu<br />
den 222 russischen Wörtern, die ALLE<br />
Deutschen kennen“ von Wolf Oschlies.<br />
Wieder hat im Wieser Verlag in Klagenfurt ein Buch von Wolf Oschlies das<br />
Licht der Welt erblickt. Wie alle Bücher der Reihe „Europa erlesen“ ist auch<br />
dieses in handlichem und damit Leser- und lesefreundlichem Format<br />
erschienen. Das Buch ist mit zahlreichen Illustrationen von Shenja Sidorkin<br />
versehen, und mit einer davon geht es auf dem Cover gleich heiter los und<br />
dann heiter weiter.<br />
Von Lutz Hustig<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
ei den beiden üppigen Matronen auf dem Titel handelt es sich um Matrjoschkas. Mütterchen<br />
Russland hat keine Barbies hervorgebracht, sondern frauliche Frauen, von der Traktoristin<br />
bis zur Dame - Fülliges in Fülle. Auch der russische Mann (die nächste Illustration) ist mit<br />
Ikone und Samowar, mit seiner Balalaika und seinem Wodka recht gemütlich und umgänglich.<br />
Aber bald lernen wir im Text, wie sehr gerade das Sowjetische der russischen Sprache abträglich<br />
gewesen ist. Ehe der Autor nämlich die 222 Wörter alphabetisch auflistet und kenntnis- und<br />
faktenreich kommentiert, geht er auf rund 120 Seiten dem Geschick der siebtgrößten Weltsprache
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 77 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Aeroflot bis Zar – Ein heiteres Sachbuch zu<br />
den 222 russischen Wörtern, die ALLE<br />
Deutschen kennen“ von Wolf Oschlies.<br />
Ende der 80-er Jahre kaum gemildert werden konnten.<br />
nach und sieht ihre Bedeutung und ihren Einfluss<br />
im Niedergang begriffen, in Osteuropa sowieso,<br />
aber auch bei uns.<br />
Russisch – im Bewusstsein der<br />
Untertanen<br />
Unterdrückungsmittel<br />
„Die russische Sprache wurde jahrzehntelang<br />
nicht als das Medium russischer Kultur und<br />
Literatur angesehen, sondern als der Originalton<br />
sowjetisch-stalinistischer Politik!“ Darum blieb<br />
sie, auch wenn sie als Band der Einheit im<br />
Sowjetreich und seinem Einflussgebiet gedacht<br />
war, im Bewusstsein der Untertanen eben doch<br />
Unterdrückungsmittel. Von daher ergaben sich<br />
anhaltende, selbst den Zerfall der Sowjetunion<br />
überdauernde Vorbehalte und Aversionen, die<br />
auch durch die günstige Phase der Perestroika<br />
Wer in der DDR Russisch-Unterricht genossen hat, und nicht wie Oschlies das seltene Glück<br />
hatte, durch die Hände einer ausgezeichneten Lehrerin zu gehen, der hatte in der Regel noch nach<br />
etlichen Jahren null Kenntnisse der Sprache: „Drei Jugendliche stehen mit einem uniformierten<br />
Russen zusammen und fragen ihre Lehrerin: ‚Was hat der gesagt?’ Die Lehrerin: ,Er sagt, er finde<br />
es schön, dass ihr bei mir sechs Jahre Russisch in der Schule gelernt habt’“.<br />
„Eine Phase, in welcher Deutsche gern und lustvoll Russisch<br />
gelernt hätten, hat es zu meinem Bedauern nie gegeben.“<br />
Selbst Erich Honecker hat sich vergeblich bemühat, aber das nicht, weil Russisch an sich schwer<br />
wäre, sondern weil er das Deutsche nicht einmal grammatikalisch sicher beherrschte. Und so<br />
laufen Oschlies’ Beobachtungen auf die zusammenfassende Feststellung hinaus: „Eine Phase, in<br />
welcher Deutsche gern und lustvoll Russisch gelernt hätten, hat es zu meinem Bedauern nie<br />
gegeben“.<br />
Dabei blicken die sprachlichen Kontakte zwischen Russen und Deutschen auf eine 1000-jährige<br />
Geschichte zurück. Der Autor erinnert an die Kauffahrer der Hanse in Nowgorod, an deutsche<br />
Beteiligung an der Petersburger Akademie im 18. Jahrhundert und an den Beitrag der<br />
Francke’schen Stiftungen in Halle zur Entwicklung der Slawistik in Deutschland. Gegenseitige<br />
Wertschätzung oder auch Gleichgültigkeit gingen erst in antirussischen Polemiken und Hetzen des<br />
ausgehenden 19. Jahrhunderts und im Vorfeld des Ersten Weltkriegs unter. Zu dieser Zeit ist der<br />
Russland-Enthusiasmus Rilkes bereits als eine Besonderheit anzusehen. Sprachkontakte und<br />
Kooperationen in der Zwischenkriegszeit hat es nur anfänglich im militärischen Bereich zwischen<br />
den beiden totalitären Systemen gegeben, zielte doch die NS-Ideologie letztlich auf die<br />
Verdrängung des als minderwertig erachteten Slawischen.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 78 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Wenigstens die kyrillischen Buchstaben sollte man sich<br />
einmal angeeignet haben“<br />
Im gespaltenen Deutschland hat dann Wolfgang Steinitz mit seinen Lehrbüchern, die teilweise<br />
auch im Westen erschienen sind, versucht, den Deutschen das Russische schmackhaft und leicht<br />
zu machen. Ich erinnere mich, im Jahr 1967 von ihm „Russisch in 26 Lektionen“ in Händen<br />
gehabt zu haben, kam aber über Lektion 4 nicht hinaus, weil ich mich nach dem Sinn und Zweck<br />
meines Tuns fragte, also teilhatte an dem allgemeinen Desinteresse am Russischen auch in der<br />
Bundesrepublik.<br />
Das kann ich im Nachhinein nur beklagen, liegt doch Russland wenigstens geographisch näher an<br />
Europa als Nord-Amerika – es gehört geographisch in größerem Maße zu Europa als die Türkei,<br />
geistes- und kulturgeschichtlich in jedem Fall. Diese Feststellung kann nicht verkehrt sein und<br />
man sollte sich den Sachverhalt gelegentlich bewusst machen. Das wird man die<br />
Minimalforderung des Autors auch eher beherzigen, sich doch wenigstens die kyrillischen<br />
Buchstaben einmal angeeignet zu haben. Aber zunächst können die 222 russischen Wörter im<br />
Deutschen helfen, Zusammenhänge zu verstehen und das Bewusstsein korrigierend zu erhellen.<br />
Rezension zu: „Aeroflot bis Zar – Ein heiteres Sachbuch zu den 222 russischen Wörtern, die<br />
ALLE Deutschen kennen“ von Wolf Oschlies, Wieser Verlag, Klagenfurt 2011, 349 S., 12,95<br />
Euro, ISBN: 978-3851298895.<br />
GELESEN<br />
„Der Anglizismen-Index - Anglizismen,<br />
Gewinn oder Zumutung?“ von Gerhard H.<br />
Junker, Hrsg.<br />
Der Anglizismen-Index ist ein Verzeichnis von rund 7.300 englischen Wörtern<br />
und Wendungen, die in die deutsche Sprache eingedrungen sind. Dabei ist er<br />
jedoch weit mehr als ein reines Wörterbuch.<br />
Von Barbara Gutmann<br />
EM 06-11 · 05.06.2011<br />
*<br />
ls „ein Buch zum Nachschlagen. Ein Buch zum Schmökern. Ein Buch zum Bessermachen.“<br />
ist dieser Index konzipiert. Alle drei dieser Versprechen erfüllt er.<br />
Zum Beispiel Nachschlagen: Der Anglizismen-Index ist ein Verzeichnis von rund 7.300<br />
englischen Wörtern und Wendungen, die in die deutsche Sprache eingedrungen sind. Manche<br />
fallen kaum noch auf. Zum Beispiel der im Vokabular der Sportreporter gebräuchliche „Keeper“,<br />
für den es das schöne deutsche Wort „Torwart“ gibt. Oder der auch immer wieder auf dem Rasen<br />
gesichtete „Referee“ für den man – viel schöner und sofort durchschaubar - „Schiedsrichter“<br />
sagen könnte (oder „Schiri“, wenn man es flapsiger mag). Oder einfach „Unparteiischer“.
<strong>Eurasisches</strong> <strong>Magazin</strong> 06-11<br />
http://localhost/eurasischesmagazin.de/3.0/!final/datenbank/pdf.asp<br />
Page 79 of 79<br />
15.06.2011<br />
„Der Anglizismen-Index -<br />
Anglizismen, Gewinn oder<br />
Zumutung?“ von Gerhard<br />
H. Junker, Hrsg.<br />
Das sind dann schon Beispiele zum Bessermachen. Auch das<br />
allgegenwärtige „Ticket“ ist eigentlich längst fällig. <strong>Zur</strong><br />
Verbesserung. Vorschläge im Index zeigen auf die Vielfalt, die im<br />
Deutschen gegeben ist: Fahrkarte, Eintrittskarte, Kinokarte,<br />
Flugkarte, Strafzettel usw.<br />
Für das Sprachkauderwelsch der Wirtschaftsleute, der Börsianer und<br />
Manager (Führungskräfte, Leiter) sind auch eine Reihe von<br />
Verbesserungsvorschlägen aufgeführt. Man höre und staune, der<br />
wichtigtuerisch klingende „break-even“ hat eine wohlklingende<br />
deutsche Entsprechung: „Gewinnschwelle“. Vielleicht würde<br />
manchem viel erspart, wenn er eher mal daran dächte, anstatt den<br />
„break“ im Munde zu führen. – Oder an die Maklergebühr, die fällig<br />
ist, auch wenn sie heute oft gedankenlos als „brokerage“ bezeichnet<br />
wird. Sie ist deshalb nicht harmloser. Und auch<br />
Erschöpfungserscheinungen sind eigentlich viel zu gefährlich, um<br />
sie mit dem anglizistischen Modebegriff „burnout“ abzutun.<br />
„Es ist kurzweilig, erhellend, verblüffend<br />
und ermutigend, die oft so naheliegenden deutschen<br />
Übersetzungen zu erfahren.“<br />
Ganz selten sehen sich die Autoren einmal nicht willens und in der Lage eine deutsche<br />
Übersetzung zu bieten. Beispiel „power“ in allen Variationen. „Frauenpower“ oder „Powerfrau“,<br />
„Powerpreise“ oder „Powersex“. Das ist auch gut so. Denn da will die deutsche Sprache einfach<br />
vielfältiger gebraucht werden. Je nach Situation. Starke Frauen kennen wir ja auch. Und guten<br />
Sex. Aber nicht alles und jedes ist „Power“.<br />
Wobei wir beim Schmökern wären: Es ist kurzweilig, erhellend, verblüffend und ermutigend, die<br />
Anglizismen zu erkennen und ihre oft so naheliegenden deutschen Übersetzungen zu erfahren.<br />
Im Klappentext des Verlags heißt es: „Der Untertitel ‚Gewinn oder Zumutung?‘ macht es<br />
deutlich: Der Anglizismen-Index ist nicht das Werk von Puristen, sondern von Menschen, die sich<br />
konstruktiv und tolerant mit der deutschen Sprache auseinandersetzen. So gibt es aus Sicht der<br />
Autoren nicht nur unwillkommene Anglizismen, sondern durchaus auch solche, die<br />
differenzierend und ergänzend das Deutsche bereichern. Der Anglizismen-Index bietet somit dem<br />
Leser Verstehenshilfen im Alltag wie auch Anregungen beim Abfassen eigener Texte. Kurzum:<br />
Ein Buch zum Nachschlagen. Ein Buch zum Schmökern. Ein Buch zum Bessermachen.“<br />
*<br />
Rezension zu: „Der Anglizismen-Index - Anglizismen, Gewinn oder Zumutung?“ von Gerhard H.<br />
Junker, Hrsg. Broschiert, 304 Seiten, Ifb Verlag (April 2011) 15,00 Euro, ISBN- -13: 978-<br />
3942409117.<br />
Den „Anglizismen-Index“ gibt es auch im Netz: http://www.vds-ev.de/anglizismenindex/