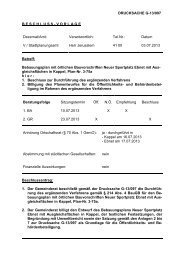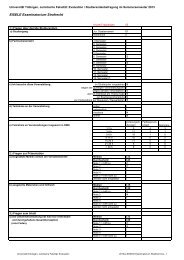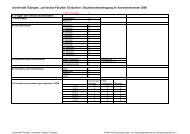Tatumstandsirrtum
Tatumstandsirrtum
Tatumstandsirrtum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
Grundlagen der Irrtumslehre<br />
Strafbarkeit des T gem. § xx StGB<br />
1. Tatbestandsmäßigkeit<br />
a) Objektiver Tatbestand<br />
b) Subjektiver Tatbestand<br />
2. Rechtswidrigkeit<br />
3. Schuld<br />
§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB:<br />
Vorsatz des Täters entfällt bei<br />
<strong>Tatumstandsirrtum</strong><br />
§ 17 S. 1 StGB:<br />
Schuld des Täters entfällt bei<br />
Verbotsirrtum<br />
Ein Irrtum ist die unbewusste Divergenz von Vorstellung und Wirklichkeit. Strafrechtliche Anknüpfungspunkte<br />
für die Behandlung von Irrtümern sind die §§ 16, 17 StGB. Das Gesetz unterscheidet<br />
darin den <strong>Tatumstandsirrtum</strong> vom Verbotsirrtum.<br />
Unbewusste Fehlvorstellung des Täters ...<br />
Ebene:<br />
... auf der<br />
Sachverhaltsebene<br />
... auf der<br />
Normebene<br />
Inhalt:<br />
... über Umstände des<br />
Tatgeschehens.<br />
... über das Ge- oder<br />
Verbotensein der Tat.<br />
Anknüpfungsnorm:<br />
§ 16 Abs. 1 Satz 1 StGB<br />
§ 17 StGB<br />
(Spezialnorm: § 35 Abs. 2 StGB)<br />
<strong>Tatumstandsirrtum</strong><br />
Verbotsirrtum<br />
Wirkung:<br />
Vorsatz<br />
entfällt<br />
Schuld<br />
entfällt<br />
Ein Irrtum auf der Sachverhaltsebene lässt als sog. <strong>Tatumstandsirrtum</strong> den Vorsatz entfallen<br />
(§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB). Zu den von der Norm bezeichneten „Tatumständen“ gehören alle<br />
im objektiven Tatbestand zu prüfenden Merkmale. Die Unkenntnis (auch nur) eines der Merkmale<br />
wirkt insgesamt vorsatzausschließend.<br />
Ein Irrtum auf der Normebene (also über das Ge- oder Verbotensein des Tuns) lässt hingegen<br />
den Vorsatz unberührt, kann aber zum Schuldausschluss führen, wenn dieser sog. Verbotsirrtum<br />
unvermeidbar war (§ 17 S. 1 StGB). Regelmäßig sind Verbotsirrtümer aber vermeidbar<br />
und führen allenfalls zu einer Strafmilderung über § 17 S. 2 StGB.<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 1 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
Der <strong>Tatumstandsirrtum</strong> (§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB)<br />
Vorsatz ist der bei Tathandlung vorliegende Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestands<br />
– „Wollenselement“ – in Kenntnis aller seiner objektiven Tatumstände – „Wissenselement“ –.<br />
Der <strong>Tatumstandsirrtum</strong> ist also die Kehrseite des Wissenselements als Vorsatzbestandteil. 1<br />
Unbewusst fehlerhafte Vorstellung von ...<br />
... dem Vorliegen eines Tatumstands<br />
• = Sachverhaltsirrtum<br />
• als <strong>Tatumstandsirrtum</strong> i.S.d. § 16 StGB vorsatzausschließend<br />
... der Bedeutung eines Tatumstands<br />
• = Bewertungsirrtum<br />
• als <strong>Tatumstandsirrtum</strong> i.S.d. § 16 StGB vorsatzausschließend<br />
... der (juristischen) Subsumtion eines Tatumstands<br />
• = Subsumtionsirrtum<br />
• kein <strong>Tatumstandsirrtum</strong> i.S.d. § 16 StGB<br />
• mglw. Verbotsirrtum i.S.d. § 17 StGB<br />
... von (außertatbestandlichen) Motivumständen<br />
• = Motivirrtum<br />
• kein <strong>Tatumstandsirrtum</strong> i.S.d. § 16 StGB<br />
• mglw. Verbotsirrtum i.S.d. § 17 StGB<br />
Bewertungsirrtum vs. Subsumtionsirrtum<br />
Abgrenzung über das Gelingen einer „Parallelwertung in der Laiensphäre“<br />
1<br />
Kühl, StrafR AT, § 13, Rn. 12.<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 2 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
Besondere Konstellationen des <strong>Tatumstandsirrtum</strong>s<br />
Vorsatzausschließender <strong>Tatumstandsirrtum</strong> (§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB)?<br />
(1) Tatobjektsverwechslung (error in persona vel in obiecto)<br />
(2) Kausalverlaufsabweichungen (Irrtum über den Kausalverlauf)<br />
(3) Fehlgehen der Tat (aberratio ictūs)<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 3 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
(1) Die Verwechslung des Tatobjekts<br />
Im Jahr 1858 hatte das Preußische Obertribunal folgenden, in die Rechtsgeschichte als „Rose-<br />
Rosahl-Fall“ 2 eingegangenen Fall zu entscheiden: Der Arbeiter Rose wurde von seinem Arbeitgeber,<br />
dem Holzhändler Rosahl, angestiftet, den Zimmermann Schliebe zu erschießen. Rose<br />
legte sich abends nach 21 Uhr in einem Hinterhalt auf die Lauer. In der Dunkelheit hielt er den<br />
des Weges kommenden 17-jährigen Gymnasiasten Harnisch irrtümlich für den Schliebe und<br />
erschoss ihn. – Obwohl aus der Sicht des Rose seine Tat fehlgeschlagen war (er hatte den<br />
Falschen erschossen), ist dieser Irrtum über die Identität des Tatopfers kein <strong>Tatumstandsirrtum</strong><br />
i.S.v. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB. Denn Tatumstand i.S.d. der Tötungstatbestände ist<br />
allein ein „Mensch“; und einen solchen hatte der Rose getötet. Die Identität des Opfers ist außertatbestandlich.<br />
Tatobjektsverwechslung<br />
(error in persona vel in obiecto)<br />
Identitätsverwechslung<br />
• gleichwertige Rechtsgüter<br />
• bloß außerstrafrechtlicher Motivirrtum<br />
• Irrtum für den Vorsatz unbeachtlich<br />
• Merke: „Die Identität des Opfers ist unter dem<br />
Gesichtspunkt eines Tötungsdelikts ebenso<br />
irrelevant wie seine Nationalität, Hautfarbe<br />
oder Geschlechtszugehörigkeit“ (Kühl, StrafR<br />
AT, § 13, Rn. 24).<br />
Rechtsgutsverwechslung<br />
• ungleichwertige Rechtsgüter<br />
• Irrtum über Tatumstand "taugliches Tatobjekt"<br />
• <strong>Tatumstandsirrtum</strong> und Vorsatzentfall<br />
gem. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB<br />
• Beispiel: T schießt zum Spaß auf eine<br />
vermeintliche Vogelscheuche, bei der es sich<br />
tatsächlich um einen Menschen handelt (Fall<br />
nach Roxin, StrafR AT I, § 12, Rn. 95).<br />
„Fernwirkungsfälle“<br />
Problematisch sind solche Konstellationen, in denen der sich irrende Täter das Opfer nicht unmittelbar<br />
optisch wahrnimmt (nicht „vor Augen“ hat); Beispiel: „Sprengfalle“ (BGH, NStZ 1998,<br />
294 f.), bei der der Täter eine Handgranate am vermeintlich für das Fahrzeug des Opfers gehaltenen<br />
Pkw befestigt.<br />
Auch eine solche nur mittelbare (Fehl-)Individualisierung des Opfers lässt den Tätervorsatz<br />
unangetastet, weil (wenn) dem Täter als notwendige Folge seines Handelns sachgedanklich<br />
bewusst sein muss, dass er – sofern er das in Aussicht genommene Objekt verfehlt – typischerweise<br />
nur ein anderes, tatbestandlich gleichwertiges Objekt verletzen wird.<br />
2<br />
Preuß. Obertribunal, GA 7, 332 ff.; wie sich der für den Vorsatz des Vordermanns Rose unbeachtliche Identitätsirrtum auf den<br />
Vorsatz des Hintermanns Rosahl auswirkt, ist ein Problem, das i.R. von „Täterschaft und Teilnahme“ aufgegriffen werden wird.<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 4 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
(2) Der Irrtum über den Kausalverlauf<br />
Nicht nur Tathandlung und -erfolg muss der Täter in den Vorsatz aufgenommen haben,<br />
sondern auch den Kausalablauf als Bindeglied zwischen beidem. Dieser Kausalverlauf ist<br />
deshalb (ungeschriebener) Tatumstand i.S.d. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB. Dabei muss der Vorsatz<br />
nur während der Tathandlung, aber nicht mehr im Zeitpunkt des Erfolgseintritts vorliegen (vgl.<br />
§§ 16, 8 StGB).<br />
Tathandlung<br />
= Tatumstand<br />
Kausalverlauf<br />
= Tatumstand<br />
Taterfolg<br />
= Tatumstand<br />
Das Zusammenwirken aller Einzelbedingungen bis zum Taterfolg ist allerdings komplex und die<br />
Kenntnis des ja zukünftigen Ablaufs der Ereignisse ist zudem naturgemäß beschränkt. Mehr als<br />
eine Prognose kann die Vorstellung vom Kausalverlauf nicht sein. Deshalb muss der Täter den<br />
Kausalverlauf nur in seinen wesentlichen Zügen erfasst haben.<br />
Eine Divergenz zwischen dem eingetretenen und dem vom Täter gedachten Geschehensablauf<br />
ist regelmäßig dann unbeachtlich, wenn sie unwesentlich ist, namentlich weil<br />
beide Kausalverläufe gleichwertig sind, und sie demgemäß keine andere Bewertung der<br />
Tat rechtfertigt. 3<br />
Ganz vorrangig maßgebend ist, ob eine Kausalabweichung so erheblich ist, dass sie der strafrechtlichen<br />
Bewertung ein anderes Gepräge gibt.<br />
Nebensächliche Verlaufsalternativen sind ohne Belang.<br />
„Brückenpfeiler-Fall“ (Roxin, StrafR AT I, § 12, Rn. 153, 155, § 11, Rn. 70 ff.)<br />
Relevante Prüfungsschritte:<br />
Kausalabweichung<br />
• Fraglich, ob<br />
objektiv und<br />
subjektiv noch<br />
"Werk" des Täters.<br />
Objektive<br />
Zurechnung?<br />
• Maßstab: Grenzen<br />
des nach<br />
allgemeiner<br />
Lebenserfahrung<br />
Vorhersehbaren<br />
Subjektive<br />
Zurechnung?<br />
• Maßstab:<br />
"Wesentlichkeit",<br />
d.h.<br />
Gleichwertigkeit /<br />
Rechtfertigung<br />
einer anderen<br />
Bewertung der Tat<br />
3<br />
Vgl. BGH, NStZ 2002, 475 (476).<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 5 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
(3) Das Fehlgehen der Tat (aberratio ictūs)<br />
Vom error in obiecto zu unterscheiden ist die Konstellation der sog. aberratio ictūs (lat. für „Abirrung<br />
des Pfeils“), in der der Täter zwar das anvisierte Tatobjekt richtig identifiziert (individualisiert)<br />
und seinen Vorsatz entsprechend konkretisiert hat, der Taterfolg aber nach dem täterseitigen<br />
Aus-der-Hand-Geben aufgrund äußerer Umstände an einem anderen Objekt eintritt.<br />
Beispiel „Robin-Hood-Fall“:<br />
Robin H. schießt in Tötungsabsicht einen Pfeil auf den O; der Pfeil wird von einem starken<br />
Windstoß erfasst und trifft deshalb den X, der neben dem O steht. Das wollte der Robin H.<br />
natürlich nicht. <strong>Tatumstandsirrtum</strong> i.S.d. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB?<br />
Vorsatz zutreffend konkretisiert auf ein Tatobjekt<br />
SCHUSS<br />
ÄUßERE EINWIRKUNG<br />
"Geschossabirrung"<br />
(lat. "aberratio ictūs")<br />
Treffer an einem anderen, aber gleichwertigen Objekt (z.B. anderer Mensch)<br />
Vorsatzausschließender <strong>Tatumstandsirrtum</strong> bzgl. des Treffers am "falschen" Objekt?<br />
Gleichwertigkeitstheorie vs. Konkretisierungstheorie (hM)<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 6 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
Gleichwertigkeitstheorie (aA)<br />
Konkretisierungstheorie (hM)<br />
vergleichbar dem error in persona,<br />
weil taugliches Tatobjekt getroffen<br />
„Die aberratio ictus ist keine eigenständige<br />
Rechtsfigur, sondern nur ein<br />
besonderer Fall der Kausalabweichung“<br />
(Roxin, StrafR AT I, § 12, Rn. 166).<br />
wesentlicher Kausalverlaufsirrtum<br />
(+)<br />
<strong>Tatumstandsirrtum</strong>, § 16 Abs. 1 S. 1 StGB<br />
(+)<br />
Vorsatz bleibt bestehen.<br />
Vorsatz entfällt<br />
Bestrafung aus vollendetem Delikt<br />
Bestrafung aus<br />
versuchtem Delikt am „richtigen“ Objekt<br />
und<br />
Fahrlässigkeitsdelikt am „falschen“<br />
Objekt (vgl. § 16 Abs. 1 S. 2 StGB).<br />
„Der Unterschied zur typischen ‚error in persona’-Konstellation<br />
ist deutlich [am Beispiel<br />
eines Tötungsdelikts]: während dort der anvisierte<br />
Mensch vom Täter getroffen wird, verfehlt<br />
hier der Täter sein Ziel. Beim ‚error in<br />
persona’ liegt nur eine ‚Personenverwechslung’<br />
vor, bei der ‚aberratio ictūs’ dagegen ein<br />
‚Danebenschießen’“ (Kühl 4 ).<br />
4<br />
Kühl, StrafR AT, § 13, Rn. 29.<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 7 von 8
STRAFRECHT AT<br />
Fallbesprechung<br />
Christian Trentmann, ass. iur.<br />
Akademischer Mitarbeiter, Lehrstuhl Prof. Eisele<br />
trentmann@jura.uni-tuebingen.de<br />
Abgrenzungsübersicht<br />
error in obiecto<br />
aberratio ictūs<br />
Der Taterfolg tritt an dem Objekt ein, an dem er<br />
nach der Tätervorstellung auch eintreten sollte.<br />
Der Taterfolg tritt aufgrund äußerer Umstände<br />
an einem anderen Objekt als dem vorgestellten<br />
ein.<br />
Der Täter individualisiert das Objekt falsch.<br />
Der Täter hat das nach seiner Vorstellung von<br />
der Tat "richtige" Objekt individualisiert und<br />
seinen Vorsatz entsprechend konkretisiert.<br />
I.d.R. bloßer Motivirrtum.<br />
I.d.R. wesentlicher Irrtum über den<br />
Kausalverlauf.<br />
Vorsatz bleibt bestehen.<br />
Vorsatzausschließender <strong>Tatumstandsirrtum</strong>.<br />
Trentmann | 25/11/2013 | Seite 8 von 8