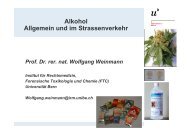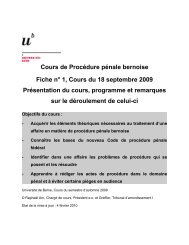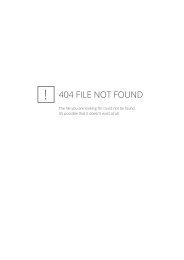Lösungsskizze zur völkerstrafrechtlichen Klausur vom 11. Januar 2011
Lösungsskizze zur völkerstrafrechtlichen Klausur vom 11. Januar 2011
Lösungsskizze zur völkerstrafrechtlichen Klausur vom 11. Januar 2011
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Lösungsskizze <strong>zur</strong> völkerstrafrechtlichen<br />
<strong>Klausur</strong> <strong>vom</strong> <strong>11.</strong> <strong>Januar</strong> <strong>2011</strong><br />
Frage 1 (3 Punkte):<br />
a) Welche Straftaten waren im – dem Londoner Viermächte-Abkommen <strong>vom</strong> 8. Aug. 1945<br />
beigefügten – Nürnberger Statut enthalten?<br />
b) Was versteht man unter den Nürnberger Nachfolgeprozessen und auf welcher Rechtsgrundlage<br />
beruhten sie?<br />
a) Verbrechen g. den Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen g. die<br />
Menschlichkeit<br />
b) Weiterführung der Prozesse gegen Kriegsverbrecher der europäischen Achse<br />
vor nationalen Militärgerichten der einzelnen Besatzungsmächte USA, UK,<br />
Frankreich, Sowjetunion) gemäss Kontrollratsgesetz Nr. 10, insb. der 12<br />
Prozesse in der amerikanischen Besatzungszone, bei denen die<br />
Militärgerichte durch zivile Strafrichter besetzt waren.<br />
Frage 2 (3 Punkte):<br />
Was versteht man unter a) Direct Enforcement, b) Indirect Enforcement und c) Mixed Enforcement?<br />
Geben Sie je zwei Beispiele.<br />
a) Prozesse nach Völkerstrafrecht vor internationalen Gerichten (z.B. ICC, ICTY,<br />
ICTR)<br />
b) Entsprechende Prozesse vor nationalen Strafgerichten (z.B. Eichmann-<br />
Prozess in Jerusalem, Niyonteze-Prozess in der Schweiz)<br />
c) Prozesse vor gemischt nationalen-internationalen Gerichte (z.B. SCSL,<br />
ECCC)<br />
Prof. Dr. iur. Hans Vest<br />
Schanzeneckstr. 1, Pf. 8573<br />
CH-3001 Bern<br />
Tel. +41 (0)31 631 47 95<br />
Fax +41 (0)31 631 82 05<br />
hans.vest@krim.unibe.ch<br />
www.krim.unibe.ch
Frage 3 (4 Punkte):<br />
Nennen und diskutieren sie am Beispiel, ob es sich bei Hutus und Tutsis um ethnische Gruppen<br />
handelt, die Modelle, aufgrund derer bestimmt wird, ob eine durch Art. 6 IStGH-Statut (Völkermord)<br />
geschützte Gruppe vorliegt?<br />
Gruppen sind durch gemeinsame Merkmale dauerhaft verbundene<br />
Personenmehrheiten, die sich von der übrigen Bevölkerung abheben. Erforderlich<br />
ist ein minimales Zugehörigkeitsgefühl der Gruppenmitglieder. Als Ethnien gelten<br />
menschliche Gruppen, welche dieselbe Kultur im Sinne einer gemeinsamen<br />
Abstammung, Geschichte, Sprache, Glaubenseinstellung, Sittenordnung, Tradition<br />
etc. besitzen. Ob unterschiedliches Brauchtum genügt, um eine Ethnie zu<br />
konstituieren, ist strittig.<br />
Konzepte der Bildung einer (ethnischen) Gruppe orientieren sich, formal gesehen,<br />
an objektiven, subjektiven oder gemischt subjektiv-objektiven Kriterien. Ob bei der<br />
Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Kriterien einem<br />
(sozial)wissenschaftlichen oder strafrechtlichen, an der Trennung zwischen<br />
objektiven und subjektiven Tatbestand orientierten, Betrachtungsweise zu folgen<br />
ist, ist ungeklärt.<br />
In objektiver Hinsicht ist problematisch, dass die Hutus und die Tutsis sich nach<br />
den meisten Kriterien, die für die Bestimmung der ethnischen Zugehörigkeit<br />
bedeutsam sind, nicht unterscheiden. Unterschiedlich ist primär die (vermutete)<br />
Abstammung und Herkunft. Zudem wurde die ethnische Zugehörigkeit in der<br />
nationalen Identitätskarte vermerkt. Auch die gesellschaftlich vorherrschende<br />
Wahrnehmung einer unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeit lässt sich als<br />
objektives Element werten.<br />
Subjektive Konzepte rekurrieren auf die Wahrnehmung bzw. Zuschreibung einer<br />
Gruppenzugehörigkeit unter deren Mitgliedern (Selbstwahrnehmung) oder durch<br />
Aussenstehende (Fremdwahrnehmung). Die Hutus und Tutsis erlebten sich<br />
Seite 2/7
zumind. 1994 wechselseitig als distinkte Gruppen. Bedeutsam ist hierbei<br />
insbesondere die Fremdwahrnehmung seitens des Täterkollektivs, zumal deren<br />
Wahrnehmung unmittelbare Konsequenzen für die Opfer hat. Der subjektive<br />
Ansatz kann sich auch auf moderne soziologische und sozialpsychologische<br />
Einsichten zum Entwicklungsprozess der Gruppenwahrnehmung und -bildung<br />
stützen.<br />
In Theorie und Praxis vorherrschend ist der kombiniert subjektiv-objektive Ansatz,<br />
der sich primär auf die Fremdwahrnehmung seitens des Täterkollektivs abstützt,<br />
jedoch auch einen mindestens minimalen objektiven Zusammenhalt der<br />
Opfergruppe fordert.<br />
Die konkrete Subsumtion sollte auf alle drei Konzepte abgestützt werden.<br />
Frage 4 (3 Punkte):<br />
Nennen Sie die Erfordernisse der Einzeltat der Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.<br />
Art. 7 Abs. 1 lit. f i.V.m. Abs. 2 lit. e IStGH-Statut setzt folgende<br />
Tatbestandselemente voraus:<br />
Objektiv ist erforderlich, dass sich das Opfer im Gewahrsam oder unter der<br />
Kontrolle des Beschuldigten befindet, wobei dieses Kontrollelement weit<br />
auszulegen ist. Mit der Tathandlung muss der Täter dem Opfer vorsätzlich grosse<br />
körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zufügen. Insoweit folgt der<br />
Tatbestand implizit einer Art von Stufentheorie, mit der erniedrigende Behandlung<br />
i.d.R. ausscheidet Ausgeschlossen sind entsprechende Schmerzen oder Leiden,<br />
die sich aus der Anwendung einer gesetzlich zulässigen Sanktion (insbesondere<br />
Todesstrafe) ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind. Eine Mittel-<br />
Zweck-Relation ist nicht erforderlich, ebenso wenig die (in der FoKo<br />
vorausgesetzte) amtliche Eigenschaft des Folterers.<br />
Seite 3/7
Subjektiv ist Vorsatz gem. Art. 30 IStGH-Statut notwendig, nicht aber die<br />
besondere Absicht der Verfolgung eines bestimmten Zwecks.<br />
Frage 5 (3 Punkte):<br />
a) Was für Personenkategorien sind durch das humanitäre Konfliktvölkerrecht des nichtinternationalen<br />
bewaffneten Konfliktes geschützt?<br />
b) Welche Personengruppe ist im Vergleich zum internationalen bewaffneten Konfliktes nicht<br />
(eigens) geschützt?<br />
a) Zivilpersonen sowie die Zivilbevölkerung. Dazu gehören auch all die<br />
Personen, die nicht (mehr) unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen,<br />
einschliesslich der Angehörigen der Streitkräfte, die sich aus diversen<br />
Gründen hors de combat befinden.<br />
Kombattanten sind ggü. meuchlerischer Tötung oder Verwundung geschützt<br />
(Art. 8 Abs. 2 lit. e/ix IStGH-Statut).<br />
b) Kriegsgefangene.<br />
Frage 6 (4 Punkte):<br />
a) Welche sind die Voraussetzungen der Mittäterschaft gemäss Art. 25 Abs. 3 Bst. A, 2. Alt.<br />
IStGH-Statut?<br />
b) Wo ist die Mittäterschaft strenger als das Joint Criminal Enterprise?<br />
a) Die gemeinschaftliche Tatausführung gemäss Art. 25 Abs. 3 lit. a, 2. Alt.<br />
IStGH-Statut erfordert subjektiv einen gemeinsamen Tatplan als Grundlage<br />
und Begrenzung für die wechselseitige Zurechnung der Tatbeiträge. Das allund<br />
gegenseitige Einverständnis kann auch konkludent zustande kommen, im<br />
Extremfall durch einen von den anderen Mittätern stillschweigend akzeptierten<br />
Einpassungsentschluss.<br />
Seite 4/7
Objektiv ist ein wesentlicher Beitrag <strong>zur</strong> koordinierten Verwirklichung des<br />
Tatplanes notwendig, der entweder im Planungs- oder Organisationsstadium<br />
oder aber im Ausführungsstadium geleistet wird. Der Tatbeitrag muss das<br />
Völkerrechtsverbrechen prägen oder zumindest wesentlich mitgestalten.<br />
Strittig ist, ob ein Mittäter ein Hemmungspotential hinsichtlich der Ausführung<br />
der Gesamttat besitzen muss.<br />
b) Die Mittäterschaft stellt mit Bezug auf den geleisteten Tatbeitrag (beim JCE:<br />
Mitwirkung) höhere Anforderungen da in der Praxis keinerlei Qualifikation in<br />
Richtung eines wesentlichen Tatbeitrages erforderlich ist. Dies gilt insb. für die<br />
systemische Form (JCE II). Subjektiv ist die Mittäterschaft selbst bei<br />
statutswidriger Anwendung des Eventualvorsatzes in Art. 30 IStGH-Statut<br />
immer noch deutlich enger als die erweiterte Form des JCE (JCE III).<br />
Frage 7 (3 Punkte):<br />
Nennen Sie die in die Regelung des Art. 33 IStGH-Statut eingeflossenen Prinzipien zum Handeln auf<br />
Befehl.<br />
Art. 33 IStGH-Statut kodifiziert in Abs. 2 das absolute liability principle in Abs. 1 lit.<br />
c findet sich das manifest illegality principle, während Abs. 1 lit. b im<br />
Zusammenhang mit dem mens rea-Grundsatz steht.<br />
Frage 8 (7 Punkte)<br />
K, Kommandant eines Infanterieregiments erhält Informationen über allgemeine Disziplinwidrigkeiten<br />
der Mitglieder einer seiner Kompanien und reagiert darauf, in dem er den verantwortlichen<br />
Kompaniekommandanten scharf verwarnt. Als sich in der Folge der Verdacht ergibt, dass Mitglieder<br />
derselben Kompanie mehrere Kriegsgefangene schwer misshandelt und einen von Ihnen auf der<br />
Flucht erschossen haben, schaltet er Militärpolizei und Militärstaatsanwaltschaft ein und schreibt dem<br />
vorgesetzten Divisionskommandeur einen dienstlichen Rapport. Wie ist sein Verhalten im Lichte von<br />
Art. 28 Bst. A IStGH-Statut zu beurteilen?<br />
Seite 5/7
Art. 28 lit. a IStGH-Statut regelt die Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber<br />
oder tatsächlich als solche handelnder Personen. Sie basiert auf einer<br />
Garantenstellung aus Überwachung einer persönlich-sachlichen Gefahrenquelle<br />
(militärische Einheit einschliesslich der ihr <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Waffen).<br />
In objektiver Hinsicht ist zunächst erforderlich, dass Untergebene des militärischen<br />
Befehlshabers im Statut geregelte Verbrechen begangen haben. In casu besteht<br />
der Verdacht, dass Angehörige einer, zum von K kommandierten Regiment<br />
gehörenden, Kompanie Kriegsgefangene schwer misshandelt und einen von ihnen<br />
auf der Flucht erschossen haben.<br />
Art. 28 setzt voraus, dass der rechtlich oder faktische militärische Befehlshaber<br />
tatsächliche Befehls- bzw. Führungsgewalt und Kontrolle über die Betreffenden<br />
hatte. Eine solche effektive Kontrollgewalt knüpft idealtypisch gesehen an drei<br />
Voraussetzungen an: 1. Autoritätsstellung in Folge der Position als solcher; 2.<br />
Kompetenz <strong>zur</strong> Befehlserteilung bei gegenseitiger Erwartung von deren Befolgung;<br />
3. Einen formalen Disziplinierungsmechanismus. Bei einem<br />
Regimentskommandanten sind diese Voraussetzungen zweifelsohne gegeben.<br />
Die Straftaten der Untergebenen müssen Folge des Versäumnisses des<br />
Befehlshabers gewesen sein, eine ordnungsgemässe Kontrolle über diese<br />
Truppen auszuüben. Gefordert wird insoweit eine Art Risikozusammenhang. Aus<br />
der vorgegebenen Frageskizze kann hierauf keine klare Antwort gegeben werden,<br />
sodass ein grosser Argumentationsspielraum besteht. Das einzige einschlägige<br />
Faktum ist die von K erhaltene Information über vorangegangene allgemeine<br />
Disziplinwidrigkeiten der entsprechenden Kompanieangehörigen, auf die er mit<br />
einer scharfen Verwarnung des verantwortlichen Kompaniekommandanten<br />
reagiert hat.<br />
Insoweit fragt sich auch, ob K damit alle – ihm möglichen und zumutbaren –<br />
erforderlichen und angemessenen Massnahmen der Verbrechensverhinderung<br />
getroffen hat. Hier darf spekuliert werden, ob ein noch strengeres Eingreifen<br />
rechtlich geboten gewesen wäre und die späteren Straftaten verhindert hätte.<br />
Allerdings gilt insoweit ein Massstab ex ante. Dass einmalige Disziplinwidrigkeiten<br />
Seite 6/7
generell <strong>zur</strong> Begehung schwerer Straftaten führen, ist wohl zu verneinen. Insoweit<br />
dürfte K mit der Verwarnung das Nötige vorgekehrt haben.<br />
Unklar ist gemäss Sachverhalt auch, ob K aufgrund der <strong>zur</strong> fraglichen Zeit<br />
gegebenen Umstände (Disziplinwidrigkeiten) hätte wissen müssen, dass<br />
Untergebene von ihm im Begriffe waren, Verbrechen zu begehen. Aus der<br />
nachträglich erlangten Kenntnis von diesen Verbrechen darf kein vorgängiges<br />
Wissen erschlossen werden! Massgebend erscheint der in der Rechtsprechung<br />
der ad hoc-Tribunale entwickelte Massstab sein, dass bestehende Informationen<br />
<strong>zur</strong> Kenntnis genommen und ggf. durch zusätzliche Abklärungen konkretisiert<br />
werden müssten. (Es darf aber auch mit dem Informationsbeschaffungs-Ansatz<br />
argumentiert werden. Auch in diesem Punkt ist der Sachverhalt nicht liquide,<br />
sodass eine weiter Beurteilungsspielraum besteht.<br />
Miit Bezug auf die – von der Präventionsverpflichtung streng zu unterscheidende –<br />
Pflicht <strong>zur</strong> Bestrafung ist eine Kenntnis von K dagegen erstellt. Es ist anzunehmen,<br />
dass er mit der Einschaltung von Militärpolizei und Militärstaatsanwaltschaft sowie<br />
der Erstattung eines dienstlichen Rapports an den vorgesetzten<br />
Divisionskommandeur seinen Handlungspflichten genüge getan hat. Ob er auf<br />
Verdacht hin bereits selbständig zusätzliche Disziplinierungsmassnahmen hätte<br />
anordnen können, erscheint diskutabel.<br />
Seite 7/7