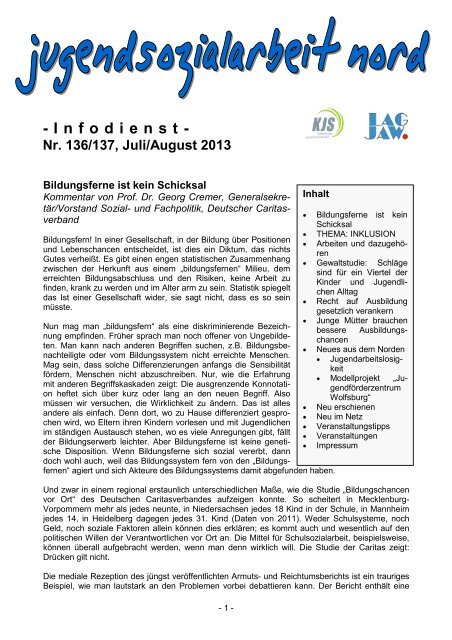I n f o d i e n s t - Katholische Jugendsozialarbeit Nord
I n f o d i e n s t - Katholische Jugendsozialarbeit Nord
I n f o d i e n s t - Katholische Jugendsozialarbeit Nord
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- I n f o d i e n s t -<br />
Nr. 136/137, Juli/August 2013<br />
Bildungsferne ist kein Schicksal<br />
Kommentar von Prof. Dr. Georg Cremer, Generalsekretär/Vorstand<br />
Sozial- und Fachpolitik, Deutscher Caritasverband<br />
Bildungsfern! In einer Gesellschaft, in der Bildung über Positionen<br />
und Lebenschancen entscheidet, ist dies ein Diktum, das nichts<br />
Gutes verheißt. Es gibt einen engen statistischen Zusammenhang<br />
zwischen der Herkunft aus einem „bildungsfernen“ Milieu, dem<br />
erreichten Bildungsabschluss und den Risiken, keine Arbeit zu<br />
finden, krank zu werden und im Alter arm zu sein. Statistik spiegelt<br />
das Ist einer Gesellschaft wider, sie sagt nicht, dass es so sein<br />
müsste.<br />
Nun mag man „bildungsfern“ als eine diskriminierende Bezeichnung<br />
empfinden. Früher sprach man noch offener von Ungebilde-<br />
bessere Ausbildungschanceten.<br />
Man kann nach anderen Begriffen suchen, z.B. Bildungsbenachteiligte<br />
oder vom Bildungssystem nicht erreichte Menschen.<br />
• Neues aus dem <strong>Nord</strong>en<br />
• Jugendarbeitslosigkeit<br />
Mag sein, dass solche Differenzierungen anfangs die Sensibilität<br />
fördern, Menschen nicht abzuschreiben. Nur, wie die Erfahrung<br />
• Modellprojekt „Jugendförderzentrum<br />
mit anderen Begriffskaskaden zeigt: Die ausgrenzende Konnotation<br />
heftet sich über kurz oder lang an den neuen Begriff. Also<br />
Wolfsburg“<br />
müssen wir versuchen, die Wirklichkeit zu ändern. Das ist alles<br />
• Neu erschienen<br />
andere als einfach. Denn dort, wo zu Hause differenziert gesprochen<br />
wird, wo Eltern ihren Kindern vorlesen und mit Jugendlichen<br />
• Neu im Netz<br />
• Veranstaltungstipps<br />
im ständigen Austausch stehen, wo es viele Anregungen gibt, fällt<br />
• Veranstaltungen<br />
der Bildungserwerb leichter. Aber Bildungsferne ist keine genetische<br />
Disposition. Wenn Bildungsferne sich sozial vererbt, dann<br />
• Impressum<br />
doch wohl auch, weil das Bildungssystem fern von den „Bildungsfernen“<br />
agiert und sich Akteure des Bildungssystems damit abgefunden haben.<br />
Und zwar in einem regional erstaunlich unterschiedlichen Maße, wie die Studie „Bildungschancen<br />
vor Ort“ des Deutschen Caritasverbandes aufzeigen konnte. So scheitert in Mecklenburg-<br />
Vorpommern mehr als jedes neunte, in Niedersachsen jedes 18 Kind in der Schule, in Mannheim<br />
jedes 14, in Heidelberg dagegen jedes 31. Kind (Daten von 2011). Weder Schulsysteme, noch<br />
Geld, noch soziale Faktoren allein können dies erklären; es kommt auch und wesentlich auf den<br />
politischen Willen der Verantwortlichen vor Ort an. Die Mittel für Schulsozialarbeit, beispielsweise,<br />
können überall aufgebracht werden, wenn man denn wirklich will. Die Studie der Caritas zeigt:<br />
Drücken gilt nicht.<br />
Die mediale Rezeption des jüngst veröffentlichten Armuts- und Reichtumsberichts ist ein trauriges<br />
Beispiel, wie man lautstark an den Problemen vorbei debattieren kann. Der Bericht enthält eine<br />
- 1 -<br />
Inhalt<br />
• Bildungsferne ist kein<br />
Schicksal<br />
• THEMA: INKLUSION<br />
• Arbeiten und dazugehören<br />
• Gewaltstudie: Schläge<br />
sind für ein Viertel der<br />
Kinder und Jugendlichen<br />
Alltag<br />
• Recht auf Ausbildung<br />
gesetzlich verankern<br />
• Junge Mütter brauchen
Fülle von erschreckenden Befunden dazu, wie Bildungsarmut „vererbt“ wird. Gelingt es Personen,<br />
deren Väter ungelernte Arbeiter waren, eine Berufsausbildung abzuschließen? Der Anteil derjenigen,<br />
die in den 1970er Jahren geborenen sind, und denen dies nicht gelingt, ist fast so hoch wie<br />
bei denjenigen, die zwischen 1920 und 1929 geborenen waren. Auch mit Qualität und Nachhaltigkeit<br />
der Bildung hapert es. Jeder zweite Hauptschüler kommt nicht über sehr basale Leseanforderungen<br />
einfach strukturierter Texte zu vertrauten Themen hinaus und ist somit nur unzureichend<br />
auf eine Ausbildung vorbereitet sind. Zudem ist, wer bereits am Ende seiner Schulzeit nur sehr<br />
basale Lesefähigkeiten hat, in hoher Gefahr, seine Lesefähigkeiten im späteren Leben wieder zu<br />
verlieren. Der Bericht benennt 7,5 Millionen funktionaler Analphabeten in Deutschland.<br />
Aber über was diskutieren wir stattdessen wochenlang? Über die Rangelei des Wirtschaftsministeriums<br />
mit dem Arbeitsministerium über einzelne bewertende Sätze, die – ob sie nun im Bericht<br />
erscheinen oder nicht – eh nichts an den Fakten ändern können. Welch eine vertane Chance!<br />
Was bedeutet das alles für die Jugendhilfe? Erfolgreiche Bildungspolitik ist weit mehr als Schulpolitik.<br />
Sie setzt Befähigung voraus. Nur die Jugendlichen sind in der Lage, mit Interesse und Offenheit<br />
am Bildungserwerb teilzunehmen, deren Gedanken nicht beherrscht sind von den Problemen<br />
zu Hause, von Erfahrungen der Missachtung oder dem Gefühl, ohnehin nicht gebraucht zu werden.<br />
In vielen Fällen schafft erst die Jugendhilfe die Voraussetzungen dafür, dass schulische<br />
Bildung und die anschließende Ausbildung gelingen können. Ihre Arbeit ist unverzichtbar. Zu<br />
Recht gibt es in Deutschland einen individuellen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung wie die<br />
sozialpädagogische Familienhilfe oder notfalls auch eine Heimerziehung, wenn eine dem Wohl des<br />
Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Und dennoch: Auch hier gibt es Bedarf,<br />
das Hilfesystem weiterzuentwickeln. Denn der Rechtsanspruch greift erst dann, wenn sich Probleme<br />
bereits verfestigt haben, wenn der Jugendliche „bereits in den Brunnen gefallen“ ist. Die<br />
Kommunen können sich der Finanzierung nicht verweigern, auch wenn Kämmerer mancherorts<br />
versucht ha-ben, auf Angebote der Hilfen Einfluss zu nehmen und teure Heimaufenthalte zu<br />
vermeiden. Präventive Ansätze dagegen fristen vielerorts ein Schattendasein. Denn für präventive<br />
Angebote wie Stadtteilsozialarbeit, Jugendtreffs oder frühe Hilfen für Familien in prekären Lebenssituationen<br />
besteht keine entsprechende rechtliche Verpflichtung. Es besteht sogar die Gefahr,<br />
dass steigende Kosten für die Hilfen zur Erziehung vielerorts die bestehenden präventiven Ansätze<br />
weiter zurückdrängen. In den nächsten Jahren, wenn die Schuldenbremse auf Ebene der Bundesländer<br />
umzusetzen ist, wird sich dies verschärfen, wenn nicht gegengesteuert wird.<br />
Derzeit steht die Jugendhilfe unter Druck – wie schon häufiger in ihrer langen Geschichte. Der in<br />
einer Reihe von Großstädten starke Anstieg der Kosten der Hilfen zur Erziehung führt bei Kommunen<br />
und Bundesländern zu Überlegungen, wie dieser Trend gebrochen werden kann. Natürlich<br />
müssen wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass jeder Jugendliche aus prekären Milieus die Hilfe<br />
bekommt, die er für eine gelingende Entwicklung benötigt. Aber Abwehr allein ist keine gute<br />
Strategie. So komplex die Gründe für den Anstieg der Kosten sind, er wirft legitimer weise die<br />
Frage auf, ob nicht Basissysteme wie Kitas und Schulen, Angebote der Familienhilfe oder nieerschwellige<br />
Angebote für (potentiell) gefährdete junge Menschen so gestärkt werden können,<br />
dass ein Teil des hohen Bedarfs an Hilfen zur Erziehung vermieden werden kann. Dieser Weg<br />
müsste auch dann beschritten werden, wenn es keine kommunalen Haushaltsprobleme gäbe. Und<br />
er wird vermutlich auch nur mittelfristig zu Kostenentlastungen bei den Hilfen zur Erziehung führen,<br />
denn es wird dauern, bis die verstärkte präventive Arbeit wirken wird. Die Zusammenarbeit von<br />
freien Trägern und öffentlicher Jugendhilfe ist auch auf diesem Feld gefordert.<br />
- 2 -
THEMA : INKLUSION<br />
Wie Eltern zur integrativen Beschulung stehen<br />
3.000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes wurden durch TNS Emnid telefonisch zu Bildungsthemen,<br />
darunter auch Inklusion, befragt. In diesem Zusammenhang befürworten neun von zehn<br />
Eltern (89%) ein gemeinsames Lernen mit körperlich beeinträchtigten Kindern. 72% sind dafür,<br />
dass Kinder mit Lernschwierigkeiten im Klassenverband einer Regelschule unterrichtet werden.Im<br />
Falle von geistig behinderten bzw. verhaltensauffälligen Kindern ist das Stimmungsbild geteilter:<br />
Nur noch knapp die Hälfte (46 %) der Befragten befürworten das Modell des gemeinsamen Lernens.<br />
Als Vorteil des gemeinsamen Lernens sehen die Eltern positive Wirkungen für das Sozialverhalten<br />
(90%). Über 40 % der Eltern äußern allerdings auch die Sorge, dass die Klasse in der<br />
Folge fachlich weniger schnell vorankommen könnte. Und 70 % der Eltern vertreten die Meinung,<br />
dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in separaten Förderschulen „besser gefördert“<br />
werden als in der allgemeinen Regelschule.<br />
Die Autoren der Studie finden es bemerkenswert, dass sich „die große Mehrheit der Eltern bei den<br />
ersten beiden Schülergruppen […] für eine integrative Beschulung ausspricht…“ und auch bei den<br />
beiden anderen Schülergruppen noch fast die Hälfte für den gemeinsamen Unterricht votiert.<br />
Studie: Horstkemper, Marianne; Tillmann, Klaus-Jürgen: Wie stehen Eltern zur integrativen Beschulung?<br />
Mehr unter: http://www.vielfalt-lernen.de/2013/05/06/was-eltern-von-inklusion-halten/<br />
Quelle: Deutscher Caritasverband Sonderinfo Inklusion, Nr.: 19/13<br />
Zur Inklusion in niedersächsischen Schulen<br />
In einem Interview mit Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (NOZ, 21.05.2013) informiert die<br />
Ministerin, dass Lehrer zukünftig in Niedersachsen besser auf den Unterricht in inklusiven Bildungseinrichtungen<br />
vorbereitet werden. Ein Problem bei der Einführung inklusiver Bildung an den<br />
Schulen sei die ungenügende Steuerbarkeit der Entwicklung. Man wisse nämlich nicht überall, in<br />
welchem Umfang die Eltern tatsächlich von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen würden, Kinder mit<br />
Förderbedarf auf die allgemeinen Schulen zu schicken. Das werde erst nach Abschluss der<br />
Anmeldungen möglich sein. Mit Ausnahme der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sowie<br />
dem Schwerpunkt Sprache könnten sich Eltern in Niedersachsen auch weiterhin für einen Förderschulbesuch<br />
ihrer Kinder entscheiden. Man wolle vorerst bei dieser Doppelstruktur bleiben, weil<br />
die Inklusion ja erst nach und nach hochwachsen werde. So werde man sich im nächsten Jahr<br />
vertieft mit den inklusiven Förderschwerpunkten Lernen und Sprache auseinandersetzen. "In<br />
Niedersachsen haben wir uns aber für den Weg der prozessartigen Gestaltung entschieden – das<br />
heißt, wir werden nach und nach sanft umstellen. Dies erfordert in der Tat einen hohen Ressourcen-aufwand.<br />
Allerdings darf man nicht vergessen: Wir wollen alle Beteiligten mitnehmen – Lehrkräfte,<br />
Eltern, Schulträger – und dabei müssen wir auch auf vorhandene Traditionen und Strukturen<br />
Rücksicht nehmen", führte Heiligenstadt aus: "Das Verständnis für die inklusive Schule und die<br />
inklusive Gesellschaft muss sich entwickeln und kann nicht verordnet werden. Wir können hier<br />
nicht einfach einen Hebel umlegen." Gleichwohl werde man jetzt Elemente inklusiver Pädagogik in<br />
die allgemeine Lehrerbildung einbauen. Das werde zum Teil in den Universitäten und Studienseminaren<br />
schon mit angeboten, aber das solle jetzt richtig verankert werden. Außerdem werde man<br />
in die Lehrerfortbildung investieren. Das dafür vorgesehene Budget über eine Million Euro zeichne<br />
sich als unzureichend ab.<br />
Quelle: Deutscher Caritasverband, Sonderinfo Inklusion, Nr.: 19/13<br />
- 3 -
Niemand darf auf der Strecke bleiben - Fachkommission zur Inklusion greift<br />
zu kurz<br />
Die niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt und der Landesbehindertenbeauftragte Karl<br />
Finke haben eine „Fachkommission Inklusion“ eingesetzt. Ziel dieser Fachkommission sei es,<br />
konkrete Schritte zur Umsetzung gelebter Inklusion auszuarbeiten. Dabei sollen verbindliche<br />
Zielvereinbarungen zum Barrierefreiheit und der direkten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen<br />
thematisiert werden. Auch bei der Benennung von weiteren Schwerpunkten liegt der Verdacht<br />
nahe, dass Inklusion in dieser Fachkommission nur einseitig im Sinne von Menschen mit Behinderung<br />
gedacht und bearbeitet werden soll. Aus diesem Grund ist der Vorstand der LAG JAW bereits<br />
schriftlich in Kontakt mit der Sozialministerin getreten. Die in der LAG JAW zusammengeschlossenen<br />
Verbände sind sich einig darin, dass der Inklusionsbegriff viel weiter gefasst werden muss. Sie<br />
folgt einer Definition des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Diese besagt:<br />
"... Inklusion als Menschenrecht ist natürlich nicht nur ein Thema für Menschen mit Behinderungen.<br />
Es ist für alle Menschen wichtig, die nicht voll und gleichberechtigt an allen Bereichen der<br />
Gesellschaft teilhaben können, etwa aufgrund ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, einer<br />
Behinderung, ihrer Hautfarbe, Herkunft oder ihrer Geschlechtsidentität. Und als Menschenrecht<br />
geht Inklusion alle Menschen an, nicht allein diejenigen, die ausgeschlossen sind. Denn Menschenrechte<br />
bauen darauf auf, dass jeder Mensch den anderen als Gleichen respektiert und sich<br />
deshalb solidarisch für die Rechte der anderen einsetzt. Nur wenn alle mitmachen, kann Inklusion<br />
gelingen."<br />
Allein für den Bereich der Kinder und Jugendlichen sind damit auch Schulverweigerer, suchtkranke,<br />
sozial schwache, von Armut bedrohte und Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund<br />
gemeint. Denn niemand darf auf der Strecke bleiben!!!<br />
Auch wenn die Ministerin zu Recht einräumt, dass man zunächst an einer Stelle mit der Umsetzung<br />
beginnen müsse, so darf der Begriff der Inklusion politisch nicht so einseitig gedacht werden,<br />
wie es sich aktuell darstellt. In Vorbildfunktion für Niedersachsen muss Inklusion wesentlich breiter<br />
gedacht werden, sonst wird sich die umfassende Idee auch auf Dauer nicht als gesellschaftliche<br />
Haltung etablieren.<br />
Arbeiten und dazugehören - Neue Lösungen der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
„Integration durch Arbeit“ (BAG IDA) für am Arbeitsmarkt<br />
benachteiligte Menschen<br />
Jeder Mensch braucht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben! Teilhabe wird insbesondere auch<br />
durch Arbeit und sinnstiftende Beschäftigung ermöglicht! Arbeitsmarktferne ALG II-Empfänger<br />
bekommen heute oftmals keine hinreichende Förderung! Phasen der Arbeitslosigkeit werden<br />
immer wieder durch wechselnde Maßnahmen unterbrochen, ohne dass eine nachhaltige Integration<br />
in Arbeit und Teilhabe gelingt. Die bestehenden Instrumente der Arbeitsgelegenheiten (§ 16d<br />
SGB II), die Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II) und die Aktivcenter nach § 16<br />
Absatz 1 SGB II i.V. m. § 45 Absatz 1 SGB III sind aufgrund der zeitlichen Befristungen und<br />
Förderrestriktionen nicht hinreichend geeignet,<br />
arbeitsmarktferne Personen wieder an den Arbeitsmarkt<br />
heranzuführen.<br />
Es ist mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar,<br />
Menschen dauerhaft von der Arbeit<br />
auszuschließen. Jeder muss die Möglichkeit erhalten, sich entsprechend seiner Fähigkeit in die<br />
Gesellschaft einzubringen und eine sinnvolle Arbeit zu leisten. Die Erfahrungen zeigen: Es geht<br />
den Menschen besser, wenn sie im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsmarkförderung wieder<br />
am Arbeitsalltag teilnehmen können. Mit einer individuell auf ihre Lage zugeschnittenen Förderung,<br />
Qualifizierung und intensiven Betreuung kann auch ihre Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt werden.<br />
- 4 -
Soziale Stabilisierung, Tagesstrukturierung und die Verbesserung der Kontaktfähigkeit können mit<br />
einer entsprechenden Förderung und Begleitung erreicht werden.<br />
In einem Positionspapier stellt die BAG IDA dar, welche Änderungen in der Arbeitsmarktförderung<br />
notwendig sind, damit arbeitsmarktferne Personen passgenaue Förderung erhalten. Nur durch die<br />
Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit und soziale Teilhabe kann gesellschaftliche Inklusion und<br />
Integration durch Arbeit nachhaltig gelingen. Damit Vermittlungshemmnisse wirkungsvoll beseitigt<br />
werden können, ist ein langfristig angelegter Integrationsprozess notwendig, der nur mit aufeinander<br />
aufbauenden Förderinstrumenten gelingen kann.<br />
Aus diesem Grund werden folgende Forderungen aufgestellt:<br />
1. Aufnahme der Förderung der sozialen Teilhabe und Teilhabe am Arbeitsleben als Ziele des<br />
SGB II und die gesetzliche Festlegung eines Rechtsanspruchs auf Leistungen der sozialen<br />
Integration<br />
2. Weiterentwicklung des Zielsteuerungssystems im SGB II mit Blick auf die Eingliederung<br />
von arbeitsmarktfernen Menschen<br />
3. Eingliederungsleistungen in der Grundsicherung für arbeitsmarktferne Menschen künftig<br />
mittelfristig konzipieren und finanzieren<br />
4. Enge Zielgruppenbegrenzung von langfristig orientierter, öffentlich geförderter Beschäftigung<br />
5. Schaffung von Begleitangeboten zur Sicherstellung einer nachhaltigen Integration während<br />
der geförderten Beschäftigung<br />
6. Soziale Inklusion durch geförderte Beschäftigung<br />
Das vollständige Positionspapier der BAG IDA ist unter:<br />
http://www.caritas.de/cms/contents/caritasde/medien/dokumente/stellungnahmen/neueloesungenf<br />
uerama/20130506_dcv_ida_arbeiten_und_dazugehoeren.pdf?d=a&f=pdf abrufbar.<br />
Gewaltstudie: Schläge sind für ein Viertel der Kinder und Jugendlichen<br />
Alltag<br />
Gewalt ist in Deutschland für viele Heranwachsende erschreckender Alltag. Fast ein Viertel (22,3<br />
%) wird von Erwachsenen oft oder manchmal geschlagen; 28 % davon sind Kinder ab sechs<br />
Jahren, etwa 17 % sind Jugendliche. Überraschend ist dieses Ergebnis vor allem deshalb, weil es<br />
bereits seit 13 Jahren ein gesetzlich verankertes Recht auf eine gewaltfreie Erziehung gibt. Die<br />
„Gewaltstudie 2013“ der Universität Bielefeld hat untersucht, wie präsent Gewalt- und Missachtungserfahrungen<br />
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland heute noch sind und inwiefern sie<br />
von Armutslagen abhängen. Die Studie ist einzigartig, weil zum ersten Mal bereits Kinder ab sechs<br />
Jahren befragt wurden. In der zweiten Altersgruppe wurden Jugendliche bis einschließlich 16<br />
Jahre befragt. Die Studie ist mit 900 Teilnehmern bevölkerungsrepräsentativ.<br />
Auch wenn Heranwachsende aus allen Schichten Gewalterfahrungen machen, lassen sich doch<br />
eindeutige soziale Unterschiede feststellen. …Im Vergleich zu den Kindern sind die Gewalterfahrungen<br />
von Jugendlichen zwar auch, jedoch weniger eindeutig mit dem sozioökonomischen Status<br />
assoziiert. 22,1 % der sozial benachteiligten im Vergleich zu 17,9 % der privilegierten Jugendlichen<br />
berichten, oft oder manchmal geschlagen zu werden. 6,4 % der sozial benachteiligten Jugendlichen<br />
hatten anschließend blaue Flecken – im Gegensatz zu 3 % der privilegierten.<br />
Gewalt äußert sich jedoch nicht nur durch Schläge, sondern auch durch (verbale) Missachtung.<br />
Ein Viertel aller befragten Heranwachsenden (25,1 %) hat die Erfahrung gemacht, von Erwachsenen<br />
als „dumm“ oder „faul“ beschimpft zu werden (26,7 % Kinder, 23,9 % Jugendliche). Ein Fünftel<br />
gibt an, dass Erwachsene ihnen das Gefühl geben, weniger wert zu sein. Bei den Kindern werden<br />
erneut sozioökonomische Unterschiede sichtbar: Mit 23,6 % sind sozial benachteiligte Kinder im<br />
- 5 -
Vergleich zu den privilegierten Kindern (9,9 %) mehr als doppelt so häufig dieser Erfahrung ausgesetzt.<br />
Bei den Jugendlichen ist das hohe Gesamtniveau über alle Schichten hinweg erschreckend:<br />
Knapp 24 % wurden von Erwachsenen schon mal als „dumm“ oder „faul“ bezeichnet, 26 % haben<br />
das Gefühl, weniger wert zu sein. „Wir wissen, dass sich solche verbalen Missachtungserfahrungen<br />
deutlich – und unter Umständen auch stärker als körperliche Gewalterfahrungen – auf das<br />
Ausmaß emotionaler Probleme, das Wohlbefinden oder Selbstvertrauen der Heranwachsenden<br />
auswirken“, so Ziegler.…<br />
Sozial benachteiligte Heranwachsende machen stärkere Mobbingerfahrungen durch Peers als<br />
privilegierte. So berichten 70,6 % der Kinder davon, zumindest manchmal von anderen gehänselt<br />
oder beleidigt worden zu sein, im Vergleich zu knapp 60 % der privilegierten Kinder. Davon geben<br />
15,3 % der sozial benachteiligten Kinder und 14,3 % der Jugendlichen gegenüber 6,3 % der<br />
privilegierten Kinder bzw. 5,9 % der privilegierten Jugendlichen an, oft gehänselt oder beleidigt zu<br />
werden. Mit Absicht nicht beachtet zu werden, erleben knapp 11 % der sozial benachteiligten<br />
Kinder im Gegensatz zu 2,1 % der privilegierten Kinder. Bei den Jugendlichen ist das Verhältnis<br />
ähnlich (10,1 % vs. 3 %).<br />
In der Gewaltstudie zeigen sich bei der Elternbeziehung statistisch bedeutsame Unterschiede nach<br />
sozioökonomischen Status. Die Frage, ob Eltern gegebene Versprechen einhalten, verneinen etwa<br />
40 % der Kinder aus prekären Lebenslagen – im Gegensatz zu rund 20 % der privilegierten<br />
Kinder. Nur knapp die Hälfte der sozial benachteiligten Kinder wird regelmäßig von den Eltern<br />
nach ihrer Meinung gefragt; bei Kindern mit privilegiertem Hintergrund sind es hingegen zwei<br />
Drittel. Rund 30 % der sozial benachteiligten Jugendlichen berichten ebenfalls davon, sich nicht<br />
auf Versprechen ihrer Eltern verlassen zu können und mehr als 40 % haben das Gefühl, die<br />
Erwartungen der Eltern nicht erfüllen zu können; bei den privilegierten Jugendlichen sind es unter<br />
30 %.<br />
Die sozioökonomische Lage der Familie wird auch von den jungen Menschen selbst ganz unmittelbar<br />
wahrgenommen. Mehr als ein Viertel (27 %) der Kinder und Jugendlichen aus prekären<br />
Lebenslagen hat kein eigenes Zimmer, im Gegensatz zu nur 2 % der privilegierten und 5 % der<br />
durchschnittlich gestellten Heranwachsenden. Bereits jedes fünfte Kind (21,4 %) aus prekären<br />
Lebenslagen ist sich bewusst, dass die eigene Familie nicht genügend Geld hat, um sich alles<br />
leisten zu können. Von den privilegierten Kindern macht nur jedes 50. Kind (2 %) eine solche<br />
Erfahrung.<br />
Quelle: Bayer HealthCare Deutschland vom 03.06.2013<br />
„Recht auf Ausbildung“ gesetzlich verankern<br />
Die BAG KJS hat ein Positionspapier zum „Recht auf Ausbildung“ veröffentlicht. Trotz guter<br />
Konjunktur und günstiger Lage auf dem Ausbildungsmarkt sind immer noch rund 1,5 Millionen<br />
junge Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren ohne Berufsabschluss. Von einem auswahlfähigen<br />
Angebot an Ausbildungsplätzen sind wir in Deutschland weit entfernt. Offiziell galten im<br />
letzten Ausbildungsjahr 15.650 Jugendliche als unversorgt. Hinzu kommen 60.379 junge Menschen<br />
in Alternativen, die ihren Ausbildungswunsch aufrecht erhalten, sowie knapp 90.000 junge<br />
Menschen, deren Verbleib der Bundesagentur für Arbeit unbekannt ist. Jugendliche, denen dauerhaft<br />
kein Start in Ausbildung gelingt drohen gänzlich aus dem Blick von Politik und Öffentlichkeit zu<br />
geraten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft <strong>Katholische</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> (BAG KJS) fordert daher<br />
die Verankerung des Rechts auf Ausbildung im Grundgesetz.<br />
Positionspapier unter: www.bagkjs.de/recht_auf_ausildung_als_grundrecht_verankern<br />
- 6 -
Junge Mütter brauchen bessere Ausbildungschancen - IN VIA fordert<br />
frühzeitiges Beratungsangebot und Teilzeitausbildung für junge Mütter<br />
Junge Mütter wünschen sich ein unterstützendes Umfeld, gute berufliche Perspektiven und eine<br />
verlässliche Kinderbetreuung. IN VIA begrüßt daher im Rahmen einer Pressemeldung den seit<br />
dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder<br />
als einen wichtigen Schritt. Er sieht jedoch Handlungsbedarf, der weit darüber hinausgeht.<br />
IN VIA fordert bessere unterstützende Rahmenbedingungen zur Förderung der Ausbildung junger<br />
Mütter. 140.000 arbeitslose Alleinerziehende verfügen über keinen Berufsabschluss. „Da 50<br />
Prozent aller allein erziehenden Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben,<br />
müssen dringend mehr Ausbildungsangebote in Teilzeit geschaffen werden. Dies ist für Alleinerziehende<br />
eine entscheidende Voraussetzung, um anschließend eigenständig den Lebensunterhalt<br />
für ihre Familie erwirtschaften zu können“, fordert Irme Stetter-Karp, Vorsitzende von IN VIA<br />
Deutschland.<br />
Im Jahr 2011 wurden in Deutschland lediglich 1173 Teilzeitausbildungsverträge neu abgeschlossen.<br />
„Dies ist nicht nachvollziehbar, wenn zeitgleich Teile der Wirtschaft beklagen, keine Auszubildenden<br />
zu finden,“ stellt Stetter-Karp fest. IN VIA fordert Arbeitsagenturen und Wirtschaft auf,<br />
mehr Ausbildungsplätze in Teilzeit zu initiieren. Die Agenturen für Arbeit müssen den Müttern in<br />
der Beratung auch solche Angebote eröffnen. IN VIA weist auch auf die häufig aussichtslose<br />
Situation von arbeitslosen Alleinerziehenden hin, die von Arbeitslosengeld II leben. Im Jahr 2011<br />
waren dies laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit über 252.000. Um zu vermeiden, dass sie<br />
dauerhaft auf staatliche Unterstützung angewiesen bleiben, sind Angebote zur beruflichen Orientierung<br />
und Qualifizierung mit flexiblen Förderbausteinen dringend erforderlich. „Dazu gehören<br />
beispielsweise Beratung bei der Berufsplanung, Bewerbungshilfen sowie die Unterstützung bei der<br />
Alltagsbewältigung. IN VIA fordert deshalb einen Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch II auf<br />
kontinuierliche sozialpädagogische Beratung und Begleitung“, betont Stetter-Karp. Nachvollziehbar<br />
ist für IN VIA auch nicht, dass der Anteil der Alleinerziehenden, die an arbeitsmarktpolitischen<br />
Programmen der Bundesagentur für Arbeit teilgenommen haben, im Jahr 2011 massiv rückläufig<br />
war. IN VIA empfiehlt Frauen, bei den anstehenden Bundestagswahlen die politischen Parteien<br />
dahingehend zu prüfen, ob die Verbesserung der Situation von Müttern Bestandteil des Wahlprogramms<br />
ist.<br />
Die vollständige Pressemeldung und die Positionierung sind zu finden unter:<br />
http://www.invia-deutschland.de<br />
- 7 -
Neues aus dem <strong>Nord</strong>en<br />
Jugendarbeitslosigkeit<br />
12,0%<br />
10,0%<br />
8,0%<br />
Quote 6,0%<br />
4,0%<br />
2,0%<br />
0,0%<br />
13.235<br />
10.805<br />
Schleswig-<br />
Holstein<br />
Jugendarbeitslosigkeit im <strong>Nord</strong>en<br />
12.619<br />
6.392<br />
5.422<br />
5.890<br />
33.680<br />
26.089<br />
Hamburg Niedersachsen Bremen Mecklenburg<br />
Vorpommern<br />
Länder<br />
29.198<br />
3.813<br />
3.314<br />
3.604<br />
8.748<br />
8.065<br />
9.875<br />
Juli 2013<br />
Juni 2013<br />
Juli 2012<br />
Quelle: Bundesagentur für Arbeit<br />
Juli 2013<br />
Naturgemäß<br />
liegt die Zahl<br />
der arbeitslosen<br />
Jugendlichen<br />
im Juli<br />
höher als im<br />
Juni, allerdings<br />
kann auch im<br />
Vergleich zum<br />
Vorjahresmonat<br />
Juli ein<br />
Anstieg der<br />
Jugendarbeitslosigkeit<br />
in der<br />
Mehrzahl der<br />
nördlichen<br />
Bundesländer<br />
verzeichnet<br />
werden.<br />
Modellprojekt „Jugendförderzentrum Wolfsburg“ – Kein Jugendlicher darf<br />
verloren gehen!<br />
Autorin; Anja Huttner, Beschäftigungs gGmbH Wolfsburg<br />
Am 03.12.2012 ging das Jugendförderzentrum (JFZ) in Wolfsburg an den Start. Das Jobcenter als<br />
Auftraggeber, die Stadt Wolfsburg als Förderer und die ausführende Trägergemeinschaft Wolfsburger<br />
BeschäftigungsgGmbH und Jobwerk Jugend:Beruf:Hilfe widmen sich Jugendlichen aus<br />
dem Arbeitslosengeld-II-Bezug mit vielfältigen und/oder schwerwiegenden Hemmnissen, insbesondere<br />
im Bereich Motivation/Einstellungen, Schlüsselqualifikationen und soziale Kompetenzen.<br />
Bislang konnten die Jugendlichen auf andere Weise nicht erreicht werden.<br />
Das Jugendförderzentrum trägt mit seinem ganzheitlichen Förderansatz wesentlich dazu bei, diese<br />
Jugendlichen auf eine berufliche Integration vorzubereiten. Ein Integrationsfortschritt ist bereits<br />
erreicht, wenn im Rahmen einer Integrationsstrategie der Übergang in eine weiterführende berufliche<br />
oder schulische Qualifizierung oder auch in eine Einstiegsqualifizierung gelingt. Es ist ebenfalls<br />
bereits ein Erfolg, wenn allein durch Motivation, Aktivierung und den Abbau von Resignation<br />
eine persönliche Stabilisierung erreicht wird.<br />
Das Projekt ist ein auf die Zielgruppe ausgerichtetes niedrigschwelliges Angebot, verzahnt mit<br />
Leistungen der <strong>Jugendsozialarbeit</strong> nach § 13 SGB VIII, flankiert mit aufsuchender Arbeit, psychologischer<br />
Beratung und intensiver sozialpädagogischer Betreuung.<br />
- 8 -
Das Jugendförderzentrum zeichnet sich besonders durch seine Heterogenität aus. Menschen mit<br />
ganz individueller Lernausgangslage bilden eine gemeinsame Lerngruppe in unterschiedlichen,<br />
wechselnden Gewerken und in Fördereinheiten. Ein ständiger Veränderungsprozess innerhalb<br />
dieser Einheiten bedeutet zugleich auch eine Chance. Gerade ein kooperativer Unterricht profitiert<br />
von der Unterschiedlichkeit und Vielseitigkeit seiner Schüler. Diese lernen miteinander und voneinander.<br />
Vorurteile, Ängste und Unsicherheiten können so abgebaut werden. Ein Erwerb wichtiger<br />
Schlüsselkompetenzen findet statt.<br />
Während sich die Entwicklung inklusiver Unterrichtskonzepte an Regelschulen noch in der Planungsphase<br />
befindet, ist gemeinsames Lernen von vorn herein fester Bestandteil des Jugendförderzentrums.<br />
Ein Inklusionsgedanke im weiteren Sinn definiert sich dabei nicht nur in der Einbindung<br />
von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, er schließt auch einen vorhandenen<br />
sonderpädagogischen Förderbedarf ein. Auf die Teilnehmer des Jugendförderzentrums trifft dieses<br />
genau zu. Es sind oft Jugendliche mit Schwierigkeiten in den Bereichen der emotionalen und<br />
sozialen Entwicklung, des Lernens oder der Sprache. Häufig sind unter ihnen Schulabgänger ohne<br />
Abschluss. Einige wurden innerhalb des Regelschulsystems aufgegeben, andere in Förderschulen<br />
ausgegliedert. Aus einem solchen Entwicklungsrückstand resultieren häufig chronische Erkrankungen.<br />
Diese wiederum erschweren eine kontinuierliche Anwesenheit und aktive Teilnahme an<br />
Bildungsmaßnahmen und gefährden schließlich eine Erwerbsfähigkeit. Gerade im Hinblick darauf<br />
erscheint Inklusion als wichtiger erster Schritt zu einer Integration.<br />
Die Teilnehmer, welche aus unterschiedlichsten Gründen das JFZ nicht aufsuchen und somit<br />
unentschuldigt fehlen, werden vom Aufsuchenden Sozialen Dienst (ASD) frequentiert. Eine Sozialpädagogin<br />
wirkt hierbei auf eine Teilnahme am JFZ motivierend hin. Die Erfolgsquote liegt bislang<br />
bei ca. 25%, Tendenz steigend.<br />
Bei Jugendlichen mit häufig zutreffenden Verhaltensauffälligkeiten und Problemlagen wird die<br />
sozialpädagogische Begleitung durch ein psychologisches Beratungsangebot erweitert. Neben der<br />
zeitnahen Krisenintervention werden dadurch auch weiterführende medizinische Maßnahmen<br />
- 9 -
zw. weitere Schritte (z.B. Überleitung zu ambulanten und stationären medizinischen Diensten,<br />
Einschaltung des psychologischen Dienstes der Arbeitsverwaltung etc.) in die Wege geleitet.<br />
Im Teamteaching leben die Anleiter, der Lehrer, die Sozialpädagogen und die Psychologin einen<br />
partizipatorischen Ansatz und verbinden interessante Inhalte mit individueller Unterrichtsgestaltung<br />
bzw. Anleitung und Förderung. Unser Motto: kein Jugendlicher darf verloren gehen! Die Teilnahmedauer<br />
beträgt 6 bis zu 24 Monate bzw. bis zur Einmündung in den Ausbildungs-, Arbeits- oder<br />
Bildungsmarkt.<br />
Kontakt: Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH, n@work Service GmbH, Frau Huttner,<br />
Tel. 05361/279323, anja.huttner@wbg-wob.de<br />
Neu erschienen<br />
Neue und alte Akteure in der Sozial- und Wohlfahrtslandschaft<br />
Autorin: Letitia Türk – Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen<br />
in Europa<br />
Der Bereich sozialer Dienste ist in den letzten zwanzig Jahren von einer Reihe von Reformen<br />
geprägt worden, die hauptsächlich eine Modernisierung der sozialen Dienstleistungen bewirken<br />
sollen. Sowohl in der Praxis als auch in der Forschung haben diese Entwicklungen beachtliche<br />
Aufmerksamkeit gefunden, vor allem unter dem Schlagwort des Neuen Steuerungsmodells (NSM).<br />
Im Kern des NSM steht der Versuch, „Steuerungselemente, wie sie aus privaten Unternehmen<br />
bekannt sind, auf staatlich verantwortete Dienstleistungserbringungen zu übertragen“ (Hofemann<br />
2001). Diese verschiedenen Reformprozesse lösten dennoch eine über Jahre hinweg andauernde<br />
Kritik aus, vor allem in der Sozialpolitik und der sozialen Arbeit (Reis / Schulze-Böing 1998).<br />
Gegenstand dieser Kritik sind insbesondere die Folgen eines Wettbewerbs, der in Teilen des<br />
sozialen Bereichs eingeführt wurde und der eine Gefährdung der Qualitätsstandards in der Arbeit<br />
der Sozialarbeiter/innen darstellt. So argumentiert z.B. Steinke, dass der Markt sich zum umfassenden<br />
Steuerungsprinzip der Sozialwirtschaft nicht eignet, da ein Großteil der sozialen Aufgaben<br />
sich der Marktlogik entzieht (Vgl. Steinke 2012: 445).<br />
Die wettbewerbliche Organisation der Hilfesysteme wird in hohem Maße auch durch eine Diversifizierung<br />
des Anbietersspektrums gefördert. Vor diesem Hintergrund geraten neue Akteure und<br />
neue Formen der Wohlfahrtsproduktion verstärkt in den Blick. Insbesondere die Debatte über<br />
Sozialunternehmen im Bereich sozialer Dienste hat in den letzten Jahren zunehmend an Relevanz<br />
gewonnen. Dazu beigetragen haben vor allem eine Reihe nationaler und europäischer Maßnahmen,<br />
die sich zum Ziel genommen haben, Sozialunternehmertum und soziale Innovationen zu<br />
fördern. So hat z.B. die Europäische Kommission eine Reihe von Initiativen gestartet, die in diese<br />
Richtung weisen. Die EU-Kommission betrachtet „Sozialunternehmen“ als Unternehmen, für die<br />
das soziale oder gesellschaftliche gemeinnützige Ziel Sinn und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit<br />
darstellt, was sich oft in einem hohen Maß an sozialer Innovation äußert, deren Gewinne größtenteils<br />
wieder investiert werden, um dieses soziale Ziel zu erreichen und deren Organisationsstruktur<br />
oder Eigentumsverhältnisse dieses Ziel widerspiegeln, da sie auf Prinzipien der Mitbestimmung<br />
oder der Mitarbeiterbeteiligung basieren oder auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet sind (Europäische<br />
Kommission 2011: 2-3).<br />
Auch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend hat sich bereits in der<br />
Nationalen Engagementstrategie (2010) verpflichtet, soziale Innovationen und Sozialunternehmertum<br />
zu fördern. Nach Ansicht des Ministeriums sind Sozialunternehmer „ein wichtiger neuer Trend<br />
(…) die aus ihrem individuellen bürgerschaftlichen Engagement heraus soziale Organisationen<br />
gründen, die gesellschaftliche Herausforderungen mit innovativen und unternehmerischen Herangehensweisen<br />
lösen“ (Deutsche Bundesregierung 2010: 5).<br />
- 10 -
Vor diesem Hintergrund wird die Debatte rund um Sozialunternehmen von den Fragen geprägt,<br />
wie neue Angebote entwickelt werden, wie diese neuen Angebote mit bestehenden koordiniert<br />
werden können und nicht zuletzt wie diese neuen Akteure in etablierte Strukturen integriert werden<br />
können. Als eine bedeutsame Chance dieses Spannungsfeldes werden immer häufiger die Kooperationen<br />
zwischen den unterschiedlichen Akteuren genannt, die etablierte und neue innovative<br />
Lösungen ermöglichen. Welches Potential solche Kooperationen in sich bergen, wird in einer<br />
Expertise vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. mit dem Titel: „Kooperationsmodelle<br />
zwischen Sozialunternehmen und anderen Trägern sozialer Dienstleistungen – Modellvorhaben<br />
aus Europa“ anhand von Praxisbeispielen gezeigt (Türk et al 2012). Im Zentrum stehen die<br />
Fragen, welche Kooperationen es zwischen Sozialunternehmen und anderen Trägern sozialer<br />
Dienstleistungen gibt, welche Bedingungen förderlich für Kooperationen sind und welche Vorteile<br />
das Zusammenarbeiten hat. Solche Kooperationen besitzen das Potential, innovative Lösungen im<br />
Umgang mit zentralen gesellschaftlichen Problemen zu entwickeln. Dennoch hängt eine erfolgreiche<br />
Zusammenarbeit von verschiedenen Faktoren ab, wie eine klare Kommunikation, gegenseitliches<br />
Vertrauen, eine Vergleichbarkeit der Werte und Interessen der beteiligten Organisationen<br />
sowie die bewusste Schaffung von Freiräumen für innovative Ideen und Kreativität.<br />
Quellenverzeichnis:<br />
- Deutsche Bundesregierung 2010: Nationale Engagementstrategie der Bundesregierung. Unter<br />
http://www.forum-engagementpartizipation.de/?loadCustomFile=Publikationen/Nationale_Engagementstrategie_10-10-06.pdf<br />
- Europäische Kommission 2011: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat,<br />
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Initiative für<br />
soziales Unternehmertum. Schaffung eines „Ökosystems“ zur Förderung der Sozialunternehmen als<br />
Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der sozialen Innovation. KOM(2011) 682 endgültig. Unter:<br />
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:DE:PDF<br />
- Hofemann, Klaus 2001: Handlungsspielräume des Neuen Steuerungsmodells, in: Schubert, Herbert:<br />
Sozialmanagement. Zwischen Wirtschaftlichkeit und fachlichen Zielen. VS Verlag für Sozialwissenschaften:<br />
Wiesbaden.<br />
- Jos, Steinke 2012: Soziale Innovation: Neue Debatten – neue Wege für die Sozialwirtschaft?, in:<br />
Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 6/2012, S. 440-450.<br />
- Lütz, Ronald 2008: Perspektiven der Sozialen Arbeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 12-13/2008.<br />
Bundeszentrale für politische Bildung, S. 3-10.<br />
- Reis, Claus und Schulze-Böing, Matthias 1998: Planung und Produktion sozialer Dienstleistungen:<br />
die Herausforderung neuer Steuerungsmodelle, in Reis, Claus (Hg.): Modernisierung des öffentlichen<br />
Sektors. Sigma Verlag: Berlin.<br />
Neu im Netz<br />
Jo B. Das Job-Lexikon<br />
Die Broschüre informiert vor allem Schülerinnen und Schüler in Form eines kleinen Lexikons von A<br />
wie Abendschule bis Z wie Zweiter Bildungsweg über alle wichtigen Stichworte bei der Ausbildungsplatz-<br />
oder Job-Suche. Darüber hinaus gibt sie auch einen Überblick über die Publikationen<br />
anderer Einrichtungen, die für Jugendliche interessant sein können.<br />
Download der Broschüre unter:<br />
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a103-job-dasjoblexikon.pdf?__blob=publicationFile<br />
Leichte Sprache - Ein Ratgeber<br />
Das Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales hat in Zusammen-Arbeit mit dem "Netzwerk<br />
Leichte Sprache" dieses Heft erstellt. Dort stehen Regeln und Tipps für Leichte Sprache. Leichte<br />
Sprache hilft vielen Menschen. Zum Beispiel: Menschen mit Lern-Schwierigkeiten, Menschen, die<br />
nichtso gut lesen können, Menschen, die nichtso gut Deutsch sprechen. Die Regeln helfen den<br />
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Ämtern und Behörden beim Schreiben von Texten in Leichter<br />
- 11 -
Sprache. In dem Heft steht auch, was bei Treffen und Tagungen zu machen ist, damit Menschen<br />
mit Behinderungen daran teilnehmen können.<br />
Internetseite: www.gemeinsam-einfach-machen.de<br />
Handlungsempfehlungen für gemeinsame Beratung von Familien<br />
Den Beratungsdiensten für junge und erwachsene Migrantinnen und Migranten liegen<br />
Handlungsempfehlungen zur besseren Abstimmung ihrer Beratungsangebote vor. In den<br />
Handlungsempfehlungen werden good-practice-Beispiele wie gemeinsame Fortbildungen der<br />
Mitarbeiter/-innen, Arbeitskreise und Kooperationsvereinbarungen sowie weitere Instrumente der<br />
Kooperation und einer gemeinsamen Netzwerk- und Beratungsarbeit zusammen getragen.<br />
Um den Bedürfnissen der Familienmitglieder zu entsprechen und die richtigen Einrichtungen in die<br />
Beratung einzubinden, haben das Bundesfamilienministerium und das Bundesinnenministerium in<br />
Zusammenarbeit mit den Trägern der beiden Beratungsprogramme diese praxisorientierten<br />
Handlungsempfehlungen entwickelt.<br />
Download unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2013/20130730-<br />
handlungsempfehlungen-mbejmd.html<br />
In eigener Sache<br />
Kathrin Scheidemann – neue Kollegin in der Geschäftsstelle<br />
Ich freue mich sehr, mich Ihnen heute als neue Kollegin des bestehenden<br />
Teams der Landesstelle für <strong>Jugendsozialarbeit</strong> und somit als Referentin für<br />
Pro Aktiv Centren und Jugendwerkstätten vorzustellen.<br />
Mein Name ist Kathrin Scheidemann, ich bin Sozialpädagogin /Sozialarbeiterin<br />
(M.A.) und gerade frisch für meine neue Arbeitsstelle von<br />
Hildesheim nach Hannover gezogen. In Hildesheim war ich bereits während<br />
sowie nach meinem Studium an der Fachhochschule Hildesheim im Pro-<br />
Aktiv-Center Hildesheim tätig und konnte hier einige Erfahrungen im<br />
Arbeitsfeld der Jugendberufshilfe sammeln. Unter anderem habe ich jungen<br />
Menschen in einem Bewerbungscenter („Job Klub“) intensive Begleitung<br />
und Unterstützung im gesamten Bewerbungsprozess gegeben sowie Casemanagement und<br />
Einzelfallhilfe im Pro Aktiv Center durchgeführt. Da ich für den ländlichen Bereich im Landkreis<br />
Hildesheim zuständig war, lag mein Schwerpunkt vor allem in der aufsuchenden<br />
<strong>Jugendsozialarbeit</strong> und dementsprechend niedrigschwelligen Jugendberufshilfe.<br />
Während meines Studiums hatte ich die Möglichkeit mich im Rahmen meiner Master-Arbeit mit<br />
dem umfangreichen Thema der neuen Medien, und diese bezogen auf die Jugendberufshilfe, zu<br />
beschäftigen. Den Einsatz von zahlreichen modernen Medien habe ich im Anschluss gut in das<br />
Pro-Aktiv-Center integrieren können. Auch hier bei der LAG JAW werde ich dieses innovative,<br />
kaum mehr wegzudenkende Thema mit Sicherheit wieder aufgreifen und freue mich sehr auf<br />
weitere, spannende Resultate.<br />
Ich freue mich darauf, möglichst viele von Ihnen bald persönlich kennen zu lernen, mich mit Ihnen<br />
auszutauschen und gemeinsam mit Ihnen, genau wie mein Vorgänger Gerhard Wienken, gegen<br />
Jugendarbeitslosigkeit anzuwirken.<br />
- 12 -
Veranstaltungstipps<br />
LAG JAW – Fachtag J u n g a r b e i t s l o s a r m k r a n k – Niedersächsische<br />
Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Centren helfen aus dem Teufelskreis?!,<br />
27.11.2013, Hanns-Lilje-Haus Hannover<br />
Der vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung<br />
belegt, dass die junge Generation am stärksten<br />
von Armut betroffen ist. Armut ist der größte Risikofaktor für<br />
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und nach<br />
wie vor gilt, dass Armut häufig krank macht und Krankheit<br />
häufig arm macht.<br />
Wie wirkt sich Armut auf die Entwicklung, die<br />
Zukunftsplanung, die Berufswahl und auf die Gesundheit von Jugendlichen, die aus armen Familien<br />
stammen aus?<br />
Und wie geht es Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, bei denen weitere Belastungsfaktoren<br />
hinzukommen?<br />
Die Programme der niedersächsischen Jugendberufshilfe Pro-Aktiv-Centren und Jugendwerkstätten<br />
begleiten und unterstützen durch eine Vielzahl von Angeboten sozial benachteiligte und<br />
individuell beeinträchtigte junge Menschen. Sie befördern die Eingliederung in die Arbeitswelt, die<br />
Integration in die Gesellschaft und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung.<br />
Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung Jugendlicher, da sie zum<br />
einen in unmittelbarem Kontakt zur Zielgruppe stehen und zum anderen in der Lage sind, angemessene<br />
pädagogische Angebote zu konzipieren und anzubieten. Doch wie lassen sich die<br />
vielfältigen Möglichkeiten und Angebote noch mehr optimieren und voll ausschöpfen?<br />
Die LAG JAW nimmt die Fachtagung „j u n g a r b e i t s l o s a r m k r a n k“ - Niedersächsische<br />
Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Centren helfen aus dem Teufelskreis?!“ zum Anlass, das Thema<br />
Jugendarmut – Bildungsarmut - Gesundheit bei Jugendlichen in Zusammenhang zu bringen, aus<br />
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, verbunden mit dem Ziel, umfassend zu informieren,<br />
neue Handlungsperspektiven zu eröffnen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Akteure anzuregen.<br />
Veranstaltungsleitung: LAG JAW, Dimitra Atiselli, Telefon 0511 / 12173-39,<br />
dimitra.atiselli@jugendsozialarbeit.de, Flyerdownload: www.nord.jugendsozialarbeit.de<br />
Auf Initiative der BAG KJS sowie<br />
der Arbeitsstelle für<br />
Jugendseelsorge der Deutschen<br />
Bischofskonferenz und in<br />
Kooperation mit den katholischen<br />
Diensten und Einrichtungen der <strong>Jugendsozialarbeit</strong> findet am 19. März 2014 der<br />
Josefstag als bundesweiter Aktionstag statt. Das Motto des Josefstages 2014 lautet „flüchtig?! –<br />
Jugend braucht Perspektive“. Diesem kann man sich inhaltlich von verschiedenen Seiten nähern.<br />
Es soll auf der einen Seite zum Ausdruck bringen, dass die Einrichtungen der katholischen <strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
junge Menschen in problematischen Lebenslagen nicht flüchtig sondern kontinuierlich<br />
und verlässlich begleiten. Auf der anderen Seite sind viele Jugendliche in Einrichtungen der<br />
katholischen <strong>Jugendsozialarbeit</strong> aus den unterschiedlichsten Gründen „geflüchtet“, sei es aus der<br />
Schule, der Ausbildung oder aus dem Elternhaus, vor Armut, politischer Verfolgung oder vor<br />
Gewalt. So unterschiedlich die Fluchtgründe der jungen Menschen sind, so vielfältig sind die<br />
Angebote in den Einrichtungen der <strong>Jugendsozialarbeit</strong>, die Orte der Zuflucht anbieten.<br />
Informationen und Arbeitshilfen zum Josefstag bis Ende November unter: www.josefstag.de<br />
- 13 -
Veranstaltungen<br />
Veranstalt.<br />
Art<br />
Fortbildung<br />
Seminar<br />
Fortbildung<br />
Thema/ Titel Datum Ort Veranstalter<br />
Transkulturelle Jungenförderung<br />
– Möglichkeiten<br />
einer Jungenarbeit,<br />
die auch Migranten erreicht<br />
Gewalt im Spiel<br />
Theaterpädagogische<br />
Methoden für die Gewaltprävention<br />
02.-<br />
03.09.2013<br />
03.-<br />
04.09.2013<br />
Körper, Lust und Liebe<br />
– Sexuelle Bildung mit<br />
Mädchen und jungen<br />
Frauen in der Migrationsgesellschaft<br />
11.-<br />
12.09.2013<br />
Loccum,<br />
Evangelische<br />
Akademie<br />
Hannover,<br />
TUT<br />
Hannover,<br />
Stephansstift<br />
LS Niedersachsen<br />
Susanne Keuntje<br />
Tel. 0511 / 106-7438<br />
www.fobionline.de<br />
Landesstelle Jugendschutz<br />
Tel. 0511 858788<br />
info@jugendschutz-niedersachsen.de<br />
www.jugendschutz-niedersachsen.de<br />
VNB Göttingen<br />
Tel. 0551 / 5076460<br />
goettingen@vnb.de<br />
www.vnb.de<br />
Fachtag Was Betriebe erwarten 18.09.2013 Sögel LAG JAW, Kathrin Scheidemann<br />
Tel. 0511 12173-31<br />
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de<br />
www.nord.jugendsozialarbeit.de<br />
Seminar<br />
Fortbildung<br />
Fachtag<br />
Seminar,<br />
zweitägig<br />
„ Machos “ - Berufliche<br />
Integration junger<br />
Migranten<br />
Hart, aber herzlich<br />
Hintergründe - Erklärungsansätze<br />
- Gegenstrategien<br />
18.-<br />
19.09.2013<br />
Zwischen Erschöpfung,<br />
Lustlosigkeit und Resignation<br />
– Burnoutprophylaxe<br />
in der sozialen<br />
Arbeit<br />
Gewaltfreie Kommunikation<br />
19.-<br />
20.09.2013<br />
Loccum,<br />
Evangelische<br />
Akademie<br />
Steyerberg,<br />
Lebensgarten<br />
10.10.2013 Hannover,<br />
Hanns-Lilje-<br />
Haus<br />
10.09. und<br />
23.10.2013<br />
Hannover,<br />
Seminarzentrum<br />
LS Niedersachsen, Anke Boes<br />
Tel. 0511 / 106-7420<br />
www.fobionline.de<br />
LAG JAW, Dimitra Atiselli<br />
Tel. 0511 12173-39<br />
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de<br />
www.nord.jugendsozialarbeit.de<br />
LAG JAW, Dimitra Atiselli<br />
Tel. 0511 12173-39<br />
pro-aktiv@jugendsozialarbeit.de<br />
www.nord.jugendsozialarbeit.de<br />
Landesstelle Jugendschutz<br />
Tel. 0511 858788<br />
info@jugendschutz-niedersachsen.de<br />
www.jugendschutz-niedersachsen.de<br />
Impressum<br />
„jugendsozialarbeit nord“ wird herausgegeben von der<br />
Landesstelle <strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
Redaktion: Ina Samusch<br />
V.i.S.d.P. Angela Denecke<br />
Kopernikusstr. 3, 30167 Hannover<br />
tel: 0511/12173-0 fax: 0511/12173-37 mail: infodienst@jugendsozialarbeit.de<br />
Erscheinungsweise: monatlich, Bezugspreis: 30 Euro für 12 Monate<br />
- 14 -