Bodenbearbeitung und Düngung [Download,*.pdf, 4,60 MB]
Bodenbearbeitung und Düngung [Download,*.pdf, 4,60 MB]
Bodenbearbeitung und Düngung [Download,*.pdf, 4,60 MB]
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Pflanzenbauliche Maßnahmen zur umweltgerechten<br />
Bewirtschaftung – <strong>Bodenbearbeitung</strong> <strong>und</strong> <strong>Düngung</strong>
Gliederung<br />
• Umweltgerechte Bewirtschaftung von Ackerflächen –<br />
Handlungsbedarf in Sachsen<br />
• Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Erosion<br />
<strong>und</strong> zum Gefügeschutz<br />
• Handlungsempfehlungen zur umweltschonenden<br />
N-<strong>Düngung</strong><br />
• Zusammenfassung<br />
2 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Umweltgerechter Ackerbau - Handlungsschwerpunkte<br />
in Sachsen<br />
Schutz vor Bodenerosion durch Wasser <strong>und</strong> Wind<br />
Bodengefügeschutz<br />
N-Austragsminderung<br />
3 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodenerosion in Sachsen<br />
• R<strong>und</strong> <strong>60</strong> % der Ackerflächen (~ 450 Tsd. ha) sind<br />
potenziell durch Wassererosion gefährdet.<br />
• R<strong>und</strong> 20 % der Ackerflächen (~ 150 Tsd. ha) sind<br />
potenziell durch Winderosion gefährdet.<br />
<br />
Erfordernis<br />
<br />
Vorsorgemaßnahmen gegen Erosion<br />
zum Schutz von Boden <strong>und</strong> Gewässern<br />
4 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodenerosion durch Wasser in Sachsen<br />
Erosionsschäden auf<br />
Ackerflächen Verlust der Ertragsfähigkeit!<br />
5 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodenerosion durch Wasser in Sachsen<br />
Erosionsschäden<br />
Außerhalb von Ackerflächen<br />
Sachschäden durch<br />
Schlammablagerung<br />
6<br />
| 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Foto: Dr. Strobel -LfA
Bodenerosion durch Wasser in Sachsen<br />
7<br />
| 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Erosionsschäden außerhalb<br />
von Ackerflächen Sediment<strong>und</strong><br />
P-Eintrag in Gewässer<br />
Foto: Dr. Strobel -LfA
Hauptprobleme der Landwirtschaft bei<br />
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie<br />
in Sachsen:<br />
► P – Einträge in Oberflächengewässer<br />
vor allem durch Bodenerosion durch Wasser!<br />
► Nitratauswaschung in Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Oberflächengewässer<br />
8 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Ökologischer Zustand sächsischer Oberflächenwasserkörper<br />
Einhaltung gewässertypspezifischer Orientierungswerte bei Phosphor<br />
ca. 70 % der sächsischen<br />
Fließgewässer-Wasserkörper<br />
überschreiten die jeweiligen<br />
gewässertypspezifischen<br />
Orientierungswerte der LAWA<br />
für Gesamtphosphor<br />
9<br />
| 15. Januar 2014 | Dr. Walter Schmidt
Ökologischer Zustand sächsischer Oberflächenwasserkörper<br />
Einhaltung gewässertypspezifischer Orientierungswerte bei Phosphor<br />
Handlungsbedarf<br />
<br />
Vorsorgemaßnahmen<br />
gegen Wassererosion<br />
zur Senkung der P-<br />
Belastung von<br />
Oberflächengewässern im<br />
Sinne der Umsetzung der<br />
EG-WRRL!<br />
ca. 70 % der sächsischen<br />
Fließgewässer-Wasserkörper<br />
überschreiten die jeweiligen<br />
gewässertypspezifischen<br />
Orientierungswerte der LAWA<br />
für Gesamtphosphor<br />
10<br />
| 15. Januar 2014 | Dr. Walter Schmidt
Nutzen des Erosionsschutzes<br />
11 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Nutzen des Erosionsschutzes<br />
• Erhalt der Ertragsfähigkeit der<br />
Ackerfläche!<br />
• Keine Nährstoffverluste durch<br />
Bodenabtrag.<br />
• Verminderung der Nährstoffbelastung<br />
von Gewässern ( EG-WRRL!).<br />
• Keine externen Schäden durch<br />
Schlammabspülungen.<br />
• Anpassung an den Klimawandel im<br />
Hinblick auf Erosionsschutz <strong>und</strong><br />
effizienter Wassernutzung.<br />
12 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Vorsorgemaßnahmen gegen Wassererosion<br />
auf Ackerflächen - Handlungsschwerpunkte:<br />
Acker- <strong>und</strong> pflanzenbauliche Maßnahmen<br />
Ergänzende Erosionsschutzmaßnahmen<br />
13 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Vorsorgemaßnahmen gegen Wassererosion<br />
auf Ackerflächen - Handlungsschwerpunkte:<br />
Acker- <strong>und</strong> pflanzenbauliche Maßnahmen<br />
Ergänzende Erosionsschutzmaßnahmen<br />
14 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Hauptursache der Wassererosion<br />
auf Ackerflächen:<br />
Gehemmte Wasserversickerung durch<br />
Oberflächenverschlämmung infolge Bodenaggregatzerfall<br />
Bild LfL Bayern<br />
15 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Hauptursache der Wassererosion<br />
auf Ackerflächen:<br />
Gehemmte Wasserversickerung durch<br />
Oberflächenverschlämmung infolge Bodenaggregatzerfall<br />
Bild LfL Bayern<br />
16 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Schutz vor Wasser- <strong>und</strong> Winderosion<br />
Verhinderung der Bodenverschlämmung<br />
Wirksamste Maßnahme:<br />
dauerhaft konservierende <strong>Bodenbearbeitung</strong>/Direktsaat<br />
17 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
<strong>Bodenbearbeitung</strong>sverfahren<br />
Konventionell – bodenwendend<br />
mit Pflug<br />
Konservierend – nichtwendend<br />
ohne Pflug<br />
Direktsaat<br />
18 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Konventionelle <strong>Bodenbearbeitung</strong> mit dem Pflug:<br />
Hauptursache für infiltrationshemmende, abfluss- <strong>und</strong><br />
erosionsfördernde Bodenverschlämmung<br />
19 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Effekte der konservierenden <strong>Bodenbearbeitung</strong>/Direktsaat<br />
20 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Effekte der konservierenden <strong>Bodenbearbeitung</strong>/Direktsaat<br />
Stabile, wenig verschlämmende Bodenstruktur durch höhere<br />
Krümelstabilität*<br />
Schutz der Bodenoberfläche durch Pflanzenreste<br />
Mehr Grobporen durch mehr Regenwürmer<br />
Schutz der Grobporen durch Pflugverzicht<br />
Erosionsmindernder/-verhindernder <strong>und</strong> infiltrations-<br />
fördernder Bodenstrukturzustand<br />
Voraussetzung: dauerhafter Pflugverzicht!<br />
21 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
* zusätzlich gefördert durch Kalkung!
Vergleich verschiedener Parameter nach konventioneller <strong>und</strong><br />
achtjährig konservierender <strong>Bodenbearbeitung</strong> bzw. Direktsaat<br />
Pflug<br />
Konservierend<br />
Direktsaat<br />
Mulchbedeckung [%] 1 13 77<br />
Humus* [%] 2,0 2,2 2,5<br />
Mikrobielle Biomasse<br />
[g C mic / g TS Boden]*<br />
415 626 575<br />
Aggregatstabilität [%] 20 22 25<br />
Regenwürmer [Anzahl · m -2 ]<br />
125<br />
312<br />
358<br />
davon Tiefgräber (L. terrestris]<br />
4<br />
37<br />
29<br />
Makroporen [Zahl · m -2 ] 264 493 775<br />
22 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
* Bodenschicht 0 – 5 cm
Wirkungen von Regenwürmern<br />
….sie erzeugen stabile<br />
Bodenkrümel<br />
….sie erzeugen viele<br />
große Poren<br />
Verbesserung der Wasserversickerung<br />
23 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
Infiltration [mm]<br />
Wasserinfiltration <strong>und</strong> Bodenabtrag auf gepflügter <strong>und</strong> dauerhaft<br />
konservierend bearbeiteter Fläche (Sächsisches Lößhügelland,<br />
Regensimulationsversuch, Niederschlag: 38 mm in 20 Minuten)<br />
2,0<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
Pflug<br />
0,2<br />
Konservierend<br />
0,0<br />
Beregnungsminute<br />
24 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Infiltrationsraten<br />
Pflug: 55 %<br />
Konservierend: 93 %<br />
Bodenabtrag<br />
Pflug: 246 g/m²<br />
Konservierend:<br />
36 g/m²<br />
P-Austragsminderung<br />
durch<br />
kon servierende<br />
<strong>Bodenbearbeitung</strong>:<br />
~ 90%
Erosionsminderung auf Maisfläche<br />
durch konservierende <strong>Bodenbearbeitung</strong><br />
Konventionell<br />
25 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Konservierend
Wassererosion auf konservierend bestellter Maisfläche:<br />
Optimierung der konservierenden Bearbeitung<br />
bezüglich Erosionsschutz!<br />
Ursachen für Wassererosion auf<br />
konservierend bestellten Flächen:<br />
zu intensive Bearbeitung<br />
dadurch zu geringe Bedeckung<br />
Optimierungsbedarf!<br />
Erfordernis: Reduktion der Bearbeitungsintensität!<br />
26<br />
Konventionell<br />
| 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Konservierend
Bodenbedeckung %<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
<strong>60</strong><br />
Mulchbedeckung in<br />
Abhängigkeit von der<br />
Arbeitstiefe beim<br />
Grubbereinsatz<br />
a<br />
Versuchsjahr: 2005<br />
Bodenentstehung: Löss<br />
Vorfrucht: Winterweizen<br />
1. Arbeitsgang: Kurzscheibenegge<br />
Arbeitstiefe: 5 cm<br />
50<br />
40<br />
b b b<br />
30<br />
20<br />
10<br />
c<br />
c<br />
0<br />
Direktsaat Grubber 5 cm Grubber 10 cm Grubber 15 cm Stoppelpflug Zweischichtpflug<br />
Technik<br />
27 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Optimierungsbedarf:<br />
Schutz vor Wassererosion auf Ackerflächen<br />
durch gezielte „Mulchproduktion“!<br />
Strohdüngung<br />
28 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Zwischenfruchtanbau
Optimierung von konservierender <strong>Bodenbearbeitung</strong><br />
hinsichtlich Erosionsminderung: Beispiel Direktsaat zu Mais<br />
Erhalt von hohem Bedeckungsgrad!<br />
Problem -> langsame Bodenerwärmung<br />
29 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Lösung:<br />
Kombination Direktsaat<br />
- pfluglose Bearbeitung:<br />
Streifenweise Bodenlockerung<br />
mit Strip Till-Technik<br />
(ggf. mit Gülleinjektion)<br />
30 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Technik Streifenbodenbearbeitung – Strip Till<br />
Fahrtrichtung<br />
(Düngerzufuhr)<br />
Andruckrolle<br />
(Hohlscheiben)<br />
Lockerungszinken<br />
oder -scheiben<br />
(Räumsterne)<br />
(Schneidscheibe)<br />
31 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Strip Till zu Mais höherer Bedeckungsgrad!<br />
Strip Till-Bearbeitung<br />
Grubberbearbeitung<br />
32 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Strip Till zu Mais höherer Bedeckungsgrad!<br />
Höhere Bedeckung durch Strip Till:<br />
Schutz vor Erosion<br />
Verdunstungsschutz<br />
Strip Till-Bearbeitung<br />
Grubberbearbeitung<br />
33 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Infiltrationsrate (mm/min)<br />
Auswirkungen von Streifenbearbeitung (Strip Till) <strong>und</strong> Direktsaat zu<br />
Mais auf die Bodenerosion durch Wasser Wasserinfiltration<br />
(Regensimulationsversuch, Körnermais, 38 mm/20 min)<br />
2,00<br />
1,80<br />
1,<strong>60</strong><br />
1,40<br />
1,20<br />
1,00<br />
0,80<br />
0,<strong>60</strong><br />
Streifenbearbeitung<br />
ganzflächig bearbeitet<br />
Direktsaat<br />
Pflug (typischer Verlauf)<br />
0,40<br />
0,20<br />
0,00<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
Beregnungsminute<br />
34 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Auswirkungen von Strip Till <strong>und</strong> Direktsaat<br />
zu Mais auf die Bodenerosion<br />
durch Wasser Bodenabtrag<br />
(Regensimulationsversuch, Körnermais, 38 mm/20 min)<br />
Sedimentabtrag (g/m²)<br />
Bodenabtrag<br />
400,00<br />
350,00<br />
Pflug 400 g/m²<br />
300,00<br />
250,00<br />
200,00<br />
Streifenbearbeitung<br />
ganzflächig bearbeitet<br />
Direktsaat<br />
Pflug (typischer Verlauf)<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
35 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Beregnungsminute
Vorsorgemaßnahmen gegen Wassererosion<br />
auf Ackerflächen:<br />
Acker- <strong>und</strong> pflanzenbauliche Maßnahmen<br />
Ergänzende Erosionsschutzmaßnahmen<br />
(immer kombiniert mit konservierender<br />
<strong>Bodenbearbeitung</strong>/Direktsaat!)<br />
36 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Ergänzende Erosionsschutz-<br />
Maßnahmen (Auswahl)<br />
nach Voß et al. 2010<br />
Erosionsminderung durch Grünstreifen<br />
sowie Fruchtartenwechsel<br />
im Hangverlauf<br />
Gewässerrandstreifen<br />
Hangrinnenbegrünung<br />
(Grünland, KUP usw.)<br />
37 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodengefügeschutz<br />
38 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodengefügeschutz<br />
Schutz des Boden vor Knetung, Scherung <strong>und</strong> schädlicher<br />
Verdichtung bei <strong>Bodenbearbeitung</strong>, Aussaat, Ernte, Transport….<br />
39 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodengefügeschutz<br />
Schutz des Boden vor Knetung, Scherung <strong>und</strong> schädlicher<br />
Verdichtung bei <strong>Bodenbearbeitung</strong>, Aussaat, Ernte, Transport….<br />
40 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodengefügeschutz<br />
Schutz des Boden vor Knetung, Scherung <strong>und</strong> schädlicher<br />
Verdichtung bei <strong>Bodenbearbeitung</strong>, Aussaat, Ernte, Transport….<br />
41 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Bodengefüge schützen!<br />
Durch Bodengefügeschutz<br />
gute Wasserversickerung!<br />
wirksamer Erosionsschutz!<br />
weniger <strong>Bodenbearbeitung</strong><br />
gutes Pflanzenwachstum!<br />
42 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Gefügeschonende Lösungen (Auswahl)<br />
Bandlaufwerk<br />
Pfluglose Bearbeitung<br />
Reifeninnendruckabsenkung<br />
Überladewagen<br />
43 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Gefügeschonende Lösungen<br />
(Auswahl)<br />
Zwillingsbereifung<br />
Bandlaufwerk<br />
44<br />
Überladewagen<br />
| 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Reifeninnendruckabsenkung
Handlungsempfehlungen zur<br />
umweltschonenden N-<strong>Düngung</strong><br />
45 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Ziele der <strong>Düngung</strong><br />
- bedarfsgerechte Pflanzenernährung: Düngermenge,<br />
Zeitpunkt, Verfügbarkeit, Ausgewogenheit<br />
- hohe Nährstoffeffizienz<br />
- Kosteneffizienz<br />
- Nährstoff-Verlustminderung<br />
- Minimierung schädlicher Auswirkungen auf die<br />
Umwelt<br />
- Erhalt <strong>und</strong> Verbesserung Bodenfruchtbarkeit<br />
46 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Gr<strong>und</strong>wasserkörper in Sachsen<br />
chemischer Zustand:<br />
Parameter Nitrat<br />
24 % der sächsischen<br />
Gr<strong>und</strong>wasserkörper<br />
sind aufgr<strong>und</strong> ihres<br />
Nitratgehaltes in einem<br />
schlechten<br />
chemischen Zustand<br />
nach EG-WRRL<br />
47 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
Quelle: Albert, 2011
Handlungsbedarf<br />
N-Austragsminderung<br />
durch effiziente Stickstoffverwertung<br />
48 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Strategien zur Verbesserung<br />
der Stickstoffverwertung - Teil 1<br />
1. Exakte Ermittlung des Düngebedarfes<br />
- Bodenuntersuchung (N min , P, K, Mg, S min , pH …)<br />
- realistische Einschätzung von Ertragserwartung <strong>und</strong> Nährstoffbedarf<br />
(Nitrattest, Pflanzenanalyse, N-Tester, Düngefenster, Luftbilder,<br />
Erfahrungen in Ihrem Betrieb auf Ihren Flächen …)<br />
- Berücksichtigung der gewachsenen Biomasse (Raps)<br />
- Berücksichtigung der Nährstoffnachlieferung des Standortes<br />
- Anrechnung der Nährstoffbereitstellung aus organischen Düngern<br />
2. Sachgerechte mineralische N-<strong>Düngung</strong><br />
- Räumliche Platzierung der Nährstoffe<br />
(unter-Fuß-<strong>Düngung</strong>,Injektion)<br />
- Prüfung des Einsatzes stabilisierter Mineraldünger<br />
- Berücksichtigung von Bodenfeuchte <strong>und</strong> Wetterprognose<br />
49 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Strategien zur Verbesserung<br />
der Stickstoffverwertung - Teil 2<br />
3. Teilschlagspezifische <strong>Düngung</strong> heterogener Standorte<br />
(N-Sensoren, Boden-Scanner, Ertragskarten …)<br />
4. Exakte Verteilung der Düngemittel auf der Fläche<br />
5. Beseitigung von Ertragsbegrenzungen<br />
- ausreichende Versorgung mit P, K usw., Kalkung (pH-Wert!)<br />
- Bekämpfung von Krankheiten/Schädlingen,<br />
- Vermeidung von schädlichen Bodenverdichtungen<br />
6. Maßnahmen im Herbst<br />
- keine pauschale Herbst-N- oder Stroh-Ausgleichsdüngung<br />
- N-Konservierung durch Zwischenfrüchte<br />
- Reduzierung der <strong>Bodenbearbeitung</strong>sintensität im Herbst<br />
7. Mitwirkung in Facharbeitskreisen (z. B. Umsetzung der<br />
Wasserrahmenrichtlinie)<br />
50 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Höhere N-Effizienz aus<br />
organischer <strong>Düngung</strong> (Auswahl)<br />
- Ausbringung organischer Dünger<br />
nur bei Nährstoffbedarf des Pflanzenbestandes<br />
(im Herbst kaum zu Getreide)<br />
- regelmäßige Bestimmung der Nährstoffgehalte<br />
- fachgerechte Anrechnung auf den N-Bedarf<br />
- Einarbeitung flüssiger organischer Düngemittel<br />
ohne Pflanzenbestand: sofort (mind. 4 h)<br />
auch im Bestand (Schlitztechnik)<br />
- Platzierung im Boden (Strip-Till-Verfahren)<br />
- ggfs. Einsatz von Nitrifikationsinhibitoren<br />
- Beachtung der Schlag-Spezifika<br />
(Humusbilanz, Nährstoffgehalte, pH)<br />
- Optimierung der Verteilgenauigkeit<br />
- evtl. Teilschlag-spezifische Ausbringung<br />
51 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Strip-Till mit Gülleausbringung: Kombination von<br />
Bodenschutz <strong>und</strong> effizienter N-<strong>Düngung</strong><br />
(Arbeitstiefe 15 – 20 cm)<br />
…in Stoppel<br />
…in Zwischenfruchtbestand<br />
52 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Strip-Till mit Gülleausbringung<br />
Gülle platziert unter Saatreihe<br />
53 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Rapsertrag (dt/ha b. 91 %) l<br />
N-Düngermenge (kg/ha) l<br />
Teilschlagspezifische N-<strong>Düngung</strong><br />
(Bestandes- <strong>und</strong> bodenabhängig)<br />
Vorteile bei uneinheitlichen Standorten:<br />
- einheitliche Bestände<br />
(Qualität, Reife, Beerntbarkeit)<br />
- höhere Nährstoffeffizienz<br />
- geringere Nährstoffsalden<br />
- verbesserte Wirtschaftlichkeit<br />
- (höhere Erträge)<br />
…..<br />
50<br />
45<br />
40<br />
Ertrag N-Düngermenge<br />
175 178<br />
161<br />
N-Saldo: 49 N-Saldo: 40 N-Saldo: 28<br />
200<br />
1<strong>60</strong><br />
120<br />
80<br />
54 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt<br />
35<br />
30<br />
19.07.2013<br />
40,2 42,6 42,9<br />
konstant / konstant Sensor / Sensor Biomassekarte / Sensor<br />
Quelle: Albert, LfULG, 2011<br />
Prüfglied<br />
mit Offsetkarte<br />
(Ertragspotential)<br />
40<br />
0
N-Austragsminderung durch<br />
Zwischenfruchtanbau<br />
N-Rückhalt bis zu 100 kg N/ha <strong>und</strong> mehr!<br />
Zwischenfruchtgemenge<br />
Gelbsenf (abgefroren)<br />
55 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Anbau von Zwischenfrüchten (ZF)<br />
zur N-Austragsminderung<br />
Praxis-Demonstrationsversuch Lö-Standort Vorfrucht Winterweizen, Ernte am 06.08.2012<br />
Grubber mit Gülleeinarbeitung am 09.08.2012 Folgefrucht Mais<br />
Quelle: A. Schmidt, LfULG, 2013<br />
56 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Umsetzung umweltgerechter Ackerbaumaßnahmen<br />
in Sachsen:<br />
1. Förderung stoffaustragsmindernder Maßnahmen<br />
2. Arbeitskreisarbeit<br />
3. Landwirtschaftliche Konsultationsbetriebe<br />
4. Wissens- <strong>und</strong> Erfahrungstransfer in der landwirtschaftlichen<br />
Ausbildung<br />
5. Durchführung von Feldtagen <strong>und</strong> Fachveranstaltungen…..<br />
57 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Förderung Agrarumweltmaßnahmen (RL AuW/2007)<br />
Stoffeintragsminimierende Bewirtschaftung<br />
(S-Maßnahmen):<br />
► Ansaat von Zwischenfrüchten (85 €/ha)<br />
► Ansaat von Untersaaten (50 €/ha)<br />
► Dauerhaft konservierende <strong>Bodenbearbeitung</strong>/Direktsaat<br />
(68 €/ha)<br />
58 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Konservierende<br />
<strong>Bodenbearbeitung</strong> <strong>und</strong> Direktsaat<br />
- Sachstand 2013 in Sachsen -<br />
• Ca. 50 % der Ackerflächen Sachsens (~ 3<strong>60</strong> Tsd. ha)<br />
werden konservierend bearbeitet (nicht dauerhaft<br />
konservierend).<br />
• Ca. 35 % der Ackerflächen Sachsens (~ 248 Tsd. ha)<br />
werden dauerhaft konservierend bearbeitet; Direktsaat wird<br />
in Einzelbetrieben praktiziert.<br />
Erfahrungen zur konservierenden <strong>Bodenbearbeitung</strong><br />
sind vorhanden Vermittlung durch Wissens- <strong>und</strong><br />
Erfahrungstransfer ist erforderlich.<br />
59 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Landwirtschaftliche Arbeitskreise<br />
zur Umsetzung der EG-WRRL in Sachsen<br />
<strong>60</strong> | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Zusammenfassung<br />
• Handlungsschwerpunkte der umweltgerechten Bewirtschaftung von<br />
Ackerflächen in Sachsen sind der Erosionsschutz, der Bodengefügeschutz<br />
sowie eine sachgerechte <strong>und</strong> effiziente N-<strong>Düngung</strong>.<br />
• Wichtige acker- <strong>und</strong> pflanzenbauliche Maßnahmen einer umweltgerechten<br />
Bewirtschaftung sind:<br />
dauerhaft konservierende <strong>Bodenbearbeitung</strong>/Direktsaat mit Streifenbearbeitung<br />
Minderung/Verhinderung der Wasser- <strong>und</strong> Winderosion.<br />
Achslastbegrenzung, Breitreifen, Bandlaufwerke, Reifendruckregelanlagen<br />
usw. Erhalt <strong>und</strong> Schutz eines funktionsfähigen Bodengefüges.<br />
bedarfsgerechte organische <strong>und</strong> mineralische N-<strong>Düngung</strong> mit<br />
Verwendung neuartiger Ausbringungstechnik (Strip-Till-Technik,<br />
Injektionstechnik, Teilschlagbewirtschaftung usw.).<br />
• Durch Förderung stoffaustragsmindernder Maßnahmen, durch AK-Arbeit,<br />
durch landwirtschaftliche Konsultationsbetriebe, durch Fachausbildung<br />
Vermittlung <strong>und</strong> Umsetzung der Gr<strong>und</strong>lagen der umweltgerechten<br />
Ackerflächenbewirtschaftung in Sachsen.<br />
61 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
Weitere Informationen: http://www.smul.sachsen.de/lfulg<br />
62 | 10. Dezember 2013 | Dr. Walter Schmidt


![Bodenbearbeitung und Düngung [Download,*.pdf, 4,60 MB]](https://img.yumpu.com/23374622/1/500x640/bodenbearbeitung-und-dungung-downloadpdf-460-mb.jpg)

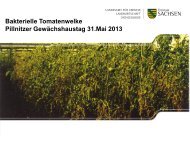


![Was ist Tierwohl? [Download,*.pdf, 0,90 MB] - Landwirtschaft in ...](https://img.yumpu.com/23374625/1/190x143/was-ist-tierwohl-downloadpdf-090-mb-landwirtschaft-in-.jpg?quality=85)


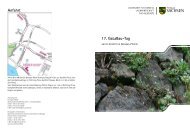
![Verzeichnis der Aussteller [Download,*.pdf, 0,21 MB]](https://img.yumpu.com/23374610/1/190x135/verzeichnis-der-aussteller-downloadpdf-021-mb.jpg?quality=85)
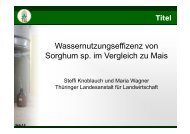
![Wirtschaftlichkeit der Feldbewässerung [Download,*.pdf, 2,86 MB]](https://img.yumpu.com/23374603/1/190x128/wirtschaftlichkeit-der-feldbewasserung-downloadpdf-286-mb.jpg?quality=85)


