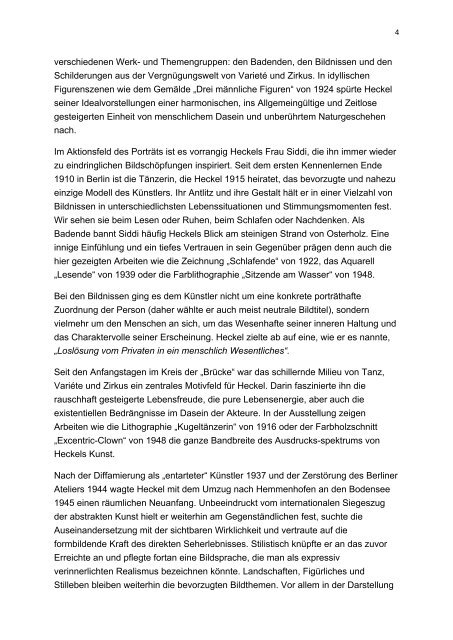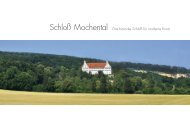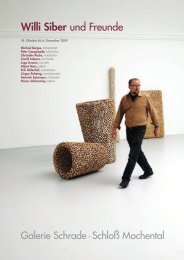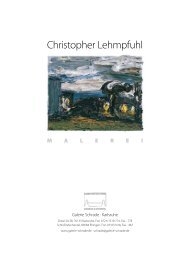ERICH HECKEL Gemälde, Aquarelle ... - Galerie Schrade
ERICH HECKEL Gemälde, Aquarelle ... - Galerie Schrade
ERICH HECKEL Gemälde, Aquarelle ... - Galerie Schrade
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 <br />
verschiedenen Werk- und Themengruppen: den Badenden, den Bildnissen und den<br />
Schilderungen aus der Vergnügungswelt von Varieté und Zirkus. In idyllischen<br />
Figurenszenen wie dem <strong>Gemälde</strong> „Drei männliche Figuren“ von 1924 spürte Heckel<br />
seiner Idealvorstellungen einer harmonischen, ins Allgemeingültige und Zeitlose<br />
gesteigerten Einheit von menschlichem Dasein und unberührtem Naturgeschehen<br />
nach.<br />
Im Aktionsfeld des Porträts ist es vorrangig Heckels Frau Siddi, die ihn immer wieder<br />
zu eindringlichen Bildschöpfungen inspiriert. Seit dem ersten Kennenlernen Ende<br />
1910 in Berlin ist die Tänzerin, die Heckel 1915 heiratet, das bevorzugte und nahezu<br />
einzige Modell des Künstlers. Ihr Antlitz und ihre Gestalt hält er in einer Vielzahl von<br />
Bildnissen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und Stimmungsmomenten fest.<br />
Wir sehen sie beim Lesen oder Ruhen, beim Schlafen oder Nachdenken. Als<br />
Badende bannt Siddi häufig Heckels Blick am steinigen Strand von Osterholz. Eine<br />
innige Einfühlung und ein tiefes Vertrauen in sein Gegenüber prägen denn auch die<br />
hier gezeigten Arbeiten wie die Zeichnung „Schlafende“ von 1922, das Aquarell<br />
„Lesende“ von 1939 oder die Farblithographie „Sitzende am Wasser“ von 1948.<br />
Bei den Bildnissen ging es dem Künstler nicht um eine konkrete porträthafte<br />
Zuordnung der Person (daher wählte er auch meist neutrale Bildtitel), sondern<br />
vielmehr um den Menschen an sich, um das Wesenhafte seiner inneren Haltung und<br />
das Charaktervolle seiner Erscheinung. Heckel zielte ab auf eine, wie er es nannte,<br />
„Loslösung vom Privaten in ein menschlich Wesentliches“.<br />
Seit den Anfangstagen im Kreis der „Brücke“ war das schillernde Milieu von Tanz,<br />
Variéte und Zirkus ein zentrales Motivfeld für Heckel. Darin faszinierte ihn die<br />
rauschhaft gesteigerte Lebensfreude, die pure Lebensenergie, aber auch die<br />
existentiellen Bedrängnisse im Dasein der Akteure. In der Ausstellung zeigen<br />
Arbeiten wie die Lithographie „Kugeltänzerin“ von 1916 oder der Farbholzschnitt<br />
„Excentric-Clown“ von 1948 die ganze Bandbreite des Ausdrucks-spektrums von<br />
Heckels Kunst.<br />
Nach der Diffamierung als „entarteter“ Künstler 1937 und der Zerstörung des Berliner<br />
Ateliers 1944 wagte Heckel mit dem Umzug nach Hemmenhofen an den Bodensee<br />
1945 einen räumlichen Neuanfang. Unbeeindruckt vom internationalen Siegeszug<br />
der abstrakten Kunst hielt er weiterhin am Gegenständlichen fest, suchte die<br />
Auseinandersetzung mit der sichtbaren Wirklichkeit und vertraute auf die<br />
formbildende Kraft des direkten Seherlebnisses. Stilistisch knüpfte er an das zuvor<br />
Erreichte an und pflegte fortan eine Bildsprache, die man als expressiv<br />
verinnerlichten Realismus bezeichnen könnte. Landschaften, Figürliches und<br />
Stilleben bleiben weiterhin die bevorzugten Bildthemen. Vor allem in der Darstellung