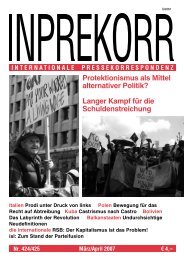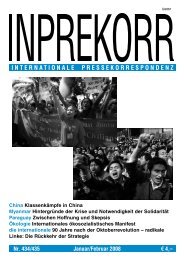Die ganze Ausgabe als PDF (1476 K) - Inprekorr
Die ganze Ausgabe als PDF (1476 K) - Inprekorr
Die ganze Ausgabe als PDF (1476 K) - Inprekorr
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
INTERNATIONALE PRESSEKORRESPONDENZ<br />
Europa Krise und Widerstand<br />
Frankreich <strong>Die</strong> Bewegung ist noch lange nicht zu Ende<br />
Italien Das System Berlusconi in der Krise und die Linke<br />
orientierungslos Spanien Der Beginn einer neuen Etappe<br />
Griechenland Wie heiß wird der Herbst?“<br />
Nr. 468/469 November/Dezember 2010 € 4,–
INHALT<br />
IMPRESSUM<br />
<strong>Inprekorr</strong> ist das Organ der IV. Internationale<br />
in deutscher Sprache. <strong>Inprekorr</strong><br />
wird herausgegeben von der<br />
deutschen Sektion der IV. Internationale,<br />
von RSB und isl. <strong>Die</strong>s geschieht<br />
in Zusammenarbeit mit GenossInnen<br />
aus Österreich und der Schweiz und<br />
unter der politischen Verantwortung<br />
des Exekutivbüros der IV. Internationale.<br />
<strong>Inprekorr</strong> erscheint zweimonatlich<br />
(6 Doppelhefte im Jahr). Namentlich<br />
gekennzeichnete Artikel geben nicht<br />
unbedingt die Meinung des herausgebenden<br />
Gremiums wieder.<br />
Konto: Neuer Kurs GmbH,<br />
Postbank Frankfurt/M.<br />
(BLZ: 500 100 60), KtNr.: 365 84-604<br />
Abonnements:<br />
Einzelpreis: € 4,–<br />
Jahresabo (6 Doppelhefte): € 20,–<br />
Doppelabo (Je 2 Hefte): € 30,–<br />
Solidarabo: ab € 30,–<br />
Sozialabo: € 12,–<br />
Probeabo (3 Doppelhefte): € 10,–<br />
Auslandsabo: € 40,–<br />
Website:<br />
http://inprekorr.de<br />
Redaktion:<br />
Michael Weis (verantw.), Birgit Althaler,<br />
Daniel Berger, Wilfried Dubois,<br />
Thies Gleiss, Jochen Herzog, Paul<br />
Kleiser, Oskar Kuhn, Björn Mertens<br />
E-Mail: Redaktion@inprekorr.de<br />
Satz: Grafikkollektiv Sputnik<br />
Verlag, Verwaltung & Vertrieb:<br />
<strong>Inprekorr</strong>, Hirtenstaller Weg 34,<br />
25761 Büsum,<br />
E-Mail: vertrieb@inprekorr.de<br />
Kontaktadressen:<br />
RSB,<br />
Revolutionär Sozialistischer Bund<br />
Postfach 10 26 10,<br />
68026 Mannheim<br />
isl, internationale sozialistische linke<br />
Regentenstr. 75–59, D-51063 Köln<br />
SOAL, Sozialistische Alternative<br />
office@soal.at<br />
Sozialistische Alternative<br />
Postfach 4070, 4002 Basel<br />
Eigentumsvorbehalt: <strong>Die</strong> Zeitung bleibt<br />
Eigentum des Verlags Neuer Kurs<br />
GmbH, bis sie dem/der Gefangenen<br />
persönlich ausgehändigt ist.<br />
„Zur-Habe-Nahme“ ist keine persönliche<br />
Aushändigung im Sinne des<br />
Eigentumsvorbehalts. Wird die Zeitschrift<br />
dem/der Gefangenen nicht<br />
persönlich ausgehändigt, ist sie dem<br />
Absender unter Angabe der Gründe<br />
der Nichtaushändigung umgehend<br />
zurückzusenden.<br />
Frankreich<br />
<strong>Die</strong> Bewegung ist noch lange nicht zu Ende, Sandra Demarcq ............................................3<br />
Italien<br />
Das System Berlusconi in der Krise und die Linke orientierungslos,<br />
Salvatore Cannavó ............................................................................................................5<br />
Von der KPI zur Demokratischen Partei, Lidia Cirillo .........................................................7<br />
Spanien<br />
Der Beginn einer neuen Etappe, Lluís Rabell .....................................................................11<br />
Der Streik vom 29. September: <strong>Die</strong> soziale Frage kehrt zurück, Miguel Romero ..............15<br />
Griechenland<br />
Wie heiß wird der Herbst?“, Tassos Anastassiadis, Andreas Sartzekis ...............................17<br />
Osteuropa<br />
Osteuropa in der Systemkrise, Catherine Samary ..............................................................20<br />
Türkei<br />
Im Labyrinth der bürgerlichen Politik, Ümit Çırak .............................................................31<br />
China<br />
Arbeiterfrühling im Herzen der „Werkstatt der Welt“, Danielle Sabaï ...............................37<br />
Nachruf<br />
Luis Vitale (1927–2010) – Ein revolutionärer Historiker aus Lateinamerika,<br />
Franck Gaudichaud .........................................................................................................40<br />
Geschichte<br />
<strong>Die</strong> grüne Fahne Mohammeds und die Ausbreitung des Welthandels, Jean Batou ............43<br />
Register ...............................................................................................................................48<br />
Ökologie<br />
Cancún – <strong>Die</strong> Via Campesina ruft die sozialen Bewegungen und alle Leute auf, überall auf<br />
der Welt zu mobilisieren! Organisiert Tausende von Cancúns! .......................................52<br />
Register 2010<br />
Register nach Ländern .........................................................................................................48<br />
Register nach Themen (Auswahl) .......................................................................................49<br />
die Internationale .................................................................................................................49<br />
die internationale<br />
Benjamins Thesen – Zu Band 19 der Kritischen Gesamtausgabe , Helmut Dahmer ...........25<br />
Nachruf– Wilebaldo Solano (1917–2010), Jaime Pastor ....................................................28<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
der angekündigte „heiße Herbst“ der Gegenwehr gegen die Abwälzung der<br />
Krisenlasten auf die arbeitenden und von der Erwerbsarbeit ausgeschlossenen<br />
Teile der Bevölkerung hat zwar die notwendige Betriebstemperatur noch<br />
nicht erreicht – am ehesten noch in Frankreich –, aber für eine Bilanz der<br />
„Gegenwehr“ ist es noch zu früh. Eine sich langsam entwickelnde Tendenz<br />
zu mehr Selbstorganisation und einem Bewusstsein von der Notwendigkeit<br />
einer größeren Unabhängigkeit von den sozialpartnerschaftlich ausgerichteten<br />
Organisationen lässt sich aus einigen Beiträgen dieser letzten <strong>Inprekorr</strong><br />
des Jahres 2010 durchaus herauslesen.<br />
In diesem Sinne wünschen wir uns und Euch einen nahtlosen Übergang ins<br />
neue Jahr 2011.<br />
Eure Redaktion<br />
Eure großzügigen Spenden erbitten wir wie immer auf das folgende Konto:<br />
Thies Gleiss Sonderkonto; Kto.Nr. 478 106-507<br />
Postbank Köln (BLZ 370 100 50)<br />
2 INPREKORR 468/469
FRANKREICH<br />
Frankreich – die Bewegung ist noch<br />
lange nicht zu Ende<br />
Der folgende Beitrag wurde inmitten der landesweiten und massiven<br />
Proteste noch vor der (inzwischen erfolgten) Abstimmung<br />
des Gesetzesentwurfs im Senat verfasst und ist insofern vorläufig<br />
und für heutige LeserInnen von der Aktualität überholt. Aufgrund<br />
der enormen Bedeutung, auch für die weitere Entwicklung der sozialen<br />
Proteste in Europa, haben wir uns trotzdem für den Abdruck<br />
entschieden und werden in einer – hoffentlich positiven – Bilanz<br />
auf das Thema zurückkommen. <strong>Die</strong> Redaktion<br />
Sandra Demarcq<br />
Seit Mai drücken die Mobilisierungen<br />
gegen die geplante Rentenreform dem<br />
Land ihren Stempel auf. Mit jedem Aktionstag<br />
entwickelt sich die Bewegung<br />
weiter und gewinnt an Stärke. Darin<br />
zeigt sich, wie sehr sie die Bevölkerung<br />
mittlerweile durchdringt und nicht nur<br />
die massive Ablehnung der Rentenreform<br />
widerspiegelt sondern darin der<br />
Verdruss an der sozialfeindlichen, rassistischen<br />
und repressiven Politik von<br />
Sarkozy im Ganzen zum Ausdruck<br />
kommt. Und auch der Unmut über die<br />
immer größere und durch die Krise<br />
noch zugespitzte Ungerechtigkeit im<br />
Land treibt die Jugend und die Lohnabhängigen<br />
um.<br />
Vor diesem Hintergrund wird erklärlich,<br />
dass sich die Demonstrationen<br />
nicht totlaufen sondern weiter steigern<br />
und am 12. und 19. Oktober mit jeweils<br />
3,5 Millionen Teilnehmern einen Rekord<br />
erreichten. Zudem werden sie immer<br />
kämpferischer und radikaler und<br />
haben – nachdem auch der privatwirtschaftliche<br />
Sektor diesmal sehr stark<br />
vertreten ist – inzwischen die Jugend,<br />
d. h. im Moment noch vornehmlich die<br />
Schüler, erreicht. Denn diese haben kapiert,<br />
dass sie es mit dieser Reform erheblich<br />
schwerer haben werden, frühzeitig<br />
Arbeit zu finden und später die<br />
volle Rente in gesundem Zustand zu<br />
erreichen. Nach und nach hat sich das<br />
Klima geädert, und mittlerweile glauben<br />
sehr viele, dass wir gewinnen und<br />
Sarkozy zum Rückzug drängen können.<br />
Bereits jetzt und in der gegenwärtigen<br />
Mobilisierungsphase hat die Regierung<br />
den Kampf um die öffentliche<br />
Meinung verloren. Denn 70 % der Bevölkerung<br />
sind gegen diese Reform<br />
und unterstützen die Proteste. Und inzwischen<br />
weiß die Mehrheit der ArbeiterInnen,<br />
prekär Beschäftigten und Jugendlichen,<br />
dass es bei der Rente weder<br />
um ein demographisches noch um<br />
ein Finanzierungsproblem geht, wie<br />
uns die Regierung seit Monaten glauben<br />
machen will.<br />
<strong>Die</strong> Streiks haben sich so nach und<br />
nach eingenistet und mit jedem Aktionstag<br />
wurde es für immer mehr Bevölkerungsteile<br />
offenkundig, dass solche<br />
auseinander gerissenen Einzelaktionen<br />
die Regierung nicht zum Rückzug<br />
zwingen würden. Und bisher war auch<br />
nicht allerorten so sehr von unbefristeten<br />
Streiks die Rede wie in den letzten<br />
Wochen, wo sich in Umfragen 61 %<br />
dafür ausgesprochen haben. Was fehlt,<br />
sind die Gewerkschaftsführungen, die<br />
sich wohlweislich davor hüten, zum<br />
Gener<strong>als</strong>treik aufzurufen, auch wenn<br />
sie von der Basis zum Durchhalten gedrängt<br />
werden. <strong>Die</strong> Einheit der Gewerkschaften<br />
ist sicherlich von Beginn<br />
der Bewegung an ein Trumpf und elementar<br />
für den Erfolg der Streiks und<br />
Demonstrationen. Aber die Gewerkschaftskoordination<br />
vermeidet es nicht<br />
nur, zu einer entscheidenden sozialen<br />
Konfrontation aufzurufen, sondern sie<br />
verlangt noch nicht einmal die Rücknahme<br />
des Gesetzesentwurfs, sondern<br />
stattdessen bloß neue Verhandlungen<br />
und Abänderungen.<br />
Glücklicherweise haben jedoch<br />
Schlüsselsektoren der Wirtschaft beschlossen,<br />
sich unbefristet in den Streik<br />
zu begeben oder ihn auszuweiten. <strong>Die</strong>s<br />
gilt z. B. für die Eisenbahner, zentrale<br />
Stromversorgung oder Raffinerien,<br />
was so seit Mai 68 nicht mehr da gewesen<br />
ist. Seit dem 14. Oktober sind alle<br />
13 Raffinerien im unbefristeten Streik<br />
und haben den kompletten Betrieb<br />
und die Auslieferung von Treibstoff an<br />
Tankstellen und Lager eingestellt. Der<br />
Streik wird ungeheuer breit befolgt und<br />
nahezu einhellig fortgeführt.<br />
Ein weiteres typisches Merkmal<br />
dieser Bewegung ist aber auch,<br />
dass sich überall etwas rührt, tägliche<br />
neue Initiativen und Blockadeaktionen<br />
(Mautstellen, Straßen, Flughäfen,<br />
Industriezonen …) ergriffen werden<br />
und Demonstrationen vor Ort auf<br />
einheitlicher und berufsübergreifender<br />
Grundlage stattfinden. Genau so<br />
INPREKORR 468/469 3
FRANKREICH<br />
gibt es tägliche Vollversammlungen<br />
der verschiedenen Streiksektoren, anfangs<br />
noch schwach besucht, mit der<br />
Zeit aber immer stärker. Zugleich muss<br />
man aber sehen, dass zwar zahlreiche<br />
Streiks hier und da im öffentlichen wie<br />
privatwirtschaftlichen Sektor stattfinden,<br />
die unbefristeten jedoch noch zu<br />
verstreut sind und nur von einer Minderheit<br />
getragen werden und dass außerdem<br />
die Beteiligungsquote an den<br />
landesweiten Streiktagen zwar hoch,<br />
aber nicht außergewöhnlich war.<br />
Seit einigen Tagen und besonders<br />
seit dem 19. Oktober beteiligen sich<br />
die Jugendlichen mit breiten und dynamischen<br />
Demonstrationen sowie zahlreichen<br />
Schulblockaden an den Protesten.<br />
Man spürt dort eine Entschlossenheit<br />
und Politisierung wie nie zuvor<br />
bei vorangegangenen Protesten. Und je<br />
lauter es hallt, sie seien ferngesteuert<br />
und hätten kein Recht zu protestieren,<br />
umso größer wird ihre Entschlossenheit.<br />
Auch an den Universitäten fangen<br />
die Proteste langsam an zu greifen. <strong>Die</strong><br />
kommenden Tage kurz vor den Schulferien<br />
werden entscheidend sein.<br />
<strong>Die</strong> Rechte, die Unternehmer und<br />
die Regierung Sarkozy sind angesichts<br />
der Lage unnachgiebig entschlossen,<br />
die Reform durchzuziehen. Sarkozy<br />
versetzt das Land in eine Blockade<br />
und probt seine Macht. Und er schreckt<br />
dabei nicht vor Gewalt zurück, wie<br />
die Polizeieinsätze gegen Schüler und<br />
Streikende in den Raffinerien zeigen.<br />
Er zieht seine parlamentarische Mehrheit<br />
durch und verweigert jede Diskussion<br />
selbst mit den moderatesten Gewerkschaftsführern.<br />
<strong>Die</strong>se Entschlossenheit<br />
rührt daher, dass die Rentenreform<br />
das Herzstück der Austeritätspolitik<br />
ist, mit der sie die Zeche der Krise<br />
auf die Unbeteiligten abwälzen wollen.<br />
Gelingt sie, gewinnen sie Pluspunkte<br />
auf den Finanzmärkten und verschaffen<br />
sich die Gelegenheit, die Kräfteverhältnisse<br />
weiter zu ihren Gunsten zu<br />
ändern und die Umverteilung von unten<br />
nach oben voranzutreiben. Zudem<br />
können sie sich dann die „sozialen und<br />
steuerlichen Lasten“ vom H<strong>als</strong> schaffen,<br />
die in früheren Kämpfen errungen<br />
wurden, und die widerständigsten<br />
Kreise in die Knie zwingen. Für Sarkozy<br />
geht es auch darum, wenige Monate<br />
vor den Präsidentschaftswahlen sein<br />
Gefolge hinter sich zu scharen. Kurzum<br />
stehen bei den gegenwärtigen Protesten<br />
die globalen Kräfteverhältnisse<br />
zwischen den Klassen auf dem Spiel.<br />
Sarkozy ist weit davon entfernt, zu gewinnen<br />
und den Widerstand zu brechen<br />
und mundtot zu machen. Er, der zu Beginn<br />
seiner Präsidentschaft tönte, dass<br />
von den vermeintlichen Streiks nichts<br />
zu sehen sei, wird von den Ereignissen<br />
auf der Straße seit dem letzten Mai widerlegt.<br />
<strong>Die</strong> Breite der Proteste zeigt, dass<br />
eine Niederlage der Regierung machbar<br />
ist. Umso notwendiger ist die Einheit<br />
der gesamten politischen und sozialen<br />
Linken in diesem Kampf. In diesem<br />
Sinn engagiert sich die NPA in allen<br />
übergreifenden politischen Initiativen<br />
für die gemeinsame Formierung<br />
unserer Kräfte, besonders im Rahmen<br />
des von der Fondation Copernic und<br />
Attac initiierten Nationalen Kollektivs.<br />
Aber hinter den Parolen „Rente mit<br />
60“ und „Rücknahme des Gesetzesentwurfs“<br />
lassen sich grundsätzliche und<br />
strategische Differenzen besonders mit<br />
der PS nicht verbergen. <strong>Die</strong>se verteidigt<br />
zwar die Rente mit 60, hat aber mit der<br />
Rechten im Parlament für die Aufstockung<br />
der Beitragsjahre auf 41,5 gestimmt,<br />
was de facto das Eintrittsalter<br />
aufschiebt. Und angesichts der wachsenden<br />
Proteste verlegt sie sich auf<br />
Wahlversprechungen für 2012 und bereitet<br />
so einen Regierungswechsel vor.<br />
Es bestehen Divergenzen mit der radikalen<br />
Linken, besonders mit der Linkspartei<br />
von Melenchon, die im Wesentlichen<br />
auf die strategische Vorgehensweise<br />
zielen. Denn diese tritt für ein sofortiges<br />
Referendum ein und will damit<br />
die Proteste von der Straße an die Urne<br />
holen, obwohl die entscheidende Kraftprobe<br />
noch vor uns liegt.<br />
<strong>Die</strong> NPA tritt seit Beginn der Mobilisierung<br />
<strong>als</strong> treibende Kraft in den<br />
Kämpfen auf und macht sich für die<br />
Einigung der betroffenen Bevölkerung<br />
entlang bestimmter politischer Forderungen<br />
stark: Rücknahme bzw. – wie<br />
die Dinge liegen – Abschaffung der Gesetzesreform<br />
und Rücktritt von Sarkozy<br />
und Woerth, die für die soziale Krise<br />
verantwortlich sind. Daneben vermitteln<br />
wir antikapitalistische Perspektiven,<br />
die auf einen Bruch mit dem System<br />
und soziale wie politische Sofortmaßnahmen<br />
und auf Autonomie zielen.<br />
<strong>Die</strong> kommenden Tage werden die<br />
Entscheidung bringen. Das Gesetz<br />
wird angenommen, aber die Proteste<br />
nicht zum Verstummen bringen, weil<br />
die Machthaber in den Augen aller, die<br />
heute auf den Straßen und im Streik<br />
sind, keine Legitimation haben. Außerdem<br />
sind wir viel zu viele, die genau<br />
wissen, dass auch ein bereits verabschiedetes<br />
Gesetz zu Fall gebracht<br />
werden kann, was 2007 mit dem Erstanstellungsvertrag<br />
CPE geschehen ist<br />
und auf ein da capo wartet.<br />
22.10.2010<br />
Sandra Demarcq ist leitendes Mitglied der<br />
NPA und der IV. Internationale<br />
Übersetzung: MiWe<br />
4 INPREKORR 468/469
ITALIEN<br />
Das System Berlusconi in der Krise<br />
und die Linke orientierungslos<br />
Salvatore Cannavò<br />
<strong>Die</strong> politische Krise in Italien und die<br />
seit mehr <strong>als</strong> zwei Jahren anhaltende internationale<br />
Wirtschaftskrise sind unübersehbar<br />
miteinander verwoben. Trotzdem<br />
werden diese Zusammenhänge in<br />
der politischen Diskussion völlig ausgeblendet,<br />
und man kapriziert sich auf die<br />
unvorhergesehene Krise des Systems<br />
Berlusconi und des Mitte-Rechts-Bündnisses.<br />
Überraschend kam dies freilich<br />
nur für diejenigen, die in Berlusconi einen<br />
Magier sehen, der über die realen<br />
Klassenverhältnisse und die Rechtsentwicklung<br />
in unserem Land hinwegtäuschen<br />
konnte. Und dann passiert es, dass<br />
einer der treuesten Verbündeten Berlusconis,<br />
der Parlamentspräsident Gianfranco<br />
Fini, sich von ihm und seiner<br />
Partei distanziert und eine neue Organisation<br />
– Futuro e Libertà – gründet. Ein<br />
Schock für die italienische Rechte, weil<br />
die Unfehlbarkeit des Führers erschüttert<br />
wurde und eine ernste Krise entstanden<br />
ist, die im Moment zwar nicht die<br />
Regierung zu Fall bringt, aber doch eine<br />
Ära beendet, die mit dem Eintritt Berlusconis<br />
ins politische Leben 1994 begonnen<br />
hat.<br />
In der italienischen Presse wird diese<br />
Auseinandersetzung in erster Linie<br />
auf den „Charakter“ der Akteure zurückgeführt<br />
und <strong>als</strong> persönlicher Konflikt<br />
gedeutet und dabei die strukturellen<br />
Momente in den Hintergrund gedrängt.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaftskrise indessen ist so tiefgreifend<br />
und essentiell, dass sie die politischen<br />
Gleichgewichtsverhältnisse beeinflusst<br />
und zur politischen und mitunter<br />
sogar institutionellen Krise ausweitet.<br />
Beredtes Beispiel dafür sind die Probleme<br />
des US-Präsidenten Obama, der<br />
nach einem triumphalen Wahlsieg vor<br />
zwei Jahren inzwischen die Kongressmehrheit<br />
zu verlieren droht, oder auch<br />
Sarkozy in Frankreich, der 2007 die<br />
Wahlen haushoch gewonnen hat und inzwischen<br />
auf dem Tiefpunkt seiner Popularität<br />
angelangt ist. <strong>Die</strong> Wirtschaftskrise<br />
gebiert <strong>als</strong>o allenthalben politische<br />
Krisen.<br />
Berlusconi hat die Wahlen 2008 v. a.<br />
deswegen verloren, weil die linke Mitte<br />
versagt hat. In absoluten Zahlen ist<br />
der Wahlsieg überhaupt nicht vergleichbar<br />
mit 2001, <strong>als</strong> Berlusconi auf seinem<br />
Gipfelpunkt angelangt war. Nur dank<br />
eines „betrügerischen“ Wahlrechts 1<br />
konnte sich Berlusconi eine komfortable<br />
Parlamentsmehrheit sichern, die<br />
er ganz zielgerichtet und effizient einsetzte,<br />
um die Arbeiterbewegung in ihren<br />
Grundfesten zu attackieren, ihre historischen<br />
Errungenschaften (Statuto<br />
dei lavoratori) infrage zu stellen und ihre<br />
Reallöhne zu senken (Tarifvertrag des<br />
Öffentlichen <strong>Die</strong>nstes) und gleichzeitig<br />
die eigene Klientel aus Mittel- und Kleinunternehmern,<br />
Freiberuflern, Steuerhinterziehern,<br />
Banken und Finanzwirtschaft<br />
zu alimentieren. Mit seiner Steuergesetzgebung<br />
hebelte er die Politik<br />
des sozialen Burgfriedens aus, die das<br />
Land in den Nachkriegsjahren geprägt<br />
hatte. Durch die Krise ist diese Politik<br />
umstritten geworden oder sind zumindest<br />
politische Differenzen, Interessensgegensätze<br />
und unterschiedliche Optionen<br />
wieder zu Tage getreten, die ins<br />
Grundsätzliche gehen. <strong>Die</strong> Differenzen<br />
zu Fini betreffen nicht die Justiz- 2 sondern<br />
die Wirtschaftspolitik. Fini hat sich<br />
hinter den ÖD – namentlich die Sicherheitskräfte<br />
und die öffentlichen Schulen<br />
– gestellt und vertritt eine Industriepolitik,<br />
die auf Kompromissen zwischen<br />
„Kapital und Arbeit“ basiert und<br />
im Konflikt mit der Herangehensweise<br />
des Wirtschaftsministers Tremonti steht.<br />
Somit liegen die eigentlichen Gegensätze<br />
in der Bewertung der Wirtschaftskri-<br />
1 Das italienische Wahlrecht (Mehrheits-<br />
Proporzsystem) sieht eine automatische<br />
Mehrheit von 55 % der Parlamentssitze für<br />
die Partei oder Koalition vor, die die relative<br />
Stimmenmehrheit erhalten hat.<br />
2 Gegen Berlusconi laufen noch einige Prozesse,<br />
die durch Gesetzesänderungen ad personam<br />
(auf B. zugeschnitten) blockiert werden. <strong>Die</strong>se<br />
Gesetze wurden von Parlament oder auch nur<br />
Regierung gebilligt und Fini versucht, sich<br />
davon zu distanzieren.<br />
se und der anstehenden Maßnahmen zu<br />
ihrer Bewältigung.<br />
In diesem Konflikt offenbart sich in<br />
vollem Umfang, dass die Mitte-Rechts-<br />
Regierung ohne Perspektiven ist und in<br />
der Krise steckt. Zwar ist es Berlusconi<br />
in den fünfzehn Jahren seiner politischen<br />
Karriere gelungen, gewissermaßen<br />
eine politische „Gemeinde“ hinter<br />
sich zu scharen: Mittlere und Kleinunternehmer<br />
aus dem Norden, Händler,<br />
Freiberufler, Steuerhinterzieher;<br />
aber auch Lumpenproletarier, die von<br />
der „Stütze“ leben, Jugendliche mit prekären<br />
Jobs und ältere Wähler. Aber dieser<br />
heterogene Block basiert nicht auf<br />
gemeinsamen wirtschaftlichen und sozialen<br />
Interessen, sondern wird zusammengehalten<br />
durch die mediale Inszenierung<br />
der Person Berlusconi mit ihrer<br />
Rhetorik, Propaganda und ideologischen<br />
Ausstrahlungskraft. Und in<br />
dem Moment, wo dieser soziale Block<br />
durch die Krise bedroht und unterminiert<br />
wird, verfliegt auch die Kraft der<br />
Propaganda und Rhetorik von Berlusconi.<br />
Fini präsentiert sich heute <strong>als</strong> Kandidat<br />
eines Teils dieser Sektoren und für<br />
eine Politik, die eindeutig über Berlusconi<br />
hinausweist und ein neues Konzept<br />
für Mitte-Rechts entwerfen will. Wenn<br />
von einem „Dritten Block“ die Rede ist,<br />
geht es dabei weniger um eine neue strategische<br />
Option <strong>als</strong> um ein Durchgangsstadium<br />
bei der Etablierung einer konservativen<br />
Formation, die sich <strong>als</strong> eine<br />
liberale Alternative zu Mitte-Links versteht<br />
und die Belange der herrschenden<br />
Klasse angemessen vertritt.<br />
<strong>Die</strong> Krise trifft natürlich auch die<br />
herrschenden Klassen und ihre machtvollen<br />
Bastionen, die Confindustria<br />
(Unternehmerverband), die Banken<br />
und das Finanzkapital. Für sie ist aktuell<br />
unklar, ob sie weiter auf die Regierung<br />
Berlusconi setzen sollen, die – wie<br />
die Auseinandersetzung bei Fiat zeigt –<br />
fest entschlossen ist, die Lohnabhängigen<br />
dauerhaft zu paralysieren, oder ob<br />
sie versuchen sollen, ein neues Gleich-<br />
INPREKORR 468/469 5
ITALIEN<br />
Salvatore Cannavó<br />
gewicht herzustellen. Während Emma<br />
Marcegaglia <strong>als</strong> gegenwärtige Präsidentin<br />
der Confindustria weiterhin das bestehende<br />
soziale Gefüge aus den Angeln<br />
heben will, sucht deren Expräsident Luca<br />
Cordero de Montezemolo nach neuen<br />
Wegen. <strong>Die</strong> Divergenzen zwischen<br />
den beiden sind im Grunde charakteristisch<br />
für diese Verunsicherung. Auch<br />
wenn in der Krise deutlich wird, dass<br />
das System Berlusconi eigentlich über<br />
keine plausible Option verfügt sondern<br />
selbst in der Krise steckt und sich verschlissen<br />
hat, verfügt Berlusconi trotzdem<br />
noch über eine hohe soziale Akzeptanz<br />
und kann sich durch das Bündnis<br />
mit der Lega Nord sicher sein, erneut<br />
die Wahlen zu gewinnen. <strong>Die</strong>s macht<br />
die Situation für die Herrschenden problematisch<br />
und erzeugt Verunsicherung.<br />
Nichtsdestoweniger schreitet die Offensive<br />
gegen die Lohnabhängigen unvermindert<br />
voran. Fiat hat die Krise und die<br />
Verunsicherung der Beschäftigten ausgenutzt,<br />
um den Flächentarifvertrag zu<br />
kündigen und Hausverträge mit den Gewerkschaften<br />
auszuhandeln. <strong>Die</strong> Regierung<br />
unterstützt diese Vorgehensweise,<br />
indem sie eine Reform des Statuto dei<br />
lavoratori, <strong>als</strong>o der arbeitsrechtlichen<br />
Errungenschaften, ins Spiel bringt. <strong>Die</strong><br />
politische Lage wird durch diese Beispiele<br />
verständlicher: die Regierungskrise,<br />
über die man sich natürlich freuen<br />
darf, hat nicht die Handlungsspielräume<br />
der Herrschenden eingeengt, die<br />
eher noch stärker zum Tragen kommen.<br />
Es ist unübersehbar, dass die politische<br />
Opposition auf parlamentarischer, aber<br />
auch außerparlamentarischer Ebene der<br />
Situation nicht gewachsen ist. <strong>Die</strong> Konfusion<br />
und Verunsicherung der Pd (Demokratische<br />
Partei, Mitte-Links) sind<br />
Ausdruck nicht nur der internen irreversiblen<br />
Zerwürfnisse sondern auch davon,<br />
dass sich die Partei vollständig der<br />
Logik der Krise unterwirft und diese akzeptiert.<br />
So hat sie sich beispielsweise<br />
bei der parlamentarischen Abstimmung<br />
über den europäischen „Rettungsplan“<br />
für Griechenland, der die bis dato härtesten<br />
Angriffe auf die Lohnabhängigen<br />
dieses Landes beinhaltet, am meisten<br />
von allen Parteien für dessen Annahme<br />
stark gemacht. <strong>Die</strong>ses „europäische<br />
Denken“ – ohne Einschränkung<br />
und unternehmerfreundlich – ist ihr inzwischen<br />
in Fleisch und Blut übergegangen,<br />
und so nimmt es nicht wunder,<br />
dass sie trotz der schwierigen Lage<br />
Berlusconis keine Wähler zurückgewinnt<br />
und keine vorwärtstreibende Rolle<br />
in der Politik des Landes spielt.<br />
Zu dem Unvermögen der „demokratischen“<br />
Opposition kommt die Haltung<br />
weiter Teile der Gewerkschaften hinzu,<br />
die den Unternehmern bei ihrer Offensive<br />
noch sekundieren. Fiat ist dabei,<br />
den Flächentarifvertrag zu torpedieren,<br />
spaltet darüber Beschäftigte und<br />
Gewerkschaften und schafft sich somit<br />
freie Bahn in den Betrieben, um die Arbeiterrechte<br />
noch hinter den Stand von<br />
1968/69 zurück zu drängen. Dahinter<br />
stecken die internationale Ausrichtung<br />
des Unternehmens nach dem Einstieg<br />
bei Chrysler und der daraus entstehende<br />
Handlungsdruck, der zwangsläufig<br />
zu Lasten der Beschäftigten geht.<br />
Durch diese Offensive macht sich Fiat<br />
zum Vorreiter der italienischen Unternehmer<br />
und genießt dabei die aktive<br />
Unterstützung der Regierung, aber auch<br />
der beiden kleineren Gewerkschaften<br />
Cisl und Uil, die zusammen sechs Millionen<br />
Mitglieder haben. <strong>Die</strong> Cgil, der<br />
allein fünf Millionen angehören, leistet<br />
bisher noch Widerstand – aber mit wenig<br />
Nachdruck und nur, weil sie unter<br />
dem Druck der Metallergewerkschaft<br />
Fiom steht, in der die Linke dominiert<br />
und die Gegenwehr trägt. Und eben die<br />
Fiom hat die wichtigste öffentliche Aktion<br />
in diesem Herbst anberaumt, nämlich<br />
eine landesweite Demonstration am<br />
16. Oktober, zu der die gesamte radikale<br />
Linke Italiens aufgerufen hat.<br />
Vor diesem Hintergrund lautet das<br />
Gebot der Stunde, den Widerstand gegen<br />
die Abwälzung der Krisenlasten<br />
aufzubauen und eine Einheit im Kampf<br />
und die sozialen Bewegungen wiederherzustellen.<br />
Daher werden wir uns in<br />
den kommenden Monaten dafür einsetzen,<br />
die Kämpfe stärker untereinander<br />
zu koordinieren, dabei auch autonome<br />
Aktionen zu fördern, einheitliche Komitees<br />
gegen die Krise aufzubauen und gemeinsame<br />
Strukturen zwischen den Gewerkschaftslinken<br />
und anderen Aktiven<br />
– bspw. unter den Studierenden und<br />
Auszubildenden in prekären Verhältnissen<br />
– auf den Weg zu bringen. Zu diesem<br />
Behufe ist die Demonstration am<br />
16. Oktober ein wichtiger Meilenstein.<br />
Auf der strikt politischen Ebene wird<br />
sich leider vorerst wenig in diese Richtung<br />
bewegen lassen. <strong>Die</strong> Mitte-Links-<br />
Parteien offenbaren hier einmal mehr,<br />
dass sie den politischen Herausforderungen<br />
nicht gewachsen sind und der<br />
Entwicklung hinterher hinken. <strong>Die</strong> Pd<br />
macht sich mal wieder für eine Neuauflage<br />
des „Ulivo“ stark, <strong>als</strong> treibende<br />
Kraft einer Koalition, die nicht nur die<br />
(christdemokratische) Udc von Casini,<br />
sondern auch die neue Partei von Fini<br />
umfassen könnte. Eine völlig defensive<br />
und elektoralistische Herangehensweise,<br />
deren sozialer Gehalt ganz in der Tradition<br />
der Mitte-Links-Regierung steht.<br />
Was die Mehrheit der radikal linken<br />
Kräfte anbelangt, haben sie sich schon<br />
für ein Bündnis mit der Pd entschieden.<br />
Auf der einen Seite strebt die „Sinistra<br />
ecologia e Libertà“ (Ökologische Linke<br />
und Freiheit – SeL), die von Nichi Vendola<br />
– inzwischen zu einer sehr populären<br />
Führungsfigur avanciert – abhängige<br />
Formation sogar die Kandidatur für<br />
das Premierministeramt an. <strong>Die</strong> Überbleibsel<br />
der PRC 3 arbeiten auf ein Wahl-<br />
3 <strong>Die</strong> PRC (Partei der kommunistischen Wiedergründung)<br />
erlebte 2009 ihre jüngste Spaltung.<br />
<strong>Die</strong> Bertinotti-Strömung ist ausgetreten und hat<br />
Sinistra ecologia e Libertà gegründet, die ihre<br />
Identität auf der Popularität von Nichi Vendola,<br />
dem Präsidenten der Region Apulien, gründet.<br />
<strong>Die</strong>se Organisation, in die auch ein Teil der Grünen<br />
und eine Linksabspaltung von der Pd eingetreten<br />
sind, kann mit ca. 5% der Stimmen rechnen.<br />
Rifondazione selbst hat mit der Pdci – einer<br />
ehemaligen Rechtsabspaltung von ihr – die Föderation<br />
der Linken gegründet und wird auf 2%<br />
der Wahlstimmen veranschlagt. <strong>Die</strong> Föderation<br />
paktiert in nahezu allen Regionen mit der Pd,<br />
wo diese an der Regierung ist. Außer Sinistra<br />
Critica, die bei den letzten Parlamentswahlen<br />
0,5% erreicht hat, gibt es auf der extremen Linken<br />
noch die Kommunistische Arbeiterpartei<br />
(Pcdl) von Marco Ferrando. Sie hat bei den letzten<br />
Wahlen 0,6% erzielt und bereits erklärt, eine<br />
eigene Liste bei den kommenden Wahlen aufstellen<br />
zu wollen.<br />
6 INPREKORR 468/469
ITALIEN<br />
bündnis hin, das ihnen den Wiedereinzug<br />
ins Parlament ermöglichen soll. Wegen<br />
des italienischen Wahlrechts liefe<br />
ein solches Bündnis auf die Unterstützung<br />
der Pd <strong>als</strong> Spitzenkandidat hinaus,<br />
was de facto ein Verzicht auf eigenständige<br />
politische Ziele beinhaltet. Möglicherweise<br />
entsteht daraus ein „Demokratisches<br />
Bündnis“ mit noch unklaren<br />
Konturen.<br />
Für uns steht nach wie vor – auch<br />
unter schwierigen Bedingungen – auf<br />
der Tagesordnung, eine klassenkämpferische<br />
Linke <strong>als</strong> Alternative zu Pd und<br />
Mitte-Links aufzubauen. Eine antikapitalistische<br />
Linke auf der Grundlage bestimmter<br />
Eckpunkte: keine „demokratische“<br />
Koalition unter Führung der Pd;<br />
ein radikales Programm zur Krisenbewältigung;<br />
eine zukunftsorientierte Perspektive,<br />
die frei von den nostalgischen<br />
Zügen ist, von denen die klassenkämpferische<br />
Linke Italiens noch immer<br />
durchdrungen ist, und die umgekehrt in<br />
der Lage ist, eine erfindungsreiche politische<br />
Alternative anzubieten; ein Anziehungspunkt<br />
für soziale Bewegungen,<br />
Streikkomitees und v. a. die jüngere Generation,<br />
die für sozialen Widerstand<br />
und alternative Politik empfänglicher ist.<br />
Im Falle vorgezogener Neuwahlen, aber<br />
auch in Hinblick auf die Kommunalwahlen<br />
im nächsten Frühjahr, beabsichtigen<br />
wir, an der Entstehung einer antikapitalistischen<br />
Liste mit den genannten<br />
Charakteristika mitzuwirken. Unser Anliegen<br />
ist nicht, das Fähnlein von Sinistra<br />
Critica hochzuhalten und unsere Eigenkandidatur<br />
zu propagieren. Wir wollen<br />
einen Prozess in Gang setzen, der in<br />
ein attraktives, phantasievolles und im<br />
Kampf nützliches Projekt einmündet<br />
und die Erfahrungen der Kämpfe und<br />
die Impulse der jüngeren Generation<br />
aufgreift. Mit diesem Vorschlag werden<br />
wir uns an alle geeigneten politischen<br />
und sozialen Kräfte wenden, um dafür<br />
einzutreten, dass unser Leben mehr wert<br />
ist <strong>als</strong> deren Profite.<br />
Salvatore Cannavò gehört dem Büro der IV. Internationale<br />
und der Leitung der italienischen<br />
Organisation Sinistra Critica (Kritische Linke)<br />
an, die auf ihrer nationalen Konferenz im<br />
November 2009 beschlossen hat, Beziehungen<br />
der „politischen Solidarität“ zur IV. Internationale<br />
aufzunehmen und in sie ihre eigene historische<br />
Erfahrung einzubringen.<br />
Übersetzung: MiWe<br />
Von der KPI zur<br />
Demokratischen Partei<br />
Lidia Cirillo<br />
<strong>Die</strong> Demokratische Partei (PD) –<br />
Nachfahr der KPI-Mehrheit – hat bei<br />
den Europawahlen vom Juni 2009 gerade<br />
mal 26,13 % der Stimmen erhalten.<br />
Bei den Parlamentswahlen 2008<br />
waren es noch 33,2 % gewesen, schon<br />
dam<strong>als</strong> ein Rückgang um 5 180 000<br />
WählerInnen gegenüber den Wahlen<br />
von 2006, aus denen die Mitte-Links-<br />
Regierung von Romano Prodi hervorgegangen<br />
war. Angeschlagen musste<br />
sie bereits nach zwei Jahren das Feld<br />
für Silvio Berlusconi und seine Mitte-<br />
Rechts-Regierung räumen.<br />
<strong>Die</strong>se Wahlergebnisse spiegeln das<br />
Ausmaß der Krise dieser „Linken“ wider,<br />
sagen aber wenig aus über deren<br />
Beschaffenheit und Dynamik. Aussagefähiger<br />
war da schon die Wahlkampagne<br />
der PD, die überwiegend auf<br />
die Person ihres vorläufigen und wenig<br />
charismatischen Führers Dario<br />
Franceschini zugeschnitten war, indem<br />
die ehemaligen KP-WählerInnen<br />
wiederholt aufgerufen wurden, sich<br />
bei der Wahl nicht zu enthalten. Tatsächlich<br />
war in den Jahren zuvor die<br />
Zahl der NichtwählerInnen immer<br />
mehr gestiegen, was hauptsächlich zu<br />
Lasten der Linken gegangen war. Zum<br />
Teil könnten diese sicherlich wieder<br />
gewonnen werden, sofern eine Wahl<br />
in Zeiten einer starken Polarisierung<br />
stattfindet oder eine Reaktion auf die<br />
Regierungspolitik der Rechten darstellt.<br />
Aber der andere Teil unter ihnen<br />
repräsentiert ein für Italien relativ<br />
neues Phänomen, nämlich dass ein<br />
großer Teil der politisch aktiven Kräfte<br />
in der Gesellschaft sich nicht nur<br />
mit keiner der politischen Parteien<br />
mehr identifiziert, sondern Wahlen<br />
<strong>als</strong> nutzloses und verzichtbares Ritual<br />
empfindet.<br />
Ein weiteres bezeichnendes Charakteristikum<br />
der Wahlkampagne war<br />
das Bemühen, gegen das Medienmonopol<br />
von Silvio Berlusconi anzukämpfen<br />
und Zugang zum Wähler zu<br />
finden. Berlusconi kontrolliert inzwischen<br />
fünf der sechs großen Fernsehsender,<br />
die ihm teils gehören, teils unter<br />
der Kontrolle seiner Regierung stehen.<br />
Auch in dieser Hinsicht wurde<br />
der Wahlkampf nach US-Manier geführt:<br />
der PD-Vorsitzende begab sich<br />
persönlich ins Getümmel verschiedener<br />
Städte, durchquerte sie inmitten<br />
eines kleinen Pulks von Parteigängern<br />
in Trikots mit dem Emblem der Partei<br />
und zeigte Hände schüttelnd sein<br />
Grinsgesicht. Abgesehen von der völligen<br />
Wirkungslosigkeit einer solchen<br />
Kampagne hält sie auch keinem Vergleich<br />
mit der Fähigkeit der Rechten<br />
stand, die WählerInnen direkt an sich<br />
binden zu können.<br />
<strong>Die</strong> PD – und darüber hinaus die<br />
gesamte Linke – leidet unter dem<br />
schwerwiegenden Problem, dass keine<br />
organische Verbindung zu den gesellschaftlichen<br />
Kräften mehr vorhanden<br />
ist. In dieser Hinsicht ist ihnen<br />
die Rechte überlegen, dank der Medien<br />
und anderer Anstalten zur Berieselung<br />
der Gesellschaft, wie der katholischen<br />
Kirche und dem organisierten<br />
Verbrechen. Das heißt natürlich nicht,<br />
dass diese beiden sich mit der Rechten<br />
offen vereinigen oder ihr zu <strong>Die</strong>nsten<br />
stehen. Sie tragen vielmehr auf ihre<br />
jeweilige Weise zu dem „reaktionären<br />
Sumpf“ (Gramsci) bei, der spezifisch<br />
für die konservativen Kräfte der italienischen<br />
Gesellschaft ist.<br />
<strong>Die</strong> organisatorische Krise der alten<br />
KPI lässt sich in wenigen Zahlen<br />
wiedergeben. Im Jahr 1989, <strong>als</strong> die<br />
Partei Namen und Symbol wechselte,<br />
zählte sie noch fast anderthalb Millionen<br />
Mitglieder, wobei sie gegenüber<br />
dem Vorjahr bereits 50 000 verloren<br />
hatte. Ein Jahr nach der Wende waren<br />
weitere 200 000 ausgetreten und 1992<br />
hatte die Partei der Demokratischen<br />
Linken (PDS), wie sie nunmehr hieß,<br />
bloß noch 789 000 Mitglieder, <strong>als</strong>o<br />
halb soviel wie 1989 und lediglich ein<br />
Drittel wie zu der Zeit Enrico Berlin-<br />
INPREKORR 468/469 7
ITALIEN<br />
der Rechten bei einem Teil der Wähler<br />
Abscheu provoziert und nicht weil<br />
diese die politische Theorie und Praxis<br />
der PD teilen oder auch nur kennen<br />
würden. Gleichwohl geht in den Führungskreisen<br />
und innerhalb der Linken<br />
im Allgemeinen die Furcht vor einer<br />
„strukturellen Schwäche“ der Partei<br />
um, zumal die anderen politischen<br />
Formationen nicht fähig scheinen, sie<br />
aktuell zu ersetzen. Allein, dass die<br />
Führung der PD das schlechte Ergebnis<br />
der Europawahlen eher erleichtert<br />
hingenommen hat, spricht Bände und<br />
zeigt, dass ihnen das Ausmaß der Krise<br />
bewusst ist.<br />
Delegierte der PD<br />
guers. 1 Als sich die Partei 2002 nochm<strong>als</strong><br />
in Linksdemokraten (DS) umbenannte,<br />
waren es nur noch 534 000<br />
und seit der Umwandlung zur PD im<br />
Jahr 2007 gibt es gar keine offiziellen<br />
Zahlen mehr. Es ist allgemein bekannt,<br />
dass die Schätzungen hierüber<br />
auf Grundlage der Bescheinigungen<br />
vorgenommen wurden, die an die<br />
Teilnehmer der „Primärwahlen“ über<br />
die Spitzenkandidatur bei den Parlamentswahlen<br />
2006 ausgestellt worden<br />
waren, an denen theoretisch (und<br />
mitunter auch praktisch) gleichermaßen<br />
Mitte-Rechts-WählerInnen teilnehmen<br />
konnten. „Statt um eine flexible<br />
Partei – um einen Slogan von 1989<br />
aufzugreifen – geht es nunmehr um eine<br />
nebulöse Partei“, schreibt Luca Telese<br />
in seiner Analyse über die Mitgliederentwicklung.<br />
2<br />
Bei der Kampagne zu den Europawahlen<br />
2009 schließlich erschien die<br />
Identität der Nachfolgerin der KPI zur<br />
Unkenntlichkeit verblasst. <strong>Die</strong> Rechte<br />
war auf den ersten Blick zu erkennen,<br />
zunächst wegen ihrer Propaganda<br />
gegen die Einwanderer und in zweiter<br />
Linie über die Person ihres Führers,<br />
der den faschistischen Mythos vom<br />
„Mann der Vorsehung“ wiedergab und<br />
1 Enrico Berlinguer war von 1972 bis zu<br />
seinem Tod 1984 Gener<strong>als</strong>ekretär der KPI.<br />
Er löste die KPI aus der Kuratel der UdSSR<br />
und war federführend bei der Entstehung des<br />
„Eurokommunismus“. Unter seiner Führung<br />
erzielte die KPI im Juni 1976 ihr bestes<br />
Wahlergebnis (33,4 % im Parlament und<br />
33,8 % im Senat).<br />
2 Luca Telese: Qualcuno era comunista,<br />
Sperling&Kupfer, 2009, S. 90<br />
sich <strong>als</strong> Macher darstellte, der die Geschicke<br />
des Landes mit dem gleichen<br />
Geschick lenkt, wie er <strong>als</strong> Unternehmer<br />
seine Geschäfte erfolgreich geführt<br />
hat. Hingegen würde sich jemand,<br />
der nicht aufmerksam die Tagespresse<br />
verfolgt hat, schwer getan<br />
haben, etwas über die Positionen der<br />
PD zu sagen. Ebenso über deren Absichten,<br />
zumal die Partei sich anscheinend<br />
selbst nicht darüber im Klaren<br />
ist. Ist sie eine Partei der Mitte, vergleichbar<br />
mit einer weniger korrupten<br />
und klerikalen Christdemokratie?<br />
Oder eine Sozialdemokratie, d. h. eine<br />
Organisation, die sich trotz der unzähligen<br />
Anpassungsmanöver weiterhin<br />
auf die Lohnabhängigen bezieht?<br />
Oder die italienische Variante der Partei<br />
von Kennedy und Obama, wie der<br />
neue Name nahelegt? Damit ist nicht<br />
gemeint, dass solche Überlegungen<br />
ausdrücklich angestellt würden oder<br />
Ausdruck bestimmter Strömungen<br />
wären. <strong>Die</strong>ses Identitätsproblem ist<br />
objektiv vorhanden und die Diskussionen<br />
innerhalb der Parteiführung<br />
thematisieren dies mehr oder minder<br />
klar, bspw. anhand der Mitgliedschaft<br />
in der Sozialdemokratischen Partei<br />
Europas, die bei einem Teil der Partei<br />
auf Widerstand stieß. <strong>Die</strong> Gründung<br />
der Progressiven Allianz der Sozialisten<br />
und Demokraten <strong>als</strong> Gruppe<br />
im Europaparlament hat nur ein aktuelles<br />
Problem beseitigt aber nicht das<br />
viel komplexere der Identität der PD.<br />
Wenn ihr noch immer eine beträchtliche<br />
Wahlunterstützung zuteil<br />
wird, dann nur, weil der Führer<br />
METAMORPHOSE UND IDENTI-<br />
TÄTSKRISE<br />
Um die Gründe für den Zerfall der<br />
größten kommunistischen Partei der<br />
westlichen Welt, die <strong>als</strong> die „nebulöse“<br />
Partei von Dario Franceschini<br />
gestrandet ist, zu benennen, müsste<br />
man auf die Geschichte Europas und<br />
der kommunistischen Bewegung zurückgehen,<br />
was hier zu weit führt. Daher<br />
beschränken wir uns darauf, die<br />
jüngere Entwicklung zu umreißen, die<br />
diese Partei um ihr organisatorisches<br />
Netzwerk gebracht und ihrer Identität<br />
und Selbstsicherheit beraubt hat, sodass<br />
sie jetzt um ihr eigenes Überleben<br />
bangen muss.<br />
Es war am 12. November 1989,<br />
<strong>als</strong> der damalige Gener<strong>als</strong>ekretär der<br />
KPI, Achille Occhetto in der bolognesischen<br />
Sektion kundtat, dass die Partei<br />
ihren Namen ändern müsste. <strong>Die</strong>se<br />
Ankündigung rief einen Aufstand<br />
der Basis hervor, auch wenn diese zuvor<br />
alle Hiobsbotschaften geschluckt<br />
und die Konterkarierung der kommunistischen<br />
Attribute hingenommen<br />
hatte. Am deutlichsten spürbar waren<br />
die Auswirkungen in der Austrittswelle<br />
aus der Partei: gleich 200 000 Austritte<br />
im Jahr danach mit einem anhaltenden<br />
Aderlass in der Folgezeit, wie<br />
oben geschildert. „<strong>Die</strong> Wende“ – wie<br />
sie allgemein bezeichnet wurde – wurde<br />
seither in verschiedener und auch<br />
widersprüchlicher Weise in Biographien,<br />
Autobiographien, Zeitungsartikeln<br />
und Interviews thematisiert. Aber<br />
ungeachtet der persönlichen Färbung<br />
der Darstellung liefern die damaligen<br />
Ereignisse einen deutlichen Einblick<br />
in die Motive dieser Entscheidung.<br />
<strong>Die</strong> Berliner Mauer war gerade ge-<br />
8 INPREKORR 468/469
ITALIEN<br />
fallen, und einige Monate zuvor hatte<br />
das Massaker am Tian’anmen-<br />
Platz Anfang Juni den Kommunismus<br />
von seiner abstoßendsten Seite gezeigt.<br />
In Italien herrschte dam<strong>als</strong> die<br />
„Fünfparteien-Regierung“ 3 , die auf<br />
einem Bündnis zwischen Christdemokratie<br />
und der PSI von Bettino Craxi,<br />
dem Paten und Gönner des Unternehmers<br />
Silvio Berlusconi, gründete.<br />
<strong>Die</strong> Ereignisse in China und Osteuropa<br />
lieferten einen ausgezeichneten<br />
Vorwand, sich auf die KPI einzuschießen,<br />
die schon seit langem unter<br />
dem Druck der intellektuellen und<br />
liberalen SympathisantInnen stand,<br />
Namen und Emblem zu ändern. Zugleich<br />
war dies eine Gelegenheit, sich<br />
mit guten Argumenten von dem gescheiterten<br />
Experiment zu distanzieren<br />
und laut zu beanspruchen, nicht<br />
damit in einen Topf geworfen zu werden.<br />
Es mangelte noch nicht einmal an<br />
einschlägigen Leninzitaten, und hatte<br />
nicht der Führer der Oktoberrevolution<br />
selbst umstandslos den Namen seiner<br />
Partei aus viel geringeren Gründen<br />
<strong>als</strong> den Schandtaten von Stalin,<br />
Pol Pot oder Ceausescu gewechselt?<br />
In der 1991 gegründeten PDS<br />
tobten Grabenkämpfe, ob sie sich<br />
<strong>als</strong> sozialdemokratisch, „Kennedylike“<br />
oder einfach <strong>als</strong> „neu“ verstehen<br />
sollte. Durch den Zusammenschluss<br />
mit Splittern – hauptsächlich<br />
– der ehemaligen Christdemokratie<br />
und PSI entstand 1998 die DS. Und<br />
2007 wurde daraus durch die Fusion<br />
mit einer Partei der Mitte – der Margherita<br />
von Romano Prodi – die PD,<br />
<strong>als</strong> deren Vorsitzender Walter Veltroni<br />
aus Primärwahlen hervorging. Bei<br />
dieser Gelegenheit schlossen sich weitere<br />
Grüppchen und Einzelpersonen<br />
aus der vorm<strong>als</strong> christdemokratischen<br />
Seilschaft an, um Mandatspöstchen zu<br />
ergattern und wieder einer „richtigen“<br />
Partei anzugehören. Aber mit diesen<br />
Wandlungen allein und dem Beitritt<br />
einzelner Fragmente oder auch <strong>ganze</strong>r<br />
Parteien der Mitte lässt sich die Identitätskrise<br />
nicht vollständig erklären.<br />
<strong>Die</strong> Identität einer Partei beruht vielmehr<br />
auf ihrer politischen Praxis …<br />
3 <strong>Die</strong>ser Ausdruck bezeichnet die<br />
Regierungskoalition in Italien 1980–1992, die<br />
aus fünf Parteien bestand: der Christdemokratie<br />
(DC), der Sozialistischen Partei Italiens (PSI),<br />
der Italienischen Sozialdemokratischen Partei<br />
(PSDI), der Italienischen Republikanischen<br />
Partei (PRI) und der Italienischen Liberalen<br />
Partei (PLI)<br />
Von der KPI zur Demokratischen Partei<br />
und genau darin liegt der Schwachpunkt<br />
der PD.<br />
Im Jahr 1996 gelang die Bildung einer<br />
Mitte-Links-Regierung, da sie <strong>als</strong><br />
Hüter des Sozi<strong>als</strong>taats auftreten konnte,<br />
der in der ersten Amtszeit Berlusconis<br />
ab 1994 bereits unter Beschuss<br />
geraten war. <strong>Die</strong>ses Image ging durch<br />
die politische Praxis der zweimaligen<br />
Mitte-Links-Regierung (1996–2001<br />
und 2006–2008) über Bord. <strong>Die</strong> PD<br />
gilt noch nicht einmal <strong>als</strong> eine liberale<br />
Partei, die die bürgerlichen Rechte<br />
garantiert: <strong>Die</strong> im Verlauf der Metamorphose<br />
absorbierten katholischen<br />
Gruppierungen konnten verhindern,<br />
dass in der zweiten Amtszeit Prodi<br />
die Rechte der Homo- und Transsexuellen<br />
anerkannt wurden, und sogar<br />
ein harmloses Gesetz gegen Homophobie<br />
erfolgreich blockieren. <strong>Die</strong> PD<br />
war aber nicht nur an der Regierung<br />
wenig erfolgreich, auch <strong>als</strong> Oppositionspartei<br />
tut sie sich schwer. Sie kann<br />
nicht die Rechte auf deren ureigenen<br />
Terrain ausstechen, auch wenn es an<br />
derlei Versuchen nicht gefehlt hat. Der<br />
Rassismus und das Spiel mit den Ängsten<br />
seitens der italienischen Rechten<br />
überschreiten in der Tat für gemäßigte<br />
Kräfte die Grenzen des Hinnehmbaren<br />
und selbst die katholische Amtskirche<br />
hat mehrere Male interveniert und zu<br />
Gemeinsinn und Mäßigung aufgerufen.<br />
<strong>Die</strong> PD kann die politische Auseinandersetzung<br />
auch nicht einfach umbiegen<br />
und sich zum Sachwalter der<br />
Rechte der Lohnabhängigen machen,<br />
da sich sämtliche Parteiflügel einschließlich<br />
der Ex-KPI für die „wirtschaftliche<br />
Entwicklung“ und die Interessen<br />
der „produktiven Schichten“<br />
(wie in der PD die Klein- und Großunternehmer<br />
genannt werden) stark machen.<br />
Außerdem kommt angesichts<br />
der Wirtschaftskrise ein Selbstverständnis,<br />
das auf Maßhalten und Geduld<br />
(das Wort „geduldig“ ist das<br />
von Veltroni meist gebrauchte) setzt,<br />
schlecht an beim Volk, das zu Recht in<br />
Wallung ist, aber von der Rechten gegen<br />
die ImmigrantInnen <strong>als</strong> Sündenbock<br />
aufgewiegelt wird.<br />
DER TIEFGREIFENDE WANDEL<br />
DER ITALIENISCHEN GESELL-<br />
SCHAFT<br />
<strong>Die</strong> damalige KP und ihre Nachfolger<br />
haben die Umbrüche und Transformationsprozesse<br />
der Gesellschaftsstruktur<br />
mitgemacht, ohne recht zu verstehen,<br />
was vor sich ging. In ihren Augen<br />
war das Ende des dreißigjährigen<br />
Wirtschaftswachstums (1945–1975)<br />
eine Konjunkturkrise. Den Prozess<br />
der Globalisierung und Finanzialisierung<br />
(Kasino-Kapitalismus) haben sie<br />
<strong>als</strong> Bestätigung der unbeugsamen Vitalität<br />
des Kapitalismus begriffen und<br />
überhaupt nicht wahrgenommen, welche<br />
Destruktivkraft in der Offensive<br />
des Kapit<strong>als</strong> gegen die Lohnabhängigen<br />
steckt. Natürlich ging es nicht in<br />
erster Linie um die mangelnde Auffassungsgabe,<br />
sondern KPI, PDS,DS<br />
und PD haben nacheinander genau die<br />
Rolle gespielt wie die Sozialdemokratie<br />
im übrigen Europa und aktiv an der<br />
Niederlage der Lohnabhängigen mitgewirkt.<br />
Im Lauf der letzten Jahrzehnte sind<br />
die Bindungen der Partei an die unteren<br />
Schichten, die sich bereits während<br />
der 80er Jahre gelockert hatten,<br />
völlig zerrissen. Wie überall haben<br />
in Italien die Niederlagen, die Prekarisierung,<br />
das Outsourcing etc. dazu<br />
beigetragen, das Terrain zu destabilisieren,<br />
in dem die KPI verwurzelt<br />
war. Aber mehr <strong>als</strong> sonstwo hat in Ita-<br />
INPREKORR 468/469 9
ITALIEN<br />
lien die Krise der Großfabriken die<br />
Reorganisierung der Lohnabhängigen<br />
in jeder Form erschwert. Als es Ende<br />
der 60er Jahre einen starken Anstieg<br />
der Arbeiterkämpfe gab, verfügte Italien<br />
über ein Netz von Industriekomplexen,<br />
das zu den größten in Europa<br />
zählte und bis Mitte der 80er Jahre<br />
zum Ausgangspunkt der sozialen<br />
Kämpfe wurde. Aber um diese großen<br />
Fabriken herum siedeln sich kleine<br />
und kleinste Unternehmen an, die oft<br />
unter dem Druck stehen, sich an Fiskus,<br />
gesetzlichen Auflagen und Konflikten<br />
mit den Gewerkschaften vorbei<br />
zu lavieren. Nachdem die großen<br />
Fabriken geschlossen worden sind, ist<br />
das <strong>ganze</strong> Gefüge auseinander gebrochen<br />
und zerfallen, wodurch die Konsequenzen<br />
dieser ansonsten universalen<br />
Entwicklung für Italien besonders<br />
schwerwiegend waren.<br />
Wie überall hat in Italien der systematische<br />
Abbau der tariflichen Arbeitsplätze<br />
die Gewerkschaften geschwächt,<br />
auch wenn die CGIL in gewissem<br />
Maß weiterhin handlungsfähig<br />
ist und über sie die PD noch über<br />
indirekten Zugang zu den unteren<br />
Schichten verfügt.<br />
Stärker <strong>als</strong> in anderen Ländern hat<br />
die Krise der italienischen Gewerkschaften<br />
irreparable Schäden hinterlassen.<br />
Nach 1969 waren die Gewerkschaften<br />
knapp zwanzig Jahre lang<br />
in Form von Räten, die von den ArbeiterInnen<br />
gewählt wurden, organisiert<br />
und diese Räte waren von fundamentaler<br />
Bedeutung in den Zeiten<br />
der großen Kämpfe und Widerstandsaktionen.<br />
Der Niedergang und das<br />
schließliche Ende des „Rätesyndikalismus“<br />
waren nicht nur die Folge sondern<br />
zugleich die Ursache der Zersetzung<br />
der sozialen Strukturen. <strong>Die</strong> Arbeiterklasse<br />
in den großen Fabriken<br />
(Fiat, Alfa Romeo, It<strong>als</strong>ider etc.) erlitt<br />
eine entscheidende Niederlage gegen<br />
die Unternehmer, weil eben die<br />
Räte die Kraftprobe mit der Gewerkschaftsbürokratie<br />
verloren haben. Wie<br />
sehr sich die Bürokratie – und leider<br />
sie allein – der Bedeutung dieses Konflikts<br />
voll bewusst war, davon zeugt<br />
die Lektüre der damaligen Gewerkschaftspresse.<br />
DER STRUKTURELLE WANDEL<br />
DES PARTEIMODELLS<br />
<strong>Die</strong> Aufspaltung und Streuung der<br />
Lohnabhängigen erschweren deren<br />
Reorganisierung in jeder Hinsicht.<br />
Aber jenseits dieser objektiven<br />
Schwierigkeiten stellt sich die PD<br />
gar nicht erst den Problemen, zu deren<br />
Lösung sie strukturell unfähig ist.<br />
Und dieser Umstand verdammt die<br />
linken Kräfte innerhalb der Organisation<br />
zu ewigem Verlieren. Sie waren<br />
sich zwar oft darüber im Klaren,<br />
welcher Voraussetzungen es bedurfte,<br />
um den Verfall der sozialen Kräfteverhältnisse<br />
aufzuhalten, aber sie richteten<br />
sich damit an eine Partei, die weder<br />
fähig noch willens war, sich damit<br />
aufzuhalten.<br />
Seit 1997 ist die Bildung von Strömungen<br />
innerhalb der Partei erlaubt.<br />
Aber da gibt es Überschneidungen<br />
und Vermischungen mit anderen Interessenssphären,<br />
wo es um Macht geht.<br />
<strong>Die</strong> vorm<strong>als</strong> monolithische Partei hat<br />
einen zunehmenden Balkanisierungsprozess<br />
durchgemacht, in dem führende<br />
Mitglieder eine Entourage von<br />
Zeitungen, Magazinen, Stiftungen,<br />
Verbänden etc. schaffen, um Karriere<br />
zu machen. <strong>Die</strong>ser Mechanismus<br />
erinnert an die „Notabeln“ in der früheren<br />
Christdemokratie, in der bestimmte<br />
Personen die Mitgliedschaften<br />
und die Klientel kontrollierten. Allerdings<br />
verhält es sich nicht so, dass<br />
für diese Zustände in der PD v. a. die<br />
ehemaligen Christdemokraten verantwortlich<br />
wären. Überwiegend handelt<br />
es sich dabei um einen substantiellen<br />
Umwandlungsprozess innerhalb der<br />
Bürokratie der KPI, der in gewisser<br />
Weise mit dem der ehemaligen Nomenklatura<br />
in Osteuropa vergleichbar<br />
ist. <strong>Die</strong> immerwährende Anpassung<br />
an das bestehende politische und soziale<br />
Umfeld und die Auswahlkriterien<br />
für den Führungsnachwuchs haben eine<br />
Politikerkaste herangezüchtet, die<br />
von primitiven materiellen Motiven<br />
und starken Partikularinteressen umgetrieben<br />
wird. <strong>Die</strong>se Führer, die in<br />
erster Linie um Posten in Partei und<br />
Institutionen schachern, haben absolut<br />
kein Interesse, sich mit der undankbaren<br />
und ungewissen Aufgabe zu befassen,<br />
die Arbeiterbewegung wieder<br />
aufzubauen. Indem das traditionelle<br />
Modell des Parteikaders quasi ausgestorben<br />
ist, ist auch das unerlässliche<br />
Bindeglied zwischen Parteiapparat<br />
und Gesellschaft verschwunden. Zwar<br />
verfügt die PD noch immer über Sektionen,<br />
aber die fungieren <strong>als</strong> Wahlkomitees<br />
und sind weit weniger effizient<br />
<strong>als</strong> in der Vergangenheit.<br />
Dennoch bleibt es der PD unbenommen,<br />
dass sie noch immer in der<br />
Lage ist, Massen zu vereinen, Primärwahlen<br />
mit hunderttausenden von<br />
Teilnehmern durchzuführen und zu<br />
Massenkundgebungen aufzurufen.<br />
Aber dies sind Ausnahmeereignisse<br />
und das teilnehmende undifferenzierte<br />
„Volk“ aus Mitgliedern und SympathisantInnen<br />
bleibt bis zur nächsten<br />
Veranstaltung passiv.<br />
EINE ANDERE GESCHICHTE<br />
Um den Abgesang der KPI wirklich zu<br />
verstehen, müsste auch auf diejenigen<br />
eingegangen werden, die die „Wende“<br />
abgelehnt und die Partei der Kommunistischen<br />
Wiedergründung (PRC) gegründet<br />
haben. <strong>Die</strong>ses Thema hätte eine<br />
lange Serie von Spaltungen, Ausschlüssen<br />
und Brüchen zum Inhalt.<br />
Das Erbe der KPI teilen sich gegenwärtig<br />
diejenigen, die den Namen<br />
der PRC beibehalten haben, und diejenigen,<br />
die dem ehemaligen Parteivorsitzenden<br />
Fausto Bertinotti gefolgt<br />
sind und die Sinistra ecologia e Libertà<br />
(SeL) gegründet haben. Auch wenn<br />
sich deren Geschichte von der der PD<br />
unterscheidet, ähneln sich die Ergebnisse<br />
ziemlich: Misserfolge bei den<br />
Wahlen (weder PRC noch SeL konnten<br />
Sitze im italienischen oder europäischen<br />
Parlament erringen), ambivalente<br />
Haltung gegenüber den Interessen<br />
der Arbeiterklasse, Hammer und<br />
Sichel – ja oder nein, mangelnde soziale<br />
Verankerung, innere Zersplitterung,<br />
Aufweichung der Kaderstrukturen, interne<br />
Machtkämpfe, Pöstchenjägerei.<br />
Lidia Cirillo, Mitglied der nationalen Koordination<br />
von Sinistra Critica und Redakteurin<br />
der Zeitschrift ERRE. Mitglied der IV. Internationale<br />
seit 1966, Mitbegründerin des Weltfrauenmarsches<br />
in Italien und Gründerin der<br />
feministischen Zeitschrift QUADERNI VIO-<br />
LA. Verfasserin zahlreicher Werke.<br />
Übersetzung: MiWe<br />
10 INPREKORR 468/469
SPANIEN<br />
Der Beginn einer neuen Etappe<br />
Lluís Rabell<br />
Es wäre unnütz, einige Tage vorher,<br />
über die Beteiligung am Gener<strong>als</strong>treik<br />
zu spekulieren. Aber unabhängig davon,<br />
was letztendlich an diesem Gener<strong>als</strong>treik<br />
erfolgreich sein wird und<br />
wo sich seine Grenzen zeigen werden,<br />
bleibt eine Sache auch schon vorher<br />
sicher feststellbar: <strong>Die</strong>ser Aufruf<br />
der Gewerkschaften beendet einen<br />
langen Abschnitt ziemlich ruhiger<br />
gesellschaftlicher Beziehungen<br />
im Spanischen Staat und führt uns in<br />
eine neue, vermutlich unruhigere und<br />
ungewissere Etappe, die die aus der<br />
Transición 1 geerbten wirtschaftlichen<br />
Grundmodelle genauso wie die politischen<br />
Einrichtungen <strong>als</strong> auch den organisatorischen<br />
Rahmen der Arbeiterbewegung<br />
zur Disposition stellt.<br />
<strong>Die</strong> Krise des globalisierten Kapitalismus<br />
schlug in der spanischen<br />
Ökonomie, deren Parameter in Europa<br />
am glaubwürdigsten durch diese<br />
Globalisierung geformt worden waren,<br />
besonders heftig ein. Das „wunderbare“<br />
Modell des spanischen Wirtschaftswachstums<br />
– 2008 konnte Zapatero<br />
sogar verwegen behaupten,<br />
dass „wir in der Champions League<br />
der Weltwirtschaft spielen“ – kollabierte<br />
sprichwörtlich im Strudel der<br />
von der Wall Street ausgehenden Finanzkrise.<br />
Eigentlich basierte die spanische<br />
Wirtschaft auf einer gigantischen<br />
Spekulationsblase im Immobiliensektor,<br />
die Motor des 15jährigen<br />
Wachstums des Bruttoinlandprodukts<br />
gewesen war. <strong>Die</strong> sich daraus ergebende<br />
Konjunktur verhüllte aber die<br />
reale strukturelle Schwäche, die dann<br />
von der Krise gnadenlos enthüllt wurde,<br />
gefolgt von enormen sozialen Verwerfungen.<br />
<strong>Die</strong> Arbeitslosigkeit pendelte<br />
sich bei rund 20 % der erwerbsfähigen<br />
Bevölkerung ein und ist damit<br />
rund doppelt so hoch wie der EU-<br />
Durchschnitt. Rund ein Viertel der<br />
Bevölkerung erfüllt die Lebensbedingungen<br />
der Armut und 1 Million Menschen<br />
überlebt nur durch soziale und<br />
1 Übergangsphase vom Franco-Regime zur<br />
konstitutionellen Monarchie, 1975-1981/82<br />
wohlfahrtstaatliche Hilfen. Nach einigen<br />
Schätzungen werden in den nächsten<br />
18 Monaten rund 350 000 Familien<br />
ihr Haus verlieren, da sie ihre Hypotheken<br />
nicht auslösen können. <strong>Die</strong><br />
Illusion von Wachstum und Reichtum<br />
hat sich endgültig in Luft aufgelöst<br />
und hinterlässt eine bittere Narbe<br />
der Enttäuschung in der Gesellschaft.<br />
EIN GESCHEITERTES MODELL<br />
Es muss festgestellt werden, dass alle<br />
Triebkräfte des neoliberalen spanischen<br />
Modells schon die Keime des<br />
jetzigen Scheiterns beinhalteten. Unter<br />
dem Antrieb der „fortschrittlichen“<br />
Regierungen von Felipe González<br />
passte der Spanische Staat seine Wirtschaft<br />
den Forderungen der europäischen<br />
Bauwirtschaft an. <strong>Die</strong> Schwerindustrien<br />
in staatlicher Hand – Schiffbau,<br />
Metallverarbeitung, Teile des<br />
Bergbaus … – wurden seit den 1980er<br />
Jahren geschliffen. Das Land verwandelte<br />
sich in eine Spielwiese für die<br />
großen multinationalen Unternehmen,<br />
deren Investitionen durch zahlreiche<br />
administrative Anreize und Erleichterungen<br />
begünstigt wurden. Durch<br />
diese Rahmenbedingungen blühte ein<br />
dichtes Netz von Zulieferfirmen – immer<br />
abhängig von den Entscheidungen<br />
der großen Wirtschaftsunternehmen.<br />
Während des Höhepunkts dieser neoliberalen<br />
Politik in den 1990er Jahren<br />
und massiv unterstützt durch die konservative<br />
Regierung Aznars wurden<br />
die zentralen Sektoren im Energieund<br />
Kommunikationsbereich privatisiert.<br />
Das neu geschriebene Bodengesetz<br />
verwandelte das gesamte Territorium<br />
in Bauland und entfesselte eine<br />
Expansion des Immobilienmarktes,<br />
die keine Grenzen zu kennen schien.<br />
In den 20 Jahren vor der jetzigen Wirtschaftskrise<br />
wurde z. B. in Katalonien<br />
mehr gebaut <strong>als</strong> in der gesamten Zeit<br />
von der römischen Antike bis zum Ende<br />
der Francozeit. In dieser Zeit wurde<br />
im Spanischen Staat mehr gebaut <strong>als</strong><br />
in Frankreich, Deutschland und Großbritannien<br />
zusammen.<br />
<strong>Die</strong> Folgen dieser unbeschränkten<br />
Entwicklung des Produktionsmodells<br />
in Kombination mit einer strikten<br />
Orientierung zugunsten des Tourismus<br />
und des <strong>Die</strong>nstleistungssektors<br />
insgesamt haben einen tiefgreifenden<br />
Wandel des Landes bewirkt,<br />
der in allen Bereichen spürbar ist. <strong>Die</strong><br />
Städte haben sich weitläufig ausgedehnt.<br />
Das Land wurde durch die unnachhaltige<br />
Bauwut an den Stadträndern<br />
übel zugerichtet. Der Druck dieses<br />
Wachstumsmodells, das Eindringen<br />
der großen multinationalen Handelsunternehmen<br />
und die Ausdehnung<br />
des Agrarhandels – gefördert durch<br />
die EU-Politik – veränderte das Gesicht<br />
der Landschaft grundlegend und<br />
begünstigte den Zuzug der Bevölkerung<br />
in die großen Städte. In Katalonien<br />
ist nur noch 1 % der Bevölkerung<br />
in der Landwirtschaft tätig, im gesamten<br />
Spanischen Staat sind es weniger<br />
<strong>als</strong> 5 %. <strong>Die</strong> Bevölkerungsentwicklung<br />
und die ethnische und kulturelle<br />
Zusammensetzung der Bevölkerung<br />
veränderten sich: Aufgrund der Migration<br />
stieg die Bevölkerung in Katalonien<br />
inerhalb von zehn Jahren von 6<br />
auf 7,5 Millionen Menschen.<br />
<strong>Die</strong>se Jahre der Veränderung der<br />
wirtschaftlichen und sozialen Situation<br />
des Landes mussten jedoch zwangsläufig<br />
zu signifikanten Änderungen in<br />
den Arbeitsbeziehungen und den Bedingungen<br />
der Arbeiterbewegung führen.<br />
Von den unterschiedlichen Regierungen<br />
wurden wirtschaftliche Liberalisierungsmaßnahmen<br />
durchgeführt,<br />
die die durch die Arbeiterbewegung<br />
erreichten Errungenschaften<br />
und Rechte untergruben. Durch den<br />
machtvollen, von den Gewerkschaften<br />
CCOO 2 und UGT 3 ausgerufenen<br />
Gener<strong>als</strong>treik am 14 Dezember 1988<br />
wurde die „sozialistische“ Regierung<br />
von Felipe González gezwungen, ihre<br />
geplanten Arbeitsreformen zurückzuziehen<br />
und stattdessen die Sozial-<br />
2 Gewerkschaft, die der kommunistischen Partei<br />
nahesteht.<br />
3 Gewerkschaft, die der „sozialistischen“ PSOE<br />
nahesteht.<br />
INPREKORR 468/469 11
SPANIEN<br />
Protest vor dem Finanzministerium im Madrid: Angestellte des öffentlichen <strong>Die</strong>nstes im<br />
Streik (8.6.2010)<br />
ausgaben in den folgenden Jahren zu<br />
erhöhen, die dam<strong>als</strong> deutlich unter<br />
dem europäischen Durchschnitt lagen.<br />
Trotzdem gelang es der neoliberalen<br />
Politik seit den 1990er Jahren, die Arbeitsschutzrechte<br />
und die Löhne abzubauen.<br />
Nach dem wenig erfolgreichen<br />
Gener<strong>als</strong>treik 1994 begann in diesen<br />
Gewerkschaften erneut eine Dynamik<br />
der Sozialpartnerschaft und zurückhaltenden<br />
Taktik, wie sie seit 1977 sowohl<br />
unter rechten wie linken Regierungen<br />
üblich war. Lediglich der Gener<strong>als</strong>treik<br />
im Juni 2002 gegen eine<br />
Gesetzesreform der zu diesem Zeitpunkt<br />
schon unbeliebten Aznar-Regierung,<br />
die die Rechte der Arbeitslosen<br />
beschneiden wollte, unterbrach diese<br />
Politik des „sozialen Friedens“.<br />
<strong>Die</strong> letzten 15 Jahre waren entscheidend,<br />
da sie einen Prekarisierungsprozess<br />
in den Arbeitsverträgen,<br />
sowohl im privatwirtschaftlichen<br />
wie auch im staatlichen Sektor,<br />
und die Vertiefung der sozialen Ungleichheit<br />
mit der Illusion des trickle<br />
down des Reichtums verbunden haben.<br />
<strong>Die</strong> spanische Wirtschaft hat mit<br />
gut 2 Millionen Arbeitslosen <strong>als</strong> Sockel<br />
ein beachtliches Niveau struktureller<br />
Arbeitslosigkeit. <strong>Die</strong> Wirtschaft<br />
war durch Schwankungen geprägt.<br />
<strong>Die</strong> Arbeitsplätze verwandelten sich<br />
in unsichere Stellen, unvorhersehbare<br />
Kündigungen nahmen zu. Aber<br />
dank der Nachfrage im Bauwesen<br />
und <strong>Die</strong>nstleistungssektor gab es eine<br />
feste Nachfrage nach Arbeitskräften.<br />
<strong>Die</strong> Charakteristiken dieser beiden<br />
Sektoren erklären auch die Nachfrage<br />
nach MigrantInnen, die zugleich<br />
beschimpft wie benötigt werden. <strong>Die</strong><br />
Gehälter verloren an Kaufkraft. Aber<br />
die Kredite waren günstig – und durch<br />
die Banken wie die öffentliche Hand<br />
propagiert – und erlaubten den Familien<br />
ein Konsumniveau aufrecht zu erhalten,<br />
das nicht mehr mit ihren Einkünften<br />
übereinstimmte. In Spanien<br />
kam es zu einem ähnlichen Phänomen<br />
wie im US-amerikanischen Immobiliensektor.<br />
So etwas Ähnliches wie Sozialbauwohnungen<br />
gibt es nicht. <strong>Die</strong><br />
Regierungen förderten das Geschäft<br />
der Banken und Baufirmen, indem sie<br />
den hypothekengestützten Kauf von<br />
Wohnungen und Häusern durch die<br />
Begünstigung der Kreditabschlüsse<br />
mittels Steuernachlässen anstachelten.<br />
Parallel dazu und trotz des Wachstums<br />
des BIP blieben die öffentlichen <strong>Ausgabe</strong>n<br />
für Bildung, Gesundheit und<br />
Sozialversorgung weiterhin 9 Punkte<br />
unter dem Mittel des „Europa der 15“.<br />
Alles in allem wurde eine schadhafte<br />
Realität des Sozialgefüges hinter der<br />
Fassade einer Scheinprosperität verborgen.<br />
DIE AUSWIRKUNGEN DER<br />
KRISE<br />
<strong>Die</strong>ser Abbau des Arbeitsmarktes und<br />
die Zerbrechlichkeit der spanischen<br />
Wirtschaftsstruktur erklären die blitzschnellen<br />
Auswirkungen der Krise. Im<br />
Herbst 2008 gab es eine Welle von Firmenschließungen<br />
und Belegschaftsreduzierungen<br />
– mit Pirelli oder Nissan<br />
<strong>als</strong> besonders auffälligen Beispielen.<br />
<strong>Die</strong> Antwort der Gewerkschaften<br />
war, jeden Fall einzeln zu verhandeln.<br />
Gleichzeitig reklamierten sie vergeblich<br />
auf nationaler Ebene einen sozialen<br />
Dialog mit den Kapitalverbänden<br />
und der Regierung, um gemeinsam<br />
die Krise zu meistern. Gleichwohl war<br />
die Mehrzahl der neuen Arbeitslosen<br />
nicht Opfer der Auswirkungen der Regulierungsgesetze<br />
[ERE: spanisches<br />
Gesetz, das in Krisenzeiten außerordentliche<br />
Kündigungen ermöglicht],<br />
sondern sie stammten aus prekären<br />
Arbeitsverträgen, die nun nicht<br />
erneuert wurden und des Pleitegehens<br />
der zahlreichen „selbständigen“<br />
ArbeiterInnen. Das Bauwesen kam<br />
über Nacht zum Erliegen und hinterließ<br />
über eine Million neue und unverkaufte<br />
Wohnungen und Häuser. <strong>Die</strong><br />
Kredite versiegten und dies beschleunigte<br />
den Zusammenbruch von tausenden<br />
kleinen Firmen und Geschäften.<br />
<strong>Die</strong> Bank von Spanien ist ein besonderer<br />
Fall: sowohl durch ihren entscheidenden<br />
Einfluss in der Politik,<br />
<strong>als</strong> auch aufgrund der unglaublichen<br />
Privilegien, die sie genießt. Es reicht<br />
zu erwähnen, dass im Falle der Zahlungsunfähigkeit<br />
die Banken nicht nur<br />
die Zwangsräumung der Familien erreichen,<br />
sondern auf den Versteigerungen<br />
trickreich auch die Wohnung<br />
– und dies meistens zu halbem Preis<br />
– und dann noch den Rest der Hypothekenschuld<br />
versuchen einzutreiben.<br />
<strong>Die</strong> defizitären Zahlungsbilanzen<br />
(der Wert der Importe übersteigt den<br />
der Exporte 4 ) bedingten, dass die spanischen<br />
Kreditinstitute seit Jahren sich<br />
um Kapital auf dem interbankären europäischen<br />
Markt bemühen mussten<br />
um in Spanien Geld verleihen und Geschäfte<br />
tätigen zu können – besonders<br />
um Immobiliengeschäfte zu finanzie-<br />
4 <strong>Die</strong> hier definierte Handelsbilanz ist nur<br />
ein – wenn auch sehr wichtiger – Teil der<br />
Zahlungsbilanz [Anm. d. Red.]<br />
12 INPREKORR 468/469
SPANIEN<br />
ren und für deren Kauf Kredite vergeben<br />
zu können. <strong>Die</strong> Zapatero-Regierung<br />
mobilisierte enorme Mengen an<br />
öffentlichen Geldern (260 000 Millionen<br />
Euro) um eine Krise unvorhersehbaren<br />
Ausmaßes im Finanzbereich zu<br />
vermeiden. <strong>Die</strong> Banken nutzten diese<br />
Finanzspritzen und Bürgschaften vor<br />
allem, um ihre Bilanzkonten zu sanieren<br />
und danach, um auf das Defizit<br />
des Staates zu spekulieren, indem<br />
sie Teile der öffentlichen Schuld kauften<br />
– aufgenommen eben darum, um<br />
die Kosten der Rettung des Bankensektors<br />
zu finanzieren. (Ungefähr die<br />
Hälfte davon ist in den Händen der<br />
großen europäischen Finanzinstitute.<br />
<strong>Die</strong> Deutsche Bank besitzt mehr <strong>als</strong><br />
45 000 Millionen Euro an spanischen<br />
Staatsschulden).<br />
<strong>Die</strong> Kreditvergabe bleibt weiterhin<br />
blockiert und die nationale Wirtschaft<br />
verharrt in der Rezession. Währenddessen<br />
sitzen die Banken, die sich<br />
in Besitzerinnen von Tausenden von<br />
Wohnungen, Ausschreibungen und<br />
Grundstücken verwandelt haben, auf<br />
offensichtlich gefälschten Bilanzen<br />
mit überbewerteten Aktiva, die sie<br />
nur künstlich aufrecht erhalten können.<br />
Nach Meinung von ExpertInnen<br />
müsste sich der Preis des Wohnraums<br />
mindestens um 30 % verringern, um<br />
den Markt wieder zu reaktivieren.<br />
Und die Zukunft hält für uns neue<br />
Schrecken bereit. Um die Gesamtlage<br />
zu vervollständigen, bleibt hinzuzufügen,<br />
dass das spanische Steuerrecht<br />
eines der regressivsten in Europa ist.<br />
Mitten in der Krise wurden die Steuergeschenke<br />
an die Firmen und Besitzenden<br />
von Vermögen vervielfacht.<br />
<strong>Die</strong> Investmentgesellschaften mit variablem<br />
Kapital – SICAV – zahlen nur<br />
1 % des Kapit<strong>als</strong>. Und der Anteil der<br />
vor der Steuer verborgenen Ökonomie<br />
wird vom Finanzministerium auf<br />
23 % des BIP geschätzt.<br />
All dieses hilft zu verstehen, wie<br />
zerbrechlich die spanische Wirtschaftssituation<br />
ist. Aber auch die endemische<br />
Korruption des neoliberalen<br />
Wirtschaftsmodells und die Offensive<br />
der herrschenden Klassen in<br />
der momentanen Situation werden so<br />
verständlich. <strong>Die</strong> antisoziale Wende<br />
der Regierung Zapatero hat die großen<br />
Gewerkschaften überrascht, die<br />
auf eine Zusammenarbeit mit der „befreundeten“<br />
Regierung gehofft hatten<br />
und nun irritiert sind. <strong>Die</strong> Reaktionen,<br />
denen sich die Gewerkschaftsführungen<br />
ausgesetzt sahen, haben<br />
die Unvorbereitetheit der Arbeiterbewegung<br />
klar zu Tage treten lassen. Es<br />
geht dabei nicht einfach nur um die<br />
Mitgliedschaft in den Gewerkschaften<br />
(CCOO und UGT haben jeweils etwas<br />
mehr <strong>als</strong> eine Million Mitglieder, und<br />
die gewerkschaftliche Organisationsquote<br />
liegt bei rund 17 %). Aber diese<br />
Zahlen spiegeln auch den Einfluss dieser<br />
Organisationen wider. Im Grunde<br />
genommen stützen sich die Gewerkschaften<br />
auf eine Struktur von Delegierten,<br />
die ohne eine aktive Basis in<br />
den Firmen agiert. <strong>Die</strong> Fragmentation<br />
der Produktion und der Arbeitsverträge<br />
der arbeitenden Klasse hat den für<br />
die Epoche des Fordismus aufgestellten<br />
Gewerkschaften ihre Grenzen aufgezeigt.<br />
Zudem wurden die Gewerkschaften<br />
während der Transición darauf<br />
beschränkt, Konflikte in Firmen<br />
und politischen Bereichen zu verhandeln,<br />
die die neoliberale Politik und<br />
die Globalisierung in Unordnung gebracht<br />
haben: <strong>Die</strong> Realitäten der Arbeitsverträge<br />
sind heute in jeder Firma<br />
anders, und die Wertschöpfungsprozesse<br />
korrespondieren nicht mehr<br />
mit den traditionellen industriellen<br />
Zyklen. <strong>Die</strong> Jahre der ökonomischen<br />
Gutwetterlage haben zugleich den Individualismus<br />
<strong>als</strong> auch die Wehrlosigkeit<br />
der Arbeitskraft erhöht. Eine <strong>ganze</strong><br />
Generation von gewerkschaftlichen<br />
AktivistInnen hat im Prinzip keine andere<br />
Gewerkschaftsaktion <strong>als</strong> die des<br />
gerichtlichen Einspruchs erlebt. Einige<br />
der kämpferischsten Streiks hatten<br />
nichts anderes <strong>als</strong> Ziel, <strong>als</strong> die Verhandlung<br />
über die Abfindungen bei<br />
Kündigungen entsprechend der Zahl<br />
der Beschäftigungsjahre in einer Firma.<br />
Auf der andere Seite reiben die<br />
Bürokratie und die Abhängigkeit von<br />
Geldern die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften<br />
auf und verschlechtern<br />
die Beziehung zu einer durch<br />
die Schwere der Krise eingeschüchterten,<br />
ungeschützten und vom Bestreben<br />
des „rette sich wer kann“ beeinflussten<br />
Arbeiterklasse. <strong>Die</strong>s sind<br />
nicht die besten Bedingungen um eine<br />
neue und konfliktive Etappe des Klassenkampfes<br />
zu meistern, die sich andeutet.<br />
Aber mensch muss der Realität<br />
so, wie sie ist, gegenüber treten.<br />
DER BEVORSTEHENDE WAN-<br />
DEL<br />
Und was noch zu all dem hinzukommt,<br />
ist ganz klar ein neuer Abschnitt von<br />
historischer Reichweite. <strong>Die</strong> Arbeiterklasse<br />
hat sich noch nicht auf die Angriffe<br />
der Regierung, die diese im Namen<br />
des Marktes durchführt, eingestellt.<br />
Im Juni beschloss sie die Reduzierung<br />
der Gehälter der Staatsangestellten,<br />
was eine direkte Auswirkung<br />
auf die privatwirtschaftlichen Sektoren<br />
hatte, zudem das Einfrieren der<br />
Renten und der sozialen Hilfen sowie<br />
drastische Sparmaßnahmen in den öffentlichen<br />
<strong>Ausgabe</strong>n, welche die Infrastruktur,<br />
die staatlichen Einrichtungen<br />
und die öffentlichen <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
betreffen. <strong>Die</strong>se Verschlechterungen<br />
öffnen einer weiteren Anzahl von Privatisierungen<br />
die Tür. <strong>Die</strong> Arbeitsreformen,<br />
die die Leidensfähigkeit der<br />
Gewerkschaften überstrapazierten, erleichtern<br />
die Kündigungen, geben den<br />
Firmen einen größeren Ermessensspielraum<br />
und erweitern die Möglichkeiten,<br />
Zeitarbeitsverträge einzurichten<br />
– und dies bis in den Sektor der öffentlichen<br />
Verwaltung hinein. Zudem<br />
– und das ist sehr schwerwiegend – erlauben<br />
sie den Firmen, sich von kollektiven<br />
Arbeitsverträgen abzukoppeln,<br />
sofern es die partikularen Interessen<br />
der Firma erfordern. <strong>Die</strong>s ist<br />
ein deutlicher Angriff auf die linienlose<br />
Politik der Gewerkschaften. <strong>Die</strong><br />
Frage der kollektiven Arbeitsverträge<br />
ist ein zentrales Anliegen der Gewerkschaften,<br />
ohne diese gibt es eine<br />
Zersplitterung der Arbeiterklasse, eine<br />
Verwandlung der ArbeiterInnen in eine<br />
Menge von wehrlosen und der gegenseitigen<br />
Konkurrenz ausgesetzten<br />
Individuen. Dass die Rentenreform im<br />
Parlament debattiert wird, mit der wie<br />
in vielen anderen europäischen Ländern<br />
die Absicht verfolgt wird, das<br />
Renteneintrittsalter auf 67 zu erhöhen,<br />
die Einkommen der RentnerInnen zu<br />
kürzen und die privaten Rentenversicherungen<br />
zu fördern, verdeutlicht die<br />
Offensive des Großkapit<strong>als</strong> gegen den<br />
Wohlfahrtsstaat. <strong>Die</strong> im Nachkriegseuropa<br />
erreichten Beziehungen zwischen<br />
den Klassen sind in Frage gestellt<br />
– und mit ihren spezifischen Eigenarten<br />
damit auch ganz besonders<br />
die im Spanischen Staat. <strong>Die</strong> Jahre des<br />
siegreichen Neoliberalismus haben ihr<br />
INPREKORR 468/469 13
SPANIEN<br />
Streik in Spanien<br />
Feld erfolgreich vorbereitet. Mittels<br />
einer neuen Variante seiner bekannten<br />
Schocktherapie versucht der Kapitalismus<br />
eine qualitativ neue Schwelle<br />
zu überschreiten.<br />
Der Streik vom 29. September<br />
wird zeigen wo die Arbeiterbewegung<br />
steht, um sich dieser Herausforderung<br />
zu stellen. <strong>Die</strong> sozialpartnerschaftlich<br />
eingestellten Führungen der einflussreichen<br />
Gewerkschaften sind widersprüchlichen<br />
Einflüssen ausgesetzt:<br />
Sie fühlen sich dem Druck der eigenen<br />
Organisation und deren Bedeutung<br />
ausgesetzt, aber sie träumen von<br />
der Rückkehr der sozialpartnerschaftlichen<br />
Zeiten. Ihre Proklamationen<br />
kritisieren heftig die Reformen der<br />
Regierung. Einige Positionspapiere<br />
von den Gewerkschaften eng verbundenen<br />
Nachbarschaftsvereinigungen<br />
schlagen einen klar linken Kurs aus<br />
der Krise vor: öffentliche Banken,<br />
progressive Steuergesetzgebung, Verstaatlichungen,<br />
Verteidigung des öffentlichen<br />
Sektors, Senkung der Militärausgaben,<br />
ökologische Umgestaltung<br />
der Produktion und Maßnahmen<br />
zur geschlechterunabhängigen Bezahlung<br />
(Frauen sind bei Zeitarbeitsverträgen<br />
mit 80 % vertreten, werden<br />
weiterhin schlechter bezahlt <strong>als</strong> Männer,<br />
und jeder weitere Rückschritt auf<br />
dem Arbeitsmarkt bezüglich der Sozialleistungen<br />
und der öffentlichen<br />
<strong>Ausgabe</strong>n betrifft sie besonders deutlich)<br />
… Trotzdem enden diese Statements<br />
mit einer Aufforderung, den sozialen<br />
Dialog wieder auf zu nehmen.<br />
<strong>Die</strong>s wird sicherlich mit den Mobilisierungserfolgen<br />
eines Delegiertenapparats<br />
zu tun haben, der häufig wenig<br />
Präsenz und Einfluss in den Arbeitervereinigungen<br />
hat. <strong>Die</strong> linken GewerkschafterInnen<br />
ihrerseits – vertreten<br />
durch Minderheitenströmungen<br />
wie die anarchosyndikalistische CNT,<br />
die Eisenbahngewerkschaft, Cobas,<br />
die intergewerkschaftliche Alternative<br />
in Katalonien oder die andalusische<br />
SAT – können trotz der Anzahl ihrer<br />
AktivistInnen und trotz ihrer Präsenz<br />
in den verschiedenen Sektoren in keinem<br />
Fall den Kräfteschwund der großen<br />
Gewerkschaften kompensieren.<br />
Außerdem ist festzustellen, dass ihre<br />
Möglichkeiten nicht dieselben sind:<br />
Während CCOO sich bei der Mobilisierung<br />
für den 29. September engagierter<br />
zeigt, ist die UGT unschlüssig,<br />
da sie starke interne Spannungen<br />
zu verarbeiten hat, die von den Pressionen<br />
seitens der PSOE herrühren, der<br />
diese Gewerkschaft ja historisch und<br />
innigst verbunden ist. Bleibt auf eine<br />
Besonderheit hinzuweisen, die die<br />
Gesamtlage kompliziert: die Situation<br />
in Euskadi (Baskenland). Dort ist die<br />
gewerkschaftliche Mehrheit, vertreten<br />
durch ELA, LAB, STES u. a., traditionell<br />
nationalistisch und hat sich häufig<br />
schon mit den gesamtspanischen Gewerkschaften<br />
angelegt. Es wurde bereits<br />
zu zwei Gener<strong>als</strong>treiks mobilisiert,<br />
einer im vergangenen Jahr, der<br />
andere in diesem Juni, wobei letzteren<br />
die CCOO unterstützte, und beide<br />
mit einem bemerkenswerten Erfolg.<br />
Aber dieses Mal hat die gewerkschaftliche<br />
Mehrheit in Euskadi entschieden,<br />
den Streikaufruf von CCOO<br />
und UGT zu ignorieren und Einsprüche<br />
anzumelden sowie einen eigenen<br />
zeitlichen Ablauf der Mobilisierung<br />
einzufordern. <strong>Die</strong> nationale Problematik,<br />
durch die Krise eher verstärkt <strong>als</strong><br />
abgeschwächt, beeinträchtigt die Aktionseinheit<br />
der Arbeiterbewegung.<br />
Und natürlich ist dies nicht die einzige<br />
Verzerrung auf politischer Ebene.<br />
Der Streik zeigt auch deutlich die unvermeidliche<br />
politische Krise der Linken.<br />
<strong>Die</strong> PSOE zeigt sich verpflichtet,<br />
Harakiri zu begehen zugunsten<br />
der Reichen. Ihre Politik bereitet die<br />
Rückkehr der Rechten an die Macht<br />
vor, deren schmutzige Arbeit sie zu<br />
erledigen sich bemüht. <strong>Die</strong> Wahlen in<br />
Katalonien diesen Herbst werden sicherlich<br />
einen Erfolg der nationalistischen<br />
Rechten bringen und damit ein<br />
Ende des Zyklus linksliberaler Regierungen.<br />
<strong>Die</strong> Vereinigte Linke (Izquierda<br />
Unida) debattiert darüber, sich mit<br />
einem antikapitalistischen Aspekt neu<br />
zu gründen … und über ihre Kompromisse<br />
auf lokaler und regionaler Ebene<br />
mit der PSOE zusammen zu regieren.<br />
<strong>Die</strong>se neue Periode beginnt mit<br />
der dringenden Notwendigkeit einer<br />
grundlegenden Neuorganisation der<br />
sozialen und politischen Linken. Mit<br />
ihren bescheidenen aktiven Kräften<br />
des Neuaufbaus hat sich die antikapitalistische<br />
Linke (Izquierda Anticapitalista)<br />
klar für eine Beteiligung im<br />
Kampf für den Gener<strong>als</strong>treik entschieden.<br />
Sie ist sich dabei der Wichtigkeit<br />
und der Notwendigkeit bewusst,<br />
aus diesem Kampf den Beginn eines<br />
<strong>ganze</strong>n Zyklus von Kämpfen zu machen,<br />
der eine fortschrittliche Perspektive<br />
heraus aus der systemimmanenten<br />
Krise und zu Gunsten der arbeitenden<br />
Klassen eröffnet.<br />
23/09/2010<br />
Lluís Rabell ist Leitungsmitglied der Izquierda<br />
anticapitalista (Antikapitalistische Linke),<br />
der Sektion der IV. Internationale im spanischen<br />
Staat.<br />
Übersetzung aus dem Spanischen:<br />
Sven<br />
14 INPREKORR 468/469
SPANIEN<br />
Der Streik vom 29. September:<br />
<strong>Die</strong> soziale Frage kehrt zurück<br />
Miguel Romero<br />
1.<br />
Eines der Ziele des Neoliberalismus<br />
bestand darin, die „soziale<br />
Frage“ – das heißt die vom Kapitalismus<br />
aufgrund der sozialen Ungerechtigkeit<br />
und Ungleichheit hervorgerufenen<br />
Konflikte – nicht nur aus<br />
der Politik sondern auch aus dem Bewusstsein<br />
der Menschen, die Mehrheit<br />
der arbeitenden Klassen inbegriffen,<br />
zu verbannen. Dazu beigetragen<br />
hat insbesondere im Spanischen<br />
Staat der sogenannte „soziale Dialog“.<br />
Das heißt die Erarbeitung eines<br />
Konsenses, bei welchem systematisch<br />
die gemeinsamen Interessen zwischen<br />
Unternehmern und Gewerkschaften<br />
gesucht werden. <strong>Die</strong>ser „soziale Dialog“<br />
ist in den Beziehungen zwischen<br />
Kapital und Arbeit zu einer grundlegenden<br />
Norm geworden. In wirtschaftlicher<br />
Hinsicht sind die Folgen<br />
katastrophal: Rückgang des Lohnanteils<br />
am Bruttoinlandprodukt und rekordhohes<br />
Wachstum der Unternehmens-„Überschüsse“<br />
(Profite) während<br />
längerer Zeit.<br />
Für die Gewerkschaften und sozialen<br />
Bewegungen sind die Folgen<br />
ebenso katastrophal: <strong>Die</strong> Lohnabhängigen<br />
in ihrer Mehrheit organisieren<br />
sich nicht mehr in den Gewerkschaften,<br />
weil sie in ihnen Kampforganisationen<br />
sehen. Folglich sind sie in deren<br />
Strukturen auch nicht mehr aktiv.<br />
Politisch ausgedrückt hat sich eine<br />
bipolare Koexistenz von PSOE und<br />
PP herausgebildet und gefestigt. 1 Und<br />
die Stimmenmehrheit der PSOE bei<br />
Wahlen wird <strong>als</strong> linke Mehrheit definiert.<br />
Mit dem Gener<strong>als</strong>treik vom 29.<br />
September 2010 scheint die „soziale<br />
Frage“ zurückgekehrt und wieder<br />
sichtbar geworden zu sein. Ich sage,<br />
es „scheint“ so. Denn zweifellos liegt<br />
dieser Gener<strong>als</strong>treik noch nicht lange<br />
genug zurück, um daraus bereits<br />
Schlussfolgerungen ziehen zu kön-<br />
1 PSOE: Partido socialista obrero español, PP:<br />
Partido popular<br />
nen. In diesem Umfeld ist die Gefahr<br />
groß, dass die Hoffnung mit der Realität<br />
verwechselt wird. Alles, was dieser<br />
Gener<strong>als</strong>treik ausgelöst hat, ist noch<br />
zuwenig entwickelt und zu zerbrechlich.<br />
Was dabei herausgeschaut hat,<br />
hat mehr mit dessen Möglichkeiten,<br />
mit den in ihn gesetzten Erwartungen<br />
zu tun <strong>als</strong> mit tatsächlichen Errungenschaften.<br />
Doch es gibt konkrete Fakten,<br />
die mit einiger Gewissheit darauf<br />
schließen lassen, dass die „soziale Frage“<br />
zurückgekehrt ist, die es dringend<br />
braucht und die in der gegenwärtigen<br />
Krise des kapitalistischen Systems lebenswichtig<br />
ist. Zu diesen Fakten gehören<br />
insbesondere die Reaktionen<br />
der Wortführer der Unternehmer und<br />
der politischen Rechten. <strong>Die</strong> Schlagzeilen<br />
auf den ersten Seiten sprachen<br />
von „Generalniederlage“ – nicht zufällig<br />
in jenen Zeitungen zu finden, die<br />
sich vor allem durch gezielte F<strong>als</strong>chinformation<br />
auszeichnen, nämlich El<br />
Mundo und ABC. Sie erheben keinesfalls<br />
den Anspruch, die Wirklichkeit<br />
wiederzugeben, sie wollen sie<br />
vielmehr heraufbeschwören, um ihre<br />
Kunden zu beruhigen wie die Reliquien<br />
und Medaillons, die die Carlisten<br />
2 im spanischen Bürgerkrieg trugen<br />
und auf denen stand „Deténte bala!“<br />
(„Kugel: Halt!“).<br />
2.<br />
Der Gener<strong>als</strong>treik ist mehr wegen<br />
der Möglichkeiten ein politischer<br />
Erfolg, die er eröffnet hat, <strong>als</strong><br />
was damit erreicht werden konnte. <strong>Die</strong>s<br />
zu übersehen wäre ein großer Fehler.<br />
Aber es müssen auch die Schwächen<br />
gesehen werden, alles, was noch<br />
zu tun ist, um ausgehend von diesem<br />
ersten Schritt weiter voranzukommen.<br />
Um so Zielen näher zu kommen, die<br />
noch in weiter Ferne liegen, deren es<br />
aber für radikale wirtschaftliche und<br />
politische Änderungen unbedingt bedarf.<br />
2 Strömung der Royalisten, entstanden in<br />
Spanien in der ersten Hälfte des 19. Jh.<br />
Zum Beispiel:<br />
<strong>Die</strong> Teilnahme an den Streiks vom<br />
29. September muss im Detail genau<br />
angeschaut werden: In den einzelnen<br />
Wirtschaftsbranchen sowie in den einzelnen<br />
Regionen, vor allem dort, wo<br />
er zu schwach befolgt wurde, um Wirkung<br />
zu zeitigen: in den Banken, Spitälern,<br />
Schulen und wie immer im Handel,<br />
insbesondere in den Warenhäusern.<br />
Einige zweideutige Losungen müssen<br />
diskutiert werden: „Korrektur (der<br />
Reform)“, „So nicht“ oder die Forderungen<br />
nach Wiederaufnahme des „sozialen<br />
Dialogs“, was Antonio Gutiérrez<br />
prompt erlaubt, am 30. September<br />
im El País die Ernennung eines „Vermittlers“<br />
zu fordern.<br />
Man wird sich vor den Versuchen<br />
der Comisiones Obreras (CCOO, Arbeiterkommissionen)<br />
und der UGT<br />
(Unión General de Trabajadores, Allgemeine<br />
Arbeiterunion) hüten müssen,<br />
den Streik zu monopolisieren.<br />
Es hat weitere Gewerkschaften gegeben,<br />
die für den Streik einen großen<br />
Einsatz geleistet haben, was sich auch<br />
ausbezahlt hat, wie dies die von der<br />
CGT 3 initiierte und geführte Demo in<br />
Madrid zeigt. Es war die größte Demo,<br />
zu welcher diese Gewerkschaft<br />
je aufgerufen hat. Ein Grund mehr<br />
zur Annahme, dass ihre Teilnahme an<br />
der Demonstration der CCOO und der<br />
UGT ein größeres Echo gehabt hätte<br />
<strong>als</strong> der Aufruf zu einer Paralleldemo.<br />
Es gab auch originelle und wirksame<br />
Beiträge, die in Zukunft übernommen<br />
werden können: Einheitliche<br />
Forderungsplattformen in einzelnen<br />
Regionen, Fahrrad-Demos, Aktionen<br />
im Kulturbereich (die allerdings zahlenmäßig<br />
kleiner ausfielen <strong>als</strong> andere<br />
Arten von Mobilisierungen).<br />
3 Confederación General de Trabajo,<br />
Minderheitsgewerkschaft, aber sehr aktiv,<br />
selbstverwaltet, auf Klassenpositionen; sie ist<br />
aus einer Abspaltung von der anarchistischen<br />
CNT entstanden.<br />
INPREKORR 468/469 15
SPANIEN<br />
Schließlich muss auch über etwas<br />
Negatives berichtet werden. ELA und<br />
LAB (zwei Gewerkschaften im Baskenland-Euskadi)<br />
sind dem Streikaufruf<br />
nicht gefolgt und haben sogar Aktionen<br />
und Streikposten aktiv behindert.<br />
<strong>Die</strong>ses Problem kann nicht in<br />
wenigen Zeilen abgehandelt werden.<br />
<strong>Die</strong>s ist auf Probleme zurückzuführen,<br />
die weit in der Vergangenheit zurückliegen<br />
und von allgemeinerer Natur<br />
sind. Es ist auch nicht erkennbar, wie<br />
solche Probleme überwunden werden<br />
können.<br />
Zusammengefasst lässt sich sagen,<br />
dass der Ausdruck „politischer Sieg“<br />
folgende innere Bedeutung hat: Er ist<br />
die Demonstration einer kollektiven<br />
Kraft, das Gefühl, jene besiegt zu haben,<br />
die entschieden der Meinung waren,<br />
der Gener<strong>als</strong>treik würde scheitern.<br />
Er zeigt, dass die Leute „von unten“,<br />
die bis anhin skeptisch und resigniert<br />
waren, ihre Einstellung ändern<br />
können. An vielen Orten ist die Basis<br />
der Mehrheitsgewerkschaften von einer<br />
beginnenden gewerkschaftlichen<br />
Eigenaktivität erfasst worden. Man<br />
kann sagen, was man will, aber künftig<br />
kann die Wirtschafts- und Sozialpolitik<br />
nicht mehr im geschlossenen Kreis<br />
von Sitzungen mit den „Agenten des<br />
Marktes“ und in den Gängen des Parlamentes<br />
festgelegt werden. Von jetzt<br />
an ist mit der Straße zu rechnen, die<br />
bis jetzt nicht zu den offiziellen Festlichkeiten<br />
geladen war und deren Präsenz<br />
den etablierten Marschplan der<br />
Regierung etwas ins Wanken gebracht<br />
hat.<br />
3.<br />
Es hat sich eine Bresche geöffnet,<br />
allerdings nur eine Bresche.<br />
Der Optimismus jener, die zum<br />
Streik aufgerufen haben („Alle Gener<strong>als</strong>treiks<br />
waren siegreich“, „Zapatero<br />
wird seine Haltung früher oder später<br />
ändern“ …) ist ok, wenn er der Vorbereitung<br />
eines Streiks dient. Aber heute<br />
müssen wir uns der Wirklichkeit stellen,<br />
voller Hoffnung aber illusionslos.<br />
Denn es ist f<strong>als</strong>ch, dass „alle Gener<strong>als</strong>treiks“<br />
siegreich waren. Es wurden<br />
jeweils Teilresultate von unterschiedlicher<br />
Bedeutung erzielt, aber in der<br />
Sozial- und Wirtschaftspolitik wurden<br />
keine grundlegenden Änderungen<br />
erzielt. Wenn man so will, haben sie<br />
zu „Korrekturen“ geführt, von denen<br />
die Gewerkschaftsführer sprechen,<br />
was nur kleine Änderungen von unterschiedlichem<br />
Ausmaß waren (Rückzug<br />
eines Gesetzes, das zur Türe hinausgeht,<br />
aber wenig später wieder<br />
zum Fenster reinkommt, was mehr <strong>als</strong><br />
einmal vorgekommen ist).<br />
Aber heute haben wir es nicht mit<br />
einem Gesetz zu tun sondern mit einer<br />
Wirtschaftspolitik, die in großem Umfang<br />
„korrigiert“ werden müsste. Wir<br />
haben es mit einer knallharten Politik<br />
zu tun, einer „strukturellen Anpassung“,<br />
die den Normen und dem Diktat<br />
des Marktes unterworfen ist, von<br />
der EU beschlossen wurde und der<br />
sich die Regierung Zapatero wie ein<br />
Vasall unterwirft.<br />
<strong>Die</strong> einzige Korrektur, die Sinn<br />
macht, besteht in der Veränderung der<br />
Grundlagen von Wirtschaft und Politik,<br />
darin, sich von den „Märkten“ zu<br />
lösen und von dieser Position aus den<br />
Angriffen zu trotzen. Dafür fehlt noch<br />
ein wirksames soziales Netz, ein Subjekt,<br />
das sich von unten her aufbaut.<br />
Oder anders gesagt: Es fehlt ein Bündnis,<br />
in dem die soziale und politische<br />
Linke für eine längere Zeit des Widerstandes<br />
und des Erlernens neuer Aktions-<br />
und Organisationsformen zusammenfindet.<br />
Um hier voranzukommen,<br />
muss eine „Linke links der Linken“<br />
gestärkt werden, die mit der heutigen<br />
Politik der institutionellen Linken<br />
bricht, einem schlimmen Erbe der<br />
Übergangszeit. 4<br />
4.<br />
Hat ein neuer politischer Zyklus<br />
begonnen? Im Moment ist dafür<br />
die Möglichkeit gegeben. Also muss<br />
der Beginn möglich gemacht werden.<br />
Wir haben alles erreicht, worin wir<br />
Vertrauen hatten und was wir für diesen<br />
Streik gemacht haben. Bestimmt<br />
die einen mehr, die anderen weniger.<br />
4 Nach dem Ende der Franco-Diktatur Übergang<br />
zu einer Zweiparteiendemokratie unter einem<br />
tendenziell bonapartistischen König.<br />
Jene, die meinen, aus diesem Streik<br />
mit politischer Autorität und gestärkt<br />
hervorgegangen zu sein, in erster Linie<br />
die Comisiones Obreras, wären<br />
gut beraten, wenn sie sich etwas umsehen<br />
und erkennen würden, dass sie<br />
nicht die einzigen waren, schon gar<br />
nicht in den Streikposten. Und wenn<br />
sie zur Kenntnis nehmen würden, dass<br />
die Koexistenz von Leuten aus verschiedenen<br />
politischen Strömungen in<br />
den Streikposten viel einfacher war,<br />
<strong>als</strong> dies die Zusammenstöße zwischen<br />
den Organisationen vermuten lässt.<br />
Mit dem 29. September bietet sich jedenfalls<br />
seit 20 Jahren zum ersten Mal<br />
auch die Gelegenheit, dass eine gewerkschaftliche,<br />
pluralistische, radikale<br />
und einheitliche Linke entsteht,<br />
die sich in den täglichen Kämpfen mit<br />
den sozialen Bewegungen verbindet.<br />
Es ist auch ein neuer, größerer<br />
Spielraum für die antikapitalistische<br />
Linke entstanden wie für viele andere<br />
organisierte und unorganisierte Aktivistinnen<br />
und Aktivisten. Jetzt geht<br />
es darum, sich ehrgeizig und gleichzeitig<br />
bescheiden in Bewegung zu setzen.<br />
Der Schlüssel der Zukunft liegt<br />
in der Fähigkeit, Einheit in der Aktion<br />
zu erreichen und diese Arbeit mit<br />
antikapitalistischen Forderungen zu<br />
kombinieren, die den gegenwärtigen<br />
Tageskämpfen entsprechen. Entscheidend<br />
ist jetzt auch, sich mit all jenen<br />
Menschen zu verbinden, die bei<br />
den Demos zur Überzeugung gekommen<br />
sind, dass weitere Streiks notwendig<br />
sind, dass diese gut vorbereitet<br />
und gut durchgeführt werden müssen<br />
und dass sie mit Sicherheit breiter<br />
und stärker sein werden <strong>als</strong> der Streik<br />
vom 29. September.<br />
30. September 2010<br />
Miguel Romero ist verantwortlicher Herausgeber<br />
der Zeitschrift Viento Sur<br />
Übersetzung: Ursi Urech<br />
16 INPREKORR 468/469
GRIECHENLAND<br />
Wie heiß wird der Herbst?“<br />
Tassos Anastassiadis, Andreas Sartzekis<br />
<strong>Die</strong> Troika: So nennt man in Griechenland<br />
die dreifache Diktatur aus<br />
IWF, Europäischer Kommission und<br />
Europäischer Zentralbank. Sie hat<br />
dem Land ein Sparprogramm 1 aufgezwungen,<br />
das von der PASOK-Regierung<br />
in vollem Umfang akzeptiert<br />
wurde. <strong>Die</strong>ses Sparprogramm wird<br />
von Fachleuten <strong>als</strong> noch undemokratischer<br />
eingestuft <strong>als</strong> jenes aus dem<br />
Jahr 1898, <strong>als</strong> Griechenland während<br />
einer schweren Wirtschaftskrise internationaler<br />
Kontrolle unterstellt wurde.<br />
Am Ende dieses Sommers beglückwünscht<br />
der ach so sozialistische IWF-<br />
Präsident Strauss-Kahn im Namen der<br />
berühmten Troika seinen Genossen<br />
Premierminister Giorgos Papandreou<br />
für die großen Fortschritte seiner Regierung<br />
in so kurzer Zeit. <strong>Die</strong>ser brüstet<br />
sich mit seinem entschiedenen Kampf<br />
gegen Steuerbetrug; so lässt er vor<br />
allem die Wohnviertel der Reichen im<br />
Zentrum Athens überfliegen, um nicht<br />
deklarierte private Swimmingpools<br />
auszumachen … <strong>Die</strong> Bekämpfung des<br />
tatsächlich bestehenden Steuerbetrugs<br />
wird zum Leitmotiv, aber kein Wort zu<br />
den Steuergeldern, die dem Staat entgehen,<br />
weil sich die großen griechischen<br />
Reeder in Steuerparadiesen niederlassen!<br />
<strong>Die</strong>s ist einer der dramatischsten<br />
Aspekte dieses Herbstes: Obwohl<br />
sich die PASOK völlig von ihren<br />
Wahlversprechen vom Oktober 2009<br />
abgewendet hat und trotz ihrer unsozialen<br />
Maßnahmen, die das Land um<br />
Jahrzehnte zurückwerfen, vermag sie<br />
mit ihrer Demagogie („Wenn ich ein<br />
gewöhnlicher Bürger wäre, würde ich<br />
selbstverständlich auch gegen solche<br />
Maßnahmen demonstrieren.“) eine gewisse<br />
Popularität zu bewahren. In Meinungsumfragen<br />
steht die PASOK trotz<br />
Verlusten einsam an der Spitze.<br />
1 Das Sparprogramm besteht aus einem Kredit<br />
von 110 Milliarden € zu einem Zins von beinahe<br />
5 % (selbst auf den „Märkten“ wurde Mitte<br />
September weniger Zins verlangt: 4,85 %!).<br />
Als Gegenleistung wird eine Lohn- und<br />
Rentensenkung verlangt, die Abschaffung des<br />
Arbeitsrechts, die „Belebung“ der Konkurrenz<br />
mit möglichst vielen Reprivatisierungen.<br />
DIE KRISE VERSCHÄRFT SICH<br />
Wie sehen nun die großen Fortschritte<br />
aus, die die Troika Mitte September<br />
auszumachen vorgibt? <strong>Die</strong> Sommerschlussverkäufe<br />
(Sommerausverkäufe),<br />
die von den Familien mit<br />
tiefem Einkommen immer sehnlichst<br />
erwartet wurden, sind dieses Jahr<br />
um 25 % zurückgegangen, in einigen<br />
Städten im Norden sogar bis 65 %.<br />
<strong>Die</strong>s lässt sich einfach erklären: ein<br />
Arbeiterehepaar verliert ab sofort vier<br />
Monatslöhne pro Jahr. <strong>Die</strong>s weil der<br />
monatliche Nettolohn gekürzt und<br />
die Preise erhöht wurden (Erhöhung<br />
der Mehrwertsteuer auf 23 %, höhere<br />
Preise für Heizmaterial). Der jährliche<br />
Einkommensverlust eines Beamtenehepaares<br />
wird auf 11 000 € geschätzt<br />
(–20 %), für ein Arbeiterehepaar aus<br />
der Privatwirtschaft auf –5 % … Ein<br />
anderes Beispiel: im Tourismus, eine<br />
alte Einnahmequelle, ist auf einigen<br />
beliebten Inseln die Bettenbelegung in<br />
den Hotels trotz Preissenkungen um<br />
bis zu 30 % zurückgegangen (–29 %<br />
auf den Zeltplätzen). So verstärkt sich<br />
das Problem ungenügender Einnahmen<br />
trotz der „Jagd auf Steuersünder“<br />
weiter. Hinzu kommt die wachsende<br />
Erwerbslosigkeit, die im Juli offiziell<br />
bei 11,6 % lag, in Wirklichkeit<br />
20 % überschritten hat. <strong>Die</strong> Situation<br />
verschlechtert sich dramatisch, insbesondere<br />
in den alten Industriestädten<br />
im Norden des Landes: in Thessaloniki<br />
liegt die Arbeitslosigkeit bei<br />
25 % (zweitgrößte Stadt des Landes),<br />
in Kozani, Kastoria und Serres zwischen<br />
30 % und 35 % und in Naussa<br />
sogar bei 50 %. Zudem nehmen<br />
die prekären Arbeitsverhältnisse explosionsartig<br />
zu: In Kavala wurden<br />
60 % der Arbeitsverträge in Teilzeitverträge<br />
umgewandelt (gemäß der Tageszeitung<br />
Eleftherotypia). Im Oktober<br />
soll die Zahl der Erwerbslosen um<br />
100 000 steigen (auf eine Bevölkerung<br />
von 11 Mio.), vor allem im Tourismus<br />
und im Baugewerbe.<br />
Ein weiterer Aspekt darf nicht vergessen<br />
werden: Um wegen des neuen<br />
Rentengesetzes nicht länger arbeiten<br />
zu müssen, sind diesen Sommer<br />
Tausende von Beamten frühzeitig<br />
in Pension gegangen. Vor allem in<br />
Schulen und Krankenhäusern werden<br />
sie schmerzlich fehlen. <strong>Die</strong>s <strong>als</strong> Folge<br />
der neuen Regel, wonach fast alle<br />
Lohnabhängigen, die in Pension gehen,<br />
nicht ersetzt werden dürfen. In<br />
den Schulen ist die Lage wegen fehlender<br />
Mittel schon heute miserabel:<br />
Im Norden führt der Mangel an Schulhäusern<br />
dazu, dass ein Teil der Schülerinnen<br />
und Schüler am Morgen, der<br />
andere gegen Abend unterrichtet wird.<br />
Einige Klassen wurden in ehemaligen<br />
Lagerhäusern untergebracht. <strong>Die</strong>se<br />
Situation verschlimmerte sich nach<br />
den Sommerferien, zu Beginn des<br />
neuen Schuljahres, wegen fehlender<br />
Lehrkräfte weiter. <strong>Die</strong> Gewerkschaft<br />
OLME (Oberstufe) kritisiert, dass<br />
die Klassen auf 30 SchülerInnen oder<br />
mehr erhöht werden … In den Krankenhäusern<br />
führt der Personalmangel<br />
bei verschiedenen Behandlungen<br />
zu langen Wartefristen: zum Beispiel<br />
bis zu 30 Tage für ärztliche Untersuchungen.<br />
Und selbst der Mangel<br />
an Polizeibeamten behindert einfache<br />
Verwaltungsdienstleistungen wie das<br />
Ausstellen von Papieren. <strong>Die</strong> Troika<br />
kann beruhigt sein: Am 11. September<br />
waren an der Demo in Thessaloniki<br />
über 5000 MAT (Bereitschaftspolizei)<br />
präsent! Und alles in allem geht<br />
es gar nicht so schlecht: <strong>Die</strong> deutsche<br />
Firma Thyssen Krupp wird zwei neue<br />
U-Boote liefern zum bescheidenen<br />
Preis von 1,2 Milliarden Euro …<br />
<strong>Die</strong> wenigen Beispiele zeigen: <strong>Die</strong><br />
„Hilfe“ europäischer und internationaler<br />
Organisationen bringt nicht<br />
den geringsten wirtschaftlichen Fortschritt,<br />
sondern führt im Gegenteil zu<br />
Elend und verstärkt noch die Krise des<br />
Systems, das darauf die Flucht nach<br />
vorn ergriffen hat: Das Bruttoinlandprodukt<br />
(BIP) wird dieses Jahr voraussichtlich<br />
um 4 % sinken. Der IWF<br />
hat soeben grünes Licht gegeben für<br />
einen zweiten Kredit von 2,57 Milliar-<br />
INPREKORR 468/469 17
GRIECHENLAND<br />
Griechenland: Polizei schützt die Banken<br />
den Euro. Und die Regierung scheint<br />
jede Art ausländischer Investitionen<br />
zu akzeptieren, insbesondere im Tourismus:<br />
Russische Kapitalisten und<br />
die israelische Regierung scheinen<br />
sehr am online-Casino-Geschäft interessiert<br />
zu sein sowie am Kauf kleinerer<br />
Flughäfen, an Energie-Anlagen …<br />
GROSSE, ABER UNGENÜ-<br />
GENDE MOBILISIERUNGEN<br />
<strong>Die</strong> Frage, die sich jetzt, Mitte September<br />
stellt, ist die folgende: Warum<br />
vermochte die Arbeiterbewegung die<br />
unsozialen Maßnahmen nicht zumindest<br />
teilweise zu verhindern, nachdem<br />
der Gener<strong>als</strong>treik am 5. Mai im öffentlichen<br />
Sektor praktisch zu 100 %<br />
und in der Privatwirtschaft gut befolgt<br />
wurde? Es fand die größte Demonstration<br />
seit dem Sturz der Militärdiktatur<br />
statt (1974). Wie groß ist die Kampfbereitschaft<br />
der Arbeiterbewegung<br />
heute?<br />
Es lässt sich nur sehr schwer abschätzen,<br />
wieweit der Tod der drei<br />
Bankangestellten die Bewegung zurückzuwerfen<br />
vermochte, die in einem<br />
Brand umgekommen waren, der von<br />
einem Molotow-Cocktail ausgelöst<br />
worden war, von dem man immer<br />
noch nicht weiß, ob es sich dabei um<br />
eine Provokation der Polizei oder von<br />
Faschisten handelt oder um eine tödliche<br />
Idiotie einer kleinen Gruppe aus<br />
der autonomen Szene. Anarchistische<br />
Gruppen haben sich im Nachhinein<br />
in vielen Texten gegen Gewalt ausgesprochen,<br />
die an die Stelle der Massenbewegung<br />
gesetzt wird. Es kann<br />
aber mit Bestimmtheit gesagt werden,<br />
dass die dam<strong>als</strong> bestehende Aussicht<br />
auf unbefristete Streiks mit einer<br />
antikapitalistischen Massendynamik<br />
(Tausende verharrten vor dem Parlament,<br />
um gegen die unsoziale Rolle<br />
dieser Versammlung zu demonstrieren)<br />
großenteils neutralisiert wurde<br />
und dass es keine zweite solche Gelegenheit<br />
mehr gegeben hat.<br />
Selbstverständlich hat die Taktik<br />
der Gewerkschaftsführungen – GSEE<br />
für den Gewerkschaftsbund der Privatwirtschaft,<br />
ADEDY für den öffentlichen<br />
<strong>Die</strong>nst, beide mit mehrheitlicher<br />
PASOK-Führung – lähmend gewirkt.<br />
Bis Ende Juni haben die Gewerkschaften<br />
zu eintägigen Gener<strong>als</strong>treiks aufgerufen,<br />
die genügend weit auseinander<br />
lagen, sodass die ArbeiterInnen<br />
diese nicht unbefristet weiterführten,<br />
solange kein neuer Streikbeschluss<br />
vorlag. <strong>Die</strong>se Taktik ist bekannt und<br />
kann schwere Konsequenzen haben,<br />
wie zum Beispiel 2009 in Frankreich,<br />
<strong>als</strong> sich am letzten Streik im Juni<br />
nur noch wenige beteiligt hatten. In<br />
Griechenland haben die brutalen Abbaumaßnahmen<br />
und die große Wut<br />
dazu geführt, dass die Bewegung bis<br />
zum letzten Streik ziemlich stark war,<br />
doch die Demos wurden immer kleiner.<br />
Sechs oder sieben landesweite<br />
Streiktage in sechs Monaten, tägliche<br />
Streiks in verschiedenen Sektoren und<br />
<strong>als</strong> Ergebnis die vollumfängliche Umsetzung<br />
der arbeiterfeindlichen Maßnahmen<br />
– dies führt unweigerlich zu<br />
einer mehr oder weniger starken Entmutigung.<br />
Selbst wenn am 11. September<br />
zwischen 15 000 und 20 000<br />
Arbeiterinnen, Arbeiter und Jugendliche<br />
an der nationalen Demonstration<br />
in Thessaloniki teilgenommen haben,<br />
entspricht dies doch nicht dem Schaden,<br />
den die bereits getroffenen und<br />
die zukünftigen Maßnahmen anrichten<br />
und noch anrichten werden.<br />
Aber wenn die Gewerkschaftsbürokratie<br />
mit ihrem Terminkalender die<br />
Bewegung so leicht ermatten konnte,<br />
so ist dies vielleicht vor allem auf die<br />
Schwäche der griechischen Arbeiterbewegung<br />
zurückzuführen. <strong>Die</strong> antikapitalistische<br />
Linke sollte jetzt dringend<br />
konkrete Vorschläge machen,<br />
damit die Bewegung wieder Vertrauen<br />
fasst. Sonst droht sie zu resignieren<br />
oder es kommt zu sozialen Explosionen,<br />
die in der Sackgasse enden. Es<br />
ist jetzt vorrangig, die Bürokraten und<br />
verschiedenen Sektierer daran zu hindern,<br />
die Arbeiterbewegung zu spalten,<br />
indem mit dem Argument zu getrennten<br />
Demonstrationen aufgerufen<br />
wird, die anderen seien Klassenverräter.<br />
In den Kämpfen muss dringend eine<br />
Einheitsdynamik angestoßen werden.<br />
<strong>Die</strong> äußerst sektiererische KKE<br />
(Kommunistische Partei Griechenlands<br />
2 ), die bestens zu spalten versteht,<br />
muss daran gehindert werden.<br />
<strong>Die</strong> Demonstration vom 5. Mai war<br />
nur deshalb so groß und stark, weil<br />
wegen der riesigen Zahl von Teilnehmenden<br />
zwischen den einzelnen Demozügen<br />
kein Abstand durchzusetzen<br />
war. Im Gegenteil: Es kam an jenem<br />
Tag sogar zu einer gewissen Vermischung,<br />
was der KKE-Führung nicht<br />
gefallen hat.<br />
Eine weitere große Schwäche der<br />
Bewegung (wie übrigens auch der Jugendbewegung<br />
im Dezember 2008)<br />
besteht darin, dass ihr jede Selbstorganisierung<br />
fehlt. Ein klarer Fortschritt<br />
hat sich in einer Differenzierung ge-<br />
2 (Kommounistikó kómma Elládas)<br />
18 INPREKORR 468/469
GRIECHENLAND<br />
zeigt. In den Demonstrationszügen<br />
waren Gruppierungen von Gewerkschaftssektionen<br />
oder sogar von regionalen<br />
Gewerkschaftsbünden mit radikalen<br />
Forderungen zu sehen (für unbefristete<br />
Streiks). Aber de facto gibt<br />
es bis heute keine wirkliche Arbeiterkoordination.<br />
<strong>Die</strong> radikale und antikapitalistische<br />
Linke (Syriza, Antarsya)<br />
hat zur Schaffung von Einheitskomitees<br />
gegen die Abbaumaßnahmen aufgerufen,<br />
aber bis heute sind sie nicht<br />
sehr zahlreich und mit einem zu kleinen<br />
Echo, um wirklich Gewicht zu haben.<br />
<strong>Die</strong> Bildung von offenen und demokratischen<br />
Strukturen der Selbstorganisierung<br />
vorschlagen und dazu<br />
beitragen ist eine weitere Priorität.<br />
Kommt eine weitere Dimension<br />
dazu: <strong>Die</strong> Radikalität der Forderungen<br />
der KKE („Gegen den Kapitalismus<br />
… und die Monopole“) und<br />
der der PASOK nahe stehenden Gewerkschaftsführungen<br />
(„Wir bezahlen<br />
nicht für ‚deren’ Krise“) mag manchmal<br />
erstaunen. <strong>Die</strong> Forderungen und<br />
Transparente der kleinsten Demonstrationen<br />
zeigen klar eine Massenradikalisierung.<br />
Doch dahinter stehen große<br />
Zweifel wie bei der <strong>ganze</strong>n europäischen<br />
Arbeiterbewegung. In den Augen<br />
der allermeisten Lohnabhängigen<br />
muss sich die konkrete Umsetzung der<br />
am meisten erhobenen Forderungen<br />
erst noch zeigen. <strong>Die</strong>s gilt für Massenforderungen<br />
wie „Nein zu den Privatisierungen!“,<br />
„Keine (Teil-) Rückzahlung<br />
der Schulden!“, „Kein Geld für<br />
die Armee!“. <strong>Die</strong> kürzliche Gründung<br />
eines Komitees gegen die Rückzahlung<br />
der Schulden, das dem CADTM 3 nahe<br />
steht, ist eine gute Sache, aber die fortschrittlichsten<br />
Teile der Arbeiterbewegung<br />
müssen dringend zusammen solche<br />
Fragen diskutieren, um für solche<br />
Forderungen wirksame und selbstorganisierte<br />
Massenkämpfe zu initiieren.<br />
DIE KOMMENDEN WOCHEN<br />
<strong>Die</strong> Kämpfe der Lohnabhängigen und<br />
Jugendlichen muss neu lanciert werden.<br />
Denn die Troika stellt weitere<br />
Forderungen. Sie verlangt die Deregulierung<br />
des Arbeitsrechts (keine<br />
Flächentarifverträge mehr in der<br />
Privatwirtschaft), weitere Privatisie-<br />
3 Komitee für die Annullierung der Schulden der<br />
„Dritten Welt“.<br />
4.5.2010: Besetzung der Akropolis durch die KP Griechenlands (KKE)<br />
rungen (die Bahnen sind im Visier).<br />
<strong>Die</strong> Unternehmer verlangen Steuergeschenke,<br />
und Papandreou scheint bereit,<br />
die Gewinnsteuer von 24 % auf<br />
20 % zu senken, was bedeutet, dass es<br />
in den öffentlichen Kassen noch weniger<br />
Geld geben wird. Vor diesem Hintergrund<br />
erstaunt es nicht, dass einer<br />
von zwei EinwohnerInnen Papandreou<br />
nicht glaubt, wenn er verspricht,<br />
dieses Jahr keine weiteren Abbaumaßnahmen<br />
mehr zu erlassen.<br />
<strong>Die</strong> Gemeinde- und Regionalwahlen<br />
Anfang November sind in diesem<br />
Zusammenhang fast eine Farce.<br />
<strong>Die</strong>s auch, weil sie zugleich die zunehmende<br />
Dezentralisierung der Sparpolitik<br />
und einen wahnsinnigen Fusionsprozess<br />
der Gemeinden absegnen.<br />
Wenn auch in verzerrter Form, so werden<br />
sie doch das Kräfteverhältnis widerspiegeln.<br />
<strong>Die</strong> Wahlabstinenz wird<br />
groß sein. <strong>Die</strong> AntikapitalistInnen<br />
müssen diese Menschen ansprechen<br />
können. Heute besteht das Hauptproblem<br />
in der schnellen Stärkung der antikapitalistischen<br />
Linken in einem Umfeld,<br />
wo sich links der PASOK (in der<br />
es für zentrifugale Kräfte ein gewisses<br />
Potenzial gibt) die KKE zu verstärken<br />
scheint (laut Umfragen auf 9 %), wo<br />
Syriza abstürzt (2,8 % verglichen mit<br />
6,8 % der extrem rechten LAOS 4 ) und<br />
4 Laïkós Orthódoxos Synagermós – „orthodoxe<br />
wo es zwischen der ehemaligen und<br />
der heutigen Führungsfigur von Syriza<br />
zum offenen Streit gekommen ist.<br />
<strong>Die</strong>s wiederum hat dazu geführt, dass<br />
es in Attika, der größten Arbeiterregion<br />
Griechenlands, zwei Syriza-Kandidaturen<br />
geben wird. Wir kommen darauf<br />
zurück, denn die Situation verändert<br />
sich rasch, und eine Bilanz Bilanz<br />
dieses radikal-reformistischen Bündnisses<br />
drängt sich auf. Wichtig ist aber<br />
vor allem die Frage, ob der antikapitalistische<br />
Zusammenschluss Antarsya<br />
(mit – unter anderen – den beiden<br />
wichtigsten Organisationen der revolutionären<br />
Linken und mit OKDE-Spartakos,<br />
der griechischen Sektion der IV.<br />
Internationale), welche bei den Mobilisierungen<br />
im Frühling eine Rolle gespielt<br />
hat, die wahrgenommen wurde,<br />
sich zu entwickeln vermag.<br />
Athen, 15. September 2010<br />
Tassos Anastassiadis und Andreas Sartzekis<br />
sind Leitungsmitglieder der OKDE-Spartakos,<br />
griechische Sektion der IV. Internationale.<br />
<strong>Die</strong>se wiederum ist Mitglied des Bündnisses<br />
der antikapitalistischen Linken Antarsya.<br />
Übersetzung: Ursi Urech<br />
Sammlung des Volkes“ (Wikipedia: „völkischorthodoxe<br />
Sammlung“), wobei das Parteikürzel<br />
selbst wieder „Volk“ bedeutet.<br />
INPREKORR 468/469 19
OSTEUROPA<br />
Osteuropa in der Systemkrise<br />
Catherine Samary<br />
Der Aufbau eines vereinten Europa rief<br />
Hoffnungen unter der Bevölkerung hervor,<br />
die im diametralen Gegensatz zur<br />
gegenwärtigen Entwicklung standen.<br />
Ein weltoffenes Europa, in dem keine<br />
Politik gegen das Volk gemacht würde<br />
und das auf demokratischen, sozialen,<br />
ökologischen und solidarischen Werten<br />
basiert – so waren die Hoffnungen<br />
in Osteuropa, dessen Bevölkerung sich<br />
ein freieres und besseres Leben versprach.<br />
Ihre Erwartungen wurden zutiefst<br />
enttäuscht und damit der Boden<br />
für fremdenfeindliche Tendenzen geschaffen.<br />
Um wieder Herr der eigenen<br />
Entscheidung werden und über ihre<br />
Zukunft bestimmen zu können, müssen<br />
die Betroffenen verstehen, welche Umbrüche<br />
in der Vergangenheit stattgefunden<br />
haben und wo es Fehlentwicklungen<br />
gegeben hat und wie die gegenwärtige<br />
Krise beschaffen ist.<br />
DER EINTRITT OSTEUROPAS IN<br />
DIE NEUE WELTORDNUNG WÄH-<br />
REND DER 80ER JAHRE<br />
<strong>Die</strong> 70er Jahre waren geprägt durch eine<br />
Krise der Profitrate und der Weltordnung,<br />
die die kapitalistischen Metropolen<br />
betraf. <strong>Die</strong> Länder Ost- und Mitteleuropas<br />
hingegen waren weiterhin<br />
von der wirtschaftlichen „Unterstützung“<br />
durch die UdSSR abhängig, die<br />
durch Panzerläufe gelegentlich ergänzt<br />
wurde, wie das Beispiel der Tschechoslowakei<br />
zeigte. Zu ihrer Verschuldung<br />
gegenüber Moskau in nicht konvertierbaren<br />
Rubeln, die sich im Rahmen<br />
der Tauschbeziehungen innerhalb<br />
des RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe)<br />
ergab, kamen nunmehr<br />
Schulden in harter Währung hinzu,<br />
die besonders drückten. <strong>Die</strong> UdSSR<br />
war davon nicht betroffen, da sie noch<br />
dem finanziellen und ökonomischen<br />
Boykott des Kalten Krieges unterworfen<br />
war, der seit 1917 den Import<br />
von Spitzentechnologie blockiert hatte.<br />
<strong>Die</strong> Öffnung gegenüber Westimporten<br />
mit dem Ziel, moderne Technologien<br />
zu erwerben, ging daher – mit der<br />
Billigung Moskaus – von den osteuropäischen<br />
Ländern aus, die nicht dem<br />
westlichen Boykott unterlagen. Für<br />
die betroffenen Regimes ging es auch<br />
um den Erwerb westlicher Konsumgüter,<br />
um die Unzufriedenheit unter der<br />
eigenen Bevölkerung nach den fehlgeschlagenen<br />
Wirtschaftsreformen in<br />
den 60ern aufzufangen. Zudem sollten<br />
westliche Technologien Qualität und<br />
Produktivität in der Exportwirtschaft<br />
verbessern, damit durch diese Exporte<br />
die Schulden in fremder Währung bezahlt<br />
werden konnten. Durch den bürokratischen<br />
Konservatismus jedoch<br />
wurden die Technologieimporte wenig<br />
effizient eingesetzt, so dass die Verschuldung<br />
immer weiter anstieg und<br />
durch die steigenden Zinssätze Anfang<br />
der 80er noch zusätzlich beschleunigt<br />
wurde.<br />
Zugleich war mit dem Regierungsantritt<br />
von Reagan das Wettrüsten nach<br />
der Sowjetintervention in Afghanistan<br />
in eine entscheidende Phase eingetreten,<br />
was der Sowjetunion in der ersten<br />
Hälfte der 80er schwer zu schaffen<br />
machte. Den USA hingegen ermöglichte<br />
dies eine Offensive auf mehreren<br />
Ebenen, in denen sie selbst von der<br />
Krise betroffen war. Einerseits wurden<br />
im eigenen Land durch die öffentlichen<br />
Rüstungsausgaben Forschung und Innovation<br />
gefördert und die seit Beginn<br />
des Jahrzehnts in der Rezession steckende<br />
Wirtschaft angekurbelt. Andererseits<br />
wurde im internationalen Maßstab<br />
die Wiedererlangung der politischmilitärischen<br />
und technologischen Hegemonie<br />
eingeläutet und durch die militärischen<br />
Interventionen des Folgejahrzehnts<br />
gesichert. <strong>Die</strong> technologische<br />
Revolution in den USA und den<br />
entwickelten kapitalistischen Ländern,<br />
die entscheidend dazu beitrug, dass die<br />
herrschenden Klassen die sozialen Verhältnisse<br />
und die Weltordnung neu aufstellen<br />
konnten, stellte den Vorsprung<br />
vor den UdSSR und Osteuropa wieder<br />
her, der in den Jahrzehnten nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg drastisch geschrumpft<br />
war.<br />
In den 80er Jahren wurde die Schuldenkrise<br />
in etlichen osteuropäischen<br />
Ländern – Rumänien, Jugoslawien,<br />
Ungarn, Polen und der DDR – unübersehbar.<br />
Unfähig zu einer wirklichen<br />
Reform von innen, solange es nicht zu<br />
einer echten antibürokratischen Transformation<br />
der Gesellschaft kam, hatten<br />
sie sich in den 70er Jahren munter<br />
bei den Banken 1 verschuldet, um westliche<br />
Technologie zu importieren. <strong>Die</strong>se<br />
Schuldenkrise war Auftakt zu einer<br />
neuen historischen Phase, in der die<br />
osteuropäischen Gesellschaften von<br />
außen real unter Druck gesetzt werden<br />
konnten, zumal die UdSSR unter Gorbatschow<br />
dam<strong>als</strong> ihr „Engagement“<br />
nach außen zurückzunehmen begann,<br />
um ihrerseits westliche Kredite für die<br />
fällige eigene Modernisierung zu erhalten.<br />
<strong>Die</strong> Jagd nach harter Währung<br />
zur Finanzierung der Importe führte<br />
Ende der 80er Jahre zu neuen Spannungen<br />
und Pressionen innerhalb des<br />
RGW, da die Sowjetunion inzwischen<br />
ihrerseits auf Schuldentilgung – möglichst<br />
in harter Währung – bestand,<br />
und stellte die Außenpolitik unter den<br />
Primat, vom Westen Gelder und Technologien<br />
zu erhalten. Nunmehr wurde<br />
die „Nichteinmischungspolitik“ praktiziert,<br />
wie das Abkommen mit dem<br />
Kanzler Kohl zur deutschen Wiedervereinigung<br />
zeigte.<br />
Inzwischen hatten die fünf verschuldeten<br />
Länder Osteuropas sich<br />
wirtschaftlich und politisch in unterschiedlicher<br />
Weise neu ausgerichtet,<br />
was sich entscheidend bei der historischen<br />
Wende hin zu einem neuen<br />
System Anfang der 80er Jahre auswirken<br />
sollte:<br />
Jugoslawien geriet in den 80ern<br />
unter den Druck des IWF und war<br />
durch die aufkommenden sozialen<br />
und ethnischen Konflikte so-<br />
1 In den 70er Jahren haben die westlichen<br />
Banken versucht die Petro-Dollars anzulegen,<br />
in dem sie den Ländern des Südens<br />
umfangreiche Kredite anboten. Weniger<br />
bekannt ist, dass sie das auch in Bezug auf<br />
östliche Staaten (Jugoslawien, Ungarn,<br />
Rumänien, Polen und die DDR) taten. Deren<br />
Schuldenkrise im folgenden Jahrzehnt war<br />
ein entscheidender Hebel für den auswärtigen<br />
Druck durch westliche Gläubiger und den<br />
WWF.<br />
20 INPREKORR 468/469
OSTEUROPA<br />
wie durch die dreistellige Hyperinflation<br />
<strong>als</strong> Ausdruck der Zersetzung<br />
des Systems paralysiert. <strong>Die</strong> ethnischen<br />
Säuberungskriege, die mit<br />
der Zerschlagung des jugoslawischen<br />
Staatenbundes und Systems<br />
einherging, und die Untauglichkeit<br />
der Friedenspläne von EU und UN<br />
wurden von den USA ausgenutzt,<br />
um die Nato nach Auflösung des<br />
Warschauer Paktes neu zu positionieren:<br />
<strong>Die</strong> Jugoslawienkrise war<br />
ein entscheidender Schritt zur euroatlantischen<br />
Integration dieser Region.<br />
2<br />
<strong>Die</strong> ungarische KP-Führung war die<br />
einzige, die auf die Außenverschuldungskrise<br />
mit dem Ausverkauf der<br />
heimischen Spitzenunternehmen<br />
an ausländisches Kapital reagierte,<br />
was anfangs eine nur moderate<br />
Austeritätspolitik im Innern ermöglichte<br />
und Ungarn im darauf folgenden<br />
Jahrzehnt des „Übergangs“<br />
zum Hauptziel ausländischer Direktinvestitionen<br />
machte. Und im<br />
Gefolge der von Gorbatschow geschaffenen<br />
neuen europäischen Beziehungen<br />
zögerten sie auch nicht,<br />
für ein gewisses Entgegenkommen<br />
am Fall der Mauer mitzuwirken.<br />
Umgekehrt wollte der Diktator<br />
Ceausescu die rumänischen Schulden<br />
komplett auf dem Rücken des<br />
eigenen Volkes zurück bezahlen.<br />
Schließlich schreckte die Nomenklatura<br />
selbst vor der Sprengkraft<br />
dieses Vorhabens zurück und inszenierte<br />
eine Pseudorevolution, die<br />
mit der Hinrichtung des Diktators<br />
Ende der 80er Jahre endete.<br />
Zur gleichen Zeit beschloss die<br />
BRD, sich die DDR wieder einzuverleiben<br />
– im Einverständnis mit<br />
der Sowjetunion, die von Deutschland<br />
Ausgleichszahlungen im Zuge<br />
der Truppenrückführung erhielt.<br />
In Polen schließlich ermöglichten<br />
Kompromissabkommen nach<br />
der Unterdrückung von Solidarnosc<br />
unter dem Regime von General<br />
Jaruzelski die Einführung einer<br />
neoliberalen Schocktherapie, die<br />
von einem Schuldenerlass durch<br />
die USA Anfang der 90er Jahre gestützt<br />
wurde. Man scheute keine<br />
Kosten, um die neuen „Eliten“ an<br />
2 S. die Website von Catherine Samary (in<br />
französisch) http://csamary.free.fr, in den<br />
Artikeln wird auf die „Unordnung in der Welt“<br />
eingegangen.<br />
der Macht für Privatisierungen und<br />
die Nato zu gewinnen.<br />
Aber wie war das Wachstum (<strong>als</strong> BIP<br />
ausgedrückt) beschaffen, das nach der<br />
Zerstörung des alten Systems unter<br />
den Bedingungen der Marginalisierung<br />
(im Sinne der Unterordnung unter<br />
externe Maßstäbe und Finanzierungen)<br />
entstand und dem EU-Eintritt<br />
voranging?<br />
Bei der Beantwortung dieser Frage<br />
müssen wir zwei Hauptphasen unterscheiden<br />
und dabei den Sonderweg<br />
Sloweniens vor der politischen Kehrtwende<br />
2008/9 berücksichtigen.<br />
1989 BIS ENDE DER 90ER JAH-<br />
RE: „SYSTEMKRISE“ UND „PRI-<br />
VATISIERUNG OHNE KAPITAL“<br />
<strong>Die</strong> 90er Jahre wurden zum Jahrzehnt<br />
der durchgängigen Zerstörung des alten<br />
Systems (Privatisierungen, geänderte<br />
Kriterien der Unternehmensführung<br />
etc.) in zwei Phasen: in der ersten<br />
Hälfte brach die Wirtschaft in allen<br />
Branchen um 20-30 % ein. Dann<br />
setzte eine Erholung ein 3 , die ungleich<br />
von statten und mit Arbeitsplatzverlusten<br />
und Lohnspreizungen<br />
einher ging. „<strong>Die</strong> Ungleichheit wuchs<br />
in der Wirtschaft aller Übergangsgesellschaften“,<br />
an deren „Ausgang die<br />
weltweit geringsten Ungleichheiten<br />
bestanden hatten“. 4<br />
Ohne diese Quelldaten ließe sich<br />
nicht verstehen, warum zu Beginn der<br />
90er Jahre bei den ersten pluralistischen<br />
Wahlen – die Haupterrungenschaft<br />
gegenüber den alten Regimes<br />
– die Stimmen des Volkes an die ehemaligen<br />
KPen gingen. <strong>Die</strong>s war nicht<br />
Ausdruck einer Sehnsucht nach dem<br />
Einparteienstaat, der radikal abgelehnt<br />
wurde, sondern nach dem Recht<br />
auf einen Arbeitsplatz und Zugang für<br />
Alle zu den elementaren Gütern und<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen. Bloß, dass dann die<br />
„Ex“ diese Rechte nicht weiter ver-<br />
3 Polen war das erste Land, dessen Wirtschaft<br />
wieder wuchs und das Niveau des BIP von<br />
1989 wieder erreichte ... durch Streichung<br />
seiner Auslandsschulden – was selten erwähnt<br />
wird – und einem Jahrzehnt der Repression<br />
ausgehend von einem sehr tiefen Niveau. …<br />
Nur die Länder Zentraleuropas haben im Jahr<br />
2000 das Niveau ihres BIP von 1989 wieder<br />
erreicht.<br />
4 Weltbank (BM), Regional Overview , 1998. S.<br />
auch BM „Dix ans de transition“, Bericht von<br />
2002.<br />
traten, die mit dem Verständnis von<br />
Wachstum und „Konvergenz“ seitens<br />
Westeuropas nicht vereinbar waren.<br />
Fortan wurde der „Aufholungsprozess“<br />
gegenüber dem Westen nur noch<br />
nach Wachstumsraten des BIP definiert,<br />
was keineswegs ein Indikator<br />
des „Wohlergehens“ ist. <strong>Die</strong> Angleichung<br />
der Systeme wurde nach Privatisierungsgrad<br />
bemessen. Bloß, woher<br />
kam das Geldkapital? Im alten System<br />
war eine Akkumulation nicht möglich<br />
und diejenigen, die früher den<br />
Parteienstaat verwaltet hatten, zogen<br />
es nun vor, Nutznießer der Privatisierungen<br />
zu sein. Also wurden die „Massenprivatisierungen“<br />
geschaffen, bei<br />
denen die Unternehmen auf verschiedene<br />
Weise legal in private GmbH umgewandelt<br />
wurden. Ihr Gesellschafterkapital<br />
wurde in Anteile unterteilt und<br />
virtuell kostenlos verteilt – teils an die<br />
Beschäftigten und BürgerInnen und<br />
der Rest an den Staat. Nur Ungarn und<br />
Estland entschieden gleich zu Beginn<br />
des „Übergangs“ ihre führenden Unternehmen<br />
für „echtes“ Geld-Kapital<br />
zu verkaufen, d. h. an ausländisches<br />
Kapital. 5<br />
1999–2008: EU-ERWEITERUNG<br />
NACH OSTEN UND ZUTIEFST<br />
UNAUSGEWOGENES WACHS-<br />
TUM<br />
Das 1999 beschlossene Unterfangen<br />
der EU, zehn mittel- und osteuropäische<br />
Länder aufzunehmen 6 zielte de<br />
facto darauf ab, die wachsende Unzufriedenheit<br />
in der Bevölkerung einzudämmen.<br />
<strong>Die</strong>se zeigt sich bis heute auf<br />
Wahlebene in zunehmender Stimmenthaltung<br />
und Voten für fremdenfeindliche<br />
Parteien und in der Problematik,<br />
regierungsfähige Mehrheiten zu bilden.<br />
Somit war die Erweiterung geo-<br />
5 <strong>Die</strong> Entwicklung dieser Analysen über die<br />
„große kapitalistische Transformation“ im<br />
Osten, sowie die Ausdehnung der EU nach<br />
Osten sind zu finden auf der Website http://<br />
csamary.free.fr. S. ebenfalls Jean-Pierre<br />
Pagé, „Europe de l’Est : économie politique<br />
d’une décennie de transition“, Critique<br />
internationale, n° 6, hiver 2000.<br />
6 Nach den acht im Jahr 2004 zusammen mit<br />
Zypern und Malta zuerst aufgenommenen<br />
Ländern, denen Rumänien und Bulgarien im<br />
Jahr 2007 folgten, versprach die Ratstagung<br />
von Thessaloniki im Jahr 2003, dass die<br />
EU sich auch für Kandidatenländer auf<br />
dem westlichen Balkan (Albanien und die<br />
Republiken Ex-Jugoslawiens mit Ausnahme<br />
Sloweniens, das schon Mitglied ist) öffnen<br />
würde.<br />
INPREKORR 468/469 21
OSTEUROPA<br />
Tabelle 1: Durchschnittliche Wachstumsrate des BSP und der<br />
Beschäftigtenzahlen<br />
BSP<br />
politisch motiviert, ging aber nicht mit<br />
Maßnahmen einher, die soziale und<br />
wirtschaftliche Stabilität herstellten.<br />
(Tabelle 1)<br />
<strong>Die</strong> Unterschiede bzgl. des BIP pro<br />
Einwohner zwischen den ärmsten und<br />
reichsten E-Staaten betrugen nach dem<br />
Beitritt Spaniens und Portug<strong>als</strong> bis zum<br />
4,9-fachen. Nach dem Beitritt Rumäniens<br />
und Bulgariens reichte die Spanne<br />
bis zum 20,1-fachen. Aber während die<br />
Erweiterung um die südeuropäischen<br />
Länder und Irland durch eine Aufstockung<br />
des EU-Budgets um Strukturbeihilfen<br />
flankiert worden war, wurde mit<br />
der „Agenda 2000“ der EU das Gegenteil<br />
beschlossen. Deutschland hatte seine<br />
eigene Währung nur unter der Maßgabe<br />
strikter Haushaltsvorgaben aufgegeben<br />
und war nicht bereit, für die Integration<br />
der Länder Mittel- und Osteuropas<br />
„zuzuzahlen“. 7 Hingegen konnte<br />
Deutschland bei der Erweiterung „kassieren“:<br />
viele Arbeitsplätze wurden<br />
dorthin verlagert, wodurch die Löhne<br />
in Deutschland unter Druck gerieten<br />
und das (schwache) Wirtschaftswachstum<br />
in den ersten zehn Jahren des neuen<br />
Jahrtausend auf Exportüberschüssen<br />
beruhte. Der EU-Haushalt wurde<br />
auf ein Prozent des BIP gedeckelt<br />
7 <strong>Die</strong> Vereinigung Deutschlands führte während<br />
eines Jahrzehnts zum Transfer von ca. jährlich<br />
100 Milliarden DM in die neuen Länder.<br />
1989-1994 1994-2000 2000-2007<br />
Beschäftigtenzahl<br />
BSP<br />
BSP<br />
– wohingegen der Bundeshaushalt der<br />
USA bei 20 % liegt – und die Maastricht-Verträge<br />
limitierten zugleich die<br />
Verschuldung und das Staatsdefizit und<br />
untersagten jedwede Staatsfinanzierung<br />
durch die Zentralbanken zu ermäßigten<br />
oder zinslosen Bedingungen <strong>als</strong><br />
Voraussetzung für den Beitritt in die<br />
Euro-Zone.<br />
So wurden diese Länder i. W. dazu<br />
getrieben, auf private Finanzierung zurückzugreifen,<br />
die <strong>als</strong> effizient gepriesen<br />
wurden und mit freiem Kapitalverkehr<br />
einhergingen.<br />
Wie können ausländische Direktinvestitionen<br />
angezogen werden? Durch<br />
Sozial- (niedrigere Löhne und Sozi<strong>als</strong>icherung)<br />
und Steuerdumping. <strong>Die</strong> Kapit<strong>als</strong>teuerquote<br />
sank zwischen 2000<br />
und 2009 um 8,4 Punkte, wobei im<br />
Osten die niedrigsten Lasten bestehen<br />
mit der stärksten Ausprägung in Lettland,<br />
wo nur 15 % vs. 23,5 % im EU-<br />
Gesamtdurchschnitt erhoben werden. 8<br />
In Einklang mit den „Kriterien“ wurde<br />
die Senkung der Einkommenssteuer<br />
flankiert von Einschnitten bei den Sozialausgaben.<br />
Als Ungarn die Staatsausgaben<br />
für Erziehung und Gesundheit<br />
zwischen 2003 und 2006 erhöhen<br />
wollte, musste es sich an die Finanz-<br />
8 S. Eurostats vom 22 Juni 2009.<br />
Nahezu die gesamten Schulden Osteuropas<br />
in Höhe von 1,7 Billionen Dollar<br />
werden de facto von westeuropäischen<br />
Banken gehalten – darunter Osterreich,<br />
Italien, Frankreich, Belgien,<br />
Deutschland und Schweden mit zu-<br />
Beschäftigtenzahl<br />
Beschäftigtenzahl<br />
Bulgarien -5,7 -5,8 -0,2 0,0 5,6 2,0<br />
Estland -1,6 -4,3 5,8 -2,7 8,0 1,7<br />
Ungarn -3,2 -4,2 3,6 0,5 3,8 0,3<br />
Lettland -11,2 -5,1 4,3 -2,3 9,0 2,4<br />
Litauen -11,5 -2,0 4,5 -1,2 8,0 1,3<br />
Polen -1,6 -3,6 5,7 -0,2 4,0 0,6<br />
Tschech. Republik -2,3 -2,0 2,2 -0,8 4,5 0,8<br />
Rumänien -4,6 -1,8 0,1 -2,4 6,1 -0,8<br />
Slowakei -2,4 nd* 3,8 -0,6 6,2 1<br />
Slowenien -2,3 -4,6 4,3 -0,3 4,4 0,9<br />
Tabelle 2 : Das unausgewogene Wachstum der baltischen Länder vor<br />
der Krise<br />
2006 Litauen Estland Lettland<br />
Anstieg des BIP 7,8 % 10,4 % 12,1 %<br />
Zunahme der Kredite 35,0 % 53,0 % 52,0 %<br />
Leistungsbilanz<br />
(in % des BIP)<br />
-9,5 % -14,6 % -21,3 %<br />
Source : BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich)<br />
märkte wenden, um das Staatsdefizit<br />
von 9 % zu finanzieren.<br />
<strong>Die</strong> freie Kapitalbewegung erschließt<br />
andere, private Finanzierungsquellen:<br />
die Banken. Nach der kapitallosen<br />
Privatisierung entstand im ersten<br />
Jahrzehnt 2000 eine existentielle Abhängigkeit<br />
von den Banken, die durch<br />
die EU-Mitgliedschaft befördert wurde.<br />
(Tabelle 2)<br />
In 2008 lagen die Bankschulden in den<br />
zehn neuen Mitgliedstaaten mit der<br />
Ausnahme Sloweniens größtenteils bei<br />
Auslandsbanken (65-80 % für Lettland<br />
und Polen und 82–100 % für die anderen<br />
sieben). 9 Slowenien bewahrte hartnäckig<br />
70 % des Bankengeschäfts unter<br />
staatlicher Kontrolle und zudem den<br />
Großteil seiner Infrastruktur (Energieund<br />
Transportwesen …) trotz der wiederholten<br />
Vorhaltungen seitens EU-<br />
Kommission, Weltbank, OECD und<br />
EBRD. 10 Der für Slowenien einmalige<br />
Einfluss der Gewerkschaften, die mehrere<br />
Gener<strong>als</strong>treiks organisierten, setzte<br />
den Einschnitten bei Steuern und Löhnen<br />
Grenzen. Somit verfügt Slowenien<br />
über die geringsten „Konkurrenzvorteile“<br />
aller mittel- und osteuropäischen<br />
Staaten in puncto Löhne … und über<br />
den geringsten Grad an ausländischen<br />
Direktinvestitionen pro Kopf, die zwischen<br />
1989 und 2008 bei 1500 Dollar<br />
lagen, während der Durchschnitt etwa<br />
4500 Dollar beträgt und in der Spitze<br />
bei über 6500 Dollar (Ungarn und Estland)<br />
liegt. Das BIP pro Kopf hingegen<br />
ist das höchste von all diesen Ländern<br />
und reicht an Spanien heran. <strong>Die</strong>s verhinderte<br />
freilich nicht, dass es „schlechte<br />
Noten“ wegen der mangelnden Compliance<br />
für die „Regeln“ des reinen und<br />
vollendeten (ungleichen) Wettbewerbs<br />
erhielt.<br />
DAS NEUE OSTEUROPÄISCHE<br />
„MEZZOGIORNO“ VOR DEM KRI-<br />
SENTEST<br />
9 Quelle: EBRD (Europäische Bank für<br />
Wiederaufbau und Entwicklung).<br />
10 In dem Bericht über Slownien „Transition<br />
report“ 2009, S. 224, werden alle diese Klagen<br />
dargestellt.<br />
22 INPREKORR 468/469
OSTEUROPA<br />
sammen 84 %. <strong>Die</strong> Privatbanken räumten<br />
jedoch öffentlichen Schuldnern und<br />
Verbraucherkrediten Vorrang ein, um so<br />
den multinationalen Konzernen den Zugang<br />
zum Einzelhandel und zu Immobilieninvestitionen<br />
zu ebnen. Der Irrsinn<br />
des durch Verschuldung angeheizten<br />
Konsums bei gleichzeitiger allgemeiner<br />
Verarmung war somit die Grundlage für<br />
den jüngsten Wachstumsschub – bes. in<br />
den baltischen Staaten – und der damit<br />
einher gehenden zutiefst unausgewogenen<br />
Handelsbilanz, letzteres namentlich<br />
in den Ländern, deren Währungskurs<br />
durch die rigide Anbindung an den<br />
Euro konstant gehalten wird – wiederum<br />
bes. in den baltischen Staaten.<br />
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts verführten<br />
die weltweit sinkenden Zinssätze<br />
zur Verschuldung in Fremdwährung,<br />
wo immer günstige Wechselkurse bestanden.<br />
Fast 90 % der in Ungarn seit<br />
2006 aufgenommenen Hypotheken lauten<br />
in Schweizer Franken und die Gesamtsumme<br />
der Darlehen in SF außerhalb<br />
der Schweiz liegt bei schätzungsweise<br />
500 Mrd. Euro. 45 % der Immobiliendarlehen<br />
und 40 % aller Verbraucherkredite<br />
lauten in SF – mehr <strong>als</strong> in<br />
der landeseigenen Währung Forint. Als<br />
die Zinsen auf den SF stiegen und die<br />
Kapitalflucht den Kurs des Forint verfallen<br />
ließ, waren die Folgen fatal.<br />
<strong>Die</strong> vorwiegend von österreichischen<br />
und schwedischen Instituten gewährten<br />
Darlehen entsprechen 20 % des<br />
BIP in Tschechien, Ungarn und der Slowakei<br />
und 90 % in den baltischen Staaten.<br />
Allein 2009 mussten diese Länder<br />
umgerechnet 400 Mrd. Dollar zurückzahlen<br />
oder umschulden – ein Viertel<br />
des BIP der gesamten EU <strong>als</strong>o. (Tabelle<br />
3)<br />
Ab September 2008 schlugen die<br />
Kapitalabflüsse und Exportrückgänge<br />
in etlichen Ländern durch und zwangen<br />
sie, sich an den IWF zu wenden. In erster<br />
Linie waren die Länder betroffen,<br />
deren Wirtschaftswachstum am stärksten<br />
von Darlehen und Finanzierungen<br />
von außen abhing, nämlich Ungarn,<br />
die Ukraine und die baltischen Staaten.<br />
In 2009 wies lediglich Polen 11 eine<br />
(schwach) positive Wachstumsrate<br />
auf, während in den anderen Ländern<br />
der Region ein Rückgang zwischen 3 %<br />
und über 10 % zu verzeichnen war – am<br />
11 Außer den Ländern Zentral- und Ost-Europas<br />
hatte Albanien 2009 noch eine Wachstumsrate<br />
von 3 Prozent, bevor dort die Rezession<br />
Anfang 2010 begann.<br />
Tabelle 3 : Wachstumsrate des BSP und der Beschäftigtenzahlen (und<br />
Arbeitlosenquote) 2008 und 2009<br />
2008 2009<br />
BSP<br />
meisten betroffen wiederum das Baltikum<br />
– was entsprechende politische und<br />
soziale Krisen nach sich zog.<br />
Natürlich kamen jetzt Zweifel auf 12 :<br />
„<strong>Die</strong> mittel- und osteuropäischen Länder<br />
waren (…) bereits vor Ausbruch der<br />
Krise durch die strukturelle Unausgewogenheit<br />
ihres Wachstumsmodells angeschlagen.<br />
Insofern war der Integrationsprozess<br />
wohl nicht wirklich nachhaltig.<br />
(…) Aber es bedurfte offensichtlich<br />
erst der Krise, damit dies augenscheinlich<br />
wurde.“ 13<br />
Nichtsdestotrotz galt in dem Bericht<br />
der EBRD von 2009 die <strong>ganze</strong> Sorge der<br />
Weiterführung der Privatisierungen und<br />
der Marktfinanzierung <strong>als</strong> Inbegriff des<br />
„Übergangs“. Aus guten Gründen ist<br />
man erfreut darüber, dass sich die dort<br />
engagierten westlichen Banken nicht<br />
wie bloße Spekulanten einfach zurückgezogen<br />
haben. Dennoch gehen die finanziellen<br />
Engagements angesichts der<br />
damit verbundenen Risiken zurück.<br />
EIN RÜCKBLICK AUF DIE<br />
„GROSSZÜGIGEN“ ANGEBOTE<br />
BEI DER „HISTORISCHEN“ VER-<br />
EINIGUNG EUROPAS<br />
Der Fall der Berliner Mauer war für<br />
Osteuropa der Auftakt zu einer neuen<br />
geschichtlichen Etappe. Zugleich war<br />
12 S. Jason Bush, „Latvia’s Crisis Mirrors<br />
eastern Europe’s Woes“, vom 03.03.2009 nach<br />
Spiegelonline.<br />
13 Alexandre Vincent, „PECO : la convergence à<br />
l’épreuve de la crise“. In : Conjoncture Nr. 1,<br />
Januar 2010.<br />
Reallohn<br />
BSP<br />
Beschäftigtenzahl<br />
(Arbeitslosen-quote)<br />
Beschäftigtenzahl<br />
(Arbeitslosenquote)<br />
Reallohn<br />
Bulgarien 6,0 3,3 (5,6) 7,4 -1,6 -2,2 (7,9) 3,4<br />
Estland<br />
-3,6 0,2 (5,5) 4,1 -10,3 -7,0 (15,2) -3,6<br />
Ungarn<br />
0,5 -1,2 (7,8) 1,5 -6,3 -3,0 (9,9) -3,2<br />
Lettland<br />
-4,6 0,7 (7,5) 0,9 -13,1 -8,9 (20,9) -10,8<br />
Litauen 3,0 -0,5 (5,8) 4,3 -11,0 -7,7 (13,8) -12,9<br />
Polen 4,8 4,0 (7,1) 3,7 -1,4 -2,3 (8,4) 0,8<br />
Tschech. Republik<br />
3,2 1,2 (4,4) 0,8 -2,7 -1,7 (7,1) 2,1<br />
Rumänien 7,1 0,3 (5,8) 12,0 -4,0 -2,2 (6,4) 2,2<br />
Slowenien 3,5 2,9 (4,4) 2,0 -3,4 -4,7 (6,2) 1,6<br />
Slowakei 6,4 2,9 (9,5) 4,2 -2,6 -1,7 (12,2) 2,5<br />
Quelle: Eurostat und online database des WIIW (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche)<br />
er aber auch ein Wendepunkt der neoliberalen<br />
Globalisierung und des Aufbaus<br />
eines vereinten Europa.<br />
<strong>Die</strong> Maastricht-Verträge von 1992<br />
versuchten, die sozialökonomische<br />
und politische Heterogenität der Mitgliedsstaaten<br />
zu glätten, indem sie<br />
strenge monetaristische Kriterien<br />
festlegten, die in keinem anderen der<br />
reichsten Staaten dieses Planeten (Japan,<br />
USA …) angewendet werden:<br />
Begrenzung der Staatsdefizite und –<br />
schulden, wobei Finanzhilfen für die<br />
Mitgliedsstaaten durch die Zentralbanken<br />
innerhalb der Eurozone verboten<br />
sind. Hintergrund für die weitgehend<br />
willkürlichen Kriterien war bei den<br />
Verhandlungen der Verzicht Deutschlands<br />
auf die eigene Währung und seine<br />
Vorbehalte gegenüber der „Laxheit“<br />
der Randstaaten. Dam<strong>als</strong> misstraute<br />
Deutschland den Ländern am südlichen<br />
Rand der EU bei der Einführung<br />
des Euro und der künftigen Rolle der<br />
EZB. Von einem Beitritt der Länder<br />
Mittel- und Osteuropas war noch lange<br />
nicht die Rede. Es stand außer Zweifel<br />
– und Deutschland nahm es sogar<br />
in seine Verfassung auf – dass die EZB<br />
einem Mitgliedsstaat in Schwierigkeiten<br />
nicht beistehen durfte. <strong>Die</strong> nationalen<br />
Haushalte waren <strong>als</strong>o gehalten,<br />
für Ausgeglichenheit zu sorgen, ohne<br />
dass auf europäischer Ebene ein Ausgleich<br />
für die daraus entstehenden Probleme<br />
vorgesehen war.<br />
<strong>Die</strong> früheren Erweiterungen um die<br />
Länder im Süden waren mit einer Erhöhung<br />
des europäischen Budgets –<br />
INPREKORR 468/469 23
OSTEUROPA<br />
insbesondere des sogenannten Kohäsionsfonds<br />
– verbunden, um die Länder<br />
zu unterstützen, deren BIP unterhalb<br />
des Durchschnitts lag. <strong>Die</strong> neuen Erweiterungen<br />
wurden mit einem minimalen<br />
europäischen Budget vorgenommen.<br />
Das französich-deutsche Duo<br />
setzte für die Dekade 2000 eine Deckelung<br />
dieses Budgets auf 1 Prozent<br />
des BIP fest. <strong>Die</strong> EU hat somit eine gemeinsame<br />
Währungspolitik, die unterschiedliche<br />
Auswirkungen auf Staaten<br />
mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen<br />
hat. Sie verfügt nicht über ein<br />
Budget, das ausreicht, um diese Asymmetrien<br />
auf dem Wege der Umverteilung<br />
auszugleichen und setzt stattdessen<br />
<strong>als</strong> gemeinsamen Wert ein Recht<br />
auf Wettbewerb durch, das Vorrang vor<br />
den Prinzipien von Solidarität und sozialer<br />
Sicherheit hat.<br />
Hinter diesen Kriterien steckten<br />
große Machtunterschiede zwischen<br />
den Staaten, und es gab insbesondere<br />
eine „deutsche Ausnahme“, festgeschrieben<br />
im europäischen Verfassungsprojekt:<br />
im Zeitraum von mehr<br />
<strong>als</strong> 10 Jahren beliefen sich die Transfers<br />
von der Bundesrepublik in die<br />
„neuen Länder“ auf mehr <strong>als</strong> 100 Mil-<br />
Lebenserwartung in den osteuropäischen Ländern 1970 und 2002 im Vgl. zu Frankreich<br />
Durchschnitt 1970–1975 Durchschnitt 2000–2005<br />
Bulgarien 98,1 % 89,7 %<br />
Ungarn 95,7 % 91,0 %<br />
Polen 97,4 % 93,5 %<br />
Tschech. Republik 96,8 % 95,4 %<br />
Rumänien 95,6 % 89,2 %<br />
Slowakei 96,7 % 93,3 %<br />
Quelle: UNDP-Bericht 2004 zur menschlichen Entwicklung<br />
Vor der geschlossenen<br />
Tveruniversalbank<br />
liarden DM pro Jahr (pro Jahr mehr<br />
<strong>als</strong> die Gesamtsumme privater Investitionen<br />
in den Ländern von Zentralund<br />
Ost-Europa in der <strong>ganze</strong>n Periode).<br />
Im Verlauf des Jahrzehnts haben<br />
diese kolossalen Resourcen nicht dazu<br />
geführt, dass die Ostdeutschen sich<br />
besser fühlten (wie ihre Unzufriedenheit<br />
und ihr politisches Verhalten zeigen),<br />
sondern zum Abbau des Sozi<strong>als</strong>taats,<br />
zu Privatisierungen und zum<br />
Drücken der Einkommen unter dem<br />
Druck der Konkurrenz mit dem benachbarten<br />
Ländern Osteuropas.<br />
Standortverlagerungen wurden<br />
durch die Vergrößerung der Union begünstigt.<br />
Und Deutschland benutzte<br />
seine Nähe zu den neuen östlichen Mitgliedsstaaten,<br />
um eine radikale Lohnausterität<br />
durchzusetzen: zwischen<br />
2000 und 2007 nahmen die nominalen<br />
bereinigten Arbeitskosten in Deutschland<br />
pro Jahr um 0,2 Prozent ab, während<br />
sie in Frankreich um 2 Prozent,<br />
in Großbritannien um 2,3 Prozent und<br />
zwischen 3,2 und 3,7 Prozent in Italien,<br />
Spanien, Irland und Griechenland stiegen<br />
(in den Ländern der Peripherie war<br />
die nominelle Steigerung wie auch die<br />
Inflationsrate höher).<br />
Und da gabe es noch einen weiteren<br />
Faktor, der für tiefe Ungleichgewichte<br />
in dieser Konstruktion sorgte:<br />
das (schwache) deutsche Wachstum<br />
basierte auf Exportüberschüssen verbunden<br />
mit niedriger Inflation, schwacher<br />
Inlandsnachfrage und einem durch<br />
die Standortverlagerung von deutschen<br />
Werken nach Osten begünstigten radikalen<br />
Rückgang des Lohnniveaus. Aber<br />
den Exportüberschüssen Deutschlands<br />
standen wachsende Defizite der Peripherie<br />
im Süden und Osten gegenüber,<br />
ohne dass es sich bei letzterem um ein<br />
homogenes Ganzes handelt. 14<br />
Global gesehen, ist neben dem<br />
„neuen Europa“, dessen untergeord-<br />
Fortsetzung Seite 29<br />
14 <strong>Die</strong> Wachstumsstrategien unterschieden<br />
sich von Griechenland (Finanzierung von<br />
Konsumwachstum durch Verschuldung)<br />
bis Spanien, das für sein Wachstum auf ein<br />
Szenarium ähnlich der Immobilienblase in<br />
den Vereinigten Staaten und Großbritannien<br />
setzte. Im Osten gab es in Polen mehr<br />
Wachstumsfaktoren, die daher weniger<br />
anfällig waren, <strong>als</strong> in den baltischen<br />
Republiken. Und da die Länder Zentral- und<br />
Ost-Europas mit Ausnahme von Slowenien<br />
und der Slowakei nicht zur Eurozone<br />
gehörten, war die Unterschiedlichkeit ihrer<br />
Austauschbeziehungen und Budgetpolitik<br />
noch größer.<br />
24 INPREKORR 468/469
die<br />
internationale<br />
die 4<br />
internationale 2010<br />
Benjamins Thesen<br />
Zu Band 19 der Kritischen Gesamtausgabe 1<br />
Helmut Dahmer, Wien<br />
„Vergangenes1historisch artikulieren<br />
heißt […], sich einer<br />
Erinnerung bemächtigen,<br />
wie sie im Augenblick einer<br />
Gefahr aufblitzt“, schrieb der<br />
Mitte März 1933 aus Hitlerdeutschland<br />
nach Paris geflohene<br />
Philosoph und Literaturkritiker<br />
Walter Benjamin in der<br />
sechsten seiner achtzehn Thesen<br />
„Über den Begriff der Geschichte“.<br />
Nach dem Verlust<br />
der Publikationsmöglichkeiten<br />
bei deutschen Zeitungen und<br />
Verlagen in dürftigen Verhältnissen<br />
lebend, in steter Sorge<br />
um das Stipendium, das er von<br />
dem in die USA emigrierten<br />
(Frankfurter) „Institut für Sozialforschung“<br />
erhielt, arbeitete<br />
Benjamin in der zweiten<br />
Hälfte der dreißiger Jahre vor<br />
allem an einer großen Studie<br />
über Baudelaire 2 und (im Zusammenhang<br />
damit) an seinem<br />
unvollendet gebliebenen „Passagen-Werk“<br />
3 . Der kampflose<br />
Sieg Hitlers über die deutsche<br />
Arbeiterbewegung und die<br />
Verleugnung dieser Niederlage<br />
durch die stalinisierte Komintern,<br />
der „Große Terror“ in der<br />
Sowjetunion mit den Moskauer<br />
Schauprozessen gegen die<br />
alten Bolschewiki, der Niedergang<br />
der „Volksfront“ in Fran-<br />
1 Benjamin, Walter (2010): Über<br />
den Begriff der Geschichte. Werke<br />
und Nachlaß, Kritische Gesamtausgabe,<br />
Bd. 19. Herausgegeben<br />
von Gérard Raulet. Berlin (Suhrkamp),<br />
380 Seiten, 34.80 Euro.<br />
2 Benjamin (1974): Charles Baudelaire.<br />
Ein Lyriker im Zeitalter<br />
des Hochkapitalismus. In: Benjamin,<br />
Gesammelte Schriften, Bd. I.<br />
2, Frankfurt, S. 509-690.<br />
3 Benjamin (1982): Das Passagen-<br />
Werk. Ges. Schr., Bd. V. 1 und 2,<br />
Frankfurt.<br />
kreich und die Niederlage der<br />
Republikaner im spanischen<br />
Bürgerkrieg machten die Hoffnung<br />
des Emigranten auf eine<br />
europäische Arbeiterrevolution,<br />
die einen zweiten Weltkrieg<br />
verhindern könnte, zunichte.<br />
1937/38 begann er, sich der<br />
„theoretischen Armatur“ zu<br />
vergewissern, die seinen historischen<br />
Arbeiten (über das<br />
deutsche Trauerspiel der Barockzeit<br />
und die Kunstkritik<br />
der deutschen Romantik)<br />
ebenso wie seinem ‚work in<br />
progress’ (der „Passagenarbeit“)<br />
zugrunde lag. In der Folge<br />
des Hitler-Stalin-Pakts vom<br />
23. August 1939, der Hitler die<br />
Möglichkeit gab, halb Polen<br />
zu besetzen und sodann in rascher<br />
Folge auch Dänemark,<br />
Norwegen, die Niederlande<br />
und Belgien, geriet Benjamin<br />
– wie viele andere deutsche<br />
Flüchtlinge in Frankreich – in<br />
einen tödlichen M<strong>als</strong>trom. Zunächst<br />
wurde er ins Olympia-<br />
Stadion von Colombes (bei<br />
Paris) beordert, das <strong>als</strong> Sammelplatz<br />
für „feindliche Ausländer“<br />
diente, dort zehn Tage<br />
lang festgehalten und dann für<br />
drei Monate in einem anderen<br />
Auffanglager (in einem heruntergekommenen<br />
Schloss bei<br />
Nevers) interniert.<br />
Als er, gesundheitlich angeschlagen,<br />
Ende November<br />
endlich nach Paris zurückkehren<br />
konnte und seine Arbeit in<br />
der Nationalbibliothek wieder<br />
aufnahm, blieb ihm noch ein<br />
gutes halbes Jahr, ehe die deutschen<br />
Truppen (am 14. 6. 1940)<br />
Paris besetzten. Benjamin floh<br />
rechtzeitig mit Zehntausenden<br />
südwärts, über Lourdes nach<br />
Marseille. Max Horkheimer<br />
und anderen Freunden gelang<br />
es schließlich, ihn mit den erforderlichen<br />
Papieren auszustatten,<br />
die es ihm ermöglichen<br />
sollten, den Menschenfängern<br />
„Vichy“-Frankreichs und der<br />
Gestapo zu entkommen und<br />
über Franco-Spanien die Vereinigten<br />
Staaten zu erreichen.<br />
Doch der Alkalde 4 von Port<br />
Bou, das Benjamin mit einer<br />
kleinen Gruppe von Flüchtlingen<br />
nach einem beschwerlichen<br />
Fußmarsch erreicht hatte,<br />
drohte, sie über die Grenze<br />
zurückzuschicken. Daraufhin<br />
endete Benjamin in der Nacht<br />
vom 26. auf den 27. September<br />
1940 sein Leben mit Hilfe von<br />
Morphium-Tabletten.<br />
In seine „Geschichtsphilosophischen<br />
Thesen“ nahm<br />
er Bruchstücke aus früher geschriebenen,<br />
veröffentlichten<br />
und unveröffentlicht gebliebenen<br />
Texten ebenso wie Zitate<br />
aus neueren Lektüren auf. Ihre<br />
definitive Gestalt erhielten sie<br />
erst in den Monaten, die auf<br />
den Schock des Hitler-Stalin-<br />
Paktes und der Internierung<br />
folgten, <strong>als</strong>o zwischen Dezember<br />
1939 und Mai 1940. Benjamin<br />
sorgte dafür, dass dies<br />
„Vermächtnis“ – das Legat<br />
einer „geschlagenen Generation“<br />
– in unterschiedlichen<br />
Versionen an einige wenige<br />
gute Freunde ging: Ein Exemplar<br />
erreichte über Hannah<br />
Arendt Theodor W. Adorno,<br />
ein anderes übermittelte seine<br />
Schwester Dora Benjamin mit<br />
Hilfe von Martin Domke ebenfalls<br />
Adorno; der für Gershom<br />
Scholem bestimmte Text ging<br />
4 Bürgermeister, (Anm. d. Red.)<br />
verloren, und das von Georges<br />
Bataille (mit anderen Manuskripten<br />
Benjamins) in der<br />
„Bibliothèque Nationale“ versteckte<br />
„Handexemplar“ der<br />
Thesen übergab dessen Witwe<br />
erst 1981 unter dem Siegel<br />
der Verschwiegenheit Giorgio<br />
Agamben...<br />
Benjamin markierte drei<br />
Grundfehler „unserer linken<br />
Führer“: ihren Fortschrittsoptimismus,<br />
das Vertrauen auf ihre<br />
„Massenbasis“ und „ihre servile<br />
Einordnung in einen unkontrollierbaren<br />
Apparat“. Besonders<br />
dem „frömmelnden<br />
Optimismus“ galt (wie er Mitte<br />
Dezember 1939 an Horkheimer<br />
schrieb) sein „unerbittlicher<br />
Haß“. Einflussreiche<br />
Historiker des 19. Jahrhunderts<br />
wie Leopold von Ranke<br />
oder Fustel de Coulanges hatten<br />
die Geschichtsschreibung<br />
dem Modell der Naturwissenschaft<br />
anzunähern gesucht.<br />
„Geschichte“ imaginierten sie<br />
<strong>als</strong> eine Kette von Ereignissen,<br />
die in einer leeren, homogenen<br />
Zeit aufeinander folgen und<br />
sich dann nacherzählen lassen.<br />
Benjamin schrieb, bei der Einfühlung<br />
dieser Historiker in<br />
vergangene Epochen handele<br />
es sich allemal um eine Identifikation<br />
mit den Siegern, und<br />
diese sei eine Folge von „Herzensträgheit“<br />
(acedia), nämlich<br />
der Weigerung, sich der<br />
namenlosen Fronsklaven, der<br />
Unterlegenen, der Opfer der<br />
Kultur zu erinnern und deren<br />
Perspektive einzunehmen.<br />
Unter dem Einfluss neukantianischer<br />
Philosophen (wie<br />
Paul Natorp und Karl Vorländer)<br />
zeichneten sozialdemokratische<br />
Ideologen (Benja-<br />
INPREKORR 468/469 25
die<br />
internationale<br />
min nennt unter anderen Josef<br />
<strong>Die</strong>tzgen und Robert Schmidt)<br />
ein Bild der historischen Entwicklung,<br />
auf dem diese einer<br />
Rolltreppe glich, die die<br />
Menschheit langsam, aber unaufhaltsam<br />
ihrem „Ideal“, der<br />
Zukunftsgesellschaft, näherbrachte.<br />
Angesichts der Katastrophen<br />
seit 1914, der Gräuel<br />
des Faschismus und des Umschlags<br />
der russischen Revolution<br />
in eine despotische Schreckensherrschaft<br />
plädierte Benjamin,<br />
der in den Thesen <strong>als</strong><br />
der „historische Materialist“<br />
(oder „Dialektiker“) auftritt,<br />
für einen radikalen Bruch mit<br />
der Vorstellung von Geschichte<br />
und Geschichtsschreibung,<br />
wie sie dem Historismus ebenso<br />
wie dem Vulgärmarxismus<br />
der Sozialdemokraten zugrunde<br />
lag.<br />
„<strong>Die</strong> Gegenstände, die die<br />
Klosterregel den Brüdern zur<br />
Meditation anwies“, schrieb<br />
er, „hatten die Aufgabe, sie der<br />
Welt und ihrem Treiben abhold<br />
zu machen. Der Gedankengang,<br />
den wir hier verfolgen,<br />
ist aus einer ähnlichen Bestimmung<br />
hervorgegangen. Er beabsichtigt<br />
in einem Augenblick,<br />
da die Politiker, die solange<br />
das große Wort geführt<br />
haben, am Boden liegen und<br />
ihre Niederlage mit dem Verrat<br />
an der eigenen Sache bekräftigen,<br />
das politische Weltkind<br />
aus den Netzen zu lösen,<br />
mit denen sie es umgarnt hatten.“<br />
(X. These)<br />
Seinen „Brüdern“ im Geiste<br />
und in der Politik riet Benjamin,<br />
radikal mit liebgewordenen<br />
Denkgewohnheiten zu<br />
brechen und ein neuartiges<br />
Geschichtsverständnis – das<br />
Faschismus wie Stalinismus<br />
Rechnung trägt – demjenigen<br />
entgegenzusetzen, an dem die<br />
(von ihm nicht genannten) Partei-Führer<br />
und -Ideologen festhielten,<br />
die aus ihren Niederlagen<br />
nichts gelernt hatten. In<br />
seinen Thesen umriss er die<br />
ihm vorschwebende gründliche<br />
Revision des vulgarisierten,<br />
konformistisch gewordenen<br />
historischen Materialismus.<br />
Weder Max Horkheimer<br />
noch Gretel Adorno mochte er<br />
sie in ihrer provisorischen Fassung<br />
vorlegen, schon gar nicht<br />
wollte er sie veröffentlicht sehen.<br />
Er fürchtete das „enthusiastische<br />
Mißverständnis“ und<br />
hatte bei der Redaktion mindestens<br />
einer der überlieferten<br />
sechs Varianten auch die (französische)<br />
Zensur im Sinn. So<br />
ließ er fort, was er bei den wenigen<br />
guten Freunden, die seinen<br />
Text lesen sollten, glaubte<br />
voraussetzen zu können. <strong>Die</strong>ser<br />
elliptische („knappe“, „reduzierte“)<br />
und darum enigmatische<br />
Charakter seiner Thesen<br />
hat, seit sie (1942 beziehungsweise<br />
1950) veröffentlicht<br />
wurden, nicht wenig zu<br />
Fehldeutungen beigetragen.<br />
Günther Stern-Anders hielt<br />
sie (laut Brecht) für „dunkel<br />
und verworren“, Brecht selbst<br />
aber (1941) für „klar und entwirrend“;<br />
Adorno und Horkheimer<br />
sahen, dass Benjamins<br />
„letzte Konzeption“ ihren eigenen<br />
Intentionen nahekam,<br />
bemängelten aber „eine gewisse<br />
Naivität in den Partien,<br />
in denen von Marxismus und<br />
Politik die Rede ist“, beziehungsweise<br />
die allzu „unverhüllte“<br />
Terminologie.<br />
Hannah Arendt und Heinrich<br />
Blücher wiederum hielten<br />
die Thesen für eine Art Abrechnung<br />
mit der Philosophie<br />
Horkheimers und Adornos,<br />
und Arendt fürchtete gar, diese<br />
„Schweinebande“ werde<br />
den Text „einfach unterschlagen“:<br />
„<strong>Die</strong> werden sich rächen,<br />
wie sich Benji im Grunde<br />
durch Schreiben dieser Sache<br />
gerächt hat.“ Jüngst noch<br />
meinte ein Rezensent, vor vier,<br />
fünf Jahrzehnten habe Benjamins<br />
„rätselhafte Orakelrede“<br />
<strong>als</strong> eine Art „heiliger Text“ gegolten,<br />
nun aber – in der neuen<br />
Edition – erwiesen sich seine<br />
Thesen <strong>als</strong> ein weit überschätzter,<br />
widersprüchlicher<br />
und „diffuser Komplex von<br />
Papieren“. 5<br />
<strong>Die</strong> früheste (H. Arendt<br />
übergebene) wie die späteste<br />
Fassung der Thesen (in Benja-<br />
5 Matz, Wolfgang (2010): „Der Engel<br />
der Philologie muß so aussehen.“<br />
Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung, 3. 8. 2010, S. 32.<br />
mins „Handexemplar“) nimmt<br />
im Druck nur 12 oder 13 Seiten<br />
ein. In dem von Gérard<br />
Raulet herausgegebenen Band<br />
19 der Kritischen Gesamtausgabe<br />
der Werke und des Nachlasses<br />
von Benjamin umfassen<br />
die sechs verschiedenen, chronologisch<br />
angeordneten Versionen<br />
der Thesen (samt Faksimiles)<br />
etwa 100 Druckseiten.<br />
Sie werden ergänzt durch<br />
50 Seiten Benjaminscher Entwürfe,<br />
und darauf folgt erst der<br />
Kommentar, der (31 Briefe aus<br />
den Jahren 1940-1967 eingeschlossen)<br />
200 Seiten umfasst.<br />
Vor dem Hintergrund all’<br />
dieser Materialien wird deutlich,<br />
warum Benjamins Reflexionen<br />
schon bei den ersten<br />
Lesern so unterschiedliche<br />
Reaktionen hervorriefen.<br />
Der Versuch, den gesamten<br />
Thesen-Komplex, wie ihn die<br />
neue Edition präsentiert, aus<br />
den Fragmenten, die Benjamin<br />
seinen Freunden übermittelt<br />
hatte, zu erschließen, musste<br />
scheitern. Denn Benjamin hatte<br />
gerade diejenigen Notate, in<br />
denen er das „Programm“ der<br />
Thesen formulierte 6 , zurückbehalten<br />
(oder schon im Entwurf<br />
gestrichen), so <strong>als</strong> folge<br />
er der Maxime „Das Beste,<br />
was du wissen kannst, darfst<br />
du den Buben doch nicht sagen.“<br />
Erst die Reunion der verstreuten<br />
Versionen und Entwürfe<br />
zeigt, dass es sich bei<br />
den Thesen um die Disposition<br />
zu einem theologisch-politischen<br />
Traktat handelt. Dessen<br />
Thema ist die ausstehende<br />
Revolution, eine, die dem ruinösen<br />
„Fortschritt“, wie er im<br />
Rahmen von Ausbeutungsverhältnissen<br />
gedeiht, „Trümmer<br />
auf Trümmer häuft“ und Massaker<br />
auf Massaker, ein Ende<br />
setzt. Der Leser meint, einem<br />
Gespräch der unterschiedlichen<br />
Personen beizuwoh-<br />
6 Es handelt sich dabei vor allem<br />
um das Konvolut IV mit dem Entwurf<br />
einer These XVII a (messianische<br />
Zeit und klassenlose Gesellschaft,<br />
S. 152 f.) und um die<br />
(nur im Handexemplar enthaltene)<br />
These XVIII (über Neukantianismus<br />
und Sozialdemokratie,<br />
S. 42 f.).<br />
nen, die Walter Benjamin in<br />
sich vereinigte, oder hört aus<br />
diesem Symposion die einander<br />
widerstreitenden Stimmen<br />
seiner Freunde Bertolt Brecht<br />
und Gershom Scholem heraus.<br />
Auch andere seiner literarischen<br />
Favoriten kommen zu<br />
Wort: Marcel Proust bringt die<br />
Lehre von der unwillkürlichen<br />
Erinnerung einer verlorenen<br />
Zeit <strong>als</strong> einer „Jetztzeit“ ein,<br />
Schlegel und Novalis mahnen,<br />
„wir sind auf der Erde erwartet<br />
worden“, und Franz Kafka gibt<br />
zu bedenken: „<strong>Die</strong> frohe Botschaft,<br />
die der Historiker der<br />
Vergangenheit mit fliegenden<br />
Pulsen bringt, kommt aus<br />
einem Munde, der vielleicht<br />
schon im Augenblick, da er<br />
sich auftut, ins Leere spricht.“<br />
„Das Subjekt historischer<br />
Erkenntnis ist die kämpfende,<br />
unterdrückte Klasse selbst“,<br />
heißt es (im Anschluss an Georg<br />
Lukács) in der XII. These.<br />
Der revolutionäre Historiker<br />
ist deren Mandatar. Im Unheil<br />
der Gegenwart manifestiert<br />
sich ihm die Quintessenz (oder<br />
„Abbreviatur“) der gesamten<br />
Klassengeschichte. Wo andere<br />
dem technischen Fortschritt<br />
huldigen, erblickt er dessen<br />
Nachtseite, den gesellschaftlichen<br />
Rückschritt. Wo andere<br />
die Kulturgüter feiern, erinnert<br />
er sich mit Grausen der Generationen<br />
von Fronarbeitern,<br />
die vernutzt wurden, um sie zu<br />
schaffen.<br />
Mit Rosa Luxemburg (im<br />
Text ist von „Spartacus“ die<br />
Rede) erkennt Benjamin in der<br />
Katastrophe die wahre „Daseinsform“<br />
des Kapitalismus 7 ,<br />
7 „Der Imperialismus führt […]<br />
die Katastrophe <strong>als</strong> Daseinsform<br />
aus der Peripherie der kapitalistischen<br />
Entwicklung nach ihrem<br />
Ausgangspunkt zurück. Nachdem<br />
die Expansion des Kapit<strong>als</strong> vier<br />
Jahrhunderte lang die Existenz<br />
und die Kultur aller nichtkapitalistischen<br />
Völker in Asien, Afrika,<br />
Amerika und Australien unaufhörlichen<br />
Konvulsionen und dem<br />
massenhaften Untergang preisgegeben<br />
hatte, stürzt sie jetzt die<br />
Kulturvölker Europas selbst in<br />
eine Serie von Katastrophen, deren<br />
Schlußergebnis nur der Untergang<br />
der Kultur oder der Übergang<br />
zur sozialistischen Produktionsweise<br />
sein kann.“ Luxemburg,<br />
26 INPREKORR 468/469
die<br />
internationale<br />
in der vermeintlichen Ausnahme<br />
die Regel. Weder die Führer,<br />
Ideologen und Anhänger<br />
der sozialdemokratisch-reformistischen<br />
noch die der stalinisierten<br />
kommunistischen Parteien<br />
haben sich dem gewachsen<br />
gezeigt; ihr Fortschrittsoptimismus<br />
schlug sie mit Blindheit.<br />
1914 wie 1933 und 1939<br />
wurden sie von den „Ereignissen“<br />
überrascht.<br />
Benjamin war – wie Sigmund<br />
Freud – vor allem am<br />
„Problem der Erinnerung (und<br />
des Vergessens)“ interessiert,<br />
und wie dieser überzeugt, dass<br />
stets das Beste vergessen wird,<br />
das nämlich, was, zur Erinnerung<br />
gebracht, aus dem Irrgarten<br />
des Seelen- und Soziallebens<br />
herausführen kann. 8 In<br />
scheinbar aussichtslosen Situationen<br />
erschließt oft nur der<br />
Rückweg einen Ausweg. So<br />
drängen sich Individuen wie<br />
Kollektiven in Augenblicken<br />
äußerster Gefährdung unwillkürlich<br />
Erinnerungsbilder<br />
(Szenen) aus ihrer Geschichte<br />
auf. Ein verborgener – ebenso<br />
bedrückender wie befreiender<br />
– Zusammenhang zwischen<br />
einer bestimmten historischen<br />
Situation und der aktuellen<br />
wird plötzlich kenntlich<br />
und eröffnet dem Mann der<br />
Feder wie dem Mann der Tat<br />
eine „revolutionäre Chance im<br />
Kampfe für die unterdrückte<br />
Vergangenheit“ und gegen eine<br />
Zukunft, die ihr gleicht. Vergangenheit<br />
und Gegenwart finden<br />
zu einer flüchtigen, höchst<br />
bedeutsamen Konstellation zusammen.<br />
So war, schreibt Benjamin,<br />
für Robespierre und die<br />
Seinen das antike Rom „eine<br />
mit ,Jetztzeit‘ geladene Vergangenheit“,<br />
und so verstan-<br />
Rosa ([1915] 1919): <strong>Die</strong> Akkumulation<br />
des Kapit<strong>als</strong> oder Was<br />
die Epigonen aus der Marxschen<br />
Theorie gemacht haben. Eine Antikritik.<br />
In: Luxemburg (1975):<br />
Gesammelte Werke, Bd. 5, Berlin,<br />
S. 521.<br />
8 „Aber das Vergessen betrifft immer<br />
das Beste, denn es betrifft<br />
die Möglichkeit der Erlösung.“<br />
Benjamin ([1934] 1955): „Franz<br />
Kafka. Zur zehnten Wiederkehr<br />
seines Todestages.“ In: Benjamin<br />
(1977): Ges. Schr., Bd. II.2,<br />
Frankfurt, S. 434.<br />
den sich (fügen wir hinzu) die<br />
Bolschewiki <strong>als</strong> neue Jakobiner<br />
(und fürchteten einen russischen<br />
„Thermidor“).<br />
Benjamin, der historische<br />
Materialist, holte sich bei Fortschritts-Skeptikern<br />
(wie Baudelaire),<br />
utopischen Sozialisten<br />
(wie Fourier) und intransigenten<br />
Revolutionären (wie<br />
Blanqui) Rat, vor allem aber<br />
bei Marx selbst, dessen kritische<br />
Begriffe von Arbeit, Natur<br />
und klassenloser Gesellschaft<br />
er sich zu eigen machte.<br />
Im Hintergrund der modernen<br />
Konzeptionen der Weltgeschichte<br />
steht noch immer die<br />
Heilsgeschichte. „Marx hat in<br />
der Vorstellung der klassenlosen<br />
Gesellschaft die Vorstellung<br />
der messianischen Zeit<br />
säkularisiert“, schrieb Benjamin<br />
im Handexemplar seiner<br />
Thesen. 9 Eben dies haben<br />
die Marx-Epigonen verdrängt.<br />
<strong>Die</strong> „messianische“ Zeit beginnt,<br />
wenn der Krieg aller gegen<br />
alle entbehrlich wird und<br />
die „freie Assoziation der Produzenten“<br />
aufhört, ihre Naturbasis<br />
zu verwüsten. Der „Messias“<br />
aber wird erst kommen,<br />
wenn wir ihn nicht mehr brauchen.<br />
10<br />
<strong>Die</strong> klassenlose Gesell-<br />
9 <strong>Die</strong> Folge dieser Säkularisierung<br />
veranschaulichte er in der I. seiner<br />
Thesen mit Hilfe einer Parabel:<br />
Im 18. Jahrhundert trat der<br />
Baron von Kempelen mit einem<br />
unschlagbaren Schachspiel-Automaten<br />
auf. Es handelte sich<br />
dabei um „eine Puppe in türkischer<br />
Tracht“, die – wie eine Marionette<br />
– von einem „buckligen<br />
Zwerg“ mit Hilfe von verborgenen<br />
Schnüren gelenkt wurde, der<br />
sich im Inneren des Schachtischs<br />
verbarg und ein wirklicher Großmeister<br />
war. Benjamin schreibt,<br />
zum Verhältnis von Puppe und<br />
Zwerg finde sich eine Art „Gegenstück<br />
in der Philosophie“: <strong>Die</strong><br />
Puppe „historischer Materialismus“<br />
könne es „ohne weiteres mit<br />
jedem aufnehmen, wenn sie die<br />
Theologie in ihren <strong>Die</strong>nst nimmt,<br />
die heute bekanntlich klein und<br />
häßlich ist und sich ohnehin nicht<br />
darf blicken lassen.“<br />
10 Vgl. Kafka, Franz (1953): Hochzeitsvorbereitungen<br />
auf dem Lande<br />
und andere Prosa aus dem<br />
Nachlaß. Gesammelte Werke, hg.<br />
von Max Brod. („Das dritte Oktavheft“,<br />
Eintrag vom 4.12.1917.)<br />
Frankfurt, S. 90.<br />
Walter Benjamin<br />
schaft wird von leidenden und<br />
denkenden Menschen herbeigeführt;<br />
sie löst die blutige<br />
Ära der Klassengesellschaften<br />
ab. 11 Daran muss das Denken<br />
und Handeln der Revolutionäre<br />
sich messen lassen. Denn<br />
dass alles so weitergeht wie<br />
jetzt und immer schon, ist die<br />
eigentliche Katastrophe. War<br />
die Geschichte der Klassenkämpfe<br />
eine endlose Folge von<br />
Massakern, so kommt alles darauf<br />
an, diese verhängnisvolle<br />
„Kontinuität“ aufzusprengen,<br />
<strong>als</strong>o einen „wirklichen Ausnahmezustand“<br />
(Benjamin)<br />
herbeizuführen. „<strong>Die</strong> klassenlose<br />
Gesellschaft ist nicht das<br />
Endziel des Fortschritts in der<br />
Geschichte sondern dessen so<br />
oft mißglückte, endlich bewerkstelligte<br />
Unterbrechung.“<br />
Hatte Marx im Rahmen der<br />
Eisenbahn-Metaphorik des 19.<br />
Jahrhunderts in den Revolutionen<br />
noch „Lokomotiven“ gesehen,<br />
die den langsamen Zug<br />
der gesellschaftlichen Entwicklung<br />
beschleunigen können,<br />
so hatte Benjamin, ein<br />
11 „<strong>Die</strong> Zentralisation der Produktionsmittel<br />
und die Vergesellschaftung<br />
der Arbeit erreichen einen<br />
Punkt, wo sie unverträglich werden<br />
mit ihrer kapitalistischen<br />
Hülle. Sie wird gesprengt. <strong>Die</strong><br />
Stunde des kapitalistischen Privateigentums<br />
schlägt. <strong>Die</strong> Expropriateurs<br />
werden expropriiert.“<br />
Marx, Karl (1867): Das Kapital.<br />
Kritik der politischen Ökonomie.<br />
Marx-Engels-Werke, Bd. 23, Berlin<br />
1962, Kap. 24, S. 791.<br />
halbes Jahrhundert später, eine<br />
ganz andere Funktion der<br />
Revolutionen im Sinn: „Vielleicht<br />
sind [sie] der Griff des<br />
in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts<br />
nach der<br />
Notbremse.“<br />
Benjamins Thesen haben<br />
der Lektüre von Trotzkis Revolutionsgeschichte<br />
12 vielleicht<br />
ebenso viel zu verdanken<br />
wie der Kabbala. <strong>Die</strong>se<br />
seine „Quellen“ aber teilen<br />
inzwischen das Schicksal der<br />
Schriften Auguste Blanquis,<br />
von dem Benjamin sagte, es<br />
sei der „Sozialdemokratie“ gelungen,<br />
seinen Namen, „dessen<br />
Erzklang das [19.] Jahrhundert<br />
erschüttert hat“, „fast<br />
auszulöschen“. In tiefer Vergessenheit<br />
harren sie einer Generation,<br />
die sie wieder herbeizitiert,<br />
weil sie verzweifelt<br />
nach einem Ausweg sucht.<br />
Denn auch nach dem Untergang<br />
Hitlers und Stalins hinterlässt<br />
uns der „Fortschritt“<br />
allenthalben verbrannte Erde,<br />
Ruinen und Massengräber.<br />
12 „Im übrigen war ich vierzehn<br />
Tage ganz im Russischen versunken:<br />
ich habe erst die Geschichte<br />
der Februarrevolution von Trotzki<br />
gelesen und bin jetzt im Begriff,<br />
seine Autobiographie zu beendigen.<br />
Seit Jahren glaube ich<br />
nichts mit so atemloser Spannung<br />
in mich aufgenommen zu haben.“<br />
Benjamin an Gretel Karplus,<br />
Mitte Mai 1932. In: Benjamin<br />
(1998): Gesammelte Briefe, Bd.<br />
IV (1931-1934), Frankfurt, S. 97.<br />
INPREKORR 468/469 27
die<br />
internationale<br />
Wilebaldo Solano (1917–2010)<br />
Symbol einer Generation<br />
Jaime Pastor<br />
Mit Wilebaldo Solano ist am 7.<br />
September in Barcelona einer<br />
der besten Repräsentanten jener<br />
Generation von RevolutionärInnen<br />
verstorben, die in den<br />
1930er Jahren in Erscheinung<br />
getreten ist und für die der Ausspruch<br />
„es ist einfach, sein Leben<br />
für die Revolution hinzugeben,<br />
viel schwieriger ist es,<br />
ihr sein <strong>ganze</strong>s Leben zu widmen“<br />
voll und ganz zutrifft.<br />
Er ist 1916 in Burgos geboren,<br />
kam kurz darauf nach Barcelona,<br />
und seit seinem Abitur<br />
beteiligte er sich an dem<br />
Kampf für den Sozialismus,<br />
den er niem<strong>als</strong> aufgeben sollte.<br />
<strong>Die</strong>ses Engagement hat bedeutet,<br />
dass er 1932 dem Bloc Obrer<br />
i Camperol (BOC, Arbeiterund<br />
Bauernblock) beitrat, 1935<br />
Gener<strong>als</strong>ekretär der Iberischen<br />
Kommunistischen Jugend und<br />
1936 Mitglied im Exekutivkomitee<br />
der Partido Obrero de<br />
Unificación Marxista (POUM,<br />
Arbeiterpartei der marxistischen<br />
Vereinigung) wurde.<br />
Nach den Maitagen 1937,<br />
dem Verbot seiner Partei und<br />
der Verschleppung von Andreu<br />
Nin wurde er im April<br />
1938 von Kräften der „republikanischen<br />
Ordnung“ festgenommen<br />
und ins Gefängnis<br />
gesteckt. Das gleiche geschah<br />
ihm im Exil in Frankreich auf<br />
Anordnung eines Gerichts im<br />
<strong>Die</strong>nste der Nazis. Nachdem<br />
er im Juli 1944 von der Résistance<br />
befreit worden war, bildete<br />
er das Batallón Libertad<br />
(Bataillon Freiheit), das weitere<br />
gefangene Genossen befreite,<br />
darunter Juan Andrade, einen<br />
Mitbegründer der Spanischen<br />
Kommunistischen Partei und<br />
der POUM.<br />
Im Exil wurde er 1947 zum<br />
Gener<strong>als</strong>ekretär der POUM und<br />
Direktor ihrer Zeitung La Batalla<br />
gewählt. In den sechziger<br />
Jahren gründete er in Paris die<br />
Zeitschrift Tribuna Socialista,<br />
die zum Organ der „POUM-<br />
Linken“ wurde und zu dem<br />
Sektor der POUM, der in die<br />
Sozialistische Partei von Katalonien<br />
eintrat, auf Distanz ging.<br />
Trotz des Scheiterns von<br />
Versuchen, eine neue starke revolutionäre<br />
Linke aufzubauen,<br />
die dazu in der Lage gewesen<br />
wäre, das Geschehen bei der<br />
„transición“ [dem Übergang,<br />
am Ende des Franco-Regimes]<br />
in Spanien zu ändern, blieb er<br />
bei seinem unermüdlichen politischen<br />
Engagement; er gab<br />
die Geschichte und die Ideen<br />
der POUM weiter und blieb<br />
dem Gedenken an sie treu, indem<br />
er für einen Sozialismus<br />
kämpfte, der einen radikalen<br />
Bruch mit dem Kapitalismus<br />
und mit dem Stalinismus darstellt.<br />
Da Wilebaldo nicht nur über<br />
die Vergangenheit gesprochen<br />
hat, übte er mit politischer Festigkeit<br />
und einer enormen Leidenschaft<br />
für die Zukunft nachdrücklich<br />
Kritik an der Wirklichkeit<br />
eines ständig wilderen<br />
Kapitalismus. Er trat dafür ein,<br />
den Begriff des „Sozialismus“<br />
von seiner Belastung durch den<br />
Stalinismus zu befreien.<br />
<strong>Die</strong>jenigen, die davon profi-<br />
tieren konnten, wie er und seine<br />
Lebensgefährtin María Teresa<br />
Freundschaft und Überzeugungen<br />
lebten – bei mir war<br />
dies seit unserer ersten Begegnung<br />
1969 der Fall –, werden<br />
ihn nie vergessen.<br />
Ein Teil seiner Schriften,<br />
Vorträge und Interviews sind<br />
auf der Webseite der Stiftung<br />
Andreu Nin (http://www.fundanin.org/biowile.htm)<br />
zugänglich.<br />
Man sollte sein Buch zur<br />
Geschichte der POUM lesen. 1<br />
Aus dem Französischen übersetzt<br />
von Friedrich Dorn.<br />
1 Wilebaldo Solano, El POUM<br />
en la historia. Andreu Nin en la<br />
revolución española, Madrid:<br />
Libros de la Catarata, 1999;<br />
2. Aufl. 2000. Französische<br />
<strong>Ausgabe</strong>: Le POUM. Révolution<br />
dans la guerre d’Espagne, aus dem<br />
Spanischen übersetzt von Olga<br />
Balaguer u. Manuel Periañez, mit<br />
einem Vorwort von Jean-René<br />
Chauvin u. Patrick Silberstein,<br />
Paris: Éditions Syllepse, 2002,<br />
(Collection Utopie Critique).<br />
Kapitalistische Klimaveränderung und unsere Aufgaben<br />
Resolution des 16. Weltkongresses der Vierten Internationale, Februar<br />
2010<br />
Im Anhang: Beschluss desWeltkongresses zur Klimawandel-Konferenz<br />
in Cochabamba und Hinweise zum Weiterlesen<br />
24 Seiten, Preis: 1 € (im Direktverkauf)<br />
Bestellungen der Broschüre nur gegen Vorkasse: bitte Brief schicken<br />
und Briefmarken im Wert von 1,50 € beilegen.<br />
Herausgegeben von:<br />
internationale sozialistische linke (isl), Regentenstr. 57–59, 51063 Köln<br />
isl@islinke.de, http://www.islinke.de<br />
Revolutionär Sozialistischer Bund/IV. Internationale (RSB), Postfach<br />
102610, 68026 Mannheim, Telefon und Fax 0621 / 15 64 046<br />
buero@rsb4.de, http://www.rsb4.de/<br />
28 INPREKORR 468/469
OSTEUROPA<br />
Fortsetzung von Seite 24<br />
nete Rolle die lange Beitrittsphase<br />
kennzeichnete, die südliche Peripherie<br />
der Euro-Zone das schwache Kettenglied<br />
des „alten asymmetrischen Europa“.<br />
Deutschland hat zusammen mit<br />
Frankreich die Kriterien von Maastricht<br />
festgelegt und war eines der ersten<br />
Länder, die sie nicht respektierten.<br />
Deutschland kontrolliert das<br />
Budget und (Tabelle 4) betont, wie<br />
viel es einzahlt, ohne zu sagen, wie<br />
viel es durch seine Exporte einstreicht.<br />
Es profitiert von der Krise, indem<br />
es auf den Euro und die öffentliche<br />
Verschuldung Griechenlands, Spaniens<br />
und der schwächsten Staaten spekuliert,<br />
um die eigene Austeritätspolitik<br />
im sozialen Bereich und bei den<br />
Löhnen zu festigen.<br />
NEUE AUSTERITÄTSPLÄNE:<br />
DIE PERIPHERIE GEGEN DAS<br />
ZENTRUM<br />
<strong>Die</strong> Kräfteverhältnisse zwischen den<br />
Staaten, ihre jeweilige Stärke und die<br />
sozialen Widerstände im Innern bestimmen<br />
die Kriterien des Umgangs<br />
mit der Staatverschuldung. Und die<br />
zentralen Länder, in denen bei Festansprachen<br />
der „Rückzug des Staates“<br />
zugunsten der Märkte und des privaten<br />
Sparens gepriesen wurde, verzeichnen<br />
seit 30 Jahren einen Anstieg<br />
der öffentlichen Verschuldung. Der<br />
war in den Vereinigten Staaten, dem<br />
„alten Europa“ und Japan wesentlich<br />
höher <strong>als</strong> in der Nachkriegsperiode,<br />
die durch sozialen Staatinterventionismus<br />
gekennzeichnet war. 15 Es<br />
gab geringere Steuereinnahmen aufgrund<br />
sinkender Wachstumsraten und<br />
wegen der neoliberalen Entscheidung,<br />
dem Kapital Steuerbefreiungen zu gewähren.<br />
<strong>Die</strong> Sozialausgaben wurden<br />
gesenkt, aber wegen des Anstiegs der<br />
Arbeitslosigkeit und des sozialen Widerstandes<br />
konnten sie nicht beseitigt<br />
werden. In den Vereinigten Staaten<br />
führte der Anstieg der Rüstungsausgaben<br />
in den 80er Jahren, dem letzten<br />
Jahrzehnt des „Kalten Krieges“, und<br />
dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts<br />
zu einem kolossalen Wachstum<br />
der Staatsverschuldung, durch die das<br />
15 S. die detaillierte Darstellung von Alain<br />
Bihr, „Que cache la croissance de la dette<br />
publique ?“. Online unter: http://www.cadtm.<br />
org/Que-cache-la-croissance-de-la.<br />
Rumänien: Streikende Bergleute (1991)<br />
Wirtschaftswachstum gestützt wurde.<br />
Allgemein hat der Rückgriff auf die<br />
Emission von Staatsanleihen (statt der<br />
Finanzierung durch die Zentralbanken)<br />
zu einer Erhöhung der Zinssätze<br />
(und damit der „Bedienung der Schulden“)<br />
geführt, um spekulatives Kapital<br />
anzulocken.<br />
Mit anderen Worten: die neue Phase<br />
der Krise der öffentlichen Verschuldung<br />
bewegt sich in einem Rahmen,<br />
der durch das Versagen des Liberalismus<br />
gekennzeichnet ist. Aber sie ist<br />
auch eine neue Phase der Bankenkrise<br />
von 2007 bis 2009, deren Epizentrum<br />
sich in den USA befindet und die<br />
sich von dort auf die <strong>ganze</strong> Welt ausgedehnt<br />
hat. <strong>Die</strong> massiven Unterstützungszahlungen<br />
zur Rettung der Privatbanken,<br />
die Opfer ihrer Gier und<br />
Finanzprodukte wurden, und die Konjunkturstützungsprogramme<br />
um der<br />
Weltwirtschaftskrise zu begegnen, haben<br />
zu der neuen Krise geführt, die<br />
insbesondere Europa betrifft. <strong>Die</strong> Rettung<br />
der Privatbanken durch die Zentralbanken<br />
und die Konjunkturstützungsprogramme,<br />
die von den Staaten<br />
aufgelegt wurden, haben den Wachstumsrückgang<br />
gestoppt, aber nicht<br />
die Entlassungen und nicht die spekulative<br />
Logik, die nach wie vor wirkt.<br />
Und die Banken verwenden heute das<br />
Geld, das sie zu niedrigsten Zinssätzen<br />
erhalten, gegen die Staaten, die sie<br />
wieder flott gemacht haben.<br />
Der ideologische Diskurs über die<br />
Staatsverschuldung verfolgt folgende<br />
Ziele: einerseits wird versucht, unter<br />
Hinweis auf die Dringlichkeit und die<br />
Offensichtlickeit „notwendiger“ Austeritätsmaßnahmen<br />
zu verbergen, in<br />
welchem Maß diese „Notwendigkeit“<br />
variabler geometrischer Natur ist; andererseits<br />
geht es darum, die wahren<br />
Ursachen der Verschuldung, die mit<br />
INPREKORR 468/469 29
OSTEUROPA<br />
den Transformationen seit der Wende<br />
in den 80er Jahren verbunden sind, zu<br />
verschleiern. <strong>Die</strong> Änderung der Verteilung<br />
der neu geschaffenen Werte zuungunsten<br />
der Löhne, die <strong>als</strong> zu reduzierende<br />
Kosten gesehen wurden, war begleitet<br />
von der Verschuldung der Haushalte<br />
zur Stützung des Konsums, insbesondere<br />
auf dem Wohnungssektor.<br />
Der wachsende Anteil der Profite,<br />
der nicht reinvestiert wurde, wurde<br />
für spekulative Anlagen in Finanzprodukten<br />
bzw. für die freie Kapitalzirkulation<br />
verwendet. <strong>Die</strong> liberalen<br />
Versprechungen, einen Beitrag zu Effektivität<br />
und Freiheit zu leisten, übersetzen<br />
sich heute in Verlängerung der<br />
Arbeitszeiten, die Zerstörung sozialen<br />
Schutzes und der Umwelt, die Herrschaft<br />
des Königs Geld beim Zugang<br />
zu Bildung, Wohnung und Gesundheit<br />
(und für Millionen von Bauern zu Boden<br />
und Wasser).<br />
ZU DEN WURZELN DER KRISE<br />
GEHEN …<br />
<strong>Die</strong> Effekte dreier Krisen sind dabei<br />
zusammenzuwirken. Es handelt sich<br />
um die von 2007 bis 2009, deren Ausgangspunkt<br />
die USA war, das Herz<br />
des globalisierten Systems; die zweite<br />
ist die Bedrohung des Euro in Gestalt<br />
der schwachen Mitglieder der Eurozone;<br />
die dritte hat 2009 begonnen und<br />
trifft Osteuropa. <strong>Die</strong>se Krisen haben<br />
etwas gemeinsam: egal ob es sich um<br />
die USA, Griechenland oder die baltischen<br />
Staaten handelt, lassen sie sich<br />
auf ein wachsendes Ungleichgewicht<br />
zurückführen, bei dem die Schwäche<br />
der Lohnentwicklung und der Staatseinkommen<br />
durch eine massive Verschuldung<br />
kompensiert wurde, eine<br />
Quelle von Finanzprofiten. Der wahnsinnige<br />
Höhenflug dieser Verschuldung<br />
wurde – wie in jeder kapitalistischen<br />
Krise seit dem XIX Jahrhundert<br />
– erleichtert durch Finanz- und Börsengeschäfte,<br />
die von dem freien Kapital<br />
getätigt wurden.<br />
Der Rückgriff auf den IWF in den<br />
zwei „Peripherien“ der EU zielt darauf<br />
ab, diese Architektur zu erhalten.<br />
Angewandt im Zentrum der europäischen<br />
Konstruktion zeigt er einerseits<br />
die Anfälligkeit der Union auf<br />
und verstärkt sie gleichzeitig: es geht<br />
darum, das monetaristische Joch der<br />
Verträge wieder in den Sattel zu heben,<br />
in dem man die private Finanzwirtschaft<br />
schützt, die für die Krise direkt<br />
verantwortlich ist und von ihr profitiert.<br />
Ziel ist es unter Ausnutzung der<br />
Krise, eine neue Radikalisierung der<br />
bisher schon verfolgten Politik durchzusetzen:<br />
die Sozialausgaben, die auf<br />
der Solidarität zwischen den Generationen<br />
basierenden Renten, die Einkommen<br />
im öffentlichen <strong>Die</strong>nst, die<br />
letzten sozialen Sicherungen sollen<br />
eingedampft werden. <strong>Die</strong> extreme Flexibilisierung<br />
der Arbeit, die gegen jeden<br />
Gedanken kollektiver Rechte, angemessener<br />
Entlohnung und angemessenen<br />
Status verstößt, soll nicht nur<br />
zusätzlichen Profit schaffen. Sie dient<br />
auch dazu, die Arbeitslosen, arbeitenden<br />
Armen und prekär Beschäftigten<br />
„schuldig“ zu sprechen, „zuviel“ zu<br />
verlangen. Sie soll sie spalten, überlasten,<br />
atomisieren, um sie zu jeder Gegenwehr<br />
unfähig zu machen.<br />
Ohne fortschrittliche Alternativen<br />
weisen die Wahlergebnisse der extremen<br />
Rechten von Ungarn bis zu den<br />
Niederlanden und Schweden auf eine<br />
traurige Zukunft.<br />
Der europäische Aufbau geht wie<br />
in jeder Phase seit seinem Beginn „voran“,<br />
weil die Entscheider (aber auch<br />
die Bevölkerung, in Ermangelung<br />
glaubhafter Alternativen) fürchten,<br />
dass es schlimmer wäre, anzuhalten<br />
<strong>als</strong> weiterzumachen. Nationalistische<br />
und frendenfeindliche Reaktionen<br />
sind Teil dieses möglichen Schlimmeren.<br />
Aber es wird die Akzeptanz der<br />
heute von WWF und den europäischen<br />
Institutionen aufgezwungenen, sozial<br />
zutiefst ungerechten Austeritätspläne<br />
sein, die den fremdenfeindlichen Antieuropäern<br />
den Weg bereiten werden.<br />
Denn es handelt sich um einen spezifischen<br />
europäischen Aufbau, der in<br />
der Krise ist. Er ist eingebettet in den<br />
globalisierten Kapitalismus. <strong>Die</strong> Regierungen,<br />
die an der Macht sind, dienen<br />
den Märkten (alle europäischen<br />
Verträge seit dem Vertrag 1986 sind in<br />
diesem Sinne abgefasst) und die Märkte<br />
dienen den dominierenden Staaten:<br />
sie verstecken sich hinter dem anonymen<br />
„Richterspruch“ der Märkte<br />
und hinter den Verträgen (die sie unterschrieben<br />
haben), um fatalistisch<br />
„festzustellen“, welche Politik am besten<br />
verfolgt werden müsse. Und diese<br />
Politik beinhaltet immer das Gleiche:<br />
Reduktion der Sozialausgaben,<br />
Zerstörung des öffentlichen <strong>Die</strong>nstes,<br />
um neue Bereiche für Privatisierungen<br />
und Finanzspekulation zu erschließen.<br />
<strong>Die</strong> europäischen Verträge und<br />
die Wirtschaftspolitik, deren Ergebnis<br />
sie sind, sind bankrott. Sie wurden mit<br />
variabler Geometrie auf dem Rücken<br />
der Völker abgeschlossen, und ihr Zustandekommen<br />
spricht jeder Demokratie<br />
Hohn, die diesen Namen verdient.<br />
Was geschützt werden muss, ist<br />
die Bewegungsfreiheit und die Freiheit<br />
der Wahl der Menschen, nicht<br />
die des Kapit<strong>als</strong>. Und auf der Ebene,<br />
wo Entscheidungen getroffen werden<br />
– insbesondere der europäischen –<br />
muss der solidarische Widerstand organisiert<br />
werden – und zwar von unten<br />
–, der die Verträge, die Finanzierungen<br />
und die Finalität bei der Befriedigung<br />
sozialer Bedürfnisse und<br />
grundlegender Rechte zum Scheitern<br />
bringt und der sich gegen die Logik<br />
des Schaffens von Sündenböcken (die<br />
„Ausländer“) und des Ausbaus der Sicherheitspolitik,<br />
was mit dem Abbau<br />
sozialer Errungenschaften einhergeht,<br />
richtet. <strong>Die</strong> Kriminalisierung der Armut<br />
und die Ethnisierung sozialer Fragen<br />
zielen darauf ab, durch das Ablenken<br />
von den wahren Gründen und<br />
Verursachern der Krise, die Unterdrückung<br />
der Widerstände zu erleichtern.<br />
Catherine Samary, Wirtschaftswissenschaftlerin,<br />
ist Aktivistin der Nouveau parti anticapitaliste<br />
(Neue Antikapitalistische Partei, NPA,<br />
Frankreich) und Mitglied des Internationalen<br />
Komitees der IV Internationale. Sie ist Autorin<br />
von Yougoslavie, de la décomposition aux<br />
enjeux européens (Éditions du cygne, 2008),<br />
Les conflits yougoslaves de A à Z (L’Atelier,<br />
2000), La Déchirure yougoslave — Questions<br />
pour l’Europe (mit Jean-Arnault Dérens,<br />
L’Harmattan, 1994), Le marché contre l’autogestion,<br />
l’expérience yougoslave, (Publisud-La<br />
Brêche, 1988).<br />
Übersetzung: MiWe und W.Weitz<br />
30 INPREKORR 468/469
TÜRKEI<br />
Türkei – Im Labyrinth der bürgerlichen<br />
Politik<br />
Ümit Çırak<br />
Seit dem Staatsstreich des Militärs am<br />
12. September 1980 strukturieren zwei<br />
grundlegende Phänomene die gesellschaftliche<br />
und politische Entwicklung<br />
in der Türkei: Der türkische Kapitalismus<br />
integriert sich immer stärker<br />
in die globalisierte Weltwirtschaft,<br />
und die kurdische nationale Frage hat<br />
sich verschärft.<br />
Natürlich existierten diese beiden<br />
Phänomene auch schon vor 1980. <strong>Die</strong><br />
türkische Wirtschaft wurde seit den<br />
sechziger Jahren von einer Exportindustrie<br />
getragen, die ein Auffangbecken<br />
für die aus dem überbevölkerten<br />
Anatolien abwandernde Landbevölkerung<br />
darstellte. Nach dem Scheitern<br />
der großen kurdischen Revolten – namentlich<br />
des Aufstands von Scheich<br />
Saïd 1 –, die sich noch auf traditionelle<br />
Strukturen gestützt gegen die<br />
neue, zentralistische türkische Republik<br />
richteten, die auf ihrem Territorium<br />
keinen nationalen Pluralismus duldete,<br />
entstand im Laufe der 70er Jahre,<br />
ausgehend von kurdischen Studierenden<br />
aus der türkischen Linken, eine<br />
neue kurdische nationale Bewegung.<br />
Jedoch ist ein wesentliches Element<br />
der 70er Jahre verschwunden:<br />
nämlich die Bewegung der Arbeitenden<br />
und der Jugend, die zu wirklich<br />
politischen Lösungen nicht in der Lage<br />
war, die eine organische Fortführung<br />
ermöglicht hätten; daher wurden<br />
sie durch den Militärputsch von 1980<br />
zerstört. <strong>Die</strong> brutale Repression, die<br />
auf den Militärputsch folgte, eröffnete<br />
seitdem den Weg für einen neoliberalen<br />
Umbau der Gesellschaft.<br />
1 Der Scheich-Said-Aufstand war ein religiös<br />
und nationalistisch motivierter Aufstand<br />
sunnitischer Kurden im Jahre 1925 unter<br />
der Führung Scheich Saids, eines hohen<br />
Vertreters der Naqschbandi-Tarikat, gegen<br />
die neue säkulare türkische Republik. Der<br />
Aufstand wurde von dem Regime Mustafa<br />
Kem<strong>als</strong> blutig unterdrückt und Scheich Said<br />
mit 47 Mitkämpfern durch ein türkisches<br />
Unabhängigkeitsgericht zum Tode verurteilt<br />
und in Diyarbakir öffentlich gehängt.<br />
DIE BEIDEN STRUKTURIE-<br />
RENDEN DYNAMIKEN<br />
1. Eine auf den Export ausgerichtete<br />
Wirtschaft, die stark<br />
im globalisierten Kapitalismus<br />
verankert ist.<br />
<strong>Die</strong> Integration des türkischen Kapitalismus<br />
in die Weltwirtschaft ist nichts<br />
Neues, doch sie wurde in den vergangenen<br />
dreißig Jahren massiv vorangetrieben.<br />
Seit Beginn der 1980er Jahre<br />
stützt sich der türkische Kapitalismus<br />
stärker auf den Export <strong>als</strong> den Binnenmarkt.<br />
<strong>Die</strong>se Entwicklung wurde heftig<br />
von den liberalen Regierungen unter<br />
Führung von Turgut Özal 2 vorangetrieben,<br />
die durch ihre Politik die<br />
Türkei in den kapitalistischen Weltmarkt<br />
integrieren wollten, indem sie<br />
umfangreichere Importe erlaubten<br />
und – mehr noch – die Türkei in ein<br />
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiges<br />
Land verwandelten. 1980 beliefen<br />
sich die Ausfuhren der Türkei auf<br />
drei Milliarden Dollar; 2008 betrugen<br />
sie 132 Mrd. $. <strong>Die</strong>ses Wachstum war<br />
nicht linear, denn die türkischen Ausfuhren<br />
lagen 2000 erst bei 28 Mrd. $,<br />
doch zwischen 2001 und 2005 gab es<br />
ein massives Wachstum. <strong>Die</strong>se Tatsache<br />
ging mit einer starken Industrialisierung<br />
einher, deren Produkte hauptsächlich<br />
für die Märkte der USA und<br />
der EU bestimmt waren. Der Anteil<br />
von Fabrikprodukten, vor allem Textilien<br />
und Autos, am Export nahm von<br />
10 Prozent auf 92 Prozent zu. Es entstanden<br />
neue Industrieregionen, vor<br />
allem in Anatolien in Städten wie<br />
Mersin, Konya, Kayseri oder Denizli,<br />
2 Der ehemalige hohe Staatsbeamte und leitende<br />
Berater bei der Weltbank mit anschließenden<br />
Spitzenpositionen in Privatunternehmen war<br />
bis zum Militärputsch von 1980 Mitglied<br />
der rechten Regierung unter Demirel. Sein<br />
Name steht für die vom IWF oktroyierten<br />
Austeritätsmaßnahmen vom Januar 1980.<br />
Nach dem Putsch wurde er Wirtschaftsminister<br />
und 1983 für die von ihm gegründete<br />
Mutterlandspartei ANAP Ministerpräsident.<br />
wo auch zahlreiche kleine und mittlere<br />
Unternehmen gegründet wurden und<br />
eine industrielle Bourgeoisie der Provinz<br />
entstand. Seit 2002 hat sich diese<br />
Entwicklung mit dem Regierungsantritt<br />
der AKP 3 enorm beschleunigt,<br />
was besonders auf die Aufstellung<br />
eines Dreijahresplans zur Steigerung<br />
der Exporte und auf die gesetzliche<br />
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes<br />
zurückzuführen ist.<br />
Der türkische Kapitalismus wurde<br />
<strong>als</strong>o in den Jahren ab 2000 zumindest<br />
regional vorherrschend und konnte eine<br />
bis dahin nie gekannte Akkumulation<br />
erreichen. Als bezeichnende Anekdote<br />
sei angefügt, dass Istanbul mit 28<br />
Milliardären nunmehr weltweit Rang<br />
vier hinter New York, Moskau und<br />
London belegt.<br />
2. Eine noch immer ungelöste<br />
nationale Frage<br />
Nach dem Aufblühen von kurdischen<br />
Organisationen Ende der 1970er Jahre<br />
spielt heute nur noch die PKK (die<br />
1978 von linken kurdischen StudentInnen<br />
gegründet wurde) eine größere<br />
Rolle. Sie kann von sich behaupten,<br />
die politische Bewegung der Kurden<br />
im Südosten der Türkei zu repräsentieren.<br />
Nach einer Reihe von schwierigen<br />
Jahren, in denen es der PKK<br />
mehr schlecht <strong>als</strong> recht gelang, ihre<br />
Organisation zu halten, hat sie sich eine<br />
größere gesellschaftliche Basis erobert<br />
und zahlreiche Mitglieder gewonnen,<br />
vor allem wegen des Rassismus<br />
des Staates und der Brutalität der<br />
Repression gegen die kurdische Bevölkerung<br />
im Südosten des Landes. 4<br />
3 <strong>Die</strong> Adalet ve Kalkınma Partisi (Partei für<br />
Gerechtigkeit und Aufschwung, AKP) wurde<br />
2001 vom Reformflügel der islamistischen<br />
politischen Bewegung unter Recep Tayyip<br />
und Teilen der parlamentarischen<br />
Rechten gegründet. Sie verfügt derzeit über die<br />
absolute Mehrheit im Parlament..<br />
4 So war beispielsweise das Gefängnis in<br />
Diyarbakir, wo eine große Zahl von kurdischen<br />
INPREKORR 468/469 31
TÜRKEI<br />
<strong>Die</strong> Kämpfe zwischen der PKK und<br />
der türkischen Armee und ihren Verbündeten<br />
(die kurdischen Dorfmilizen<br />
Korucu, die kurdische Hizbollah, ultrasektiererische<br />
und gewaltbereite<br />
religiöse Gruppen, die in die beiden<br />
Fraktionen Menzil und Ilim gespalten<br />
sind) haben zu einem richtigen Bürgerkrieg<br />
geführt, der im türkischen<br />
Teil von Kurdistan stattfindet, gelegentlich<br />
aber auch in den Großstädten<br />
der Türkei. <strong>Die</strong> Auseinandersetzungen<br />
erreichten ihren Höhepunkt zwischen<br />
1995 und 1996; in dieser Zeit nutzten<br />
die Sicherheitsorgane (die Armee<br />
und die Geheimdienste) ihre Autonomie<br />
und führten in den Kurdengebieten<br />
Maßnahmen des „Ausnahmezustandes“<br />
durch oder setzten die Jitem-<br />
Einheiten (eine geheime Zelle der<br />
Gendarmerie, die den Kampf gegen<br />
den Terrorismus durchsetzen soll) ein.<br />
<strong>Die</strong> „Kurdenfrage“ verkam so zu<br />
einer einfachen „militärischen“ Frage,<br />
während der plurale Charakter<br />
der Türkei zugunsten der Dreieinigkeit<br />
aus „Flagge, Sprache und Nation“<br />
verneint wurde. Der Tod zahlreicher<br />
einfacher Soldaten bei den Zusammenstößen<br />
zwischen der Armee und<br />
der PKK und das Fehlen eines glaub-<br />
Gefangenen einsaßen, für seine Härte bekannt.<br />
Zwischen 1981 und 1989 verloren dort 34<br />
Häftlinge ihr Leben.<br />
Erdoan träumt von der EU<br />
würdigen alternativen Diskurses verstärkten<br />
den Nationalismus, während<br />
die Zeremonien der Einberufung zum<br />
Militärdienst und die Beerdigung von<br />
Rekruten die Gelegenheit abgaben, ultranationalistische<br />
Gewaltdemonstrationen<br />
vom Zaun zu brechen.<br />
Auch heute noch bleibt Abdullah<br />
Öcalan, der historische Führer der<br />
PKK und Objekt eines starken Persönlichkeitskultes,<br />
das Gravitationszentrum<br />
der kurdischen Bewegung, trotz<br />
der Krise, die diese Organisation nach<br />
seiner Verhaftung durchmachen musste.<br />
Er stellt die wichtigste, ja einzige<br />
Legitimitätsquelle für die große Mehrheit<br />
der kurdischen Massen und besonders<br />
für die jungen Menschen dar,<br />
die mehr noch „Apoisten“ 5 <strong>als</strong> Sympathisanten<br />
der BDP 6 sind. <strong>Die</strong> Krise,<br />
die die PKK nach der Verhaftung von<br />
Öcalan durchmachen musste, bedeutete<br />
keineswegs ihr Ende.<br />
5 „Apo“ ist eine geläufige Kurzform für<br />
Abdullah und bezeichnet häufig Öcalan.<br />
Seine Anhänger und Mitkämpfer standen<br />
schon vor der Gründung der PKK <strong>als</strong><br />
„Apocular“ (Apo-Anhänger) in den öffiziellen<br />
Fahndungsbüchern.<br />
6 <strong>Die</strong> Barı ve Demokrasi Partisi (Partei<br />
des Friedens und der Demokratie, BDP)<br />
ist gegenwärtig die Partei der kurdischen<br />
Bewegung in der Türkei. Sie wurde 2008<br />
<strong>als</strong> Nachfolgerpartei der DTP, die unter dem<br />
Vorwand der PKK-Nähe aufgelöst worden war,<br />
gegründet.<br />
So ist das AKP-Projekt einer „demokratischen<br />
Öffnung“, mit dem versucht<br />
wurde, Veränderungen in die <strong>als</strong><br />
unerträglich empfundene Lage der<br />
Kurden und Kurdinnen zu bringen,<br />
ohne jedoch die PKK zum Gesprächspartner<br />
zu machen, schon deswegen<br />
gescheitert, weil diese Organisation<br />
auf den Versuch entschlossen und heftig<br />
reagierte und sich nicht auf diese<br />
Weise zur Seite drängen lassen wollte.<br />
<strong>Die</strong> Zusammenstöße führten auf der<br />
einen Seite zum Tod von kurdischen<br />
Militanten und Zivilisten, auf der anderen<br />
Seite verloren Einberufene ihr<br />
Leben, was zu einer verstärkten Ethnisierung<br />
der Politik führte. Ein weiterer<br />
Beweis (für die Stärke der PKK) war<br />
der Erfolg des Boykotts des Verfassungsreferendums,<br />
der von der BDP<br />
im türkischen Teil von Kurdistan im<br />
Rahmen ihrer Kampagne für eine „demokratische<br />
Autonomie“ (diese Formel<br />
läuft auf ein föderales Modell hinaus)<br />
organisiert wurde. <strong>Die</strong>se beiden<br />
Beweise zeigen eindeutig, dass es unmöglich<br />
ist, zu einer politischen Vereinbarung<br />
über diese Frage zu kommen,<br />
ohne den wichtigsten Bestandteil<br />
der kurdischen Bewegung daran<br />
zu beteiligen. Eine solche Lösung<br />
könnte von wichtigen Sektoren des<br />
türkischen Kapitalismus vorgeschlagen<br />
werden, wie etwa zur Zeit der Regierung<br />
Özal 1993 7 , bevor es dann zur<br />
militärischen Eskalation der 1990er<br />
Jahre kam, die den türkischen Kapitalismus<br />
durchaus nicht gestärkt hat.<br />
WAS IST DER SINN DER AKP-<br />
REGIERUNG UND DER VERFAS-<br />
SUNGSÄNDERUNG IN DIESEM<br />
RAHMEN?<br />
<strong>Die</strong> Diskussionen über die soziale und<br />
politische Einordnung der AKP, die<br />
seit 2002 an der Regierung ist, werden<br />
durch das Etikett „islamistisch“ und<br />
einige Initiativen zu einer „Öffnung“<br />
sowie durch die Frage nach ihrer „sozialen<br />
Basis“ verzerrt.<br />
Das Adjektiv „islamistisch“, das<br />
häufig durch „gemäßigt“ ergänzt wird,<br />
ist vielleicht das größte Problem bei<br />
der Einschätzung der AKP, denn diese<br />
Kategorie ist nichts weiter <strong>als</strong> der<br />
7 1993 gab es öffentliche Debatten an der<br />
Spitze des Staates über die Möglichkeit,<br />
die KämpferInnen der PKK aus den<br />
Bergen herauszuführen, indem man ihnen<br />
Sicherheitsaufgaben anvertrauen wollte.<br />
32 INPREKORR 468/469
TÜRKEI<br />
Gebrauch einer bestimmten religiösen<br />
Bezeichnung, ohne dass man<br />
sich über den wirklichen sozialen und<br />
politischen Charakter des von ihr vertretenen<br />
Projektes Rechenschaft gibt.<br />
Einerseits ist die AKP unbestreitbar<br />
aus der Strömung Millî Görü (nationale<br />
Vision) hervorgegangen, der<br />
wichtigsten Strömung, die dem Bezug<br />
zur Religion in ihren Diskursen einen<br />
zentralen Platz einräumte, andererseits<br />
hat die AKP diesen Bezug „gemäßigt“<br />
in dem Sinne, dass dieser Bezug<br />
weniger ausgeprägt ist (das Prinzip<br />
des Laizismus 8 wird akzeptiert)<br />
und die Religion wird nicht <strong>als</strong> Quelle<br />
der politischen Legitimität angesehen.<br />
9 Jedoch gehen diese Feststellungen<br />
nicht auf den Klasseninhalt der<br />
AKP ein. Auch wenn ihre Wählerbasis<br />
in der einfachen Bevölkerung liegt,<br />
was es ihr ermöglicht, über eine absolute<br />
Mehrheit im Parlament zu verfügen,<br />
so stellt sich die AKP doch entschlossen<br />
in den Rahmen der Interessen<br />
der Bourgeoisie. Schematisch lassen<br />
sich drei Sektoren dieser Bourgeoisie<br />
herausstellen:<br />
a. Das konservativ-nationalistische<br />
Kleinbürgertum: Handwerker und<br />
kleine Eigner in Anatolien und den<br />
Städten, wichtigere Unternehmer,<br />
die erst jüngst aus diesem Kleinbürgertum<br />
aufgestiegen sind und das<br />
Rückgrat des „muslimischen“ Kapit<strong>als</strong><br />
darstellen, subalterne Beamte,<br />
Grundbesitzer usw. Ihre Wünsche<br />
gehen wesentlich in Richtung<br />
Verteidigung des kleinen Kapit<strong>als</strong><br />
gegen die Erschütterungen der kapitalistischen<br />
Weltwirtschaft, dazu<br />
kommt der moralische Konservatismus<br />
und Nationalismus. Das<br />
Kleinbürgertum stellte traditionell<br />
die soziale Basis der konservativen<br />
parlamentarischen Parteien oder<br />
des politischen Islam dar und teilte<br />
sich auf die Regierungspartei AKP,<br />
aber auch auf die ultranationalistische<br />
(MHP) oder andere islamis-<br />
8 <strong>Die</strong> türkische Variante des „Laizismus“<br />
zeigt viel eher eine Kontrolle der religiösen<br />
Institutionen durch den Staat <strong>als</strong> eine Trennung<br />
vom Staat. So ist die Führung des Instituts<br />
für religiöse Angelegenheiten eine staatliche<br />
Institution, die Imame werden normalerweise<br />
in öffentlichen Schulen ausgebildet und sind<br />
Beamte.<br />
9 Wir möchten auch darauf hinweisen, dass<br />
eine <strong>ganze</strong> Reihe von Politikern der AKP aus<br />
Formationen der parlamentarischen Rechten<br />
stammen, die verschwunden sind.<br />
tische Gruppierungen (Saadet) auf.<br />
b. <strong>Die</strong> „liberale“ Bourgeoisie – die<br />
klar in den globalisierten Kapitalismus<br />
integriert ist, Leiter von Unternehmen,<br />
Teile der Intelligenz<br />
und der Hochschullehrer, die –<br />
trotz aller Spannungen – hinter der<br />
AKP stehen, weil es keine glaubwürdigen<br />
anderen „liberalen“ Parteien<br />
gibt. Sie wünschen sich einen<br />
Umbau der Gesellschaft gemäß<br />
der neoliberalen Doktrin, was<br />
zu einer noch stärkeren Integration<br />
in den globalisierten Kapitalismus<br />
führen würde, wobei man die<br />
Vorteile des Landes (das industrielle<br />
Netz, die Infrastruktur, die qualifizierten<br />
und relativ billigen ArbeiterInnen)<br />
nutzen möchte. Unter<br />
diesem Gesichtspunkt ist der Anschluss<br />
an die Europäische Union,<br />
auch die demokratischen Veränderungen,<br />
die er mit sich brächte,<br />
vor allem ein Projekt dieser „liberalen“<br />
Bourgeoisie, auch wenn diese<br />
Perspektive, die häufig mit einer<br />
höheren Lebensqualität in Verbindung<br />
gebracht wird, sich einer weit<br />
breiteren Unterstützung erfreut (etwa<br />
beim kurdischen Nationalismus,<br />
wir kommen darauf zurück). <strong>Die</strong><br />
große Stärke der AKP liegt in ihrer<br />
Fähigkeit, während ihres Aufstiegs<br />
an die Regierung den Spagat zwischen<br />
dem konservativen Kleinbürgertum<br />
und der „liberalen“ Bourgeoisie<br />
hinbekommen zu haben.<br />
Wir haben „liberal“ in Anführungszeichen<br />
gesetzt, um auf den äußerst<br />
wetterwendigen Charakter dieses<br />
„Liberalismus“ hinzuweisen. Im<br />
Verlauf der vergangenen Jahrzehnte<br />
hat sich diese Bourgeoisie nicht gegen<br />
die politische Autorität des bestehenden<br />
politischen Regimes gewehrt<br />
(wie etwa in Frankreich und<br />
Großbritannien), sondern ist ganz<br />
und gar in dessen Schatten verblieben.<br />
<strong>Die</strong> ersten großen industriellen<br />
Vermögen der republikanischen<br />
Türkei (unter Atatürk) wurden im<br />
Schatten des neuen Staates und seines<br />
Willens, eine industrielle, türkische<br />
und muslimische Bourgeoisie<br />
gegen die jüdische und christliche<br />
(Armenier, d. Ü.) Handelsbourgeoisie<br />
aufzubauen, akkumuliert<br />
(obgleich das neue Regime<br />
immer wieder große Erklärungen<br />
über seinen Laizismus abgab).<br />
<strong>Die</strong> Anwandlungen im Hinblick<br />
auf den politischen Liberalismus<br />
dieser großen türkischen Bourgeoisie<br />
haben sich generell <strong>als</strong> äußerst<br />
beschränkt erwiesen. Angesichts<br />
des Auftauchens von sozialen<br />
Bewegungen mit ihren Forderungen<br />
im Verlauf der 70er Jahre<br />
stellte sie sich schnell hinter die Armee<br />
und die staatliche Repression.<br />
So hat die TÜSIAD (Vereinigung<br />
der Geschäftsleute und der Industriellen<br />
der Türkei), eine der wichtigsten<br />
Organisationen des Großkapit<strong>als</strong>,<br />
den Staatsstreich vom September<br />
1980 eindeutig unterstützt.<br />
Heute verteidigt die gleiche Unternehmerorganisation,<br />
die immer<br />
noch die Großbourgeoisie vertritt,<br />
die Perspektive eines Beitritts zur<br />
EU und in diesem Rahmen auch die<br />
kulturellen Rechte der Kurden (etwa<br />
den Gebrauch der Muttersprache<br />
im Unterricht). In der gegenwärtigen<br />
Phase des Kapitalismus<br />
und wegen des Fehlens einer realen<br />
gesellschaftlichen und politischen<br />
Opposition verteidigt diese Bourgeoisie<br />
politische Reformen einer<br />
„Liberalisierung“ des Regimes,<br />
die ziemlich weit gehen, um jene<br />
Probleme zu klären, die zu einer<br />
„Schwächung der Türkei“ (<strong>als</strong>o des<br />
türkischen Kapitalismus) führen<br />
könnten, besonders natürlich die<br />
kurdische nationale Frage. Insgesamt<br />
betrachtet handelt es sich um<br />
den Willen, eine parlamentarische<br />
Demokratie zu haben, die durch einen<br />
Föderalismus ergänzt wird, für<br />
den es aber gegenwärtig keine nennenswerte<br />
Anhängerschaft gibt.<br />
c. <strong>Die</strong> Zwischenschichten und die<br />
etatistische, militaristische und nationalistische<br />
Bourgeoisie: Hier<br />
handelt es sich um hohe und mittlere<br />
Beamte, Magistrate, gewisse<br />
Fraktionen von „liberalen“ Berufen<br />
(der Begriff ist eher unzutreffend),<br />
etwa Rechtsanwälte oder<br />
„Intellektuelle“ aus den Universitäten,<br />
vor allem aber die militärische<br />
Führung (die Offiziere und<br />
der Gener<strong>als</strong>tab); sie stellen das<br />
Knochengerüst der Verteidiger des<br />
„Kemalismus“ dar. Wir können zu<br />
dieser keineswegs erschöpfenden<br />
Liste noch die militärische Bourgeoisie<br />
hinzufügen, die sich nicht<br />
nur im Schatten des Staates entwickeln<br />
konnte, sondern ihre Existenz<br />
den beträchtlichen Militär-<br />
INPREKORR 468/469 33
TÜRKEI<br />
haushalten verdankt. So haben die<br />
Arbeiten des Hochschullehrers Ismet<br />
Akça sehr deutlich den Charakter<br />
eines „kollektiven Kapitalismus“<br />
des Militärs gezeigt. <strong>Die</strong><br />
Führer der türkischen Armee stellen<br />
nicht nur den bewaffneten Arm<br />
des Kapit<strong>als</strong> dar, sondern sie sind<br />
selbst Kapitalisten, entweder über<br />
die wirtschaftlichen Direktinvestitionen<br />
der Armee, die Aktivitäten<br />
der Stiftungen, die mit ihr verbunden<br />
sind, oder aber den militärischindustriellen<br />
Sektor, der dank der<br />
Verträge mit den Militärs besteht<br />
und die Offiziere im Ruhestand und<br />
ihre Familien aufnimmt.<br />
ERFOLG UND SACKGASSE DES<br />
REFERENDUMS<br />
<strong>Die</strong> Haltung der AKP sowie die Charakteristika<br />
ihres Projektes für die Verfassung<br />
können über die Beziehungen<br />
mit jedem dieser drei Sektoren verstanden<br />
werden. <strong>Die</strong> Beibehaltung einer<br />
großen Zahl von früheren Verfügungen,<br />
die die konservativ-nationalistische<br />
Kleinbourgeoisie ruhig stellen<br />
sollen (der unitarische Charakter des<br />
Staates und die Verneinung jedes Bezugs<br />
auf den nationalen Pluralismus),<br />
die kosmetischen und formalen Fortschritte<br />
in der politischen Liberalisierung<br />
(Abbau der Kompetenzen der Militärgerichte)<br />
und vor allem der Zugriff<br />
auf das Justizmilieu, das dem dritten<br />
Sektor der Bourgeoisie nahe steht und<br />
der AKP feindlich gesonnen ist. <strong>Die</strong>se<br />
hat <strong>als</strong>o ihre vorherrschende politische<br />
Position ganz logisch eingesetzt,<br />
um ihre Position zu stärken und ihren<br />
Zugriff auf die Teile der Bourgeoisie,<br />
die ihr feindlich gesonnen sind, zu verbessern,<br />
indem sie ein Projekt durchgesetzt<br />
hat, was noch hinter eine „parlamentarische<br />
Demokratie“ zurückfällt –<br />
trotz aller ohnmächtigen Kritiken von<br />
Seiten von Liberalen und der frontalen,<br />
aber erfolglosen Gegnerschaft der<br />
etatistischen Bourgeoisie. Wir möchten<br />
aber noch anmerken, dass diese Spannungen<br />
sich strikt im kapitalistischen<br />
Rahmen abspielen. Es scheint daher,<br />
dass die „neue“ Verfassung der AKP<br />
den Beziehungen zwischen den verschiedenen<br />
kapitalistischen Sektoren<br />
entspricht, wie sie sich im langen Prozess<br />
des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft<br />
herausgebildet haben, der in<br />
der Türkei im wesentlichen zu Beginn<br />
der 1980er Jahre von Turgut Özal begonnen<br />
wurde.<br />
Gegen dieses Projekt sind mehrere<br />
Oppositionsfronten aufgetaucht:<br />
Das „Nein“ der Liberalen vor allem<br />
des TÜSIAD (eine Art türkischer<br />
BDI), der die Großkapitalisten repräsentiert:<br />
sie fanden, das Projekt<br />
sei zu weit von einem bürgerlichen<br />
Parlamentarismus entfernt.<br />
Das ultranationalistische Nein der<br />
MHP, die sich vor allem abgrenzen<br />
wollte. <strong>Die</strong> extreme Rechte prangert<br />
die Politik der AKP generell an<br />
und meint, sie mache den Kurden<br />
zu viele Konzessionen (der Versuch<br />
einer „demokratischen Öffnung“),<br />
obwohl es im Projekt überhaupt<br />
keinen Bezug zu den Rechten<br />
der Kurden gibt. Hier handelt e<br />
sich somit um eine reaktionäre Opposition.<br />
Das zweischneidige Nein der wichtigsten<br />
Oppositionspartei im Parlament,<br />
der „kemalistischen“ CHP,<br />
die ein paar vage Überlegungen zu<br />
sozialen Fragen mit einem nationalistischen<br />
und etatistischen Diskurs<br />
verband.<br />
Der von der BDP angeleierten Boykottkampagne<br />
muss man einen besonderen<br />
Platz einräumen. Denn<br />
di kurdische Bewegung und ihre<br />
Führung stellten fest, das Projekt<br />
bringe den Kurden absolut nichts,<br />
was zutrifft. Sie riefen daher eher<br />
zum Boykott <strong>als</strong> einem Nein auf.<br />
<strong>Die</strong>se Taktik verweist auf den Charakter<br />
der kurdischen Frage. Denn<br />
die politische Lage in Kurdistan<br />
ist ganz anders <strong>als</strong> die im übrigen<br />
Land. <strong>Die</strong> BDP verfügt über einen<br />
Massenanhang, boykottierte das<br />
Referendum und startete <strong>als</strong> Alternative<br />
eine Kampagne zugunsten<br />
einer „demokratischen Autonomie“<br />
(eine Formel, die man gemäß<br />
dem deutschen Föderalismus verstehen<br />
darf). Wenn der Boykott aus<br />
der Sicht der BDP einen Sinn hat,<br />
gilt es zu betonen, dass auch mehrere<br />
Gruppen der radikalen Linken<br />
sich ihm angeschlossen haben, die<br />
aber isoliert sind und natürlich keine<br />
der „demokratischen Autonomie“<br />
der BDP vergleichbare Aussicht<br />
für den Rest des Landes besitzen.<br />
Wir müssen <strong>als</strong>o feststellen,<br />
dass es außerhalb Kurdistans keine<br />
Bedingungen gab, diese Taktik erfolgreich<br />
umsetzen zu können.<br />
Im Unterschied zu diesen verschiedenen<br />
Ablehnungen, allerdings weniger<br />
hörbar, gab es ein „linkes<br />
Nein“, das dem Entwurf demokratische<br />
und soziale Forderungen entgegen<br />
stellte, und das von verschiedenen<br />
nationalen Vereinigungen,<br />
Berufsverbänden und politischen<br />
Organisationen vertreten wurde:<br />
der ÖDP (Özgürlük v Dayanıma<br />
Partisi, Partei der Freiheit und der<br />
Solidarität, in der die türkischen<br />
Mitglieder der IV. Internationale<br />
Mitglied sind), die TKP (kommunistische<br />
Partei der Türkei), die<br />
Emep (Emen Partisi, Partei der<br />
Arbeit, pro-albanisch), aber auch<br />
die Volkshäuser haben sich auf dieser<br />
Grundlage erklärt. <strong>Die</strong>se Position<br />
erfreute sich auch der Unterstützung<br />
von gewissen Gewerkschaften<br />
und Vereinigungen. <strong>Die</strong> Wirkung<br />
blieb wegen der Schwäche der Linken<br />
in der Türkei beschränkt, aber<br />
auch, weil die Kampagne zu spät<br />
gestartet wurde und sich nicht auf<br />
Basisgruppen, etwa lokale Komitees<br />
stützen konnte, in denen sich<br />
alle AnhängerInnen eines „Neins<br />
der Linken“ hätten zusammenfinden<br />
können. <strong>Die</strong>se Begrenztheiten<br />
trübten die Dynamik dieser Zusammenarbeit,<br />
doch ist positiv zu werten,<br />
dass es sie überhaupt gab. Und<br />
damit lässt sich auch die Konfusion<br />
angehen, die sich aus dem „Ja der<br />
Linken“ ergab.<br />
Es scheint daher ziemlich erstaunlich<br />
zu sein, dass es Individuen und<br />
Gruppen 10 der radikalen Linken gab,<br />
die beim Referendum für ein „kritisches<br />
Ja“ eingetreten sind. Sie haben<br />
behauptet, die Annahme der Verfassungsänderungen<br />
würde es ermöglichen,<br />
die Seite des Staatsstreichs von<br />
1980 zu wenden, während aber das<br />
Projekt der AKP keinerlei soziale und<br />
politische Freiheiten enthält, die es<br />
den Arbeitenden erleichtern würden,<br />
sich selbst zu organisieren. So macht<br />
10 <strong>Die</strong> bekanntesten sind: die EDP (Esitlik ve<br />
Demokrasi Partisi, Partei der Gleichheit und<br />
der Demokratie), die kleine Gruppe von Ufuk<br />
Uraz, dem „Einheits“-Abgeordneten der<br />
Linken in Istanbul, von Antikapitalist, die<br />
zur Internationalen Sozialistischen Tendenz<br />
gehört und die DSIP (Devrimci Sosyalist<br />
Partisi (Revolutionär-Sozialistische<br />
Arbeiterpartei), die früher mit der SWP<br />
verbunden war und immer noch Beziehungen<br />
unterhält.<br />
34 INPREKORR 468/469
TÜRKEI<br />
die Aufhebung des Verbots von politischen<br />
oder von Solidaritäts-Streiks,<br />
worüber viel geredet wurde, nur wenig<br />
Sinn, weil die Möglichkeit, einen<br />
Streiks „auszusetzen“, wenn die „nationale<br />
Sicherheit“ gefährdet ist, beibehalten<br />
wurde. Wenn es nicht zu einer<br />
Vereinbarung kommt, dann entscheidet<br />
schließlich eine Schiedskommission<br />
(die in der Regel für die Arbeitenden<br />
ungünstig ist), deren Entscheidung<br />
nicht mehr angefochten werden<br />
kann (Art. 54). Zu diesem Vorgehen<br />
haben die Regierungen, auch die der<br />
AKP, schon häufig gegriffen. 11 <strong>Die</strong>s<br />
ist auch ganz logisch, denn aufgrund<br />
des Fehlens einer starken Arbeiterbewegung<br />
gibt es kein Kräfteverhältnis,<br />
was wirkliche Veränderungen durchsetzen<br />
könnte.<br />
Ein „kritisches Ja“ liefe <strong>als</strong>o im<br />
Grunde darauf hinaus, größere demokratische<br />
Fortschritte von der Partei<br />
des Präsidenten der Republik Abdullah<br />
Gül zu erwarten, der zur Kurdenfrage<br />
äußerte: „Es wäre schlecht für<br />
den Kampf (gegen den Terrorismus),<br />
Einzelheiten zu nennen, nachdem die<br />
Entscheidung getroffen wurde. (…)<br />
Es wird bereits ein Programm ausgearbeitet,<br />
doch es wäre schlimm, darüber<br />
zu reden.“ 12 Er kritisierte indirekt<br />
den Chef des Gener<strong>als</strong>tabes, der angeblich<br />
der Presse zu viel erzählt habe,<br />
ohne dass es in seinem Lager auch<br />
nur die geringste Regung gab. In der<br />
Zeitschrift der türkischen Sektion der<br />
IV. Internationale beschrieb Masis<br />
Kürkçügil dieses Vorgehen des Präsidenten,<br />
er habe sich „im Labyrinth der<br />
bürgerlichen Politik verloren“ 13 . <strong>Die</strong>s<br />
11 Zwischen 1983 und 2007 gab es 27<br />
Entscheidungen eines „Aufschubs“ eines<br />
Streiks, wovon über 600 Arbeitsstätten<br />
betroffen waren (eine Entscheidung gilt<br />
für diverse Betriebe). <strong>Die</strong>se Praxis wird<br />
weitergeführt: In den Jahren seit 2000 waren<br />
die Reifenproduktion (Goodyear, Pirelli,<br />
Bridgestone, Petlas), eine Kristallfabrik<br />
(Pasabahçe), die Bergwerke (Erdemir)<br />
usw. betroffen. Vgl. dazu Aziz Çelik, Milli<br />
Güvenlik Gerekçeli Grev Ertelemeleri,<br />
Çalima ve Toplum, Nr. 18-3, unter www.<br />
birikimdergisi.com/birikim/makale.<br />
aspx?mid=475<br />
12 Milliyet, 8. Juli 2010, „Gülirdi:<br />
Detay mücadeleyi etkiler“. Auch im Netz<br />
unter http://www.milliyet.com.tr/gul-basbugu-elestirdi-detay-mucadeleyi-etkiller-/siyaset/<br />
sondakika/08.07.2010/1260883/default.htm<br />
13 http://www.sdyeniyol.org/index.php/siyasalguendem/353-esas-felaket-zihinlerde-yaanmyenilgidir-masis-kuerkcuegil.<br />
Wahlkampf in der Türkei<br />
bedeutete gleichzeitig, aus den Augen<br />
zu verlieren, dass sogar die geringsten<br />
Fortschritte zugunsten der Arbeitenden<br />
nur aus der realen Bewegung der<br />
Arbeitenden stammen, weil es ihnen<br />
gelang, ein bestimmtes Kräfteverhältnis<br />
aufzubauen.<br />
<strong>Die</strong> Annahme dieser Verfassung<br />
durch ein Referendum geschah zu<br />
einem Zeitpunkt, da die Arbeiterbewegung<br />
stark geschwächt ist, was<br />
gleichzeitig bedeutet, dass die soziale<br />
Frage aus der politischen Agenda<br />
verschwunden ist und die zersplitterte<br />
Linke sich unfähig zeigt, ihre Isolierung<br />
zu überwinden. <strong>Die</strong> politische<br />
Agenda ist daher im Allgemeinen<br />
von den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen<br />
abgekoppelt und zwischen<br />
dem Imperativ des „Kampfes<br />
gegen den Terrorismus“ (der kurdischen<br />
Bewegung) und dem Aufbrechen<br />
der Spannungen zwischen verschiedenen<br />
Sektoren der Bourgeoisie<br />
eingezwängt. Das kann auf völlig<br />
künstliche Weise geschehen wie etwa<br />
die Aufdeckung des „Ergenekon“-<br />
Netzwerkes, das in der Türkei und im<br />
Ausland häufig <strong>als</strong> ein dramatischer<br />
Kampf zwischen der AKP und dem<br />
putschlüsternen Teil der Armee hingestellt<br />
wird, obwohl es sich nur um<br />
die Verhaftung der härtesten Teile der<br />
kemalistischen Opposition gehandelt<br />
hat, die überhaupt nicht in der Lage<br />
wären, einen Staatsstreich durchzuziehen.<br />
Es kann auch um die Probleme<br />
gehen, die einen Großteil der Bevölkerung<br />
betreffen wie die Kurdenfrage,<br />
die es ermöglicht, auf dem Klavier der<br />
nationalen Eintracht zu spielen und jeden<br />
subversiven Diskurs zu disqualifizieren,<br />
oder aber um das Tragen des<br />
Schleiers. Das Tragen des Schleiers in<br />
öffentlichen Gebäuden (der Universität)<br />
nimmt einen wichtigen Platz ein,<br />
weil es eine starke Opposition von<br />
Seiten der etatistischen Bourgeoisie<br />
gibt, die sich immer mehr verkrampft,<br />
weil sie nach und nach viele Positionen<br />
verloren hat. Das ermöglicht es<br />
der AKP, mit wenig Kosten <strong>als</strong> Vertreterin<br />
der Interessen des Volkes zu erscheinen,<br />
obwohl sie eine brutale Politik<br />
gegen die Mobilisierungen der<br />
Arbeitenden veranstaltet. Aber es sind<br />
genau diese Mobilisierungen, die es<br />
von Zeit zu Zeit möglich gemacht haben,<br />
dass die soziale Frage auf der politischen<br />
Agenda aufgetaucht ist.<br />
INPREKORR 468/469 35
TÜRKEI<br />
DER BEISPIELHAFTE KAMPF<br />
DER BESCHÄFTIGTEN VON<br />
TEKEL<br />
<strong>Die</strong>s traf zu während des großen Marsches<br />
der Bergleute von Zonguldak<br />
nach Ankara im Jahr 1991 oder für den<br />
Kampf der Beamten 1995. <strong>Die</strong> markanteste<br />
Mobilisierung in den vergangenen<br />
Jahren war die der Arbeitenden<br />
von Tekel (dem früher staatlichen Unternehmen<br />
für Alkohol und Tabak) in<br />
diesem Jahr, die sich gegen ein neues<br />
Statut zur Wehr setzen, das nach der<br />
Privatisierung des Unternehmens und<br />
den Teilschließungen für sie höchst<br />
nachteilig ausgefallen wäre. <strong>Die</strong>se<br />
massenhafte und lange Mobilisierung,<br />
bei der 78 Tage lang in Ankara eine<br />
Vertretung eingerichtet wurde, war in<br />
mehrfacher Hinsicht aufschlussreich.<br />
Nicht nur handelte es sich um eine direkte<br />
Reaktion auf den Neoliberalismus<br />
in der Türkei, sondern auch – da<br />
der Großteil der beispiellosen Privatisierungen<br />
bereits erfolgt war – um eine<br />
verspätete Reaktion und einen notwendigen<br />
Kampf, der wertvoll, aber<br />
ein Nachhutgefecht war. Neuerlich hat<br />
die AKP ihren wahren Charakter <strong>als</strong><br />
bürgerliche Partei gezeigt, indem sie<br />
sich der Arbeiterklasse brutal in den<br />
Weg stellte und heftigste Repressionsformen<br />
einsetzte. Schließlich war diese<br />
Mobilisierung mit einer Front des<br />
Schweigens von Seiten der Gewerk-<br />
schaftsbürokratien konfrontiert, die<br />
gegen das Entstehen einer radikalen<br />
Bewegung mit dieser Dauer und diesem<br />
Umfang waren. So waren die ArbeiterInnen<br />
von Tekel nicht nur mit<br />
der polizeilichen Gewalt konfrontiert,<br />
sondern auch mit zahlreichen Manövern<br />
der Führung des Dachverbandes,<br />
zu dem ihre Gewerkschaft gehört, um<br />
die Bewegung zu kanalisieren und dadurch<br />
zu schwächen. <strong>Die</strong> Reaktion der<br />
Arbeitenden von Tekel, denen sich andere<br />
kämpfende Sektoren anschlossen,<br />
war entschlossen und nahm eine<br />
ganz radikale Wendung, <strong>als</strong> die Tribüne<br />
des 1. Mai, auf der die Führer<br />
der verschiedenen Gewerkschaftsverbände<br />
saßen, von den Arbeitern gestürmt<br />
wurde und es ihnen gelang,<br />
den Vorsitzenden der T zu verjagen.<br />
<strong>Die</strong>se Aktion wurde von allen<br />
sechs Gewerkschaftsführungen verurteilt,<br />
auch von derjenigen, die man<br />
<strong>als</strong> die linkeste ansieht, nämlich der<br />
KESK. Darauf antworteten die Arbeitenden<br />
von Tekel mit einer Besetzung<br />
der Lokale der Türknbul und<br />
erhielten die Unterstützung von vielen<br />
Gewerkschaftsmitgliedern. <strong>Die</strong> Mobilisierungen<br />
führten schließlich zu<br />
einem Sieg in der Sache beim Staatsrat;<br />
der Fall gelangte schließlich sogar<br />
zum Verfassungsgericht, dessen Entscheidung<br />
allerdings noch aussteht.<br />
<strong>Die</strong> Arbeiterbewegung von Tekel<br />
kann natürlich nicht allein den Weg<br />
ändern, auf dem sich die Türkei befindet<br />
und zu dem die neue Verfassung<br />
nur einen weiteren Stein darstellt; damit<br />
meine ich den Weg des neoliberalen<br />
Umbaus der gesamten Gesellschaft,<br />
bei dem die soziale Dimension<br />
aus den politischen Debatten verschwunden<br />
ist und die Auseinandersetzungen<br />
sich auf die Spannungen<br />
zwischen den verschiedenen Sektoren<br />
der Bourgeoisie beschränken. Trotzdem<br />
stellt die Bewegung von Tekel<br />
ein beachtliches Beispiel dar, um zu<br />
zeigen, wie man in der Türkei die sozialistische<br />
Linke neu aufbauen muss,<br />
um den Weg der Gesellschaft zu ändern.<br />
<strong>Die</strong>s ist eine immense Aufgabe,<br />
die mit dem Bewusstsein beginnt,<br />
dass es keine Abkürzungen gibt, etwa<br />
künstliche Wahlen für ein neues Parlament,<br />
Brosamen einer Demokratie,<br />
die vom Tisch der Parteien der Bourgeoisie<br />
gefallen sind, oder aber Umbesetzungen<br />
innerhalb der gewerkschaftlichen<br />
Bürokratien, die über keine<br />
wirklichen Bindungen an die Arbeiterklasse<br />
verfügen.<br />
Ümit Çırak ist Politologe und Mitglied der<br />
Neuen antikapitalistischen Partei (NPA, Frankreich)<br />
und in der Vierten Internationale.<br />
Übersetzung aus dem Französischen:<br />
Paul B. Kleiser<br />
IV. Internationale im Internet<br />
englisch:<br />
http://www.internationalviewpoint.org<br />
französisch:<br />
http://www.inprecor.fr<br />
spanisch:<br />
http://puntodevistainternacional.org<br />
deutsch:<br />
http://www.inprekorr.de<br />
36 INPREKORR 468/469
CHINA<br />
Arbeiterfrühling im Herzen der<br />
„Werkstatt der Welt“<br />
Danielle Sabaï<br />
Seit Mai/Juni 2010 haben in China in<br />
zahlreichen Fabriken Arbeitskonflikte<br />
und Streiks stattgefunden.<br />
Im Land mit der zahlenmäßig<br />
größten und billigsten Arbeitskraft<br />
der Welt (sie wird auf ca. 300 Millionen<br />
Menschen geschätzt) sind Arbeitskonflikte<br />
relativ häufig, doch berichten<br />
westliche Medien selten darüber.<br />
Nach Angaben der offiziellen chinesischen<br />
Zeitschrift Outlook Weekly<br />
wurden 2008 280‘000 Arbeitskonflikte<br />
registriert und haben diese<br />
im ersten Halbjahr 2009 im Vergleich<br />
zum Vorjahr um 30% zugenommen.<br />
Dass den Konflikten im Mai/Juni<br />
2010 plötzlich soviel Aufmerksamkeit<br />
gewidmet wurde, ist bestimmt kein<br />
Zufall. <strong>Die</strong>se Konflikte könnten sehr<br />
wohl Ausdruck wesentlicher Veränderungen<br />
sein, die es wert sind, analysiert<br />
zu werden.<br />
HONDA FOSHAN: EIN VORBILD-<br />
LICHER STREIK<br />
<strong>Die</strong> Streikwelle begann in der Honda-Fabrik<br />
Foshan. Obwohl die Streikführer<br />
verhaftet wurden und trotz<br />
der Spaltungsversuche der Direktion,<br />
blieben die Arbeiter während des<br />
zweiwöchigen Streiks fest zusammen.<br />
In dieser Fabrik sind 80 % der Arbeiter<br />
Technikum-Studenten mit einem<br />
Firmenarbeitsvertrag. Sie unterstehen<br />
nicht dem geltenden Arbeitsgesetz<br />
und ihr Lohn liegt weit unter einem<br />
regulären Arbeiterlohn.<br />
Der Konflikt wurde von diesen<br />
Technik-Studenten ausgelöst, die nach<br />
1980 geboren sind und die die Zeit<br />
Maos nicht erlebt haben. Der Streik<br />
hat gezeigt, dass sie mit der Durchsetzung<br />
besserer Arbeitsbedingungen<br />
ihrer Menschenwürde entschlossen<br />
Respekt verschaffen wollen. Sie<br />
sind nicht mehr bereit, für die Fabrik<br />
und für die Hierarchie ihr Leben<br />
zu opfern und die schlimmsten Ungerechtigkeiten<br />
hinzunehmen. Sie haben<br />
ein Wachstumsmodell an den Pranger<br />
gestellt, das auf billiger Arbeit und<br />
Überausbeutung der Arbeitskraft beruht,<br />
aber auch auf der Schamlosigkeit<br />
der Großbetriebe, die ihnen extrem<br />
niedrige Löhne bezahlen, selber<br />
aber schwindelerregend hohe Profite<br />
einfahren.<br />
Gleichzeitig hat eine Reihe von<br />
Selbstmorden in der taiwanesischen<br />
Fabrik Foxconn – ein Elektronikriese,<br />
der Teile für Dell, Apple und Hewlett<br />
Packard herstellt – ein grelles Licht<br />
auf das Schicksal der Arbeiter in Fabriken<br />
geworfen, die wie Gefängnisse<br />
organisiert sind.<br />
<strong>Die</strong> eiserne Disziplin und die niedrigen<br />
Löhne haben die multinationalen<br />
Konzerne angelockt und dazu beigetragen,<br />
dass China zur „Werkstatt der<br />
Welt“ geworden ist. Eine Werkstatt,<br />
die eher einem Arbeitslager gleicht.<br />
Zum ersten Mal haben sich die<br />
jungen Honda-Angestellten nicht für<br />
die Auszahlung ihrer Löhne oder für<br />
die Umsetzung ihrer Rechte gewehrt,<br />
wie dies bei Arbeitskonflikten in China<br />
normalerweise der Fall ist, sondern<br />
für eine substantielle Lohnerhöhung.<br />
Sie forderten eine sofortige Erhöhung<br />
der Grundlöhne von 800 Yuan (91 €),<br />
das heißt ohne Überstunden, sowie eine<br />
jährliche Lohnerhöhung von mindestens<br />
15 %. <strong>Die</strong>ser Streik hat Honda<br />
während mehrerer Tage zur Stillegung<br />
der Produktion im <strong>ganze</strong>n Land<br />
gezwungen, weil es infolge des Konflikts<br />
an Einzelteilen mangelte. <strong>Die</strong><br />
Honda-Direktion musste mit einer<br />
von den Streikenden ernannten Delegation<br />
verhandeln und bedeutende<br />
Lohnerhöhungen sowie bessere Arbeitsbedingungen<br />
zugestehen. Der<br />
Sieg der Honda-Foshan-Arbeiter ist<br />
ein phantastisches Beispiel für deren<br />
Kampfbereitschaft. Im Gefolge dieses<br />
Kampfes kam es in Zweigniederlassungen<br />
von Honda, Toyota, Mitsumi<br />
Electric, Nippon Sheet Glass, Atsumitec<br />
und vielen anderen ebenfalls zu<br />
Konflikten, in deren Verlauf Lohnerhöhungen<br />
zugestanden werden mussten.<br />
<strong>Die</strong>s war in allen Konflikten die<br />
Hauptforderung. Presseberichten zufolge<br />
haben einige Betriebe und sogar<br />
Provinzbehörden die Löhne ihrer Angestellten<br />
erhöht, bevor es überhaupt<br />
zu Konflikten gekommen war!<br />
DIE GRÜNDE FÜR DIE WUT<br />
<strong>Die</strong>se Lohnforderungen überraschen<br />
nicht. <strong>Die</strong> unterste Kategorie bilden<br />
die ungefähr 130 Millionen Wanderarbeiter,<br />
die der Armut auf dem Land<br />
entflohen sind. Sie stellen die Mehrheit<br />
der Ungelernten, auf die die<br />
Großbetriebe und multinationalen<br />
Konzerne so gierig sind, die sich in<br />
den großen Zentren der verarbeitenden<br />
Industrie Chinas wie Guangzhou,<br />
Shenzhen und Suzhou sowie in Großstädten<br />
wie Schanghai und Peking<br />
niedergelassen haben. Dort arbeiten<br />
sie hauptsächlich auf dem Bau. Aufgrund<br />
des Hukou-Systems (Niederlassungsrecht)<br />
werden die Wanderarbeiter<br />
von den Behörden nicht <strong>als</strong> Stadtbewohner<br />
anerkannt. Dadurch sind<br />
sie verletzlich, weil Sans-Papiers im<br />
eigenen Land. Sie haben kein Recht<br />
auf öffentliche <strong>Die</strong>nstleistungen, <strong>als</strong>o<br />
auch auf keine Sozialversicherungen.<br />
Ihre Kinder dürfen keine öffentlichen<br />
Schulen besuchen.<br />
Gemäß Angaben des Landwirtschaftsministeriums<br />
verdienen sie<br />
heute im Durchschnitt 1348 Yuan monatlich,<br />
das sind 154 €. Trotz jährlicher<br />
Lohnerhöhungen von 10 bis<br />
15 % bleiben diese extrem niedrig.<br />
<strong>Die</strong> Zahl der Luxus-Einkaufszentren<br />
ist explodiert, wo die Konsumbefriedigung<br />
der ungefähr 300 Mio. Ange-<br />
INPREKORR 468/469 37
CHINA<br />
hörigen der Mittelklasse – Neureiche<br />
und Bürokraten nicht mitgezählt<br />
– zur Schau gestellt wird. Den Arbeitern<br />
hingegen hat das fulminante chinesische<br />
Wirtschaftswachstum wenig<br />
gebracht. <strong>Die</strong> sozialen Ungleichheiten<br />
haben zugenommen, vor allem<br />
zwischen Stadt und Land. Eine Wirtschaftsstudie<br />
kommt zu dem Schluss,<br />
dass sich die Arbeits“kosten“ in den<br />
Großbetrieben von 1995 bis 2004 verdreifacht<br />
haben, dass sich die Produktivität<br />
in der gleichen Zeit jedoch verfünffacht<br />
hat, was zu einer Senkung<br />
der Lohnstückkosten um 43 % 1 geführt<br />
hat. Zur Illustration eine weitere<br />
Zahl: Der Anteil der Arbeitseinkommen<br />
hat in 15 Jahren um 10 % abgenommen,<br />
was zu einem Rückgang<br />
der <strong>Ausgabe</strong>n der Haushalte geführt<br />
hat. 2 Mit den gegenwärtigen Lohnerhöhungen<br />
hat demnach eine gerechtere<br />
Verteilung des Nationaleinkommens<br />
zugunsten der Arbeiter eigentlich<br />
erst begonnen.<br />
WERKSTATT DER WELT GEGEN<br />
SUPERMARKT<br />
<strong>Die</strong> Behörden sehen diese Lohnerhöhungen<br />
gerne und zwar aus zwei<br />
Gründen. Erstens möchte die Regierung<br />
den inländischen Konsum erhöhen,<br />
um die Verlangsamung der Exporte<br />
zu kompensieren. Zweitens bedeuten<br />
Lohnerhöhungen auch eine<br />
Verbesserung der Lebensbedingungen,<br />
was für die Aufrechterhaltung<br />
der politischen Stabilität ein wichtiger<br />
Faktor darstellt. <strong>Die</strong> Arbeitskämpfe<br />
der vergangenen Monate sind<br />
in Fabriken ausgebrochen, die ausländischen,<br />
hauptsächlich japanischen<br />
Gesellschaften gehören. Das war der<br />
Regierung hochwillkommen; sie ließ<br />
den Dingen ihren Lauf, hat den Lokalmedien<br />
sogar erlaubt, darüber zu berichten.<br />
Damit hat sie den Eindruck<br />
erweckt, die ausländischen Betriebe<br />
1 Untersuchung von Ms Chen und Bart van Ark<br />
von der Wirtschaftsorganisation „Conference<br />
Board“ sowie Harry Wu von der japanischen<br />
Hitotsubashi University, Angaben nach<br />
„China’s Labour Market: The Next China“,<br />
in: The Economist, http://www.economist.<br />
com/research/articlesBySubject/displaystory.<br />
cfm?subjectid=478048&story_id=16693397<br />
(29. Juli 2010).<br />
2 Jean Sanuk, „La Chine peut-elle sauver<br />
le capitalisme mondial?“, in: Inprecor Nr.<br />
543/544, November/Dezember 2008<br />
seien schuld an der Unzufriedenheit<br />
der Arbeiter. Gleichzeitig wurden damit<br />
nationalistische Gefühle gestärkt.<br />
Der Regierung bringt es mehr,<br />
wenn ausländische Konzerne Zugeständnisse<br />
machen müssen <strong>als</strong> wenn<br />
sie Arbeitskämpfe unterdrücken würde.<br />
Sie befürchtet nicht, dass das Land<br />
wegen der Konflikte und der Lohnerhöhungen<br />
an Attraktivität verliert.<br />
In China sind die Lohnkosten zwar<br />
für die stark exportorientierte Industrie<br />
entscheidend, sie sind aber keineswegs<br />
das einzige Argument dafür,<br />
dass ausländische Firmen in China<br />
investieren. Der durchschnittliche<br />
Monatslohn in Thailand, auf den Philippinen,<br />
in Vietnam und Indonesien<br />
liegt heute unter demjenigen Chinas. 3<br />
Aber die Arbeitskräftereserven dieser<br />
Länder sind unvergleichlich viel kleiner.<br />
Zudem können nicht alle Firmen<br />
einfach umziehen. <strong>Die</strong>s trifft zum Beispiel<br />
auf die Automobilfabriken, die<br />
Stahlproduktion und die chemische<br />
Industrie zu.<br />
<strong>Die</strong> meisten Unternehmen investieren<br />
hauptsächlich deshalb in China,<br />
weil sich hier rasant ein riesiger<br />
nationaler Markt entwickelt, während<br />
der Konsum in den westlichen<br />
Ländern <strong>als</strong> Folge der Krise stagniert.<br />
Mit den Lohnerhöhungen wird dieser<br />
Markt noch lukrativer. <strong>Die</strong>se Tatsache<br />
kann kein Investor übersehen.<br />
Höhere Arbeits„kosten“ und die<br />
Zunahme an Arbeitskonflikten führen<br />
nicht dazu, dass die multinationalen<br />
Konzerne ins Ausland abwandern,<br />
sondern sie verlagern ihre Fabriken<br />
vielmehr in China selbst. <strong>Die</strong><br />
Firmen ziehen lieber von der Küste<br />
weg und ins Landesinnere, wo der Boden<br />
und die Löhne viel günstiger sind.<br />
Mit der Verlagerung der Industrie können<br />
sie den beginnenden Arbeitskräftemangel<br />
in den küstennahen Industriezonen<br />
wettmachen, was die Folge<br />
der geografischen Aufteilung des Arbeitsmarktes<br />
ist. Nach Meinung von<br />
Deng Quheng von der chinesischen<br />
Akademie der Sozialwissenschaften<br />
und Li Shi von der Pekinger Universität<br />
gibt es noch 70 Millionen chine-<br />
3 Patrick Barta und Alex Frangos, „Southeast<br />
Asia Tries to Link Up to Compete“, in: The<br />
Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/NA_WSJ_PUB:SB1000142405274870<br />
4488404575441802903187976.html<br />
(22. August 2010).<br />
sische Landarbeiter, die der Industrie<br />
zur Verfügung stehen. Doch das Hukou-System<br />
und die Furcht, ihr Stück<br />
Land zu verlieren, wenn sie es nicht<br />
bearbeiten, hindern sie daran, in den<br />
Küstenstädten Arbeit zu suchen.<br />
<strong>Die</strong> chinesische Bevölkerung wird<br />
zudem älter. Ein Sechstel jener, die<br />
keine Wanderarbeiter sind, finden, sie<br />
seien zu alt um wegzugehen, selbst<br />
wenn sie noch nicht 40 Jahre alt sind. 4<br />
VERBESSERTES ARBEITSGE-<br />
SETZ<br />
Das Wiederaufflammen der Arbeitskämpfe,<br />
die durch die siegreichen<br />
Kämpfe im Frühling gestärkt wurden,<br />
ist zweifellos auch auf das neue<br />
Arbeitsgesetz zurückzuführen. Das<br />
am 1. Januar 2008 in Kraft getretene<br />
„ Arbeitsvertrags-Gesetz der Volksrepublik<br />
China“ ist „eines der wichtigsten<br />
Arbeitsgesetze der letzten zehn<br />
Jahren.“ 5 Mit ihm sollen vor allem die<br />
Missbräuche der Unternehmer gegenüber<br />
ihren Angestellten eingeschränkt<br />
werden, wie missbräuchliche Kündigungen<br />
und Nichtbezahlung der Löhne.<br />
<strong>Die</strong> Regierung möchte einen ständigen<br />
Anlass für Arbeitskämpfe ausschalten,<br />
deren politische Dynamik<br />
für sie gefährlich werden könnte. Sie<br />
hofft zudem, mit einem besseren Arbeitsschutz<br />
die hohe Fluktuation in<br />
den Betrieben einzudämmen. Von<br />
1980 bis 1990 verließen die Angestellten<br />
den Betrieb, wenn sie mit den<br />
Arbeitsbedingungen oder ihrem Lohn<br />
nicht zufrieden waren und suchten sich<br />
eine neue Stelle. Sie hatten auch gar<br />
keine andere Wahl, da die staatliche<br />
Repression jede kollektive Organisierung<br />
am Arbeitsplatz verhinderte. <strong>Die</strong><br />
Hauptaufgabe des offiziellen Gewerkschaftsbundes<br />
bestand darin, Kämpfe<br />
zu verhindern. Mit dem beginnenden<br />
Arbeitskräftemangel in den Küstenregionen,<br />
der Überalterung der Bevölke-<br />
4 Angaben nach: „The Next China“, in: The<br />
Economist, a.a.O.<br />
5 Jeffrey Becker und Manfred Elfstrom<br />
(International Labor Rights Forum),<br />
„The Impact of China’s Labor Contract<br />
Law on Workers “ (12. Mai 2010), http://<br />
www.laborrights.org/sites/default/<br />
files/publications-and-resources/<br />
ChinaLaborContractLaw2010_0.pdf;<br />
Zusammenfassung: http://www.laborrights.<br />
org/creating-a-sweatfree-world/rule-of-law/<br />
china-program/resources/12318<br />
38 INPREKORR 468/469
CHINA<br />
rung und aufgrund der besseren Ausbildung müssen Behörden<br />
und Unternehmen eine Arbeitskraft stabilisieren,<br />
die zudem immer mehr Forderungen stellt. <strong>Die</strong> jungen<br />
Wanderarbeiter haben am meisten vom neuen Gesetz<br />
profitiert, zweifellos weil sie dank Internet besser informiert<br />
sind. Es überrascht deshalb nicht, wenn sie an den<br />
Kämpfen in den japanischen Betrieben beteiligt waren.<br />
<strong>Die</strong>se Jungen sind heute besser ausgebildet und haben<br />
qualifiziertere Jobs <strong>als</strong> früher. Welten trennen sie von ihren<br />
Eltern auf dem Land. <strong>Die</strong>se jungen Arbeiter, alles<br />
Einzelkinder, streben nach einem anständigen Leben in<br />
den Großstädten, was mit ihren Hungerlöhnen aber ein<br />
Ding der Unmöglichkeit ist. Deshalb werden die siegreichen<br />
Arbeitskämpfe der vergangenen Monate die soziale<br />
Lage stark prägen. <strong>Die</strong> Regierung hofft auf Lohnerhöhungen,<br />
damit sich die soziale Lage entspannt. Es<br />
ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass sich die Streiks<br />
vom Frühjahr und Sommer noch ausweiten werden.<br />
<strong>Die</strong>s deshalb, weil eines der wichtigsten Merkmale<br />
der Kämpfe bei Honda war, dass die Streikenden den<br />
Vertretern der offiziellen, von der KP kontrollierten Gewerkschaft<br />
(die „All Chinese Federation of Trade Union“<br />
ACFTU) die Gefolgschaft verweigert haben. <strong>Die</strong>se<br />
Vertreter haben sich mit gewalttätigen Aktionen gegen<br />
Streikende in Misskredit gebracht, da sie <strong>als</strong> Streikbrecher<br />
aufgetreten waren und dadurch den Eindruck<br />
erweckt haben, sie stünden auf der Seite der Direktion.<br />
In mindestens drei Honda-Fabriken haben die Streikenden<br />
verlangt, ihre Vertreter selbst zu wählen und die<br />
Gewerkschaft neu zu organisieren, was ein Affront gegen<br />
die AFCTU-Vertreter war. <strong>Die</strong>se „Gewerkschafter“<br />
haben systematisch für die Unternehmer Partei ergriffen<br />
und entpuppten sich <strong>als</strong> treue Helfer der Polizei. Dass<br />
sich die Honda-Arbeiter unter diesen äußerst schwierigen<br />
Umständen selber zu organisieren vermochten, ist<br />
eine große Leistung. Dank dieser Formen der Selbstorganisierung<br />
konnte sich ein neues Arbeiterbewusstsein<br />
entwickeln.<br />
<strong>Die</strong> zahlreichen Konflikte haben sich auf die Wirtschaft<br />
konzentriert, doch die Behörden achten sehr darauf,<br />
dass sie nicht zu einem politischen Protest werden.<br />
<strong>Die</strong> Streikerfahrung in den Honda-Fabriken zeigt, dass<br />
die Regierung in Zukunft mehr Mühe haben wird, die<br />
Kämpfe mit Hilfe des weitgehend diskreditierten Gewerkschaftsbundes<br />
zu kontrollieren.<br />
Auch in Bangladesch, Vietnam und Kambodscha haben<br />
in den vergangenen Monaten Kämpfe für höhere<br />
Löhne stattgefunden. Das Elend ist <strong>als</strong>o nicht Schicksal.<br />
Danielle Sabaï, Mitglied der Nouveau parti anticapitaliste<br />
(NPA) und der IV. Internationale, ist Asien-Korrespondentin<br />
von Inprecor. Sie betreibt eine interessante Website „Extrême<br />
Asie, Pour une politique progressiste en Asie“: http://daniellesabai.wordpress.com<br />
Übersetzung: Ursi Urech<br />
Ellen Meiksins Wood<br />
Demokratie contra Kapitalismus<br />
Beiträge zur Erneuerung des historischen Materialismus<br />
Aus dem Englischen von Ingrid Scherf und Christoph Jünke<br />
304 Seiten, kartoniert, 29,80 Euro<br />
ISBN 978-3-89900-123-5<br />
Vorbemerkung des Verlages<br />
Dass wir hiermit ein Buch erstm<strong>als</strong> in deutscher Übersetzung verlegen, dessen<br />
englisches Original bereits vor 15 Jahren erschien, bedarf für manche vielleicht<br />
der Erklärung.<br />
Nicht nur, aber vor allem hat unsere Entscheidung damit zu tun, dass es<br />
sich bei Ellen Meiksins Woods Werk Democracy against Capitalism. Renewing<br />
Historical Materialism um einen Beitrag zur neueren internationalen<br />
Marxismus-Diskussion handelt, der bereits zum Klassiker geworden ist. Wir<br />
haben es hierbei mit einem der wichtigsten und anregendsten Versuche der<br />
letzten beiden Jahrzehnte zu tun, den historischen Materialismus zu erneuern<br />
und auf die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform in Geschichte und<br />
Gegenwart anzuwenden.<br />
Ellen Meiksins Wood gilt <strong>als</strong> eine der bedeutendsten marxistischen TheoretikerInnen<br />
der angloamerikanischen Welt. 1942 in New York geboren, studierte<br />
sie in den sechziger Jahren an der University of California. Von 1967<br />
bis 1997 unterrichtete sie Politische Wissenschaften an der York University in<br />
Toronto, Kanada, und veröffentlichte in den siebziger Jahren erste Bücher<br />
und Aufsätze (u. a. zusammen mit ihrem 2003 gestorbenen Ehemann Neal<br />
Wood). Einem größeren Publikum wurde sie aber erst in den achtziger Jahren<br />
bekannt, <strong>als</strong> Redakteurin der renommierten britischen Theoriezeitschrift<br />
New Left Review und <strong>als</strong> Autorin des preisgekrönten Werkes The Retreat<br />
from Class: A New »True« Socialism (London 1986), in welchem sie sich kritisch<br />
mit postmarxistischen und postmodernen Theoretikern der internationalen<br />
Linken auseinandersetzt. In den dann folgenden Büchern Peasant-Citizen<br />
and Slave: The Foundations of Athenian Democracy (London 1988), The<br />
Pristine Culture of Capitalism (London 1992), Democracy Against Capitalism:<br />
Renewing Historical Materialism (Cambridge 1995) und The Origin of<br />
Capitalism: A Longer View (London 2002) widmete sie sich vor allem der<br />
Diskussion über die sozialgeschichtliche Herausbildung des modernen Kapitalismus<br />
und die unterschiedlichen Grundlagen antiker wie moderner Demokratiekonzeptionen.<br />
Der politisch-theoretische Aufbruch der internationalen<br />
Linken am Ende der neunziger Jahre sah sie <strong>als</strong> aktive Herausgeberin der USamerikanischen<br />
Zeitschrift Monthly Review, für die sie von 1997 bis 2000<br />
verantwortlich zeichnete und zahllose Beiträge verfasste. Nachdem ihr Werk<br />
bereits in zahllose Sprachen übersetzt war, wurde sie nun auch in Deutschland<br />
wahrgenommen und übersetzt, nicht nur, aber vor allem in den Zeitschriften<br />
Sozialistische Zeitung (Köln) und Sozialismus (mit ihrem Hambur-<br />
<strong>Die</strong> Autorin<br />
Ellen Meiksins Wood gilt <strong>als</strong> eine der bedeutendsten marxistischen TheoretikerInnen<br />
der angloamerikanischen Welt. 1942 in New York geboren, studierte<br />
sie in den sechziger Jahren an der University of California. Von 1967 bis<br />
1997 unterrichtete sie Politische Wissenschaften an der York University in<br />
Toronto, Kanada, und veröffentlichte in den siebziger Jahren erste Bücher<br />
und Aufsätze. In den achtziger Jahren war sie Redakteurin der renommierten<br />
britischen Theoriezeitschrift New Left Review, dann von 1997 bis 2000 Herausgeberin<br />
der US-amerikanischen Zeitschrift Monthly Review. Heute lebt<br />
Ellen Meiksins Wood in London. Eine ausführlichere Würdigung ihres<br />
Schaffens enthält die Vorbemerkung des Verlages.<br />
INPREKORR 468/469 39
NACHRUF<br />
Luis Vitale (1927–2010)<br />
Ein revolutionärer Historiker aus<br />
Lateinamerika<br />
Franck Gaudichaud<br />
Luis Vitale hat uns am 27. Juni 2010 verlassen<br />
– und mit ihm scheint ein <strong>ganze</strong>r<br />
Abschnitt der Geschichte der chilenischen<br />
(und lateinamerikanischen) Arbeiterbewegung<br />
zu Ende zu sein, für<br />
den auch Persönlich keiten wie Clotario<br />
Blest 1 stehen.<br />
Welche und wie viele politische Kräfte<br />
bei seiner Beisetzung in Santiago sowie<br />
bei der Gedenkveranstaltung mit seiner<br />
Asche in der Bergbaustadt Lota im<br />
Süden von Chile vertreten waren, zeigt,<br />
dass er sein Leben lang seinem Engagement<br />
und einem anspruchsvollen marxistischen<br />
Denken treu geblieben ist. Bis<br />
zu seinem letzten Atemzug fühlte er sich<br />
stets denen „unten“ verbunden, den arbeitenden<br />
Menschen, den Unterdrückten,<br />
dem Volk, das sich gegen jegliche Form<br />
von Ausbeutung und Unterdrückung zur<br />
Wehr setzte. „Lucho“, wie wir ihn aus<br />
Sympathie heraus genannt haben, war<br />
ein Mensch, der aufgrund seines biographischen<br />
Werdegangs und seinem vielfachen<br />
Engagement – <strong>als</strong> Gewerkschafter,<br />
<strong>als</strong> aktiver Revolutionär, <strong>als</strong> produktiver<br />
marxistischer Historiker, aber auch <strong>als</strong><br />
liebenswürdige und farbige Persönlichkeit<br />
– mit Sicherheit außergewöhnlich<br />
gewesen ist.<br />
Er ist in Argentinien geboren, verband<br />
aber sein Schicksal recht bald mit<br />
dem des chilenischen Volks und mit dessen<br />
Kämpfen. Seine Entwicklung war<br />
eng mit der Geschichte der trotzkistischen<br />
Bewegung in Chile verbunden,<br />
für die auch Namen wie der von Manuel<br />
Hidalgo, Luis und Pablo López Cáce-<br />
1 [Clotario Blest (1899–1990) war<br />
von 1953 bis 1961 Vorsitzender des<br />
Gewerkschaftsdachverbands<br />
CUT,<br />
1965 gehörte er zusam men mit anderen<br />
führenden Gewerkschaftern zu den<br />
Mitbegründern des MIR, den er 1969 verließ.<br />
Luis Vitale hat ihm eines seiner ersten Bücher<br />
gewidmet: Los discursos de Clotario Blest<br />
y la revolución chilena, Santiago de Chile:<br />
Editorial POR, 1961, (Colección Recabarren).]<br />
res, Héctor Velásquez, Joaquín Guzmán<br />
oder Hum berto Valenzuela stehen. 2 Der<br />
zuletzt genannte, ein bedeutender Arbeiterführer<br />
und Mitbegründer des chilenischen<br />
Trotzkismus in den 1930er<br />
Jahren 3 , war es übrigens, der Luis Vitale<br />
1955 für die chilenische Revolutionäre<br />
Arbeiter partei (Partido Obrero Revolucionario,<br />
POR) gewann. 4 Als „Lu-<br />
2 Vgl. hierzu das Buch von Dolores Mujica:<br />
Retratos: Hombres y mujeres del trotskismo.<br />
La cara oculta de la clase trabajadora chilena,<br />
o. O.: Clase Contra Clase, o. J. [2009],<br />
(Biblioteca de Historias Obreras, Bd. 6),<br />
www.bibliotecaobrera.cl/wp-content/<br />
uploads/2009/02/retratos-web1.doc.<br />
[Es enthält eine Einleitung von Luis Vitale und<br />
einen Abschnitt über ihn.]<br />
3 Humberto Valenzuela Montero (1909–<br />
1977) war bereits mit 15 Jahren in der<br />
Gewerkschaftsbewegung aktiv und trat<br />
ebenfalls 1924 der kommunistischen Partei<br />
bei. 1930 war Mitbegründer der trotzkistischen<br />
Bewegung in Chile, 1955 bis 1964 übte er<br />
das Amt des Gener<strong>als</strong>ekretärs der POR aus.<br />
1972 schrieb Humberto Valenzuela eine<br />
Geschichte der chilenischen Arbeiterbewegung<br />
von deren Anfängen bis 1970; <strong>als</strong> Luis<br />
Vitale 1975/76 in Westdeutschland im Exil<br />
lebte, bekam er diese Arbeit kapitelweise<br />
geschickt; sie wurde in kleiner Auflage und<br />
sehr einfacher Ausstattung im damaligen<br />
Verlag der deutschen Sektion der IV.<br />
Internationale veröffentlicht (Humberto<br />
Valenzuela, Historia del movimiento obrero,<br />
mit einem Vorwort von Luis Vitale, o. O.<br />
[Frankfurt/M.]: ISP Verlag, o. J. [1976?])<br />
Der Text kann aus dem Internet herunter<br />
geladen werden: „Historia del Movimiento<br />
Obrero Chileno. (Humberto Valenzuela)“<br />
http://www.bibliotecaobrera.cl/?cat=6.<br />
4 Er war ab 1952 in der argentinischen POR<br />
politisch aktiv gewesen [bis er im Februar<br />
1955 nach Chile ging bzw. geschickt wurde].<br />
[<strong>Die</strong> argentinische POR unter Führung von<br />
Nahuel Moreno (eigentlich Hugo Miguel<br />
Bressano Capacete, 1924–1987), 1944 <strong>als</strong><br />
„Grupo Obrero Marxista“ (GOM) entstanden,<br />
existierte ab 1948 unter dieser Bezeichnung,<br />
und stand in scharfer Rivalität zu der von J.<br />
Posadas (eigentlich Homero Rómulo Cristalli<br />
Frasnelli, 1912–1981) geführten „Grupo<br />
Cuarta Internacional“ (GCI), die 1953 auf dem<br />
3. Weltkongress <strong>als</strong> argentinische Sektion der<br />
IV. Internationale anerkannt wurde; vgl. hierzu<br />
L. Vitale, De Martí a Chiapas. Balance de un<br />
cho“ mir 2002 auf Fragen zu seinem politischen<br />
Leben antwortete, erinnerte er<br />
sich: „Ich war nicht nur <strong>als</strong> Mitglied der<br />
Sektion der IV. Internationale in Argentinien<br />
und in Chile aktiv, sondern auch<br />
<strong>als</strong> Gewerkschaftsführer. Ich bin in Argentinien<br />
geboren, und <strong>als</strong> ich nach Chile<br />
kam, gründete ich mit anderen die<br />
erste Gewerkschaft der Laboratoriumsbeschäftigten,<br />
und so bin ich in die Leitung<br />
der Föderation Chemie und Pharmazie<br />
gekommen; 1958 bin ich an der<br />
Seite von Clotario Blest auf die Ebene<br />
der CUT 5 gekommen. Ich habe von 1958<br />
bis 1969 der nationalen Leitung angehört.<br />
Das machte es möglich, dass ich die<br />
chilenische Gewerk schaftsbewegung im<br />
<strong>ganze</strong>n Land kennenlernte. Sie kennen<br />
zu lernen und sich zu verlieben, das hat<br />
auch bedeutet, dass ich den Rest meines<br />
Lebens in Chile verbringen würde. Dam<strong>als</strong><br />
hat in Chile die POR, die Revolutionäre<br />
Arbeiterpartei, existiert, eine Sektisiglo,<br />
Santiago de Chile: Editorial Síntesis;<br />
CELA, 1995, S. 123/124; Robert J. Alexander,<br />
International Trotskyism, 1929-1985. A<br />
Documented Analysis, Durham u. London:<br />
Duke University Press, 1991, S. 41.]<br />
5 [<strong>Die</strong> „Central Única de Trabajadores“ (CUT,<br />
Einheitszentrale der Arbeitenden), in deren<br />
Vorstand auf dem Gründungskongress<br />
Mitglieder der Sozialistischen Partei,<br />
der Kommunistischen Partei, von<br />
dissidenten sozialistischen Strömungen,<br />
Anarchosyndikalis ten, Unabhängige und andere<br />
gewählt wurden, organisierte im Mai 1954,<br />
September 1955 und Januar Gener<strong>als</strong>treiks.<br />
„Im Februar 1953 (…) gelang durch Druck<br />
der Basis der erneute Zusammenschluß der<br />
gespaltenen und in verschiedene lokale Sektionen<br />
zersplitterten Gewerkschaften zur<br />
(…) CUT. Sie bezeichnete sich auf ihrem 1.<br />
Kongreß <strong>als</strong> ein autonomes Organ des Klassenkampfes,<br />
sprach sich für den Aufbau einer<br />
sozialistischen Gesellschaft in Chile aus und<br />
unterstrich die Solidarität mit dem Proletariat<br />
der anderen Länder Lateinamerikas. Der<br />
Zusammenschluß führte binnen kurzer Zeit zu<br />
einer gewaltigen Stärkung des Kampfpotenti<strong>als</strong><br />
der Arbeiterklasse.“ (Arno Münster, Chile<br />
– friedlicher Weg? Historische Bedingungen,<br />
„Revolution in der Legalität“, Nieder lage,<br />
Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1972, S. 60.)]<br />
40 INPREKORR 468/469
NACHRUF<br />
on der IV. Internationale. Sie war, wenn<br />
ich mich richtig erinnere, die zweitgrößte<br />
Sektion, die der Trotzkismus in Lateinamerika<br />
hatte.“ 6 1955 gehörte er zu denen,<br />
die sich gegen die Strategie des vollständigen<br />
Entris mus in der chilenischen sozialistischen<br />
Partei stellten, er folgte <strong>als</strong>o<br />
der Minderheit unter Führung von Humberto<br />
Valen zuela und wurde zusammen<br />
mit ihm zu einem der führenden Mitglieder<br />
der POR. 7 Nach der „Wiedervereinigung“<br />
der IV. Internationale 1963 trafen<br />
sich Luis Vitales politische Aktivitäten<br />
und Standpunkte im Wesentlichen mit<br />
denen der internationalen Strömung, für<br />
die Ernest Mandel steht. 8<br />
Er war ein aufmerksamer Beobachter<br />
der Auf- und Umbrüche in Lateinamerika<br />
und wurde zu einem leidenschaftlicher<br />
Verteidiger der kubanischen Revolution.<br />
In der neuen Periode, die dam<strong>als</strong><br />
einsetzte, beteiligte sich die POR<br />
zu sammen mit anderen Organisationen<br />
1965 an der Gründung der Bewegung der<br />
Revolutionären Linken, des MIR (Movimiento<br />
de Izquierda Revolucionario);<br />
Lucho verfasste ihre Grundsatzerklärung.<br />
Während einige Mitglieder in dieser<br />
Fusion/Neugründung eine „Liquidation“<br />
der POR sahen, hat Vitale sich immer<br />
zu der Gründung des MIR bekannt,<br />
der während des vorrevolutionären Prozesses<br />
der „Unidad Popular“ (Volkseinheit)<br />
in den Jahren 1970 bis 1973 eine bedeutende<br />
Rolle spielen sollte: „Von un-<br />
6 Franck Gaudichaud, „Contribution à<br />
l’histoire du mouvement révolutionnaire<br />
chilien: Conversation avec Luis Vitale“,<br />
in: Dissiden ces, Nancy, Nr. 14/15, Januar<br />
2004 (Teil des Dossiers „Autour du<br />
mouvement révolutionnaire chilien“).<br />
http://www.dissidences.net<br />
7 [Luis Vitale schrieb: „Ende diesen Jahres<br />
[1954] beschloss die Mehrheit der POR, in<br />
die Sozialistische Partei einzutreten. Humberto<br />
wandte sich dagegen und beschloss,<br />
zusammen mit einer Handvoll von Arbeitern,<br />
das Banner der POR beizubehalten.“ (Vor wort<br />
zu: H. Valenzuela, Historia del movimiento<br />
obrero, a.a.O., S. 3.) Siehe auch L. Vitale, De<br />
Martí a Chiapas, a.a.O., S. 126.]<br />
8 [Bei der Spaltung der IV. Internationale 1953<br />
in die internationale Fraktion, die von einem<br />
Internationalen Sekretariat (IS) geleitet<br />
wurde (bekannteste Mitglieder: Michel Pablo<br />
[M. Raptis], Pierre Frank, Livio Maitan,<br />
Ernest Mandel), und das Internationale Komitee<br />
(IK) stellten sich die argentinische,<br />
die chilenische und die peruanische POR auf<br />
die Seite des IK, vor allem gegen J. Posadas,<br />
den Repräsentanten des IS in Lateinamerika.<br />
Vgl. hierzu L. Vitale, De Martí a Chiapas,<br />
a.a.O., S. 119; Livio Maitan, Per una storia<br />
della IV internazionale. La testimonianza di<br />
un comunista controcorrente, Roma: Edizioni<br />
Alegre, 2006, S. 272, 169, 170; R. J. Alexander,<br />
International Trotskyism, a.a.O., S. 198.]<br />
Luis Vitale (1927–2010)<br />
serem Standpunkt aus handelte es sich<br />
nicht um eine liquidatorische Operation,<br />
sondern vielmehr in Anbetracht der Bedeutung<br />
der kubanischen Revolution auf<br />
lateinamerikanischer Ebene um den Versuch<br />
einer politischen Praxis, die ein Vorankommen<br />
ermöglichen sollte.“ 9 Vier<br />
Jahre später verließ die alte Garde von<br />
Arbeitern und Trotzkisten (darunter Vitale)<br />
den MIR, sie wurde von einer neuen<br />
Generation (darunter Miguel Enrí quez),<br />
die zu einem Boykott von Allende und<br />
der Präsidentschaftswahl aufrief, hinausgedrängt.<br />
10 <strong>Die</strong> Mitglieder der IV. Inter-<br />
9 F. Gaudichaud, „Contribution …“.<br />
10 [Zur weiteren Entwicklung des MIR siehe:<br />
Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario<br />
en Chile. Discursos y documentos del<br />
Movimiento de Izquierda Revolucionario,<br />
MIR, hrsg. von Pedro Naranjo, Mauricio<br />
Ahumada, Mario Garcés, Julio Pinto,<br />
Santiago de Chile: Ediciones LOM, Centro<br />
de Estudios Miguel Enríquez, 2004; H.<br />
Valenzuela, Historia del movimiento<br />
obrero, a.a.O., S. 131–144. – Siehe auch:<br />
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_<br />
de_Izquierda_Revolucionaria_(Chile).<br />
Luis Vitale diskutiert die Entwicklung von dem<br />
1961 einsetzenden Prozess, der zur Gründung<br />
des MIR im August 1965 führte, bis zur<br />
Spaltung in drei Fraktionen im Jahr 1988, die<br />
<strong>als</strong> Organisationen rasch verschwinden sollten,<br />
in dem Abschnitt „Estudio de un caso: el MIR<br />
chileno“ seines Buchs De Martí a Chiapas.<br />
Balance de un siglo, a.a.O., S. 200–206.<br />
Auf Deutsch liegen unter anderem vor: A.<br />
Münster, Chile – friedlicher Weg? a.a.O.,<br />
nationale bildeten dann die Frente Revolucionario,<br />
aus der Ende 1972 die Partido<br />
Socialista Revolucionaria (PSR) entstand.<br />
<strong>Die</strong>se Organisation versuchte<br />
– mit ihren sehr bescheidenen Kräften<br />
– während der Regierung Allende<br />
die Kämpfe der „cordones industriales“<br />
(Delegiertenkomitees von mehreren Fabriken<br />
in einem Stadtteil oder Ort) zu<br />
radikalisieren. 11<br />
S. 172–184 (Kapitel „VI. <strong>Die</strong> revolutionäre<br />
Strategie des MIR); Gaby Weber: <strong>Die</strong> Guerilla<br />
zieht Bilanz. Lateinamerikanische Guerilla-<br />
Führer sprechen über Fehler, Strategien und<br />
Konzeptionen – Gespräche, aufgezeichnet in<br />
Argentinien, Bolivien, Chile und Uruguay,<br />
Gießen: Focus Verlag, 1989, S. 186–262<br />
(Interviews mit Andrés Pascal Allende, Rafael<br />
Marotto, Martín, Carmen Rojas, Enrique).]<br />
11 [Ein „cordón industrial“ (wörtlich:<br />
Industriegürtel) war eine Delegiertenstruktur<br />
von Fabriken auf der Ebene von Stadtteilen oder<br />
ähnlich, die unabhängig von den Apparaten<br />
der CUT oder der Parteien der Unidad Popular<br />
waren; in Santiago de Chile gab es zur Zeit des<br />
Putschs im September 1973 acht „Cordones<br />
Industriales“. Sie entstanden im Juni 1972<br />
und waren – zusammen mit „Coman dos<br />
Comunales“ (sowie „Consejos Campesinos“)<br />
– Ansätze zu einer Rätebewegung oder<br />
potentielle Organe einer Doppelmacht<br />
oder eines „poder popular“ (Volksmacht).<br />
Vgl. hierzu unter anderem die umfangreiche<br />
Arbeit, mit der Franck Gaudichaud promoviert<br />
hat: Poder popular y Cordones industri ales.<br />
Testimonios sobre el movimiento popular<br />
urbano chileno 1970-1973, mit einem Vorwort<br />
von Michael Löwy, Santiago de Chile: LOM<br />
INPREKORR 468/469 41
NACHRUF<br />
Der Putsch vom September 1973 bedeutete<br />
für „Lucho“ wie für Hunderttausende<br />
Folter, Konzentrationslager (von<br />
denen er in nicht weniger <strong>als</strong> neun geschleppt<br />
wurde), dann ab 1975 Exil. 12 Er<br />
war weiter politisch aktiv, zuerst in Europa,<br />
dann in Venezuela (El Topo Obrero,<br />
1980 bis 1985); nachdem er 1989 nach<br />
Chile zurückgekehrt war, suchte er zu einer<br />
neuen revolutionären Bewegung beizutragen.<br />
13 Der Einschnitt von 1973 (ein<br />
persönlicher wie kollektiver Ein schnitt)<br />
bezeichnete auch das Ende seines Wegs<br />
<strong>als</strong> politische Führungsperson, nicht jedoch<br />
das Ende seiner Tätigkeit <strong>als</strong> eines<br />
engagierten Intellektuellen.<br />
Aufgrund seiner theoretischen Arbeit<br />
und <strong>als</strong> Historiker hatte Vitale eine beträchtliche<br />
Wirkung, und zwar auf internationaler<br />
Ebene. Nachdem er Gewerkschafter<br />
war, ist er 1968 Universitätsdozent<br />
geworden, <strong>als</strong> Ergebnis einer Forschungsarbeit,<br />
die wegen ihrer Ernsthaftigkeit<br />
und Originalität Anerkennung<br />
fand. In den 1960er Jahren begann er damit,<br />
sein großes Werk zu verfassen: eine<br />
marxistische Interpretation der Geediciones,<br />
2004; sowie Miguel Silva, Los<br />
Cordones Industriales y el socialismo desde<br />
abajo, Santiago de Chile: im Selbstverlag,<br />
1997; Franck Gaudichaud, La Central Única de<br />
Trabajadores, las luchas obreras y los Cordones<br />
Industriales en el periodo de la Unidad Popular<br />
en Chile (1970-1973). Análisis histórico crítico<br />
y Perspectiva (http://www.bibliotecaobrera.<br />
cl/wp-content/uploads/2008/11/cut.pdf).<br />
Siehe auch: http://en.wikipedia.org/wiki/<br />
Cordón_Industrial.]<br />
12 Zu der Repression, die er zu erleiden hatte, und zu<br />
der gegen sein Volk siehe: F Gaudichaud, „Luís<br />
Vitale: Memoria de la tortura“, Rebelión, 2004,<br />
www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=8269.<br />
[Vgl. auch die Broschüre, die nicht lange nach<br />
seiner Ankunft in Deutschland (Ende November<br />
1974) verfasst wurde in der Inter views, Berichte,<br />
Informationen für die Solidaritätsbewegung und<br />
in der Gefangenschaft geschriebene Notizen<br />
zusammengestellt sind: Luis Vitale, La represión<br />
militar en Chile. Vida, muerte y discusion<br />
politica en los campos de concentracion,<br />
Frankfurt/M.: Edicio nes Rojas, 1975.<br />
Sie enthält unter anderem die spanischsprachige<br />
Version eines Interviews, das unter dem<br />
Titel „Luis Vitale nimmt Stellung“ in was<br />
tun, der damaligen Zeitung der deutschen<br />
Sektion der IV. Internationale, der Gruppe<br />
Internationale Marxisten (GIM), erschienen<br />
ist (7. Jg., Nr. 66, 16. Dezember 1974, S. 8/9).<br />
Luis Vitale war vom 12. September 1973 bis 28.<br />
November 1974 in Chile in neun Gefängnissen<br />
und Konzentrationslagern und lebte danach etwa<br />
16 Jahre lang im Exil – in Deutschland, dem<br />
Spanischen Staat, Venezuela und Argentinien.]<br />
13 [Luis Vitale selber hat seinen politischen<br />
Werdegang von 1948 bis 1995 auf gedrängtem<br />
Raum in dem Vorwort zu dem Buch dargestellt,<br />
in dem er eine Bilanz des 20 Jahrhunderts aus<br />
lateinamerikanischer Sicht zieht: De Martí a<br />
Chiapas. Balance de un siglo, a.a.O., S. 7/8.]<br />
schichte Chiles. 14 Er setzte sich <strong>als</strong> einer<br />
der in Chile und in Lateinamerika<br />
meistgelesenen marxistischen Historiker<br />
durch, der eine materialistische Lektüre<br />
der Ge schichte des Kontinents anbot, 15<br />
wobei der Akzent auf den Klassenkämpfen,<br />
der Rolle der Arbeiterbewegung,<br />
dem Imperia lismus und dem Ort von<br />
Lateinamerika in einer ungleichen und<br />
kombinierten Entwicklung des internationalen<br />
Kapitalismus liegt. Parallel hierzu<br />
führte er innerhalb dieser geschichtswissenschaftlichen<br />
Strömung scharfe<br />
Debatten mit Forschern und Ideologen,<br />
die mit dem Stalinismus und den kommunistischen<br />
Parteien verbunden waren.<br />
Er wider legte ihre Theorien der „Revolution<br />
in Etappen“ oder ihre Analyse<br />
des lateinamerikanischen Feudalismus.<br />
Stets lag es ihm am Herzen, seine zahlreichen<br />
Schriften – 67 Bücher und über<br />
200 Artikel 16 – mit einer ausdrücklich<br />
antikapitalisti schen Reflexion auf politischer<br />
und strategischer Ebene zu verknüpfen.<br />
Er reagierte auf das, was sich in der<br />
Gesellschaft tat, und er blieb bis ins hohe<br />
Alter fröhlich und gut gelaunt. Er liebte<br />
Tango, guten Wein und lange Abende,<br />
an denen die <strong>ganze</strong> Welt durchgegangen<br />
wurde; in seiner bescheidenen Wohnung<br />
empfing er Studierende, politische AktivistInnen,<br />
Nachbarn, stets wusste er einige<br />
gute Geschichten zu er zählen, und<br />
er hatte viel Humor. Er bekämpfte Arbeitertümelei<br />
und Dogmatismus jeder<br />
Art, und – zum Teil Jahrzehnte, bevor<br />
diese Themen für alle Welt Pflicht wurden<br />
– weitete er seine Forschungen auf<br />
die Geschichte der Frauen und des Feminismus<br />
17 , auf die Problematik der indíge-<br />
14 [Interpretación marxista de la historia<br />
de Chile, 5 Bde., 1967–1980.]<br />
Neue <strong>Ausgabe</strong> in sieben Bänden bei Ediciones<br />
LOM (Santiago 2000).<br />
15 Siehe vor allem: Historia general de América<br />
latina, 9 Bde., Caracas, 1984; De Martí a<br />
Chiapas. Balance de un siglo, 1995; Historia<br />
social comparada de los pueblos de América<br />
Latina, 3 Bde., Punta Arenas: Comercial Atelí,<br />
1999.<br />
16 Einige Schriften im Buchformat und kürzere<br />
Texte von Luis Vitale sind im Netz zugänglich,<br />
siehe: http://mazinger.sisib.uchile.cl/<br />
repositorio/lb/filosofia_y_humanidades/vitale/<br />
[sowie http://www.bibliotecaobrera.cl/?cat=6;<br />
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/<br />
html/vitale_l.html].<br />
17 [Aportes para una historia y sociología de la<br />
mujer latinoamericana, Caracas: Universidad<br />
Central de Venezuela, 1978; Historia y<br />
sociología de la mujer latinoamericana,<br />
Barcelona: Editorial Fontamara, 1981;] La<br />
mitad invisible de la historia latinoamericana.<br />
El protagonismo social de la mujer, Buenos<br />
nas oder die Volksmusik aus und befasste<br />
sich mit der ökologischen Frage 18 oder<br />
der Geschichte des Anarchismus 19 . Kurz<br />
vor seinem Tod schrieb er: „Mein Engagement<br />
an der Seite der Völker Unseres<br />
Amerikas kommt in meinen Veröffentlichungen<br />
zum Ausdruck. (…) Ich bin gegenwärtig<br />
ein libertärer Marxist, der zum<br />
Kampf der sozialen Bewegungen für eine<br />
Gesellschaft beiträgt, die alternativ<br />
zum ,neoliberalen‘ Ka pitalismus steht,<br />
dem Kapitalismus, der viel eher konservativ<br />
<strong>als</strong> liberal ist.“<br />
Aus dieser großen geistigen Offenheit<br />
im <strong>Die</strong>nst eines lebendigen, kritischen<br />
Marxismus und seiner vielgestaltigen<br />
Zusammenarbeit mit zahlreichen<br />
Kollektiven erklärt sich, von welch unterschiedlichen<br />
Zusammenhängen ihm<br />
Nachrufe gewidmet worden sind – von<br />
libertären, trotzkistischen oder antikapitalistischen<br />
Organisationen, Stadtteilkomitees,<br />
Gewerkschaften, Studentengruppen<br />
oder Verbänden von indigenen<br />
Mapuches. Alle gemeinsam riefen:<br />
„¡Lucho Vitale presente!“<br />
Franck Gaudichaud ist „Maître de conférences“<br />
(außerordentlicher Professor) an der Universität<br />
Grenoble 3, Mitglied der NPA und ihrer Arbeitsgruppe<br />
Lateinamerika; er gehört den Redaktionen<br />
der Webseite www.rebelion.org und<br />
der Zeitschriften ContreTemps und Dissidences<br />
an. Er hat einen umfangreichen Sammelband<br />
über die unterschiedlichen Varianten der Linken,<br />
die sozialen Bewe gungen und den Neoliberalismus<br />
in Lateinamerika herausgegeben (Le volcan<br />
latino-américain. Gauches, mouvements sociaux<br />
et néolibéralisme, Paris: Les éditions Textuel,<br />
2008).<br />
Aus dem Französischen übersetzt und<br />
bearbeitet von Wilfried Dubois.<br />
Aires: Sudamericana / Planeta, 1987.<br />
18 [Hacia una historia del ambiente en América<br />
Latina. De las culturas aborígenes a la crisis<br />
ecológica actual, México, D. F.: Nueva<br />
Sociedad / Editorial Nueva Imagen, 1983;<br />
dt.: Umwelt in Lateinamerika. <strong>Die</strong> Geschichte<br />
einer Zerstörung. Von den Kulturen der<br />
Eingeborenen zur ökologischen Krise der<br />
Gegenwart, {aus dem Spanischen übersetzt<br />
von Alexander Schertz}, Frankfurt/M.: ISP-<br />
Verlag, 1990.]<br />
19 [Contribución a la historia del anarquismo<br />
en América latina, Santiago: Ed. Instituto<br />
de Investigación de Movimientos Sociales<br />
„Pedro Vuskovic“, 1998; sowie Oscar Ortiz,<br />
Crónica anarquista de la subversión olvidada<br />
/ Luis Vitale, Contribución a una histo ria del<br />
anarquismo en América Latina, o. O. [Chile]:<br />
Eds. Espíritu Libertario, 2002.]<br />
42 INPREKORR 468/469
GESCHICHTE<br />
<strong>Die</strong> grüne Fahne Mohammeds und<br />
die Ausbreitung des Welthandels<br />
Jean Batou<br />
Mohammed erblickt etwa um 570 nach<br />
Christi Geburt in Mekka das Licht der<br />
Welt. Das Zentrum der arabischen<br />
Halbinsel erfährt in dieser Zeit durch<br />
Karawanenströme, die Waren und Informationen<br />
von Palästina im Norden<br />
und Yemen im Süden, von Äthiopien<br />
im Westen bis zum Persischen Golf im<br />
Osten transportieren, eine rasche Entwicklung.<br />
<strong>Die</strong> Geburtsstunde des Islams<br />
kann ohne diesen Hintergrund<br />
nicht erfasst werden.<br />
<strong>Die</strong> beiden Großreiche, das römisch-byzantinische,<br />
das noch immer<br />
den Großteil des Mittelmeerraums<br />
kontrolliert, und das Perserreich<br />
der Sassaniden, sowie die Zivilisation<br />
Äthiopiens (Königreich von<br />
Aksum) und das „glückliche Arabien“<br />
(Himjar oder Jemen) bilden mächtige<br />
Anziehungspole in den vier Himmelsrichtungen<br />
dieser Weltregion. Byzanz<br />
ist in dieser Zeit mit dem christlichen<br />
Äthiopien verbündet, während<br />
das Sassanidenreich sich Südarabien<br />
unterwerfen konnte, das damit seinen<br />
Einfluss über den Rest der Halbinsel<br />
teilweise einbüßt. Zwischen 540 und<br />
629 schwächen ständige Kriege zwischen<br />
den Byzantinern und Persern deren<br />
Einfluss über die umkämpften Gebiete<br />
des Fruchtbaren Halbmonds 1 , in<br />
dem sich immer mehr MigrantInnen<br />
arabischen Ursprungs niederlassen.<br />
<strong>Die</strong> teilweise sesshaft gewordenen<br />
Beduinenstämme Zentralarabiens<br />
gehen voll in ihrer Vermittlerrolle auf<br />
und entwickeln ein Netz an Märkten<br />
mit Mekka im Zentrum. Sie stehen mit<br />
zahlreichen christlichen Abtrünnigen<br />
des Fruchtbaren Halbmonds (Mono-<br />
1 Der „Fruchtbare Halbmond“ ist eine Region<br />
im Nahen Osten, die das Gebiet der heutigen<br />
Staaten Israel/Palästina, Libanon, Zypern,<br />
Kuweit sowie Teile von Jordanien, Syrien,<br />
Irak, Iran, Ägypten (darüber scheint kein<br />
Konsens zu bestehen) und den Südosten der<br />
Türkei umfasst. Der Begriff „Fruchtbarer<br />
Halbmond“ wurde vom Archäologen James<br />
Henry Breasted von der Universität Chicago<br />
geprägt und spielt auf den halbmondförmigen<br />
Bogen an, den die genannten Gebieten bilden.<br />
physiten, Nestorianern etc.), aber auch<br />
Äthiopiens und des Jemen in Kontakt,<br />
die sich über die doppelte göttlichmenschliche<br />
Wesenheit Christi streiten,<br />
aber auch mit den Zoroastriern<br />
und Juden Persiens. 2<br />
DIE ARABISCHE HALBINSEL<br />
ZUR ZEIT MOHAMMEDS<br />
„Der Fruchtbare Halbmond und die<br />
benachbarten Regionen bieten mehr<br />
Kontaktpunkte zu Fernhandelsrouten<br />
<strong>als</strong> jede andere vergleichbare Region“<br />
Eurasiens. 3 <strong>Die</strong> relative Trockenheit<br />
außerhalb der großen Überschwemmungsgebiete<br />
in den Ebenen<br />
fördert die halbnomadischen Züchter<br />
und die Kaufleute, die gemeinsam ein<br />
Gegengewicht zur aufsteigenden Bodenaristokratie<br />
bilden. <strong>Die</strong>se soziale<br />
Zusammensetzung lässt die monotheistischen<br />
Religionen – Zoroastrismus,<br />
Judentum und Christentum – aufblühen,<br />
die den Bedürfnissen der Kaufleute<br />
entgegenkommen, denen vor allem<br />
an der Regulierung der zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen liegt. Dem<br />
Individuum wird unterdessen die Verantwortung<br />
für sein einmaliges Leben<br />
(statt mehrfacher Reinkarnationen) vor<br />
einem einzigen Gott und einer einzigen<br />
Gemeinschaft mit einheitlicher Rechtsprechung<br />
und gleichberechtigtem Anspruch<br />
zugeschrieben.<br />
An den Rändern der großen Agrarländer<br />
kontrollieren Viehzüchter- und<br />
Händlergesellschaften, in denen auch<br />
2 Patricia Crone behauptet, der Islam sei eher im<br />
Norden der arabischen Halbinsel und nicht in<br />
Zentralarabien entstanden, wo der Aufschwung<br />
des Handels, aber auch die Verbreitung des<br />
Judentums und des Christentums im ersten<br />
Drittel des 7. Jahrhunderts noch sehr begrenzt<br />
waren (Meccan Trade and the Rise of Islam,<br />
Princeton U.P., 1987). <strong>Die</strong> Fundiertheit dieser<br />
provokanten These wurden jedoch durch<br />
jüngste arachäologische Arbeiten erschüttert.<br />
3 <strong>Die</strong> Zitate von M. S. Hodgson stammen aus<br />
„The Venture of Islam. Conscience and History<br />
in a World Civilization“, Bd. 1: The Classical<br />
Age of Islam, Chicago 1977.<br />
Plünderungen an der Tagesordnung<br />
sind, den Tauschhandel zwischen dem<br />
Mittelmeer und den südlichen Meeren.<br />
Verglichen mit den bedeutenden landwirtschaftlichen<br />
Zivilisationen sind sie<br />
zweifellos Zwerge, doch sie sitzen auf<br />
den Schultern dieser Riesen und sehen<br />
manchmal weiter <strong>als</strong> diese. <strong>Die</strong> Domestizierung<br />
des Kamels sichert ihnen<br />
gleichzeitig Milch, Karawanen<br />
(aus dem Sanskrit Karhaba, was Kamel<br />
bedeutet) und – nebem dem Pferd<br />
– einen entscheidenden militärischen<br />
Vorteil. <strong>Die</strong>se Stämme und ihre Anverwandten<br />
in den Oasen genießen<br />
das höchste Ansehen und nennen sich<br />
selbst ‚Arab’. Sie leben in einer wenig<br />
hierarchischen, wenig polarisierten<br />
und damit solidarischen Gesellschaftsordnung.<br />
<strong>Die</strong> Einzelnen werden<br />
<strong>als</strong> verantwortlich für ihre Entscheidungen<br />
angesehen, wodurch sich Gewalt<br />
innerhalb der Gruppe angesichts<br />
der Vergeltung, die sie nach sich zieht,<br />
in Grenzen hält.<br />
„In Mohammeds Kindheit führt<br />
der Großteil des Handels zwischen<br />
dem Mittelmeerraum und dem indischen<br />
Ozean über Landwege, die von<br />
den Arabern kontrolliert werden“,<br />
schreibt Hodgson. In spiritueller Hinsicht<br />
breiten sich entlang der Karawanenrouten<br />
biblische Ideen aller Glaubensrichtungen<br />
aus, während die Perser<br />
<strong>als</strong> Schutzmacht der Juden einen<br />
Sieg nach dem anderen über Byzanz<br />
erringen. „Nun wandte man sich den<br />
universalistischen Religionen zu, den<br />
Religionen des Individuums, jenen,<br />
die nicht mehr den ethnischen Verband<br />
betrafen, sondern darauf abzielten, das<br />
Heil einer jeden menschlichen Person<br />
in ihrer unvergleichlichen Einmaligkeit<br />
zu erlangen.“ Sowohl dem Judentum,<br />
das sich in manchen Oasen ansiedelt,<br />
<strong>als</strong> auch dem Christentum, dessen<br />
gläubige Eremiten die Fantasien der<br />
Zeitgenossen ansprechen, fehlt es jedoch<br />
an lokaler Verankerung.<br />
Sollte der alte Allah, die verbin-<br />
INPREKORR 468/469 43
GESCHICHTE<br />
dende Gottheit der Beduinen, um die<br />
es bislang keinen besonderen Kultus<br />
gibt, in der Lage sein, die zahlreichen<br />
Stammesidole zu verdrängen und <strong>als</strong><br />
authentischer Gott des Buches „wiedergeboren“<br />
zu werden? Rodinson<br />
geht davon aus, dass dies dem Zeitgeist<br />
entsprach. „Das große Bedürfnis<br />
der Epoche bestand in einem arabischen<br />
Staate, der von einer arabischen<br />
Ideologie geleitet und den neuen Verhältnissen<br />
angepasst war, der jedoch<br />
dem Milieu der Beduinen, denen er ihren<br />
Platz einräumen musste, noch nahe<br />
genug stand, einem Staate, der eine<br />
mit den großen Reichen gleichrangige<br />
und gleichermaßen geachtete Macht<br />
bildete. <strong>Die</strong> Wege waren für den genialen<br />
Mann geebnet, der es besser <strong>als</strong> irgendein<br />
anderer verstand, diesem Befürnis<br />
zu entsprechen.“ (S. 45) <strong>Die</strong>se<br />
Aufgabe fiel Mekka zu, das die Nord-<br />
Süd-Verbindung des Hedschas 4 kontrollierte,<br />
des wichtigsten Handelsknotens<br />
West- und Zentralarabiens auf<br />
halbem Weg zwischen Syrien, Persien<br />
und dem Jemen. Übrigens stand die<br />
Kaaba, das bereits unter dem Schutz<br />
Allahs stehende Heiligtum, <strong>als</strong> Kultstätte<br />
zahlreichen anderen heidnischen<br />
Gottheiten der <strong>ganze</strong>n Region offen<br />
und zog sogar christliche Pilger an.<br />
DIE ANFÄNGE EINES PROPHE-<br />
TEN<br />
Anfang des 7. Jahrhunderts profitierte<br />
Arabien von der politischen Schwächung<br />
seiner Nachbarn vor dem Hintergrund<br />
des Aufschwungs des Handels<br />
auf seinem Gebiet. Kulturell drückte<br />
sich diese Vitalität durch das Aufblühen<br />
der vorislamischen Poesie aus, die<br />
zur Vereinheitlichung der Sprache auf<br />
der Grundlage der verschiedenen Dialekte<br />
beitrug. <strong>Die</strong>se rhythmischen,<br />
mündlich nach einer geregelten Metrik<br />
vorgetragenen Oden geben eine<br />
starken Eindruck von den Lebensbe-<br />
4 Maxime Rodinson, Mohammed. C. J. Bucher-<br />
Verlag, Luzern u. Frankfurt/M. 1975. <strong>Die</strong><br />
anderen Zitate von Rodinson sind ebenfalls<br />
der 1994 veröffentlichten überarbeiteten und<br />
ergänzten Fassung dieses hervorragenden<br />
Überblickswerks entnommen, das 1961<br />
erstm<strong>als</strong> erschien (Paris, Seuil). Vom selben<br />
Autor: Islam und Kapitalismus, Frankfurt<br />
1986 (frz. Paris 1966); Marxisme and the<br />
muslim world, New York 1981 (Paris 1972) ;<br />
<strong>Die</strong> Araber, Frankfurt/M. 1991 (Paris 1979);<br />
<strong>Die</strong> Faszination des Islam, München 1985<br />
(Paris 1980); L’Islam : politique et croyances,<br />
Fayard, Paris 1993.<br />
dingungen, den Idealen und Gefühlen<br />
der Araber dieser Zeit. 5 <strong>Die</strong> Geschichte<br />
von Leila und Madschnun 6 ist in der<br />
zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts entstanden<br />
und erzählt von der unmöglichen<br />
Liebe, die in soziale Transgression<br />
in Form von Verrücktheit, aber auch<br />
von Spiritualität führen kann:<br />
„Abends erhellte sein Gesicht die<br />
Finsternis wie die Lampe eines in Abgeschiedenheit<br />
lebenden Mönchs.“<br />
<strong>Die</strong> schöpferischen Dichter ebenso<br />
wie die christlichen Eremiten beeinflussen,<br />
wie wir noch sehen werden,<br />
den Werdegang Mohammeds (eigentlich<br />
Muhammad, Mehmet für die Türken,<br />
Mamadou für die Afrikaner). Er<br />
wird in eine verarmte Sippe des mächtigen<br />
Stammes der Kuraisch geboren,<br />
der den Tempel von Mekka kontrolliert<br />
und von dem es heißt, er beherrsche<br />
die wichtigsten Handelsrouten<br />
des Hedschas. Nach dem frühen Tod<br />
seiner Eltern wird Mohammed von seinem<br />
Großvater und später von seinem<br />
Onkel Abu Talib aufgezogen, einem<br />
wohlhabenden Geschäftsmann. Im Alter<br />
von 25 Jahren heiratet er eine um<br />
fünfzehn Jahre ältere Witwe, mit der er<br />
vier Töchter hat.<br />
Das Leben Mohammeds ist historisch<br />
besser dokumentiert <strong>als</strong> das<br />
von Jesus. 7 Er wird <strong>als</strong> Mann mittlerer<br />
Körpergröße mit breiten Schultern<br />
und robustem Knochenbau,<br />
großem Kopf, langem, schmalem Gesicht<br />
und schwarzen Augen beschrieben.<br />
Er ist ein besonnener, ausgeglichener<br />
Mensch, der sowohl langwierige<br />
Verhandlungen führen <strong>als</strong> auch<br />
schnell zur Tat schreiten kann. Er wird<br />
rasch ein erfolgreicher Kaufmann, was<br />
auch Eingang in seine Sprache findet.<br />
So wird im Koran beispielsweise<br />
das jüngste Gericht <strong>als</strong> „Abrechnung“<br />
(21, 1) bezeichnet. <strong>Die</strong> materiellen Erfolge<br />
scheinen ihm aber keine ausreichende<br />
Genugtuung zu bieten. Seine<br />
Unfähigkeit, seiner Frau einen männlichen<br />
Nachkommen zu geben, setzt<br />
ihm zu. Sein freiwilliger Verzicht auf<br />
jegliche außereheliche Beziehung in<br />
einem Umfeld, in dem junge Männer<br />
eine sehr freizügige Sexualität leben,<br />
5 Nordwesten der arabischen Halbinsel mit den<br />
Städten Mekka und Medina.<br />
6 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples,<br />
Cambridge (Mass.), Harvard U.P. 1991, S. 12–<br />
14.<br />
7 Nizami: <strong>Die</strong> Geschichte der Liebe von Leila<br />
und Madschnun, Zürich, Unionsverlag 2001.<br />
frustriert ihn zweifellos, vor allem aber<br />
leidet er darunter, dass seine außergewöhnlichen<br />
intellektuellen und politischen<br />
Fähigkeiten nicht zur Geltung<br />
kommen.<br />
Den Spuren seiner arabischen monotheistischen<br />
Vorfahren (Hanif) wie<br />
auch der jüdischen und christlichen<br />
Mystiker folgend verbringt Mohammed<br />
lange Stunden meditierend in einer<br />
Höhle auf dem Berg Hira in der<br />
Umgebung von Mekka. Hier empfängt<br />
er eines Nachts „die wahre Schau, und<br />
sie kam wie der Anbruch des Morgengrauens“,<br />
wie er später seiner zweiten<br />
Ehefrau Aïsha verrät. Zuerst hörte<br />
er eine Stimme, die ihm sagt: „Du<br />
bist der Abgesandte Gottes! (…) Nach<br />
den Empfindungen einer übernatürlichen<br />
Gegenwart, den verschwommenen<br />
Visionen und dem Vernehmen einfacher<br />
Sätze kamen die langen Folgen<br />
wohlgeordneter Worte, die einen klaren<br />
Sinn offenbarten, einer Botschaft.<br />
Schließlich befahl ihm das Mächtige<br />
Wesen, zu rezitieren: ‚Im Namen Allahs<br />
…‘ Er hatte den ersten Satz des<br />
zukünftigen Korans ausgesprochen.“<br />
(S. 75) „All dies ereignete sich im Hirn<br />
eines einzigen Menschen“, kommentiert<br />
Rodinson, „doch darin spiegelten,<br />
darin bewegten sich die Probleme eines<br />
<strong>ganze</strong>n Universums, und die historischen<br />
Umstände waren dergestalt,<br />
dass die Ergebnisse all dieser geistigen<br />
Unrast in der Lage waren, ganz<br />
Arabien und darüber hinaus die <strong>ganze</strong><br />
Welt aufzurütteln.“<br />
DIE SOZIALE SPRACHE DES<br />
FRÜHEN ISLAM<br />
Jeder monotheistische Glauben tendiert<br />
zum Prinzip der Gleichheit aller<br />
und deren Gehorsam gegenüber<br />
dem Willen Gottes, aber auch ihres<br />
Heils und ihrer Verdammnis am Ende<br />
aller Zeiten, ungeachtet des Reichtums.<br />
<strong>Die</strong>s gilt umso mehr für den Islam,<br />
der die christliche Lehre von der<br />
Dreifaltigkeit im Namen der absoluten<br />
Einmaligkeit Allahs ablehnt. Der Koran<br />
schildert den Gläubigen daher sehr<br />
eindrücklich die Qualen der Hölle und<br />
die Freuden des Paradieses. „In diesen<br />
Synthesen erhielt das Individuum<br />
einen besonderen und herausragenden<br />
Wert. Es war der Gegenstand der<br />
Sorge des Höchsten Wesens, das es erschaffen<br />
hatte und das ohne Ansehen<br />
der Verwandtschaft, der Familie, des<br />
44 INPREKORR 468/469
GESCHICHTE<br />
Stammes über es richten würde“, wie<br />
Rodinson betont.<br />
Ab den letzten Jahrzehnten des 6.<br />
Jahrhunderts bedrohte der Aufstieg der<br />
Kaufleute aus Mekka „des Stammeszusammenhalt<br />
und untergrub auf jeden<br />
Fall das bei den Beduinen gelebte Ideal<br />
des großzügigen Menschen, für den<br />
Reichtum ein willkommener, aber relativ<br />
vergänglicher Unterschied war“,<br />
schreibt Hodgson. So wenden sich vor<br />
allem Freigeister, die die Herrschaft<br />
der führenden Gesellschaftsschichten<br />
in Mekka ablehnen, <strong>als</strong> erstes Mohammed<br />
zu, darunter junge Menschen aus<br />
gutem Haus, die sich gegen die ältere<br />
Generation auflehnen, aber auch Abkömmlinge<br />
weniger einflussreicher<br />
Clans, Leute von außerhalb Mekkas,<br />
die nicht der Sippe angehören, Sklaven<br />
und freigelassene Sklaven. Der<br />
Prophet ergreift übrigens Partei für die<br />
Armen und Waisen und ermahnt die<br />
reichen Koraischiten, deren Arroganz<br />
er verachtet:<br />
„Nein, ihr seid nicht freigebig gegen<br />
die Waisen und treibt einander<br />
nicht an, den Armen zu speisen! Und<br />
verzehrt das Erbe (anderer) ganz und<br />
gar! Und ihr liebt den Reichtum mit<br />
übermäßiger Liebe.“ (Koran, 89, 17–<br />
20)<br />
Gemäß den Grundsätzen der Offenbarungsreligionen<br />
werden die Gebote<br />
des Allerhöchsten den Menschen<br />
über einen Propheten vermittelt,<br />
der aufgrund seiner Stellung legitime<br />
Ambitionen auf die oberste spirituelle<br />
Macht hegt: „Wie sollte sich ein<br />
Mensch, zu dem Gott direkt gesprochen<br />
hat, den Entscheidungen irgendeines<br />
Senats unterwerfen?“, schreibt<br />
Rodinson. „Wie sollten die Vorschriften<br />
des Allerhöchsten von der Aristokratie<br />
Mekkas erörtert werden?“ Entwickelt<br />
Mohammed zudem nicht „eine<br />
kritische Haltung [Rodinson nennt<br />
sie sogar ‹implizit revolutionär›] gegenüber<br />
den Reichen und Mächtigen,<br />
<strong>als</strong>o den Konformisten“?<br />
Folglich erfahren die rund vierzig<br />
Anhänger Mohammeds und insbesondere<br />
die verletztlichsten unter ihnen<br />
Repression: So wird der schwarze<br />
Sklave Bilâl von seinen Herren während<br />
der heißesten Tageszeit stundenlang<br />
mit einem Felsen auf der Brust<br />
der Sonne ausgesetzt. In dieser belastenden<br />
Atmosphäre schließen sich<br />
dennoch weitere Schüler dem Propheten<br />
an, wie ‹Omar ibn al-Khattab, der<br />
Arabische Händler<br />
später <strong>als</strong> zweiter Kalif sein Nachfolger<br />
wird. Manche wandern nach Abessinien<br />
aus, die meisten genießen<br />
aber weiterhin die Unterstützung ihres<br />
Clans. So wird Mohammed von den<br />
Banu Hashim und insbesondere von<br />
seinem sehr einflussreichen Abu Talib<br />
in Schutz genommen. <strong>Die</strong>ses prekäre<br />
Gleichgewicht bricht mit dem Tod<br />
des Letzteren im Jahr 619 sowie jenem<br />
von Mohammeds erster Frau Chadidscha<br />
zusammen.<br />
Im Jahr 622, <strong>als</strong> sich das ausgehungerte,<br />
von Persern und Awaren belagerte<br />
Byzanz in einer apokalyptischen<br />
Stimmung befindet, bricht die kleine<br />
Gruppe von Gläubigen in das rund 350<br />
Kilometer nordwestlich gelegene Medina<br />
auf: Es ist die Hidschra (Auswanderung),<br />
die den Beginn des muslimischen<br />
Kalenders markiert. <strong>Die</strong> neue,<br />
von der Stimme Gottes inspirierte Gesellschaftsordnung<br />
unter Führung Mohammeds<br />
setzt sich hier weiter für die<br />
Interessen der Waisen, der Bettler und<br />
Reisenden ein. Sie empfiehlt, die Sklaven<br />
gut zu behandeln und wenn möglich<br />
freizulassen; Gläubigen ist es sogar<br />
verboten, Sklaven zu halten. 632,<br />
<strong>als</strong> der Prophet höchstpersönlich einige<br />
Monate vor seinem Tod die erste<br />
Pilgerreise nach Mekka (Hadsch) anführt,<br />
spricht er sich mit Nachdruck für<br />
die Gleichheit aller, ob reich oder arm,<br />
Araber oder nicht, vor Gott aus, was<br />
für die weitgehende Ablehnung des<br />
Rassismus im Islam prägend wird.<br />
UNTER DEM GRÜNEN BANNER<br />
DES HANDELS<br />
Hodgson betont, das die Gemeinschaft<br />
der Gläubigen – die die Offenbarung<br />
akzeptieren – sich unterdessen<br />
im Kreis der Umma (von Umm, Mutter)<br />
durch Bande verbunden haben, die<br />
die Stammesgrenzen überschreiten. In<br />
Medina bemüht sich Mohammed darum,<br />
dieser Gemeinschaft ihre eigenen<br />
Regeln zu geben und sie insbesondere<br />
durch Steuern mit finanziellen Mitteln<br />
auszustatten, womit er die Grundlagen<br />
für eine neue Gesellschaftsordnung<br />
legt.<br />
Er vermittelt in Konflikten zwischen<br />
heidnischen Sippen und genießt<br />
anfangs ein gewisses Wohlwollen der<br />
mächtigen jüdischen Stämme, von denen<br />
er einzelne Rituale übernimmt,<br />
wie das nach Jerusalem gerichtete Mittagsgebet<br />
und das Kippur-Fasten. Allah<br />
erlaubt zudem, von der Nahrung<br />
der Anhänger der Buchreligionen zu<br />
essen und ihre Frauen zu heiraten. In<br />
dieser Zeit baut Mohammed seinen<br />
politischen Einfluss aus und sichert<br />
INPREKORR 468/469 45
GESCHICHTE<br />
die Unabhängigkeit seiner Anhänger<br />
durch eine Reihe von „Überfällen“ auf<br />
Karawanen aus Mekka (Privatkriege<br />
waren dam<strong>als</strong> eine durchaus zulässige<br />
Gepflogenheit).<br />
<strong>Die</strong> GegnerInnen der Beduinen-<br />
Stämme sind wenig zahlreich und<br />
schließen sich mit der Zeit an oder<br />
werden ausgelöscht. Das gilt für die<br />
Dichterin Asma bint Marwan, die im<br />
Schlaf ermordet wird. Denn hatte sie<br />
nicht erklärt: „Ihr Gefickten der Malik<br />
und der Nabit [Medineser Sippen<br />
und Stämme] (…). Ihr gehorcht einem<br />
Ausländer (…). Gibt es denn keinen<br />
Mann von Ehre (…), der (…) den<br />
Hoffnungen der Gimpelträger ein Ende<br />
setzt?“ 8<br />
8 Das Leben Mohammeds wird in den<br />
Überlieferungen (Hadith) geschildert, deren<br />
älteste vermutlich mindestens 120 Jahre<br />
nach den Ereignissen entstanden ist. Sie<br />
wurden durch die großen muslimischen<br />
Rechtsgelehrten für rechtsgültig erklärt. <strong>Die</strong>se<br />
bestätigten ihre Glaubwürdigkeit, indem<br />
<strong>Die</strong> politischen Ansprüche und der<br />
ideologische Zusammenhalt der Juden<br />
sind dagegen bedrohlicher. Sie begegnen<br />
den religiösen Ideen Mohammeds<br />
mit Arroganz, während dieser sie<br />
mit dem Verweis auf die uralten Wurzeln<br />
des Islam herausfordert: Sind die<br />
Araber nicht Nachfahren von Ismâ‘il,<br />
dem Sohn Abrahams (Ibrâhîm), dem<br />
ursprünglichen Gründer der Buchreligionen?<br />
Ebenso bricht er mit ihnen<br />
durch die Einführung des Fastens während<br />
des Ramadan und die Ablehnung<br />
gewisser Nahrungsvorschriften (während<br />
er den mit heidnischen Kulten assoziierten<br />
Wein verpönt) und indem er<br />
von den Gläubigen fordert, nach Mekka<br />
gerichtet zu beten. Schließlich setzt<br />
sie die Belegkette untersuchten, auf denen<br />
sie beruhen, die machmal nicht frei ist von<br />
Widersprüchen, weshalb sie hinzufügen: „Und<br />
Allah ist der Allweise.“ Mehr dazu, siehe Ibn<br />
Warraq (Hg.): The Quest for the Historical<br />
Mohammed, Amherst, New York 2000.<br />
er sich mittels einer Reihe von Vertreibungen,<br />
Enteignungen und Massakern<br />
gegen sie durch, darunter jenes an den<br />
Banu Kuraischa im Jahr 627, bei dem<br />
mehrere Hundert Menschen getötet<br />
werden. Er distanziert sich auch von<br />
den ChristInnen, indem er Jesus zwar<br />
<strong>als</strong> Propheten, der auch Wunder wirken<br />
konnte, anerkennt, aber eben dennoch<br />
nur <strong>als</strong> Menschen.<br />
Als Herrscherin über Medina und<br />
die stark frequentierten Handelswege<br />
im Norden des Hedschas, aus denen<br />
sie ihre wachsenden Ressourcen bezieht,<br />
stellt die Partei Mohammeds die<br />
reichen Kaufleute Mekkas, die ihn mit<br />
Waffen nicht besiegen können, vor ein<br />
unlösbares Problem. Denn der junge,<br />
im Entstehen begriffene Staat, der seinen<br />
starken Zusammenhalt der muslimischen<br />
Religion verdankt, wird von<br />
einem außergewöhnlichen Mann geleitet,<br />
der langfristige Ziele mit einem<br />
Sinn für das momentan Machba-<br />
Handel und Religion im Zeichen<br />
des individuellen Heils<br />
„Solange der Mensch sozusagen organisch<br />
mit seiner Sippe, seinem Stamm,<br />
seinem Dorf, seiner Stadt verbunden ist,<br />
solange er in einer streng hierarchischen<br />
Gesellschaft nur ein austauschbares, an<br />
den ihm vom Schicksal für eine gleichbleibende<br />
Aufgabe zugewiesenen Platz<br />
gebundenes Element ist, wird ihm eine<br />
Vorstellung von jenseitigem Leben aufgezwungen,<br />
die dem diesseitigen ähnlich<br />
oder gleich ist. Auch bestimmen<br />
weiterhin die sozialen Einheiten dieser<br />
Welt die bleichen Schatten, die ein<br />
herabgesetztes Leben führen. In diesen<br />
Gefilden jenseits der Todesschwelle<br />
werden die Schatten der Bediensteten<br />
weiter die Gespenster der Herren pflegen,<br />
die Fantome der Bauern werden<br />
das Land für sie beackern und die Handwerker<br />
im Reich des Todes für ihre Bequemlichkeit<br />
sorgen. Verdienst und Verschulden<br />
auf dieser Erde ändern daran<br />
nicht viel (…)<br />
Doch <strong>als</strong> die Zeiten des intensiven<br />
internationalen Handels kamen, die die<br />
Völker, die Menschen und die Ideen<br />
durcheinanderrührten, <strong>als</strong> sich Gesellschaften<br />
etablierten, wo das Geld zum<br />
Maß aller Dinge wurde, wo die monetäre<br />
Wirtschaft die Grenzen der ethnischen<br />
Gruppen aufbrach, wo es jeder<br />
inidivudell zu Reichtum bringen konnte,<br />
wo der Wert des Einzelnen in dieser<br />
Welt vom Platz abhing, den er sich darin<br />
durch seinen eigenen Kampf errang, begann<br />
man für jeden ein Schicksal zu erhoffen,<br />
das ihm selbst angemessen wäre.<br />
Von da an erhoben sich Propheten,<br />
die individuell (…) [den Reichen] eine<br />
Bestrafung zuerst in dieser und später<br />
in der anderen Welt versprachen. Von<br />
da an entstanden Gesellschaften, Gemeinschaften,<br />
die ihre Mitglieder lehrten,<br />
wie man im Jenseits einen anderen<br />
Zustand erreichen, sich individuell retten<br />
könne.“<br />
(Maxime Rodinson, Mohammed 1975)<br />
Wann und wie wurde der Koran<br />
verfasst?<br />
Heutige WissenschaftlerInnen sind sich<br />
ausgesprochen uneinig über die konkreten<br />
Entstehungsbedingungen und<br />
die wahrscheinliche Zeit der definitiven<br />
Niederschrift des Korans. Wurde er im<br />
Wesentlichen zu Lebzeiten Mohammeds<br />
verfasst, kurz nach seinem Tod<br />
oder vielleicht 200 Jahre später, lange<br />
nach der arabischen Eroberung?<br />
Maxime Rodinson meint: „<strong>Die</strong><br />
Wortgruppen, die Mohammed <strong>als</strong> von<br />
Allah eingegeben rezitierte, bildeten sogenannte<br />
‹Rezitationen›, auf Arabisch<br />
Koran. Sie wurden zu Mohammeds<br />
Lebzeiten auf verstreuten Dokumenten,<br />
Lederstücken, Kamelknochenplatten,<br />
Tonscherben, Palmstängeln etc. notiert.<br />
Ebenfalls zu seinen Lebzeiten begann<br />
man damit, diese Fragmente zu Gruppen<br />
zusammenzufassen und daraus Suren<br />
oder Kapitel zu machen. (…) Es entstand<br />
ein Buch (Kitab) wie jenes der Juden<br />
und der Christen. (…) <strong>Die</strong> gesamten<br />
Offenbarungen flossen damit in die<br />
Form von Einheiten, in denen sich eine<br />
gewisse Ordnung, ein gewisser Plan<br />
erkennen ließ (…). <strong>Die</strong>se Arbeit erfolgte<br />
gewiss zumindest unter Mohammeds<br />
Aufsicht, sofern er daran nicht selbst<br />
mitarbeitete. „ (Mohammed 1975)<br />
John Wansbrough sieht in der Neuerfassung<br />
des Koran einen langen Prozess,<br />
geprägt von zahlreichen Konfrontationen<br />
mit dem Judentum und dem Christentum,<br />
dessen definitive Version auf<br />
die Zeit nach 800 datiert (Quranic Studies,<br />
Oxford, 1977; The Sectarian Milieu:<br />
Content and Composition of Islamic<br />
Salvation History, Oxford, 1978.). Patricia<br />
Crone (1987) ging übrigens so weit,<br />
infrage zu stellen, dass Mohammed und<br />
die Ursprünge des Islam in Mekka anzusiedeln<br />
seien (vgl. Fußnote 1).<br />
Weitere Informationen, vgl.: Encyclopédie de<br />
l’Islam, 2. Aufl. 12 Bde., Leiden, Brill, 1960–<br />
2005.<br />
Ein Islam der Armen?<br />
„Der Koran (…) überlieferte den Generationen<br />
die Botschaft eines unterdrück-<br />
46 INPREKORR 468/469
GESCHICHTE<br />
re zu verbinden weiß. Zudem holt er<br />
sich umsichtigen Rat, namentlich bei<br />
seinen beiden Schwiegervätern und<br />
Nachfolgern, Abu Bekr und Omar, denen<br />
zum Teil sein Cousin Ali, der mit<br />
seiner Tochter Fâtima verheiratet ist,<br />
widerspricht.<br />
628 kündigt Mohammed an, dass<br />
er sich zur spirituellen Eroberung<br />
Mekkas aufmachen möchte und setzt<br />
sich an die Spitze eines friedlichen<br />
Marsches. Das Unternehmen ist trotz<br />
der demütigenden Bedingungen, die er<br />
akzeptieren muss, von Erfolg gekrönt.<br />
Ab 629 werden die Muslime <strong>als</strong> Pilger<br />
in der Stadt geduldet. 630 bereitet Mohammed<br />
jedoch einen großen militärischen<br />
Feldzug vor, um die letzten GegenerInnen<br />
einzuschüchtern. <strong>Die</strong> uneinige<br />
Aristokratie Mekkas weicht der<br />
Kraftprobe aus und unterwirft sich, um<br />
in der Folge zu konvertieren. Medina<br />
wird damit zur Hauptstadt des vereinten<br />
Arabiens rund um seinen Propheten,<br />
mit den großen kuraischitischen<br />
Familien an der Spitze. Auf dem Höhepunkt<br />
seiner Macht stirbt der Gesandte<br />
Gottes am 6. Juni 632.<br />
Gleichzeitig kann sich das ausgeblutete<br />
Byzanz wieder gegenüber dem<br />
endlich geschlagenen Persien durchsetzen.<br />
<strong>Die</strong> Armeen der ersten Kalifen<br />
(Erben des Propheten), die die islamisierten<br />
Araber nicht mehr erpressen<br />
können, ergreifen die Gelegenheit,<br />
um sich auf die Eroberung der Welt zu<br />
machen, die sie kennen. Wie Rodinson<br />
festhält, rücken sie blitzartig vor.<br />
„Ein Jahrhundert nach dem Datum, <strong>als</strong><br />
der unbekannte Kameltreiber Mohammed<br />
damit begonnen hatte, ein paar arme<br />
Bewohner Mekkas in seinem Haus<br />
um sich zu scharen, herrschten seine<br />
Nachfolger von der Loire bis über den<br />
Indus hinaus, von Poitiers bis Samarkand.“<br />
Und der Philosoph Ernst Bloch<br />
schreibt: „<strong>Die</strong> grüne Fahne wehte bald<br />
über einem Handels-, Kriegs- und<br />
Glaubenssturm ganz homogen“, die<br />
den Mittleren Osten und den Mittelmeerraum<br />
erschütterten. Der Islam –<br />
die Ideologie der damaligen Moderne<br />
– „beherrschte das Handels-Empire,<br />
das zwischen dem Untergang Westroms<br />
und dem Aufstieg Venedigs, fast<br />
Englands liegt“. 9<br />
Jean Batou, Historiker, ist Mitglied der Leitung<br />
von Solidarités (Antikapialisitische, feministische,<br />
ökologische Bewegung für den<br />
Sozialismus des 21. Jahrhunderts) in der<br />
Schweiz und Herausgeber der zweiwöchentlich<br />
erscheinenden Zeitschrift solidaritéS. Der<br />
vorliegende Artikel ist in der Beilage „Cahiers<br />
émancipationS“ der Zeitschrift „solidaritéS“<br />
Nr. 160 vom 17. Dezember 2009.<br />
Aus dem Französischen: Tigrib<br />
9 Aus dem Persischen von Ibn Hisham, zitiert<br />
nach Rodinson)<br />
ten Mannes, der sich eines Tages gegen<br />
die Ungerechtigkeit und Unterdrückung<br />
empört hatte. Er führte in seinem chaotischen<br />
Text Schmähungen und Herausforderungen<br />
an die Mächtigen mit<br />
sich und Aufrufe zur Billigkeit und zur<br />
Gleichheit der Menschen. Eines Tages<br />
fanden sich Leute, um sich dieser Worte<br />
zu bemächtigen und sich Waffen daraus<br />
zu schmieden. (…)<br />
„<strong>Die</strong> (…) Araber eingeborener Abstammung<br />
hatten Menschen <strong>als</strong> ihresgleichen<br />
anerkennen müssen, die sie<br />
einmal unterworfen hatten und die sich<br />
jetzt völlig mit ihnen identifizierten.<br />
<strong>Die</strong> revolutionäre Bewegung, die diese<br />
Gleichheit durchsetzte, siegte im Namen<br />
eben dieser Werte, die ihr zum Sieg<br />
verholfen hatten. (…) Im Lauf der Jahrhunderte<br />
sollte noch gar manche andere<br />
Bewegung, die dem Islam Umwälzungen<br />
brachte, dasselbe tun. (…) Irgendwo<br />
an der Quelle dieser geglückten<br />
oder mißglückten Gärungen, dieser<br />
mehr oder weniger gerechtfertigten,<br />
mehr oder weniger unangemessenen<br />
Auffassungen befand sich ein Mann, der<br />
ein unbekannter Kameltreiber aus einer<br />
bescheidenen Famlie der Koraisch war.<br />
(…)<br />
Aber die Ideen besitzen ihr eigenes<br />
Leben, und dieses Leben ist revolutionär.<br />
Sobald sie einmal im Gedächtnis<br />
der Menschen verankert sind, auf den<br />
Papyrus geschrieben, das Pergament<br />
oder sogar – wie im Fall des Korans –<br />
auf den Schulterblättern von Kamelen,<br />
setzen sie ihr Wirken fort, und zwar zum<br />
großen Ärgernis der Staatsmänner und<br />
der Männer der Kirche, die sie benutzt<br />
und in Dämme gefasst, die eine Kasuistik<br />
ausgearbeitet haben, um ihre für die<br />
ungestörte Ordnung einer wohlgeregelten<br />
Gesellschaft gefürchteten Auswirkungen<br />
auszumerzen.“<br />
(Maxime Rodinson, Mohammed 1975)<br />
Der Koran und die Frauen<br />
„<strong>Die</strong> Männer stehen den Frauen in Verantwortung<br />
vor“ und haben das Recht,<br />
sie zu ermahnen und auch zu schlagen<br />
(Koran 4, 34). <strong>Die</strong> Polygynie ist beschränkt<br />
auf vier Frauen (außer für den<br />
Propheten), sofern der Ehemann in der<br />
Lage ist, sie gleichberechtigt zu behandeln.<br />
Sie gilt selbstverständlich nur für<br />
eine Minderheit von ausreichend wohlhabenden<br />
Gläubigen.<br />
<strong>Die</strong> Frauen nehmen in der Frühzeit<br />
des Islams eine aktive Rolle ein. Sie<br />
hinterfragen, beraten und kämpfen. Aïsha,<br />
eine der Frauen Mohammeds, erklärt<br />
sich verwundert darüber, dass Allah<br />
nur zu den Männern spricht, worauf<br />
die Offenbarungen so geändert werden,<br />
dass sie sich fortan an beide Geschlechter<br />
wenden. Generell erhalten die Frauen<br />
aber nur das halbe Erbe, weil sie keine<br />
materielle Verantwortung gegenüber<br />
ihrer Familie tragen (Koran 4, 11).<br />
Den Frauen wird ein zehnmal stärkeres<br />
sexuelles Begehren zugeschrieben<br />
<strong>als</strong> den Männern. <strong>Die</strong>ses wird nicht<br />
missbilligt – im Himmel soll jeder Orgasmus<br />
mindestens 24 Jahre dauern –,<br />
muss aber strikt im Rahmen der patriarchalen<br />
Heirat erfolgen. <strong>Die</strong> Beschneidung<br />
kommt im Koran nicht vor.<br />
Was das Tragen des Kopftuchs betrifft,<br />
empfiehlt ein Koranvers den Frauen,<br />
den Schal um ihre Kleidungsausschnitte<br />
zu schlagen (24, 31); ein anderer<br />
fordert sie auf, ihre Übergewänder<br />
reichlich über sich zu ziehen (33, 59).<br />
Ebenso ist vorgeschrieben, sich hinter<br />
einem Vorhang an die Frauen des Propheten<br />
zu richten (33, 53). <strong>Die</strong> Tradition<br />
sieht vor, dass der Körper der Frauen<br />
verborgen bleibt, mit Ausnahme des Gesichts<br />
und der Hände (dabei handelt es<br />
sich allerdings um einen Hadith, dessen<br />
Überlieferungskette schlecht belegt ist).<br />
Ehebruch muss von vier übereinstimmenden<br />
Zeugen belegt werden, um<br />
bestraft zu werden (4, 15). <strong>Die</strong> Steinigung<br />
ist im Koran nicht erwähnt, kommt<br />
aber im Alten Testament vor (Deuteronomium,<br />
22, 23–24). Manche Hadîthen<br />
nehmen darauf Bezug, doch ihre Glaubwürdigkeit<br />
ist umstritten.<br />
Quelle der Koranzitate: http://qibla.appspot.<br />
com/<br />
INPREKORR 468/469 47
REGISTER 2010<br />
Register nach Ländern<br />
Monat<br />
Titel AutorIn Heft Seite<br />
Afghanistan<br />
Obamas Eskalation der Kriege<br />
und die Misere Zentralasiens<br />
Afrika<br />
Afrika nach fünfzig Jahren „Unabhängigkeit“<br />
Brasilien<br />
Wahlen in Brasilien<br />
Conclat: Ein offensichtlicher<br />
Rückschritt<br />
Chile<br />
Neoliberale Schockstrategie und<br />
Rückkehr der Chicago-Boys<br />
China<br />
Nationalistische Antwort auf die<br />
Herausforderung der Globalisierung<br />
Arbeiterfrühling im Herzen der<br />
„Werkstatt der Welt“<br />
Andreas Kloke 462 38 5<br />
Jean Nanga 466 39 9<br />
Plínio de Arruda 466 16 9<br />
Sampaio<br />
Ernesto Herrera 466 19 9<br />
Franck Gaudichaud<br />
466 34 9<br />
Au Loong-Yu 458 37 1<br />
Danielle Sabaï 468 37 11<br />
Europa<br />
In Europa tut sich was Esther Vivas 462 47 5<br />
Austerität für ganz Europa Martine Orange 464 17 7<br />
Erklärung zur Krise in Europa 464 56 7<br />
Das Kapital geht zum Angriff über Jan Malewski 466 3 9<br />
Frankreich<br />
<strong>Die</strong> Situation in Frankreich nach<br />
den Regionalwahlen vom März<br />
2010<br />
<strong>Die</strong> Bewegung ist noch lange nicht<br />
zu Ende<br />
Griechenland<br />
<strong>Die</strong> Werktätigen gegen das sog.<br />
Stabilitätsprogramm<br />
Sandra Demarcq 462 3 5<br />
Sandra Demarcq 468 3 11<br />
Tassos Anastassiadis,<br />
Andreas<br />
Sartzekis<br />
462 5 5<br />
Pascal Franchet 464 4 7<br />
<strong>Die</strong> Bedeutung der griechischen<br />
Krise<br />
Griechenland im Schraubstock der Nikos Tamvaklis 464 8 7<br />
Rezession und der Zinswucherei<br />
<strong>Die</strong> griechische Schuldenkrise Charles-André 464 13 7<br />
Udry<br />
Wie heiß wird der Herbst?“ Tassos Anastassiadis,<br />
468 17 11<br />
Andreas<br />
Sartzekis<br />
Großbritannien<br />
Widerstand gegen die Regierung<br />
der Reichen für die Reichen<br />
Socialist Resistance<br />
464 19 7<br />
Haiti<br />
Solidaritätsappell Batay Ouvriye 460 56 3<br />
International<br />
<strong>Die</strong> internationale Lage François Sabado 458 5 1<br />
<strong>Die</strong> Weltlage steht unter dem<br />
Zeichen der Krise<br />
Laurent Carasso 462 12 5<br />
Iran<br />
Wohin treibt die islamische Republik?<br />
Internationale Solidarität mit den<br />
Völkern Irans<br />
Houshang Sepehr 458 23 1<br />
Resolution des 16.<br />
Weltkongresses<br />
der IV. Internationale<br />
462 35 5<br />
Israel<br />
Ja zu Boykott, Desinvestition und<br />
Sanktionen (BDS) gegen Israel.<br />
Eine Antwort auf Uri Avnery<br />
Zur israelischen Offensive gegen<br />
Gaza und zur Solidarität mit dem<br />
Kampf des palästinensischen<br />
Volks<br />
Nach dem Angriff auf die Gaza-<br />
Flottille dürfen die Verbrechen<br />
Israels nicht länger straflos<br />
hingenommen werden<br />
Michael Warschawski<br />
Resolution des 16.<br />
Weltkongresses<br />
der IV. Internationale<br />
Büro der IV. Internationale<br />
458 21 1<br />
462 33 5<br />
464 3 7<br />
Italien<br />
Der Aufstand der Arbeitsimmigranten<br />
Charles-André 460 3 3<br />
in Rosarno<br />
Udry<br />
Das System Berlusconi in der Krise<br />
Salvatore Cannavó 468 5 11<br />
und die Linke orientierungslos<br />
Von der PCI zur Demokratischen<br />
Partei<br />
Lidia Cirillo 468 7 11<br />
Kasachstan<br />
Vorbildlicher Streik der Ölarbeiter Jan Malewski 464 38 7<br />
Kirgisistan<br />
Der Volksaufstand eröffnet eine<br />
neue geschichtliche Periode<br />
Jan Malewski 464 33 7<br />
Osteuropa<br />
Osteuropa in der Systemkrise Catherine Samary 468 20 11<br />
Pakistan<br />
Pakistans Frauen leiden am meisten<br />
Bushra Khaliq 458 34 1<br />
unter dem Klimawandel<br />
Obamas Eskalation der Kriege Andreas Kloke 462 38 5<br />
und die Misere Zentralasiens<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung der Arbeiterpartei Farooq Tariq 464 40 7<br />
Pakistans (LPP)<br />
Ein historisch gescheiterter Staat Pierre Rousset 464 45 7<br />
Spendet für die Flutopfer in<br />
Pakistan<br />
466 52 9<br />
Palästina<br />
Ja zu Boykott, Desinvestition und<br />
Sanktionen (BDS) gegen Israel.<br />
Eine Antwort auf Uri Avnery<br />
Zur israelischen Offensive gegen<br />
Gaza und zur Solidarität mit dem<br />
Kampf des palästinensischen<br />
Volks<br />
Nach dem Angriff auf die Gaza-<br />
Flottille dürfen die Verbrechen<br />
Israels nicht länger straflos<br />
hingenommen werden<br />
Michael Warschawski<br />
Resolution des 16.<br />
Weltkongresses<br />
der IV. Internationale<br />
Büro der IV. Internationale<br />
458 21 1<br />
462 33 5<br />
464 3 7<br />
Portugal<br />
<strong>Die</strong> Linke angesichts der Krise Bruno Maia 466 13 9<br />
Russland<br />
„Tag des Zorns“ Carine Clément 462 36 5<br />
Spanien<br />
Der Beginn einer neuen Etappe Lluís Rabell 468 11 11<br />
Der Streik vom 29. September: <strong>Die</strong> Miguel Romero 468 15 11<br />
soziale Frage kehrt zurück<br />
Sri Lanka<br />
Wahlfälschung bei den Präsidentschaftswahlen<br />
Zur Lage in Sri Lanka Resolution des 16.<br />
Weltkongresses<br />
der IV. Internationale<br />
462 42 5<br />
462 43 5<br />
48 INPREKORR 468/469
REGISTER 2010<br />
Thailand<br />
Weder Kriegsrecht noch Ausnahmezustand<br />
noch Staatsstreich!<br />
Für Demokratie und soziale<br />
Gerechtigkeit!<br />
<strong>Die</strong> alten Eliten können Wahlen<br />
nicht mehr gewinnen<br />
462 34 5<br />
Danielle Sabaï 464 46 7<br />
Türkei<br />
Solidarität mit Doan Tarkan 464 32 7<br />
Im Labyrinth der bürgerlichen<br />
Politik<br />
Ümit Çırak 468 31 11<br />
Uruguay<br />
Der entfesselte Barbar Ernesto Herrera 462 44 5<br />
Register nach Themen (Auswahl)<br />
Titel AutorIn<br />
Monat<br />
Heft Seite<br />
Buchbesprechung<br />
Klaus Engert: Ökosozialismus –<br />
das geht!<br />
Michael Löwy 464 30 7<br />
Debatte<br />
Ihre Krise und unser Widerstand Wolfgang Alles 464 25 7<br />
Frauen<br />
<strong>Die</strong> Frauen und die Zivilisationskrise<br />
IIRE-Frauen-Seminar<br />
458 14 1<br />
Geschichte<br />
<strong>Die</strong> grüne Fahne Mohammeds und Jean Batou 468 43 11<br />
die Ausbreitung des Welthandels<br />
Gesundheit<br />
Asbest – die tödliche „Wunderfaser“<br />
– Millionenfacher Mord aus<br />
Profitgründen<br />
Nachruf<br />
André Fichaut (1928–2009)<br />
Bis zum letzten Atemzug ein<br />
revolutionärer Kämpfer: Daniel<br />
Bensaïd (1946–2010)<br />
Hugo González Moscoso<br />
(1922–2010)<br />
Luis Vitale (1927–2010) – Ein<br />
revolutionärer Historiker aus<br />
Lateinamerika<br />
Heinrich Neuhaus 462 28 5<br />
Jean-Michel 458 50 1<br />
Krivine<br />
Gilbert Achcar 460 48 3<br />
Michael Löwy 464 53 7<br />
Franck Gaudichaud<br />
468 40 11<br />
Wilebaldo Solano (1917–2010) Jaime Pastor 468 28 11<br />
Ökologie<br />
COP 15: Scheitern des Gipfels,<br />
Sieg der Basis<br />
Systemveränderung – statt Klimawandel!<br />
Daniel Tanuro 458 3 1<br />
Erklärung der TeilnehmerInnen<br />
des<br />
Klimaforum09 in<br />
Kopenhagen<br />
458 52 1<br />
Lars Henriksson 460 4 3<br />
Gestaltet die kränkelnde Autoindustrie<br />
um!<br />
Klimamobilisierung und antikapitalistische<br />
Daniel Tanuro 462 19 5<br />
Strategie<br />
Antikapitalismus und Klimagerechtigkeit<br />
Esther Vivas 462 31 5<br />
Cochabamba: Einige kritische Bemerkungen<br />
Sandra Invernizzi, 464 22 7<br />
zur Schlusserklärung Daniel Tanuro<br />
Klaus Engert: Ökosozialismus – Michael Löwy 464 30 7<br />
das geht!<br />
Umweltzerstörung und Gesellschaftsform<br />
Bernhard Brosius 466 21 9<br />
– oder: Brauchen wir<br />
einen Ökosozialismus?<br />
Ökonomie<br />
EU: <strong>Die</strong> weltweite Krise und die Özlem Onaran 460 7 3<br />
Wirtschaftspolitik: Kann die<br />
Politik den Kapitalismus vor sich<br />
selbst retten?<br />
Der freie Fall ist vorbei, aber die Joel Geier 460 19 3<br />
Krise geht weiter<br />
<strong>Die</strong> Asienkrise: Krise eines exportgestützten<br />
Jean Sanuk 460 23 3<br />
Wachstums oder der<br />
Verdrängung von Arbeit?<br />
<strong>Die</strong> Auswirkungen Krise auf Lateinamerika<br />
Claudio Katz 460 33 3<br />
Nicht aller Marxismus ist Dogmatismus<br />
Chris Harman 460 39 3<br />
– eine Erwiderung an<br />
Michel Husson<br />
Lange Wellen – die letzte? Thadeus Pato 460 46 3<br />
Privatisierung der Post – die Beschäftigten<br />
Lot van Baaren, 462 50 5<br />
zahlen die Zeche Paul Benschop<br />
<strong>Die</strong> Automobilindustrie im Umbrucsillier<br />
Jean-Claude Ves-<br />
466 7 9<br />
Cancún – <strong>Die</strong> Via Campesina ruft<br />
die sozialen Bewegungen und<br />
alle Leute auf, überall auf der<br />
Welt zu mobilisieren! Organisisert<br />
Tausende Cancúns<br />
468 52 11<br />
Theorie<br />
<strong>Die</strong> Krise jenseits der Krise Daniel Bensaïd 460 49 3<br />
Benjamins Thesen – Zu Band 19<br />
der Kritischen Gesamtausgabe<br />
Helmut Dahmer 468 25 11<br />
Vierte Internationale<br />
<strong>Die</strong> Internationale – wieder eine<br />
Perspektive<br />
Resolution zu Angriffen auf Transgendered/Intersexed<br />
Auf nach Perugia! Bericht vom<br />
Amsterdamer Vorbereitungstreffen<br />
zum Sommercamp 2010<br />
<strong>Die</strong> IV. Internationale: Einige<br />
Anmerkungen zu einer ganz<br />
besonderen Geschichte<br />
die Internationale<br />
Salvatore Cannavò 462 9 5<br />
Resolution des 16.<br />
Weltkongresses<br />
der IV. Internationale<br />
462 43 5<br />
Philipp Xanthos 462 52 5<br />
Wolfgang Alles 462 23 5<br />
Titel AutorIn<br />
Monat<br />
Heft Seite<br />
<strong>Die</strong> IV. Internationale: Einige Wolfgang Alles 462 23 5<br />
Anmerkungen zu einer ganz<br />
besonderen Geschichte<br />
Asbest – die tödliche „Wunderfaser“<br />
Heinrich Neuhaus 462 28 5<br />
– Millionenfacher Mord aus<br />
Profitgründen<br />
Ihre Krise und unser Widerstand Wolfgang Alles 464 25 7<br />
Klaus Engert: Ökosozialismus – Michael Löwy 464 30 7<br />
das geht!<br />
Solidarität mit Doan Tarkan 464 32 7<br />
Umweltzerstörung und Gesellschaftsform<br />
Bernhard Brosius 466 21 9<br />
– oder: Brauchen wir<br />
einen Ökosozialismus?<br />
Benjamins Thesen – Zu Band 19 Helmut Dahmer 468 25 11<br />
der Kritischen Gesamtausgabe<br />
Wilebaldo Solano (1917–2010) Jaime Pastor 468 28 11<br />
INPREKORR 468/469 49
ÖKOLOGIE<br />
Fortsetzung von Seite 52<br />
und ohne <strong>als</strong> Ausrede dazu zu dienen,<br />
dass die anderen Länder und Vereinigungen<br />
weiterhin verschmutzen und<br />
Baummonokulturen anpflanzen. <strong>Die</strong><br />
Land- und kulturellen Rechte der indigenen<br />
Völker und der Bauern müssen<br />
in jeglichem Klimaabkommen<br />
explizit zuerkannt werden.<br />
Das Geoengineering ablehnen:<br />
<strong>Die</strong> großformatigen Vorschläge, das<br />
Klima gezielt zu beeinflussen, wie<br />
Biokohle (biochar), genetisch modifizierte<br />
Pflanzen, um die Reflektivität<br />
und die Resistenz gegenüber<br />
Trockenheit, Hitze und Salz zu erhöhen,<br />
Düngung des Meeres oder<br />
die massive Erzeugung von Wolken<br />
schaffen nur neue unbeherrschbare<br />
Probleme, sie stellen keine Lösungen<br />
dar. Das Geoengineering ist nur ein<br />
weiteres Beispiel, wie die transnationalen<br />
Konzerne dazu bereit sind,<br />
mit der Zukunft des Planeten und der<br />
Menschheit zu spielen, um neue Einnahmequellen<br />
zu schaffen.<br />
Alle Modelle des Kohlenstoffhandels<br />
und die Mechanismen zur<br />
Neu bei ISP<br />
Eric Toussaint<br />
Neuer ISP Verlag GmbH<br />
Belfortstr. 7, D -76133 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 3 11 83<br />
neuer.isp.verlag@t-online.de<br />
www.neuerispverlag.de<br />
<strong>Die</strong> Bank des Südens<br />
und die<br />
Weltwirtschafts krise<br />
Bolivien, Ecuador, Venezuela und<br />
die Alternativen zum neoliberalen<br />
Kapitalismus<br />
208 Seiten, 19,80 Euro<br />
ISBN 978-3-89 900-132-7<br />
sauberen Entwicklung (MDL –<br />
mecanismos de desarrollo limpio)<br />
ablehnen: Der Kohlenstoffhandel<br />
hat sich <strong>als</strong> extrem lukrativ erwiesen<br />
im Sinne von Gewinngenerierung für<br />
Anleger, dabei aber rundum versagt<br />
hinsichtlich der Reduktion der Treibhausgase.<br />
Im Kohlenstoffhandel fällt<br />
der Kohlenstoffpreis rapide, was die<br />
Verschmutzung sogar noch verstärkt.<br />
<strong>Die</strong> Kohlenstoffemissionen müssen<br />
an der Quelle/Wurzel weniger werden<br />
anstatt dass man erlaubt, dass<br />
man dafür zahlt, das Recht zu verschmutzen<br />
zu behalten.<br />
Ablehnung jeglicher Teilnahme<br />
der Weltbank an der Verwaltung der<br />
Fonds und Politiken, die mit dem Klimawandel<br />
zu tun haben.<br />
Wir brauchen Abermillionen<br />
von bäuerlichen Gemeinden und<br />
indigenen Territorien, um die<br />
Menschheit zu ernähren und den<br />
Planeten abzukühlen.<br />
Wissenschaftliche Untersuchungen<br />
zeigen, dass wir bäuerlichen und<br />
indigenen Völker die globalen Emissionen<br />
um 75% reduzieren können<br />
durch Erhöhen der Biodiversität, Zurückgewinnung<br />
der organischen Substanz<br />
im Boden, Ersetzen der industriellen<br />
Erzeugung von Fleisch<br />
durch eine diversifizierte Produktion<br />
in kleinem Rahmen, Ausweiten der<br />
lokalen Märkte, Beendigung der Abholzung<br />
und Durchführen einer integrierten<br />
Waldbewirtschaftung.<br />
<strong>Die</strong> bäuerliche Landwirtschaft<br />
trägt nicht nur positiv zum Kohlenstoffgleichgewicht<br />
des Planeten bei,<br />
sondern schafft auch 2,8 Millionen<br />
Arbeitsplätze für Männer und Frauen<br />
in der <strong>ganze</strong>n Welt, und es ist die beste<br />
Art des Kampfes gegen den Hunger,<br />
die Unterernährung und die aktuelle<br />
Lebensmittelkrise.<br />
Das volle Recht auf den Boden<br />
und die Rückgewinnung von Land,<br />
die Ernährungssouveränität, der Zugang<br />
zu Wasser <strong>als</strong> sozialem Gut und<br />
Menschenrecht, das Recht, Samen<br />
frei zu gebrauchen, vermehren und<br />
tauschen, die Dezentralisierung und<br />
Stärkung der lokalen Märkte sind unabdingbare<br />
Voraussetzungen, damit<br />
wir bäuerlichen und indigenen Völker<br />
weiterhin die Welt ernähren und den<br />
Planeten abkühlen.<br />
Organisiert Tausende von Cancúns!<br />
Zusammen mit verschiedenen Organisationen<br />
werden wir in Cancún,<br />
zeitgleich mit dem COP 16, das Alternative<br />
Globale Forum „Für das<br />
Leben, die Umwelt- und soziale<br />
Gerechtigkeit“ durchführen, das die<br />
Kraft und den Widerstand der bäuerlichen<br />
Völker der Welt vereinigen<br />
wird, die den Planeten bereits jetzt<br />
abkühlen.<br />
Wir appellieren an die sozialen<br />
Bewegungen, die gesellschaftlichen<br />
Organisationen und an die Völker der<br />
<strong>ganze</strong>n Welt, am 7. Dezember 2010<br />
Tausende von Protesten und Aktionen<br />
gegen die f<strong>als</strong>chen Lösungen<br />
und die Lösungen der Märkte zu<br />
organisieren. Wir erklären die dauerhafte<br />
Mobilisierung, bis wir die Weltklimaverhandlungen<br />
in Cancún im<br />
Dezember 2010 zum Platzen bringen.<br />
Bauern und Bäuerinnen, kühlen<br />
wir den Planeten ab!<br />
Globalisieren wir den Kampf!<br />
Globalisieren wir die Hoffnung!<br />
50 INPREKORR 468/469
ANZEIGE<br />
Klaus Engert<br />
Ökosozialismus –<br />
das geht<br />
isp-pocket 68<br />
142 S., € 12,80<br />
2010,<br />
ISBN 978-3-89900-068-9<br />
ABO-<br />
BESTELLUNG<br />
Ich bestelle<br />
☐ Jahresabo (6 Doppelhefte) € 20<br />
☐ Solidarabo (ab € 30) € ....<br />
☐ Sozialabo € 12<br />
☐ Probeabo (3 Doppelhefte) € 10<br />
☐ Auslandsabo € 40<br />
Name, Vorname<br />
Straße, Hausnummer<br />
PLZ, Ort<br />
Datum, Unterschrift<br />
Spätestens seit dem Bericht des Club of Rome Ende der sechziger<br />
Jahre und den Klimavoraussagen von James Hansen Ende der<br />
siebziger Jahre hätte jeder, der das wollte, wissen können, dass ein<br />
grundlegender Wandel in der Umweltpolitik notwendig ist. Geschehen<br />
ist so gut wie nichts. Aber das ist kein Zufall. Für eine kapitalistische<br />
Industriegesellschaft ist Nachhaltigkeit Gift. Das Konkurrenzprinzip,<br />
auf dem diese Gesellschaftsform beruht, hat die zwangsläufige<br />
Konsequenz, dass der belohnt wird, der auf die ökologischen Folgen<br />
seiner Produktion die wenigste Rücksicht nimmt. Zudem beruht die<br />
kapitalistische Produktionsweise auf immer währendem Wachstum.<br />
Und was diese Welt am wenigsten vertragen kann, ist (noch) mehr<br />
quantitatives Wachstum. <strong>Die</strong> hilflosen Versuche der Herrschenden,<br />
den Kapitalismus aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Umweltzerstörung<br />
im Allgemeinen und den Klimawandel im Besonderen aufhalten<br />
zu wollen, sind der Versuch der Quadratur des Kreises: Beides<br />
zusammen ist nicht zu haben.<br />
<strong>Die</strong> Länder des sogenannten „Re<strong>als</strong>ozialismus“ können ebenfalls<br />
kein Vorbild sein. <strong>Die</strong> Umweltzerstörung dort stand der der kapitalistischen<br />
Welt in nichts nach.<br />
Wir brauchen <strong>als</strong>o eine Alternative. Wir nennen diese Alternative<br />
Ökosozialismus. Natürlich ist es nicht möglich, einen detaillierten,<br />
ausgearbeiteten Plan für eine Zukunftsgesellschaft zu entwerfen.<br />
Eine solche Gesellschaft wird sich in einem längeren Prozess herausbilden<br />
und für manche der späteren Lösungen dürfte unsere heutige<br />
Phantasie nicht ausreichen. Aber es ist möglich, die Grundzüge<br />
darzustellen, nach denen ein Gemeinwesen funktionieren muss, das<br />
gleichzeitig die Bedürfnisse der Menschen erfüllt, die natürlichen<br />
Lebensgrundlagen schützt und gleiche Lebens- und überlebensvoraussetzungen<br />
für die Menschheit schafft.<br />
Überweisung an<br />
Neuer Kurs GmbH,<br />
Postbank Frankfurt/M.<br />
(BLZ 500 100 60),<br />
Kontonummerr.: 365 84 604<br />
Zahlung per Bankeinzug<br />
Hiermit erteile ich bis auf Widerruf<br />
die Einzugsermächtigung für mein<br />
Bank-/Postgirokonto<br />
bei<br />
in<br />
Konto-Nr.<br />
BLZ<br />
Datum, Unterschrift<br />
Das Abonnement (außer Geschenkabo)<br />
verlängert sich automatisch um<br />
ein Jahr, wenn es nicht vier Wochen<br />
vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.<br />
Bestellung an:<br />
<strong>Inprekorr</strong>, Hirtenstaller Weg 34,<br />
25761 Büsum<br />
oder per E-Mail an:<br />
vertrieb@inprekorr.de<br />
INPREKORR 468/469 51
Cancún – <strong>Die</strong> Via Campesina ruft die sozialen<br />
Bewegungen und alle Leute auf, überall auf<br />
der Welt zu mobilisieren<br />
Organisiert Tausende von Cancúns!<br />
<strong>Die</strong> sozialen Bewegungen der <strong>ganze</strong>n Welt mobilisieren<br />
zur 16. Vertragsstaatenkonferenz (VSK; Conferencia<br />
de las Partes COP) der Rahmenkonvention der Vereinten<br />
Nationen zum Klimawandel (CMNUCC, Convención<br />
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático),<br />
die vom 29. November bis zum 10. Dezember in<br />
Cancún stattfinden wird<br />
<strong>Die</strong> COP 15 in Kopenhagen zeigte das Unvermögen<br />
des Großteils der Regierungen, die realen Ursachen des<br />
Klimachaos anzugehen, und speziell den Druck der USA,<br />
in antidemokratischer Weise das sogenannte „Abkommen<br />
von Kopenhagen“ abzusegnen, mit dem Ziel, die wenig<br />
verbindlichen Vereinbarungen der Vereinten Nationen von<br />
Kyoto zu verlassen und nur noch auf freiwillige Mechanismen<br />
auf Basis des freien Marktes zu setzen.<br />
<strong>Die</strong> Klimaverhandlungen haben sich in einen großen<br />
Markt verwandelt. <strong>Die</strong> Industrienationen, in der Vergangenheit<br />
verantwortlich für den Großteil der Emissionen<br />
an Treibhausgasen, erfinden alle möglichen Tricks,<br />
um ihre Emissionen nicht zu reduzieren. Zum Beispiel erlaubt<br />
der „Mechanismus für eine saubere Entwicklung“<br />
(MDL - Mecanismo para el Desarrollo Limpio) des Protokolls<br />
von Kyoto den Ländern, weiterhin zu verschmutzen<br />
und wie gewohnt zu konsumieren. Im Gegenzug müssen<br />
sie nur minimale Zahlungen leisten, damit angeblich<br />
die Länder des Südens ihre Emissionen reduzieren. Das,<br />
was tatsächlich passiert, ist, dass die Firmen doppelt verdienen:<br />
am Verschmutzen und am Verkaufen von f<strong>als</strong>chen<br />
Lösungen.<br />
Monsanto versucht uns davon zu überzeugen, dass sein<br />
Roundup Ready Soja geeignet ist <strong>als</strong> Kohlenstoffkredit,<br />
weil es dazu beitragen würde, die Treibhausgase, die den<br />
Planeten aufheizen, zu reduzieren aufgrund der Anreicherung<br />
von organischer Materie im Boden. <strong>Die</strong> Gemeinden,<br />
die in der Nähe von Sojamonokulturen leben, sind ein lebendes<br />
Beispiel für die tödlichen und zerstörerischen Auswirkungen<br />
dieser Monokulturen. <strong>Die</strong> gleichen f<strong>als</strong>chen<br />
Argumente werden benutzt, um Kohlenstoffkredite zu verkaufen<br />
für Waldmonokulturen, den Anbau von Agrotreibstoffen<br />
oder die industrielle Tierproduktion.<br />
Viele Regierungen der Länder des Südens, angelockt<br />
von den möglichen Einnahmen, setzen auf diese f<strong>als</strong>chen<br />
Lösungen und weigern sich, die Maßnahmen umzusetzen,<br />
die dem Klimawandel effektiv entgegenwirken, wie<br />
zum Beispiel Hilfen für die nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft,<br />
Ausrichten der Produktion auf die internen<br />
Märkte oder Entwickeln effektiver Energiesparrichtlinien<br />
für die Industrie, usw.<br />
Wir fordern die Umsetzung der Tausenden von<br />
Lösungen der Völker angesichts der Klimakrise<br />
Es ist jetzt an der Zeit, dass die Rahmenkonvention<br />
der Vereinten Nationen zum Klimawandel (CMNUCC)<br />
auf entschlossene Politiken setzt, um zur Lösung des Klimachaos<br />
beizutragen. <strong>Die</strong> Länder müssen sich klar und<br />
bindend verpflichten, die Emissionen radikal zu reduzieren<br />
und die Art, wie sie produzieren und konsumieren,<br />
vollständig zu ändern.<br />
Der Klimawandel verschärft auch die Krise der<br />
Migration. Dürren, Stürme mit schrecklichen Überschwemmungen,<br />
Wasserverschmutzung und Verschlechterung<br />
des Bodens ebenso wie andere destruktive Einflüsse<br />
des neoliberalen Umweltdesasters führen zur Vertreibung<br />
von Tausenden von Menschen, vor allem Frauen<br />
und ruinierte Bauern, von ihren ländlichen Gemeinden in<br />
die Städte und Richtung Norden, in verzweifelter Suche<br />
nach einer Überlebensmöglichkeit für sich und ihre Familien.<br />
Es wird geschätzt, dass 50 Millionen Leute durch<br />
die Klimaveränderungen gezwungen wurden zu migrieren.<br />
<strong>Die</strong>se „Klimavertriebenen“ verstärken die Reihen<br />
der laut der Internationalen Organisation für Migration<br />
(IOM) mehr <strong>als</strong> 200 Millionen Menschen, die heute<br />
die schlimmste Krise der Migration darstellen, der die<br />
Menschheit jem<strong>als</strong> gegenüberstand.<br />
<strong>Die</strong> Lösungen existieren. Mehr <strong>als</strong> 35 000 Personen<br />
versammelten sich im April in Cochabamba, Bolivien,<br />
zur Weltkonferenz der Völker über den Klimawandel und<br />
die Rechte der Mutter Erde, um neue Visionen und Vorschläge<br />
zur Rettung des Planeten zu verbreiten. Das sind<br />
die Tausende von Lösungen, die die Völker hervorbringen,<br />
die sich der Klimakrise wirkungsvoll entgegenstellen.<br />
Wir fordern von der Rahmenkonvention der Vereinten<br />
Nationen zum Klimawandel, dass sie die Forderungen<br />
des „Abkommens der Völker von Cochabamba“ übernimmt<br />
und dass sie alle f<strong>als</strong>chen Lösungen ablehnt, die<br />
ausgeheckt werden. Dazu zählen:<br />
<strong>Die</strong> Rechte des Bodens und des Waldes verteidigen:<br />
Wir lehnen die Initiative REDD + (reducción de las emisiones<br />
por deforestación y degradación; Reduktion der<br />
Emissionen aufgrund von Abholzung und Degradation)<br />
ab. Der Schutz der Wälder und die Wiederaufforstung der<br />
degradierten Wälder ist eine Verpflichtung aller Regierungen,<br />
die umgesetzt werden muss, ohne die Autonomie,<br />
die Rechte oder die Kontrolle der indigenen Völker und<br />
Bauern über den Boden und das Land einzuschränken,<br />
Fortsetzung Seite 50<br />
52 INPREKORR 468/469