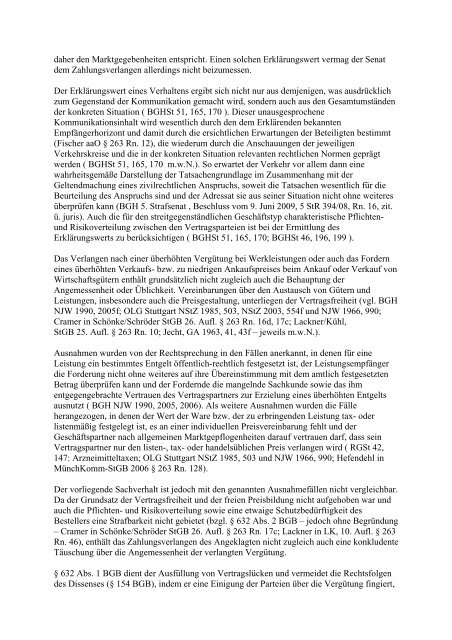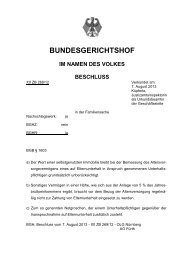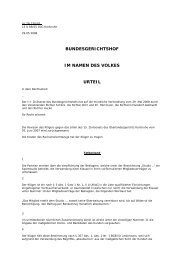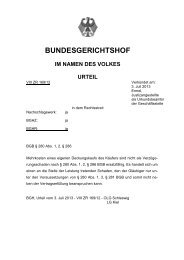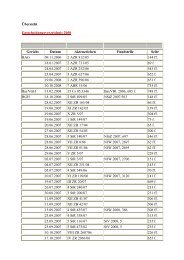Urteil im Volltext - Ja-Aktuell
Urteil im Volltext - Ja-Aktuell
Urteil im Volltext - Ja-Aktuell
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
daher den Marktgegebenheiten entspricht. Einen solchen Erklärungswert vermag der Senat<br />
dem Zahlungsverlangen allerdings nicht beizumessen.<br />
Der Erklärungswert eines Verhaltens ergibt sich nicht nur aus demjenigen, was ausdrücklich<br />
zum Gegenstand der Kommunikation gemacht wird, sondern auch aus den Gesamtumständen<br />
der konkreten Situation ( BGHSt 51, 165, 170 ). Dieser unausgesprochene<br />
Kommunikationsinhalt wird wesentlich durch den dem Erklärenden bekannten<br />
Empfängerhorizont und damit durch die ersichtlichen Erwartungen der Beteiligten best<strong>im</strong>mt<br />
(Fischer aaO § 263 Rn. 12), die wiederum durch die Anschauungen der jeweiligen<br />
Verkehrskreise und die in der konkreten Situation relevanten rechtlichen Normen geprägt<br />
werden ( BGHSt 51, 165, 170 m.w.N.). So erwartet der Verkehr vor allem dann eine<br />
wahrheitsgemäße Darstellung der Tatsachengrundlage <strong>im</strong> Zusammenhang mit der<br />
Geltendmachung eines zivilrechtlichen Anspruchs, soweit die Tatsachen wesentlich für die<br />
Beurteilung des Anspruchs sind und der Adressat sie aus seiner Situation nicht ohne weiteres<br />
überprüfen kann (BGH 5. Strafsenat , Beschluss vom 9. Juni 2009, 5 StR 394/08, Rn. 16, zit.<br />
ü. juris). Auch die für den streitgegenständlichen Geschäftstyp charakteristische Pflichtenund<br />
Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien ist bei der Ermittlung des<br />
Erklärungswerts zu berücksichtigen ( BGHSt 51, 165, 170; BGHSt 46, 196, 199 ).<br />
Das Verlangen nach einer überhöhten Vergütung bei Werkleistungen oder auch das Fordern<br />
eines überhöhten Verkaufs- bzw. zu niedrigen Ankaufspreises be<strong>im</strong> Ankauf oder Verkauf von<br />
Wirtschaftsgütern enthält grundsätzlich nicht zugleich auch die Behauptung der<br />
Angemessenheit oder Üblichkeit. Vereinbarungen über den Austausch von Gütern und<br />
Leistungen, insbesondere auch die Preisgestaltung, unterliegen der Vertragsfreiheit (vgl. BGH<br />
NJW 1990, 2005f; OLG Stuttgart NStZ 1985, 503, NStZ 2003, 554f und NJW 1966, 990;<br />
Cramer in Schönke/Schröder StGB 26. Aufl. § 263 Rn. 16d, 17c; Lackner/Kühl,<br />
StGB 25. Aufl. § 263 Rn. 10; Jecht, GA 1963, 41, 43f – jeweils m.w.N.).<br />
Ausnahmen wurden von der Rechtsprechung in den Fällen anerkannt, in denen für eine<br />
Leistung ein best<strong>im</strong>mtes Entgelt öffentlich-rechtlich festgesetzt ist, der Leistungsempfänger<br />
die Forderung nicht ohne weiteres auf ihre Übereinst<strong>im</strong>mung mit dem amtlich festgesetzten<br />
Betrag überprüfen kann und der Fordernde die mangelnde Sachkunde sowie das ihm<br />
entgegengebrachte Vertrauen des Vertragspartners zur Erzielung eines überhöhten Entgelts<br />
ausnutzt ( BGH NJW 1990, 2005, 2006). Als weitere Ausnahmen wurden die Fälle<br />
herangezogen, in denen der Wert der Ware bzw. der zu erbringenden Leistung tax- oder<br />
listenmäßig festgelegt ist, es an einer individuellen Preisvereinbarung fehlt und der<br />
Geschäftspartner nach allgemeinen Marktgepflogenheiten darauf vertrauen darf, dass sein<br />
Vertragspartner nur den listen-, tax- oder handelsüblichen Preis verlangen wird ( RGSt 42,<br />
147: Arzne<strong>im</strong>itteltaxen; OLG Stuttgart NStZ 1985, 503 und NJW 1966, 990; Hefendehl in<br />
MünchKomm-StGB 2006 § 263 Rn. 128).<br />
Der vorliegende Sachverhalt ist jedoch mit den genannten Ausnahmefällen nicht vergleichbar.<br />
Da der Grundsatz der Vertragsfreiheit und der freien Preisbildung nicht aufgehoben war und<br />
auch die Pflichten- und Risikoverteilung sowie eine etwaige Schutzbedürftigkeit des<br />
Bestellers eine Strafbarkeit nicht gebietet (bzgl. § 632 Abs. 2 BGB – jedoch ohne Begründung<br />
– Cramer in Schönke/Schröder StGB 26. Aufl. § 263 Rn. 17c; Lackner in LK, 10. Aufl. § 263<br />
Rn. 46), enthält das Zahlungsverlangen des Angeklagten nicht zugleich auch eine konkludente<br />
Täuschung über die Angemessenheit der verlangten Vergütung.<br />
§ 632 Abs. 1 BGB dient der Ausfüllung von Vertragslücken und vermeidet die Rechtsfolgen<br />
des Dissenses (§ 154 BGB), indem er eine Einigung der Parteien über die Vergütung fingiert,