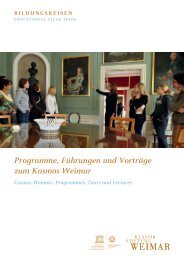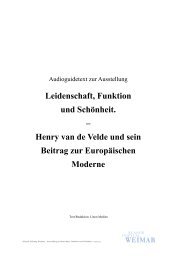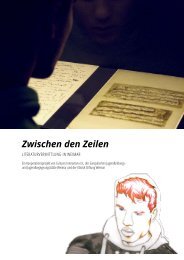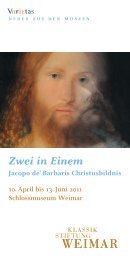im Sinne liszts ist es gehandelt« - Klassik Stiftung Weimar
im Sinne liszts ist es gehandelt« - Klassik Stiftung Weimar
im Sinne liszts ist es gehandelt« - Klassik Stiftung Weimar
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Evelyn Liepsch<br />
»Im <strong>Sinne</strong> Liszts <strong>ist</strong> <strong>es</strong> gehandelt«<br />
Zur Gründung der Liszt-<strong>Stiftung</strong> und d<strong>es</strong> We<strong>im</strong>arer Liszt-Museums<br />
Am 3. August 1886 wurde Liszt auf dem städtischen Friedhof in Bayreuth<br />
beig<strong>es</strong>etzt, »still und einfach«, wie er t<strong>es</strong>tamentarisch verfügt hatte, und »an<br />
dem Ort, wo er sterben würde«. 1 Weder We<strong>im</strong>ar, Rom noch Budap<strong>es</strong>t, seit<br />
1869 die Hauptstädte sein<strong>es</strong> »vie trifurquée«, sollten ihm die letzte Ruh<strong>es</strong>tätte<br />
gewähren dürfen. Er fand sie in Bayreuth, dort, wo Richard Wagner seinen<br />
Ruhm gelebt hatte, zu dem der Hofkapellme<strong>ist</strong>er Franz Liszt Jahrzehnte zuvor<br />
in We<strong>im</strong>ar den Grund gelegt hatte. Im Wissen, dass Wagner nur ein Protegé in<br />
einer Reihe namhafter Kompon<strong>ist</strong>en war, denen der Verstorbene den Weg in<br />
die Konzert- und Opernhäuser der Welt gebahnt hatte, wandte sich der Wagner-Dirigent<br />
Hans Richter nach dem Begräbnis in einer Ansprache an die versammelten<br />
Musiker und formulierte die Verpflichtung, die das künstlerische<br />
Erbe den Nachkommenden auferlege: »Liszt, der selbstlos<strong>es</strong>te Künstler, sei<br />
während sein<strong>es</strong> Lebens der größte Gläubiger der Künstler geworden«, gibt die<br />
We<strong>im</strong>arische Zeitung aus Richters Rede wieder, »di<strong>es</strong>e Schuld müsse nun endlich<br />
getilgt werden, d<strong>es</strong>sen möchten sich die reproduktiven Künstler, Kapellme<strong>ist</strong>er,<br />
Sänger und Orch<strong>es</strong>terglieder heute bewußt werden, wo sich die Gruft<br />
über dem reproduktiven Künstler Liszt für <strong>im</strong>mer schloß und einzig mehr der<br />
Kompon<strong>ist</strong> Liszt unter uns fortleben kann, als ein wahrer Heros der Tonkunst«.<br />
2<br />
Neben Richter kamen auch der Jenaer Justizrat und langjährige vertraute<br />
Freund Franz Liszts Carl Gille, der Liszt-Schüler Eduard Reuß aus Karlsruhe<br />
und Martin Krause, Vorsitzender d<strong>es</strong> Leipziger Liszt-Vereins, zu Wort, die<br />
ebenso bekundeten, dass ihnen das künstlerische Vermächtnis d<strong>es</strong> Kompon<strong>ist</strong>en<br />
Herzenssache und Verpflichtung sei. Das zeitgenössische Musikschaffen<br />
sollte künftig w<strong>es</strong>entlich gefördert werden. Dabei sollten Liszts eigene Kompositionen<br />
einen Ehrenplatz in den Konzertprogrammen erhalten und die musikh<strong>ist</strong>orische<br />
Le<strong>ist</strong>ung d<strong>es</strong> Tondichters endlich die gebührende umfassende<br />
Anerkennung und Würdigung erfahren.<br />
Carl Alexander von Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach erreichte die Nachricht vom<br />
Tod d<strong>es</strong> geliebten und hochverehrten Freund<strong>es</strong> während sein<strong>es</strong> Sommeraufenthalt<strong>es</strong><br />
auf Schloss Wilhelmsthal bei Eisenach. Der russische Maler Paul von<br />
1 Liszts T<strong>es</strong>tament. Aus dem Französischen ins Deutsche übertragen und hrsg. von<br />
Friedrich Schnapp. We<strong>im</strong>ar 1931, S. 19 f.<br />
2 We<strong>im</strong>arische Zeitung Nr. 183, 7. August 1886.
268<br />
evelyn liepsch<br />
Abb. 1<br />
Tod<strong>es</strong>anzeige für Franz Liszt in der We<strong>im</strong>arischen Zeitung, Extrablatt, 1. August 1886<br />
Joukowsky, Freund der Familie Wagner und häufig Gast am We<strong>im</strong>arer Hof,<br />
hatte den Großherzog unverzüglich in einem Telegramm informiert und in<br />
einem nachfolgenden Brief Trost zug<strong>es</strong>prochen. Er gehörte zu den Schülern<br />
und Freunden Liszts, die dem schwer erkrankten Me<strong>ist</strong>er in Bayreuth beig<strong>es</strong>tanden<br />
hatten, als di<strong>es</strong>er <strong>es</strong> sich nicht hatte nehmen lassen, die F<strong>es</strong>tspiele zu<br />
b<strong>es</strong>uchen und noch am 25. Juli 1886 einer Aufführung d<strong>es</strong> ersten Bayreuther<br />
Tr<strong>ist</strong>an in der Regie seiner Tochter Cos<strong>im</strong>a Wagner beizuwohnen.<br />
Am 31. Juli starb Franz Liszt (Abb. 1). Carl Alexander war tief bewegt:<br />
»Der Tag vergangen in Schmerz und Kummer. Arm<strong>es</strong> We<strong>im</strong>ar! Walther von<br />
Goethe, Liszt – zwei Lücken in meinem Leben! – Gebetet, geweint und nachgedacht.«<br />
So heißt <strong>es</strong> am 1. August in seinem Tagebuch. 3 »Wir kennen uns so<br />
gut, daß wir <strong>es</strong> uns gar nicht zu sagen brauchen, wie wir leiden«, antwortet er<br />
Joukowsky am 2. August auf d<strong>es</strong>sen Brief aus Bayreuth.<br />
3 thHStAW, HA A XXVI, Nr. 1984. Übersetzung aus dem Französischen zit. nach<br />
Angelika Pöthe: Carl Alexander. Mäzen in We<strong>im</strong>ars »Silberner Zeit«. Köln, We<strong>im</strong>ar,<br />
Wien 1998, S. 264.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
269<br />
Sie haben recht, Trost in dem Gedanken zu finden, daß Gott ihn gerufen,<br />
um ihn von Leiden zu befreien und vor größeren zu bewahren. Es giebt noch<br />
einen Trost – daß er aus künstlerischer und Freundschafts-Atmosphäre abberufen<br />
worden, nachdem er wie ein Meteor zuletzt noch durch die Welt<br />
geflogen <strong>ist</strong> und hochverdiente Ovationen geerntet hat. Aber all<strong>es</strong> das <strong>ist</strong><br />
steril neben dem Schmerz ihn verloren zu haben,<br />
vertraut er ihm an. »Der Versuch, nach seinen Prinzipien zu arbeiten wird, mit<br />
Gott<strong>es</strong> Hülfe, ein Trost werden.« 4 Den Schmerz über Liszts Tod teilte der<br />
Großherzog mit vielen Freunden, so auch mit Hofrat Gille, dem er am 1. August<br />
gleichfalls versichert, »in dem großen <strong>Sinne</strong> d<strong>es</strong> Verklärten für die Kunst<br />
weiter zu wirken«. 5<br />
Zu den Trauerfeierlichkeiten entsandte Carl Alexander seinen Hausmarschall<br />
Oskar Graf von Wedel und den Generalintendanten d<strong>es</strong> Hoftheaters<br />
August Freiherr von Loën als Vertreter d<strong>es</strong> großherzoglichen Haus<strong>es</strong> nach<br />
Bayreuth. In einem Brief an Loën unterbreitet er einen konkreten Vorschlag:<br />
»Das traurige Ereigniß, das Sie nach Bayreuth berufen, die Allgemeinheit d<strong>es</strong><br />
Antheils, d<strong>es</strong>sen Ausdruck an Mich herantritt, haben in Mir die Sorge entstehen<br />
lassen, ob der Augenblick nicht der günstigste wäre, der Erinnerung<br />
Liszts ein Denkmal zu errichten. Nicht ein leblos<strong>es</strong>, sondern ein lebend<strong>es</strong>«,<br />
zitiert die We<strong>im</strong>arische Zeitung aus dem Schreiben vom 3. August 1886. Mit<br />
Bezug auf die Leipziger Tonkünstlerversammlung d<strong>es</strong> Jahr<strong>es</strong> 1859, in der die<br />
Gründung d<strong>es</strong> Allgemeinen Deutschen Musikvereins (künftig: ADMV) b<strong>es</strong>chlossen<br />
worden war, fährt der Großherzog in seinem Brief fort:<br />
Den neuen Deutschen Musikverein hatte der Me<strong>ist</strong>er gegründet, um seiner<br />
Kunst neue Bahnen zu öffnen; Mich hatte er zum Protektor gemacht; in d<strong>es</strong><br />
Me<strong>ist</strong>ers Richtung weiter seine Kunst zu fördern, <strong>ist</strong> also Meine Pflicht.<br />
D<strong>es</strong>halb möchte Ich eine Liszt-<strong>Stiftung</strong> zur Förderung der ›neuen deutschen<br />
Musikrichtung‹ gegründet sehen, durch welche Schüler und Schülerinnen<br />
unterstützt würden durch Prämien, Stipendien u.s.w., welche würdig befunden<br />
würden, jenem Zwecke zu dienen. In We<strong>im</strong>ar würden sie alljährlich<br />
geprüft werden, in We<strong>im</strong>ar müßte der Sitz der Leitung der <strong>Stiftung</strong> für <strong>im</strong>mer<br />
sein, in dem Saal der Orch<strong>es</strong>terschule die Prüfung, in der Wohnung<br />
Liszts die Sitzung der Oberleitung. Theilen Sie doch, lieber Freund, di<strong>es</strong>en<br />
Gedanken jetzt der in Bayreuth versammelten Künstlerschaft mit,<br />
trägt er seinem Intendanten auf, »fordern Sie sie auf, <strong>im</strong> Andenken an unseren<br />
Me<strong>ist</strong>er für das Unternehmen zu wirken durch Vorstellungen und Konzerte;<br />
4 Carl Alexander an Paul von Joukowsky, 2. August 1886. Zit. nach Adelheid von<br />
Schorn: Das nachklassische We<strong>im</strong>ar. Bd. 2: Unter der Regierungszeit von Karl<br />
Alexander und Sophie. We<strong>im</strong>ar 1912, S. 270.<br />
5 Carl Alexander an Carl Gille, 1. August 1886. Zit. nach We<strong>im</strong>arische Zeitung<br />
Nr. 185, 10. August 1886.
270<br />
evelyn liepsch<br />
schmieden wir das Eisen, solange <strong>es</strong> warm <strong>ist</strong>. Di<strong>es</strong> all<strong>es</strong> in Meinem Namen.<br />
[…] Möge Gott seinen Segen geben. Im <strong>Sinne</strong> Liszts <strong>ist</strong> <strong>es</strong> gehandelt«. 6<br />
Die Idee Carl Alexanders entsprach ganz den Intentionen der in Bayreuth<br />
versammelten Künstler. Sie war Diskussionspunkt in den G<strong>es</strong>prächen, an denen<br />
neben anderen Musikern vor allem Vertreter d<strong>es</strong> Leipziger Liszt-Vereins,<br />
so Martin Krause und Alexander Siloti aus der jüngeren Schülergeneration<br />
Franz Liszts, und Vertreter d<strong>es</strong> ADMV, <strong>im</strong> B<strong>es</strong>onderen Carl Riedel, der Vorsitzende,<br />
und Carl Gille, der Generalsekretär und Bevollmächtigte bei der Großherzoglich-Sächsischen<br />
Staatsregierung, beteiligt waren. Der Liszt-Verein war<br />
<strong>im</strong> Jahre 1885 infolge kontroverser Diskussionen um H<strong>ist</strong>orizität und Moderne<br />
in der zeitgemäßen musikalischen Aufführungspraxis, die vornehmlich<br />
auch in den Reihen d<strong>es</strong> ADMV geführt wurden, gegründet worden. Die Leipziger<br />
Musiker hatten sich deutlich positioniert und fortan in ihren Konzerten<br />
in kühnster Weise Kompositionen der musikalischen Avantgarde aufgeführt. 7<br />
In gemeinsamer Verantwortung, »das Andenken d<strong>es</strong> unsterblichen Me<strong>ist</strong>ers<br />
dauernd zu ehren«, wurde nun in Bayreuth ein Aufruf verfasst, der dem We<strong>im</strong>arer<br />
Großherzog die Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisieren und der<br />
öffentlichen Proklamierung sein<strong>es</strong> Plan<strong>es</strong> dienen sollte. 8<br />
Inzwischen wurden die Überlegungen zur Gründung der Liszt-<strong>Stiftung</strong> in<br />
Wilhelmsthal fortgeführt. Der Großherzog beriet sich auch mit seiner 32-jährigen<br />
Tochter Elisabeth, die Liszts Klavierschülerin und eine seiner herausragenden<br />
Verehrerinnen war. Sie begrüßte die Idee ihr<strong>es</strong> Vaters, jährlich Prämien<br />
an ausgewählte Künstler zu vergeben, die sich <strong>im</strong> <strong>Sinne</strong> Liszts für den<br />
Fortschritt der Musik einsetzten. Beide entwickelten bereits Vorstellungen<br />
über die B<strong>es</strong>etzung ein<strong>es</strong> aufsichtsführenden Gremiums. Es sollte dem Direktorium<br />
d<strong>es</strong> ADMV, dem sich Carl Alexander als Protektor verpflichtet fühlte,<br />
unterstellt werden und seinen Sitz in We<strong>im</strong>ar haben. Die Sorge um die »durch<br />
das Hinscheiden Liszts gefährdeten musikalischen Inter<strong>es</strong>sen We<strong>im</strong>ars«, die<br />
Vater und Tochter teilten, ließ die Erinnerung an die Vergangenheit und die<br />
enge Verbindung zwischen der fürstlichen Familie und dem großen Künstler<br />
lebendig werden. 9<br />
Im Herbst 1841 hatte »der König der Pian<strong>ist</strong>en« seine ersten Konzerte in<br />
We<strong>im</strong>ar gegeben und der russischen Großfürstin Maria Pawlowna, der Mutter<br />
Carl Alexanders, seine Aufwartung gemacht. Der Erbgroßherzog war von der<br />
Persönlichkeit und dem Spiel d<strong>es</strong> Virtuosen gleichermaßen bege<strong>ist</strong>ert. Er lud<br />
6 Carl Alexander an August von Loën, 3. August 1886. Zit. nach We<strong>im</strong>arische Zeitung<br />
Nr. 186, 11. August 1886.<br />
7 Liszt-Verein unter dem Protectorat Sr. Kgl. Hoheit d<strong>es</strong> Großherzogs Carl Alexander<br />
von Sachsen. Zum zehnjährigen Jubiläum: Bericht über die 10jährige Tätigkeit d<strong>es</strong><br />
Vereins 1885-1895. Leipzig 1895.<br />
8 Die Vorgänge sind in den Akten d<strong>es</strong> ADMV dokumentiert. GSA 70/36.<br />
9 Aktennotiz Carl Alexanders, 7. August 1886. thHStAW, HA A XXVI, Nr. 1631, Bl. 7 f.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
271<br />
ihn spontan zu seiner bevorstehenden Hochzeit ein. Nach den Feierlichkeiten<br />
<strong>im</strong> Februar 1842 wurde Liszt zu We<strong>im</strong>ars »Kapellme<strong>ist</strong>er in außerordentlichen<br />
Diensten« ernannt. Aber erst ab 1848, als sich der Pian<strong>ist</strong> von seiner Virtuosenkarriere<br />
verabschiedet und als Kompon<strong>ist</strong> und Kapellme<strong>ist</strong>er in We<strong>im</strong>ar<br />
niedergelassen hatte, sollte sich die Hoffnung Carl Alexanders auf ein neu<strong>es</strong><br />
We<strong>im</strong>ar erfüllen, die er mit der Person Franz Liszts verbunden hatte. In bewusster<br />
Nachfolge der klassischen literarischen Tradition strebte Liszt in di<strong>es</strong>er<br />
Stadt nach einer neuen Blüte der Kultur. Binnen kurzer Zeit gelang <strong>es</strong> ihm,<br />
die kleine R<strong>es</strong>idenzstadt zum Mittelpunkt d<strong>es</strong> musikalischen G<strong>es</strong>chehens in<br />
Deutschland werden zu lassen. Die Ur- und Erstaufführungen in den Konzerten<br />
und auf dem Musiktheater zogen Musiker und Kunstinter<strong>es</strong>sierte europaweit<br />
in ihren Bann. Liszts Überlegungen, der zeitgenössischen Kunst ein<br />
national<strong>es</strong> Forum zu schaffen, hatten sich 1850 in seinem »Exposé d’un projet<br />
de la Fondation-Goethe à We<strong>im</strong>ar« 10 niederg<strong>es</strong>chlagen. Mit di<strong>es</strong>er Schrift reagierte<br />
er auf einen Aufruf Berliner Künstler und Gelehrter zum 100. Geburtstag<br />
Goeth<strong>es</strong> und schlug vor, <strong>im</strong> jährlichen Wechsel nationale Wettbewerbe für<br />
Literatur, Malerei, Skulptur und Musik auszuschreiben. Die Preisverleihung<br />
di<strong>es</strong>er »Goethe-Wettbewerbe« und die damit verbundene Präsentation bzw.<br />
Aufführung der preisgekrönten Arbeiten hätten in We<strong>im</strong>ar, dem Sitz der Nationalstiftung,<br />
stattfinden sollen. Wenngleich Carl Alexander Liszts Plan grundsätzlich<br />
unterstützte – sein Wirken <strong>im</strong> <strong>Sinne</strong> einer allgemeinen Förderung von<br />
Kunst und Kultur lässt sich beispielsweise <strong>im</strong> Bau d<strong>es</strong> Großherzog lichen Museums<br />
erkennen – sollte er doch Utopie bleiben. 11 Niedergedrückt von Unverständnis<br />
und Gleichgültigkeit gegenüber seiner Idee und seinem leidenschaftlichen<br />
Engagement für das zeitgenössische Musikschaffen, mit dem er sogar<br />
die Errichtung ein<strong>es</strong> Uraufführungstheaters für Wagners Ring d<strong>es</strong> Nibelungen<br />
in We<strong>im</strong>ar betrieben hatte, schreibt Liszt in seinem T<strong>es</strong>tament von 1860:<br />
Zu einer b<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mten Zeit (<strong>es</strong> sind etwa zehn Jahre her) hatte ich für Weymar<br />
eine neue Kunstperiode erträumt, ähnlich der von Carl August, wo<br />
Wagner und ich die Führer gew<strong>es</strong>en wären, wie einst Goethe und Schiller.<br />
Die Engherzigkeit, um nicht zu sagen der schmutzige Ge<strong>ist</strong> gewisser örtlicher<br />
Verhältnisse, alle Arten von Mißgunst und Dummheit von draußen<br />
wie drinnen haben die Verwirklichung di<strong>es</strong><strong>es</strong> Traum<strong>es</strong> zu nichte gemacht, d<strong>es</strong>sen<br />
Ehre Seiner Kgl. Hoheit, dem jetzigen Großherzog, zugekommen wäre.<br />
Trotzdem hege ich noch di<strong>es</strong>elben Gefühle und bleibe derselben Überzeugung,<br />
daß <strong>es</strong> nur allzu leicht gew<strong>es</strong>en wäre, <strong>es</strong> allen greifbar zu machen. 12<br />
10 GSA 59/4.<br />
11 Die wissenschaftliche Auswertung d<strong>es</strong> Projekt<strong>es</strong> erfolgte in: Franz Liszt: Sämtliche<br />
Schriften. Hrsg. von Detlef Altenburg. Wi<strong>es</strong>baden 1989 ff. Bd. 3: Die Goethe-<strong>Stiftung</strong>.<br />
Hrsg. von Detlef Altenburg und Britta Schilling-Wang. Wi<strong>es</strong>baden 1997.<br />
12 Vgl. Franz Liszt: Di<strong>es</strong> <strong>ist</strong> mein T<strong>es</strong>tament. Den 14. September 1860. In: Liszts<br />
t<strong>es</strong>tament (Anm. 1), S. 9.
272<br />
evelyn liepsch<br />
W<strong>es</strong>entliche Gedanken aus dem Lisztschen Goethe-<strong>Stiftung</strong>s-Projekt wurden<br />
in die Statuten d<strong>es</strong> ADMV übernommen. In ihren grundlegenden B<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mungen<br />
sahen di<strong>es</strong>e die Aufführung bedeutender Werke der Musikg<strong>es</strong>chichte und<br />
der Gegenwart sowie die Förderung begabter Kompon<strong>ist</strong>en und Virtuosen vor.<br />
Am 7. August 1861 hatte sich der Musikverein unter dem Protektorat Carl<br />
Alexanders in We<strong>im</strong>ar konstituiert. Wenige Tage danach re<strong>ist</strong>e Liszt nach<br />
Rom, doch blieb er dem ADMV auch während seiner Abw<strong>es</strong>enheit treu verbunden.<br />
Carl Gille hielt ihn auf dem Laufenden. Mit ihm und Franz Brendel, der<br />
bis 1868 den Vorsitz d<strong>es</strong> ADMV innehatte, korr<strong>es</strong>pondierte er über viele relevante<br />
Fragen der Vereinsarbeit, über Konzertprogramme und Künstlerengagements.<br />
Im Jahre 1881 wurde ihm die Ehrenpräsidentschaft verliehen.<br />
Auch der Großherzog bedurfte in mancher Angelegenheit der bewährten<br />
Ratschläge d<strong>es</strong> abw<strong>es</strong>enden Musikers. In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr<br />
hatte er ihn noch 1861 zu seinem Kammerherrn ernannt. Aus der Zeit<br />
danach <strong>ist</strong> ein reger Briefwechsel überliefert. Zwe<strong>im</strong>al traf man sich zu längeren<br />
persönlichen Unterredungen in We<strong>im</strong>ar und auf Schloss Wilhelmsthal –<br />
1864, als Liszt anlässlich der Tonkünstlerversammlung d<strong>es</strong> ADMV in Karlsruhe<br />
zum ersten Mal wieder in Deutschland weilte, und 1867, nach seiner<br />
Teilnahme an der Meininger Tonkünstlerversammlung sowie zur Feier d<strong>es</strong><br />
800-jährigen B<strong>es</strong>tehens der Wartburg in Eisenach. Der Kompon<strong>ist</strong> hatte die<br />
F<strong>es</strong>tveranstaltung mit dem Dirigat sein<strong>es</strong> Oratoriums Die Legende der heiligen<br />
Elisabeth gekrönt. Erst <strong>im</strong> Jahre 1869 gelang <strong>es</strong> Carl Alexander, seinen<br />
»Ma<strong>es</strong>tro« zu bewegen, in We<strong>im</strong>ar wieder einen f<strong>es</strong>ten Wohnsitz zu beziehen.<br />
Bis 1886 lebte Liszt vor allem in den Sommermonaten in di<strong>es</strong>er Stadt, er komponierte<br />
und unterrichtete begabte Pian<strong>ist</strong>en aus aller Welt.<br />
Nach Liszts Tod fanden weltweit Gedenkkonzerte statt. Nicht nur die Klavierkonzerte<br />
d<strong>es</strong> Kompon<strong>ist</strong>en, auch seine Symphonischen Dichtungen, seine<br />
Faust-Symphonie und die Dante-Symphonie wurden vielfach aufgeführt. Der<br />
Erlös einiger Konzerte in Deutschland kam bereits dem Fonds der künftigen<br />
Liszt-<strong>Stiftung</strong> zugute. So überwi<strong>es</strong> der Dirigent und Liszt-Schüler Karl Klindworth<br />
dem ADMV einen Betrag von 2.000 Mark, den die Berliner Symphoniker<br />
am 11. Oktober 1886 unter seiner Leitung zur »Liszt-Feier« in Berlin<br />
eing<strong>es</strong>pielt hatten. Ebenso veranstaltete der ADMV am 22. Januar 1887 in<br />
We<strong>im</strong>ar ein opulent<strong>es</strong> Erinnerungskonzert für seinen verstorbenen Ehrenpräsidenten<br />
»zum B<strong>es</strong>ten der von Sr. Königlichen Hoheit dem Grossherzog […]<br />
inaugurierten Liszt-<strong>Stiftung</strong>«. 13 Eduard Lassen, seit 1861 Nachfolger Liszts <strong>im</strong><br />
Amt d<strong>es</strong> Hofkapellme<strong>ist</strong>ers, dirigierte ausschließlich Werke aus dem Œuvre<br />
Liszts. Der Sol<strong>ist</strong> d<strong>es</strong> Es-Dur-Klavierkonzert<strong>es</strong> war Eugen d’Albert. Die Einnahmen<br />
beliefen sich auf knapp 900 Mark. 14<br />
13 Programmheft d<strong>es</strong> Großherzoglichen Hoftheaters. GSA 70/235.<br />
14 Abrechnung der <strong>Stiftung</strong>smittel. GSA 70/313.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
273<br />
Weitere zweckgebundene Spenden gingen auch von Privatpersonen ein.<br />
Schließlich aber bildete die großzügige Schenkung der Fürstin Marie von<br />
Hohenlohe-Schillingsfürst das Stammkapital der <strong>Stiftung</strong>. Die Nachfolgeerbin<br />
der Lisztschen Hinterlassenschaft stellte dem ADMV nach ihrem B<strong>es</strong>uch <strong>im</strong><br />
April 1887 in We<strong>im</strong>ar 70.000 Mark »zur ehrenden Erinnerung an den Me<strong>ist</strong>er«<br />
zur Verfügung. 15 Damit konnte die Gründung der Liszt-<strong>Stiftung</strong> b<strong>es</strong>chlossen<br />
und am 22. Oktober 1887, zum Geburtstag d<strong>es</strong> Kompon<strong>ist</strong>en, in der<br />
Neuen Zeitschrift für Musik bekannt gegeben werden.<br />
An di<strong>es</strong>er Stelle sei daran erinnert, dass Liszt sein T<strong>es</strong>tament bereits <strong>im</strong><br />
September 1860 in We<strong>im</strong>ar verfasste, in welchem er nur einzelne kleinere<br />
Schenkungen verfügt, seine damalige Lebensgefährtin Carolyne von Sayn-<br />
Wittgenstein jedoch als Universalerbin eing<strong>es</strong>etzt hatte. Schon bald nach Liszts<br />
Tod, am 8. März 1887, starb di<strong>es</strong>e in Rom. Ihre Hinterlassenschaft ging auf<br />
ihre einzige Tochter über, die die endgültigen Entscheidungen über den We<strong>im</strong>arer<br />
Nachlass – wohl ganz <strong>im</strong> <strong>Sinne</strong> Liszts – getroffen hat. Marie hatte elf<br />
Jahre ihrer Kindheit und Jugend in We<strong>im</strong>ar verbracht. Ihre Mutter war 1848<br />
mit ihr aus Russland geflohen und Franz Liszt nach We<strong>im</strong>ar gefolgt. Die unglücklich<br />
verheiratete Fürstin hatte den Pian<strong>ist</strong>en ein Jahr zuvor während sein<strong>es</strong><br />
Gastspiels in Kiew kennengelernt. Sie hoffte, unter dem Schutz und mit<br />
Fürsprache der in We<strong>im</strong>ar regierenden russischen Großfürstin Maria Pawlowna,<br />
die Annullierung ihrer Ehe erwirken und die mit Liszt gehegten Heiratspläne<br />
verwirklichen zu können. Ihre Hoffnungen sollten sich bekanntlich<br />
nicht erfüllen. Dennoch lebten Carolyne und ihre Tochter viele Jahre gemeinsam<br />
mit Franz Liszt in einem gleichsam familiären Verhältnis in der Altenburg<br />
an der Jenaer Straße. Ihr Domizil entwickelte sich zu einem künstlerischen<br />
Zentrum, d<strong>es</strong>sen Ruhm sich in ganz Europa verbreitete. Nach ihrer Hochzeit<br />
mit dem Obersthofmarschall d<strong>es</strong> österreichischen Kaisers, Fürst Constantin<br />
von Hohenlohe-Schillingsfürst, verließ der »gute Ge<strong>ist</strong> der Altenburg«, wie<br />
Hans von Bülow Prinz<strong>es</strong>sin Marie genannt hatte, <strong>im</strong> Oktober 1859 We<strong>im</strong>ar<br />
und ging nach Wien. Hier erwi<strong>es</strong> sie sich als eine große Förderin von Kunst<br />
und Kultur. Liszt traf sie noch einige wenige Male. Bis zu seinem Tod stand er<br />
mit ihr in brieflichem Kontakt. 16<br />
Die Satzungen der Liszt-<strong>Stiftung</strong> d<strong>es</strong> ADMV, die zwischen Großherzog Carl<br />
Alexander und Fürstin Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst beraten und vom<br />
Direktorium d<strong>es</strong> ADMV verabschiedet wurden, erschienen bei C. F. Kahnt<br />
Nachfolger in Leipzig. Folgende Hauptaufgaben hatte die <strong>Stiftung</strong> zu ihrem<br />
Zweck erhoben:<br />
15 Arthur Seidl: F<strong>es</strong>tschrift zum fünfzigjährigen B<strong>es</strong>tehen d<strong>es</strong> Allgemeinen Deutschen<br />
Musikvereins. Berlin 1911, S. 75.<br />
16 Vgl. Howard E. Hugo: The letters of Franz Liszt to Marie zu Sayn-Wittgenstein.<br />
Cambridge 1953.
274<br />
evelyn liepsch<br />
a.<br />
Die Förderung und <strong>im</strong> Falle der Hilfsbedürftigkeit Unterstützung bereits<br />
anerkannter verdienstvoller Compon<strong>ist</strong>en und hervorragender Claviervirtuosen<br />
durch Gewährung von Ehrengaben und beziehungsweise Pensionen.<br />
b.<br />
Die Unterstützung junger Compon<strong>ist</strong>en und Claviervirtuosen von hervorragender<br />
und eigenartiger Begabung durch Verleihung von Stipendien, Gratisb<strong>es</strong>uch<br />
der Bayreuther Wagner-Aufführungen, zum Behufe ihrer weiteren<br />
Ausbildung.<br />
c.<br />
Die Subvention von F<strong>es</strong>t- und Musikaufführungen Lisztscher Tondichtungen.<br />
17<br />
Die <strong>Stiftung</strong> hatte ihren Sitz in We<strong>im</strong>ar. Die Verwaltung d<strong>es</strong> <strong>Stiftung</strong>svermögens<br />
und die G<strong>es</strong>chäftsführung oblagen dem Direktorium d<strong>es</strong> ADMV. Über die<br />
Verteilung der Ehrengaben, Pensionen, Stipendien und Subventionen hatte ein<br />
Kuratorium von sieben Mitgliedern zu entscheiden. Satzungsgemäß konnten<br />
zwei Personen vom Protektor d<strong>es</strong> Musikvereins, dem Großherzog, ausgewählt<br />
und zwei weitere von der Stifterin Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst b<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mt<br />
werden. D<strong>es</strong> Weiteren wurden ein Vorstandsmitglied aus dem Leipziger<br />
Liszt-Verein und zwei Personen aus dem Direktorium d<strong>es</strong> ADMV b<strong>es</strong>tellt.<br />
Das erste Kuratorium der Liszt-<strong>Stiftung</strong> setzte sich <strong>im</strong> Oktober 1887 dementsprechend<br />
aus folgenden Vertretern zusammen: Hofkapellme<strong>ist</strong>er Eduard<br />
lassen und Hofrat Dr. Carl Gille, Nikolaus Dumba, Vizepräsident der G<strong>es</strong>ellschaft<br />
der Musikfreunde in Wien, und Hofkapellme<strong>ist</strong>er Dr. Hans Richter aus<br />
Wien, Martin Krause vom Liszt-Verein sowie Prof. Dr. Carl Riedel und Kapellme<strong>ist</strong>er<br />
Arthur Nikisch seitens d<strong>es</strong> ADMV. Zu ihren Sitzungen trafen sich<br />
die Mitglieder in der ehemaligen We<strong>im</strong>arer Wohnung Liszts, die inzwischen<br />
als Museum eingerichtet worden war.<br />
Der <strong>Stiftung</strong>sfonds wurde durch zahlreiche freiwillige Spenden und Konzerteinnahmen<br />
b<strong>es</strong>tändig vermehrt. Viele Pian<strong>ist</strong>innen und Pian<strong>ist</strong>en aus dem<br />
ehemaligen Schülerkreis Franz Liszts, unter ihnen Bernhard Stavenhagen,<br />
Martha Remmert und Eugen d’Albert, widmeten ihre Konzerte den wohltätigen<br />
Zwecken der Liszt-<strong>Stiftung</strong>. Nach einem Anfangskapital von 77.400 Mark<br />
<strong>im</strong> November 1887 war das <strong>Stiftung</strong>svermögen <strong>im</strong> Jahre 1906 auf 106.700<br />
Mark ang<strong>es</strong>tiegen. 18 Das erste Stipendium erhielt Robert Franz in Halle.<br />
Bezeichnenderweise war die Entscheidung für einen Künstler gefallen, d<strong>es</strong>sen<br />
kompositorisch<strong>es</strong> Schaffen schon von Liszt gewürdigt und gefördert worden<br />
war. In den folgenden Jahren gingen die Zuwendungen an viele weitere Künst-<br />
17 Satzungen der Liszt-<strong>Stiftung</strong> d<strong>es</strong> Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Leipzig<br />
[o. J.]. GSA 70/12.<br />
18 Rechnungsabschluß d<strong>es</strong> ADMV für das Jahr 1906. GSA 70/105.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
275<br />
ler, so an Otto Reubke, Waldemar von Baußnern, Philipp Wolfrum, Claudio<br />
Arrau und Arnold Schönberg, dem 1903 das Höchststipendium von 1.000<br />
Mark bewilligt wurde.<br />
Fürstin Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst hatte in allen wichtigen Fragen<br />
ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht. Mit ihr wurden der Modus der<br />
Vermögensanlage abg<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mt, d<strong>es</strong>gleichen Zuwendungsvorschläge b<strong>es</strong>prochen<br />
und Satzungsänderungen diskutiert. 19 Wichtige Änderungen und Zusätze<br />
hatten sich 1906 in Vorbereitung der ersten Liszt-G<strong>es</strong>amtausgabe ergeben, die<br />
der Großherzog noch initiiert hatte und die aus <strong>Stiftung</strong>smitteln bewerkstelligt<br />
werden sollte. Die Fürstin befürwortete in einer Erklärung vom 26. Juli<br />
1907 das Projekt. Damit konnte die »Förderung und Subvention einer kritischen<br />
G<strong>es</strong>amtausgabe der Werke Liszts« als vierte Zweckb<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mung der <strong>Stiftung</strong><br />
in die neuen Satzungen aufgenommen werden. 20 Bis 1936 wurde die<br />
Großherzog-Carl-Alexander-Ausgabe aus einem eigens errichteten Spezialkonto<br />
der Liszt-<strong>Stiftung</strong> finanziert. Nach 33 publizierten Bänden musste die<br />
Ausgabe leider vorzeitig abgebrochen werden. 21<br />
Die Liszt-<strong>Stiftung</strong> war 1937, nach der Auflösung d<strong>es</strong> ADMV durch die Nationalsozial<strong>ist</strong>en,<br />
noch <strong>im</strong>mer wirksam. Erst nach 1943 können keine Aktivitäten<br />
mehr f<strong>es</strong>tg<strong>es</strong>tellt werden. 22<br />
Parallel zu den Bemühungen d<strong>es</strong> Großherzogs um die Gründung der Liszt-<br />
<strong>Stiftung</strong> verliefen seine Aktivitäten <strong>im</strong> Hinblick auf das We<strong>im</strong>arer Liszt-Museum.<br />
Nachdem ihn die Kunde vom Ableben Liszts erreicht hatte, b<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mte<br />
er unverzüglich, dass die We<strong>im</strong>arer Wohnräume, die er dem Künstler 1869 <strong>im</strong><br />
ehemaligen Hofgärtnerhaus am Eingang d<strong>es</strong> Ilmparks zur Verfügung g<strong>es</strong>tellt<br />
hatte, unverändert belassen und baldmöglichst einer memorialen Zweckb<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mung<br />
zugeführt werden sollten. In einer Mitteilung aus Wilhelmsthal, die<br />
Friedrich Hermann Graf von Beust, General adjutant und Oberhofmarschall<br />
d<strong>es</strong> Großherzogs, am 7. August 1886 an das Hofmarschallamt in We<strong>im</strong>ar richtete,<br />
l<strong>es</strong>en wir:<br />
19 Vgl. thHStAW, Departement d<strong>es</strong> Kultus 515.<br />
20 Satzungen der Franz Liszt-<strong>Stiftung</strong> d<strong>es</strong> Allgemeinen Deutschen Musikvereins.<br />
O. O. [1907]. GSA 70/12.<br />
21 Franz Liszt: Musikalische Werke. Hrsg. von Ferrucio Busoni, Peter Raabe u. a.<br />
Leipzig 1907-1936. Die Werkausgabe erschien zunächst bei Breitkopf & Härtel;<br />
1970 wurde in Kooperation von Editio Musica Budap<strong>es</strong>t und dem Bärenreiter-<br />
Verlag Kassel die neue kritische Edition d<strong>es</strong> musikalischen G<strong>es</strong>amtwerk<strong>es</strong> unter<br />
dem Titel Neue Liszt-Ausgabe begonnen. Seit 1986 wird die Ausgabe von dem<br />
ungarischen Verlag allein b<strong>es</strong>tritten.<br />
22 Neben der Liszt-<strong>Stiftung</strong> gehörten die Beethoven-<strong>Stiftung</strong>, die Mansouroff-<strong>Stiftung</strong>,<br />
die Hermann-<strong>Stiftung</strong> und die Richard-Wagner-<strong>Stiftung</strong> zum ADMV. Vgl.<br />
Irina Lucke-Kaminiarz: Der Allgemeine Deutsche Musikverein und seine Tonkünstlerf<strong>es</strong>te<br />
1859-1886. In: Detlef Altenburg (Hrsg.): Liszt und die Neudeutsche<br />
Schule (We<strong>im</strong>arer Liszt-Studien, Bd. 3). Laaber 2006, S. 221-235, hier S. 224 f.
276<br />
evelyn liepsch<br />
Da mit Sicherheit vorauszusehen <strong>ist</strong> daß die unzähligen Freunde und Verehrer<br />
Liszts, sobald ihr Weg sie nach We<strong>im</strong>ar führt, dem Andenken d<strong>es</strong><br />
Verstorbenen durch B<strong>es</strong>uch der Räume die er bewohnte huldigen werden<br />
befiehlt der Großherzog aufs aller strengste, daß sich an der Ausschmückung<br />
der von Liszt bewohnten Z<strong>im</strong>mer, also an dem Mobiliar <strong>im</strong> ausgedehnt<strong>es</strong>ten<br />
<strong>Sinne</strong> durchaus nichts verändern dürfe.<br />
Am 11. August heißt <strong>es</strong> in einer Aktennotiz Beusts, der Großherzog wolle »die<br />
drei von Liszt bewohnten Räume, also d<strong>es</strong>sen Salon, Schlafz<strong>im</strong>mer und Speisez<strong>im</strong>mer<br />
nur und ganz ausschließlich dem Andenken Liszts weihen«. 23<br />
Mit raschem Entschluss setzte Carl Alexander seine B<strong>es</strong>trebungen fort, in<br />
We<strong>im</strong>ar eine vielg<strong>es</strong>taltige Museumslandschaft aufzubauen, die das bedeutende<br />
künstlerische Erbe der Stadt bewahren und über seine Grenzen hinaus<br />
ins Bewusstsein der kunstinter<strong>es</strong>sierten Öffentlichkeit rücken sollte. Bereits <strong>im</strong><br />
Jahre 1847 war Schillers Wohnhaus als erste We<strong>im</strong>arer Dichter-Gedenkstätte<br />
eingerichtet worden. Das Goethe-Haus am Frauenplan konnte erst 1885 in ein<br />
Nationalmuseum umgewandelt und am 4. Juli 1886 für B<strong>es</strong>ucher öffentlich<br />
zugänglich gemacht werden. (Es sei hier nur erwähnt, dass zur Eröffnungsfeier<br />
Franz Liszts Komposition Licht, mehr Licht für Männerchor, nach einem Text<br />
von Franz von Schober, erklang.) Die Gründung d<strong>es</strong> neuen Museums, welch<strong>es</strong><br />
die Ära Liszts in We<strong>im</strong>ar am authentischen Ort lebendig halten würde, sollte<br />
baldmöglichst erfolgen.<br />
Zunächst jedoch war Liszts Wohnung versiegelt und der Obhut d<strong>es</strong> Großherzoglichen<br />
Hofmarschallamt<strong>es</strong> übergeben worden. Die ersten Verhandlungen<br />
über den in We<strong>im</strong>ar verbliebenen Nachlass d<strong>es</strong> Kompon<strong>ist</strong>en führte der<br />
Großherzog mit der Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein. Sie lebte zurückgezogen<br />
in Rom und bevollmächtigte den Wiener Rechtsanwalt Johann<br />
Brichta, ihre Inter<strong>es</strong>sen in We<strong>im</strong>ar wahrzunehmen. Am 16. August 1886 wurden<br />
die Räume in Anw<strong>es</strong>enheit Brichtas entsiegelt, die t<strong>es</strong>tamentarischen B<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mungen<br />
Liszts bekannt gegeben und die von der Fürstin angeforderten<br />
sämtlichen Briefschaften, Notenmanuskripte und -drucke sowie kleinere Gegenstände<br />
zur Übersendung nach Rom übergeben. Die weiteren Nachlassteile,<br />
auch solche aus dem gemeinsamen B<strong>es</strong>itz Liszts und seiner Lebensgefährtin in<br />
der Altenburg, sollten zunächst in We<strong>im</strong>ar deponiert bleiben.<br />
Auf Vorschlag Brichtas hatten die anw<strong>es</strong>enden Vertreter d<strong>es</strong> Hofmarschallamt<strong>es</strong><br />
und d<strong>es</strong> Amtsgerichts (leider) auf ein Übergabeprotokoll verzichtet. Es<br />
wurde jedoch ein Verzeichnis d<strong>es</strong> Mobiliars und der sonstigen in We<strong>im</strong>ar<br />
verbliebenen Objekte und Ausstattungsgegenstände der Lisztschen Wohnung<br />
angefertigt und in den Akten d<strong>es</strong> Hofmarschallamt<strong>es</strong> protokollarisch niedergelegt.<br />
Unberücksichtigt blieben in di<strong>es</strong>em Inventar Gegenstände aus dem<br />
23 thHStAW, Hofmarschallamt (künftig: HMA), Nr. 2225, Bl. 29 und 31.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
277<br />
Eigentum d<strong>es</strong> großherzoglichen Haus<strong>es</strong>, die dem Künstler für die persönliche<br />
Nutzung zur Verfügung g<strong>es</strong>tellt worden waren. 24<br />
Am 19. November 1886 erging in der Neuen Zeitschrift für Musik ein Aufruf<br />
d<strong>es</strong> ADMV an alle in- und ausländischen Verleger, Freunde und Verehrer<br />
Liszts, »musikalische oder literarische Originalmanuskripte, Compositionen,<br />
Briefe, Verlagswerke in Partitur und St<strong>im</strong>men, literarische Druckwerke, Artikel<br />
in Zeitschriften, Autographien, Bildwerke, Büsten, Medaillons etc.« zur<br />
Errichtung einer Liszt-Bibliothek <strong>im</strong> zukünftigen Liszt-Museum einzusenden.<br />
»Bekanntlich soll nach den Allerhöchsten Intentionen unser<strong>es</strong> Protectors, Sr.<br />
Königl. Hoheit d<strong>es</strong> Grossherzogs von Sachsen, in We<strong>im</strong>ar […] die Hofgärtnerei,<br />
Dr. Franz Liszt’s letzte langjährige Wohnung, zu einem Liszt-Museum,<br />
verbunden mit vollständiger Liszt-Bibliothek zum dauernden Andenken an<br />
den verstorbenen unersetzlichen Me<strong>ist</strong>er eingerichtet werden«, gab »der mit<br />
der Verwaltung betraute Allgemeine Deutsche Musik-Verein« bekannt. 25<br />
Auch in Vorbereitung der Eröffnung d<strong>es</strong> Liszt-Museums hat sich die Zusammenarbeit<br />
zwischen dem Großherzog und dem ADMV, vornehmlich in<br />
G<strong>es</strong>talt sein<strong>es</strong> überaus engagierten Generalsekretärs Carl Gille, als fruchtbar<br />
erwi<strong>es</strong>en. Zahlreiche Originalausgaben, handschriftliche Zeugnisse und Erinnerungsstücke<br />
waren auf den von Riedel und Gille initiierten Aufruf in We<strong>im</strong>ar<br />
eingegangen. Sie bildeten schon bald den beachtlichen Grundstock der<br />
Liszt-B<strong>es</strong>tände <strong>im</strong> zukünftigen Museum. Gille gehörte neben Eduard Lassen<br />
und Alexander Wilhelm Gottschalg zu den ersten Bearbeitern der Musikalienund<br />
Bücherb<strong>es</strong>tände, die schon frühzeitig in Verzeichnissen erfasst wurden. Er<br />
bewirkte auch, dass Mitte März 1887, noch vor der Eröffnung d<strong>es</strong> Museums,<br />
an beiden We<strong>im</strong>arer Wohnstätten Liszts Gedenktafeln angebracht wurden. 26<br />
Später sollte er zum ersten Kustos d<strong>es</strong> Liszt-Museums ernannt werden.<br />
Inzwischen war Carolyne von Sayn-Wittgenstein in Rom verstorben. Im<br />
April 1887 kam ihre Tochter Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst nach We<strong>im</strong>ar,<br />
um an Ort und Stelle die weitere Nachlassregelung vorzunehmen. Mit<br />
großem Inter<strong>es</strong>se verfolgte sie die Vorbereitungen zur Gründung d<strong>es</strong> Liszt-<br />
Museums. Nachdem einzelne, von Liszt selbst verfügte Schenkungen vor allem<br />
an das Ungarische Nationalmuseum in Budap<strong>es</strong>t und an das h<strong>ist</strong>orische Museum<br />
in Wien gegangen waren, übergab sie den g<strong>es</strong>amten in We<strong>im</strong>ar verbliebenen<br />
Nachlass dem Großherzog zur <strong>im</strong>merwährenden Aufbewahrung <strong>im</strong> Liszt-<br />
Museum. Im Jahre 1902, als die Fürstin nach dem Tod Carl Alexanders um<br />
eine Übergabeerklärung ihr<strong>es</strong> Vermächtniss<strong>es</strong> an Großherzog Wilhelm Ernst<br />
ersucht wurde, begründete sie ihre Entscheidung in einem Schreiben an den<br />
damaligen Generalintendanten d<strong>es</strong> Hoftheaters und Vorsitzenden der Liszt-<br />
<strong>Stiftung</strong> mit folgenden Worten:<br />
24 Protokoll, We<strong>im</strong>ar, am 16. August 1886. Ebd., Bl. 54-57.<br />
25 Neue Zeitschrift für Musik 53 (1886), Nr. 47, S. 508.<br />
26 Vgl. GSA 70/37.
278<br />
evelyn liepsch<br />
Als nach dem Tode meiner Mutter […] an mich als Erbin die Aufgabe herantrat,<br />
für die Trophäen der glänzenden Laufbahn d<strong>es</strong> Me<strong>ist</strong>ers eine Stätte<br />
zu suchen, fand ich keine würdigere, als das pietätvolle We<strong>im</strong>ar, welch<strong>es</strong> die<br />
Erinnerung an große Männer ein<strong>es</strong> früheren Jahrhunderts hütete und ehrte.<br />
D<strong>es</strong>halb übergab ich vertrauensvoll die betreffenden Sammlungen Liszts<br />
hohem Freunde und Gönner, Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog Carl<br />
Alexander, höchstd<strong>es</strong>sen Dienste Liszt die gehaltvollsten Jahre sein<strong>es</strong> lebens<br />
gewidmet hatte. 27<br />
Die Fürstin hatte viele Briefe und Notenmanuskripte Liszts aus dem Nachlass<br />
ihrer Mutter zurück nach We<strong>im</strong>ar g<strong>es</strong>andt. Auch später überwi<strong>es</strong> sie noch<br />
weitere Schriftstücke und Erinnerungsdokumente. Die umfangreichste Sendung<br />
von Manuskripten, Diplomen, Konzertprogrammen, Bildnissen und<br />
Büchern sollte das Liszt-Museum <strong>im</strong> Jahre 1903 erreichen.<br />
Am 22. Mai 1887 feierten Freunde und Schüler Liszts gemeinsam mit dem<br />
Großherzog, der Großherzogin und weiteren Repräsentanten d<strong>es</strong> Hof<strong>es</strong> die<br />
Einweihung d<strong>es</strong> Liszt-Museums. Zu den Gästen gehörten Graf von Beust,<br />
Staatsmin<strong>ist</strong>er Dr. Gottfried Theodor Stichling, Hofkapellme<strong>ist</strong>er Lassen und<br />
eine Abordnung der Hofkapelle, das Direktorium d<strong>es</strong> ADMV und viele Künstler<br />
aus dem ehemaligen We<strong>im</strong>arer Umkreis Liszts. Unter ihnen waren das<br />
Künstlerehepaar Feodor und Rosa von Milde, die Sängerin Emilie Merian-<br />
Genast und die Pian<strong>ist</strong>innen und Pian<strong>ist</strong>en Anna und Helene Stahr, Conrad<br />
Ansorge und William Dayas. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung<br />
hatten Sol<strong>ist</strong>en der Großherzoglichen Musikschule unter der Leitung von Carl<br />
Müllerhartung übernommen. Zu Beginn erklang das Grablied (Pilger auf Erden<br />
…) von Peter Cornelius, am Schluss Franz Liszts Ave Maria. Der Dr<strong>es</strong>dner<br />
Schriftsteller und Direktoriumsvertreter d<strong>es</strong> ADMV Adolf Stern hielt die Ansprache.<br />
In bewegenden Worten gedachte er der unverg<strong>es</strong>slichen Begegnungen<br />
mit dem Künstler, der noch vor wenigen Monaten die jetzigen Museumsräume<br />
bewohnt hatte. Die denkwürdige Gründung d<strong>es</strong> Liszt-Museums betrachtete er<br />
<strong>im</strong> ideellen Zusammenhang mit der zweiten Jahr<strong>es</strong>versammlung der Goethe-<br />
G<strong>es</strong>ellschaft. Di<strong>es</strong>e hatte einen Tag zuvor in We<strong>im</strong>ar getagt. Stern habe als<br />
Teilnehmer der Versammlung erfahren, teilt die We<strong>im</strong>arische Zeitung aus seiner<br />
Rede mit,<br />
in wie leuchtender G<strong>es</strong>talt, in wie überwältigender Deutlichkeit uns das Gew<strong>es</strong>ene<br />
wiederum nahe treten kann. […] Wer g<strong>es</strong>tern recht inne geworden,<br />
was We<strong>im</strong>ars große Vergangenheit sei, dürfe heute auch einer jüngeren Vergangenheit<br />
gedenken, an die der 22. Mai, der Geburtstag Richard Wagners<br />
gemahne, d<strong>es</strong> Künstlers, dem Liszt wie keinem anderen verbunden gew<strong>es</strong>en<br />
sei, d<strong>es</strong>sen Werke von hier aus ihren Sieg<strong>es</strong>zug in die Welt angetreten hätten.<br />
27 Marie von Hohenlohe-Schillingsfürst an Hippolyt von Vignau, 24. April 1902<br />
(Abschrift). thHStAW, HMA, Nr. 2225, Bl. 277 f.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
279<br />
Abb. 2<br />
Anzeige zur Eröffnung d<strong>es</strong> Liszt-Museums (daneben Anzeige d<strong>es</strong><br />
Goethe-Nationalmuseums) in der We<strong>im</strong>arischen Zeitung, 24. Juni 1887<br />
Liszt habe schon 1850 be<strong>im</strong> Herder-F<strong>es</strong>t und der ersten Aufführung d<strong>es</strong><br />
»Lohengrin« prophetisch verkündet, daß sich ein neu<strong>es</strong> Leben an das alte<br />
schließen, daß We<strong>im</strong>ar seine großen Erinnerungen pflegen und mit frischer<br />
Jugend nach neuen streben werde. Ueber di<strong>es</strong>e Stunde hinaus wage der Redner<br />
zu sagen, daß eine Zeit kommen werde, die in anderm und doch verwandtem<br />
<strong>Sinne</strong> der Tage Karl Alexanders und Sophiens gedenken müsse,<br />
wie eine dankbare Nachwelt der leuchtend herrlichen Tage Karl Augusts<br />
und Luisens gedenkt. 28<br />
Anschließend an die Rede Sterns enthüllte Carl Gille eine Marmorbüste Liszts.<br />
Sie war <strong>im</strong> Auftrag d<strong>es</strong> ADMV von Adolf Lehnert g<strong>es</strong>chaffen worden. Liszt<br />
hatte dem Bildhauer noch am 20. Juni 1886 Modell g<strong>es</strong><strong>es</strong>sen. Ursprünglich<br />
sollte die Büste ihren Platz in der Großherzoglichen Bibliothek in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft zu den anderen Ge<strong>ist</strong><strong>es</strong>größen We<strong>im</strong>ars erhalten. Nun<br />
wurde sie dem Großherzog als Ehrengabe überreicht, der sie schon bald <strong>im</strong> neu<br />
gegründeten Liszt-Museum aufstellen ließ. Am 24. Juni 1887, dem Geburtstag<br />
Carl Alexanders, wurde das Haus eröffnet (Abb. 2).<br />
Das Museum b<strong>es</strong>tand aus den drei ehemaligen Wohnräumen Liszts in der<br />
ersten Etage der Hofgärtnerei, dem Salon (Liszts Wohn- und Arbeitsz<strong>im</strong>mer),<br />
dem Speisez<strong>im</strong>mer und dem Schlafz<strong>im</strong>mer. Salon und Schlafz<strong>im</strong>mer waren<br />
weit<strong>es</strong>tgehend in ihrem ursprünglichen Einrichtungszustand belassen worden.<br />
In dem prachtvollen, durch eine zweiteilige Portiere getrennten Wohn- und<br />
Arbeitsz<strong>im</strong>mer spürte man die b<strong>es</strong>ondere Aura d<strong>es</strong> Ort<strong>es</strong>. Der Flügel d<strong>es</strong> Berliner<br />
Klavierbauers Carl Bechstein und das Klavier der Firma »Rud. Ibach<br />
28 Liszt-Feier. In: We<strong>im</strong>arische Zeitung Nr. 119, 24. Mai 1887.
280<br />
evelyn liepsch<br />
Sohn« aus Barmen, einst dem Pian<strong>ist</strong>en von den Firmeninhabern g<strong>es</strong>tellt und<br />
von so vielen seiner begabten Schüler aus aller Welt genutzt, waren inzwischen<br />
dem Liszt-Museum überwi<strong>es</strong>en worden.<br />
Das Speisez<strong>im</strong>mer hatte der Großherzog in den eigentlichen Museumsraum<br />
umg<strong>es</strong>talten lassen. Di<strong>es</strong>e Aufgabe war seinem Hausmarschall Graf von Wedel<br />
zugekommen, der sich in vielen konzeptionellen Fragen mit Gille, Lassen und<br />
dem ersten Direktor d<strong>es</strong> neu gegründeten Goethe-Nationalmuseums, Carl<br />
ruland, beriet. Ein Teil d<strong>es</strong> neuen Interieurs stammte aus dem früheren We<strong>im</strong>arer<br />
B<strong>es</strong>itz Franz Liszts und der Fürstin Wittgenstein. Bei ihrem Auszug<br />
1860/61 aus der Altenburg hatten sie mehrere K<strong>ist</strong>en mit Briefen, Büchern,<br />
Notenausgaben, Büsten, Gemälden und kunstgewerblichen Gebrauchsgegenständen<br />
gepackt und zusammen mit einigen Möbelstücken auf unb<strong>es</strong>t<strong>im</strong>mte<br />
Zeit in We<strong>im</strong>ar deponiert. Ein Teil der Gegenstände wurde <strong>im</strong> Privathaus von<br />
Rosine Walther eingelagert, ein weiterer Teil dem Hofmarschallamt zur Aufbewahrung<br />
übergeben. 29<br />
Im ehemaligen Speisez<strong>im</strong>mer (Abb. 3) war nun Liszts Boisselot-Flügel aus<br />
dem blauen Salon der Altenburg aufg<strong>es</strong>tellt. Der Wiener Mäzen Nikolaus<br />
Dumba hatte für di<strong>es</strong><strong>es</strong> Instrument wie für den Flügel <strong>im</strong> Salon vitrinenartige<br />
Aufsätze anfertigen lassen, die Ausstellungsflächen für Autografen, Diplome<br />
und kleinere Sammlungsgegenstände boten. Auf dem Boisselot-Flügel waren<br />
nun mehrere Manuskripte Liszts, darunter eigenhändige Partituren seiner<br />
Symphonischen Dichtungen, Briefe d<strong>es</strong> Kompon<strong>ist</strong>en, der Abguss seiner rechten<br />
Hand und eine plastische Abformung der aufeinanderliegenden Hände<br />
Liszts und Carolyn<strong>es</strong> zu sehen. Eine Vielzahl von Bildnissen, Büsten, Reliefs,<br />
Medaillons und verschiedenartige andere Ehrengaben und Pretiosen, die Liszt<br />
in seinem Leben empfangen hatte, waren in Glasschränken und an den Wänden<br />
ausg<strong>es</strong>tellt.<br />
Das Hofmarschallamt hatte die Aufsicht und Fremdenführung <strong>im</strong> Museum<br />
zunächst drei Personen übertragen: den Hofmarschallamtsdienern Weißleder<br />
und Knabe sowie Pauline Apel, Liszts langjähriger Haushälterin in der Hofgärtnerei<br />
und vormaliger Dienerin der Fürstin Wittgenstein in der Altenburg.<br />
Sie nahm sich di<strong>es</strong>er Aufgabe mit b<strong>es</strong>onderem Eifer an. Bis zum 6. August<br />
waren 106 Eintrittskarten zu je 50 Pfennigen verkauft. Die Öffnungszeiten<br />
wurden nun täglich um eine Stunde erweitert. Schließlich war <strong>es</strong> <strong>im</strong> Dezember<br />
1887 schon möglich, von »11 bis 1 Uhr vormittag« und »von 3 bis 5 Uhr nachmittag«<br />
das Museum zu b<strong>es</strong>uchen. 30 Die Führungen hatte man ab 12. Dezember<br />
offiziell allein Pauline Apel erlaubt.<br />
29 Vgl. Evelyn Liepsch: Ergebnis der Nachforschungen. Neue Fragen zur We<strong>im</strong>arer<br />
Nachlaßg<strong>es</strong>chichte. In: Mária Eckhardt, Evelyn Liepsch: Franz Liszts We<strong>im</strong>arer<br />
Bibliothek (We<strong>im</strong>arer Liszt-Studien, Bd. 2). Laaber 1999, S. 59-62 und thHStAW,<br />
HMA, Nr. 2225, Bl. 87.<br />
30 Bekanntmachung (Konzept). thHStAW, HMA, Nr. 2225, Bl. 86.
zur gründung d<strong>es</strong> we<strong>im</strong>arer liszt-museums<br />
281<br />
Abb. 3<br />
Liszt-Museum in We<strong>im</strong>ar; Blick in das ehemalige Speisez<strong>im</strong>mer, <strong>im</strong> Vordergrund der<br />
Flügel der Firma »Boisselot & Fils«, an dem Liszt mit Vorliebe komponierte, vor 1900<br />
Mit der Gründung d<strong>es</strong> Museums waren ind<strong>es</strong> noch weitere w<strong>es</strong>entliche<br />
Aufgaben verbunden. Neben der pietätvollen Bewahrung und Erhaltung der<br />
Liszt-B<strong>es</strong>tände hatte der Großherzog schon frühzeitig ihre wissenschaftliche<br />
Betreuung angeregt. Im August 1887 erarbeitete Hofrevisor Neumann <strong>im</strong> Auftrag<br />
d<strong>es</strong> Hofmarschallamt<strong>es</strong> die ersten vollständigen Inventarverzeichnisse d<strong>es</strong><br />
Liszt-Museums. 31 Die früh<strong>es</strong>te Führungsschrift legte der We<strong>im</strong>arer Schriftsteller<br />
Adolf Mirus vor. Sie erschien <strong>im</strong> Jahre 1889 unter dem Titel Ueber das<br />
Liszt-Museum zu We<strong>im</strong>ar bei Ludwig Thelemann in We<strong>im</strong>ar. 1891 ernannte<br />
der Großherzog einen Kustos für das Museum. Carl Gille, der sich von<br />
Anbeginn um di<strong>es</strong>e Einrichtung verdient gemacht hatte, wurde für das Amt<br />
ausgewählt. Er solle »darüber wachen«, heißt <strong>es</strong> in der Verfügung d<strong>es</strong> Hofmarschallamt<strong>es</strong>,<br />
»daß das Museum, seiner Bedeutung und den bei seiner<br />
Gründung ang<strong>es</strong>trebten idealen Zwecken entsprechend, als eine bleibende Erinnerungsstätte<br />
an Liszt erhalten werde«. 32 Neben der Wahrnehmung der<br />
31 thHStAW, Departement d<strong>es</strong> Kultus 314-316.<br />
32 thHStAW, HMA, Nr. 2225, Bl. 114.
282<br />
evelyn liepsch<br />
technisch-musealen Aufgaben war Gille für die kontinuierliche Anreicherung<br />
der B<strong>es</strong>tände und die Verzeichnung der Neuzugänge zuständig. Er unterstützte<br />
verschiedene Publikationen, beispielsweise die von Marie Lipsius herausgegebene<br />
Liszt-Briefausgabe, 33 klärte Fragen der Veröffentlichungsrechte mit<br />
den Heraus gebern und Verlegern und vertrat die Inter<strong>es</strong>sen d<strong>es</strong> Museums in<br />
Verbindung mit seinen Funktionen <strong>im</strong> ADMV und <strong>im</strong> Kuratorium der Liszt-<br />
<strong>Stiftung</strong>. Seine Amtsnachfolger waren Carl Müllerhartung (1899-1902), Aloys<br />
Obr<strong>ist</strong> (1902-1910) und Peter Raabe (1910-1920). Im Jahre 1920 wurden die<br />
Aufsicht über das Liszt-Museum und seine B<strong>es</strong>tände der Direktion d<strong>es</strong> Goethe-<br />
National museums übertragen.<br />
33 La Mara [Marie Lipsius] (Hrsg.): Franz Liszts Briefe. 8 Bde. Leipzig 1893-1905.
Bildnachweis<br />
Archiv Bauaufsichtsamt We<strong>im</strong>ar: S. 302, 310 (Tafel 9)<br />
Archiv Stefan Renno: S. 281, 328<br />
<strong>Klassik</strong> <strong>Stiftung</strong> We<strong>im</strong>ar: Frontispiz, S. 18 bis 20, 34 bis 37, 82, 85, 91, 98, 101 bis<br />
104 (Tafel 1 bis 5), 149, 151, 161, 168, 186, 188, 191, 192, 196, 209, 212, 233,<br />
234, 241, 268, 279, 286, 302, 309 (Tafel 6), 311 (Tafel 10), 312 (Tafel 11 und<br />
12), 327, 340, 344, 355 bis 357, 359, 363, 371, 377 bis 379, 381 bis 384 ( Ta -<br />
fel 13 bis 17), 388, 389<br />
Neue Pinakothek München: S. 347<br />
Stadtarchiv We<strong>im</strong>ar: S. 198, 303, 350<br />
Stadtmuseum We<strong>im</strong>ar: S. 353<br />
Thüringisch<strong>es</strong> Hauptstaatsarchiv We<strong>im</strong>ar: S. 251, 305, 309 (Tafel 7), 310 (Tafel 8)
Erstpublikation<br />
Evelyn Liepsch: »Im <strong>Sinne</strong> Liszts <strong>ist</strong> <strong>es</strong> gehandelt«. Zur Gründung der<br />
Liszt-<strong>Stiftung</strong> und d<strong>es</strong> We<strong>im</strong>arer Liszt-Museums.<br />
In: Hellmut Th. Seemann, Thorsten Valk (Hrsg.): Das Zeitalter der<br />
Enkel. Kulturpolitik und <strong>Klassik</strong>rezeption unter Carl Alexander.<br />
Jahrbuch der <strong>Klassik</strong> <strong>Stiftung</strong> We<strong>im</strong>ar 2010. Göttingen: Wallstein<br />
Verlag 2010, S. 267–282.