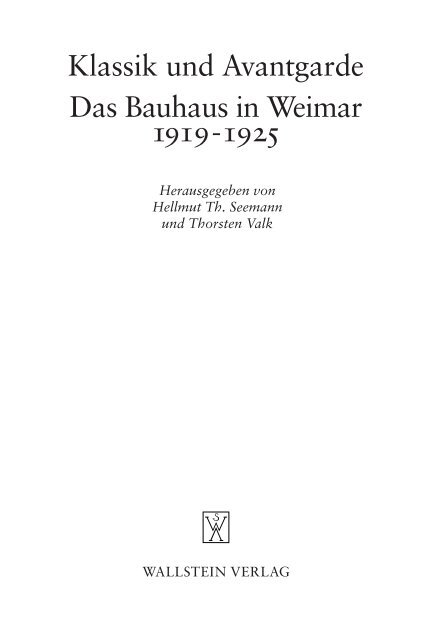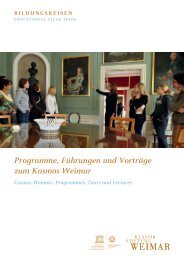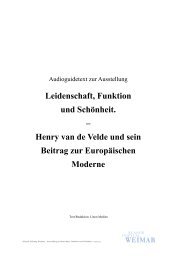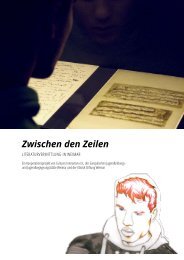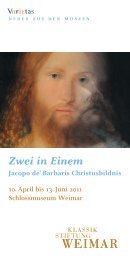einfachste Körperform. Zur Rezeption von Goethes Gartenhaus in ...
einfachste Körperform. Zur Rezeption von Goethes Gartenhaus in ...
einfachste Körperform. Zur Rezeption von Goethes Gartenhaus in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Klassik und Avantgarde<br />
Das Bauhaus <strong>in</strong> Weimar<br />
1919-1925<br />
Herausgegeben <strong>von</strong><br />
Hellmut Th. Seemann<br />
und Thorsten Valk<br />
Wallste<strong>in</strong> Verlag
Wolfgang Pehnt<br />
Blutwarmes Leben – <strong>e<strong>in</strong>fachste</strong> Körperform<br />
<strong>Zur</strong> <strong>Rezeption</strong> <strong>von</strong> <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong><br />
<strong>in</strong> Zeiten des Bauhauses 1<br />
»Das Goethe-<strong>Gartenhaus</strong> zeichnet man nicht, es ist schon zu oft geschehen«,<br />
befand die Bauhaus-Schüler<strong>in</strong> Lou Scheper-Berkenkamp <strong>in</strong> ihrer humoristischen<br />
Übersichtskarte <strong>von</strong> Weimar unter besonderer Berücksichtigung se<strong>in</strong>er<br />
Kulturstätten aus dem Jahre 1924. 2 In der Tat war diese Ikone des Goethe-<br />
Kultes wieder und wieder gezeichnet, radiert, lithografiert und fotografiert<br />
worden und wurde es auch weiterh<strong>in</strong> (Abb. 1). Auch das Missvergnügen e<strong>in</strong>er<br />
jungen Bauhäusler<strong>in</strong> änderte nichts an der steilen publizistischen Karriere des<br />
<strong>Gartenhaus</strong>es. Es gehöre »zu dem unberührbaren Bestand dessen <strong>in</strong> Deutschland,<br />
das man sich für die Ewigkeit geweiht vorzustellen liebt, weil es e<strong>in</strong>e letzte<br />
Innigkeit deutschen Wesens auszudrücken sche<strong>in</strong>t!«, me<strong>in</strong>te zwei Jahre später<br />
Hans Wahl, Direktor des Goethe-Nationalmuseums. 3<br />
Der Dichter war <strong>in</strong> das Haus »an der Ilm schönen Wiesen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Thale« 4<br />
im April 1776 e<strong>in</strong>gezogen. Sechs Jahre lang hatte er es als ständigen, wenn auch<br />
nicht alle<strong>in</strong>igen Wohnsitz benutzt und später als idyllischen Zufluchtsort. Seit<br />
es 1841 für den Besucherverkehr freigegeben und nach dem Tode des Goethe-<br />
1 Annemarie Jaeggi und Wolfgang Voigt b<strong>in</strong> ich für H<strong>in</strong>weise und Ratschläge dankbar.<br />
Dem Thema g<strong>in</strong>g Voigt bereits 1992 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em umfangreichen, auf Paul Schmitthenner<br />
zentrierten Aufsatz nach: Vom Ur-Haus zum Typ. Paul Schmitthenners ›deutsches<br />
Wohnhaus‹ und se<strong>in</strong>e Vorbilder. In: Vittorio Magnago Lampugnani, Romana Schneider<br />
(Hrsg.): Moderne Architekur <strong>in</strong> Deutschland 1900 bis 1950. Reform und Tradition.<br />
Stuttgart 1992, S. 244-265.<br />
2 Reproduziert <strong>in</strong>: Jeann<strong>in</strong>e Fiedler, Peter Feierabend (Hrsg.): Bauhaus. Köln 1999,<br />
S. 33. H<strong>in</strong>weis <strong>von</strong> Annemarie Jaeggi. – Als frühe Abbildung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fachpublikation<br />
nennt Kai K. Gutschow die Süddeutsche Bauzeitung 15 (1905), S. 145; The<br />
Anti-Mediterranean <strong>in</strong> the Literature of Modern Architecture. Paul Schultze-Naumburg’s<br />
Kulturarbeiten. Carnegie Mellon University, 10. August 2006. In: Jean-François<br />
Lejeune, Michelangelo Sabat<strong>in</strong>o (Hrsg.): North-South. The Mediterranean Ideal<br />
<strong>in</strong> Modern Architecture. New York (<strong>in</strong> Vorbereitung).<br />
3 Hans Wahl: <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>. Leipzig o. J. [1926], S. 3.<br />
4 Johann Wolfgang Goethe an Auguste <strong>von</strong> Stolberg, 17.-24. Mai 1776. In: <strong>Goethes</strong><br />
Werke (Weimarer Ausgabe, künftig: WA). 143 Bde. Hrsg. im Auftrag der Großherzog<strong>in</strong><br />
Sophie <strong>von</strong> Sachsen. Weimar 1887-1919. Nachdruck: München 1987. Bd. 144-<br />
146: Nachträge und Register zur IV. Abt. Briefe Bd. 1-3. Hrsg. <strong>von</strong> Paul Raabe.<br />
München 1990. IV, 3, S. 64.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
69<br />
Abb. 1: <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>, Weimar, Foto 2000
70 wolfgang pehnt<br />
Enkels Walther im Jahre 1885 vollends zur öffentlichen Gedenkstätte wurde, 5<br />
gewann die touristische Attraktion auch e<strong>in</strong>en kulturpolitischen Stellenwert. In<br />
den Reformbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts spielte sie e<strong>in</strong>e tragende<br />
Rolle. Von konservativen Zeitgenossen wurde das Haus <strong>in</strong> den 1920er und<br />
30er Jahren gern als Argument gegen die ungeliebte Moderne benutzt, als »Ur-<br />
Ausdruck e<strong>in</strong>es Hauses«, 6 enthoben allen modischen Wandels.<br />
Unüberbrückbarer Abgrund<br />
Der räumlich nächste Adressat der Moderne-Kritik war das Weimarer Bauhaus,<br />
das e<strong>in</strong>e Stellvertreter-Rolle für die neue Zeit zu übernehmen begann und<br />
entsprechende Angriffe auf sich zog. »Goethehaus und Bauhaus s<strong>in</strong>d zwei<br />
fe<strong>in</strong>dliche Lager, deren politische Fehde das Leben im Geme<strong>in</strong>wesen an der Ilm<br />
oft pe<strong>in</strong>lich erschwert.« 7 Wege, die Lehrer und Schüler zwischen den verschiedenen<br />
Standorten der Bauhaus-Institute zurücklegten und Moderne-Interessenten<br />
wie Goethe-Touristen e<strong>in</strong>schlugen, kreuzten sich <strong>in</strong> der überschau baren<br />
Mittelstadt vielfach. Anlässe zur kritischen Gegenüberstellung waren daher<br />
ständig gegeben. So schrieb die Deutsche Bauzeitung, als 1922 die Pläne für<br />
e<strong>in</strong>e Bauhaus-Siedlung Am Horn bekannt wurden: »Goethe und die alten Meister<br />
würden sonderbare Augen machen beim Anblick dieser Bauhaus-Siedlung,<br />
und mit Recht dürfte Altmeister Goethe ausrufen: Habt ihr es noch nicht<br />
weitergebracht?« 8<br />
Die Frage wurde erst recht gestellt, als das Musterhaus Am Horn nach e<strong>in</strong>em<br />
Entwurf <strong>von</strong> Georg Muche entstand, realisiert vom Bauatelier Gropius unter<br />
der technischen Leitung <strong>von</strong> Adolf Meyer mit Walter March (Abb. 2). Das<br />
Versuchshaus stellte das größte Exponat der Bauhaus-Ausstellung <strong>von</strong> 1923<br />
dar. Als öffentlich begehbares Anschauungsobjekt war es das vor Ort anschaulichste<br />
Zeugnis e<strong>in</strong>er neuen Bauges<strong>in</strong>nung. Auf dem Wege dorth<strong>in</strong> durchquerte<br />
5 Vgl. Ernst Gerhard-Güse, Margarete Oppel: <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>. Weimar 2008.<br />
6 He<strong>in</strong>rich Tessenow: Der Wohnhausbau. München 2 1914, S. 7. Vgl. Marco De Michelis:<br />
He<strong>in</strong>rich Tessenow 1876-1950. Stuttgart 1991, S. 59.<br />
7 Gisella Selden-Goth: Das andere Weimar. In: Prager Tageblatt, 26. August 1923. –<br />
Die meisten hier benutzten Pressestimmen zur Bauhaus-Ausstellung <strong>von</strong> 1923 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
drei Mappen mit Zeitungsausschnitten im Bauhaus-Archiv Berl<strong>in</strong> gesammelt (GS 10/<br />
Mappe 75, Zeitungsausschnitte über Bauhaus-Ausstellung Sommer 1923/I und II).<br />
H<strong>in</strong>weis auf das Material <strong>von</strong> Annemarie Jaeggi. Auszüge veröffentlicht bei Christian<br />
Wolsdorff: Das ›Haus am Horn‹ im Spiegel der Presse. In: Magdalena Droste,<br />
Christian Wolsdorff, Bauxi Mang (Hrsg.): Georg Muche. Das künstlerische Werk<br />
1912-1927. Berl<strong>in</strong> 1980, S. 31 ff.<br />
8 A. Buschmann: Die Bauhaus Siedlung <strong>von</strong> Walter Gropius <strong>in</strong> Weimar. In: Deutsche<br />
Bauzeitung 56 (1922), H. 64, S. 392.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
71<br />
Abb. 2: Georg Muche (Entwurf), Bauatelier Walter Gropius unter Leitung<br />
<strong>von</strong> Adolf Meyer, Haus Am Horn, Weimar, 1923<br />
fast jeder Besucher, der aus der Stadt kam, »<strong>Goethes</strong> seligen Park« an der Ilm<br />
und wanderte »an <strong>Goethes</strong> stillem <strong>Gartenhaus</strong>« vorüber. 9 Daher lud das Musterhaus,<br />
nur wenige hundert Meter vom »alten Hausgen« im »lieben Gärtgen<br />
vorm Thore« 10 entfernt, zum Vergleich geradezu e<strong>in</strong>: e<strong>in</strong>geschossiger Flachbau<br />
mit erhöhter Gadenzone über dem zentralen Wohnraum gegen zweistöckigen<br />
Hausquader unter holzsch<strong>in</strong>delgedecktem Walmdach, Experimentalbaustelle<br />
mit <strong>in</strong>dustriellen Fertigfabrikaten gegen die Handwerkstradition <strong>von</strong> »hohem<br />
Dach und niedrem Haus« 11 .<br />
Das »weiße Würfelhaus« <strong>von</strong> 1923 hatte <strong>in</strong> dieser Gegenüberstellung wenig<br />
Chancen auf wohlwollende Beurteilung. Rezensenten fanden es »für Menschen<br />
mit Nerven glatt unbewohnbar«, fühlten sich an das »Sammelbecken e<strong>in</strong>er<br />
Hochdruckwasserleitung« er<strong>in</strong>nert oder gar an »jene Häuschen auf öffentlichen<br />
Plätzen, die […] auf der e<strong>in</strong>en Seite ›für Herren‹, auf der anderen ›für<br />
9 Zit. bei A. Ho.: Die Bauhauswoche <strong>in</strong> Weimar. In: Neue Hessische Volksblätter.<br />
Darmstadt, 17. August 1923; Egbert Delpy: Die Weimarer Bauhaus Ausstellung. In:<br />
Leipziger Neueste Nachrichten, 22. August 1923.<br />
10 Johann Wolfgang Goethe an Auguste <strong>von</strong> Stolberg, 17.-24. Mai 1776. In: WA IV, 3,<br />
S. 64.<br />
11 Johann Wolfgang Goethe, 1828. Handschriftliche Zeile unter e<strong>in</strong>er Radierung nach<br />
Otto Wagner. In: WA I, 4, S. 142.
72 wolfgang pehnt<br />
Damen‹ zugänglich s<strong>in</strong>d«. 12 Dass die Konfrontation auch bei freundlichen Beobachtern<br />
nicht zugunsten des neuen Gebäudes ausg<strong>in</strong>g, belegt die Reaktion<br />
des Architekturtheoretikers und -lehrers Paul Klopfer, der als Direktor der Weimarer<br />
Baugewerkenschule Lehrveranstaltungen auch für Bauhäusler hielt:<br />
Me<strong>in</strong> Heimweg führte mich an <strong>Goethes</strong> Gartenhäuschen vorbei. Wie <strong>in</strong>nig<br />
wuchs es heraus, aus dem Wiesenplan im Vere<strong>in</strong> mit den hohen Bäumen und<br />
dem Berghang dah<strong>in</strong>ter. In e<strong>in</strong>er Frühl<strong>in</strong>gsnacht schlug dort die Nachtigall<br />
[…] All dieses urwüchsige, heimliche, heimatliche Kulturhafte fehlt dem<br />
Gropiushaus – <strong>in</strong> der Kühle se<strong>in</strong>er <strong>in</strong>neren und äußeren Ersche<strong>in</strong>ung hat es<br />
nichts mit Nachtigallen zu tun. 13<br />
Anwälte des Neuen wie Sigfried Giedion und Adolf Behne äußerten E<strong>in</strong>wände<br />
<strong>von</strong> der anderen Seite her. Giedion beklagte die mangelnde Öffnung des <strong>in</strong>trovertierten<br />
Hauses zum Außenraum h<strong>in</strong>. Behne fand den um den höheren Mittelraum<br />
geordneten Grundriss zwanghaft und wünschte sich e<strong>in</strong> dynamischeres,<br />
funktionales Bauen, wie es gleichzeitig <strong>in</strong> manchen Beispielen der Internationalen<br />
Architektur-Ausstellung zu sehen sei. 14 Angesichts dieser fatalen Reaktion<br />
unterschiedlichster Parteigänger nimmt es nicht Wunder, dass Gropius sich<br />
bei der New Yorker Bauhaus-Ausstellung <strong>von</strong> 1938 der Äußerung »e<strong>in</strong>er jungen<br />
unvore<strong>in</strong>genommenen Kanadier<strong>in</strong>« entsann, die, endlich, e<strong>in</strong>en positiven<br />
Vergleich zwischen Goethe- und Musterhaus zog. <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>, habe<br />
Miss G. Wookey <strong>von</strong> der Universität Toronto bemerkt, sei das e<strong>in</strong>zige Gebäude<br />
<strong>in</strong> ganz Weimar, »das e<strong>in</strong>e gewisse kongeniale Verwandtschaft zum Bauhaus<br />
aufwiese«. 15<br />
In der Kulturpropaganda völkisch-nationaler Kreise machte das <strong>Gartenhaus</strong><br />
Karriere als Inbegriff bürgerlich-deutscher Bescheidenheit, an dem die Produktionen<br />
der neuen Zeit gemessen wurden. E<strong>in</strong>er, der ihm zu dieser Rolle verhalf,<br />
war der Maler, Architekt und Kulturschriftsteller Paul Schultze-Naumburg, der<br />
früh <strong>in</strong> Weimar gebaut hatte und <strong>von</strong> 1930 bis 1940 die Vere<strong>in</strong>igten Kunstlehranstalten<br />
Weimar, e<strong>in</strong>e Nachfolgeanstalt des Bauhauses, leitete. In den Kulturarbeiten,<br />
se<strong>in</strong>em verdienstvollen publizistischen Frühwerk, das sich im S<strong>in</strong>ne<br />
<strong>von</strong> Dürerbund und Heimatschutz für die Erhaltung der Kulturlandschaften<br />
12 A. Ho: Die Bauhauswoche <strong>in</strong> Weimar (Anm. 9); Fritz Stahl: Das Musterhaus. In:<br />
Berl<strong>in</strong>er Tageblatt, 28. August 1923; ohne Verf.: Das Bauhaus. In: Mitteldeutsche<br />
Zeitung. Erfurt, 27. August 1923; ohne Verf.: Viel Lärm um Nichts. In: Jenaische<br />
Zeitung, 16. August 1923, Fränkischer Courier, Nürnberg, 21. August 1923.<br />
13 Zit. bei Konrad Nonn: Das Staatliche Bauhaus <strong>in</strong> Weimar. In: Zeitschrift der Bauverwaltung<br />
44 (1924), H. 6, S. 44.<br />
14 Sigfried Giedion: Bauhaus und Bauhauswoche zu Weimar. In: Das Werk. September<br />
1923; Adolf Behne: Das Musterwohnhaus der Bauhaus-Ausstellung. In: Die Bauwelt<br />
14 (1923), H. 41.<br />
15 Herbert Bayer, Walter Gropius, Ise Gropius (Hrsg.): 1919 Bauhaus 1928. Zit. nach<br />
der deutschen Ausgabe Stuttgart 1955, S. 83.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
73<br />
e<strong>in</strong>setzte, spielte das <strong>Gartenhaus</strong> bereits e<strong>in</strong>e Rolle. Schultze-Naumburg bildete<br />
es allerd<strong>in</strong>gs nicht als Ganzes ab, obwohl es als positives Beispiel <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e argumentative<br />
Konfrontation guter, das heißt bei Schultze-Naumburg vor<strong>in</strong>dustrieller,<br />
Bauten mit verderbten Baulichkeiten des späteren 19. und frühen 20. Jahrhunderts<br />
vorzüglich gepasst hätte.<br />
Aber pars pro toto war das <strong>Gartenhaus</strong> doch vertreten, mit dem Gartentor,<br />
das Goethe sich vom großherzoglichen Oberbaudirektor Clemens Wenzeslaus<br />
Coudray noch zwei Jahre vor se<strong>in</strong>em Tode hatte entwerfen lassen: »Man zeige<br />
mir <strong>in</strong> der ganzen Welt e<strong>in</strong>e zweite Tür, die mehr dem S<strong>in</strong>n entspricht, als<br />
freundlicher Zugang zu e<strong>in</strong>em heiteren Garten zu dienen und die dabei mehr<br />
dem Material – dem durch Farbe geschützten Holz – entspricht«. Der Autor<br />
setzte noch e<strong>in</strong>s darauf: Es sei für ihn das schönste Bild, das er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Foto-<br />
Sammlung besitze. 16 E<strong>in</strong> anderes <strong>Goethes</strong>ches <strong>Gartenhaus</strong>, das an der rückwärtigen<br />
Gartenmauer des Hauses am Frauenplan, fand gleichfalls E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong><br />
Schultze-Naumburgs Kulturfeldzug. 17<br />
In den 1920er und 30er Jahren verschärften sich die Fehden, <strong>in</strong> denen den<br />
Neuerern das <strong>Gartenhaus</strong> als Muster vorgehalten wurde. Die damals konservative<br />
Fachzeitschrift Baumeister suchte im ersten Heft des Jahrgangs 1934 ihre<br />
künftige Redaktionspolitik im Dritten Reich zu def<strong>in</strong>ieren und illustrierte den<br />
Leitartikel ihres Hauptschriftleiters Guido Harbers mit mehreren Abbildungen<br />
und maßgerechten Plänen dieses »S<strong>in</strong>nbildes notwendiger geistiger Sammlung<br />
und körperlicher Erholung«. Das eigene Heim werde wieder zum Ziel staatlicher<br />
Kulturpolitik, »bei voller Freiheit der <strong>in</strong>neren organischen Entwicklung«. 18<br />
Gründlicher kann man sich nicht irren.<br />
E<strong>in</strong>en Höhepunkt erreichte der propagandistische Diskurs mit dem <strong>Gartenhaus</strong><br />
auf dem Panier bei Paul Schmitthenner. In dessen Baugestaltung <strong>von</strong><br />
1932, später mit dem zunächst als Untertitel verwendeten Begriff Das deutsche<br />
Wohnhaus als Haupttitel, figurierte e<strong>in</strong>e sonnendurchstrahlte Aufnahme des<br />
<strong>Gartenhaus</strong>es gegenüber der dräuenden Abbildung e<strong>in</strong>er »Wohnmasch<strong>in</strong>e«, die<br />
sich als Hans Scharouns kle<strong>in</strong>e Villa <strong>in</strong> der Stuttgarter Weißenhofsiedlung<br />
(1927) entpuppt. Schmitthenner, neben Paul Bonatz Haupt der sogenannten<br />
Stuttgarter Schule, hatte Anlass, den Architekten der Siedlung zu grollen. An<br />
der prestigeträchtigen Werkbund-Veranstaltung auf dem Weißenhof waren weder<br />
Bonatz noch er selbst beteiligt worden – und das <strong>in</strong> ihrem Lehr- und Wohnort<br />
Stuttgart. So konstatierte Schmitthenner nicht weniger als e<strong>in</strong>e »Menschheitsfrage«:<br />
»Von <strong>Goethes</strong> Haus zur Wohnmasch<strong>in</strong>e klafft e<strong>in</strong> Abgrund, der<br />
16 Paul Schultze-Naumburg: Kulturarbeiten. Bd. 2. Gärten. München 1902, 2 1905,<br />
3 1909, S. 175 f.<br />
17 Paul Schultze-Naumburg: Kulturarbeiten. Bd. 4. Städtebau. München 1906, 2 1909,<br />
S. 426.<br />
18 Guido Harbers: Die Neue Zeit und »Der Baumeister«. In: Der Baumeister 32 (1934),<br />
H. 1, S. 1-3, hier S. 3.
74 wolfgang pehnt<br />
unüberbrückbar […] Auf der e<strong>in</strong>en Seite: Rechnender Verstand, Masch<strong>in</strong>e,<br />
Masse, Kollektivismus, auf der anderen Seite: Gefühl, blutwarmes Leben,<br />
Mensch, Persönlichkeit«. 19 In Schmitthenners eigenen Entwürfen kehrt der<br />
Typus des zweistöckigen <strong>Gartenhaus</strong>es, mit drei Fensterachsen und steilem<br />
Walmdach, immer wieder, wenn auch zumeist mittig und nicht seitlich erschlossen.<br />
Se<strong>in</strong>e Stuttgarter Studenten ließ er <strong>Goethes</strong> Häuschen übungshalber<br />
zeichnen. 20<br />
Schmitthenner sollte 1933 auf e<strong>in</strong>e Berl<strong>in</strong>er Leitungsposition im Bauwesen<br />
berufen werden – laut se<strong>in</strong>es Kollegen Hans Poelzig e<strong>in</strong> »sehr wichtiger, e<strong>in</strong>flussreicher<br />
Posten« – und amtierte für kurze Zeit als Reichsfachleiter für bildende<br />
Kunst im Kampfbund für deutsche Kultur (1933/34). 21 Se<strong>in</strong> Enga gement<br />
für Volk und Führer ist ihm nicht honoriert worden, er reüssierte im Dritten<br />
Reich so wenig wie Schultze-Naumburg. Mit se<strong>in</strong>er Rede über das »sanfte Gesetz«,<br />
zuerst <strong>in</strong> Freiburg 1941 gehalten, verdarb er es sich endgültig mit den<br />
Machthabern. 22 In der Nachkriegsauflage <strong>von</strong> Das deutsche Wohnhaus 23 verschwand<br />
die Abbildung des Scharounschen Wohnmasch<strong>in</strong>chens, das <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
kapriziösen Willkür auch zuvor schon e<strong>in</strong> denkbar ungeeigneter Beleg für modernen<br />
Kollektivismus gewesen war. <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong> musste nun auf e<strong>in</strong>er<br />
Doppelseite geme<strong>in</strong>sam mit dem gleichfalls abgebildeten Straßburger Münster<br />
die »Sendung des deutschen Volkes« 24 auch und erst recht nach dem verlorenen<br />
Krieg verteidigen.<br />
Die tatsächliche Entstehungs- und Nutzungsgeschichte des <strong>Gartenhaus</strong>es trat<br />
<strong>in</strong> solchen Polemiken <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergrund. Es war nicht erst <strong>in</strong> <strong>Goethes</strong> Lebenszeit<br />
als e<strong>in</strong> Produkt der Epoche »um 1800« entstanden, wie es viele Veröffentlichungen<br />
der 1920er und 30er Jahre (und noch unserer Tage) suggerieren. Es<br />
lag <strong>in</strong> Gärten und We<strong>in</strong>äckern, datierte <strong>in</strong>s 16. und 17. Jahrhundert und unter-<br />
19 Paul Schmitthenner: Baugestaltung. Das deutsche Wohnhaus. Stuttgart 1932, S. 8. –<br />
Schmitthenner wies se<strong>in</strong>e Leser und Schüler bereits 1926 auf das Vorbild <strong>Gartenhaus</strong><br />
h<strong>in</strong>: Das bürgerliche Haus. In: Die Bauzeitung 23 (1926), H. 22-23, S. 175-<br />
177.<br />
20 Mitteilung <strong>von</strong> Gerd Behrens, Hamburg, e<strong>in</strong>em Schmitthenner-Schüler, an Theodor<br />
Böll, Kunstbibliothek, Hamburg. Vgl. die Zeichnung <strong>von</strong> Erich Petzold <strong>in</strong>: Wolfgang<br />
Voigt, Hartmut Frank (Hrsg.): Paul Schmitthenner 1884-1972. Ausstellungskatalog.<br />
Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt a. M. Tüb<strong>in</strong>gen 2003, S. 48.<br />
21 Vgl. Wolfgang Voigt: Vom Ur-Haus zum Typ (Anm. 1), S. 252, 263; Hans Poelzig<br />
an Paul Schmitthenner, 17. Juni 1934. Getty Research Institute, Los Angeles. Abgedruckt<br />
<strong>in</strong>: Wolfgang Pehnt, Matthias Schirren (Hrsg.): Hans Poelzig. Architekt<br />
Lehrer Künstler. München 2007, S. 207 f.<br />
22 Vgl. Hartmut Frank: Schiffbrüche der Arche. In: Paul Schmitthenner. Das deutsche<br />
Wohnhaus. Neuauflage Stuttgart 1984, S.V-XVII; Aufsätze <strong>von</strong> Wolfgang Voigt,<br />
Christian Weller und Hartmut Frank <strong>in</strong>: Paul Schmitthenner. Ausstellungskatalog<br />
(Anm. 20).<br />
23 Paul Schmitthenner. Das deutsche Wohnhaus. Stuttgart 3 1950.<br />
24 Paul Schmitthenner. Baugestaltung (Anm. 19), S. 8.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
75<br />
lag mehreren Umbauten. Auch der Dichter übernahm das Haus im damaligen<br />
Börnerschen Garten, das Herzog Carl August für ihn kaufte, nicht ohne Veränderungen.<br />
25 Erst Goethe ließ zwei Fenster vermauern, um sich besser gegen<br />
W<strong>in</strong>d und Kälte zu schützen. Die Symmetrie der Hauptfassade wurde mit Hilfe<br />
e<strong>in</strong>es Bl<strong>in</strong>dfensters notdürftig gewahrt. Sogar die Rankspaliere, die dekorativ<br />
die verputzten Flächen gliedern, fügen sich ke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong>er pedantischen Regel.<br />
Ihre vertikalen Leisten halten unterschiedliche Abstände, Teile der Fassade<br />
blieben ganz ausgespart. Über solche, der Zweckmäßigkeit oder e<strong>in</strong>em Mangel<br />
an Dogmatik geschuldeten Verstöße, auch über die Restaurierungen und wechselnden<br />
Ausstattungen, die seit <strong>Goethes</strong> Tod stattgefunden hatten, sah die konservative<br />
Kulturkritik gnädig h<strong>in</strong>weg. So leicht ließ sie sich dieses vom Dichterruhm<br />
überglänzte Belegstück ihrer antimodernen Ästhetik nicht <strong>in</strong> Frage<br />
stellen.<br />
Neue und alte Sachlichkeit<br />
Weimar war nicht nur für Patrioten das »höchste Symbol re<strong>in</strong>ster Deutschheit<br />
und letzte Ziel alles Strebens deutscher Menschen«, 26 sondern die Stadt, die<br />
der ersten demokratischen Republik <strong>von</strong> 1918 bis 1933 den Namen gegeben<br />
hatte. Auch <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong> gehörte nicht ausschließlich <strong>in</strong> die konservative<br />
Asservaten-Kammer. »Es gilt nicht, um 1920 […] e<strong>in</strong> falsches Biedermeiertum<br />
künstlich zu beleben, das doch nur Maskerade und nie Leben werden<br />
kann, sondern es gilt, die Aufgaben, die unsere Zeit uns stellt, mit den Mitteln,<br />
die unsere Armut uns gelassen hat, im gleichen S<strong>in</strong>ne sauber und sachlich zu<br />
lösen, wie es jene Zeit getan hat«, schrieb der Kritiker Paul Fechter. 27 In se<strong>in</strong>er<br />
strengen Quaderform, die Höhe des Hauskorpus im Verhältnis 1:1 zur Höhe<br />
des steilen Walmdaches, entsprach das <strong>Gartenhaus</strong> durchaus »jenen typischen<br />
Bau-Elementen«, die Gropius zu den Grundlagen für ›Neues Bauen‹ zählte; sie<br />
beruhten »selbstverständlich auf den <strong>e<strong>in</strong>fachste</strong>n Körperformen der Stereometrie:<br />
Würfel, Halbkugel, Halbzyl<strong>in</strong>der, Kegel, Prisma, Pyramide«. 28<br />
25 Den Kaufvertrag unterzeichnete Goethe auf Wunsch des Herzogs, der <strong>in</strong> der Weimarer<br />
Öffentlichkeit nicht als Förderer se<strong>in</strong>es Günstl<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung treten wollte.<br />
Vgl. u. a. Wolfgang Huschke: Die Geschichte des Parkes <strong>von</strong> Weimar. Weimar 1951,<br />
S. 180 ff.; Ra<strong>in</strong>er Ewald: <strong>Goethes</strong> Architektur. Des Poeten Theorie und Praxis. Weimar<br />
1999, vor allem S. 48 ff.<br />
26 Leonhard Schrickel: Weimar. E<strong>in</strong>e Wallfahrt <strong>in</strong> die Heimat aller Deutschen. Weimar<br />
o. J., S. 278.<br />
27 Paul Fechter: Schönheit der Armut. In: Will Vesper, Paul Fechter: Lob der Armut.<br />
Berl<strong>in</strong> 1921, S. 17 f. Zit. <strong>in</strong> Wolfgang Voigt: Vom Ur-Haus zum Typ (Anm. 1).<br />
S. 247.<br />
28 Walter Gropius: Grundlagen für Neues Bauen. In: Oesterreichs Bau- und Werkkunst<br />
2 (Januar 1926), S. 136.
76 wolfgang pehnt<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>er publizistischen Laufbahn war das <strong>Gartenhaus</strong> noch nicht<br />
e<strong>in</strong>er der antagonistischen Parteiungen im architekturästhetischen Streit zuzuordnen<br />
gewesen. Wo wäre die Front <strong>in</strong> den ersten anderthalb Jahrzehnten<br />
des 20. Jahrhunderts auch verlaufen? E<strong>in</strong>en vorsichtigen Reduktionismus empfanden<br />
viele Reformer als diszipl<strong>in</strong>ierende Befreiung vom Überschwang des<br />
Jugendstils, ob Joseph Maria Olbrich <strong>in</strong> den letzten Jahren se<strong>in</strong>es Schaffens, ob<br />
Peter Behrens nach den Darmstädter Anfängen, ob Autoren wie Friedrich<br />
Osten dorf <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>flussreichen Büchern vom Bauen (1913): »Entwerfen<br />
heißt: die <strong>e<strong>in</strong>fachste</strong> Ersche<strong>in</strong>ungsform für e<strong>in</strong> Bauprogramm f<strong>in</strong>den«. 29<br />
Den <strong>von</strong> Paul Mebes herausgegebenen Band Um 1800. Architektur und<br />
Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, dessen<br />
1. Auf lage 1908 im zweiten Band e<strong>in</strong>e Abbildung <strong>von</strong> <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong><br />
enthielt und <strong>in</strong> beiden Bänden zahlreiche Bauten des Weimarer Klassizismus<br />
zeigte, 30 kannte jeder <strong>in</strong>formierte Architekt jener Zeit. Der Band erlebte 1918<br />
und 1920 weitere Auflagen, allerd<strong>in</strong>gs ohne <strong>Gartenhaus</strong>. Auch Schultze-Naumburgs<br />
Kulturarbeiten wurden damals, lange vor den späteren rasse-ideologischen<br />
Ausfällen dieses Autors, als das gelesen, was diese Kampagnen zu ihrer Entstehungszeit<br />
tatsächlich waren, nämlich Versuche, dem eklektizistischen Stilchaos<br />
mit e<strong>in</strong>em an der bürgerlichen Kultur des 18. Jahrhunderts geschulten<br />
Purismus entgegenzuwirken. Adel der Armut sollte dem plebejischen Reichtum<br />
der Gründerzeit E<strong>in</strong>halt gebieten.<br />
E<strong>in</strong>en Aufruf, den Typus zu beherzigen, hätten damals viele unterschrieben.<br />
Und was, wenn nicht e<strong>in</strong>en Typus, sichtbar auch <strong>in</strong> der <strong>in</strong>dividuellen Überformung,<br />
verkörperte das Haus an der Ilm? Sogar der traditionsbewusste<br />
Schmitthenner erwies sich als e<strong>in</strong> Schrittmacher zeitgemäßer Rationalisierung.<br />
Zusammen mit anderen Vorbildern nahm er das <strong>Gartenhaus</strong> als Ausgangspunkt<br />
für Typenbildung, Normung und Vorfertigung. In se<strong>in</strong>em postum veröffentlichten<br />
Material für e<strong>in</strong> weiteres Buch dekl<strong>in</strong>ierte er e<strong>in</strong>e Vielzahl <strong>von</strong><br />
Variationen des dreiachsigen, zweistöckigen Hauses durch und wandelte sie<br />
nach Bauart, Material und Lage ab. 31<br />
Ob Walter Gropius und se<strong>in</strong> Partner Adolf Meyer (Abb. 3) 32 , Hans Scharoun,<br />
Bruno Taut, der zweite Bauhaus-Direktor Hannes Meyer oder dessen Nachfolger<br />
Ludwig Mies van der Rohe, sie alle haben noch nach dem Ersten Weltkrieg<br />
29 Friedrich Ostendorf: Sechs Bücher vom Bauen. Karlsruhe 1913, 4 1922 (Bd. 1), 1914<br />
(Bd. 2), 1920 (Bd. 3). Nur die ersten drei Bücher s<strong>in</strong>d erschienen. Zit. <strong>in</strong> Bd. 1,<br />
4 1922, S. 5.<br />
30 Paul Mebes (Hrsg.): Um 1800. Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert<br />
ihrer traditionellen Entwicklung. Bd. 2. München 1908, S. 115.<br />
31 Elisabeth Schmitthenner (Hrsg.): Gebaute Form. Le<strong>in</strong>felden-Echterd<strong>in</strong>gen 1984.<br />
Vgl. Wolfgang Voigt. Vom Ur-Haus zum Typ (Anm. 1), vor allem S. 255 ff.<br />
32 E<strong>in</strong>e Fotografie des <strong>Gartenhaus</strong>es, im Vordergrund Adolf Meyer im weißen Sommeranzug,<br />
bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> der Staatlichen Bildstelle Berl<strong>in</strong>, Brandenburgisches Landesamt<br />
für Denkmalpflege, Zossen. H<strong>in</strong>weis <strong>von</strong> Annemarie Jaeggi.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
77<br />
Abb. 3: Adolf Meyer vor <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>
78 wolfgang pehnt<br />
blockhafte, klassizistisch diszipl<strong>in</strong>ierte, sparsam mit Pilastern und Gesimsen,<br />
Sattel- und Walmdächern, Schlagläden und Gauben gegliederte Wohnhäuser<br />
gebaut – Mies noch bis zum Haus Mosler <strong>in</strong> Neubabelsberg (1924/26). Gropius<br />
gab sich nach dem Ersten Weltkrieg alle erdenkliche Mühe, die skeptischen<br />
Weimarer Handwerker zu überzeugen, »wie vernünftig und wie schlicht e<strong>in</strong><br />
solches Haus« des frisch ernannten Bauhaus-Direktors se<strong>in</strong> werde. 33 Das Haus<br />
Stöckle <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Zehlendorf (1921) aus dem Gropius-Atelier – Mauerwerk,<br />
holzverschalter Giebel, Satteldach – belegt es. Es hätte, wie Gropius-Mit arbeiter<br />
Fred Forbat formulierte, fast <strong>von</strong> Tessenow se<strong>in</strong> können. 34<br />
He<strong>in</strong>rich Tessenow, der »Holz-Goethe«, hat publizistisch viel für e<strong>in</strong>e Bauund<br />
Wohnkultur im Geiste der Goethezeit getan, auch dort, wo er sich nicht<br />
ausdrücklich auf sie bezog. Und Tessenow war e<strong>in</strong>e Figur, die Autorität <strong>in</strong> unterschiedlichen<br />
Lagern genoss, früh schon bei den Boden- und Wohnreformern<br />
verschiedener Couleur und erst recht, nachdem sich die Gegensätze zwischen<br />
Traditionalisten und Modernen ausdifferenziert hatten. In der radikalen Berl<strong>in</strong>er<br />
Künstlergruppe Arbeitsrat für Kunst war er 1918 Mitglied, ebenso <strong>in</strong> der<br />
Berl<strong>in</strong>er Modernistengruppen Zehnerr<strong>in</strong>g (ab 1924) und Der R<strong>in</strong>g (ab 1926).<br />
Er baute und entwarf bis <strong>in</strong> die 40er Jahre h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> Häuser, <strong>von</strong> denen manche<br />
bis h<strong>in</strong> zu den knapp unter der Traufe sitzenden Obergeschossfenstern wie Kopien<br />
des <strong>Gartenhaus</strong>es wirken – so die Zwill<strong>in</strong>gshäuser am Heideweg <strong>in</strong> Dresden-Hellerau<br />
(1910 / Abb. 4). In e<strong>in</strong>em da<strong>von</strong> wohnte er für kurze Zeit selbst.<br />
Doch Tessenow baute und entwarf auch großstädtische Bauten wie das Hochhaus<br />
für den Dresdner Anzeiger (1925), das Hallenbad <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Mitte oder die<br />
Malwida <strong>von</strong> Meysenbug-Schule <strong>in</strong> Kassel (beide 1927/30), die <strong>in</strong> ihrer Rationalität,<br />
Klarheit und Härte jeder modernen Anforderung <strong>in</strong> Programm wie<br />
Ästhetik gerecht wurden.<br />
Vermutlich während der Zeit, <strong>in</strong> der Tessenow bei Schultze-Naumburg <strong>in</strong><br />
Saaleck arbeitete, 1904/05, zeichnete er e<strong>in</strong>e Reihe <strong>von</strong> Ansichten Alt-Weimars,<br />
<strong>von</strong> denen der Schriftsteller Wilhelm Bode e<strong>in</strong>ige für die Illustrierung se<strong>in</strong>er<br />
zahlreichen populären Schriften zur Weimarer Klassik nutzte. 35 Zwei Zeich-<br />
33 Walter Gropius. Manuskript. Bauhaus-Archiv, Berl<strong>in</strong>.<br />
34 Fred Forbat an Wolfgang Pehnt, 27. August 1969.<br />
35 Wilhelm Bode, der Weimarer Bode, nicht zu verwechseln mit dem großen Berl<strong>in</strong>er<br />
Kunsthistoriker Wilhelm <strong>von</strong> Bode. Tessenow-Zeichnungen s<strong>in</strong>d enthalten <strong>in</strong> den<br />
Büchern Bodes: <strong>Goethes</strong> Lebenskunst. Berl<strong>in</strong> 5 1908; Amalie Herzog<strong>in</strong> <strong>von</strong> Weimar.<br />
Bd. 1-3. Berl<strong>in</strong> 1908; <strong>Goethes</strong> Leben im Garten am Stern. Berl<strong>in</strong> 1909; Damals <strong>in</strong><br />
Weimar. Weimar 1910; Das Leben <strong>in</strong> Alt-Weimar. Weimar 1912; sowie <strong>in</strong> Heften der<br />
ebenfalls <strong>von</strong> Bode herausgegebenen Reihe: Stunden mit Goethe. Berl<strong>in</strong> 1905 ff. – Drei<br />
der Tessenowschen Zeichnungen, darunter e<strong>in</strong>e mit dem <strong>Gartenhaus</strong>, abgebildet <strong>in</strong>:<br />
Marco De Michelis: He<strong>in</strong>rich Tessenow (Anm. 6), S. 60, 101. Die Zeichnungen begründeten<br />
Tessenows Ruf als Goethe-Kenner, der ihm 1931 zur Umbau- und Erweiterungsplanung<br />
des Goethe-Nationalmuseums am Frauenplan verhalf. Tessenows Projekt<br />
scheiterte jedoch an f<strong>in</strong>anziellen und politischen Umständen. Vgl. ebd. S. 313-315.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
79<br />
Abb. 4: He<strong>in</strong>rich Tessenow, E<strong>in</strong>familienhaus Heideweg 4-6,<br />
Dresden-Hellerau, Federzeichnung, 1910<br />
nungen vom <strong>Gartenhaus</strong> selbst bef<strong>in</strong>den sich unter den vier Federzeichnungen,<br />
die <strong>von</strong> der Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz <strong>in</strong> den 1980er<br />
Jahren angekauft wurden (Abb. 5). 36 In ihrer dichten Textur präludierten die<br />
liebevollen Darstellungen den sehr viel sparsameren Illustrationen, die Kenner<br />
und Laien <strong>in</strong> Tessenows Buch Hausbau und dergleichen (1916) entzückten.<br />
Doch man sah <strong>in</strong> Tessenows Häusern auch das »über alle Orig<strong>in</strong>alität h<strong>in</strong>auswachsende<br />
Allgeme<strong>in</strong>gültige«, »Qu<strong>in</strong>tessenzhafte«, »die sehr positive Tugend,<br />
Urzellen e<strong>in</strong>es allgeme<strong>in</strong>gültigen Baustils zu se<strong>in</strong>«, »e<strong>in</strong>e neue Art <strong>von</strong> künstlerischer<br />
Ehrlichkeit«. »Er verfährt so, wie jene bedeutenden Baumeister um<br />
1800 verfahren würden, wenn sie heute lebten«, me<strong>in</strong>te der Architekturkritiker<br />
Karl Scheffler. 37 So wurde das <strong>Gartenhaus</strong> auch <strong>in</strong> jenen Kreisen geschätzt, die<br />
auf e<strong>in</strong>e Vermittlung zwischen den Parteien bedacht waren.<br />
36 Mitteilung <strong>von</strong> Theodor Böll, Kunstbibliothek <strong>in</strong> der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,<br />
Berl<strong>in</strong>. Die Außenansicht abgebildet <strong>in</strong>: Marco De Michelis: He<strong>in</strong>rich Tessenow<br />
(Anm. 9), S. 60.<br />
37 Karl Scheffler: Die Architektur der Großstadt. Berl<strong>in</strong> 1913, S. 167-169.
80 wolfgang pehnt<br />
Abb. 5: He<strong>in</strong>rich Tessenow, <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>, Federzeichnung, um 1904<br />
Auch Anhänger oder Pioniere des ›Neuen Bauens‹ ließen sich ihren Goethe<br />
(und dessen <strong>Gartenhaus</strong>) nicht nehmen. Gropius hat se<strong>in</strong>e Schriften gern mit<br />
Goethe-Zitaten geschmückt, vor allem als er selbst das Greisenalter des Dichterfürsten<br />
erreicht und sich zweimal für die Auszeichnung mit e<strong>in</strong>em Goethe-Preis<br />
zu bedanken hatte. 38 <strong>Goethes</strong> Farbenlehre gehörte am Bauhaus, vor allem bei<br />
Itten, Hirschfeld-Mack, Klee und Kand<strong>in</strong>sky, zur Pflichtlektüre. Aufmaßzeichnungen<br />
des <strong>Gartenhaus</strong>es wurden nicht nur an der Stuttgarter Hochschule bei<br />
Schmitthenner verwendet (Abb. 6), sondern auch <strong>von</strong> Bauhäuslern angefertigt.<br />
1920/21 sollten Bauhausschüler Möbel im Schloss, im Wittumspalais und im<br />
<strong>Gartenhaus</strong> aufmessen. Später gab Wilhelm Wagenfeld, Bauhäusler und <strong>von</strong><br />
1928 bis 1930 Leiter der Metallwerkstatt am Weimarer Nachfolge<strong>in</strong>stitut des<br />
Bauhauses, der Staatlichen Bauhochschule, e<strong>in</strong> Aufmaß des Hauses <strong>in</strong> Auftrag. 39<br />
38 Hansischer Goethe-Preis Hamburg 1956, Frankfurter Goethe-Preis 1961. Die Dankesreden<br />
<strong>von</strong> Gropius veröffentlicht <strong>in</strong>: Apollo <strong>in</strong> der Demokratie. Ma<strong>in</strong>z 1967,<br />
S. 11-19, 34-42.<br />
39 Abgebildet <strong>in</strong>: Wolfgang Voigt, Hartmut Frank (Hrsg.): Paul Schmitthenner 1884-<br />
1972 (Anm. 20), S. 48; Dagmar Blaha, Frank Boblenz, Volker Wahl (Bearbeiter):<br />
Repertorien des Thür<strong>in</strong>gischen Hauptstaatsarchivs Weimar. Bd. 4. Weimar 2008,<br />
S. 332. (Thür<strong>in</strong>gisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Akten Staatliches Bauhaus Weimar,<br />
Nr. 170. Dort auch e<strong>in</strong>e Anfrage der Deutschen Werkstätten München, die
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
81<br />
Abb. 6: Erich Petzold, Aufmaßzeichnung <strong>von</strong> <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>, um 1925<br />
Man gew<strong>in</strong>nt den E<strong>in</strong>druck, irgendjemand war <strong>in</strong> den Zimmerchen des <strong>Gartenhaus</strong>es<br />
immer mit dem Zollstock unterwegs. Die Blätter aus dem Schmitthenner-<br />
und die aus dem Wagenfeld-Unterricht unterscheiden sich übrigens<br />
markant <strong>in</strong> der Darstellungstechnik: die Stuttgarter Zeichnung <strong>in</strong> Sütterl<strong>in</strong> beschriftet<br />
und mit atmosphärischem Sfumato, die bei Wagenfeld entstandene e<strong>in</strong>e<br />
präzise Federzeichnung, die jede e<strong>in</strong>zelne Holzsch<strong>in</strong>del des Daches wiedergibt.<br />
Aufmaße für Kopien <strong>von</strong> Möbeln aus <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong> herstellen wollten.) –<br />
Marco De Michelis: He<strong>in</strong>rich Tessenow (Anm. 6), S. 60, dort wohl falsch auf 1934<br />
datiert. Wagenfeld war <strong>in</strong> Weimar bereits zum 31. März 1930 gekündigt worden.<br />
Auskunft <strong>von</strong> Beate Manske, Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung, Bremen.
82 wolfgang pehnt<br />
E<strong>in</strong>e Figur des Schachspiels, das Josef Hartwig 1923 am Bauhaus entwarf,<br />
die Dame-Figur (Abb. 7), wirkt, Zufall oder nicht, wie e<strong>in</strong>e verkle<strong>in</strong>erte Kopie<br />
jenes »Ste<strong>in</strong>s des Guten Glücks«, der Agathe Tyche, den Goethe 1777 <strong>in</strong> Sandste<strong>in</strong><br />
ausführen und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Garten aufstellen ließ (Abb. 8): Kugel auf Kubus.<br />
Im Schachspiel symbolisieren diese »<strong>e<strong>in</strong>fachste</strong>n Körperformen der Stereometrie«<br />
(Gropius) die allseitige Beweglichkeit der Dame-Figur, im Garten den<br />
Augenblick des Glücks, <strong>in</strong> dem die wetterwendische Kugel auf ihrem standfesten<br />
Sockel zum Stillstand gekommen ist und das Wandel bare auf dem Beharrenden<br />
gründet. 40 Aus dem Me<strong>in</strong>ungsaustausch zwischen Goethe und<br />
se<strong>in</strong>em Leipziger Zeichenlehrer Adam Friedrich Oeser geht hervor, wie ungewöhnlich<br />
der ältere Künstler dieses frühe nichtfigürliche Denkmal und se<strong>in</strong>e<br />
harte Konfrontation zweier stereometrischer Körper empfand. Oeser empfahl<br />
vermittelnde Wolken- und Flügelformen und für den Übergang zwischen Kubus<br />
und Boden e<strong>in</strong>en geböschten Sockel. Dass Goethe auf den »strengen mathematischen<br />
Formen« (Oeser) <strong>in</strong> ihrer Re<strong>in</strong>heit und Klarheit bestand, hätte ihm<br />
die Billigung der Bauhäusler e<strong>in</strong>tragen können, so wie es ihm das Unverständnis<br />
des Lehrers e<strong>in</strong>brachte. 41<br />
Im 18. Jahrhundert war es ke<strong>in</strong>e Seltenheit, Ste<strong>in</strong>kugeln auf flankierende<br />
Torpfeiler zu setzen, auch wenn die Übergänge abgemildert waren wie <strong>in</strong> Oesers<br />
Korrekturvorschlag. 42 Neu s<strong>in</strong>d Größe, Härte und Isolation des <strong>Goethes</strong>chen<br />
Denkmals. E<strong>in</strong> Vorbild, zumal e<strong>in</strong> ikonografisch bedeutsames, hatte M<strong>in</strong>ister<br />
Goethe bei se<strong>in</strong>en Amtsbesuchen <strong>in</strong> Jena f<strong>in</strong>den können. Dort flankierte e<strong>in</strong><br />
Kugelpaar auf Rechteckpfeilern, das den Himmels- und den Erdglobus darstellte,<br />
die Freitreppe des Alten Stadtschlosses. Es war <strong>von</strong> dem Astronomen<br />
Erhard Weigel ursprünglich am E<strong>in</strong>gang zum Collegium Jenense aufgestellt und<br />
im 18. Jahrhundert vor das Stadtschloss verpflanzt worden. Als Theodor Fischer<br />
1903/08 se<strong>in</strong>en Universitätsbau an die Stelle des Schlosses setzte, übernahm er<br />
die Kugeln für den kle<strong>in</strong>en Innenhof se<strong>in</strong>er Baugruppe und setzte sie auf gemauerte<br />
Kuben ohne Deckplatte, als habe er sich dabei des <strong>Goethes</strong>chen Denkmals<br />
er<strong>in</strong>nert und die barocke auf die klassische Form reduzieren wollen. 43<br />
40 <strong>Zur</strong> Interpretation des Denkmals vgl. Werner Weiland: Der »Ste<strong>in</strong> des guten Glücks«<br />
im Garten am Stern. In: Goethe-Jahrbuch 103 (1986), S. 344 ff.<br />
41 Timo John: Adam Friedrich Oeser 1717-1799. Stuttgart 2001, S. 154 ff. John veröffentlichte<br />
erstmals e<strong>in</strong> Briefkonzept Oesers vom 10. Januar 1777, aus dem Oesers<br />
Kritik an <strong>Goethes</strong> Wünschen hervorgeht.<br />
42 Vgl. Paul Mebes (Hrsg.): Um 1800 (Anm. 30).<br />
43 Vgl. W<strong>in</strong>fried Nerd<strong>in</strong>ger: Theodor Fischer. Architekt und Städtebauer 1862-1938.<br />
Berl<strong>in</strong> 1988, S. 82 f. – H<strong>in</strong>weise <strong>von</strong> Hans-Dieter Nägelke und Wolfgang Voigt. – In<br />
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts waren Kugeln auf Pfeilern beliebte<br />
Motive für Tore<strong>in</strong>fahrten, Gartenmauern und Balkonbrüstungen. Joseph Maria Olbrich<br />
setzte bei se<strong>in</strong>en Villen van Geleen, Kurska, Banzhaf und Fe<strong>in</strong>hals <strong>in</strong> Köln,<br />
Clarenbach <strong>in</strong> Wittlaer (1907-08) und auf der Darmstädter Mathildenhöhe ganze<br />
Kugellager e<strong>in</strong>.
zur rezeption <strong>von</strong> goethes gartenhaus<br />
83<br />
Abb. 7: Josef Hartwig,<br />
Bauhaus-Schachspiel, Dame-Figur,<br />
1923<br />
Abb. 8: Ste<strong>in</strong> des guten Glücks<br />
im Garten <strong>von</strong> <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong>,<br />
Weimar 1777, Foto 2000<br />
Auch Zeitschriften, die dem ›Neuen Bauen‹ nahestanden, erwiesen dem Weimarer<br />
Olympier ihre Reverenz. Der Chefredakteur der modernefreundlichen<br />
Bauwelt, Friedrich Paulsen, wusste zwar 1932, zum hundertsten Todestag<br />
<strong>Goethes</strong>, nicht sonderlich viel zum Lobe des Architekturschriftstellers und Bauherrn<br />
Goethe zu sagen. Dem Klassizismus habe der Dichter e<strong>in</strong>e längere Lebensdauer<br />
verschafft, als dieser Stil sie sonst erlebt hätte. <strong>Goethes</strong> Interesse für »den<br />
uns Heutigen faden Palladio« konnte Paulsen nichts abgew<strong>in</strong>nen. Immerh<strong>in</strong><br />
erschien ihm die Position des älteren Goethe als »Verständnis für die damals<br />
neue Sachlichkeit«. 44 Goethe als Protagonist der Neuen Sachlichkeit <strong>von</strong> 1800!<br />
Sieben Jahre zuvor hatte die Bauwelt – nach eigener Behauptung zum ersten<br />
Mal – die beiden eigenhändigen Sepia-Zeichnungen <strong>Goethes</strong> für den Umbau<br />
des Treppenhauses <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Haus am Frauenplan veröffentlicht, »weil sie<br />
se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>stellung zu unserer Kunst scharf zeichnen«. Mit den geschlossenen<br />
Treppenwangen, dem fast völligen Verzicht auf Ornament und sogar Handläufe<br />
und den ohne Fensterkreuze wiedergegebenen Öffnungen folgen sie e<strong>in</strong>em<br />
für se<strong>in</strong>e Zeit – 1792 – erstaunlichen M<strong>in</strong>imalismus (S. 52, Taf. 5). Der Bauwelt-Bearbeiter<br />
entdeckte »e<strong>in</strong> architektonisches Formengefühl, das sich nicht<br />
im E<strong>in</strong>zelnen verliert, sondern e<strong>in</strong> straffes Ganzes gibt. E<strong>in</strong>fach und <strong>in</strong> un-<br />
44 P[aulsen]: Goethe. Was verdankt die Baukunst Goethe. Zu se<strong>in</strong>em hundertsten<br />
Todes tag am 22. März 1932. In: Bauwelt 23 (1932), H. 11, S. 285-288.
84 wolfgang pehnt<br />
verfälschtem zeitgenössischem Stil«. 45 Die karge Monumentalität, der glattflächige<br />
Reduk tionismus etwa des Umbaus für das Jenaer Theater durch Gropius<br />
und Adolf Meyer (1921/22) sche<strong>in</strong>t <strong>von</strong> diesen Zeichnungen her gesehen<br />
<strong>in</strong> der Tat nicht mehr fern.<br />
Nicht zuletzt hatten gerade die Parteigänger e<strong>in</strong>er radikaleren Moderne <strong>in</strong><br />
ihrer Kritik am Musterhaus <strong>von</strong> 1923 e<strong>in</strong>en subkutanen Klassizismus gewittert,<br />
der ihnen Muches Schöpfung verdächtig machte. Der bauhistorisch versierte<br />
Adolf Behne vermutete <strong>in</strong> der »Reißbrettarchitektur« des Hauses Am Horn, <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er Regelmäßigkeit und Symmetrie, das Vorbild des antiken Hauses. Was im<br />
klassischen Rom das Atrium gewesen war, stellt hier, <strong>in</strong> den bescheidenen Maßen<br />
des Musterhauses, der zentrierende, überhöhte Mittelraum dar. Giedion,<br />
gleichfalls gelernter Kunsthistoriker, sah <strong>in</strong> dieser Innenorientierung – »wie es<br />
beim antiken Haus geschah« – das eigentlich Unmoderne, Rückwärtsgewandte<br />
der Lösung. 46 Den Vergleich mit »dem römischen Atrium« hatte Gropius selbst<br />
gezogen. 47<br />
Dass die Weimarer Klassik <strong>in</strong> ihren künstlerischen und baukünstlerischen<br />
Hervorbr<strong>in</strong>gungen und nicht zuletzt mit dem vor ihrer Zeit entstandenen, aber<br />
untrennbar mit ihr verbundenen <strong>Gartenhaus</strong> an den Ilmwiesen so andauernd<br />
und unterschiedlich rezipiert und <strong>in</strong>terpretiert werden konnte, hatte mehrere<br />
Gründe. Sie lagen nicht zuletzt an jenem Zufall, dass e<strong>in</strong>e Hochburg der Moderne<br />
am Zentralort der deutschen Klassik entstand und dass diese Schulgründung<br />
<strong>in</strong> der deutschen Prov<strong>in</strong>z sich zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternational renommierten<br />
Institution entwickelte. Im Falle des <strong>Goethes</strong>chen <strong>Gartenhaus</strong>es lagen sie auch<br />
an der Vere<strong>in</strong>igung weniger, aber starker Eigenschaften, die dieses kle<strong>in</strong>e Gebäude<br />
auszeichnete. In se<strong>in</strong>er fast über<strong>in</strong>dividuellen Ersche<strong>in</strong>ungsform, die sich<br />
als Modell e<strong>in</strong>es Hauses schlechth<strong>in</strong>, als Ur-Haus analog zur Ur-Pflanze <strong>in</strong>terpretieren<br />
ließ, konnten sich die unterschiedlichsten Ambitionen, Anschauungen<br />
und Ideologien spiegeln.<br />
Se<strong>in</strong> prom<strong>in</strong>enter Bewohner war »Weltbewohner« und »Weimaraner« 48 .<br />
Das galt auch für die Bauhäusler der Jahre 1919 bis 1925: Weltbewohner und<br />
Weimaraner auch sie.<br />
45 Josef Beitscher: Beziehungen <strong>Goethes</strong> zur Baukunst. In: Bauwelt 16 (1925). H. 49.<br />
Archiv für Baukunst, S. 5-8.<br />
46 Adolf Behne: Das Musterwohnhaus der Bauhaus-Ausstellung (Anm. 14), S. 591;<br />
Sigfried Giedion: Bauhaus und Bauhauswoche zu Weimar (Anm. 14), S. 23. Christian<br />
Wolsdorffs Me<strong>in</strong>ung, <strong>in</strong> den zeitgenössischen Besprechun gen f<strong>in</strong>de sich ke<strong>in</strong><br />
H<strong>in</strong>weis auf die traditionellen Momente des Musterhauses – Christian Wolsdorff:<br />
Georg Muche als Architekt. In: Georg Muche (Anm. 7), S. 27 – wäre daher e<strong>in</strong>zuschränken:<br />
Behne und Giedion haben sie sehr wohl gesehen.<br />
47 Walter Gropius: Grundlagen für Neues Bauen (Anm. 28), S. 141. H<strong>in</strong>weis <strong>von</strong><br />
Anne marie Jaeggi.<br />
48 Johann Wolfgang Goethe: Gott grüß’ euch, Brüder. Zahme Xenien V. In: WA, I, 3,<br />
S. 314.
Bildnachweis<br />
Bauhaus-Archiv Berl<strong>in</strong>: S. 19, 71, 107 (Taf. 9), 107 (Taf. 10) © VG Bild-Kunst Bonn<br />
2008, 108 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 171 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 177<br />
© VG Bild-Kunst Bonn 2008, 178 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 180 © VG Bild-<br />
Kunst Bonn 2008, 182 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 229, 328, 348, 363 © VG Bild-<br />
Kunst Bonn 2008<br />
Bauhaus-Universität Weimar: S. 207, 209 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 238 © VG<br />
Bild-Kunst Bonn 2008, 239 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 272 und 279<br />
bpk, Nationalgalerie, Museum Berggruen, SMB, Jens Ziehe: S. 257 © VG Bild-Kunst<br />
Bonn 2008<br />
bpk, Nationalgalerie, SMB, Jörg P. Anders: S. 258 (Taf. 13) © VG Bild-Kunst Bonn<br />
2008<br />
Deutsches Literaturarchiv Marbach: S. 327<br />
Klassik Stiftung Weimar: Frontispiz © VG Bild-Kunst Bonn 2008, S. 52, 69, 81,<br />
106 (Taf. 8), 189 (Abb. 4), 205, 217, 226, 240, 389, 393, 396<br />
Kunstbibliothek, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berl<strong>in</strong>: S. 79, 80<br />
Lenbach-Haus München: S. 91 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 105 © VG Bild-Kunst<br />
Bonn 2008, 106 (Taf. 7) © VG Bild-Kunst Bonn 2008<br />
Privatbesitz: S. 49 (Taf. 1) © VG Bild-Kunst Bonn 2008<br />
Sammlung M<strong>in</strong>nie Bechtler, Zollikon: S. 254 (Taf. 14) © VG Bild-Kunst Bonn 2008<br />
Staatliche Bildstelle Berl<strong>in</strong>, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege: S. 77<br />
Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung: S. 259 © VG Bild-Kunst Bonn 2008<br />
Thür<strong>in</strong>gisches Hauptstaatsarchiv Weimar: S. 255<br />
Wenzel-Hablick-Museum, Itzehoe: S. 260<br />
Zentrum Paul Klee, Bern: S. 35, 49 (Taf. 2) © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 50 © VG<br />
Bild-Kunst Bonn 2008, 51 © VG Bild-Kunst Bonn 2008, 59 © VG Bild-Kunst Bonn<br />
2008<br />
Sollte trotz sorgfältiger Recherche e<strong>in</strong> Rechte<strong>in</strong>haber nicht genannt se<strong>in</strong>, werden<br />
berechtigte Ansprüche im Rahmen der üblichen Vere<strong>in</strong>barungen abgegolten.<br />
Bildzitate s<strong>in</strong>d nicht gesondert ausgewiesen.
Erstpublikation<br />
Wolfgang Pehnt: Blutwarmes Leben – <strong>e<strong>in</strong>fachste</strong> Körperform. <strong>Zur</strong> <strong>Rezeption</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong> <strong>in</strong> Zeiten des Bauhauses.<br />
In: Hellmut Th. Seemann, Thorsten Valk (Hrsg.): Klassik und Avantgarde.<br />
Das Bauhaus <strong>in</strong> Weimar 1919-1925. Jahrbuch der Klassik Stiftung Weimar 2009.<br />
Gött<strong>in</strong>gen: Wallste<strong>in</strong> Verlag 2009, S. 68–84.<br />
Klassik Stiftung Weimar | Pehnt: <strong>Zur</strong> <strong>Rezeption</strong> <strong>von</strong> <strong>Goethes</strong> <strong>Gartenhaus</strong> | 06.2011