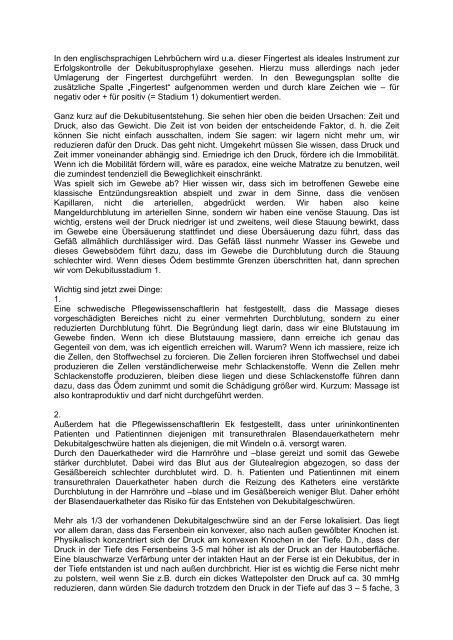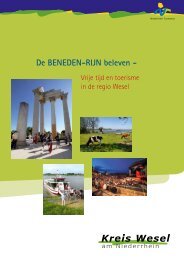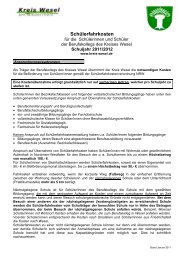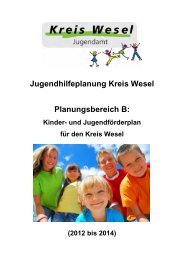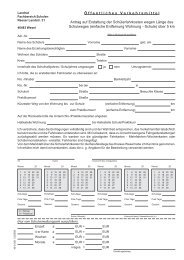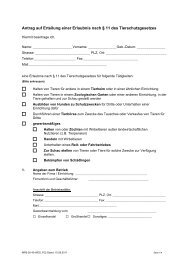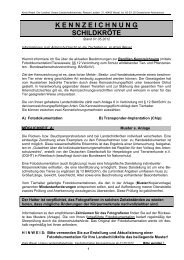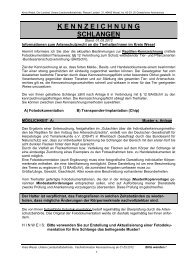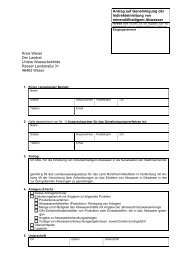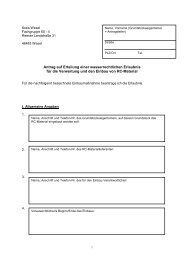sichtbarer Linktext - Kreis Wesel
sichtbarer Linktext - Kreis Wesel
sichtbarer Linktext - Kreis Wesel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In den englischsprachigen Lehrbüchern wird u.a. dieser Fingertest als ideales Instrument zur<br />
Erfolgskontrolle der Dekubitusprophylaxe gesehen. Hierzu muss allerdings nach jeder<br />
Umlagerung der Fingertest durchgeführt werden. In den Bewegungsplan sollte die<br />
zusätzliche Spalte „Fingertest“ aufgenommen werden und durch klare Zeichen wie – für<br />
negativ oder + für positiv (= Stadium 1) dokumentiert werden.<br />
Ganz kurz auf die Dekubitusentstehung. Sie sehen hier oben die beiden Ursachen: Zeit und<br />
Druck, also das Gewicht. Die Zeit ist von beiden der entscheidende Faktor, d. h. die Zeit<br />
können Sie nicht einfach ausschalten, indem Sie sagen: wir lagern nicht mehr um, wir<br />
reduzieren dafür den Druck. Das geht nicht. Umgekehrt müssen Sie wissen, dass Druck und<br />
Zeit immer voneinander abhängig sind. Erniedrige ich den Druck, fördere ich die Immobilität.<br />
Wenn ich die Mobilität fördern will, wäre es paradox, eine weiche Matratze zu benutzen, weil<br />
die zumindest tendenziell die Beweglichkeit einschränkt.<br />
Was spielt sich im Gewebe ab? Hier wissen wir, dass sich im betroffenen Gewebe eine<br />
klassische Entzündungsreaktion abspielt und zwar in dem Sinne, dass die venösen<br />
Kapillaren, nicht die arteriellen, abgedrückt werden. Wir haben also keine<br />
Mangeldurchblutung im arteriellen Sinne, sondern wir haben eine venöse Stauung. Das ist<br />
wichtig, erstens weil der Druck niedriger ist und zweitens, weil diese Stauung bewirkt, dass<br />
im Gewebe eine Übersäuerung stattfindet und diese Übersäuerung dazu führt, dass das<br />
Gefäß allmählich durchlässiger wird. Das Gefäß lässt nunmehr Wasser ins Gewebe und<br />
dieses Gewebsödem führt dazu, dass im Gewebe die Durchblutung durch die Stauung<br />
schlechter wird. Wenn dieses Ödem bestimmte Grenzen überschritten hat, dann sprechen<br />
wir vom Dekubitusstadium 1.<br />
Wichtig sind jetzt zwei Dinge:<br />
1.<br />
Eine schwedische Pflegewissenschaftlerin hat festgestellt, dass die Massage dieses<br />
vorgeschädigten Bereiches nicht zu einer vermehrten Durchblutung, sondern zu einer<br />
reduzierten Durchblutung führt. Die Begründung liegt darin, dass wir eine Blutstauung im<br />
Gewebe finden. Wenn ich diese Blutstauung massiere, dann erreiche ich genau das<br />
Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will. Warum? Wenn ich massiere, reize ich<br />
die Zellen, den Stoffwechsel zu forcieren. Die Zellen forcieren ihren Stoffwechsel und dabei<br />
produzieren die Zellen verständlicherweise mehr Schlackenstoffe. Wenn die Zellen mehr<br />
Schlackenstoffe produzieren, bleiben diese liegen und diese Schlackenstoffe führen dann<br />
dazu, dass das Ödem zunimmt und somit die Schädigung größer wird. Kurzum: Massage ist<br />
also kontraproduktiv und darf nicht durchgeführt werden.<br />
2.<br />
Außerdem hat die Pflegewissenschaftlerin Ek festgestellt, dass unter urininkontinenten<br />
Patienten und Patientinnen diejenigen mit transurethralen Blasendauerkathetern mehr<br />
Dekubitalgeschwüre hatten als diejenigen, die mit Windeln o.ä. versorgt waren.<br />
Durch den Dauerkatheder wird die Harnröhre und –blase gereizt und somit das Gewebe<br />
stärker durchblutet. Dabei wird das Blut aus der Glutealregion abgezogen, so dass der<br />
Gesäßbereich schlechter durchblutet wird. D. h. Patienten und Patientinnen mit einem<br />
transurethralen Dauerkatheter haben durch die Reizung des Katheters eine verstärkte<br />
Durchblutung in der Harnröhre und –blase und im Gesäßbereich weniger Blut. Daher erhöht<br />
der Blasendauerkatheter das Risiko für das Entstehen von Dekubitalgeschwüren.<br />
Mehr als 1/3 der vorhandenen Dekubitalgeschwüre sind an der Ferse lokalisiert. Das liegt<br />
vor allem daran, dass das Fersenbein ein konvexer, also nach außen gewölbter Knochen ist.<br />
Physikalisch konzentriert sich der Druck am konvexen Knochen in der Tiefe. D.h., dass der<br />
Druck in der Tiefe des Fersenbeins 3-5 mal höher ist als der Druck an der Hautoberfläche.<br />
Eine blauschwarze Verfärbung unter der intakten Haut an der Ferse ist ein Dekubitus, der in<br />
der Tiefe entstanden ist und nach außen durchbricht. Hier ist es wichtig die Ferse nicht mehr<br />
zu polstern, weil wenn Sie z.B. durch ein dickes Wattepolster den Druck auf ca. 30 mmHg<br />
reduzieren, dann würden Sie dadurch trotzdem den Druck in der Tiefe auf das 3 – 5 fache, 3