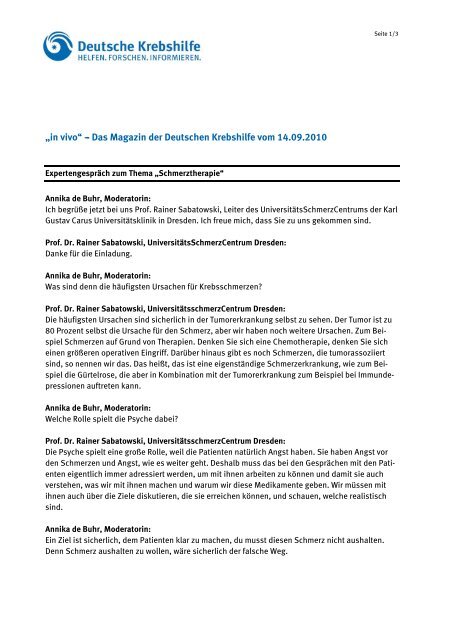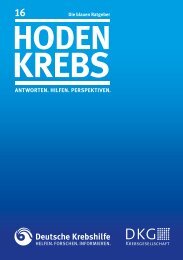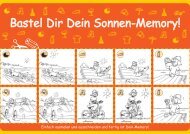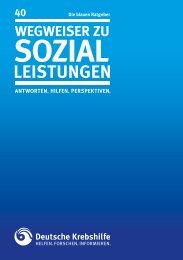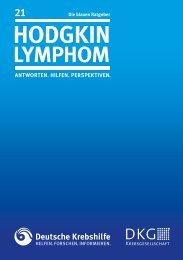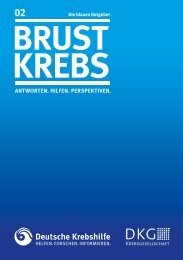Schmerztherapie - Deutsche Krebshilfe eV
Schmerztherapie - Deutsche Krebshilfe eV
Schmerztherapie - Deutsche Krebshilfe eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 1/3<br />
„in vivo‘‘ -- Das Magazin der <strong>Deutsche</strong>n <strong>Krebshilfe</strong> vom 14.09.2010<br />
Expertengespräch zum Thema „<strong>Schmerztherapie</strong>‘‘<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Ich begrüße jetzt bei uns Prof. Rainer Sabatowski, Leiter des UniversitätsSchmerzCentrums der Karl<br />
Gustav Carus Universitätsklinik in Dresden. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind.<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Danke für die Einladung.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Was sind denn die häufigsten Ursachen für Krebsschmerzen?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsschmerzCentrum Dresden:<br />
Die häufigsten Ursachen sind sicherlich in der Tumorerkrankung selbst zu sehen. Der Tumor ist zu<br />
80 Prozent selbst die Ursache für den Schmerz, aber wir haben noch weitere Ursachen. Zum Beispiel<br />
Schmerzen auf Grund von Therapien. Denken Sie sich eine Chemotherapie, denken Sie sich<br />
einen größeren operativen Eingriff. Darüber hinaus gibt es noch Schmerzen, die tumorassoziiert<br />
sind, so nennen wir das. Das heißt, das ist eine eigenständige Schmerzerkrankung, wie zum Beispiel<br />
die Gürtelrose, die aber in Kombination mit der Tumorerkrankung zum Beispiel bei Immundepressionen<br />
auftreten kann.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Welche Rolle spielt die Psyche dabei?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsschmerzCentrum Dresden:<br />
Die Psyche spielt eine große Rolle, weil die Patienten natürlich Angst haben. Sie haben Angst vor<br />
den Schmerzen und Angst, wie es weiter geht. Deshalb muss das bei den Gesprächen mit den Patienten<br />
eigentlich immer adressiert werden, um mit ihnen arbeiten zu können und damit sie auch<br />
verstehen, was wir mit ihnen machen und warum wir diese Medikamente geben. Wir müssen mit<br />
ihnen auch über die Ziele diskutieren, die sie erreichen können, und schauen, welche realistisch<br />
sind.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Ein Ziel ist sicherlich, dem Patienten klar zu machen, du musst diesen Schmerz nicht aushalten.<br />
Denn Schmerz aushalten zu wollen, wäre sicherlich der falsche Weg.
Seite 2/3<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Wenn ein Patient Schmerzen aushalten will, führt das in der Regel dazu, dass er sich permanent<br />
unwohl fühlt und dass er permanent an die Erkrankung erinnert wird. Das führt zu einer maximalen<br />
Einschränkung der Lebensqualität und damit wird es dem Patienten in der Regel sehr, sehr schlecht<br />
gehen. Das Ziel sollte also sein, den Schmerz zu reduzieren, auf ein vernünftiges Maß. Was wir<br />
nicht mit dem Patienten besprechen können oder was wir ihm nicht versprechen können, ist, dass<br />
er schmerzfrei wird. Das ist heutzutage häufig ein Problem, weil es natürlich schon Initiativen gibt,<br />
denken sie an schmerzfreies Krankenhaus, die solche Dinge unterschwellig implizieren. Das umzusetzen,<br />
ist ausgesprochen schwierig.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Wie sieht eigentlich die optimale <strong>Schmerztherapie</strong> aus?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Eine optimale <strong>Schmerztherapie</strong> sollte so sein, dass der Patient möglichst gut schmerzreduziert ist,<br />
möglichst wenig Nebenwirkungen von der <strong>Schmerztherapie</strong> hat, auch möglichst wenig in seiner<br />
Lebensqualität eingeschränkt ist und möglichst viel wieder an seinem normalen privaten, beruflichen<br />
und sozialen Leben teilnehmen kann.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Und warum werden eigentlich auch Antidepressiva eingesetzt?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Antidepressiva sind Medikamente, die in der <strong>Schmerztherapie</strong> eingesetzt werden, weil sie ein<br />
schmerzmodifizierendes System aktivieren können. Schmerz wird nicht nur von der Peripherie,<br />
vom Bein oder vom Arm in das zentrale Nervensystem gemeldet, sondern es gibt auch eine Meldung<br />
vom Schmerz, vom zentralen Nervensystem, die den nozizeptiven Input, den Schmerzinput,<br />
reduziert und da können Antidepressiva angreifen. Das muss man mit dem Patienten allerdings<br />
besprechen, denn wenn sie den Beipackzettel lesen, dann sehen sie erst mal Depressionen und<br />
sagen: Warum soll ich das nehmen? Ich habe doch gar keine Depressionen?<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Nun gibt es aber nicht nur die medikamentöse Therapie, sondern eben auch begleitende Maßnahmen.<br />
Zu welchen würden Sie raten? Welche machen Sinn?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Was viele von unseren Patienten bekommen, ist eine begleitende Psychotherapie. Wir haben an<br />
unserem Zentrum Psychoonkologen, auch am Krebscentrum sind Psychoonkologen, die mit den<br />
Patienten reden, die mit den Patienten versuchen, psychische Probleme, aber auch Probleme im<br />
sozialen Bereich, in der Interaktion mit Angehörigen zum Beispiel, zu adressieren und das Problem
Seite 3/3<br />
gemeinsam mit dem Patienten zu lösen. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, denn viele Patienten<br />
haben zusätzlich Depressionen und Ängste, die alle dazu führen, dass der Schmerz intensiver<br />
wahrgenommen wird. Wenn wir das nicht mitbesprechen, dann haben wir ein Problem. Es gibt<br />
darüber hinaus noch andere alternative Maßnahmen, die von den Patienten zum Teil angefragt<br />
werden. Dazu gehört zum Beispiel die Akkupunktur. Das kann man sicherlich machen, jedoch ist<br />
die wissenschaftliche Evidenz dazu sehr widersprüchlich. Es ist nicht klar, wann man es machen<br />
kann, auch TENS, Transkutane Elektrische Nervenstimulation, ist sowas, was man machen kann.<br />
Wenn Patienten das wünschen, kann man das anbieten, allerdings nur als zusätzliche Maßnahmen.<br />
Es ersetzt keine medikamentöse <strong>Schmerztherapie</strong>.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Viele Patienten schrecken ja vor Opiaten zurück, weil sie denken: So etwas Starkes hört sich schon<br />
fast nach Lebensende an. Ist das eigentlich verkehrt?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Ich denke, dass es ungerechtfertigt ist, vor den Opioiden Angst zu haben. Das hat einen historischen<br />
Hintergrund. Opioide werden im OP zum Beispiel immer noch als Gifte bezeichnet und die<br />
Medikamente werden im Giftbuch eingetragen. Eine tiefverwurzelte Angst ist auf Seiten der Patienten,<br />
aber auch auf Seiten des medizinischen Personals vorhanden. Diese Angst ist nicht gerechtfertigt,<br />
wenn man diese Substanzen adäquat bei den Patienten einsetzt. Wir können Patienten über<br />
lange Zeit mit Opioiden behandeln und, wenn zum Beispiel bei einem Patienten eine Tumorerkrankung<br />
besteht und die Tumortherapie greift, dann können wir auch mit den Opiaten wieder rausgehen.<br />
Das ist überhaupt kein Problem.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Hätten Sie für unsere Zuschauer vielleicht noch einen abschließenden Rat?<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Der abschließende Rat ist, dass, wenn Sie eine Tumorerkrankung haben und Schmerzen haben,<br />
warten Sie nicht so lange, sprechen Sie Ihren behandelnden Arzt an und fragen nach einer gezielten<br />
<strong>Schmerztherapie</strong>. Wenn Ihr Arzt diese selber nicht vorhalten kann, fragen Sie nach Spezialisten.<br />
Die sind dafür da und Sie bekommen auch in der Regel sehr schnell einen Termin.<br />
Annika de Buhr, Moderatorin:<br />
Professor Sabatowski, vielen Dank für die Information und, dass Sie bei uns waren.<br />
Prof. Dr. Rainer Sabatowski, UniversitätsSchmerzCentrum Dresden:<br />
Gern geschehen.