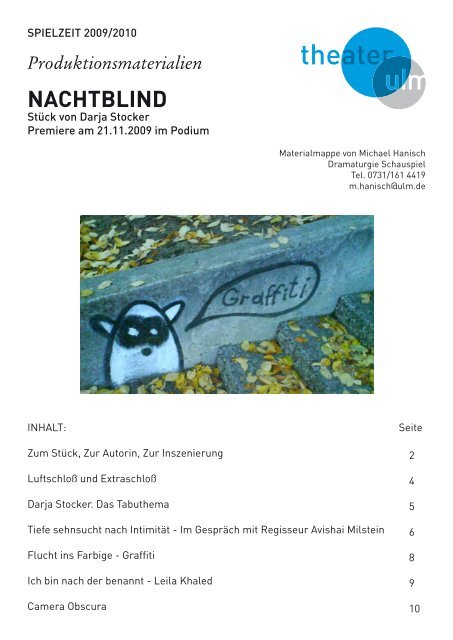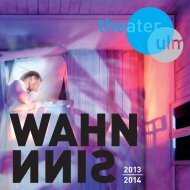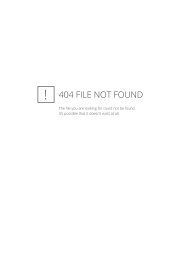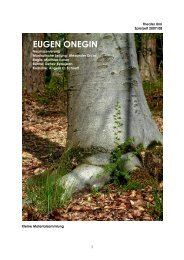NACHTBLIND - Theater Ulm
NACHTBLIND - Theater Ulm
NACHTBLIND - Theater Ulm
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SPIELZEIT 2009/2010<br />
Produktionsmaterialien<br />
<strong>NACHTBLIND</strong><br />
Stück von Darja Stocker<br />
Premiere am 21.11.2009 im Podium<br />
Materialmappe von Michael Hanisch<br />
Dramaturgie Schauspiel<br />
Tel. 0731/161 4419<br />
m.hanisch@ulm.de<br />
INHALT:<br />
Zum Stück, Zur Autorin, Zur Inszenierung<br />
Luftschloß und Extraschloß<br />
Darja Stocker. Das Tabuthema<br />
Tiefe sehnsucht nach Intimität - Im Gespräch mit Regisseur Avishai Milstein<br />
Flucht ins Farbige - Graffiti<br />
Ich bin nach der benannt - Leila Khaled<br />
Camera Obscura<br />
Seite<br />
2<br />
4<br />
5<br />
6<br />
8<br />
9<br />
10
Zum Stück;<br />
Leyla lebt in bedrückenden Verhältnissen. Zu Hause<br />
gibt es ständig Stress, sei es mit der Mutter, die sich in<br />
ihre Arbeit vergräbt statt sich um die eigene Familie zu<br />
kümmern oder dem kleinen, aggressiven Bruder, der<br />
mal wieder von der Schule verwiesen worden ist. Leylas<br />
Freund, den sie nur den „Großen“ nennt, scheint auch<br />
nicht gerade friedliebend, schlägt seine Freundin. Dennoch<br />
ist sie nicht bereit mit ihm zu brechen, ist geradezu<br />
süchtig nach ihm. Diese Spannungen bestimmen ihr<br />
Leben. Leylas große Leidenschaft sind Graffitis, die sie<br />
Nachts sprüht. In diese Situation tritt der verständnisvolle<br />
Moe. Er ist ein Außenseiter, der Probleme mit seiner<br />
Umwelt hat, in der Werkstatt des Vaters unglücklich ist<br />
und eigentlich lieber Physiker wäre.. Mit ihm kann sich<br />
Leyla unterhalten. Und sie kann ihm ihre Graffitis zeigen. Besonders stolz ist sie auf den<br />
Schriftzug „Luftschl“. Eigentlich sollte es Luftschloss heißen, doch sie hat es nicht mehr<br />
geschafft ihn zu vollenden. So aber kann sie wenigstens davon träumen. Vielleicht findet sie<br />
mit Moe eine Möglichkeit ihrem Leben zu entkommen.<br />
Darja Stocker hat ein einfühlsames Stück über zwei Jugendliche und ihre Nöte geschrieben.<br />
Ihre Figuren müssen erst gegen Widerstände ankämpfen, um zueinander zu finden. Verletzungen<br />
und Enttäuschungen haben sie geprägt, aber am Ende scheint ein Schritt Richtung<br />
Zukunft möglich.<br />
Darja Stocker schreibt in einer einfachen, verknappten Sprache, die aber auch poetische<br />
und lyrische Züge enthält. Das Geschehen wird immer wieder von monologischen Szenen<br />
Leylas unterbrochen, die ebenso in die Kategorie Lyrik fallen könnten.<br />
Zur Autorin:<br />
Darja Stocker wird 1983 in Zürich geboren. Mit elf Jahren beginnt sie zu schreiben und verfasst<br />
eine 600 Seiten starke Geschichte, die sie allerdings nicht veröffentlicht. während ihrer<br />
Jugendzeit nahm sie an Produktionen des Jugendspielclubs des <strong>Theater</strong>s an der Sihl teil<br />
und beginnt szenisch zu schreiben. Im Rahmen des Dramenprozessors des <strong>Theater</strong>s an der<br />
Winkelwiese in Zürich entsteht 2003/2004 ihr stück <strong>NACHTBLIND</strong>, das 2006 uraufgeführt<br />
wurde und beim Heidelberger Stückemarkt mit dem ersten Preis ausgezeichnet.<br />
Momentan ist sie Teilnehmerin der Masterclass im szenischen Schreiben unter Leitung von<br />
John von Düffel an der Universität der Künste in Berlin. Am Maxim-Gorki-<strong>Theater</strong> Berlin<br />
wird am 24 September 2009 ihr aktuelles Stück ZORNIG GEBOREN uraufgeführt.<br />
Zur Inszenierung:<br />
Avishai Milstein setzt in seiner Inszenierung auf die Kraft der Emotionen. er beginnt den<br />
Abend mit einer <strong>Theater</strong>situation: Die Figuren sind zunächst Zuschauer, die in ihre eigene<br />
Geschichte hineingeraten. Das zentrale Thema des Abends sind zwischenmenschliche Beziehungen:<br />
die Figuren haben Angst vor der eigenen Körperlichkeit und der des Partners.<br />
Intimität wird dadurch zur Bedrohung, aber auch als Herausforderung. Leyla hat Intimität<br />
bisher nur über Gewalt erfahren. Als sie Moe trifft, muss sie erst lernen ihn als Alternative
wahrzunehmen. Umgekehrt muss Moe erst lernen sich auf ein Gegenüber einzulassen, bisher<br />
hat er ohne Bezug zur Außenwelt gelebt, seine einzige Freundin war die alte Nachbarin.<br />
Für beide Figuren erzählt der Abend die Erfahrung Muster zu erkennen und zu durchbrechen.<br />
Aber auch die anderen Figuren stecken in dieser Intimitätsklemme. Die Mutter versteckt<br />
sich vor den eigenen Problemen, insbesondere in ihrer Ehe und verkriecht sich in die Arbeit.<br />
Und Rico steckt mitten in der Pubertät, also dem Alter, in dem Intimität die größte Bedrohung<br />
darstellt.<br />
Szenisch verdeutlicht sich dieser Vorgang in den Verwandlungen Leylas. Leyla steckt in unterschiedlichen<br />
Verkleidungen, die sie im Laufe des Abends ablegt, bis am Ende wohl das zu<br />
sehen ist, was der „echten Leyla“ am nächsten kommt.<br />
Der Raum, den Mona Hapke für <strong>NACHTBLIND</strong> entworfen hat, orientiert sich an drei Stationen.<br />
In der Mitte der Arena wird ein abgefahrenes Podest, das mit Matratze und Kuscheltieren<br />
dekoriert ist und Leylas Kinderzimmer vertritt. Ein Tisch auf Rollen schafft Raum für<br />
Familienszenen, wobei immer ein Platz für den abwesenden Vater leer bleibt. Und eine wackelige,<br />
von der Decke hängende Ebene symbolisiert den Ort über den Gleisen, dem Rückzugsort<br />
für Leyla und Moe, auf dem sie einander kennen lernen können.
LUFTSCHLOSS UND EXTRASCHLOSS<br />
Leylas große Leidenschaft sind Graffitis.<br />
Leidenschaft? Graffitis sind für Leyla<br />
eher eine Möglichkeit der tristen Welt des<br />
Alltags zu entkommen. Farbenfroh sollen<br />
sie sein. Und eine Botschaft haben. Doch<br />
das Graffiti, das Leyla am meisten bedeutet,<br />
konnte sie nicht vollenden. Ein Teil<br />
fehlt. Und so, sagt sie, muss sich jeder<br />
vier Buchstaben dazudenken: LOSS. Erst<br />
dann kann man die ganze Aussagekraft<br />
des Graffitis verstehen: LUFTSCHLOSS -<br />
ein unerreichbarer Ort, der aber Wärme<br />
und Geborgenheit verspricht.<br />
Auch Moes Welt ist grau. Nicht nur,<br />
dass er mit seinem Leben unzufrieden<br />
ist und in der Werkstatt seines Vaters<br />
nicht glücklich werden kann, sondern grau im wahrsten Sinn des Wortes. Denn Moe ist<br />
farbenblind, seine Welt ist schwarz-weiß, wie ein Fernseher vor fünfzig Jahren. Moe hat<br />
sich ebenfalls ein Schloss gebaut, keine unerreichbare Utopie, sondern ein ganz reales: ein<br />
EXTRASCHLOSS, mit dem er sein Zimmer abschließen kann und sich so vor der Außenwelt<br />
verbarrikadiert.<br />
Leyla träumt sich eine schönere Welt, Moe baut sich seine Welt. Zwei weltfremde Träumer?<br />
Können sich beide ändern, wenn sie zusammen treffen? Nachtblindheit bedeutet zunächst<br />
ganz konkret, dass man im Dunkeln nichts sehen kann. Besonders gefährlich wird es dann,<br />
wenn sich Leyla und Moe nachts auf dem Gerüst über den Gleisen treffen. Hier brauchen<br />
sie einander, um sich Halt zu geben und vor dem Absturz zu beschützen. Sie kommen sich<br />
näher, beginnen einander von den schlimmen und schönen Dingen des Alltags zu erzählen.<br />
So helfen sie sich gegenseitig.<br />
Doch Leyla verschweigt Moe die Gewaltattacken, die sie erfährt.<br />
Aus Scham? Aus Verzweiflung? Aus Sucht nach dem ‚Großen‘?<br />
Leyla sucht Nähe und Geborgenheit und kann doch niemanden<br />
an sich heran lassen. Zu groß ist die Furcht, wieder eine Enttäuschung<br />
zu erfahren. Auf der anderen Seite weiß sie, dass ihr die<br />
Beziehung mit dem ‚Großen‘ nicht gut tut. Doch wie mit ihm brechen,<br />
wenn sie befürchten muss, wieder von ihm verprügelt zu<br />
werden?<br />
Moe kann Leyla helfen. Der schüchterne junge Mann erkennt,<br />
dass es Leyla nicht gut geht. Anfangs ist er noch unerfahren,<br />
weiß nicht, wie er sich der jungen Frau und ihren Problemen gegenüber<br />
verhalten soll. Kurzzeitig denkt er sogar daran, einfach<br />
weg zu sehen. Doch dann tut er instinktiv das Richtige: Er bietet<br />
ihr Geborgenheit und Nähe. Und er kann sie vor dem Großen beschützen.<br />
Leyla und Moe können gemeinsam einen neuen Weg<br />
einschlagen. LUFTSCHLOSS und EXTRASCHLOSS ergänzen sich:<br />
ein perfekter Ort, der Sicherheit und Raum zu Träumen bietet -<br />
die Zukunft als farbenfrohe Welt.
Darja Stocker DAS TABUTHEMA<br />
Zu Beginn stehen persönliche Erlebnisse, etwas oder mehrere Dinge geben mir zu denken<br />
und ich verfolge sie mit erhöhter Aufmerksamkeit. Manchmal ergeben sich daraus Erkenntnisse,<br />
die mich sehr beschäftigen, ich möchte unbedingt wissen, ob sie etwas mit der Wirklichkeit<br />
zu tun haben oder nur persönliche Hirngespinste sind. Wenn ich über die Recherche<br />
(ich recherchiere die ganze Zeit irgendwas) herausfinde, dass bei einer der Sachen tatsächlich<br />
etwas dahinter steckt, bekomme ich den Drang, darüber ein Stück zu schreiben. Bei<br />
Nachtblind begann das, als mir immer mehr jungen Frauen zugaben, in (zum Teil lebensgefährdenden)<br />
Abhängigkeitsverhältnissen zu leben oder gelebt zu haben, obwohl sie sich absolut<br />
emanzipiert gaben. (...) Da Gewalt in gebildeten Schichten tatsächlich ein Tabuthema<br />
ist, fand ich es als „Mitwisserin“ besonders wichtig, etwas darüber zu schreiben. Den Opfern<br />
selbst fällt es schwer, in ihrem Umfeld darüber zu sprechen, da die Ächtung in diesen<br />
Kreisen besonders groß ist. (...) Leylas Mutter hat ihrer Tochter Emanzipation und Selbstbestimmung<br />
beigebracht. Nun erlebt sie, dass ihre Mutter diese Werte, die Leyla als selbstverständlich<br />
ansieht, nicht verteidigt. Sie lässt sich von ihrem Sohn tyrannisieren und von ihrem<br />
Mann betrügen, ohne etwas gegen diese Verletzungen zu unternehmen. Dies ist eine große<br />
Enttäuschung für Leyla, zumal die Mutter dadurch immer mehr an Persönlichkeit verliert.<br />
Dass sie so lange mit einem Gleichaltrigen zusammen bleibt, der sie schlägt, kann also<br />
auch der Versuch sein, der Mutter (und sich selbst) zu beweisen, dass sie es schafft, eine<br />
solch schwierige Beziehung „im Griff“ zu haben. Oder sie versucht, die Mutter zu verletzen,<br />
in dem sie sich selbst Leid zufügt, ihr die Augen zu öffnen – für sich und für die Situation, in<br />
der sich die Familie befindet. Die Mutter ihrerseits ist befremdet von ihrer Tochter, ebenfalls<br />
enttäuscht von ihrem Verhalten und machtlos vor ihrer Verschlossenheit. Ausserdem muss<br />
sie sich ständig als Erziehungsperson beweisen, die die gesamte Verantwortung trägt. In<br />
einem Punkt gleichen sich Mutter und Tochter: Mit ihnen werden Dinge gemacht, gegen die<br />
sie sich durch Konsequenzen im Verhalten schützen / wehren müssten. Der Mutter fehlt<br />
dazu sowohl die Substanz als auch die Kraft. Intellektuell hat sie den Durchblick, doch sie ist<br />
gelähmt in der Umsetzung. Leyla hingegen gelingt der Befreiungsakt. Vielleicht ein Resultat<br />
eben jener Emanzipation, die der Mutter selbst noch nicht mitgegeben wurde?
TIEFE SEHNSUCHT NACH INTIMITÄT<br />
Im Gespräch mit Regisseur Avishai Milstein<br />
Michael Hanisch: Was hat dich bei der Arbeit besonders beschäftigt?<br />
Avishai Milstein: Ich konnte versuchen, mich in die Psyche eines jungen Mädchen zu versetzen.<br />
So eine Erfahrung hatte ich bisher nicht. Ich glaube, dass das Stück das Leben, die<br />
Gefühle, die Erfahrungen und Beziehungserfahrungen Leylas sehr gut und intim vermittelt.<br />
Du hast mit Darja Stocker an der Universität der Künste in Berlin gearbeitet. In einem Interview<br />
betont die Autorin, wie sehr Recherche für sie von Bedeutung ist.<br />
Als ich mit der Klasse der Universität der Künste in Berlin arbeitete, da habe ich die Schüler<br />
immer zur Recherche motiviert. Es gibt das objektive Recherchieren, also das Fakten sammeln,<br />
aber daneben gibt es auch das subjektive Recherchieren. Im Verlauf des subjektiven<br />
Recherchierens muss der Autor oder Regisseur bei sich selbst weiterrecherchieren und sich<br />
fragen, ob er sich mit der Figur, die er erschafft, identfizieren kann. Gefühle und Gedanken,<br />
das ist es, was Figuren ausmacht. Wir wollen ja keinen journalistischen Essay verfassen. Die<br />
Kunst des Schaffenden ist es sich mit seiner eigenen, subjektiven Biographie auszumalen,<br />
wie er selbst unter diesen Umständen gelebt hätte.<br />
Leyla ist der klare Mittelpunkt, und Moe ihr Ankerplatz und Haltepunkt. Was treibt die Figuren<br />
an?<br />
Leyla wird in ihrer Beziehung mit dem Großen heimgesucht. Es ist eine mitreißende, immer<br />
wieder im Enthusiasmus ausufernde Beziehung, die sie mit dem Großen führt. Sie hat etwas<br />
Phantastisches, erkennt aber keine Grenzen an. Leyla weiß zunächst nicht, dass diese Beziehung<br />
ihr auch schadet. Sie wächst ja in einer Familie auf, in der man über Beziehungen<br />
nicht spricht und deshalb fehlt ihr die Erfahrung. An der grenzenlosen, fantastischen Beziehung<br />
droht sie zugrunde zu gehen.<br />
Moe ist anders als sie und kommt aus ganz anderen Verhältnissen. Dass Leyla mit Moe<br />
nicht so verschmelzen kann, wie sie es mit dem Großen getan hat, ist zunächst ihr größtes<br />
Problem. Sie muss sich die Frage stellen: wie gestalte ich Beziehungen? Das hat sie bisher<br />
nicht getan. Aber auch für Moe sind Beziehungen ein neues Terrain. Er ist sehr isoliert aufgewachsen,<br />
in einer auf andere Weise defekten Familie. Er ist sehr schüchtern und kann<br />
sich der Sprache des Verliebtseins gar nicht bedienen.<br />
Und was führt beide Figuren zusammen?<br />
Leyla kann nicht nach Hilfe suchen und Moe ist jemand, der immer helfen möchte. Er will<br />
Leyla helfen, kann aber die Situation zunächst noch nicht einschätzen und die Fakten nicht<br />
sortieren. Am Ende aber kann Leyla ihre Masken fallen lassen und sich helfen lassen. Nur<br />
so kann die Beziehung zwischen Leyla und Moe überhaupt zustande kommen.<br />
Du hast den Konflikt zwischen Leyla und ihrer Mutter noch etwas verdichtet. Was macht diesen<br />
Konflikt aus?<br />
In ihrem großen Monolog am Ende erfahren wir, was sie von ihrer Tochter hält oder erwar-
tet. Sie will komischerweise ihre Tochter nicht als Kind sehen, sondern als ihre beste Freundin.<br />
Darauf hat die Mutter ihr ganzes Leben hingearbeitet. Die Jahre der Kindheit hat sie<br />
verdrängt und verschwendet. Sie hat Leylas gesamte Entwicklung übersprungen, vielleicht<br />
weil sie Leyla nicht gewachsen ist oder weil sie selbst ihre emotionalen Schwierigkeiten und<br />
große Probleme mit Intimität hat. Die große Frage dabei ist, wie kann man noch miteinander<br />
leben, wenn man sich gegen die Entwicklung des Kindes sperrt. Leyla sucht bei der Mutter<br />
nach Anhaltspunkten, wie man eine gesunde Beziehung führen kann. Aber die Mutter<br />
drückt sich vor klaren Antworten. Fast würde ich sagen, die Mutter ist emotional behindert.<br />
Ihre Geschichte ist von Versäumnissen geprägt.<br />
In der Familienkonstellation fehlt der Vater. Sein Platz bleibt leer. Der Tisch ist für jemanden<br />
gedeckt, der nie da ist. Wie gehen die Figuren damit um?<br />
Die Abwesenheit des Vaters ist für die Kinder ein Rätsel. Die Lösung dieses Rätsels würde<br />
natürlich auch ein neues Licht auf die Mutter werfen, aber sie will vor den Kindern keine<br />
Rechenschaft über die Beziehung mit dem Vater ablegen. Vielleicht hat sie Angst, auf ihr<br />
eigenes Versagen hingewiesen zu werden. Leyla und Rico bringt dieses Schweigen dazu,<br />
anderweitig nach Lösungen zu suchen.<br />
Wird dadurch der Große für Leyla zum Ersatzvater?<br />
So sehen wir das nicht, wobei es ganz lustig ist, weil wir tatsächlich zu Beginn der Proben<br />
darüber gesprochen haben, in wie weit Vater und Großer identisch sein könnten.<br />
Aber ich glaube, der Große ist Leylas Wunsch nach einer Liebe, die nicht wahr ist, und die<br />
Tiefe Sehnsucht nach Intimität.
FLUCHT INS FARBIGE – GRAFFITI<br />
Graffiti, in der Einzahl spricht man von einem Graffito, ist ein Oberbegriff für visuell wahrnehmbare<br />
Elemente, die anonym oder ungefragt auf Oberflächen angebracht werden. Das<br />
Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich kratzen. Man bezeichnete<br />
damit zunächst die Kratzputztechnik, bei der in den Putz Motive eingeritzt wurde. Ab ca.<br />
1850 verwendeten auch Archäologen den Begriff, um damit in Wände und Scherben eingeritzte<br />
Botschaften zu bezeichnen. Schon in der Antike war es üblich, an wichtigen Orten,<br />
Sehenswürdigkeiten oder Tempeln seinen Namen in die Wände einzuritzen und somit auf<br />
seine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Auch heute kann man solche Graffiti noch an<br />
vielen Sehenswürdigkeiten beobachten, z.B. im Treppenhaus des <strong>Ulm</strong>er Münsters - wenn<br />
auch der Filzstift das Messer abgelöst hat.<br />
Heute dominiert der Charakter der inoffiziellen Botschaft über die technische Ausführung,<br />
denn in den letzten Jahrzehnten hat der Begriff eine erneute Wandlung erfahren. Auch hat<br />
sich die Jugendkultur mittlerweile auch legale Flächen erobert, an denen sie ihre Botschaften<br />
und Bilder mit Hilfe von Spraydosen und Filzstiften hinterlassen kann. Diese Auftragsarbeit<br />
bzw. Duldung steht im Widerspruch zur eigentlichen Graffiti-Definition, denn Klassifikationsmerkmal<br />
des Graffitis ist, dass die Botschaft ungefragt bzw. illegal angebracht wird.<br />
In der Regel ist ein Graffito ein Einzelstück, d.h. in seiner Form gibt es nur an einer Stelle.<br />
Das heißt aber nicht, dass es spontan entstanden sein muss. Graffiti-Künstler planen ihre<br />
Werke in der Regel, suchen sich dann eine passende Wand oder das richtige Objekt aus, um<br />
dort der Umwelt ihre Botschaft zu hinterlassen. Ziel der Sprayer ist es eine persönliche oder<br />
politische Botschaft zum Ausdruck zu bringen. Das geht vom Liebesgeständnis, über politische<br />
Parolen bis hin zu Aufrufen zum Widerstand gegen gesellschaftliche und politische<br />
Veränderungen. Oder aber das Graffiti soll über das persönliche Befinden Auskunft geben:<br />
in vielen Graffitis erfährt man vom Seelenleben des Künstlers, von Liebe, Wut, Trauer oder<br />
Träumer. Es handelt sich dabei um den Versuch, sich über das Medium Wand oder andere<br />
Objekte Gehör zu verschaffen oder ein Ventil für seine Gefühle zu finden.<br />
Graffitis erfreuen aber nicht jeden. Von einem Großteil der Bevölkerung werden sie als Vandalismus<br />
und Verbrechen aufgefasst. Das liegt zum einen daran, dass Wände ungefragt gestaltet<br />
werden, zum anderen, dass ein Hausbesitzer ein Graffito als Straftat und Sachbeschädigung<br />
wahrnimmt. Auf der anderen Seite befassen sich mittlerweile auch zahlreiche<br />
Soziologen und Psychologen mit Graffiti.<br />
Sie wollen die Botschaften hinter<br />
den Bildern erkennen, suchen nach den<br />
Gründen und wollen auf diese Weise<br />
Aufschluss über Entwicklungen in der<br />
Gesellschaft erlangen. Und sie betonen,<br />
dass Graffiti egal ob geritzt oder gesprayt<br />
seit den ersten Hochkulturen der<br />
Antike in jeder Epoche zu finden sind.
ICH BIN NACH DER BENANNT - LEILA KHALED:<br />
TERRORISTIN ODER FREIHEITSKÄMPFERIN?<br />
Als sich Leyla und Moe kennenlernen, fällt ein Name,<br />
der heute vielen vielleicht nicht mehr bekannt ist:<br />
Leila Khaled. Von ihren Eltern wurde Leyla nach ihr<br />
benannt - ein deutlicher Hinweis auf das Erbe der<br />
Generation 68. Moe aber bezeichnet Leila Khaled als<br />
Terroristin, während Leyla ihre „Namenspatronin“ als<br />
Freiheits- und Friedenskämpferin lobt. Wer ist diese<br />
Frau, die mit solch unterschiedlichen Meinungen beschrieben<br />
wird?<br />
1969 ging ein Bild um die Welt: Das Foto einer jungen<br />
Frau mit Palästinenserkopftuch auf dunklem Haar<br />
und einer Kalaschnikow in der Hand. Am 29. August<br />
1969 hatte Leila Khaled zusammen mit Komplizen das Flugzeug TWA 840 von Rom nach<br />
Athen entführt. Sie zwang den Piloten über ihre Heimatstadt Haifa zu fliegen, wo sie 1944<br />
als Tochter palästinensischer Eltern zur Welt kam. Das Flugzeug landete schließlich in Damaskus,<br />
alle Passagiere wurden freigelassen und das Flugzeug medienwirksam vor laufenden<br />
Fernsehkameras gesprengt. Leila Khaled wurde zwar festgenommen, aber von den<br />
syrischen Behörden nur fünf Tage später wieder auf freien Fuss gesetzt. Leila Khaled ließ<br />
sich ihr Gesicht operativ verändern, um weitere Aktionen planen zu können. So entführte sie<br />
am 6. September 1970, während des Schwarzen September, den Flug El Al 219 von Amsterdam<br />
nach New York City. Der Versuch schlug fehl, als ein an Bord befindlicher Sicherheitsmann<br />
einen ihrer Begleiter, den Nicaraguaner Joseph Arguello, erschoss. Leila Khaled<br />
wurde überwältigt, nachdem sie eine Handgranate geworfen hatte, die jedoch nicht zündete.<br />
Der flug konnte in London notlanden. Nach 28 Tagen wurde sie von Terroristen freigepresst,<br />
obwohl Israel einen Auslieferungsantrag gestellt hatte.<br />
Bis heute engagiert sich Leila Khaled für diverse Palästinenserorganisationen. Sie bleibt der<br />
ursprünglichen, marxistischen Ausrichtung der palästinesischen Freiheitsbewegung treu<br />
und lehnt islamistischen Terror ab. Dennoch ist sie bis heute umstritten, unter anderem, da<br />
sie das Existenzrecht Israels nicht anerkennt.
CAMERA OBSCURA<br />
Das Prinzip der Camera Obscura ist den Menschen von alters her bekannt. Bereits im 5.<br />
Jahrhundert v. Chr. werden die grundlegenden optischen Prinzipien in chinesischen Texten<br />
niedergeschrieben. Im 9. Jahrhundert wird über ein projiziertes Bild in einer verdunkelten<br />
Pagode berichtet.<br />
Im westlichen Kulturkreis fand die Entdeckung der Bildprojektion durch ein Loch kaum später<br />
statt. Bereits Aristoteles beschrieb im 4. Jahrhundert v. Chr. Erscheinungen, die er allerdings<br />
nicht erklären konnte. Er stellte fest, daß Sonnenlicht, welches durch Flechtwerk<br />
hindurch schien, ein Bild der Öffnungen, durch die es gelangte, auf den Boden projizierte.<br />
Anläßlich einer Sonnenfinsternis entdeckte er, daß die winzigen Öffnungen im Blattwerk<br />
eines Baumes Abbilder der Sonne auf dem Boden erzeugten.<br />
Bis zum Verständnis der Erscheinungen sollten noch viele Jahrhunderte vergehen. Ein erster<br />
Meilenstein auf dem langen Weg war die Entdeckung arabischer Gelehrter im 10. Jahrhundert,<br />
daß sich Licht geradlinig ausbreitet. Sie fanden dies durch Experimente mit der<br />
Projektion des Bildes dreier Kerzen durch ein kleines Loch heraus. Die erzeugten Abbilder<br />
ließen sich durch eine gedachte Gerade durch das Loch mit ihren Originalen verbinden.<br />
In den folgenden Jahrhunderten wurden die bisher erkannten Abbildungsmöglichkeiten mit<br />
Hilfe eines Lochs vor allem von Astronomen zum Studium des Sonnenlichts und von Künstlern<br />
als Zeichenhilfe für Studien der Perspektive genutzt. Bekannte Namen wären hier Leonardo<br />
da Vinci oder Albrecht Dürer.<br />
Da Vinci beschrieb als erster eine richtige Camera Obscura im eigentlichen Wortsinn: „Wenn<br />
die Fassade eines Gebäudes, oder ein Platz, oder eine Landschaft von der Sonne beleuchtet<br />
wird und man bringt auf der gegenüberliegenden Seite in der Wand einer nicht von der Sonne<br />
getroffenen Wohnung ein kleines Löchlein an, so werden alle erleuchteten Gegenstände<br />
ihr Bild durch diese Öffnung senden und werden umgekehrt erscheinen“.<br />
Nunmehr wurde das Prinzip der Camera Obscura in vielfältiger Weise verwendet. So brachte<br />
der italienische Mathematiker und Astronom Toscanelli 1475 einen bronzenen Ring mit einer<br />
kleinen Öffnung in einem Fenster der Kathedrale in Florenz an. An sonnigen Tagen wird<br />
ein Bild der Sonne auf den Boden der Kathedrale geworfen. Eine Mittagsmarke am Boden<br />
gibt die Möglichkeit zur Zeitbestimmung. Dieser Ring kann heute noch besichtigt werden.<br />
Eine ähnliche Vorrichtung wurde 1580 von päpstlichen Astronomen genutzt, um Papst Gregor<br />
XIII. zu beweisen, daß die Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche auf den 11. statt wie eigentlich<br />
korrekt auf den 21. März fiel. Dies führte zur berühmten gregorianischen Kalenderreform.
Im 16. Jahrhundert kamen zwei verschiedene<br />
Arten der Camera Obscura auf. Neben der bekannten<br />
- ein verdunkelter Raum mit einer kleinen<br />
Öffnung in der Wand -, die z.B. von Frisius<br />
zum Studium einer Sonnenfinsternis genutzt<br />
wurde, führte der deutsche Astronom Johannes<br />
Kepler, der auch den Ausdruck „Camera Obscura“<br />
(= „dunkler Raum“) prägte, eine Abart ein,<br />
indem er das Loch durch eine Linse ersetzte.<br />
Diese Linse erzeugte ein helleres Bild, das allerdings<br />
nun nur noch auf eine bestimmte Entfernung<br />
fokussiert werden konnte. Kepler war es auch, der später als erster eine tragbare<br />
Camera Obscura benutzte.<br />
Das 19. Jahrhundert brachte die Erfindung der begehbaren Camera Obscura als Unterhaltungsmittel<br />
für die Bevölkerung. Durch geschickte Drehmechanismen im Dach sowie durch<br />
Verwendung einer Meniskuslinse ist es in diesen Räumen möglich, ein relativ helles Rundumbild<br />
der Umgebung auf eine waagrechte Projektionsfläche zu werfen. Das Bild kann so<br />
von vielen Menschen gleichzeitig betrachtet werden. Solche begehbaren Cameras Obscuras<br />
gibt es auch heute noch.<br />
Mit der Erfindung der Fotografie dauerte es auch nicht lange, bis die ersten Versuche unternommen<br />
wurden, das in der Camera Obscura projezierte Bild auf lichtempfindlichen Materialien<br />
festzuhalten. Damit war die Lochkamera geboren.<br />
Fotografieren mit der Lochkamera ist in vieler Hinsicht vergleichbar mit der „normalen Fotografie“.<br />
Der Hauptunterschied liegt darin, daß die verwendete Kamera bzw. deren Objektiv<br />
keine Linse aufweist. Stattdessen besitzt sie eine sehr kleine Öffnung (das „Pinhole“), welche<br />
das Bild auf die lichtempfindliche Schicht (Film oder Papier) projeziert. Diese Tatsache<br />
erfordert eine andere Arbeitsweise mit der Kamera (hauptsächlich weil die Belichtungszeiten<br />
sehr lang werden) und erzeugt Bilder, die sich von Aufnahmen mit einer üblichen Kamera<br />
in mehrfacher Hinsicht unterscheiden.<br />
Während eine Linse ein Bild dadurch erzeugt, daß sie alle auf sie treffenden Lichtstrahlen<br />
von jedem Punkt des Aufnahmeobjekts in einem gemeinsamen Brennpunkt vereinigt, erzeugt<br />
das Loch einer Lochkamera überhaupt keinen Brennpunkt. Idealerweise wäre das<br />
Loch ein Punkt, also nur so groß, daß von jedem Punkt des Objekts lediglich ein Lichtstrahl<br />
passieren könnte. Dieser Lichtstrahl träfe den Film natürlich ebenfalls nur in einem Punkt.<br />
Ein Lichtstrahl von einem anderen Punkt des Objekts würde damit auch den Film an einem<br />
anderen Punkt treffen. Die Summe aller durch das Loch einfallenden Strahlen würde so ein<br />
exaktes Abbild des Objekts auf dem Film erzeugen. Würde man die Filmebene vor oder zurück<br />
bewegen, bliebe das Bild unverändert, lediglich seine Größe würde sich abhängig von<br />
der Entfernung zum Loch ändern.<br />
In Wahrheit ist das Loch natürlich niemals nur ein Punkt. Es werden also von jedem Punkt<br />
des Aufnahmeobjekts mehrere Lichtstrahlen ankommen und auf dem Film auftreffen. Ab<br />
hängig von der Größe des Lochs werden diese Lichtstrahlen etwas gestreut. Dies ist ein<br />
Grund, warum Aufnahmen mit der Lochkamera immer etwas weicher (unschärfer) sind als<br />
Aufnahmen durch ein Linsensystem. Ein zweiter Grund liegt darin, daß an den Lochrändern<br />
Beugungserscheinungen auftreten und die unmittelbar am Lochrand passierenden Lichtstrahlen<br />
somit aus ihrer Bahn gelenkt werden.<br />
Da es keinen Brennpunkt gibt, wird eine Lochkameraaufnahme über das gesamte Bildfeld<br />
gleichmäßig scharf (soweit man hier von Schärfe sprechen kann, s.o.). In anderen Worten:
es gibt keine Beschränkung der Tiefenschärfe wie bei der Fotografie mit Hilfe von Linsen.<br />
Sehr nahe Objekte (Entfernung Objekt-Loch kleiner als Entfernung zwischen Loch und Film)<br />
werden allerdings aufgrund der Divergenz der von jedem Punkt des Objekts eintreffenden<br />
Lichtstrahlen unschärfer abgebildet