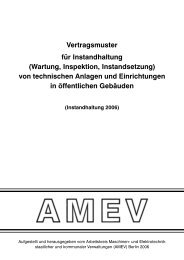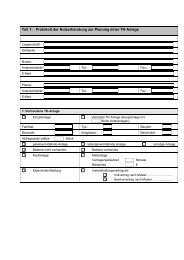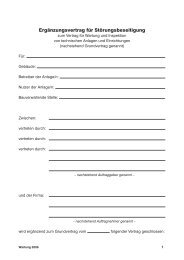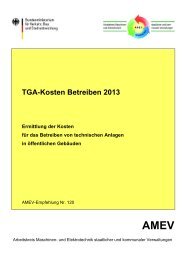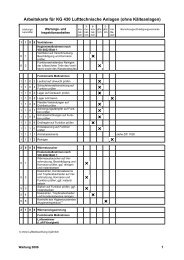Trennungsabstand bei Blitzschutzanlagen
Trennungsabstand bei Blitzschutzanlagen
Trennungsabstand bei Blitzschutzanlagen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AMEV<br />
<strong>Trennungsabstand</strong><br />
<strong>bei</strong> <strong>Blitzschutzanlagen</strong><br />
(Infoblatt <strong>Trennungsabstand</strong>)<br />
Stand: 20.04.2012
Das AMEV-Infoblatt "<strong>Trennungsabstand</strong>" greift ein Praxisproblem <strong>bei</strong> der Ausführung von<br />
<strong>Blitzschutzanlagen</strong> auf. Es benennt die diesbezüglichen normativen Anforderungen und gibt<br />
Empfehlungen für Planung und Bau.<br />
Hintergrund<br />
Nach Ansicht verschiedener Baudienststellen führt die Blitzschutznorm DIN EN 62305-3<br />
„Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen“ zu einem höheren<br />
Planungsaufwand und höheren Baukosten. Die Vergrößerung der Trennungsabstände oder die<br />
Ausführung als getrennte bzw. isolierte Anlage kann zu einem Interessenkonflikt mit der<br />
Architektur führen. Auch <strong>bei</strong> Baudenkmälern kann die Umsetzung dieser Blitzschutznorm<br />
problematisch sein.<br />
Es wurde geprüft,<br />
- ob und inwieweit die Anforderungen an den <strong>Trennungsabstand</strong> normativ verschärft wurden<br />
und<br />
- wie die Anforderungen im Hinblick auf Planung, Bau und Architektur umgesetzt werden<br />
können.<br />
Allgemein<br />
Aufgabe des Blitzschutzes ist u. a. die Vermeidung gefährlicher Funkenbildung.<br />
Funkenbildung kann auftreten zwischen dem äußeren Blitzschutzsystem und metallenen<br />
Installationen, elektrischen und elektronischen Systemen am und im Gebäude sowie in die<br />
bauliche Anlage eingeführten äußeren leitenden Teilen, Kabeln und Leitungen (z. B. Rohrleitung,<br />
Kommunikationsanschluss).<br />
Eine gefährliche Funkenbildung wird <strong>bei</strong> Einhaltung des erforderlichen <strong>Trennungsabstand</strong>es mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit verhindert.<br />
Der <strong>Trennungsabstand</strong> ist seit über 30 Jahren Bestandteil der nationalen Normung zum<br />
Blitzschutz.<br />
Entwicklung der Normung<br />
Mindestens seit 1982 enthalten die Blitzschutznormen Regelungen zum <strong>Trennungsabstand</strong>. Die<br />
VDE 0185 Teil 1 vom November 1982 definiert den "Näherungsabstand". Alle nachfolgenden<br />
Blitzschutznormen enthalten Vorgaben zum Trennungs- bzw. Sicherheitsabstand.<br />
- DIN 57 185 Teil 1 / VDE 0185 Teil 1: 1982-11<br />
o Ziffer 6.2 Näherungen<br />
• Näherungen zu metallenen Installationen<br />
• Näherungen zu elektrischen Anlagen<br />
mit Formel zur Berechnung des Näherungsabstandes D<br />
Infoblatt <strong>Trennungsabstand</strong> Seite 2 von 5
- ENV 61024-1: 1995<br />
o Ziffer 3.2 Trennung von Leitern des Äußeren Blitzschutzes<br />
• <strong>Trennungsabstand</strong> D muss größer als der Sicherheitsabstand s sein<br />
• Berechnungsvorschrift für s = k i *k c /k m *l<br />
mit<br />
k i – Koeffizient, der von der gewählten Schutzklasse des Blitzschutzsystems<br />
abhängt<br />
k c – Koeffizient, der von der geometrischen Anordnung abhängt<br />
k m – Koeffizient, der vom Material in der Trennungsstrecke abhängt<br />
l – die Länge der Ableitungseinrichtung, gemessen von dem Punkt der<br />
Annäherung bis zum nächstliegenden Punkt des Blitzschutz-<br />
Potentialausgleichs<br />
• Tabellen zur Bestimmung der Koeffizienten k<br />
- Weitere Vornomen<br />
o z. B. DIN V VDE V 0185-3: 2002-11<br />
- DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): 2006-10<br />
o Ziffer 6.3 Elektrische Isolierung von äußeren Blitzschutzsystemen<br />
• Abstand d zwischen Fangeinrichtung/Ableitung und (baulichen) metallenen<br />
Installationen muss größer als der <strong>Trennungsabstand</strong> s sein<br />
• Berechnungsvorschrift für s = k i *k c /k m *l<br />
mit<br />
k i – Koeffizient, abhängig von der gewählten Schutzklasse des LPS<br />
k c – Koeffizient, abhängig vom Blitzstrom, der in den Ableitungen fließt<br />
k m – Koeffizient, abhängig vom elektrischen Isolierstoff (der Trennungsstrecke)<br />
l – die Länge entlang der Fangeinrichtung oder der Ableitung in Meter von<br />
dem Punkt, an dem der <strong>Trennungsabstand</strong> ermittelt werden soll, bis zum<br />
nächstliegenden Punkt des Potentialausgleichs<br />
• Tabellen zur Bestimmung der Koeffizienten k<br />
- DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): 2011-10<br />
o Ziffer 6.3 Elektrische Isolierung von äußeren Blitzschutzsystemen<br />
• Abstand d zwischen Fangeinrichtung/Ableitung und (baulichen) metallenen<br />
Installationen muss größer als der <strong>Trennungsabstand</strong> s sein<br />
• Berechnungsvorschrift für s = k i *k c /k m *l<br />
mit<br />
k i – Koeffizient, abhängig von der gewählten Schutzklasse des LPS<br />
k c – Koeffizient, abhängig vom Blitzstrom, der in den Ableitungen fließt<br />
k m – Koeffizient, abhängig vom elektrischen Isolierstoff (der Trennungsstrecke)<br />
l – die Länge entlang der Fangeinrichtung oder der Ableitung in Meter von<br />
dem Punkt, an dem der <strong>Trennungsabstand</strong> ermittelt werden soll, bis zum<br />
nächstliegenden Punkt des Potentialausgleichs oder der Erdung<br />
• Tabellen zur Bestimmung der Koeffizienten k (angepasst wurden Tabelle 12 und<br />
Anhang C)<br />
• Anhang E, Abschnitt E.6.3 (Hinweise zur Berechnung des <strong>Trennungsabstand</strong>es)<br />
Bewertung<br />
Die normativen Hinweise, Empfehlungen und Maßnahmen zum Blitzschutz dienen dem Schutz<br />
von Personen, Gebäuden, elektrischen und elektronischen Anlagen. Werden sie berücksichtigt<br />
Infoblatt <strong>Trennungsabstand</strong> Seite 3 von 5
und umgesetzt, reduziert sich die Gefährdung durch direkte sowie indirekte Blitzeinschläge und<br />
damit die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch Blitzstrom.<br />
Mit der Überar<strong>bei</strong>tung der Blitzschutznormen wurde auch die Berechnung des<br />
<strong>Trennungsabstand</strong>s fortgeschrieben. Die Begrifflichkeiten „Näherungs-“, „Sicherheits-“,<br />
„<strong>Trennungsabstand</strong>“ und die zugehörigen Formelzeichen wurden mehrfach geändert. Die<br />
Berechnung des „<strong>Trennungsabstand</strong>s“ wurde wiederholt modifiziert (z. B. Anpassung der zu<br />
berücksichtigenden Länge l der Ableitung (Definition von l), des Koeffizienten k i (Wert) und des<br />
Koeffizienten k c (Werte für vereinfachtes Verfahren und Standardverfahren (s. DIN EN 62305-3<br />
Anhang C)). Grundsätzliche Änderungen sind nach 1995 jedoch nicht festzustellen.<br />
Statistiken, welche eine Minimierung der Schadenshäufigkeit durch die erhöhten Anforderungen<br />
an den <strong>Trennungsabstand</strong> belegen, existieren nach Angaben des Verbandes der Sachversicherer<br />
und von Blitzschutzfirmen nicht.<br />
Beim Neubau, <strong>bei</strong> Änderungen und Erweiterungen an Bestandsanlagen kann die Einhaltung des<br />
<strong>Trennungsabstand</strong>es problematisch sein. Ein größerer <strong>Trennungsabstand</strong> kann den<br />
Installationsaufwand erhöhen und die Anlagenkonfiguration erschweren.<br />
„Primäre“ Maßnahmen<br />
„Primäre“ Maßnahmen zur Einhaltung und ggf. Reduzierung des <strong>Trennungsabstand</strong>es ergeben<br />
sich aus der Berechnungsformel für den <strong>Trennungsabstand</strong> und den zugehörigen Tabellen für die<br />
Koeffizienten.<br />
- s steigt mit höherer Schutzklasse (z. B. Faktor 2 zwischen Schutzklasse I und III)<br />
- s steigt, wenn Isolierstoff nicht Luft (<strong>bei</strong> Luft Faktor 0,5)<br />
- s steigt <strong>bei</strong> höherem Blitzstrom<br />
Folgende Maßnahmen reduzieren den <strong>Trennungsabstand</strong>:<br />
• Vermaschung des Fangleitungsnetzes<br />
• Erhöhung der Anzahl der Ableitungen<br />
• geringer Abstand zur nächsten Ableitung<br />
- s steigt mit der Länge der Ableitungseinrichtungen<br />
Folgende Maßnahme reduziert den <strong>Trennungsabstand</strong>:<br />
• Verringerung des Abstandes zum nächstliegenden Punkt des Potentialausgleichs oder<br />
der Erdung<br />
„Primär“ ist auch zu prüfen, ob die elektrischen und metallenen Installationen<br />
• umverlegt werden können, die den <strong>Trennungsabstand</strong> zu den Ableitungen der<br />
Fangeinrichtung nicht einhalten bzw.<br />
• so verlegt werden können, dass der <strong>Trennungsabstand</strong> dauerhaft gewährleistet ist.<br />
Die „primären“ Maßnahmen zur Reduzierung bzw. zum „Entfall“ des <strong>Trennungsabstand</strong>es sind<br />
umzusetzen, sofern dadurch die normativen Vorgaben zum <strong>Trennungsabstand</strong> eingehalten und<br />
dauerhaft gewährleistet werden können. Sie haben Vorrang vor den Alternativmaßnahmen.<br />
Alternativmaßnahmen<br />
Kann der notwendige <strong>Trennungsabstand</strong> auf Grund der Gebäudeform (z. B. hohe Gebäude), der<br />
vorgegebenen Nutzung, Lage, Abstände und Materialien (z. B. im Bestand) oder der Ästhetik<br />
(z. B. Denkmalschutz) nicht eingehalten werden, sind folgende Alternativmaßnahmen zu prüfen:<br />
Infoblatt <strong>Trennungsabstand</strong> Seite 4 von 5
1. Einsatz hochspannungsfest isolierter Ableitungen oder<br />
2. Einbinden metallener Installationen und Leitungen in den Blitzschutz durch Herstellen einer<br />
blitzstromstragfähigen Verbindung.<br />
Bei hochspannungsfest isolierten Ableitungen gemäß Nr. 1 handelt es sich um Leitungen aus<br />
Kupferdraht mit einer dickwandigen hochspannungsfesten Isolierung. Diese Leitungen<br />
ermöglichen die Einhaltung des <strong>Trennungsabstand</strong>es nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)<br />
zu elektrisch leitenden Teilen. Insbesondere <strong>bei</strong> architektonisch anspruchsvollen Fassaden und<br />
Dächern sollte diese technische Lösung in Erwägung gezogen werden.<br />
Bei der Alternativmaßnahme gemäß Nr. 2 werden innerhalb des errechneten <strong>Trennungsabstand</strong>s<br />
liegende metallene Installationen sowie elektrische und informationstechnische Leitungen<br />
blitzstromstragfähig über Blitzstrom-Ableiter (SPD Typ 1) mit dem Schutzpotentialausgleich<br />
(Haupterdungsschiene) verbunden. Durch diese Maßnahme werden die Trennungsabstände auf<br />
„0“ gesetzt.<br />
Nr. 2 hat den Nachteil, dass im Falle eines Blitzeinschlages ein Teil des Blitzstroms durch das<br />
Gebäudeinnere fließt. Metallene Installationen und Leitungen im Gebäude können Blitzstrom<br />
führen. Der zu den Erdungssystemen im Gebäude fließende Blitzstrom bewirkt neu einzuhaltende<br />
Trennungsabstände zu benachbarten Installationen und Leitungen. Weiterhin können<br />
elektromagnetische Beeinträchtigungen auftreten. Bei der Konzeption des inneren Blitzschutzes<br />
(s. DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4)) sind daher die Auswirkungen auf elektrische und<br />
elektronische Systeme in der Nähe blitzstromführender „Ableitungen“ zu berücksichtigen.<br />
Soweit machbar und aus architektonischen Gründen vertretbar sollte die Alternativmaßnahme<br />
gemäß Nr. 2 nur im besonderen Einzelfall angewendet werden.<br />
Für Gebäude mit Photovoltaik-Stromversorgungssystemen wird empfohlen, dass informative<br />
Beiblatt 5 zur DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) anzuwenden. Es ergänzt die DIN EN 62305-3<br />
und fasst die Erkenntnisse zum <strong>Trennungsabstand</strong> und zu weiteren Maßnahmen des Blitz- und<br />
Überspannungsschutzes für Photovoltaik-Systeme zusammen. Im Besonderen wird verwiesen<br />
auf<br />
- das Flussdiagramm (Bild 8) zur Vorgehensweise <strong>bei</strong> der Auswahl der<br />
Blitzschutzmaßnahmen und von Überspannungsschutzgeräten sowie<br />
- das Praxis<strong>bei</strong>spiel zur Berechnung der Trennungsabstände (Anhang C).<br />
Hinweis<br />
Die Mängelfreiheit einer Leistung setzt voraus, dass technisch ordnungsgemäß gehandelt worden<br />
ist. Bei Anwendung gültiger Normen kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass die<br />
allgemein anerkannten Regeln der Technik berücksichtigt sind. Da private technische Regeln nur<br />
Empfehlungscharakter haben, steht es den Handelnden jedoch frei, auch außerhalb von Normen<br />
(z. B. EN, DIN) technisch ordnungsgemäß zu handeln. Die Selbstverantwortung des Handelnden<br />
nimmt dann jedoch zu.<br />
Infoblatt <strong>Trennungsabstand</strong> Seite 5 von 5