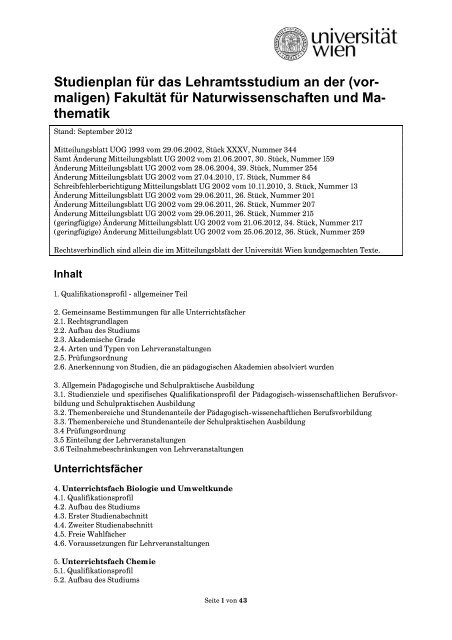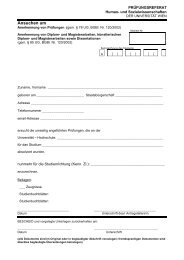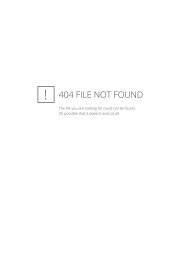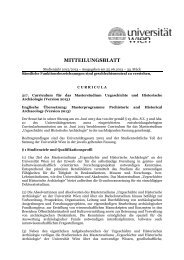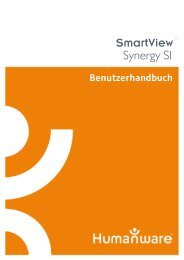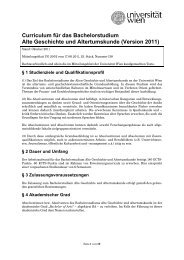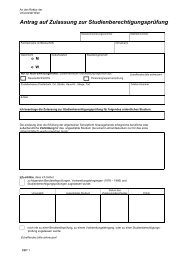Curriculum/Studienplan - Student Point - Universität Wien
Curriculum/Studienplan - Student Point - Universität Wien
Curriculum/Studienplan - Student Point - Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Studienplan</strong> für das Lehramtsstudium an der (vormaligen)<br />
Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik<br />
Stand: September 2012<br />
Mitteilungsblatt UOG 1993 vom 29.06.2002, Stück XXXV, Nummer 344<br />
Samt Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 21.06.2007, 30. Stück, Nummer 159<br />
Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 28.06.2004, 39. Stück, Nummer 254<br />
Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 27.04.2010, 17. Stück, Nummer 84<br />
Schreibfehlerberichtigung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 10.11.2010, 3. Stück, Nummer 13<br />
Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2011, 26. Stück, Nummer 201<br />
Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2011, 26. Stück, Nummer 207<br />
Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2011, 26. Stück, Nummer 215<br />
(geringfügige) Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 21.06.2012, 34. Stück, Nummer 217<br />
(geringfügige) Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 25.06.2012, 36. Stück, Nummer 259<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Inhalt<br />
1. Qualifikationsprofil - allgemeiner Teil<br />
2. Gemeinsame Bestimmungen für alle Unterrichtsfächer<br />
2.1. Rechtsgrundlagen<br />
2.2. Aufbau des Studiums<br />
2.3. Akademische Grade<br />
2.4. Arten und Typen von Lehrveranstaltungen<br />
2.5. Prüfungsordnung<br />
2.6. Anerkennung von Studien, die an pädagogischen Akademien absolviert wurden<br />
3. Allgemein Pädagogische und Schulpraktische Ausbildung<br />
3.1. Studienziele und spezifisches Qualifikationsprofil der Pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung<br />
und Schulpraktischen Ausbildung<br />
3.2. Themenbereiche und Stundenanteile der Pädagogisch-wissenchaftlichen Berufsvorbildung<br />
3.3. Themenbereiche und Stundenanteile der Schulpraktischen Ausbildung<br />
3.4 Prüfungsordnung<br />
3.5 Einteilung der Lehrveranstaltungen<br />
3.6 Teilnahmebeschränkungen von Lehrveranstaltungen<br />
Unterrichtsfächer<br />
4. Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde<br />
4.1. Qualifikationsprofil<br />
4.2. Aufbau des Studiums<br />
4.3. Erster Studienabschnitt<br />
4.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
4.5. Freie Wahlfächer<br />
4.6. Voraussetzungen für Lehrveranstaltungen<br />
5. Unterrichtsfach Chemie<br />
5.1. Qualifikationsprofil<br />
5.2. Aufbau des Studiums<br />
Seite 1 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
5.3. Erster Studienabschnitt<br />
5.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
5.5. Freie Wahlfächer<br />
5.6. Ergänzung zur Prüfungsordnung<br />
5.7. Anmerkungen und Erläuterungen zum Unterrichtsfach Chemie<br />
Seite 2 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
6. Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung<br />
6.1. Qualifikationsprofil<br />
6.2. Aufbau des Studiums<br />
6.3. Erster Studienabschnitt<br />
6.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
6.5. Freie Wahlfächer<br />
7. Unterrichtsfach Mathematik<br />
7.1. Qualifikationsprofil<br />
7.2. Aufbau des Studiums<br />
7.3. Erster Studienabschnitt<br />
7.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
7.5. Freie Wahlfächer<br />
8. Unterrichtsfach Physik<br />
8.1. Qualifikationsprofil<br />
8.2. Aufbau des Studiums<br />
8.3. Erster Studienabschnitt<br />
8.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
8.5. Freie Wahlfächer und Empfehlungen<br />
1. Qualifikationsprofil<br />
Die Lehramtsstudien der naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichtsfächer dienen der<br />
fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Berufsausbildung unter Einschluß einer schulpraktischen<br />
Ausbildung in zwei Unterrichtsfächern für das Lehramt an Höheren Schulen. Als Fachleute für<br />
die Vermittlung naturwissenschaftlich-mathematischer Kenntnisse erwerben die Absolventinnen und<br />
Absolventen jedoch auch Qualifikationen, die ihnen andere Berufsmöglichkeiten eröffnen. Beispiele<br />
hierfür sind Lehrtätigkeit an anderen Schultypen oder in der Erwachsenenbildung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
in Unternehmen einschlägiger Bereiche oder Tätigkeit im Wissenschaftsjournalismus und -<br />
management.<br />
Das primäre Ziel des Studiums ist der Erwerb eines breiten, wissenschaftlich fundierten Grundlagenwissens<br />
des jeweiligen Unterrichtsfachs. Diese Ausbildung soll die Absolventinnen und Absolventen<br />
befähigen, der wissenschaftlichen Entwicklung des Fachs in den Jahren ihres Berufslebens zu folgen<br />
und so ihr Unterrichtsfach stets eigenständig aktualisieren zu können. Von den Absolventinnen und<br />
Absolventen wird das Bestreben nach einer engagierten und optimalen Ausübung ihres Berufs und die<br />
Bereitschaft zur berufsbegleitenden Fortbildung erwartet. Die Studien orientieren sich sowohl am<br />
Forschungsgegenstand der beteiligten Fächer als auch am Lehrplan der höheren Schulen.<br />
Für die naturwissenschaftliche Methodik ist der Gewinn von Erkenntnissen durch genaue und systematische<br />
Naturbeobachtung charakteristisch. Die Absolventinnen und Absolventen sind mit den<br />
grundlegenden Experimenten vertraut und können die Phänomene ihres gewählten Fachs experimentell<br />
demonstrieren sowie Schülerexperimente anleiten. Dies schließt den sicheren Umgang mit Geräten<br />
und Gefahrenquellen sowie Verantwortungsbewußtsein für die Sicherheit der Schülerinnen und<br />
Schüler ein.<br />
Die Naturwissenschaften und die Mathematik haben einen festen Platz in der an Höheren Schulen<br />
vermittelten Allgemeinbildung. Sie sind für das Verständnis der Vorgänge des täglichen Lebens notwendig<br />
und sie haben Bedeutung für eine Vielzahl technischer, ingenieurwissenschaftlicher, medizinischer,<br />
biologischer und pharmazeutischer Berufe, wie auch für die Entwicklung der Philosophie und<br />
der Wissenschaftstheorie. Jedes Gemeinwesen profitiert davon, daß seine Bürgerinnen und Bürger ein<br />
gewisses mathematisch naturwissenschaftliches Grundverständnis besitzen, das eine sachorientierte<br />
Meinungsbildung und Mitentscheidung ermöglicht. Dies schließt auch die Auseinandersetzung mit der<br />
Frauen- und Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften ein. Von Lehrkräften wird erwartet,<br />
daß sie ihr Fach in interdisziplinäre Zusammenhänge stellen können. Die freien Wahlfächer bieten die<br />
Möglichkeit, fachübergreifendes Wissen und entsprechende Kompetenzen zu erwerben.<br />
Seite 3 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Neben der unabdingbaren fachlichen Kompetenz erfordert die Vermittlung der Fachkenntnisse aber<br />
auch didaktische, sprachliche und soziale Kompetenz, insbesondere hinsichtlich der Überwindung von<br />
veralteten Geschlechterrollen. Die Absolventinnen und Absolventen haben eine Schulung in den modernen<br />
Grundlagen und Methoden der Fachdidaktik und Pädagogik sowie eine schulpraktische Ausbildung<br />
erfahren und kennen die wesentlichen rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit als Lehrkräfte<br />
und Prüferinnen oder Prüfer ihrer Schülerinnen oder Schüler.<br />
Durch die Wahl einer Diplomarbeit in einem der gewählten Unterrichtsfächer können die Studierenden<br />
das Wissen in einem Spezialgebiet vertiefen und allgemeine Einblicke in die wissenschaftliche<br />
Forschung gewinnen<br />
2. Gemeinsame Bestimmungen für alle Unterrichtsfächer<br />
2.1. Rechtsgrundlagen<br />
Gesetzliche Grundlage ist das Universitätsstudiengesetz 1997, das Universitätsorganisationsgesetz<br />
1993, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, sowie die Verordnungen der Bundesministerin<br />
oder des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Einrichtung von Studien in der<br />
jeweils geltenden Fassung. Rechtsgrundlage sind weiters die Beschlüsse des Akademischen Senates<br />
und des Fakultätskollegiums der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der Universität<br />
<strong>Wien</strong> sowie der Wirtschaftsuniversität <strong>Wien</strong>.<br />
2.2. Aufbau des Studiums<br />
Die Studien sind in der Weise organisiert, daß die Lehrveranstaltungen jedes Abschnittes in jeweils<br />
zwei Semestern absolviert werden können (das schließt die Diplomarbeit nicht mit ein), sodaß die<br />
Unterrichtsfächer nicht nur parallel, sondern auch sequentiell studiert werden können.<br />
a. Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />
Studierende, die ab Wintersemester 2011/12 das Studium beginnen, haben die Studieneingangs- und<br />
Orientierungsphase gemäß der Verordnung über die Einführung der Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />
in den Lehramtsstudien der Universität <strong>Wien</strong>, veröffentlicht am 29.06.2011 im Mitteilungsblatt<br />
der Universität <strong>Wien</strong>, 26. Stück, Nummer 218 verpflichtend vor dem weiteren Studium zu<br />
absolvieren.<br />
b. Erster Studienabschnitt<br />
Der Erste Studienabschnitt dient der Grundausbildung. Die Studiendauer des Ersten Studienabschnittes<br />
beträgt 4 Semester. Der Erste Studienabschnitt wird mit der Ersten Diplomprüfung abgeschlossen.<br />
c. Zweiter Studienabschnitt<br />
Der zweite Studienabschnitt dient der Weiterführung, der Vertiefung und der speziellen Ausbildung,<br />
sowie der Berufsvorbereitung für das Lehramt an höheren Schulen. Die Studiendauer des Zweiten<br />
Studienabschnittes beträgt 4 Semester bzw. für das Unterrichtsfach, in dem die Diplomarbeit abgefaßt<br />
wird, 5 Semester. Die Abfassung der Diplomarbeit soll in 6 Monaten möglich sein. Der Zweite Studienabschnitt<br />
und das Studium wird mit der Zweiten Diplomprüfung abgeschlossen.<br />
2.3. Akademische Grade<br />
Sofern das Thema der Diplomarbeit aus einem naturwissenschaftlichen oder mathematischen Unterrichtsfach<br />
gewählt wurde, ist den Absolventinnen oder Absolventen des Lehramtsstudiums der akademische<br />
Grad „Magistra der Naturwissenschaften“ oder „Magister der Naturwissenschaften“, lateinische<br />
Bezeichnung „Magistra rerum naturalium“ oder „Magister rerum naturalium“, zu verleihen.<br />
Seite 4 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
2.4. Arten und Typen von Lehrveranstaltungen<br />
Im Unterschied zum AHStG verzichtet das UniStG auf eine Definition von Lehrveranstaltungsarten<br />
(Vorlesung, Übung, Seminar, Proseminar, ...) und überläßt dies den Studienkommissionen. In Übereinstimmung<br />
mit dem Gesetzgeber erscheint aus unserer Sicht eine Unterscheidung traditioneller Art<br />
problematisch bis kaum möglich zu sein. Zum einen lassen sich die verschiedenen Arten von Lehrveranstaltungen<br />
kaum eindeutig definieren bzw. voneinander abgrenzen. Zum anderen geht die Entwicklung<br />
eindeutig in Richtung integrierter Lehrveranstaltungen, die nach traditioneller Diktion als Kombination<br />
von etwa Vorlesung plus Seminar plus Übung (oder ähnlich) zu bezeichnen wären. Im vorliegenden<br />
<strong>Studienplan</strong> wird primär nur zwischen zwei Arten von Lehrveranstaltungen unterschieden, die<br />
in ihrer Definition unmittelbar auf die Prüfungsordnung Bezug nehmen: LV mit punktueller<br />
LVPrüfung am Ende der LV sowie LV mit immanentem Prüfungscharakter. Wo es aufgrund didaktischer<br />
Notwendigkeiten notwendig erscheint, werden genauere Definitionen gegeben.<br />
Lehrveranstaltungen der Art „LP“ sind mit einer Lehrveranstaltungs-Prüfung nach dem Ende der<br />
Lehrveranstaltung abzuschließen. Sie dienen der Einführung in die Tatsachen, Methoden und Lehrmeinungen<br />
verschiedener Teilbereiche des Studiums.<br />
Lehrveranstaltungen der Art „IP“ besitzen immanenten Prüfungscharakter. Sie dienen der exemplarischen<br />
Vertiefung der Lehrinhalte, wobei die Studierenden in angemessenem Ausmaß zur Mitarbeit<br />
und zum eigenständigen Lösen konkreter Aufgaben angehalten werden. Die Leistungsfeststellung<br />
erfolgt im Rahmen der Lehrveranstaltung (Mitarbeit usw.), nicht ausschließlich durch eine punktuelle<br />
Prüfung.<br />
Folgende Typen von Lehrveranstaltungen sind vorgesehen:<br />
VO Vorlesungen<br />
Vorlesungen führen in didaktische aufbereiteter Weise in Teilbereiche des Faches und seiner Methoden<br />
ein.<br />
KO Konversatorien:<br />
Dienen zur Wiederholung und Erläuterung von Lehrinhalten.<br />
UE Übungen:<br />
In Übungen werden durch selbständige Arbeit Fertigkeiten erworben und die praktische Auseinandersetzung<br />
mit wissenschaftlichen Inhalten gefördert. Übungen können auch außerhalb des Studienorts<br />
bzw. im Gelände stattfinden.<br />
SE Seminare:<br />
Diese dienen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden eines Teilgebietes<br />
des Faches durch Referate und schriftliche Arbeiten.<br />
PS Proseminare:<br />
Dienen der wissenschaftlichen Vertiefung von erlernten Stoffinhalten.<br />
EX Exkursionen:<br />
Dienen der Veranschaulichung von Themenbereichen außerhalb des Studienortes bzw. im Gelände.<br />
ID Interdisziplinäre Projekte:<br />
Solche Projekte verbinden fachwissenschaftliche, fachdidaktische und schulpraktische Zielsetzungen.<br />
Kombinierte Lehrveranstaltungen verbinden die Zielsetzungen der einzelnen Lehrveranstaltungen.<br />
Falls es sich durch die räumliche und personelle Situation nicht anders ergibt, gilt für Parallellehrveranstaltungen<br />
im selben Studienjahr eine Teilungszahl von 20. Sind Lehrveranstaltungen gefährlich<br />
und/oder besonders lehr- und/oder geräteintensiv gilt eine Teilungszahl von 10.<br />
Seite 5 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
2.5. Prüfungsordnung<br />
Entsprechend dem UniStG sind<br />
Lehrveranstaltungsprüfungen die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten dienen,<br />
die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden,<br />
Fachprüfungen hingegen die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten in einem<br />
Fach dienen, wobei Fächer thematische Einheiten sind, deren Inhalt und Methodik im Regelfall durch<br />
mehrere zusammenhängende Lehrveranstaltungen vermittelt werden.<br />
Diplomprüfungen sind die Prüfungen, mit deren positiver Beurteilung ein Studienabschnitt abgeschlossen<br />
wird.<br />
Gesamtprüfungen dienen dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten in mehr als einem Fach.<br />
a. Erste Diplomprüfung<br />
Die Prüfungen der Ersten Diplomprüfung werden abgelegt<br />
(1) durch die erfolgreiche Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „IP“ („immanenter<br />
Prüfungscharakter“).<br />
(2) durch Lehrveranstaltungsprüfungen über den Stoff der im Stundenrahmen für das jeweilige Fach<br />
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „LP“<br />
oder<br />
durch Fachprüfungen bei einer Prüferin oder einem Prüfer mit entsprechender Lehrbefugnis, wobei<br />
der Stoff dieser Fachprüfung(en) nach Inhalt und Umfang mit dem der Lehrveranstaltungen vergleichbar<br />
sein muß, welche dadurch ersetzt werden (die entsprechenden Stundenzahlen sind auf dem<br />
Prüfungszeugnis anzugeben).<br />
oder<br />
durch eine kommissionelle Gesamtprüfung am Ende des Studienabschnittes vor dem Prüfungssenat.<br />
Auch eine Kombination der unter (2) angeführten Prüfungstypen ist möglich. Es können auch Prüfungen<br />
über einzelne Lehrveranstaltungen durch Fachprüfungen ersetzt werden. Bei einer allfälligen Gesamtprüfung<br />
sind bereits abgelegte Lehrveranstaltungs- und Fachprüfungen zu berücksichtigen. In<br />
diesem Fall beschränkt sich der Gegenstand der Gesamtprüfung auf den noch nicht durch Lehrveranstaltungs-<br />
und Fachprüfungen nachgewiesenen Teil des Prüfungsstoffes.<br />
Für die Wiederholung von Prüfungen gilt § 58 UniStG.<br />
b. Zweite Diplomprüfung<br />
Die Zweite Diplomprüfung ist in zwei Teilen abzulegen.<br />
A. Die Prüfungen des ersten Teils der Zweiten Diplomprüfung werden abgelegt<br />
(1) durch die erfolgreiche Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „IP“ („immanenter<br />
Prüfungscharakter“).<br />
(2) durch Lehrveranstaltungsprüfungen über den Stoff der im Stundenrahmen für das jeweilige Fach<br />
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „LP“<br />
oder<br />
durch Fachprüfungen bei einer Prüferin oder einem Prüfer mit entsprechender Lehrbefugnis, wobei<br />
der Stoff dieser Fachprüfung(en) nach Inhalt und Umfang mit dem der Lehrveranstaltungen vergleichbar<br />
sein muß, welche dadurch ersetzt werden (die entsprechenden Stundenzahlen sind auf dem<br />
Prüfungszeugnis anzugeben).<br />
oder<br />
durch eine kommissionelle Gesamtprüfung am Ende des Studienabschnittes vor dem Prüfungssenat.<br />
Seite 6 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Auch eine Kombination der unter (2) angeführten Prüfungstypen ist möglich. Es können auch Prüfungen<br />
über einzelne Lehrveranstaltungen durch Fachprüfungen ersetzt werden. Bei einer allfälligen Gesamtprüfung<br />
sind bereits abgelegte Lehrveranstaltungs- und Fachprüfungen zu berücksichtigen. In<br />
diesem Fall beschränkt sich der Gegenstand der Gesamtprüfung auf den noch nicht durch Lehrveranstaltungs-<br />
und Fachprüfungen nachgewiesenen Teil des Prüfungsstoffes.<br />
Für die Wiederholung von Prüfungen gilt § 58 UniStG.<br />
B. Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfung<br />
Voraussetzung für die Zulassung zum zweiten Teil der Zweiten Diplomprüfung ist die positive Beurteilung<br />
der Diplomarbeit, sowie die Absolvierung der schulpraktischen Ausbildung. Das Thema der Diplomarbeit<br />
ist einem der im <strong>Studienplan</strong> eines der beiden Unterrichtsfächer festgelegten Fächer einschließlich<br />
der Fachdidaktik zu entnehmen. Die oder der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen<br />
oder aus einer Anzahl von Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer<br />
auszuwählen. Die Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, daß für eine Studierende<br />
oder einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist (§<br />
61, 2 UniStG).<br />
(1) Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfung ist in Form einer maximal einstündigen kommissionellen<br />
Gesamtprüfung vor dem Prüfungssenat abzulegen, wobei aus jedem Unterrichtsfach jeweils eine<br />
Prüferin oder ein Prüfer zu wählen ist. Dabei ist den Prüferinnen oder den Prüfern annähernd dieselbe<br />
Zeit einzuräumen.<br />
oder<br />
(2) Die zweite Teil der zweiten Diplomprüfung ist durch zwei maximal jeweils einstündige kommissionelle<br />
Gesamtprüfungen vor dem Prüfungssenat abzulegen, wobei zunächst zwei Prüferinnen oder Prüfer<br />
aus dem einen Unterrichtsfach zu wählen sind, dann zwei Prüferinnen oder Prüfer aus dem anderen<br />
Unterrichtsfach zu wählen sind. Dabei ist den Prüferinnen oder den Prüfern annähernd dieselbe<br />
Zeit einzuräumen.<br />
c. Abtausch von Lehrveranstaltungen<br />
Auf Antrag (an den Studiendekan) können Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnittes im<br />
Ausmaß von bis zu 11 Semesterstunden gegen Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnittes<br />
abgetauscht werden, wobei die in den Unterrichtsfächern vorgesehenen speziellen Bedingungen zu<br />
beachten sind.<br />
d. Vorziehen von Lehrveranstaltungen<br />
Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnittes können in den ersten Studienabschnitt<br />
vorgezogen werden, wobei die in den Unterrichtsfächern vorgesehenen besonderen Bedingungen zu<br />
beachten sind.<br />
e. Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl<br />
Für die Vergabe beschränkter Plätze ist in erster Linie eine Reihung der Studierenden aufgrund bisheriger<br />
Beurteilungen solcher Lehrveranstaltungen vorzunehmen, die mit der betreffenden Lehrveranstaltung<br />
in engem fachlichen Zusammenhang stehen, wobei Studierende mit besseren Leistungen<br />
bevorzugt werden.<br />
f. Anerkennung von Lehrveranstaltungen aus einem anderen Unterrichtsfach<br />
Sind Lehrveranstaltungen aus einem Unterrichtsfach mit Lehrveranstaltungen eines anderen Faches<br />
zumindest gleichwertig, so sind diese anzuerkennen.<br />
Seite 7 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
2.6. Anerkennung von Studien, die an pädagogischen Akademien<br />
absolviert wurden.<br />
Die Anerkennung erfolgt durch den Vorsitzenden der Studienkommission (UniStG, Anlage I, Abs.<br />
3.8).<br />
Dabei ist auf besondere Bestimmungen in den einzelnen Unterrichtsfächern Rücksicht zu nehmen.<br />
3. Allgemein-Pädagogische und Schulpraktische Ausbildung<br />
3.1 Studienziele und spezifisches Qualifikationsprofil der Pädagogisch-wissenschaftlichen<br />
Berufsvorbildung und Schulpraktischen<br />
Ausbildung<br />
a. Ziele<br />
Die Pädagogisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung für Lehramtsstudierende (PWB) und die Schulpraktische<br />
Ausbildung für Lehramtsstudierende (SPA) an der Universität <strong>Wien</strong> haben folgendes übergreifendes<br />
Bildungsziel:<br />
Durch die PWB und die SPA sollen die Studierenden persönliche, soziale und fachliche Kompetenzen<br />
erwerben, die es ihnen ermöglichen, eigenverantwortlich, auf wissenschaftlicher Grundlage und in<br />
sozialer Verantwortung den Anforderungen des Lehrberufs an allgemeinbildenden höheren Schulen,<br />
berufsbildenden höheren Schulen oder anderen Schulen und Lehrinstitutionen zu entsprechen.<br />
Zu diesen Kompetenzen zählen im besonderen:<br />
• die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken im Bereich der Erziehungswissenschaft,<br />
• die Fähigkeit zu methodisch geleitetem Planen, Durchführen und Evaluieren in pädagogischdidaktischen<br />
Handlungssituationen,<br />
• die Fähigkeit zum eigenständigen weiteren Erwerb von Wissen und Können (Weiterbildung),<br />
• die Fähigkeit zur Einnahme einer pädagogischen Haltung gegenüber den Lernenden und zur<br />
Teamarbeit mit anderen Lehrenden.<br />
Weiters zählen dazu:<br />
• die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion in pädagogischen, fachwissenschaftlichen,<br />
didaktischen und kommunikativen Angelegenheiten,<br />
• die Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit den gegebenen Strukturen<br />
des Bildungssystem und mit deren gesellschaftspolitischen Voraussetzungen,<br />
• Sensibilität für bildungsrelevante gesellschaftliche Veränderungen und Problembestände<br />
(z.B.: Gesellschaft und Umwelt, Berufswelt und Arbeit, Ethik und Wissenschaft), insbesondere<br />
in Bezug auf die damit verbundenen Herausforderungen an die pädagogische Verantwortung,<br />
• die Fähigkeit und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Spannungen<br />
• und Konflikten, z.B. im Bereich der Geschlechterproblematik, in der Auseinandersetzung mit<br />
Minderheiten und Randgruppen und der Verwirklichung der Menschenrechte,<br />
• Sensibilität und Verständnis für Entwicklungen im Bereich der Ethnien, der religiösen<br />
• Überzeugungen, der kulturellen Vielfalt und der geschlechtsspezifischen Anliegen<br />
• die Fähigkeit und Bereitschaft, auf die vielfältigen konkreten Herausforderungen im Berufsalltag<br />
kreativ und eigenverantwortlich zu reagieren.<br />
b. Stundenausmaß und Durchführung<br />
b.1 Die PWB umfasst 14 SS. Daher beträgt das Stundenausmaß für die PWB 7 SS je Unterrichtsfach.<br />
Die SPA umfasst 11 SS (165 Stunden), die im Rahmen von 12 Wochen zu<br />
absolvieren sind (gemäß UniStG Anlage 1 Z 3.6).<br />
Seite 8 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
b.2 Die PWB und die Phase 1 der SPA (pädagogisches Praktikum - 3 SS) sind nur einmal im Rahmen<br />
des Lehramtsstudiums zu absolvieren, die Phase 2 der SPA (fachbezogenes Praktikum) ist in jedem<br />
Unterrichtsfach im Ausmaß von 3 SSt. bzw. 45 Stundeneinheiten zu absolvieren.<br />
b.3 Das fachbezogene Praktikum der schulpraktischen Ausbildung wird (im jeweiligen Unterrichtsfach)<br />
vom Betreuungslehrer an der jeweiligen Schule eigenverantwortlich in Übereinstimmung mit<br />
den vom Institut für Bildungswissenschaft/LehrerInnenbildung formulierten Richtlinien geleitet.<br />
b.4 Es wird empfohlen, bei der schulpraktischen Ausbildung nach Möglichkeit Unterrichtserfahrungen<br />
in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2 bzw. in den allgemeinbildenden und in den berufsbildenden<br />
höheren Schulen einzubeziehen.<br />
b.5 Die Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (Einführung in die Schulpädagogik<br />
und Theorie der Schule) ist Voraussetzung für das weitere Studium der Pädagogischwissenschaftlichen<br />
Berufsvorbildung und Schulpraktischen Ausbildung.<br />
b.6 Die Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (Einführung in die Schulpädagogik<br />
und Theorie der Schule) und des Proseminars ist Voraussetzung für das Pädagogische Praktikum.<br />
b.7 Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen des zweiten Abschnitts ist die Absolvierung des ersten<br />
Abschnitts der Pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung und des Pädagogischen Praktikums<br />
Voraussetzung.<br />
b.8 Für nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen im zweiten Abschnitt ist die Absolvierung der<br />
Studieneingangs- und Orientierungsphase (Einführung in die Schulpädagogik und Theorie der Schule)<br />
und die Absolvierung des Proseminars Voraussetzung.<br />
b.9 Für die Fachbezogenen Praktika und die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion* ist die Absolvierung<br />
des ersten Abschnitts der Pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung und des Pädagogischen<br />
Praktikums Voraussetzung. Die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion* soll im selben<br />
Semester wie ein Fachbezogenes Praktikum bzw. nach Abschluss des Fachbezogenen Praktikums 1<br />
absolviert werden.<br />
* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />
3.2 Themenbereiche und Stundenanteile der Pädagogischwissenschaftlichen<br />
Berufsvorbildung<br />
a. Übersicht<br />
1. Studienabschnitt SS<br />
1. Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />
Einführung in die Schulpädagogik und Theorie der Schule Vorlesung 2<br />
2. Proseminar Proseminar 2<br />
3. Bildungstheorie und Gesellschaftskritik (unter Berücksichtigung<br />
Vorlesung 1<br />
der Frauen- und Geschlechterforschung)<br />
4. Pädagogische Probleme der ontogenetischen Entwicklung<br />
Vorlesung mit Übung 1<br />
2. Studienabschnitt SS<br />
Aus den folgenden Lehrveranstaltungen sind zwei in Form eines Seminars zu absolvieren:<br />
5. Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens Seminar oder Vorlesung 2<br />
6. Theorie und Praxis des Erziehens und Beratens Seminar oder Vorlesung 2<br />
Seite 9 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
7. Theorie und Praxis der schulischen Organisationsentwicklung<br />
8. Vertiefendes oder erweiterndes Wahlpflichtfach aus<br />
Pädagogik<br />
Seminar 2<br />
Seminar oder Vorlesung 2<br />
14<br />
b. Erläuterungen<br />
b.1. Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />
Ziele: In der Studieneingangs- und Orientierungsphase erhalten die Studierenden Information über<br />
die Struktur des Lehramtsstudiums an der Universität <strong>Wien</strong>. Sie führt in die pädagogische Professionstheorie<br />
und in die Themenbereiche der wissenschaftlichen Pädagogik ein.<br />
Themenbereiche:<br />
▪ Gesellschaftliche und pädagogische Funktionen der Schule<br />
▪ Parameter, Ansatzpunkte und jeweiliger Stand der Schulreform<br />
▪ Binnenstrukturen und organisatorische Differenzierung des Schulsystems<br />
▪ Schulsysteme im internationalen Vergleich<br />
▪ Nahtstellen und Problemzonen im österreichischen Bildungssystem<br />
▪ Historische Entwicklung der Schule: Evolutionsmodelle, Realgeschichte<br />
▪ <strong>Curriculum</strong>entwicklung<br />
▪ Leitkategorien des schulpolitischen Diskurses (z.B. offene Curricula, Schulklima,<br />
Schulautonomie, Schulprofil, Leitbildentwicklung, Qualitätssicherung,<br />
Organisationsentwicklung, Alternativ- und Privatschulen, Aspekte der<br />
Frauenforschung zum Schulbereich)<br />
b.2. Proseminar:<br />
• Auseinandersetzung mit Berufsbild Lehrer/in und verwandten Berufsfeldern<br />
• Reflexion der eigenen Schulerfahrungen<br />
• Erkundung der Berufsrolle und des Berufsbildes<br />
• Grundlegung pädagogischer Handlungskompetenzen<br />
• Erkundungen an Schulen und anderen Bildungsinstitutionen<br />
b.3. Bildungstheorie und Gesellschaftskritik<br />
Themenbereiche:<br />
• Ausgangspunkte, Grundfragen und kritische Funktion von Bildungstheorie<br />
• Schule zwischen Bildungsauftrag und Ausbildungserfordernissen<br />
• Schule als Produkt und Faktor gesellschaftlicher Veränderung (auch in Hinsicht auf die<br />
• Frauen- und Geschlechterforschung)<br />
• massenmediale Information zwischen Aufklärung und Manipulation<br />
• gesellschaftlich-historische Konstituierung von Kindheit und Jugend, aktuelle Entwicklungstendenzen<br />
• Leitkategorien des bildungspolitischen Diskurses (z.B.: Schulbilder/Lehrerbilder, Medienkritik,<br />
Bildung in der globalen Risikogesellschaft, lebensbegleitendes Lernen, Kommunitarismus)<br />
b.4. Pädagogische Probleme der ontogenetischen Entwicklung<br />
Themenbereiche:<br />
• Konzepte ontogenetischer Entwicklung (z.B.: Piaget, Erikson, Kohlberg, Holzkamp) und<br />
• ihre pädagogischen Implikationen<br />
• Lerntheorien und ihre pädagogischen Implikationen<br />
• Veränderte Entwicklungsbedingungen und Lebensentwürfe Jugendlicher<br />
• Phasen und Stufen der kognitiven und moralischen Entwicklung im Kindes-, Jugend- und<br />
Jungerwachsenenalter<br />
Seite 10 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
• Entwicklungsprobleme im Kindes-, Jugend- und Jungerwachsenenalter<br />
• Fragen der Geschlechterproblematik<br />
b.5.Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens<br />
Themenbereiche:<br />
• Theoretische und empirische Analysen typischer Lehr-Lern-Situationen<br />
• Didaktische Theorien und ihre Anwendung (z.B.: exemplarisches Prinzip, innere Differenzierung,<br />
Wissenschaftsorientierung)<br />
• Unterrichtsmethoden und ihre Anwendung (z.B.: Lehrvortrag, Team-Teaching Kleingruppenunterricht,<br />
Projektunterricht, Projektmanagement)<br />
• Planung, Durchführung und Evaluation von Lehr-Lern-Prozessen<br />
• Moderationskonzepte und -techniken<br />
• Persönliche Dimension der Lehr-Lern-Interaktion und soziales Lernen<br />
• Problemfelder des Unterrichts (z.B.: Disziplin, Leistungsbeurteilung, heterogene Lernvoraussetzungen)<br />
• Entwicklung individueller Curricula<br />
b.6. Theorie und Praxis des Erziehens und Beratens<br />
Themenbereiche:<br />
• Theoretische und empirische Analysen typischer Erziehungs- und Beratungs-Situationen<br />
• Pädagogische Theorien und ihre Anwendung (z.B.: Erziehungsstile, Vermittlung von Normen<br />
und Werten, Kommunikationsregeln, Sozialisations- vs. Erziehungskonzepte)<br />
• Gesprächsführung<br />
• Gewalt, Aggression, Konfliktlösung und -prävention<br />
• Interventions- und Beratungskonzepte (z.B.: systemisch, psychoanalytisch)<br />
• Kooperation mit Familien und außerschulischen Beratungs- und Betreuungsinstitutionen<br />
• Grenzen der eigenen Beratungskompetenz<br />
• Sozialpädagogische Aufgabenstellungen der Schule (z.B.: Suchtproblematik, sexueller Mißbrauch,<br />
Medienkonsum, Verwahrlosung)<br />
• Schulische Integration behinderter Kinder und Jugendlicher<br />
b.7. Theorie der schulischen Organisationsentwicklung<br />
Themenbereiche:<br />
• Schule als Organisation und professionelle Anforderungen an ihre Mitglieder<br />
• Schulischer Bildungsauftrag versus betriebswirtschaftlich optimierte Organisationskonzepte<br />
• Ansätze und methodische Konzepte zur schulischen Organisationsentwicklung (z.B.: Organisationsberatung,<br />
Supervision, Handlungsforschung, Gruppendynamik, TQM)<br />
• Teamkooperation<br />
• Projektmanagement<br />
• LehrerInnen als ForscherInnen im Praxisfeld Schule<br />
• Humanisierung und Demokratisierung von Schule<br />
b.8. Vertiefendes oder erweiterndes Wahlpflichtfach aus Pädagogik<br />
Empfohlene Themenbereiche:<br />
• Ausbildung zur Fachtutorin/ zum Fachtutor (v.a. für die Studieneingangsphase)<br />
• EDV und Multimediatechnologie im Unterricht<br />
• Methodologie und Methodik der Schul- und Unterrichtsforschung<br />
• Schulentwicklung und pädagogische Professionsforschung<br />
• Drogenprävention und Umgang mit Abhängigkeiten<br />
• Lernmotivation (Förderung von Lernbereitschaft, Neugierde, Betroffenheit)<br />
• Lehrerverhalten, Selbsterfahrung für Lehrer/innen (unter Berücksichtigung der Frauenund<br />
Geschlechterforschung)<br />
• Lernen lernen (Zeiteinteilung, Projektgestaltung, Arbeitsbedingungen, ....)<br />
• Lerntechniken (mentales Training, Entspannungsübungen im Unterricht, Abbau von Lernwiderständen,<br />
Unterstützung der Lehrstoffaufnahme, Lerntypen u.ä.)<br />
Seite 11 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
• Gruppendynamische Phänomene im Unterricht<br />
• Integration im Unterricht und Förderung der Autonomie von behinderten Menschen<br />
• Begabungen entdecken, Begabte fördern<br />
• Lern- und Motivationsstörungen<br />
• Medien im Unterricht<br />
• Projektunterricht<br />
• Ökologie im Unterricht<br />
• Benoten und Beurteilen in der Schule<br />
• Schulrecht<br />
• Spielpädagogik<br />
• Multikulturelles Lernen<br />
• vertiefende Lehrveranstaltungen zu den verschiedenen Unterrichtsprinzipien<br />
• Lebensbegleitendes Lernen zwischen Massenmedien und Expertenwissen: Information zwischen<br />
Aufklärung und Manipulation<br />
• Jugendforschung: auf dem Weg zum mündigen und selbstbestimmten Mitglied der Gesellschaft;<br />
gesellschaftliche Konstituierung von Kindheit und Jugend<br />
• Themenbereiche von 2-7 mit besonderer Berücksichtigung des jeweiligen Unterrichtsfaches.<br />
Seite 12 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
3.3 Themenbereiche und Stundenanteile der Schulpraktischen<br />
Ausbildung<br />
a. Übersicht<br />
ab dem 3. Semester<br />
9. Schulpraktikum Phase 1: Pädagogisches Praktikum<br />
SS<br />
Einheiten<br />
Seminar 2 30<br />
ab dem 5. Semester<br />
SS Einheiten<br />
10. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 1<br />
im Unterrichtsfach 1, Dauer: 4 Wochen<br />
Seminar 3 45<br />
11. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 2<br />
im Unterrichtsfach 2, Dauer: 4 Wochen<br />
Seminar 3 45<br />
12. Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion*: Diese Lehrveranstaltung ist<br />
im selben Semester wie das fachbezogene Praktikum 1 oder 2 zu absolvieren.<br />
3 45<br />
11 165<br />
* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />
b. Erläuterungen<br />
b.9. Schulpraktikum Phase 1: Pädagogisches Praktikum<br />
• Einführung in die Beobachtung und Auswertung von Unterricht<br />
• Einführung in die Planung und Durchführung von Unterricht<br />
• Selbständige Durchführung von Unterrichtssequenzen<br />
b.10. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 1 (im Unterrichtsfach 1)<br />
• Unterrichtsbeobachtungen mit Vor- und Nachbesprechungen<br />
• Mindestens 5 Stunden selbständige Durchführung von Unterricht<br />
• Fachbezogene Voraussetzungen und weitere begleitende Lehrveranstaltungen sind gegebenenfalls<br />
in den Studienplänen bzw. <strong>Studienplan</strong>punkten der einzelnen Unterrichtsfächer geregelt.<br />
b.11. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 2 (im Unterrichtsfach 2)<br />
• Unterrichtsbeobachtungen mit Vor- und Nachbesprechungen<br />
• Mindestens 5 Stunden selbständige Durchführung von Unterricht<br />
• Fachbezogene Voraussetzungen und weitere begleitende Lehrveranstaltungen sind gegebenenfalls<br />
in den Studienplänen bzw. <strong>Studienplan</strong>punkten der einzelnen Unterrichtsfächer geregelt.<br />
b.12. Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion* (VÜ) 3 SSt.<br />
Diese Lehrveranstaltung ist im selben Semester wie das Fachbezogene Praktikum 1 oder 2 zu absolvieren<br />
und dient der Aufarbeitung des in der Schule Erlebten. Ziel: Die Studierenden analysieren und<br />
beurteilen exemplarische Unterrichtssituationen aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie lernen die<br />
Seite 13 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Anwendung bildungswissenschaftlicher Theorien auf die Gestaltung von Unterricht und die Wahrnehmung<br />
von Unterricht als pädagogisches Verhältnis.<br />
* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />
3.4 Prüfungsordnung<br />
(1) Die Leistungsüberprüfung der Studieneingangs- und Orientierungsphase der pädagogischwissenschaftlichen<br />
Berufsvorbildung erfolgt anhand einer Modul- bzw. Fachprüfung.<br />
(2) Die weiteren <strong>Studienplan</strong>punkte werden durch Abschluss der Lehrveranstaltungen absolviert. Die<br />
Praktika der schulpraktischen Ausbildung sind gemäß den Richtlinien des Instituts für Bildungswissenschaft/LehrerInnenbildung<br />
abzulegen.<br />
(3) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen<br />
Die Leiterin oder der Leiter einer Lehrveranstaltung hat die Ziele, die Inhalte und die Art der Leistungskontrolle<br />
gemäß der Satzung der Universität <strong>Wien</strong> bekannt zu geben.<br />
(4) Prüfungsstoff<br />
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang<br />
her dem vorgegebenen Semesterstundenausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modul- bzw. Fachprüfungen.<br />
3.5 Einteilung der Lehrveranstaltungen<br />
(1) Veranstaltungscharakter<br />
Die Lehrveranstaltungen werden in prüfungsimmanente und nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen<br />
eingeteilt.<br />
(2) Nicht-Prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen:<br />
Vorlesung (VO):<br />
Die VO vermittelt im Überblick Theorien, Methodologien, Lehrmeinungen bzw. den rezenten Forschungsstand<br />
des Faches bzw. eines seiner Teilgebiete.<br />
(3) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen<br />
Vorlesungen mit Übungen (VÜ):<br />
In VÜs wird Fachwissen vermittelt und durch aktive Mitarbeit der Studierenden eingeübt (z. B. durch<br />
schriftliche Arbeiten, Hausaufgaben, Gruppenarbeiten etc.). In VÜ wird der Vortrag der Lehrveranstaltungsleiterin<br />
oder des Lehrveranstaltungsleiters durch aufgabenorientiertes Arbeiten der Studierenden<br />
ergänzt. Das aufgabenorientierte Arbeiten wird durch Tutorien unterstützt.<br />
Proseminar (PS):<br />
Das PS führt in die grundlegenden Denkformen des Faches ein und dient der Vermittlung wissenschaftlicher<br />
Arbeitsweisen. Die Leistungsbeurteilung erfolgt aufgrund kontinuierlicher Mitarbeit,<br />
mündlicher Beiträge und schriftlicher Prüfungsarbeiten. Proseminare sind in der Regel die Vorstufe zu<br />
den Seminaren.<br />
Seminar (SE):<br />
Das SE geht auf fortgeschrittene Denkformen des Fachs ein und dient der Vermittlung wissenschaftlicher<br />
Arbeitsweisen.<br />
(4) Praktikum im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung, prüfungsimmanent<br />
Die Praktika im Rahmen der Schulpraktischen Ausbildung dienen der begleiteten Einübung der Unterrichtspraxis.<br />
Es ist ein Pädagogisches Praktikum (PPR) und pro Unterrichtsfach ein Fachbezogenes<br />
Praktikum (FPR) abzulegen. Die Praktika sind gemäß den Richtlinien des Instituts für Bildungswissenschaft/LehererInnenbildung<br />
zu absolvieren.<br />
Seite 14 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
3.6 Teilnahmebeschränkungen von Lehrveranstaltungen<br />
(1) Für die genannten Lehrveranstaltungen gelten folgende generelle Teilnahmebeschränkungen:<br />
Proseminare: 30<br />
Seminare: 25<br />
VÜ Pädagogische Probleme der ontogenetischen Entwicklung: 450<br />
VÜ Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion*: 250<br />
(2) Wenn bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl die Zahl<br />
der Anmeldungen die Zahl der vorhandenen Plätze übersteigt, erfolgt die Aufnahme der Studierenden<br />
in die Lehrveranstaltungen nach dem vom studienrechtlich zuständigen Organ festgelegten Anmeldeverfahren.<br />
Das Verfahren ist vom studienrechtlich zuständigen Organ im Mitteilungsblatt der Universität<br />
<strong>Wien</strong> rechtzeitig kundzumachen.<br />
(3) Die Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstaltungsleiter sind berechtigt, im Einvernehmen<br />
mit dem studienrechtlich zuständigen Organ für bestimmte Lehrveranstaltungen Ausnahmen zuzulassen.<br />
Auch das studienrechtlich zuständige Organ kann in Absprache mit den Lehrenden Ausnahmen<br />
ermöglichen.<br />
* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />
Seite 15 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
4.Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde<br />
4.1. Qualifikationsprofil<br />
Ausbildungsziel des Studiums „Biologie und Umweltkunde (Lehramt)“ ist die Befähigung zur beruflichen<br />
Tätigkeit an Höheren Schulen in Österreich.<br />
a) Im Rahmen der fachwissenschaftlichen Ausbildung sollen die Studierenden Kenntnisse in<br />
folgenden Bereichen erlangen:<br />
• Allgemeine Lebensprozesse und ihre physiko-chemischen, zellbiologischen und evolutiven<br />
Grundlagen<br />
• Bau und Funktion der Lebewesen sowie deren stammesgeschichtliche Entwicklung<br />
• Lebensräume und Biologie/Ökologie ihrer Organismen unter besonderer Berücksichtigung<br />
der heimischen Natur<br />
• Aufbau der Erde, ihre Rohstoffe, Dynamik geologischer Prozesse sowie die Stellung der Erde<br />
im Kosmos, ihre Entwicklungsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des geologischen<br />
Aufbaues von Österreich<br />
• Entwicklung, Bau und Funktion des menschlichen Organismus<br />
• Angewandte Aspekte der Biologie (Medizin, Biotechnologie, Landwirtschaft etc.)<br />
• Stellung des Menschen in Natur und Gesellschaft (einschließlich geschlechtsspezifischer Aspekte)<br />
sowie seine daraus resultierende Verantwortung<br />
• Entwicklung eines Problembewusstseins für aktuelle Fragen des Umwelt- und Naturschutzes<br />
Bei Abfassung einer Diplomarbeit in Biologie und Umweltkunde werden zusätzliche Detailkenntnisse<br />
zu dem entsprechenden Thema erworben.<br />
b) Im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung sollen die Studierenden Kenntnisse und Handlungskompetenz<br />
in folgenden Bereichen erlangen:<br />
• fachspezifische und fächerübergreifende Unterrichts- und Bildungsziele<br />
• Anknüpfen an der Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler<br />
• Berücksichtigung der altersspezifischen Lern- und Lehrvoraussetzungen<br />
• Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Anliegen<br />
• praxisnahe Planung und Durchführung von Lehreinheiten<br />
• Evaluierung der eigenen Unterrichtstätigkeit und der Lernleistungen der Schülerinnen und<br />
Schüler<br />
Übergreifende Bildungsziele sind die Zusammenschau der Inhalte der Einzelfächer sowie die Befähigung<br />
zur selbständigen Aktualisierung des Fachwissens und der didaktischen bzw. sozialen Kompetenz.<br />
Besondere Bedeutung hat dabei die Sensibilisierung für Konflikte im Spannungsfeld von Wissenschaft,<br />
Natur, Ethik und Gesellschaft.<br />
4.2. Aufbau des Studiums<br />
4.2.1 Dauer des Studiums und der Stundenrahmen:<br />
Das Studium „Biologie und Umweltkunde (Lehramt für höhere Schulen)“ dauert 9 Semester mit einem<br />
Gesamtstundenrahmen von 118 Semesterstunden für dieses Fach. Davon entfallen 82 Semesterstunden<br />
auf die Fachausbildung, 17 Semesterstunden auf fachdidaktische Lehrveranstaltungen, 12 Semesterstunden<br />
auf freie Wahlfächer und 7 Semesterstunden auf Lehrveranstaltungen aus der Allgemeinen<br />
Pädagogik.<br />
4.2.2 Studienabschnitte<br />
Das Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte. Der erste Studienabschnitt, mit einem Umfang<br />
von 53 Semesterstunden, dauert 4 Semester, er führt in das Studium ein und dient der Erarbeitung der<br />
Grundlagen. Der zweite Abschnitt, mit einem Umfang von 53 Semesterstunden, dauert 5 Semester,<br />
und dient der Vertiefung und speziellen Ausbildung, wobei das letzte (5.) Semester der Abfassung der<br />
Diplomarbeit und dem Studienabschluss vorbehalten ist. Zusätzlich sind in Rahmen der Freien Wahl-<br />
Seite 16 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
fächer 12 Semesterwochenstunden zu absolvieren, die keinem Studienabschnitt zugeordnet werden.<br />
4.3 Erster Studienabschnitt<br />
4.3.1 Stundenausmaß der Pflicht- und Wahlfächer der Diplomprüfung:<br />
Name des Fachgebietes<br />
Zahl der Semesterstunden<br />
a) Studieneingangs- und Orientierungphase Biologie 4<br />
(ab Studienbeginn Wintersemester 2011/12)<br />
b) Allgemeine Biologie (einschl. Anthropologie) 9<br />
c) Botanik 6<br />
d) Zoologie einschl. Paläobiologie 8<br />
e) Erdwissenschaftliche Fächer 5<br />
f) Ökologie und Integrative Biologie 4<br />
g) Chemie 3<br />
h) Physik 2<br />
i) Fachdidaktik 8<br />
j) LehrerInnenbildung 4<br />
4.3.2 Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern:<br />
Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />
a) Studieneingangsphase / Studieneingangs- und Orientierungphase Biologie<br />
- Für Studierende, die vor Wintersemester 2011/12 das Studium begonnen haben, gilt die Studieneingangsphase.<br />
Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />
a) Einführung in die Biochemie und Molekularbiologie (LA) 2 VO<br />
d) Einführung in die Anthropologie (LA) 2 VO<br />
e) Das dynamische Bild der Erde (LA) 2 VO<br />
i) Theorie und Praxis der Biologiedidaktik (LA) 4 VO+SE+UE<br />
Studierende, die vor Wintersemester 2011/12 das Studium begonnen haben, haben den <strong>Studienplan</strong> in<br />
der vorliegenden Fassung zu erfüllen. Für Lehrveranstaltungen, die gegenüber der ursprünglichen<br />
Fassung weggefallen sind, hat das studienrechtlich zuständige Organ Äquivalenzlisten zu veröffentlichen.<br />
- Für Studierende, die ab Wintersemester 2011/12 das Studium begonnen haben, gilt die Studieneingangs-<br />
und Orientierungsphase. Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />
Einführung in die Biologie 1 (Anthropologie, Ökologie, Pflanzenwissenschaften,<br />
Zoologie)<br />
4 VO LP<br />
Studierende, die ab Wintersemester 2011/12 das Studium beginnen, haben die Studieneingangs- und<br />
Orientierungsphase gemäß der Verordnung über die Einführung der Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />
in den Lehramtsstudien der Universität <strong>Wien</strong>, veröffentlicht am 29.06.2011 im Mitteilungsblatt<br />
der Universität <strong>Wien</strong>, 26. Stück, Nummer 218 verpflichtend vor dem weiteren Studium zu<br />
absolvieren.<br />
b) aus Allgemeiner Biologie:<br />
Einführung in die Biochemie und Zellbiologie (LA) 2 VO LP<br />
Einführung in die Genetik und Molekularbiologie (LA) 2 VO LP<br />
Einführung in die Mikrobiologie (LA) 1 VO LP<br />
Evolution (einschl. Anthropologie) 4 VO LP<br />
c) aus Botanik:<br />
Seite 17 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Pflanzenanatomie (LA) 2 VO+UE LP/IP<br />
Diversität und Organisation der Pflanzen und Pilze (LA) 4 VO+UE LP/IP<br />
d) aus Zoologie einschl. Paläobiologie:<br />
Diversität, Organisation und Biologie der Tiere (LA) 5 VO+SE+UE LP<br />
Paläobiologie der Tiere (nur gemeinsam mit obiger LV) (LA) 2 VO+SE+UE LP<br />
Biologie und Ökologie einheimischer Tiere (LA) 1 VO LP<br />
e) aus erdwissenschaftlichen Fächern:<br />
Mineralien- und Rohstoffkunde (LA) 3 VO+UE LP/IP<br />
Das dynamische Bild der Erde (LA) 2 VO LP<br />
f) aus Ökologie und Integrativer Biologie:<br />
Bestimmen heimischer Pflanzen (LA) 2 UE IP<br />
Bestimmen heimischer Tiere (LA) 2 UE IP<br />
g) aus Chemie:<br />
Chemie für Biologie und Umweltkunde (LA) 3 VO LP<br />
h) aus Physik:<br />
Physik für Biologie und Umweltkunde (LA) 2 VO LP<br />
i) aus Fachdidaktik:<br />
Theorie und Praxis der Biologiedidaktik (LA) 4 VO+SE+UE LP/IP<br />
Zentrale Themen in Biologie und Umweltkunde (LA) 2 VO + UE IP<br />
Medien und Unterrichtsmaterialien in BU (LA) 2 VO + UE IP<br />
j) aus LehrerInnenbildung:<br />
Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudien im<br />
Ausmaß von 4 Semesterstunden<br />
4<br />
4.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
4.4.1 Stundenausmaß der Pflicht- und Wahlfächer der Diplomprüfung:<br />
Name des Fachgebietes<br />
Zahl der Semesterstunden<br />
a) Allgemeine Biologie 7<br />
b) Botanik einschl. Paläobiologie 5<br />
c) Zoologie 4<br />
d) Anthropologie 6<br />
e) Erdwissenschaftliche Fächer 5<br />
f) Ökologie und Integrative Biologie 12<br />
g) Vertiefende Wahlfächer zur Biologie und Umweltkunde 2<br />
h) Fachdidaktik 9<br />
i) Allgemeine Pädagogik 3<br />
4.4.2 Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern:<br />
Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />
a) aus allgemeiner Biologie:<br />
Seite 18 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Fortpflanzungs- und Entwicklungsbiologie (LA) 2 VO LP<br />
Einführung in die Ethologie (LA) 1 VO LP<br />
Genetik und Molekularbiologie (LA) 2 VO+SE+UE LP/IP<br />
Populationsgenetik 2 VO LP<br />
b) aus Botanik einschl. Paläobiologie:<br />
Diversität und Paläobiologie der Pflanzen (LA) 2 VO LP<br />
Pflanzenphysiologie (LA) 3 VO+UE LP/IP<br />
c) aus Zoologie:<br />
Organ- und Kommunikationssysteme der Tiere (LA) 4 VO+UE LP+IP<br />
d) aus Anthropologie:<br />
Anatomie und Biologie des Menschen (LA) 3 VO LP<br />
Gesundheits- und Sexualkunde (LA) unter Berücksichtigung 3 VO LP<br />
der Frauen- und Geschlechterforschung<br />
e) aus erdwissenschaftlichen Fächer:<br />
Gesteins- und Bodenkunde für das Lehramt (LA) 3 VO+UE LP+IP<br />
Erdgeschichte mit bes. Ber. der Geologie von Österreich (LA) 2 VO+UE LP+IP<br />
f) aus Ökologie und Integrativer Biologie:<br />
Einführung in die Ökologie (LA) 1 VO LP<br />
Großlebensräume der Erde (LA) 2 VO LP<br />
Interdisziplinäre Exkursionen (LA) 3 EX IP<br />
Kenntnis mitteleuropäischer Lebensräume (Freilandblock) (LA) 3 UE IP<br />
sowie entweder:<br />
Landschaftsökologie und Naturschutz (LA) 1 VO+SE LP<br />
Mensch, Gesellschaft und Umwelt (LA) 2 VO+SE IP<br />
oder:<br />
Pflanzengärtnerische Übungen (LA) 3 VO+UE LP/IP<br />
Es wird empfohlen, die nicht gewählte Lehrveranstaltung in den freien Wahlfächern zu absolvieren.<br />
g) aus vertiefenden Wahlfächern zur Biologie und Umweltkunde:<br />
Lehrveranstaltungen nach Wahl 2<br />
h) aus Fachdidaktik:<br />
Experimente in Biologie und Umweltkunde (LA) 3 UE IP<br />
Freilanddidaktik in Biologie und Umweltkunde (LA) 3 VO+UE+EX IP<br />
Interdisziplinäres Projekt (LA) 3 ID IP<br />
i) aus allgemeiner Pädagogik:<br />
Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudien<br />
im Ausmaß von 3 Semesterstunden<br />
3<br />
4.4.3 Schulpraktische Ausbildung<br />
Die schulpraktische Ausbildung ist ab dem dritten Semester zu absolvieren.<br />
4.5 Freie Wahlfächer<br />
Seite 19 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Nach Wahl Lehrveranstaltungen von in- und ausländischen Universitäten (darunter auch<br />
Frauen- und Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften) im Ausmaß von 12 Semesterstunden.<br />
12<br />
4.6. Voraussetzungen für Lehrveranstaltungen:<br />
a) positive Absolvierung der LV „Chemie für BU (LA)“ [LA-BU 161] für die LV „Chemische Übungen<br />
für LA-BU“ [LA-BU 162];<br />
b) positive Absolvierung der LVs „Einführung in die Biochemie und Zellbiologie (LA)“ [LABU 101],<br />
„Einführung in die Genetik und Molekularbiologie (LA)“ [LA-BU 102] und „Einführung in die Mikrobiologie<br />
(LA)“ [LA-BU 103] für die LV „Genetik und Molekularbiologie (LA)“ [LA-BU 203];<br />
c) positive Absolvierung der LVs „Bestimmen heimischer Pflanzen“ [LA-BU 151] und „Bestimmen<br />
heimischer Tiere“ [LA-BU 152] für die LV „Interdisziplinäre Exkursionen“ [LA-BU 254];<br />
d) positive Absolvierung der LV „Pflanzenphysiologie (LA)“ [LA-BU 113] für die LV „Pflanzengärtnerische<br />
Übungen (LA)“ [LA-BU 257];<br />
e) positiver Abschluß des I. Studienabschnittes für die LV „Interdisziplinäres Projekt (LA)“ [LA-BU<br />
283].<br />
Seite 20 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
5. Unterrichtsfach Chemie<br />
5.1. Qualifikationsprofil<br />
Das Qualifikationsprofil entspricht den unter Ziffer 1. angeführten Zielen und Fertigkeiten.<br />
5.2. Aufbau des Studiums<br />
a. Gesamtstundenzahl<br />
Die Gesamtstundenzahl des Lehramtsstudiums des Unterrichtsfaches Chemie beträgt 120 Semesterstunden.<br />
Davon entfallen 7 Semesterstunden auf die verpflichtende pädagogische Ausbildung (Z.3.2)<br />
und 10 Semesterstunden auf Freie Wahlfächer.<br />
b. Erster Studienabschnitt<br />
Die Stundenzahl des Ersten Studienabschnittes umfaßt 52 Semesterstunden (exklusive verpflichtende<br />
pädagogische Ausbildung und Freie Wahlfächer).<br />
c. Zweiter Studienabschnitt<br />
Die Stundenzahl des Zweiten Studienabschnittes umfaßt 51 Semesterstunden (exklusive verpflichtende<br />
pädagogische Ausbildung und Freie Wahlfächer).<br />
5.3. Erster Studienabschnitt<br />
a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />
Im Ersten Studienabschnitt sind in den Pflichtfächern folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />
a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />
Im Ersten Studienabschnitt sind in den Pflichtfächern folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />
Fach/Titel der Lehrveranstaltung Art Std.<br />
(ECTS)<br />
WS<br />
Std.<br />
(ECTS)<br />
SS<br />
Allgemeine und Anorganische Chemie<br />
Allgemeine Chemie LP 5 (8)<br />
Chemisches Grundpraktikum I / Proseminar LP 1 (1)<br />
Chemisches Grundpraktikum I / einführende Laborübungen IP 5 (5)<br />
Chemisches Grundpraktikum I / präparative Laborübungen IP 3 (3)<br />
Chemisches Grundpraktikum II IP 10 (10)<br />
Anorganische Chemie I LP 3 (5)<br />
Organische Chemie<br />
Organische Chemie I LP 4 (6)<br />
Analytische Chemie<br />
Analytische Chemie I LP 3 (5)<br />
Physikalische Chemie<br />
Physikalische Chemie I LP 4 (6)<br />
Mathematik und Physik<br />
Mathematik IP 4 (6)<br />
Physik LP 3 (4,5)<br />
Seite 21 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Fachdidaktik<br />
Einführung in die Schulpraxis (unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen<br />
IP 2 (2)<br />
Aspekten)<br />
Chemische Fachdidaktik IP 2 (2)<br />
Summe der Stunden (ECTS) 49 (63,5)<br />
Allgemeine Pädagogik<br />
Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für<br />
Lehramtsstudien<br />
LP 3<br />
b. Reihenfolge der Lehrveranstaltungen<br />
Der Stoff von Lehrveranstaltungen der dritten Spalte (gemäß Z. 5.3.a) ist Grundlage für die Lehrveranstaltungen<br />
der vierten Spalte.<br />
c. Anmeldungsvoraussetzungen<br />
Es gelten folgende Anmeldungsvoraussetzungen, die durch die Vorlage der entsprechenden Lehrveranstaltungs-Zeugnisse<br />
nachzuweisen sind:<br />
Erfolgreicher Abschluss von<br />
Chemisches Grundpraktikum I / Proseminar<br />
Chemisches Grundpraktikum I / einführende<br />
Laborübungen<br />
Chemisches Grundpraktikum I / präparative<br />
Laborübungen<br />
Allgemeine Chemie<br />
ist Anmeldevoraussetzung für<br />
Chemisches Grundpraktikum II<br />
Chemische Fachdidaktik<br />
Chemisches Grundpraktikum I / präparative<br />
Laborübungen<br />
Chemisches Grundpraktikum II<br />
Chemische Fachdidaktik<br />
Chemisches Grundpraktikum II<br />
Chemische Fachdidaktik<br />
d. Studieneingangsphase<br />
Die Studieneingangsphase umfasst 13 Semesterstunden (16 ECTS) und besteht aus folgenden Lehrveranstaltungen:<br />
Chemisches Grundpraktikum I / Proseminar (IP, 1 Std. / 1 ECTS)<br />
Chemisches Grundpraktikum I / einführende Laborübungen (IP, 5 Std. / 5 ECTS)<br />
Allgemeine Chemie (LP, 5 Std. / 8 ECTS)<br />
Einführung in die Schulpraxis (IP, 2 Std., 2 ECTS)<br />
5.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />
a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />
Im Zweiten Studienabschnitt sind in den Pflichtfächern folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />
Fach/Titel der Lehrveranstaltung Art Std.(ECTS)<br />
Anorganische Chemie<br />
Anorganische Technologie LP 2 (2)<br />
Umweltchemie IP 4 (4)<br />
Organische Chemie<br />
Organische Chemie II für LA LP 2 (2)<br />
Industrielle Organische Chemie LP 2 (2)<br />
Spektroskopie für LA IP 1 (1)<br />
Analytische Chemie<br />
Seite 22 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Analytische Chemie II LP 3 (4)<br />
Analytische Chemie A LP 1 (1)<br />
Analytische Chemie B LP 1 (1)<br />
Analytische Chemie C LP 1 (1)<br />
Physikalische und Theoretische Chemie<br />
Physikalische Chemie II LP 3 (4)<br />
Physikalische Chemie III LP 3 (5)<br />
Theoretische Chemie für LA IP 2 (2)<br />
Biochemie und Lebensmittelchemie<br />
Biologische Chemie I LP 3 (5)<br />
Biochemisches Seminar für LA IP 4 (4)<br />
Lebensmittelchemie LP 2 (3)<br />
Toxikologie LP 1 (1)<br />
Fachdidaktik<br />
Vertiefungsseminar Fachdidaktik IP 4 (4)<br />
Seminar für das Lehramt IP 2 (2)<br />
Chemische Schulversuche (Anorg. Chem.) IP 6 (6)<br />
Chemische Schulversuche (Org. Chem.) IP 3 (3)<br />
Ausgewählte Kapitel für LA IP 2 (2)<br />
Geschichte der Chemie (unter Berücksichtigung von Frauen- und Geschlechterforschung)<br />
LP 1 (1)<br />
EDV-Einsatz im Chemieunterricht IP 1 (1)<br />
Tutorium* IP 1 (1)<br />
Allgemeine Pädagogik<br />
Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudien<br />
LP 3<br />
*... Wahllehrveranstaltung im Sinne von Z.3.2.b.8. (Allgemeine Pädagogik mit bes. Berücksichtigung<br />
des Unterrichtsfaches)<br />
b. Ameldungsvoraussetzungen<br />
Es gelten folgende Voraussetzungen, die durch die Vorlage der entsprechenden LV-Zeugnisse nachzuweisen<br />
sind:<br />
Erfolgreicher Abschluß von<br />
Biologische Chemie I<br />
ist Anmeldungsvoraussetzung für<br />
Biochemisches Seminar<br />
5.5. Freie Wahlfächer<br />
Es wird empfohlen, die Freien Wahlfächer bevorzugt im Zweiten Studienabschnitt zu absolvieren.<br />
Empfohlen werden insbesondere Lehrveranstaltungen aus:<br />
• Bachelorstudium Chemie<br />
• Masterstudium Chemie<br />
• Masterstudium Biologische Chemie<br />
• Umweltwissenschaft und Ökologie<br />
• Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie und Philosophie<br />
• Frauen- und Geschlechterforschung<br />
Seite 23 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
5.6. Ergänzung zur Prüfungsordnung<br />
a. Erste Diplomprüfung: Ergänzung für Absolventinnen und Absolventen der Lehramtsprüfung<br />
an den Pädagogischen Akademien<br />
Zur Ergänzung auf die Erfordernisse der Ersten Diplomprüfung sind folgende Lehrveranstaltungen zu<br />
absolvieren (17 Semesterstunden, 21 ECTS):<br />
Anorganische Chemie I (LP, 3 Std., 5 ECTS)<br />
Physikalische Chemie I (LP, 4 Std., 6 ECTS)<br />
Chemisches Grundpraktikum II (IP, 10 Std., 10 ECTS)<br />
b. Vorziehen von Lehrveranstaltungen<br />
Lehrveranstaltungen des Zweiten Studienabschnittes können unter den folgenden Voraussetzungen in<br />
den Ersten Abschnitt vorgezogen werden:<br />
Der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltungen<br />
des Ersten Abschnittes aus dem Fach<br />
Allgemeine und Anorganische Chemie<br />
Organische Chemie<br />
Analytische Chemie<br />
Physikalische Chemie<br />
Mathematik und Physik<br />
ist Voraussetzung für das Vorziehen<br />
von Lehrveranstaltungen des Zweiten Abschnittes<br />
aus dem Fach<br />
Anorganische Chemie<br />
Organische Chemie<br />
Analytische Chemie<br />
Physikalische und Theoretische Chemie<br />
Physikalische und Theoretische Chemie<br />
c. Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl<br />
(1) Für die Vergabe der Plätze ist entsprechend 2.5.B.e. vorzugehen.<br />
(2) Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl<br />
Lehrveranstaltung<br />
Maximale Teilnehmerzahl je Kurs<br />
Seminar für das Lehramt 10<br />
Chemische Schulversuche (Anorganische Chemie) 6<br />
Chemische Schulversuche (Organische Chemie) 6<br />
5.7 Anmerkungen und Erläuterungen zum Unterrichtsfach Chemie<br />
ad 5.3. Erster Studienabschnitt<br />
(i) Von wenigen Ausnahmen abgesehen, umfaßt der 1. Abschnitt im Wesentlichen die grundlegenden<br />
Pflichtlehrveranstaltungen des <strong>Studienplan</strong>s für das Bachelorstudium „Chemie“, womit der vielfach<br />
gewünschten Durchlässigkeit zwischen Lehramtsstudium und Bachelorstudium „Chemie“ Rechnung<br />
getragen wird.<br />
(ii) Die Regelstudienzeit des 1. Abschnitts beträgt zwar 4 Semester, die Lehrveranstaltungen sind aber<br />
derart auf ein (erstes) Wintersemester und ein (inhaltlich darauf aufbauendes) Sommersemester verteilt,<br />
daß sie auch innerhalb von nur zwei Semestern absolviert werden können. Dadurch sollen Kollisionen<br />
mit den Lehrveranstaltungen des zweiten Unterrichtsfaches weitgehend vermieden werden<br />
können. Die folgende Tabelle (v) enthält neben der 2 Semester-Variante auch einen Vorschlag für eine<br />
(sinnvolle) 4-Semester-Variante.<br />
(iii) Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Einführung in die Schulpraxis“ sollen die Studierenden (während<br />
der Semesterferien) etwa eine Woche lang am Chemieunterricht in einer AHS oder BHS teilnehmen<br />
und damit möglichst frühzeitig einen ersten Eindruck über ihre künftige Berufstätigkeit gewin-<br />
Seite 24 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
nen, und zwar aus der Sicht der Lehrkraft und nicht aus der eines Schülers oder einer Schülerin. Mehrere<br />
Chemielehrerinnen oder Chemielehrer haben bereits ihre Mitarbeit zugesichert.<br />
(iv) Vorgeschlagene Semestereinteilung:<br />
1. 2. 1. 2. 3. 4.<br />
Allgemeine und Anorganische Chemie<br />
Allgemeine Chemie LP 5 5<br />
Chem. Grundprakt. I / Proseminar IP 1 1<br />
Chem. Grundprakt. I / einf. Laborüb. IP 5 5<br />
Chem. Grundprakt. I / präp. Laborüb. IP 3 3<br />
Chem. Grundpraktikum II IP 10 10<br />
Anorganische Chemie I LP 3 3<br />
Organische Chemie<br />
Organische Chemie I LP 4 4<br />
Analytische Chemie<br />
Analytische Chemie I LP 3 3<br />
Physikalische Chemie<br />
Physikalische Chemie I LP 4 4<br />
Mathematik und Physik<br />
Mathematik IP 4 4<br />
Physik LP 3 3<br />
Fachdidaktik<br />
Einführung in die Schulpraxis IP 2 2<br />
Chemische Fachdidaktik IP 2 2<br />
Summe Semesterstunden 23 26 12 15 13 9<br />
ad 5.4. Fächer und Lehrveranstaltungen des Zweiten Studienabschnittes<br />
(i) Von wenigen Ausnahmen abgesehen, umfasst der 2. Abschnitt im Wesentlichen Lehrveranstaltungen,<br />
die auf die speziellen Erfordernisse zukünftiger Chemielehrer abgestimmt sind.<br />
Seite 25 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
(ii) Die Regelstudienzeit des 2. Abschnitts beträgt zwar 4 Semester, die Lehrveranstaltungen sind aber<br />
derart auf ein (erstes) Wintersemester und ein (inhaltlich darauf aufbauendes) Sommersemester verteilt,<br />
daß sie auch innerhalb von nur zwei Semestern absolviert werden können. Die folgende Tabelle<br />
(v) enthält neben der 2-Semester-Variante auch einen Vorschlag für eine (sinnvolle) 4- Semester-<br />
Variante.<br />
(iii) Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Tutorium“ sollen die Studierenden an der Durchführung von<br />
Seminarlehrveranstaltungen für Studienanfänger des Diplomstudiums „Chemie“ teilnehmen und dabei<br />
mit kleinen Gruppen (maximal 10 Personen) von Studierenden vorgegebene Fragen und Probleme<br />
besprechen.<br />
(iv) Vorgeschlagene Semestereinteilung:<br />
1. 2. 1. 2. 3. 4.<br />
Anorganische Chemie<br />
Anorganische Technologie LP 2 2<br />
Umweltchemie IP 4 4<br />
Organische Chemie<br />
Organische Chemie II für LA LP 2 2<br />
Industrielle Organische Chemie LP 2 2<br />
Spektroskopie IP 1 1<br />
Analytische Chemie<br />
Analytische Chemie II LP 3 3<br />
Analytische Chemie A LP 1 1<br />
Analytische Chemie B LP 1 1<br />
Analytische Chemie C LP 1 1<br />
Physikalische und Theoretische Chemie<br />
Physikalische Chemie II LP 3 3<br />
Physikalische Chemie III LP 3 3<br />
Theoretische Chemie für LA IP 2 2<br />
Biochemie und Lebensmittelchemie<br />
Biologische Chemie I LP 3 3<br />
Biochemisches Seminar für LA IP 4 4<br />
Lebensmittelchemie LP 2 2<br />
Toxikologie LP 1 1<br />
Seite 26 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Fachdidaktik<br />
Vertiefungsseminar Fachdidaktik IP 3 3<br />
Seminar für das Lehramt IP 2 2<br />
Chemische Schulversuche (Anorg. Chem.) IP 6 6<br />
Chemische Schulversuche (Org. Chem.) IP 3 3<br />
Ausgewählte Kapitel für LA LP 2 2<br />
Geschichte der Chemie LP 1 1<br />
EDV-Einsatz im Chemieunterricht IP 1 1<br />
Tutorium* IP 1 1<br />
Summe Semesterstunden 27 27 14 13 15 12<br />
Seite 27 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
6. Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung<br />
6.1. Qualifikationsprofil<br />
Das Qualifikationsprofil entspricht den unter Ziffer 1. angeführten Zielen und Fertigkeiten.<br />
6.2. Aufbau des Studiums<br />
Das Studium umfasst insgesamt 118 Semesterstunden, davon entfallen auf den ersten Studienabschnitt<br />
49, auf den zweiten Studienabschnitt 43. Auf die Fachdidaktik entfallen 19, auf die Allgemeine<br />
Pädagogik 7 und auf die Freien Wahlfächer 12 Semesterstunden.<br />
6.3. Erster Studienabschnitt<br />
Fach Referenzwissenschaften<br />
Art Typ 1.& 3.<br />
Sem.<br />
2.& 4.<br />
Sem.<br />
Allgemeine und organische Chemie LP VO 4<br />
Chemische Übungen für LA-HE IP/LP VO/UE 3<br />
Physik LP/IP VO/UE 4<br />
Fach Grundlagen der Biologie<br />
Allgemeine Biologie und Botanik LP VO 3<br />
Übungen zur Allgemeinen Biologie IP UE 2<br />
Mikrobiologie LP VO 3<br />
Anatomie und Histologie LP VO 3<br />
Physiologie LP VO 3<br />
Fach Ernährungslehre<br />
Einführung in die Ernährungslehre LP VO 2<br />
Übungen zur Ernährungslehre IP UE 3<br />
Fach Lebensmitteltechnologie<br />
Pflanzenproduktion LP VO 2<br />
Produktion tierischer Lebensmittel LP VO 2<br />
Fach Humanökologie<br />
*Humanökologie LP VO 1<br />
Wohngestaltung unter humanökologischen Aspekten und IP SE<br />
mit Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung<br />
Erste Hilfe einschließlich Unfallverhütung IP UE 1 2<br />
Fach Einführung in die Wirtschaftswissenschaften<br />
*Volkswirtschaftslehre LP VO 2<br />
Betriebswirtschaftslehre LP VO 2<br />
*Konsumentenschutz – Konsumentenpolitik LP VO 2<br />
Buchhaltung und Kostenrechnung LP VO 1<br />
Fach Fachdidaktik und Pädagogik<br />
*Lehrplan- und Stundengestaltung (FDP) IP SE 2<br />
Projekte zur Lehrplan- und Stundengestaltung (FDP) IP UE 2<br />
Summe Semesterstunden 24 25<br />
Seite 28 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
6.4. Zweiter Studienabschnitt<br />
5. & 7.<br />
Sem.<br />
6. & 8.<br />
Sem.<br />
Fach Ernährungsphysiologie und Biochemie<br />
Biochemie LP VO 3<br />
Ernährungsphysiologie LP VO 3<br />
Seminar zur Ernährungsphysiologie IP SE 2<br />
Übungen zur Ernährungsphysiologie IP UE 5<br />
Lebensmittelchemie VO 3<br />
Fach Diätetik<br />
Übungen zur Nahrungszubereitung IP UE 4<br />
Grundlagen der Diätetik LP+IP VO+UE 2+1<br />
Fach Haushalts- und Lebensmitteltechnologie<br />
Haushaltstechnik und Lebesmitteltechnik (unter Berücksichtigung<br />
LP+IP VO+SE 2+1<br />
gesellschaftskritischer,<br />
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung)<br />
Ökologische Grundlagen d. landwirtschaftlichen Produktion LP VO 2<br />
Allgemeine Lebensmitteltechnologie LP VO 2<br />
Grundlagen der Qualitätsbeurteilung von Lebensmitteln LP VO 1<br />
Fach Wirtschaftswissenschaften und Lebensmittelrecht<br />
Lebensmittelrecht LP VO 2<br />
Wirtschaftslehre und Arbeitsorganisation des Haushaltes LP VO 2<br />
Fach Fachdidaktik und Pädagogik<br />
Ernährungslehre – Schulversuche (FDP) IP UE 2<br />
Projekte im Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährungswissenschaften<br />
IP UE 2<br />
Fachdidaktik der Lebensmittelverarbeitung IP UE 4<br />
Summe Semesterstunden 22 21<br />
**Wahltopf Fachdidaktik (FDP) = 7 h<br />
Einführung in die Methodik der Ernährungsberatung (FDP) VO 3<br />
Lehr- und Lernformen (FDP) SE 2<br />
Medienkunde und Unterrichtstechnik (FDP) SE 2<br />
Moderation und Präsentation (FDP) SE 2<br />
Rhetorik und Atemtechnik (FDP) SE 2<br />
Spezielle Unterrichtslehre (FDP) VO 2<br />
Übungen zur Unterrichtsgestaltung (unter Berücksichtigung<br />
von geschlechtsspezifischen Anliegen) (FDP)<br />
UE 2<br />
Davon insgesamt 7<br />
6.5. Freie Wahlfächer 12<br />
Im Rahmen des Studiums sind Freie Wahlfächer aus dem Angebot der in- und ausländischen Universitäten<br />
zu absolvieren (darunter auch eine Auseinandersetzung mit der Frauen- und Geschlechterforschung<br />
in den Naturwissenschaften).<br />
Allgemeine Pädagogik (FDP) 7<br />
Gesamtstundenumfang 119<br />
(FDP: Fachdidaktik/Pädagogik)<br />
Statt der mit ** gekennzeichneten Lehrveranstaltungen kann auch die in Z 3.2.b.8. gekennzeichnete<br />
Lehrveranstaltung der Allgemeinen Pädagogik gewählt werden.<br />
Seite 29 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Studieneingangsphase:<br />
Lehrveranstaltungen der Studieneingangsphase sind mit einem * gekennzeichnet.<br />
Ameldungsvoraussetzungen:<br />
1. Abschnitt<br />
Übungen zur Allgemeinen Biologie: Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltung<br />
„Allgemeine Biologie und Botanik“<br />
Chemisches Grundpraktikum: Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltung<br />
„Allgemeine und Organische Chemie“<br />
2. Abschnitt<br />
Voraussetzung für das Ablegen von Prüfungen in Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnittes<br />
ist der erfolgreiche Abschluß des ersten Studienabschnittes.<br />
Seminar zur Ernährungsphysiologie: Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltung<br />
„Ernährungsphysiologie“<br />
Übungen zur Ernährungsphysiologie: Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltung<br />
„Ernährungsphysiologie“<br />
Übungen zur Grundlagen der Diätetik: Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltung<br />
„Einführung in die Ernährungslehre“<br />
Ernährungslehre – Schulversuche: Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltung<br />
„Chemisches Grundpraktikum“<br />
Seite 30 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
7. Unterrichtsfach Mathematik<br />
7.1 Qualifikationsprofil<br />
Das Qualifikationsprofil entspricht den unter Ziffer 1. angeführten Zielen und Fertigkeiten.<br />
7.2 Aufbau des Studiums<br />
Die Gesamtanzahl der Semesterwochenstunden (SWS) beträgt 99. Davon entfallen 7 SWS auf Pädagogik,<br />
38 SWS auf Mathematik und Fachdidaktik im ersten und 44 SWS im zweiten Studienabschnitt.<br />
Außerdem sind im 1. und 2. Studienabschnitt insgesamt 10 SWS an freien Wahlfächern zu absolvieren.<br />
„LAK“ steht für Lehramtskandidatinnen bzw. -kandidaten.<br />
7.3 Erster Studienabschnitt<br />
Es sind (Wahl-)Pflichtfächer im Ausmaß von 41 SWS zu absolvieren. Davon entfallen 3 SWS auf die<br />
Pädagogik.<br />
7.3.1 Mathematik – Pflichtfächer<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Einführung in das mathematische Arbeiten 3 LP Studieneingangsphase<br />
Hilfsmittel aus der EDV 2 IP Studieneingangsphase<br />
Einführung in die Analysis 3 LP Analysis<br />
Übung: Einführung in die Analysis 2 IP Analysis<br />
Analysis in einer Variable für LAK 2 LP Analysis<br />
Übung: Analysis in einer Variable für LAK 2 IP Analysis<br />
Reelle Analysis in mehreren und komplexe Analysis in einer<br />
Variable für LAK 5 LP Analysis<br />
Übung: Reelle Analysis in mehreren und komplexe Analysis in<br />
einer Variable für LAK 2 IP Analysis<br />
Einführung in die Lineare Algebra und Geometrie 3 LP Algebra<br />
Übung: Einführung in die Lineare Algebra und Geometrie 2 IP Algebra<br />
Lineare Algebra und Geometrie für LAK 4 LP Algebra<br />
Übung: Lineare Algebra und Geometrie für LAK 2 IP Algebra<br />
Zahlentheorie 2 LP Algebra<br />
Übung: Zahlentheorie 1 IP Algebra<br />
Gesamt 35<br />
7.3.2 Fachdidaktik – Wahlpflichtfach<br />
Es ist eine der Schulmathematik-Vorlesungen plus die jeweilige Übung zu absolvieren:<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Schulmathematik 1 (Arithmetik und Algebra) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 1 (Arithmetik und Algebra) 1 IP<br />
Schulmathematik 2 (Geometrie) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 2 (Geometrie) 1 IP<br />
Schulmathematik 3 (Angewandte Mathematik) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 3 (Angewandte Mathematik) 1 IP<br />
Schulmathematik 4 (Vektorrechnung) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 4 (Vektorrechnung) 1 IP<br />
Schulmathematik 5 (Stochastik) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 5 (Stochastik) 1 IP<br />
Seite 31 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Schulmathematik 6 (Differential- und Integralrechnung) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 6<br />
1 IP<br />
(Differential- und Integralrechnung)<br />
Gesamt 3 Schulmathematik<br />
7.3.3 Pädagogik<br />
SWS Art Prüfungsfach<br />
Gesamt 3 LP Pädagogik<br />
7.3.4 Freie Wahlfächer (Gesamtumfang 10 SWS im 1. und 2. Studienabschnitt)<br />
Als freie Wahlfächer für den 1. Studienabschnitt werden zwei der nicht gewählten Schulmathematik-<br />
Veranstaltungen besonders empfohlen sowie die folgenden Lehrveranstaltungen:<br />
Titel SWS Art<br />
Modellierung (VO + UE) 2 + 1 LP, IP<br />
Algorithmen, Datenstrukturen und Programmieren (VU) 3 IP<br />
7.4 Zweiter Studienabschnitt<br />
Es sind (Wahl-)Pflichtfächer im Ausmaß von 48 SWS zu absolvieren. Davon entfallen 4 SWS auf die<br />
Pädagogik.<br />
7.4.1 Mathematik – Pflichtfächer<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Angewandte Mathematik für LAK 3 LP Angewandte Mathematik<br />
Übung: Angewandte Mathematik für LAK 1 IP Angewandte Mathematik<br />
Stochastik für LAK 4 LP Stochastik<br />
Übung: Stochastik für LAK 2 IP Stochastik<br />
Differentialgleichungen für LAK 2 LP Analysis<br />
Übung: Differentialgleichungen für LAK 1 IP Analysis<br />
Algebra für LAK 2 LP Algebra<br />
Übung: Algebra für LAK 1 IP Algebra<br />
Computerpraktikum für LAK 3 IP Angewandte Mathematik<br />
Gesamt 19<br />
7.4.2 Mathematik – Wahlpflichtfach<br />
Es ist eine der folgenden Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Genderspezifische Aspekte in der Mathematik 2 LP<br />
Geschichte der Mathematik und Logik 2 LP<br />
Philosophie der Mathematik 2 LP<br />
Elementargeometrie 2 LP<br />
Englisch für Mathematiker/innen 2 LP<br />
Gesamt 2 Mathematik im Umfeld<br />
Seite 32 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
7.4.3 Seminare<br />
Es sind zwei aus den vier Seminartypen zu wählen:<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Seminar für LAK (Algebra) 2 IP Algebra<br />
Seminar für LAK (Angewandte Mathematik) 2 IP Angewandte Mathematik<br />
Seminar für LAK (Analysis) 2 IP Analysis<br />
Seminar für LAK (Stochastik) 2 IP Stochastik<br />
Gesamt 4<br />
7.4.4 Fachdidaktik – Pflichtfächer<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Einführung in die Fachdidaktik 2 LP<br />
Seminar zum Schulpraktikum 2 IP<br />
Seminar zur Unterrichtsplanung 2 IP<br />
Seminar zur Fachdidaktik 2 IP<br />
Gesamt 8 Fachdidaktik<br />
7.4.5 Fachdidaktik-Wahlpflichtfächer<br />
Es ist eine der folgenden Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Genderfragen und Mathematikunterricht 2 LP oder<br />
IP<br />
Außermathematische Anwendungen im Unterricht 2 LP<br />
Ausgewählte Kapitel der Fachdidaktik 2 LP<br />
Probleme des Mathematikunterrichts (VO oder KO) 2 LP oder<br />
IP<br />
Problemlösen (VU oder PS) 2 IP<br />
Gesamt 2 Fachdidaktik<br />
Es sind weitere drei Schulmathematik-Vorlesungen (die nicht schon im 1. Abschnitt als Schulmathematik<br />
oder als freie Wahlfächer gewählt wurden!) plus die jeweiligen Übungen zu absolvieren:<br />
Titel SWS Art Prüfungsfach<br />
Schulmathematik 1 (Arithmetik und Algebra) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 1 (Arithmetik und Algebra) 1 IP<br />
Schulmathematik 2 (Geometrie) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 2 (Geometrie) 1 IP<br />
Schulmathematik 3 (Angewandte Mathematik) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 3 (Angewandte Mathematik) 1 IP<br />
Schulmathematik 4 (Vektorrechnung) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 4 (Vektorrechnung) 1 IP<br />
Schulmathematik 5 (Stochastik) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 5 (Stochastik) 1 IP<br />
Schulmathematik 6 (Differential- und Integralrechnung) 2 LP<br />
Übung: Schulmathematik 6<br />
1 IP<br />
(Differential- und Integralrechnung)<br />
Gesamt 9 Schulmathematik<br />
Seite 33 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
7.4.6 Pädagogik<br />
SWS Art Prüfungsfach<br />
Gesamt 4 LP Pädagogik<br />
7.5 Freie Wahlfächer (Gesamtumfang 10 SWS im 1. und 2. Studienabschnitt)<br />
Als freie Wahlfächer werden die nicht gewählten Wahlpflichtfächer in Fachdidaktik und Mathematik<br />
besonders empfohlen. Darüber hinaus auch noch die folgenden anwendungsorientierten Lehrveranstaltungen:<br />
Titel SWS Art<br />
Modellierung (VO + UE) 2 + 1 LP, IP<br />
Algorithmen, Datenstrukturen und Programmieren (VU) 3 IP<br />
Diskrete Mathematik (VO + UE) 2 + 1 LP, IP<br />
Biomathematik und Spieltheorie (VO + UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Algebra in den Anwendungen (VO + UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Differentialgleichungen in den Anwendungen (VO+UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Bild- und Signalverarbeitung (VO + UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Finanzmathematik (VO + UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Optimierung in den Anwendungen (VO + UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Angewandte Statistik (VO + UE; oder VU) 3 + 1 (4) LP, IP<br />
Seite 34 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
8. Unterrichtsfach Physik<br />
8.1. Qualifikationsprofil<br />
Das Qualifikationsprofil entspricht den unter Ziffer 1. angeführten Zielen und Fertigkeiten.<br />
8.2 Aufbau des Studiums<br />
8.2.1. Gesamtstundenzahl und Dauer: Das Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Physik dauert 9<br />
Semester, die Gesamtstundenanzahl beträgt 98 Semesterstunden (bei einem Stundenrahmen von 80-<br />
120 Semesterstunden). Davon entfallen 7 Semesterstunden auf die verpflichtende pädagogische Ausbildung<br />
und 10 Semesterstunden auf Freie Wahlfächer.<br />
8.2.2. Erster Studienabschnitt: Dauer, Stundenzahl und Stundenausmaß der Pflichtund<br />
Wahlfächer:<br />
Der Erste Studienabschnitt dauert 4 Semester, seine Stundenzahl umfaßt 50 Semesterstunden (exklusive<br />
Freie Wahlfächer). Das Stundenausmaß der Pflicht- und Wahlfächer der Diplomprüfung ist:<br />
Name des Prüfungsfaches<br />
Experimentelle Physik (in 8.3. und 8.4. abgekürzt „Exp.<br />
Physik“)<br />
Zahl der Semesterstunden<br />
Kodierung<br />
25 LA-Ph 11#<br />
Theoretische Physik (in 8.3. und 8.4. abgekürzt „Theoret.<br />
7 LA-Ph 12#<br />
Physik“)<br />
Fachdidaktik der Physik 2 LA-Ph 13#<br />
Mathematik 11 LA-Ph 14#<br />
Chemie 3 LA-Ph 15#<br />
Allgemeine Pädagogik 2 LA-Ph 16#<br />
(Die Lehrveranstaltungen für das Lehramt im Unterrichtsfach Physik des Ersten Studienabschnitts<br />
sind durch LA-Ph1## kodiert; die vorletzte Ziffer gibt dabei die Prüfungsfächer nach obigem<br />
Schlüssel an. Die letzte Ziffer ist eine fortlaufende Numerierung.)<br />
Die Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern sind in Kap.8.3.1., die Lehrveranstaltungen<br />
der Studieneingangsphase in Kap.8.3.2. festgelegt.<br />
8.2.3. Zweiter Studienabschnitt: Dauer, Stundenzahl und Stundenausmaß der Pflichtund<br />
Wahlfächer:<br />
Der Zweite Studienabschnitt dauert 5 Semester, seine Stundenzahl umfaßt 38 Semesterstunden (exklusive<br />
Freie Wahlfächer). Das letzte (5.) Semester ist der Abfassung der Diplomarbeit und dem Studienabschluß<br />
vorbehalten. Das Stundenausmaß der Pflicht- und Wahlfächer der Diplomprüfung ist:<br />
Name des Prüfungsfaches<br />
Zahl der Semesterstunden*<br />
Kodierung<br />
Experimentelle Physik (in 8.3. und 8.4. abgekürzt „Exp.<br />
8-15 LA-Ph 21#<br />
Physik“)<br />
Theoretische Physik (in 8.3. und 8.4. abgekürzt „Theoret.<br />
7-8 LA-Ph 22#<br />
Physik“)<br />
Fachdidaktik der Physik 11-18 LA-Ph 23#<br />
Allgemeine Pädagogik 5 LA-Ph 26#<br />
(Die Lehrveranstaltungen für das Lehramt im Unterrichtsfach Physik des Zweiten Studienabschnitts<br />
sind durch LA-Ph2## kodiert; die vorletzte Ziffer gibt dabei die Prüfungsfächer nach obigem<br />
Schlüssel an. Die letzte Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung.)<br />
Seite 35 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Die Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern sind in Kap.8.4.1. festgelegt.<br />
*) Die Spannweite der Zahl der Semesterstunden ist Folge der Wahlmöglichkeiten der Studierenden.<br />
Die Gesamtstundenzahl im Zweiten Studienabschnitt beträgt jedenfalls 38 Semesterstunden (exklusive<br />
Freie Wahlfächer).<br />
8.2.4. Reihenfolge der Lehrveranstaltungen:<br />
Der <strong>Studienplan</strong> ist dahingehend ausgelegt, daß nur bei Studienbeginn in einem Wintersemester die<br />
Pflichtlehrveranstaltungen in ihrer zeitlichen Abfolge aufeinander abgestimmt sind. Die Lehrveranstaltungen<br />
bauen zum Teil aufeinander auf.<br />
8.2.5. Anmeldungsvoraussetzungen:<br />
In den in den Kap.8.3.1. und Kap.8.4.1. folgenden Tabellen (Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und<br />
Wahlfächern) sind für weiterführende Lehrveranstaltungen vorausgesetzte Lehrveranstaltungen in der<br />
rechten Spalte durch ihren Code angegeben, die entsprechende Spalte trägt den Titel „vorausgesetzt<br />
wird LA-Ph“. Die Absolvierung der in der Spalte „vorausgesetzt wird LA-Ph“ durch ihren Code definierten<br />
Lehrveranstaltung(en) sind daher die Anmeldungsvoraussetzung für die in dieser Zeile genannte<br />
Lehrveranstaltung.<br />
Zur leichteren Lesbarkeit sind die Anmeldungsvoraussetzungen für den Ersten Studienabschnitt zusätzlich<br />
in Kap. 8.3.3. und für den Zweiten Studienabschnitt in Kap. 8.4.2. tabelliert.<br />
Sind die Anmeldungsvoraussetzungen gestundet, so ist deren Erfüllung binnen 7 Wochen nach Semesterbeginn<br />
nachzuweisen. In besonderen Fällen (z. B. Krankheitsfall, erhebliche berufliche Tätigkeit)<br />
kann der Studiendekan Ausnahmen von den im <strong>Studienplan</strong> festgelegten Voraussetzungen zulassen.<br />
8.2.6. Alternativen für Studierende des Diplomstudiums Physik, des Lehramtsstudiums<br />
im Unterrichtsfach Mathematik und des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Chemie:<br />
In den folgenden Kapiteln 8.3.4. und 8.4.3. werden für Studierende dieser Studienrichtungen Alternativen<br />
zu Lehrveranstaltungen des <strong>Studienplan</strong>s Lehramt Physik ausgewiesen, die Bestandteil der jeweiligen<br />
Studienpläne sind.<br />
1. Alternative: Sie betrifft Studierende des Diplomstudiums Physik. Einige Lehrveranstaltungen<br />
sind mit dem Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Physik identisch, andere können durch bestimmte<br />
Lehrveranstaltungen des Diplomstudiums ersetzt werden. Dadurch reduziert sich die Gesamtzahl der<br />
Semesterstunden des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Physik auf 23 Semesterstunden (die<br />
Lehrveranstaltungen LA-Ph161, LAPh261 und LA-Ph262 der Allgemeinen Pädagogik, LA-Ph131, LA-<br />
Ph231 und LA-Ph232 der Fachdidaktik, LA-Ph214 der Fachphysik und LA-Ph151 der Chemie sind<br />
zusätzlich zu den Veranstaltungen des Diplomstudiums Physik zu absolvieren).<br />
2. Alternative: Sie betrifft Studierende des Lehramtes, welche als zweites Unterrichtsfach<br />
Mathematik gewählt haben. Diese können die Lehrveranstaltungen zu Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium durch Lehrveranstaltungen ersetzen, welche im <strong>Studienplan</strong> „Lehramt im Unterrichtsfach<br />
Mathematik“ verpflichtend sind. Dadurch reduziert sich die Gesamtzahl auf 87 Semesterstunden.<br />
3. Alternative: betrifft Studierende des Lehramts, welche als zweites Unterrichtsfach Chemie gewählt<br />
haben. Diese können die Lehrveranstaltungen Chemie für Physiker durch Lehrveranstaltungen<br />
ersetzen, welche im <strong>Studienplan</strong> „Lehramt im Unterrichtsfach Chemie“ verpflichtend sind. Dadurch<br />
reduziert sich die Gesamtzahl der Semesterstunden von 98 auf 95.<br />
Seite 36 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
8.3 Erster Studienabschnitt (50 Semesterstunden):<br />
8.3.1. Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern:<br />
LA-<br />
Ph<br />
###<br />
Lehrveranstaltung Art Typ Semesterstunden vorausgesetzt<br />
wird<br />
LA-Ph<br />
Prüfungsfach<br />
LP VO 5 - Exp. Physik<br />
111 Einführung in die Physik<br />
I<br />
112 Rechenübungen zur<br />
Einführung in die Physik<br />
I<br />
IP UE 2 - Exp. Physik<br />
113 Vorpraktikum IP UE 3 - Exp. Physik<br />
114 Methoden der Experimentellen<br />
Physik I<br />
115 Einführung in die Physik<br />
II<br />
116 Rechenübungen zur<br />
Einführung in die Physik<br />
II<br />
117 Physikalisches Praktikum<br />
für das Lehramt<br />
121 Relativistische Physik<br />
und elementare<br />
Quantenmechanik<br />
122 Theoretische Physik<br />
für das Lehramt L1<br />
123 Übungen zur Theoretischen<br />
Physik für das<br />
Lehramt L1<br />
131 Fachdidaktische Vertiefung<br />
der Physik (A,<br />
B, C oder D) mit Berücksichtigung<br />
geschlechtsspezifischer<br />
Aspekte<br />
141 Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium<br />
I<br />
142 Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium<br />
II<br />
143 Übungen zu Mathematische<br />
Grundlagen für<br />
das<br />
Physikstudium II<br />
144 Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium<br />
III<br />
145 Übungen zu Mathematische<br />
Grundlagen für<br />
das<br />
Physikstudium III<br />
IP UE 2 - Exp. Physik<br />
LP VO 5 141 Exp. Physik<br />
IP UE 2 - Exp. Physik<br />
IP UE 6 113 Exp. Physik<br />
LP VO 2 - Theoret. Physik<br />
LP<br />
IP<br />
VO<br />
UE<br />
Insgesamt 5,<br />
davon VO<br />
mindestens.3,<br />
höchstens 4<br />
gestundet:<br />
141, 142<br />
-<br />
Theoret. Physik<br />
Theoret. Physik<br />
LP VO 2 gestundet:<br />
161<br />
Fachdidaktik<br />
der<br />
Physik<br />
LP+IP VO+UE 1+1 - Mathematik<br />
LP<br />
IP<br />
VO<br />
UE<br />
Insgesamt 6,<br />
davon VO<br />
mindestens 4,<br />
höchstens 5<br />
-<br />
-<br />
Mathematik<br />
Mathematik<br />
LP VO Insgesamt 3,<br />
davon VO<br />
mindestens 1,<br />
höchstens 2<br />
141 Mathematik<br />
IP UE - Mathematik<br />
151 Chemie für Physiker LP VO 3 - Chemie<br />
161 Zur Wahl Lehrveranstaltungen<br />
LP VO 2 - Allgemeine<br />
aus dem<br />
Pädagogik<br />
Seite 37 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Angebot der<br />
Pädagogik für Lehramtsstudierende<br />
Die Lehrveranstaltung LA-Ph141 (Mathematische Grundlagen für das Physikstudium I) wird in den<br />
ersten beiden Wochen des Wintersemesters als Blocklehrveranstaltung angeboten.<br />
8.3.2. Die Studieneingangsphase:<br />
LA-Ph Lehrveranstaltung der Studieneingangsphase Art Typ Semesterstunden<br />
###<br />
111 Einführung in die Physik I LP VO 5<br />
113 Vorpraktikum IP UE 3<br />
141 Mathematische Grundlagen für das Physikstudium<br />
LP+IP VO+UE 1+1<br />
I<br />
161 Zur Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot<br />
der<br />
Pädagogik für Lehramtsstudierende<br />
LP VO 2<br />
Die Studieneingangsphase (Stundenausmaß 12 Semesterstunden) besteht aus den oben genannten<br />
Lehrveranstaltungen LA-Ph111, LA-Ph113, LA-Ph141 und LA-Ph161. Sie sind für das Studium des<br />
Lehramtes im Unterrichtsfach Physik grundlegend und charakteristisch.<br />
8.3.3. Anmeldungsvoraussetzungen:<br />
Für die Lehrveranstaltung<br />
ist Anmeldungsvoraussetzung der positive Abschluß von<br />
LA-Ph Lehrveranstaltung<br />
LA-Ph Lehrveranstaltung(en)<br />
###<br />
###<br />
115 Einführung in die Physik II 141 Mathematische Grundlagen für das Physikstudium<br />
I<br />
117 Physikalisches Praktikum für das 113 Vorpraktikum<br />
Lehramt<br />
122 Theoretische Physik für das<br />
Lehramt L1<br />
141 gestundet: Mathematische Grundlagen für<br />
das Physikstudium I<br />
142 gestundet: Mathematische Grundlagen für<br />
das Physikstudium II<br />
131 Fachdidaktische Vertiefung der<br />
Physik (A, B, C oder D)<br />
144 Mathematische Grundlagen für<br />
das Physikstudium III<br />
161 gestundet: Zur Wahl Lehrveranstaltungen<br />
aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudierende<br />
141 Mathematische Grundlagen für das Physikstudium<br />
I<br />
Sind die Anmeldungsvoraussetzungen gestundet, so ist deren Erfüllung binnen 7 Wochen nach Semesterbeginn<br />
nachzuweisen.<br />
8.3.4.1. Alternative für Studierende des Diplomstudiums Physik<br />
LA-Ph<br />
###<br />
Lehrveranstaltung aus dem<br />
<strong>Studienplan</strong> Lehramt<br />
aus dem Unterrichtsfach Physik<br />
kann ersetzt werden durch folgende<br />
Lehrveranstaltung(en) aus dem <strong>Studienplan</strong><br />
Physik<br />
111 Einführung in die Physik I Einführung in die Experimentelle<br />
Physik I und<br />
Einführung in die Experimentelle<br />
Physik II<br />
Typ<br />
VO je 5<br />
112 Rechenübungen zur Einfüh- Rechenübungen zu Einführung in die UE 2<br />
Semesterstun<br />
den<br />
Seite 38 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
rung in die Physik I<br />
experimentelle Physik I<br />
115 Einführung in die Physik II Einführung in die Experimentelle<br />
Physik II und<br />
Einführung in die Experimentelle<br />
Physik III<br />
116 Rechenübungen zur Einführung<br />
Rechenübungen zu Einführung in die<br />
in die Physik II<br />
experimentelle Physik II<br />
122 Theoretische Physik für das Theoretische Physik T1 und Theoretische<br />
Lehramt L1<br />
Physik T2<br />
123 Übungen zu Theoretische Übungen zu Theoretische Physik T1<br />
Physik für das Lehramt L1 und Übungen zu Theoretische Physik<br />
T2<br />
VO je 5<br />
UE 2<br />
VO je 5<br />
UE je 2<br />
8.3.4.2. Alternative für Studierende des Lehramtes mit dem Unterrichtsfach Mathematik<br />
LA-Ph<br />
###<br />
Lehrveranstaltung aus dem<br />
<strong>Studienplan</strong><br />
Lehramt aus dem Unterrichtsfach<br />
Physik<br />
142 Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium II<br />
143 Übungen zu Mathematische<br />
Grundlagen für das<br />
Physikstudium II<br />
144 Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium III<br />
145 Übungen zu Mathematische<br />
Grundlagen für das Physikstudium<br />
III<br />
kann ersetzt werden durch folgende<br />
Lehrveranstaltungen<br />
aus dem <strong>Studienplan</strong> Lehramt aus<br />
dem<br />
Unterrichtsfach Mathematik<br />
Typ<br />
Analysis I und Lineare Algebra I VO je 4<br />
Übungen zur Analysis I und Übungen<br />
zu Lineare Algebra und Geometrie I<br />
UE je 2<br />
Analysis II und Lineare Algebra II VO je 4<br />
Übungen zur Analysis II und Übungen<br />
zu Lineare Algebra und Geometrie II<br />
UE je 2<br />
Semester<br />
stunden<br />
8.3.4.3. Alternative für Studierende des Lehramtes mit dem Unterrichtsfach Chemie<br />
LA-Ph<br />
###<br />
Lehrveranstaltung aus dem<br />
<strong>Studienplan</strong><br />
Lehramt aus dem Unterrichtsfach<br />
Physik<br />
kann ersetzt werden durch folgende<br />
Lehrveranstaltung(<br />
en) aus dem <strong>Studienplan</strong> Lehramt aus<br />
dem<br />
Unterrichtsfach Chemie<br />
Mathematische Übungen für das<br />
Lehramt<br />
141 Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium I<br />
151 Chemie für Physiker Allgemeine Chemie und<br />
Organische Chemie I<br />
Typ<br />
IP 4<br />
VO<br />
2<br />
Semester<br />
stunden<br />
3 und 4<br />
8.4 Zweiter Studienabschnitt (38 Semesterstunden)<br />
8.4.1. Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern:<br />
LA-<br />
Ph<br />
###<br />
Lehrveranstaltung Art Typ Semesterstunden vorausgesetzt<br />
wird<br />
LA-Ph<br />
Prüfungsfach<br />
221 Theoretische Physik für<br />
das Lehramt L2<br />
222 Übungen zur Theoretischen<br />
Physik für das<br />
LP VO Insgesamt 7,<br />
davon VO<br />
mindestens 5,<br />
höchstens<br />
6<br />
112, 116,<br />
123 u.<br />
145<br />
Theoret. Physik<br />
IP UE - Theoret. Physik<br />
Seite 39 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Lehramt L2<br />
231 Praktikum für Schulversuche<br />
I (auch in<br />
Hinsicht auf<br />
geschlechtsspezifische<br />
Aspekte)<br />
232 Lehrveranstaltung aus<br />
der Fachdidaktik (mit<br />
Berücksichtigung der<br />
Frauen- und<br />
Geschlechterforschung)<br />
233 Lehrveranstaltung aus<br />
der Fachdidaktik<br />
261 Lehrveranstaltung aus<br />
der Allgemeinen Pädagogik,<br />
vorzugsweise zur<br />
Theorie der Schule<br />
bzw. Erziehung<br />
262 Lehrveranstaltung aus<br />
der Allgemeinen Pädagogik<br />
263 Lehrveranstaltung aus<br />
der Allgemeinen Pädagogik<br />
unter besonderer<br />
Berücksichtigung des<br />
Unterrichtsfaches Physik<br />
(vgl. Z 3.2.b.8)<br />
IP UE 8 gestundet:<br />
111 – 161<br />
LP/IP<br />
LP/IP<br />
VO,<br />
SE<br />
oder<br />
UE<br />
VO,<br />
SE,<br />
UE,<br />
KO,<br />
EX,<br />
PR<br />
VO,<br />
SE<br />
oder<br />
UE<br />
VO,<br />
SE,<br />
UE<br />
VO,<br />
SE,<br />
UE,<br />
KO,<br />
EX,<br />
PR<br />
Fachdidaktik<br />
der Physik<br />
2 - Fachdidaktik<br />
der Physik<br />
1 - Fachdidaktik<br />
der Physik<br />
2 - Allgemeine<br />
Pädagogik<br />
2 - Allgemeine<br />
Pädagogik<br />
1 - Allgemeine<br />
Pädagogik<br />
Zusätzlich im 2.Studienabschnitt zu absolvieren sind wahlweise:<br />
LA-<br />
Ph<br />
###<br />
211<br />
und<br />
212<br />
Lehrveranstaltung Art Typ Semester<br />
stunden<br />
entweder<br />
Physik der Materie I und Physik der<br />
Materie II<br />
oder alternativ<br />
Lehrveranstaltungen aus mindestens<br />
drei der<br />
folgenden Bereiche<br />
- Kernphysik, Atomphysik, Mittel- bzw.<br />
Hochenergiephysik, Elementarteilchenphysik<br />
- Quantenphysik<br />
- Materialphysik, Festkörperphysik<br />
- Interdisziplinär ausgerichtete Physik<br />
- Computational Physics<br />
LP<br />
LP/IP<br />
VO<br />
VO u./od.<br />
UE u./od.<br />
SE<br />
u./od.KO<br />
insgesamt<br />
8<br />
voraus<br />
gesetzt<br />
wird<br />
LA-<br />
Ph<br />
Prüfungsfach<br />
- Exp. Physik<br />
Zusätzlich im 2.Studienabschnitt zu absolvieren ist wahlweise:<br />
Seite 40 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
LA-<br />
Ph<br />
###<br />
214 Entweder<br />
Exkursion zu Großforschungsanlagen der Physik<br />
und Institutionen der außeruniversitären Forschung<br />
223 oder alternativ<br />
Exkursion zu Großforschungsanlagen der Physik<br />
und Institutionen der außeruniversitären Forschung<br />
234 oder alternativ<br />
Exkursion zu Großforschungsanlagen der Physik<br />
und Institutionen der außeruniversitären Forschung<br />
Zusätzlich im 2.Studienabschnitt zu absolvieren ist wahlweise:<br />
Lehrveranstaltung Art – Typ –<br />
Semesterstunden<br />
vorausgesetzt<br />
wird<br />
LA-Ph<br />
Prüfungsfach<br />
IP – EX- 1 - Exp. Physik<br />
Theoret.<br />
Physik<br />
Fachdidaktik<br />
der Physik<br />
LA-<br />
Ph<br />
###<br />
235 Entweder<br />
Fachdidaktisches Praktikum für Vorgeschrittene<br />
(im Umfang von mindestens 6 Semesterstunden)<br />
Lehrveranstaltung Art – Typ –<br />
Semesterstunden<br />
vorausgesetzt<br />
wird<br />
LA-Ph<br />
IP – UE – 6 111, 115,<br />
117, 231<br />
Prüfungsfach<br />
Fachdidaktik<br />
der Physik<br />
• Praktikum für Schulversuche II<br />
• Projektpraktikum<br />
oder ein anderes gleichwertiges Praktikum<br />
213 oder alternativ<br />
Experimentalphysikalisches Praktikum für Vorgeschrittene<br />
(im Umfang von mindestens 6 Semesterstunden)<br />
• Aerosolphysikpraktikum<br />
• Festkörperpraktikum<br />
• Hochenergiephysikpraktikum<br />
• Kernphysikalisches Praktikum<br />
• Moderne Methoden der Experimentalphysik<br />
• Moderne Mikroskopische Methoden<br />
• Physikalisches Praktikum für Vorgeschrittene<br />
• Praktikum Quantenoptik<br />
• Tieftemperaturpraktikum<br />
oder ein anderes gleichwertiges Praktikum<br />
111, 115,<br />
117<br />
Exp. Physik<br />
8.4.2. Anmeldungsvoraussetzungen:<br />
Für die Lehrveranstaltung ist Anmeldungsvoraussetzung der positive Abschluß von<br />
LA-Ph Lehrveranstaltung<br />
LA-Ph Lehrveranstaltung(en)<br />
###<br />
###<br />
213 Experimentalphysikalisches<br />
111 Einführung in die Physik I<br />
Praktikum für Vorgeschrittene (im<br />
Umfang von mindestens 6<br />
115 Einführung in die Physik II<br />
Semesterstunden)<br />
117 Physikalisches Praktikum für das<br />
Seite 41 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
Lehramt<br />
221 Theoretische Physik für das<br />
Lehramt L2<br />
112 Rechenübungen zur Einführung in<br />
die Physik I<br />
116 Rechenübungen zur Einführung in<br />
die Physik II<br />
123 Übungen zur Theoretischen Physik<br />
für das Lehramt L1<br />
145 Übungen zu Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium III<br />
231 Praktikum für Schulversuche I 111 gestundet: Einführung in die Physik<br />
I<br />
112 gestundet: Rechenübungen zur<br />
Einführung in die Physik I<br />
113 gestundet: Vorpraktikum<br />
114 gestundet: Methoden der Experimentellen<br />
Physik I<br />
115 gestundet: Einführung in die Physik<br />
II<br />
116 gestundet: Rechenübungen zur<br />
Einführung in die Physik II<br />
117 gestundet: Physikalisches Praktikum<br />
für das Lehramt<br />
121 gestundet: Relativistische Physik<br />
und elementare Quantenmechanik<br />
122 gestundet: Theoretische Physik für<br />
das Lehramt L1<br />
123 gestundet: Übungen zur Theoretischen<br />
Physik für das Lehramt L1<br />
131 gestundet: Fachdidaktische Vertiefung<br />
der Physik (A, B, C oder D)<br />
141 gestundet: Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium I<br />
142 gestundet: Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium II<br />
143 gestundet: Übungen zu Mathematische.Grundlagen<br />
für das<br />
Physikstudium II<br />
144 gestundet: Mathematische Grundlagen<br />
für das Physikstudium III<br />
145 gestundet: Übungen zu Mathematische<br />
Grundlagen für das<br />
Physikstudium III<br />
151 gestundet: Chemie für Physiker<br />
161 gestundet: Zur Wahl Lehrveranstaltungen<br />
aus dem Angebot der<br />
Pädagogik für Lehramtsstudierende<br />
111 Einführung in die Physik I<br />
115 Einführung in die Physik II<br />
117 Physikalisches Praktikum für das<br />
Lehramt<br />
231 Praktikum für Schulversuche I<br />
Sind die Anmeldungsvoraussetzungen gestundet, so ist deren Erfüllung binnen 7 Wochen nach Semesterbeginn<br />
nachzuweisen.<br />
Seite 42 von 43
Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />
8.4.3. Alternative für Studierende des Diplomstudiums Physik<br />
LA-Ph<br />
###<br />
Lehrveranstaltung aus dem <strong>Studienplan</strong><br />
Lehramt aus dem Unterrichtsfach<br />
Physik<br />
122 Theoretische Physik für das Lehramt<br />
L2<br />
123 Übungen zu Theoretische Physik<br />
für das<br />
Lehramt L2<br />
kann ersetzt werden durch folgende<br />
Lehrveranstaltungen aus<br />
dem <strong>Studienplan</strong> Physik<br />
Theoretische Physik T2 und<br />
Theoretische Physik T3<br />
Übungen zu Theoretische Physik<br />
T2 und Übungen<br />
zu Theoretische Physik T3<br />
Typ<br />
VO je 5<br />
UE je 2<br />
Semesterstunden<br />
8.5 Freie Wahlfächer (10 Semesterstunden) und Empfehlungen<br />
8.5.1 Freie Wahlfächer:<br />
Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der In- und Ausländischen Universitäten.<br />
LA-Ph<br />
Lehrveranstaltung<br />
###<br />
71 Freie Wahlfächer (auch hinsichtlich<br />
Frauen- und Geschlechterforschung)<br />
Semesterstunden<br />
10<br />
8.5.2 Empfehlungen:<br />
Das Schulpraktikum sollte nach Möglichkeit zu Beginn des zweiten Studienabschnittes des Studiums<br />
des Lehramtes im Unterrichtsfaches Physik durchgeführt werden.<br />
Wird eine Diplomarbeit in Physik ins Auge gefaßt, so wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig – vorzugsweise<br />
unmittelbar nach Beendigung des ersten Studienabschnitts – mit den möglichen Betreuern<br />
zu beraten. Es ist sinnvoll, die freien Wahlfächer und das Fortgeschrittenenpraktikum so auszuwählen,<br />
daß sie im Umfeld der anvisierten Diplomarbeit liegen.<br />
Wird keine Diplomarbeit in Physik ins Auge gefaßt, so wird empfohlen, die freien Wahlfächer möglichst<br />
zu einer Verbreiterung des Studiums zu nutzen. Im Hinblick auf den Lehrplan der Physik in den<br />
Schulen sind Lehrveranstaltungen aus folgenden Bereichen besonders geeignet:<br />
• Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Erkenntnistheorie<br />
• Astronomie<br />
• Meteorologie und Geophysik<br />
• Biophysik<br />
• Medizinische Physik<br />
• Meßtechnik<br />
• Elektronik<br />
Für den Unterricht ist es bereichernd, wenn der Lehrer die physikalischen Grundkenntnisse in einen<br />
interdisziplinären Zusammenhang stellen kann. Hierfür wären Lehrveranstaltungen aus folgenden<br />
Bereichen sehr geeignet:<br />
• Biologie<br />
• Chemie<br />
• Mineralogie und Kristallographie<br />
Aber auch eine Ergänzung oder Vertiefung der fachlichen, fachdidaktischen oder pädagogischen<br />
Kenntnisse sind nützlich. Hierzu sind Lehrveranstaltungen aus folgenden Bereichen geeignet:<br />
• Mathematik<br />
• Informatik<br />
• weitere Lehrveranstaltungen aus der Physik<br />
• weitere Lehrveranstaltungen aus der Fachdidaktik der Physik<br />
• weitere Lehrveranstaltungen aus der Allgemeinen Pädagogik<br />
• Logistik<br />
Seite 43 von 43