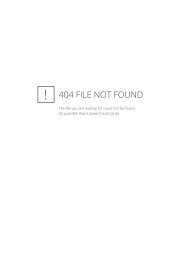Radio- und Fernsehformate in der Schweiz seit 1980 ... - Moodle 2
Radio- und Fernsehformate in der Schweiz seit 1980 ... - Moodle 2
Radio- und Fernsehformate in der Schweiz seit 1980 ... - Moodle 2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Radio</strong>- <strong>und</strong> <strong>Fernsehformate</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>seit</strong> <strong>1980</strong><br />
BA-Hauptsem<strong>in</strong>ar<br />
Universität Freiburg (CH)<br />
Medien- <strong>und</strong> Kommunikationswissenschaft<br />
Dozent: Daniel Beck<br />
26. Februar 2013<br />
Seite 2<br />
Thematische E<strong>in</strong>führung<br />
• Begriffe: Format, Genre, Gattung,<br />
Programmsparte<br />
• Entwicklung des <strong>Schweiz</strong>er R<strong>und</strong>funkmarkts<br />
(wirtschaftliche <strong>und</strong> rechtliche<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen)<br />
• Wichtige technische Neuerungen<br />
Seite 3<br />
Auswirkungen <strong>der</strong> Formatierung<br />
• S<strong>in</strong>d die Formatierung <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />
Formathandel e<strong>in</strong>e positive o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e negative<br />
Entwicklung <strong>in</strong> Bezug auf das Programmangebot?<br />
• Wie bewertet ihr die euch bekannten <strong>Schweiz</strong>er<br />
Versionen von <strong>in</strong>ternationalen Formaten?<br />
1
Seite 4<br />
Zum Begriff des Fernsehformats<br />
• Format = „Bezeichnung für die unverän<strong>der</strong>lichen Elemente<br />
serieller Fernsehproduktion“ (Lünenborg 2006)<br />
• umfasst neben Idee <strong>und</strong> Konzept <strong>der</strong> Sendung auch Aussagen<br />
zu Ersche<strong>in</strong>ungsbild, Logos, Festlegung von Sendezeit <strong>und</strong><br />
Zielpublikum<br />
• nach Esser (2010) Programme, die zur Adaptation <strong>in</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Län<strong>der</strong> verkauft werden<br />
• Ziel: Optimierung von Inhalt <strong>und</strong> Form im H<strong>in</strong>blick auf hohe<br />
E<strong>in</strong>schaltquoten bei e<strong>in</strong>em bestimmten Zielpublikum (Hickethier<br />
1998)<br />
Seite 5<br />
Gleiches Format o<strong>der</strong> nicht?<br />
Seite 6<br />
Formatierung beim <strong>Radio</strong><br />
• Durchstrukturierung des gesamten Programms <strong>in</strong> Bezug auf<br />
Musikauswahl, Mo<strong>der</strong>ation <strong>und</strong> akustische Elemente (J<strong>in</strong>gles)<br />
• Entwicklung vom E<strong>in</strong>schalt- zum Begleitmedium, Ausrichtung<br />
auf e<strong>in</strong>e bestimmte Zielgruppe<br />
• „Durchhörbarkeit“: Das gesamte Programm soll die Bedürfnisse<br />
<strong>der</strong> Zielgruppe befriedigen.<br />
• daher Vermeidung längerer Wortbeiträge <strong>und</strong> polarisieren<strong>der</strong><br />
Musikstile<br />
(vgl. z.B. Pöhls 2006, Goldhammer 1995, Seiler/Grossenbacher 1997)<br />
2
Seite 7<br />
Unterscheidung von „Gattung“ <strong>und</strong><br />
„Genre“ im deutschen Sprachgebrauch<br />
(vgl. Gehrau 2001)<br />
• Gattung = Klassifikation nach formalen Kriterien wie<br />
Sendungslänge, Anzahl Beiträge, Abgeschlossenheit,<br />
Filmtechnik: Serien, Shows, Magaz<strong>in</strong>e, Übertragungen, …<br />
• Genre = Klassifikation nach <strong>in</strong>haltlichen Kriterien (nur bei<br />
fiktionalen Inhalten), aufgr<strong>und</strong> typischer Handlungen <strong>und</strong><br />
typischer Figuren: Krimis, Komödien, Science-Fiction, Western,<br />
Horror<br />
→ bei nonfiktionalen Inhalten <strong>in</strong>haltliche Kategorisierung nach<br />
Themen: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Kultur<br />
Seite 8<br />
Programmsparten beim Fernsehen<br />
(vgl. Trebbe 2004)<br />
• fiktionale Unterhaltung<br />
• nonfiktionale Unterhaltung<br />
• Fernsehpublizistik<br />
• Sportsendungen<br />
• K<strong>in</strong><strong>der</strong>sendungen<br />
• Religionssendungen<br />
Seite 9<br />
Programmelemente beim <strong>Radio</strong><br />
(vgl. Publicom 2009)<br />
• Musik<br />
• Information (z.B. Nachrichten, Reportagen)<br />
• Mo<strong>der</strong>ation<br />
• Service (z.B. Verkehrsmeldungen, Veranstaltungsh<strong>in</strong>weise)<br />
• Unterhaltung (z.B. Spiele, Hörspiele)<br />
• Layout (z.B. J<strong>in</strong>gles)<br />
3
Seite 10<br />
<strong>Radio</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>in</strong> den 70er-Jahren<br />
„Das Musikprogramm war von Marsch <strong>und</strong> Jodel<br />
beherrscht, <strong>und</strong> damit die <strong>Radio</strong>journalisten ke<strong>in</strong><br />
schlechtes Gewissen beschlich, wenn sie e<strong>in</strong>en<br />
Song von Elvis Presley ausstrahlen, nutzten sie das<br />
zum pädagogisch wertvollen Sprachunterricht: Nur<br />
scheibchenweise durfte so e<strong>in</strong> Chanson o<strong>der</strong><br />
Schlager ausgestrahlt werden. Je<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelne Satz<br />
wurde wie im Schulunterricht übersetzt, je nach<br />
Studio auf Zürich-, Bern- o<strong>der</strong> Baseldeutsch.”<br />
„<strong>Radio</strong> Days“-Ansprache von Moritz Leuenberger, 11.9.2008<br />
Seite 11<br />
Treibende Kräfte beim Fall<br />
des SRG-Monopols<br />
• Piratenradios aus <strong>der</strong> Umwelt-, Frauen<strong>und</strong><br />
Jugendbewegung (<strong>Radio</strong>-Aktiv<br />
Freies Gösgen, Wälle-Häxe, LoRa <strong>und</strong><br />
viele an<strong>der</strong>e)<br />
• Roger Schaw<strong>in</strong>skis „<strong>Radio</strong> 24“ als<br />
professioneller, halbkommerzieller<br />
Unterhaltungssen<strong>der</strong>, sendet ab 1979<br />
vom Pizzo Groppero aus nach Zürich<br />
• rechtsbürgerliche Politiker, die gegen<br />
die angebliche „L<strong>in</strong>ksunterwan<strong>der</strong>ung“<br />
<strong>der</strong> SRG kämpfen<br />
Roger Schaw<strong>in</strong>ski,<br />
1983<br />
Seite 12<br />
Erste Liberalisierung: 3-Ebenen-Modell<br />
• 1982 von Expertenkommission empfohlen, 1991 im ersten<br />
<strong>Radio</strong>- <strong>und</strong> TV-Gesetz (RTVG) festgeschrieben<br />
• Gr<strong>und</strong>idee: SRG behält Monopol auf sprachregionaler Ebene,<br />
private Akteure s<strong>in</strong>d auf regionaler <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationaler Ebene<br />
zugelassen<br />
• im RTVG von 1991: allgeme<strong>in</strong>er Leistungsauftrag,<br />
Werbebeschränkungen für Private, Gebührensplitt<strong>in</strong>g<br />
4
Seite 13<br />
Umsetzung des 3-Ebenen-Modells<br />
Lokalradios gehen 1983<br />
versuchsweise für fünf Jahre auf<br />
Sendung <strong>und</strong> erhalten dann<br />
def<strong>in</strong>itive Konzessionen<br />
SRG führt gleichzeitig<br />
sprachregionale Programme<br />
für das jüngere Publikum<br />
e<strong>in</strong>: 1982 Couleur 3, 1983<br />
DRS 3, 1988 Rete 3<br />
Seite 14<br />
Und <strong>der</strong> Fernsehmarkt?<br />
• starke Konkurrenz aus dem Ausland (Marktanteil <strong>der</strong><br />
ausländischen Sen<strong>der</strong> ca. 60%)<br />
• Namensän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Deutschschweiz: Aus Fernsehen<br />
DRS wird 1990 SF DRS <strong>und</strong> 2005 SF<br />
• Lokales Privatfernsehen (TeleZüri ab 1994)<br />
• 1998-2001 kurzer Boom sprachregionaler TV-Stationen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Deutschschweiz (Tele24, TV3, RTLProSieben <strong>Schweiz</strong>, Swizz)<br />
• medienpolitische Anliegen: e<strong>in</strong>er<strong>seit</strong>s mehr Freiheiten für<br />
Privatsen<strong>der</strong>, an<strong>der</strong>er<strong>seit</strong>s Gebührensplitt<strong>in</strong>g für lokale <strong>und</strong><br />
regionale TV-Sen<strong>der</strong> → neues RTVG von 2006<br />
Seite 15<br />
Entwicklung des R<strong>und</strong>funkmarkts - Fazit<br />
• Unruhige Anfangszeiten – <strong>Radio</strong>piraten <strong>und</strong> rechtsbürgerliche<br />
Politiker als Triebkräfte <strong>der</strong> Liberalisierung<br />
• Übergang vom Monopol des Service-Public-Sen<strong>der</strong>s zum<br />
dualen System erfolgt nur schrittweise.<br />
• Drei-Ebenen-Modell hat bis heute Auswirkungen auf das<br />
Programmangebot.<br />
5
Seite 16<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Übertragungstechnik<br />
• Kabelfernsehen: <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> erstmals 1965; Ende <strong>der</strong> 80er-<br />
Jahre s<strong>in</strong>d über 80% <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong>er Haushalte angeschlossen<br />
• Satellitenfernsehen: erster europäischer R<strong>und</strong>funksatellit 1983<br />
→ um 1990 s<strong>in</strong>d per Kabel je ca. 30 TV- <strong>und</strong> <strong>Radio</strong>programme<br />
empfangbar, dank Satellit auch aus weiter entfernten Län<strong>der</strong>n<br />
→ ab 1988 neue ausländische Privatsen<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>Schweiz</strong>er<br />
Kabelnetzen (Bewilligungspflicht durch PTT entfällt 1990)<br />
• Ab Mitte 90er-Jahre weiterer Ausbau <strong>der</strong> Programmvielfalt<br />
durch Digitalisierung beim <strong>Radio</strong> (DAB) <strong>und</strong> beim Fernsehen<br />
→ Platz für zusätzliche Spartenprogramme<br />
Seite 17<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Produktionstechnik<br />
• „Musikrotation“: automatische Programmierung <strong>der</strong> Musiktitel<br />
per Computer wird bei <strong>Schweiz</strong>er <strong>Radio</strong>programmen zu Beg<strong>in</strong>n<br />
<strong>der</strong> 90er-Jahre e<strong>in</strong>geführt<br />
→ bei SRG-Programmen heute Datenbanken mit 3500-5000 Titeln<br />
→ Effizienzgew<strong>in</strong>n ermöglicht kostengünstigen Betrieb neu<br />
geschaffener Spartenprogramme<br />
• digitalisierte Produktion <strong>und</strong> automatische Programmierung<br />
beim Fernsehen<br />
→ Sendungswie<strong>der</strong>holungen mit wenig Aufwand realisierbar,<br />
ermöglicht neue Angebote (Endlosschlaufen bei Regional-TV,<br />
SF<strong>in</strong>fo)<br />
Seite 18<br />
Die Rolle des Internet<br />
• 1996 erste SRG-Websites mit Programmh<strong>in</strong>weisen<br />
• ab 1997 Download von <strong>Radio</strong>beiträgen<br />
• ab 2001 Download von Fernsehbeiträgen<br />
• ab 2005 Podcasts für mobile Geräte<br />
→ Voraussetzung: digitalisierte Produktion <strong>und</strong> Archivierung<br />
→ R<strong>und</strong>funk<strong>in</strong>halte werden zeitlich unabhängig verfügbar<br />
→ neue Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Publikum<br />
(Beispiel mx3.ch)<br />
6
Seite 19<br />
Vielen Dank für Eure<br />
Aufmerksamkeit!<br />
7


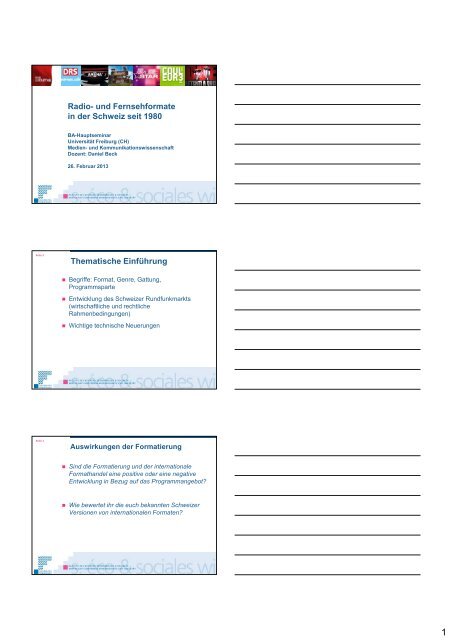






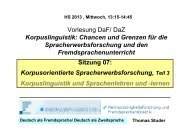


![Vorlesung DaF/ DaZ [L028.0239] Korpuslinguistik ... - Moodle 2](https://img.yumpu.com/45172857/1/190x134/vorlesung-daf-daz-l0280239-korpuslinguistik-moodle-2.jpg?quality=85)