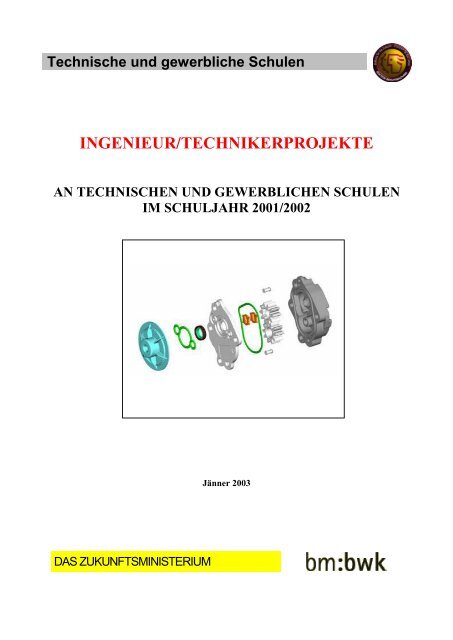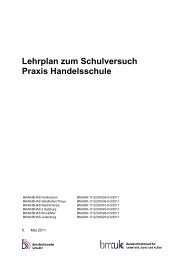INGENIEUR/TECHNIKERPROJEKTE - Berufsbildende Schulen
INGENIEUR/TECHNIKERPROJEKTE - Berufsbildende Schulen
INGENIEUR/TECHNIKERPROJEKTE - Berufsbildende Schulen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Technische und gewerbliche <strong>Schulen</strong><br />
<strong>INGENIEUR</strong>/<strong>TECHNIKERPROJEKTE</strong><br />
AN TECHNISCHEN UND GEWERBLICHEN SCHULEN<br />
IM SCHULJAHR 2001/2002<br />
Jänner 2003<br />
DAS ZUKUNFTSMINISTERIUM
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2001/2002<br />
Einführung<br />
EINFÜHRUNG – GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN<br />
EINIGE WESENTLICHE DATEN ZU BEGINN<br />
Vorweg eine kurze zahlenmäßige Übersicht über die in dieser Broschüre enthaltenen<br />
Projekte des Schuljahres 2001/2002:<br />
Ø 42 vertretene <strong>Schulen</strong>,<br />
Ø 1336 eingereichte Projekte für das Schuljahr 2001/02,<br />
Ø davon wurde 887 mal das Ergebnis in die Praxis umgesetzt,<br />
Ø 591 Projekte wurden mit außerschulischen Partnern durchgeführt<br />
Ø 412 Projekte erbrachten eine Wertschöpfung innerhalb des Schulbereiches,<br />
Ø 255 Projekte werden auf einer eigenen Web-Seite dargestellt und können somit im<br />
Internet ausführlicher betrachtet werden.<br />
ZUM ZIEL DIESER DOKUMENTATION<br />
Die Abteilung II/2 „Technische und gewerbliche Lehranstalten“ des Bundesministeriums für<br />
Bildung, Wissenschaft und Kultur will mit dieser Publikation die Leistungen, die an den<br />
Fachschulen und Höheren Technischen Lehranstalten in Form von Ingenieur- und Technikerprojekten<br />
erbracht werden, der interessierten Öffentlichkeit vorstellen. Immer wieder treten<br />
einzelne Projekte, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel durch Wettbewerbe<br />
wie „Jugend innovativ“. Dabei gelingt es einzelnen <strong>Schulen</strong> und Schülern ihr Leistungsniveau<br />
öffentlichkeitswirksam zur Schau zu stellen. So schön diese Erfolge auch sind, sie können<br />
eben nur einen kleinen Ausschnitt des Leistungsspektrums an Technischen und gewerblichen<br />
Lehranstalten vermitteln.<br />
Aus diesem Anlass gibt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur diese<br />
Broschüre heraus die eine breite und standardisierte Übersicht über die Projekte des<br />
vorangegangenen Schuljahres aus dem Bereich der technischen und gewerblichen<br />
Lehranstalten gibt.<br />
Die vorliegende Dokumentation verfolgt im Wesentlichen drei Ziele:<br />
· Sie will die Leistungen von Schülerinnen und Schülern aufzeigen, die an den technischen<br />
und gewerblichen <strong>Schulen</strong> im Rahmen eines realitätsnahen und berufsbezogenen<br />
Unterrichts erbracht werden und so den hohen und zeitgemäßen Ausbildungsstandard<br />
der Absolventinnen und Absolventen signalisieren.<br />
· Sie will zum Ausdruck bringen, dass sich die technischen und gewerblichen <strong>Schulen</strong> nicht<br />
nur als reine Ausbildungsinstitutionen sehen, sondern auch als Partner der Wirtschaft,<br />
die im Stande sind, spezielle Problemlösungen und Leistungen zu erbringen.<br />
- I -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2001/2002<br />
Einführung<br />
· Sie will zu einem fruchtbaren Ideen- und Erfahrungsaustausch innerhalb und zwischen<br />
den technischen und gewerblichen <strong>Schulen</strong> anregen. Das Wissen um die Aktivitäten an<br />
anderen <strong>Schulen</strong> kann und soll Synergieeffekte hervorbringen.<br />
FÄCHERÜBERGREIFENDE PROJEKTE IM BEREICH DER TECHNISCH-GEWERBLICHEN SCHULEN<br />
Projekte haben im Unterricht an technisch-gewerblichen <strong>Schulen</strong> eine lange Tradition. Sie<br />
sind bereits seit langem im Lehrplan des technischen Schulwesens verankert und Schülerinnen<br />
und Schüler erbringen dabei seit Jahren gemeinsam mit ihren Lehrkräften im Rahmen<br />
des Unterrichts Leistungen, die die Standards der schulischen Ausbildung nachhaltig geprägt<br />
haben.<br />
Die erbrachten Leistungen waren derart bemerkenswert (eine hohe Anzahl an Auszeichnungen<br />
und Preisen in öffentlichen Bewerben geben davon Zeugnis), dass es letztlich nur<br />
logisch erschien, diesen Einsatz auch in die am Ende der Ausbildung stehende Reife- und<br />
Diplomprüfung (bzw. Abschlussprüfung) einzubeziehen. Die Neufassung der Verordnung<br />
zur Reife- und Diplomprüfung 1 ermöglicht die Anrechnung solcher Projekte in Form einer<br />
Diplomarbeit vor. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen dabei neben der Abgabe eines<br />
ausführlich dokumentierten Projektberichtes ihre Arbeit im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung<br />
präsentieren und sich einer detaillierten Befragung stellen.<br />
Die Zahl der durchgeführten Projekte ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und sie<br />
stellen nun, insbesondere seit der Möglichkeit der Anrechnung bei der Reife- Und Diplomprüfung<br />
bzw. Abschlussprüfung einen fixen Bestandteil der Ausbildung an technischgewerblichen<br />
<strong>Schulen</strong> dar. Diese Projekte weisen nun einige Besonderheiten auf, die sich<br />
auch in der Übersicht dieser Broschüre widerspiegeln.<br />
Außerschulische Partner<br />
Ein hoher Anteil der Projekte wurden in Kooperation mit einem ausserschulischen Partnern<br />
durchgeführt. Diese ausserschulischen Partner kommen zum einen aus der Industrie, wobei<br />
hier wiederum zu etwa gleichen Anteilen sowohl Großbetriebe als auch Klein- und<br />
Mittelbetriebe vertreten sind. Ebenso greift aber vielfach auch die öffentliche Hand (z.B.<br />
Landesbehörden, Gemeinden) auf das Potenzial der technischen <strong>Schulen</strong> zurück. Letztlich<br />
soll besonders darauf hingewiesen werden, dass auch sehr viele Projekte ihr Umfeld in der<br />
Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen (z.B. Behindertenbetreuung, Entwicklungshilfe)<br />
haben. Im dritten Teil der Broschüre finden sie eine alphabetische Auflistung aller<br />
ausserschulischen Partner und Auftraggeber der Projekte des letzten Schuljahres.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, dass in den Projekten nicht theoretische<br />
Ergebnisse angestrebt werden, sondern die eigentliche Intention die konkrete Umsetzung in<br />
der Praxis ist. Auch im Schuljahr 2001/2002 endeten wiederum fast zwei Drittel der Projekte<br />
mit der Realisierung, also mit einer wirtschaftlichen oder sozialen Nutzung.<br />
Alternative: schulinterne Wertschöpfung<br />
Dem gegenüber stehen Projekte, die mit einer „innerschulischen Wertschöpfung“ verbunden<br />
sind. Bei solchen Projekten ist der „wirtschaftliche Partner“ die Schule selbst, die<br />
Schüler erfahren die konkrete Arbeitspraxis ihres späteren Berufsfeldes im realen Betriebs-<br />
1 BGBl. II Nr. 70/2000<br />
- II -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2001/2002<br />
Einführung<br />
umfeld der eigenen Schule (z.B. Aus- und Umbauarbeiten an Gebäudeobjekten, Entwicklung<br />
und Installation von EDV-Verwaltungs- oder Organisationsprogrammen). Dies traf im letzten<br />
Schuljahr bei etwa einem Drittel der durchgeführten Projekte zu. Das Ausbildungsziel wird<br />
hier mit sinnvollen schulischen Notwendigkeiten, die letztlich allen zu Gute kommen, äußerst<br />
effizient verbunden<br />
In der tabellarischen Gesamtübersicht in Abschnitt 2 befinden sich Hinweise zu außerschulischen<br />
Partnern und zur innerschulischen Wertschöpfung.<br />
Hohe Wertigkeit für die Ausbildung<br />
Aus all dem kann erkannt werden, warum die Ingenieur- und Technikerprojekte („Technikerprojekte“<br />
sind die im Rahmen der Fachschulausbildung durchgeführten Projekte) in kurzer<br />
Zeit einen solch hohen Stellenwert erlangen konnten. Zu den allgemein bekannten positiven<br />
Effekten eines projektorientierten Unterrichts, kommen im technisch-gewerblichen Bereich<br />
noch weitere Effekte hinzu, die für ein berufsbildendes Schulwesen von grundlegender<br />
Bedeutung sind:<br />
Ø Die Komplexität der zu bewältigenden Aufgabe (von der Planung zur Realisierung) führt<br />
den Schülern realistisch die wahre Breite des gewählten Berufsfeldes vor Augen.<br />
Ø Die Schüler sammeln bei der Realisierung praktische Erfahrungen in diesem Berufsumfeld.<br />
Ein Umstand, der bei den Schülern in der Regel ein hohes Maß an Interesse und<br />
Einsatzbereitschaft hervorruft.<br />
Ø Die Schüler erfahren realistisch, dass sie in der Berufspraxis im Normalfall mit komplexen<br />
Problemen konfrontiert werden und nicht mit detaillierten Aufgaben.<br />
Ø Die Schüler sind gezwungen, im Rahmen des Projektes Verantwortung zu übernehmen.<br />
Hängt doch daran nicht nur ihr eigener Erfolg, sondern auch der des gesamten Projektes<br />
und somit jener ihrer Mitschüler.<br />
Ø Letztlich erfahren sie den Wert, die Vorteile, aber auch Probleme einer kooperativen<br />
Arbeit im Team, vor allem, dass Teamfähigkeit eine der grundlegenden Qualifikationen<br />
für das reale Berufsleben darstellt.<br />
STANDARDS FÜR <strong>INGENIEUR</strong>- UND <strong>TECHNIKERPROJEKTE</strong><br />
Im Zuge der Anerkennung von Ingenieurprojekten als Diplomarbeit im Rahmen der Reifeund<br />
Diplomprüfung (resp. von Technikerprojekten als Abschlussarbeit im Rahmen der<br />
Abschlussprüfung) wurden im Sinne einer Qualitätssicherung Richtlinien in Form von<br />
Standards für die Durchführung solcher Projekte herausgegeben. Diese wurden als<br />
Rundschreiben Nr. 60/1999 unter der Zahl 17.600/101-II/2b/99 am 8. Februar 2000 veröffentlicht.<br />
Sie können unter den später angeführten Web-Adressen eingesehen und heruntergeladen<br />
werden.<br />
DER LEITFADEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON <strong>INGENIEUR</strong>- UND <strong>TECHNIKERPROJEKTE</strong>N<br />
Für näher Interessierte sei darauf verwiesen, dass von der Abteilung II/2 des BMBWK in<br />
Kürze ein neuer Leitfaden zur Durchführung von Ingenieur- und Technikerprojekten<br />
- III -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2001/2002<br />
Einführung<br />
herausgegeben wird, der nach der Fertigstellung ab ca. der 2. Jahreshälfte angefordert werden<br />
kann:<br />
Kontakt- und Bestelladresse:<br />
BMBWK, Abteilung II/2b, MinR Mag. Dr. Peter Schüller, 1014 Wien, Minoritenplatz 5;<br />
Tel.: 01-53120-4465; Fax.: 01-53120-4130; E-Mail: peter.schueller@bmbwk.gv.at<br />
DAS NETZWERK ITP AN DEN HTLS ÖSTERREICHS<br />
Die Durchführung von Ingenieur- und Technikerprojekten (weiterhin kurz ITP) erfasst in<br />
jüngster Zeit immer mehr Bereiche, die Kontakte außerhalb der eigenen Schule erforderlich<br />
machen. Aus diesem Grund hat die Abteilung II/2 des BMBWK in Zusammenarbeit<br />
mit dem Arbeitskreis ITP ein „Netzwerk ITP“ installiert, dem sich jede Schule bei Interesse<br />
anschließen kann. Dieses Netzwerk funktioniert auf Basis elektronischer Kommunikation<br />
und hat den Sinn eines raschen und unmittelbaren Informationsflusses in beide Richtungen.<br />
Die Ziele des Netzwerkes:<br />
· Die <strong>Schulen</strong> sollen rasch und unbürokratisch mit allen wesentlichen Informationen<br />
versorgen werden können, die sich im Umfeld der Projektdurchführung ergeben.<br />
· Bei notwendigen schulinternen organisatorischen Arbeiten im Zusammenhang mit ITP<br />
sollen der Direktor und die Abteilungsvorstände entlastet werden.<br />
· Den <strong>Schulen</strong> soll bei allen themenbezogenen Anfragen eine direkte und kompetente<br />
Ansprechstelle zur Verfügung gestellt werden.<br />
· Ebenso soll es in umgekehrter Weise den Dienststellen der Schulbehörde 1. und<br />
2. Instanz, sowie Personen von außen möglich sein, am Schulstandort eine fachkundige<br />
und autorisierte Person direkt kontaktieren zu können, die rasch und<br />
effizient innerhalb der Schule weiterverzweigen kann.<br />
Die Organisation des Netzwerkes<br />
· An jeder interessierten Schule wurde durch den Direktor ein kompetenter Kontaktlehrer<br />
ernannt, der für alle schulweiten (also die gesamte Schule betreffenden)<br />
Agenden in Zusammenhang mit der Durchführung von ITP zuständig und auch autorisiert<br />
ist.<br />
· Der zentrale Arbeitskreis ITP, der aus 14 Experten besteht und unter der Leitung<br />
der Abteilung II/2 des BMBWK steht, teilt alle am Netzwerk teilnehmenden <strong>Schulen</strong><br />
unter sich auf (im wesentlichen nach regionalen Gesichtspunkten), sodass jedem<br />
Kontaktlehrer an den einzelnen <strong>Schulen</strong> sein persönlicher Ansprechpartner in<br />
diesem Gremium für Anfragen jeglicher Art bekannt ist.<br />
· Im Regelfall erfolgt auch die Verteilung von Informationen auf diesem Weg (Arbeitskreis<br />
Þ Kontaktlehrer)<br />
Die Aufgabenbereiche der Kontaktlehrer<br />
Der durch die Schulleitung bestimmten Kontaktperson sollen dabei folgende Aufgaben<br />
zukommen:<br />
- IV -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2001/2002<br />
Einführung<br />
· Koordinierung aller schulischen Aktivitäten in Verbindung mit ITP (Entlastung der<br />
Schulleitung)<br />
· Zentraler Ansprechpartner am Schulstandort für den Themenbereich ITP<br />
· Kontaktperson für den österreichweiten „Arbeitskreis ITP“<br />
· Weiterleitung aller Informationen zu den jeweils betroffenen Stellen am<br />
Schulstandort.<br />
· Bemühungen um Termintreue im Umfeld ITP zwischen Schule und Schulbehörden<br />
· Input von Ideen in das Netzwerk ITP<br />
· eventuell Aufbau interner Organisationsformen (Arbeitsgruppe Projekte, standortbezogene<br />
Zentral-Erfassung der durchgeführten Projekte, schulinterne Seminarangebote,....)<br />
Die Teilnahme an dem Netzwerk ist grundsätzlich freiwillig. Im letzten Abschnitt dieser<br />
Broschüre findet sich eine Auflistung aller zur Zeit der Drucklegung in das Netzwerk integrierten<br />
<strong>Schulen</strong> und Kontaktpersonen mit ihren E-Mail-Adressen und Telefonnummern.<br />
ORGANISATORISCHES ZUR ERSTELLUNG DER NÄCHSTJÄHRIGEN BROSCHÜRE<br />
„<strong>INGENIEUR</strong>- UND <strong>TECHNIKERPROJEKTE</strong> IM SCHULJAHR 2002/03“<br />
Auch in Zukunft erscheint eine bundesweite Dokumentation der Leistungen, die im<br />
Rahmen der ITP erbracht werden, sinnvoll und wünschenswert.<br />
Der aufgrund der bisherigen Vorgangsweise entstandene Aufwand hat jedoch ein Ausmaß<br />
erreicht, das die zur Verfügung stehenden geringen Ressourcen, mehr als ausschöpft. Das<br />
BMBWK beabsichtigt daher, die Erstellung der Broschüre neu zu organisieren..<br />
Überlegungen dazu sind im Gange.<br />
Bis zum Vorliegen eines umsetzbaren Konzeptes werden die <strong>Schulen</strong> gebeten, die bisher<br />
übermittelten Informationen auch für das Schuljahr 2002/03 bereitzuhalten. Bezüglich<br />
der weiteren Vorgangsweise werden die <strong>Schulen</strong> rechtzeitig informiert.<br />
Die für die bisherige Vorgangsweise notwendigen Informationen finden sie unter folgenden<br />
Adressen:<br />
HTL Salzburg: WWW-Server: www.htl.fh-sbg.ac.at/aktiv/itp/index.htm<br />
FTP- Server: ftp.htl.fh-sbg.ac.at/ing-proj/<br />
HTL Wien 3 Rennweg:<br />
WWW-Server:<br />
www.htl.rennweg.at/bmbwk/itp/<br />
DANK<br />
An dieser Stelle sei allen Damen und Herren aus den schulischen und wirtschaftlichen<br />
Bereichen gedankt, die all diese Projektarbeiten gefördert haben, ganz besonders aber den<br />
jeweiligen Projektteams, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern, die<br />
mit den Techniker- und Ingenieurprojekten neue Maßstäbe in der Ausbildung an den technischen<br />
und gewerblichen <strong>Schulen</strong> gesetzt haben und immer wieder setzen.<br />
- V -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2001/2002<br />
Einführung<br />
Ebenso gebührt Dank den Mitgliedern des Arbeitskreises ITP, die im vergangenen Jahr wie<br />
auch in den Jahren davor viel Freizeit und Arbeit in diesen Themenbereich investiert haben.<br />
Ganz besonders sind hier wiederum Herr Abteilungsvorstand DI Siegfried Eckart,<br />
Abteilungsvorstand an der HTL Braunau und seine Mitarbeiterin Frau Tamara Hangl<br />
hervorzuheben, die mit großem Einsatz die redaktionelle Arbeit für diese Broschüre<br />
geleistet haben. Frau Amtsrätin Christa Pregesbauer, Abteilung II/2 des BMBWK hat die<br />
Endredaktion der Broschüre übernommen, wofür ihr auch herzlicher Dank auszusprechen ist.<br />
Obwohl die Erstellung der Broschüre sehr zeitaufwendig ist, hat der Einsatz und die<br />
Zusammenarbeit aller Beteiligten es wiederum ermöglicht, den Gesamtüberblick über die<br />
Leistungen des technisch – gewerblichen Schulwesens im Bereich der Ingenieur- und<br />
Technikerprojekte zu veröffentlichen.<br />
Diese Broschüre ist ebenfalls elektronisch verfügbar: http://www.berufsbildendeschulen.at<br />
Wolfgang Pachatz<br />
BMBWK, Abt II/2a, Technisch-gewerbliche <strong>Schulen</strong><br />
1014 Wien, Minoritenplatz 5<br />
Tel.: 01-53 120-5892 (Fax: 01-53 120-4130)<br />
E-Mail.: wolfgang.pachatz@bmbwk.gv.at<br />
- VI -
DIE „<strong>INGENIEUR</strong>/<strong>TECHNIKERPROJEKTE</strong>“<br />
DES SCHULJAHRES 2001/2002<br />
Abschnitt 1: Ausgewählte Projekte, Detailbeschreibungen .................... 2<br />
Abschnitt 2: Tabellarische Übersicht aller Projekte ................................ 101<br />
Abschnitt 3: Außerschulische Partner ..................................................... 210<br />
Abschnitt 4: Verzeichnis der <strong>Schulen</strong> ..................................................... 215<br />
Abschnitt 5: Das Netzwerk ITP ............................................................... 219<br />
ZUR STRUKTUR DER DOKUMENTATION:<br />
· Im ersten Abschnitt Dokumentation werden 49 Projekte auf jeweils<br />
zwei Seiten ausführlicher vorgestellt. Eine Seite (Datenblatt) dient dabei der<br />
Übersicht über die sachlichen und technischen Fakten des Projektes, eine<br />
zweite Seite (Projektpräsentation) einer allgemein verständlichen<br />
Darstellung.<br />
· Im zweiten Abschnitt wurden im Sinne einer möglichst umfassenden<br />
Dokumentation alle eingereichten Projekte in eine Tabelle aufgenommen,<br />
die Thema, Schule und Projektbetreuer – nach Fachrichtungen geordnet –<br />
zusammenfasst. Es soll so möglich werden, sich rasch Informationen zu<br />
bescchaffen und mit den Projektverantwortlichen direkt Kontakt<br />
aufzunehmen. Sie finden hier 1336 Projekte angeführt.<br />
· Den dritten Abschnitt bildet eine Übersichtsliste aller<br />
außerschulischen Partner, die im Schuljahr 2001/2002 an Ingenieur- bzw.<br />
Technikerprojekten beteiligt waren.<br />
· Der vierte Abschnitt enthält eine komplette Adressenliste jener<br />
<strong>Schulen</strong>, die mit Projekten in dieser Broschüre vertreten sind.<br />
· Der fünfte Abschnitt gibt zum Abschluss eine Übersicht der<br />
Kontaktpersonen, die im Arbeitskreis AKITP zusammenarbeiten und die in<br />
Zusammenhang mit Projekten kontaktiert werden können.<br />
- 1 -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2000/2001<br />
[1] Ausgewählte Projekte<br />
ABSCHNITT 1: AUSGEWÄHLTE PROJEKTE, DETAILBESCHREIBUNGEN<br />
Bautechnik – Hochbau<br />
Autobahnraststätte ........................................................................................................................................ 4<br />
Jugendzentrum Bregenz............................................................................................................................... 6<br />
Umbau des Gemeindeamtes und Neubau eines Kulturzentrums .................................................................. 8<br />
Bautechnik – Metall- und Fassadenbau Kolleg<br />
Hofüberdachung Horn ................................................................................................................................ 10<br />
Bautechnik – Tiefbau<br />
Wildbachverbauung Pöttlergraben ............................................................................................................. 12<br />
Wirtschaftlichkeit von energetischen Sanierungen bei Mehrfamilienhäusern ........................................... 14<br />
Betriebsmanagement – Holzwirtschaft<br />
KemFlooring............................................................................................................................................... 16<br />
Biochemie & Gentechnik<br />
Reaktion von Futtermittelkomponenten<br />
bei der Lagerung mit Natriumselenit.......................................................................................................... 18<br />
Elektronik<br />
E-Recruiting für das Amt der Steiermärkischen<br />
Landesregierung - EDV und Organisation ................................................................................................. 20<br />
Funkferngesteuertes Insekt ......................................................................................................................... 22<br />
Fernüberwachung per Funk ........................................................................................................................ 24<br />
System zur Verhaltensforschung zerebral<br />
paretischer Kinder....................................................................................................................................... 26<br />
Elektronik – Telekommunikationstechnik<br />
Mobile Robot.............................................................................................................................................. 28<br />
4-Quadrantennetzteil .................................................................................................................................. 30<br />
Elektronik - Technische Informatik<br />
Variable Getriebesteuerung ........................................................................................................................ 32<br />
Elektrotechnik<br />
Optimierung einer Schneckenfaltmaschine SFM ....................................................................................... 34<br />
Messung der dielektrischen Eigenschaften von Papier............................................................................... 36<br />
Computerarbeitsplatz für einen Körperbehinderten ................................................................................... 38<br />
Dreiphasiger Sperrwandler ......................................................................................................................... 40<br />
Elektrotechnik – Regelungstechnik<br />
Audiodosimeter .......................................................................................................................................... 42<br />
Echtzeit-Bahnberechnung........................................................................................................................... 44<br />
Innenraumgestaltung und Möbelbau<br />
Büroeinrichtung - Ergonomie ..................................................................................................................... 46<br />
Innenraumgestaltung und Holztechnik<br />
Gestaltung eines Kirchenraumes ................................................................................................................ 48<br />
- 2 -
Ingenieur/Technikerprojekte HTL 2000/2001<br />
[1] Ausgewählte Projekte<br />
Maschineningenieurwesen<br />
Tragseilklemmapparat ................................................................................................................................ 50<br />
Move Theresa ............................................................................................................................................. 52<br />
Maschineningenieurwesen - Maschinen- und Anlagentechnik<br />
Einlegen von Schokoladeröllchen in Kunststofftassen............................................................................... 54<br />
Maschineningenieurwesen – Automatisierungstechnik<br />
Bohr – und Nietstation ............................................................................................................................... 56<br />
Montageautomat ......................................................................................................................................... 58<br />
Stanzmaschine für Beschriftungsschilder................................................................................................... 60<br />
Automatische Nietenhärtung ...................................................................................................................... 62<br />
Maschineningenieurwesen – Fertigungstechnik<br />
Photovoltaikanlage ..................................................................................................................................... 64<br />
Maschineningenieurwesen - Maschinen- und Anlagetechnik<br />
Motoroptimierung....................................................................................................................................... 66<br />
Maschineningenieurwesen – Waffentechnik<br />
Lern- und Übungsystem für den waffenkundlichen<br />
Teil der Jägerausbildung............................................................................................................................ 68<br />
Maschineningenieurwesen Berufstätige<br />
2 Komponenten Spritzgusswerkzeug mit Einlegeteilen ............................................................................. 70<br />
Maschineningenieurwesen, Tagesschule<br />
SOLARDUSCHE....................................................................................................................................... 72<br />
Mechatronik<br />
Schwenkarmroboter (SCARA) ................................................................................................................. 74<br />
Zentriervorrichtung für optische Linsen ................................................................................................... 76<br />
Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Optimierung eines Common-Rail-Zahnradförderpumpendeckels.............................................................. 78<br />
WeKoVe Webunterstützte Koordination internationaler Vermarktungspläne........................................... 80<br />
Flächendruckmessung von Langlaufschiern............................................................................................... 82<br />
Wirtschaftsingenieurwesen – Betriebsinformatik<br />
W2MC 2 - Konfiguration mobiler Telefonanlagen...................................................................................... 84<br />
Technikerprojekte<br />
Testmustergenerator - MC-basierend ......................................................................................................... 86<br />
Distanzmessgerät auf Ultraschallbasis ....................................................................................................... 88<br />
Vollautomatische Markisensteuerung ........................................................................................................ 90<br />
Dämpfen von Nadelschnittholz .................................................................................................................. 92<br />
Konfektions- und Verpressvorrichtung ...................................................................................................... 94<br />
EIB- Demokoffer........................................................................................................................................ 96<br />
Stanzwerkzeug Gabelschlüssel................................................................................................................... 98<br />
Vino in Giro.............................................................................................................................................. 100<br />
- 3 -
Schule:<br />
HTBLVA Innsbruck<br />
Trenkwalderstrasse 2<br />
A-6026 Innsbruck<br />
Tel.: 0512/281525<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Autobahnraststätte<br />
Datenblatt<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Bautechnik Hochbau<br />
Jahrgang / Klasse: 5HHa Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: Prof. DI Peter Nocker, Prof. DI Robert Pirschl,<br />
VL DI Dr.techn. Gerhard Müller,<br />
VL DI Johannes Morass, Prof. DI Hartwig Erlacher<br />
Projektteam: Clemens Jäger, Thomas Walser<br />
Partner: Gemeinde Mils bei Imst<br />
Dauer: von 10.09.2001 bis 08.05.2002<br />
Problemstellung:<br />
An der Westautobahn ist im Raum Mils bei Imst ein Rasthaus mit sämtlichen Nebeneinrichtungen und<br />
Tankstelle sowie Shop zu planen. Außerdem ist die verkehrstechnische Erschließung über Autobahn<br />
und Bundesstraße zu erarbeiten. Das Gebäude selbst ist für eine Besucherzahl von 300 zu konzipieren,<br />
wobei das gesamte Areal nach barrierefreiem Standard zu gestalten ist. Ziel ist es, eine den modernen<br />
Anforderungen des Touristischen- und Berufsverkehrs entsprechende Raststätte auszuarbeiten.<br />
Zielsetzung:<br />
Die Anlage soll in organisatorischer und gestalterischer Hinsicht ganz der Erholung nach der langen<br />
Fahrt dienen.<br />
Die architektonische Leistung besteht in der Schaffung von Raumfolgen, welche die Atmosphäre der<br />
Entspannung bieten. Die in diesem Zusammenhang oft angebotene Pseudo-Regionalität und ländliche<br />
Romantik ist zu hinterfragen oder besser durch neue, gültigere Zugänge zu besetzen.<br />
Ablauf:<br />
Grundlagenforschung, Bauplatzbesichtigung, Gespräche mit den zuständigen Ämtern in Mils b. Imst<br />
und mit Technikern eines Planungsbüros, die bereits Erfahrung in der Planung mit Raststätten haben,<br />
Einzelentwürfe, Teamentwurf, Einreichungspläne, Modellbau, Detailausarbeitung, Ausführungspläne,<br />
3D-Zeichnung, Präsentation.<br />
Ergebnis:<br />
Durch die intensive Auseinandersetzung der Beteiligten mit der gestellten Aufgabe, der Umsetzung des<br />
angeeigneten Wissens und der guten Zusammenarbeit mit den betreuenden Lehrern war es möglich, ein<br />
gut funktionierendes und ästhetisch ansprechendes Gebäude zu entwickeln.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die Ausarbeitung des Projektes erfolgte so, dass eine Realisierung durchaus möglich wäre. Nur durch<br />
den Zeitmangel war es nicht möglich, alle erforderlichen Planunterlagen für die Praxis zu erarbeiten,<br />
diese Aufgabe könnte aber im Falle einer Umsetzung leicht nachgeholt werden.<br />
- 4-
Schule:<br />
HTBLVA Innsbruck<br />
Trenkwalderstrasse 2<br />
A-6026 Innsbruck<br />
Tel.: 0512/281525<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projekt-Präsentation<br />
Autobahnraststätte<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Bautechnik Hochbau<br />
Jahrgang / Klasse: 5HHa Schuljahr: 2001/2002<br />
Beschreibung des Projektes:<br />
Der Standort der Raststätte befindet sich an der Westautobahn im Bereich Mils bei Imst. Erreichen<br />
kann man das Grundstück entweder über die Autobahn A12 oder die Bundesstraße B171, welche<br />
mittels eines Kreisverkehrs angeschlossen wird. Die erforderliche Umlegung des Radweges erfolgt<br />
so, dass es auch den Radfahrern möglich ist zur Raststätte zu gelangen.<br />
Das Hauptgebäude, in dem 300 Personen Platz finden sollen, weist die Außenmaße von 42,00m x<br />
24,00m und eine Höhe von 4,00m auf. Im Inneren ist die Raststätte in 3 Ebenen mit 40cm<br />
Höhenunterschied gegliedert. Eine weitere Unterteilung des Gastraums wird durch eine massive,<br />
radiale Betonwand erreicht. Diese übernimmt neben ihrer gestalterischen auch eine statische<br />
Funktion für die Decke. Jedoch ein Großteil der Konstruktion hängt lediglich durch Spannseile an 5<br />
über das Dach hinausragende Pylone. Im Norden überragt eine 4,60m hohe Betonwand - welche mit<br />
satiniertem Glas und schwarzen Eternit-Tafeln verkleidet wird - die ebene Dachfläche. Dank einer<br />
Hinterleuchtung strahlen diese Glasverkleidungen in der Nacht ein sanftes weißes Licht in Richtung<br />
Autobahn und verwandeln die Raststätte somit auch nachts in einen gut sichtbaren<br />
Anziehungspunkt. Da den Besuchern die Sicht nach außen, auf die umliegende Natur erhalten<br />
bleiben soll, wurde auf der Ost-, Süd- und Westseite eine vollflächige Glasfassade geplant. An der<br />
Südseite befinden sich 4 voneinander unabhängige Terrassen. Über die beiden mittleren gelangt<br />
man vom Radweg ins Restaurant.<br />
Im Westen und Osten sind jeweils zwei kleinere Baukörper angefügt. In ihnen befinden sich der<br />
Shop, die WC-Anlagen, die Aufenthaltsräume fürs Personal, Büros und die Technikräume. Als<br />
Fassadengestaltung dienen hier horizontale, gebogene schwarze Eternit-Lamellen, die zwar<br />
Ausblick jedoch keinen Einblick gewähren und den angehängten Baukörpern ihre dreidimensional<br />
gebogene Form verleihen.<br />
3D-Ansicht von Nord-West<br />
- 5-
Schule:<br />
HTL Rankweil<br />
Negrellistraße 50<br />
A-6830 Rankweil<br />
Tel. 05522-42190<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Jugendzentrum Bregenz<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Abteilung: Bautechnik -Hochbau<br />
Jahrgang/Klasse: H 5 – Schuljahr 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI Peter MARTIN, DI Paul FRICK,<br />
DI Roland DÜNSER, DI Richard BEREUTER<br />
Projektteam: Daniela KOHLER, Thomas HOPFNER, Simon METZLER<br />
Projektdauer: von September 2001 bis Juni 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Neubau eines Jugendzentrums<br />
Zielsetzung:<br />
Entwurf und Konstruktive Bearbeitung eines Jugendzentrums.<br />
Erhebung des Funktions– und Raumprogramms und Finden einer entsprechenden<br />
Gebäudeform u. Konstruktion.<br />
Ablauf:<br />
Die Schüler erarbeiten gemeinsam einem Entwurf, der in der Folge getrennt<br />
nach statischer, baukonstruktiver und baubetrieblicher<br />
Hinsicht vertieft und ausgearbeitet wurde.<br />
Ergebnis:<br />
Der Projekt ist rechnerisch und planerisch weitgehend ausgearbeitet.<br />
Einreichpläne M1:100, Polierpläne M1:50, Fassadenschnitte M 1:10,<br />
Modell M 1:100<br />
Verwertbarkeit:<br />
Bedingt als Grundlage für einen geplanten Neubau<br />
- 6 -
Schule:<br />
HTL Rankweil<br />
Negrellistraße 50<br />
A-6830 Rankweil<br />
Tel. 05522-42190<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Jugendzentrum Bregenz<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Abteilung:<br />
Hochbau<br />
Jahrgang/Klasse: H 5 – Schuljahr 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI Peter MARTIN, DI Paul FRICK,<br />
DI Roland DÜNSER, DI Richard BEREUTER<br />
Nach eingehenden Untersuchungen der örtliche Voraussetzungen und der differenzierten<br />
funktionalen Erfordernisse wurden zwei zusammenhängende, in den Funktionen jedoch getrennte<br />
Baukörper konzipiert. Für das Jugendzentrum wurde eine vorgefertigte Holzbauweise mit massiver<br />
Ausführung der Querwände und einer gekrümmten, rückseitigen Außenwand gewählt. Der<br />
Veranstaltungssaal für 400 Besucher besteht aus einem rechteckiger Kubus in Stahlbeton und einer<br />
hinterlüfteten Fassade.<br />
Das komplexe Raum- und Funktionsprogramm wird den wechselnden Bedürfnissen der<br />
unterschiedlichen Nutzer gerecht.<br />
Einen wichtigen Teil des Konzepts bildet die Einbindung des Gebäudes in die Topgraphie und die<br />
Einbeziehung des Außenraumes<br />
- 7 -
Schule:<br />
HTBLuVA Wr. Neustadt<br />
Dr.-Eckener-Gasse 2<br />
2700 Wr. Neustadt<br />
Tel. 02622-27871<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
ÖFFENTLICHE BAUVORHABEN DER<br />
GEMEINDE SIGLESS<br />
Jahrgang / Klasse: 5 BH Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): BAUTECHNIK - HOCHBAU<br />
Projektbetreuer: DI Georg Fiska (Entwurf-Baukonstruktion)<br />
DI Eduard Kraus (Stahlbetonbau)<br />
DI Friedrich Tschiedel (Statik, Baubetrieb)<br />
Projektteam: Dora Bognar, Elisa Teufelsbauer, Florian Ehrenhofer,<br />
Christian Glavanits, Peter Pusitz<br />
Projektpartner: Bürgermeister der Gemeinde Sigless<br />
Dauer: Dezember 2001 – Mai 2002<br />
Problemstellung:<br />
Die Anforderungen seitens des Projektpartners, insbesondere hinsichtlich äußerst differenzierter<br />
Planungserfordernisse (Zu – Umbau - und Neubauplanung) verlangten die Beiziehung einer großen<br />
Bearbeitergruppe.<br />
Zielsetzung:<br />
Neben den formal und technisch hohen Ansprüchen wünschte der Projektpartner das Resultat der<br />
Planungsaufgabe in Ausführungsqualität behördenreifer Einreichpläne. Aus pädagogischen und<br />
verständlicherweise haftungsrechtlichen Gründen entschloss sich die Projektbetreuung, lediglich<br />
hochwertige Entwurfspläne herstellen zu lassen. Darüber hinaus wurden während der gesamten<br />
Projektabwicklung keinerlei Plan- und Demonstrationsunterlagen der Gemeinde übergeben.<br />
Ablauf:<br />
Nach Vermessungs- und Bauaufnahmearbeiten wurden den Teammitgliedern einzelne<br />
Schwerpunktsbereiche und Entwurfsaufgaben zugeteilt. So waren für die drei Hauptbereiche sowie<br />
für Statik und Realisierungsmöglichkeiten jeweils eigene Verantwortliche koordiniert. Im Verlaufe<br />
der Arbeiten wurde rechtzeitig facheinschlägige Einflussnahme wahrgenommen, wonach zu den<br />
Planlösungen Berechnungen, Ausführungsdetails und Ausschreibungen für das Baumeistergewerk<br />
koordiniert wurden. Ein detailliertes Modell über die drei Aufgaben wurde hergestellt.<br />
Ergebnis:<br />
Das Team hat einheitlich gute Arbeit geleistet und während der gesamten Zeit technisch große<br />
Reife bewiesen.<br />
Verwertbarkeit:<br />
In Fortführung der geleisteten Entwurfsarbeiten, technischen Berechnungen und Beschreibungen<br />
wäre eine weitere Bearbeitung und Realisierung durchaus denkbar, doch ist, im schulischen<br />
Zusammenhang gesehen wie auch schon im Kapitel Zielsetzung angeschnitten, das Thema Planung<br />
und Ausführung eines Projekt für einen Auftraggeber befugnis – haftungs – und gebührenmäßig<br />
mehr als ungeklärt.<br />
- 8 -
Schule:<br />
HTBLuVA Wr. Neustadt<br />
Dr.-Eckener-Gasse 2<br />
2700 Wr. Neustadt<br />
Tel. 02622-27871<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
ÖFFENTLICHE BAUVORHABEN DER<br />
GEMEINDE SIGLESS<br />
Das Projekt umfasst drei Planungsaufgaben:<br />
1) Das Gemeindeamt bleibt im Kern bestehen, wird jedoch den Wünschen von Bürgermeister<br />
und Gemeinderat entsprechend umgeplant und aufgestockt. Im Dachgeschoss werden<br />
Wohnungen geschaffen. Die vorhandene Gebäudefassade wird neu gestaltet.<br />
2) Die Einrichtung eines Kindergartens ist auf dem Grundstück neben dem Gemeindeamt<br />
vorgesehen, auf welchem bereits jetzt ein Kinderspielplatz vorhanden ist. Mit zentralem,<br />
kreisförmigen Grundrisskonzept und gestaffelten Dachsegmenten fügt sich das freistehende<br />
Bauwerk gut in das örtliche Erscheinungsbild ein.<br />
3) Eine multifunktionelle Halle, das Kulturhaus, unmittelbar neben dem Sportplatz gelegen,<br />
wurde aus Gründen des Ortsbildschutzes großteils unter die Erde gelegt. Ober Terrain sind<br />
lediglich begrünte Dachflächen sowie die großzügigen Bogenträger in Holzleimbauweise<br />
mit grüner Profilblechbedachung wahrzunehmen.<br />
- 9 -
Schule:<br />
HTL Krems<br />
Alauntalstr. 29<br />
3500 Krems<br />
02732/83190<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Hofüberdachung Horn<br />
Jahrgang / Klasse: 4 RK Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Kolleg Metall- und Fassadenbau<br />
Projektbetreuer: Prof. Haidl, Prof. Getz<br />
Projektteam: Ulrike Andert, Bernhard Dorn<br />
Projektpartner: Stadt Horn<br />
Dauer: von September 2001 bis September 2002<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Im ehemaligen Piaristenkloster in Horn soll eine transparente Hofüberdachung hergestellt werden.<br />
Der Hof besteht aus einem 3-geschossigen quadratischen Raumgebilde. Das Kloster besitzt keinen<br />
großen Veranstaltungssaal der sich für eine Mehrzwecknutzung eignet. Dieser so entstehende Raum<br />
soll auch für Theaterveranstaltungen und Musikaufführungen geeignet sein.<br />
Zielsetzung:<br />
Ziel soll es sein, eine leichte transparente Konstruktion aus Glas über einen bestehenden<br />
historischen Innenhof zu entwickeln. Die Konstruktion selbst soll möglichst zart ausgebildet sein,<br />
die Eindeckung selbst sollte eine schattenfreie Belichtung des Innenhofes ermöglichen. Dieser<br />
Innenraum sollte auch natürlich be- und entlüftet werden können.<br />
Ablauf:<br />
Es wurde eine Bauaufnahme der Fassaden durchgeführt und planlich dargestellt. Es wurden<br />
mehrere Varianten für die Primärkonstruktion aus Stahl untersucht, wobei besonders auf die große<br />
Spannweite von ca. 16 m Rücksicht genommen wurde. Darüber hinaus wurde die gesamte<br />
Konstruktion mit Hilfe von EDV Programmen statisch durchgerechnet und verschiedene Lastfälle<br />
simuliert. Da es sich um eine harte Klimahülle handelt, wurden auch bauphysikalische<br />
Berechnungen betreffend Kondensatbildung sowie akustischer Nachhallzeiten durchgeführt.<br />
Ergebnis:<br />
Das Ergebnis ist eine zarte Metallprofilkonstruktion, die mit Hilfe von Seilen abgestützt wird. Die<br />
gesamte Konstruktion beruht auf 4 Stützen aus runden schlanken Stahlrohren in einer Länge von ca.<br />
15 m, damit die bestehende Bausubstanz nicht beeinträchtigt werden muss. Die<br />
Überkopfverglasung besteht aus einer VSG-Verglasung, wobei die einzelnen Felder eine Größe von<br />
3,84 m x 1.48 m aufweisen. Diese Glaskonstruktion wird durch Glasschwerter und<br />
Nirostapunkthalter getragen. Die Abdichtung der einzelnen Glasfenstern selbst wird durch eine<br />
spezielle Fugenmasse erreicht. Die natürliche Be- und Entlüftung wird durch Glaslamellen an der<br />
Nord- bzw. Südseite bewerkstelligt. Bei der Berechnung der Nachhallzeit wurde gemäß ÖNORM<br />
B8115 für eine Frequenz von 500 Hertz eine Nachhallzeit von 2,5 Sekunden errechnet. Dies stellt<br />
einen hervorragenden Wert für Räume mit Musik und Sprachdarbietungen dar. Sollte eine andere<br />
Nachhallzeit benötigt werden, so ist es möglich, durch mobile Konstruktionen mit jeweils<br />
differenzierten Absorptionsvermögen zu erreichen. Der Hof selbst wird im Raster von 15 m mit<br />
Anschlüssen für Beleuchtungskörper, Strom und Internet ausgestattet. So ist es möglich, auch<br />
Ausstellungen und andere IT-Darbietungen durchzuführen.<br />
- 10 -
Schule:<br />
HTL Krems<br />
Alauntalstr. 29<br />
3500 Krems<br />
02732/83190<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Hofüberdachung Horn<br />
Jahrgang / Klasse: 4 RK Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Kolleg Metall- und Fassadenbau<br />
Projektbetreuer: Prof. Haidl, Prof. Getz<br />
Verwertbarkeit:<br />
Diese transparente Hochüberdachung im Piaristenkloster Horn dient für die Stadt Horn als<br />
Leitprojekt für eine mögliche transparente Überdachung eines historischen Platzes.<br />
HOFÜBERDACHUNG HORN<br />
BAUZEICHNEN<br />
3. Konstruktion<br />
Schnitt C-C<br />
3. Konstruktion<br />
Schnitt D- D<br />
DIPLOMARBEIT<br />
HOFÜBERDACHUNG HORN<br />
ULRIKE ANDERT<br />
BERNHARD DORN<br />
- 11 -
Schule:<br />
HTL Wien 3 Camillo Sitte<br />
Leberstrasse 4C<br />
A-1030 Wien<br />
Tel.: 01/799 26 31<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Wildbachverbauung Pöttlergraben<br />
Jahrgang / Klasse: 5 HTA Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en):<br />
Tiefbau<br />
Projektbetreuer(o.Titel): Michael SRAMEK<br />
Projektteam:<br />
Vogel, Kovac, Ferscha, Möslinger, Postrihac,<br />
Steiner, Rössler<br />
Projektpartner:<br />
Wildbach und Lawinenverbauung Salzburg,<br />
Hofrat SKOLAUT (WLV)<br />
Dauer: von Sept. 2001 bis Juni 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Der Pöttlergraben ist ein linker Zubringerbach der Salzburger Enns, aus dem Gemeindegebiet Eben<br />
im Pongau in der Nähe von Radstadt. Dieser Wildbach besitzt ein erhebliches Potenzial an<br />
Geschiebe, welches bei starken Niederschlägen die im Schwemmkegelbereich gelegenen<br />
Wohngebiete sowie Wirtschaftsgebäude und die ÖBB-Gleisanlagen der Gemeinde EBEN extrem<br />
gefährdet. Bestehende Verbauungen können ihre Funktion nur noch unzureichend erfüllen,<br />
Vermurungen in der jüngsten Vergangenheit machen eine Verbauung des Pöttlergrabens mittels<br />
Sperrenbauwerken, Hangsicherungen, Drainagen u.ä. dringend erforderlich.<br />
Zielsetzung:<br />
Erarbeiten von Plänen als Grundlage für die Wasserrechtliche Einreichung der<br />
Verbauungsmaßnahmen des Wildbaches Pöttlergraben.<br />
Ablauf:<br />
Die enge Kooperation zwischen dem Klassenteam und der WLV erfüllte die Zielvorstellung nach<br />
praxisnaher, umsetzungsorientierter Lehre und fächerübergreifender Ausbildung. Die individuelle<br />
Betreuung der SchülerInnenteams erfolgte in erster Linie durch das schuleigene Professorenteam. In<br />
wichtigen Sachfragen stand die WLV zur Verfügung. Wöchentliche Jour Fixe -Termine sorgten für<br />
termingerechten und korrekten Projektablauf. Im November 2001 erfolgte eine<br />
Zwischenpräsentation, Ende Februar 2002 wurde das in Teamarbeit entwickelte Generelle Projekt<br />
vorgestellt. Das Detailprojekt wurde im Rahmen von Diplomarbeiten erarbeitet. Den Höhepunkt<br />
bildete die offizielle Projektvorstellung in Salzburg Ende Mai 2002. In Anwesenheit von TV und<br />
Presse präsentierten die SchülerInnen den interessierten Bürgern der Gemeinde Eben und den<br />
Fachleuten der WLV ihre Arbeit. In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden Planungsdetails<br />
hinterfragt und die SchülerInnen mussten die zum Teil kritischen Einwände der Parteien<br />
beantworten. Der Fortschritt des Projektes wurde selbstverständlich auf einer eigenen, von<br />
SchülerInnen aktualisierten Homepage (http://www.come.to/poettlergraben) dem interessierten<br />
Internet-Publikum präsentiert.<br />
Ergebnis:<br />
Die als Zielvorstellung definierte Grundlage zur Wasserrechtlichen<br />
Einreichplanung wurde der WLV zur Verfügung gestellt. Weiters erhielten die SchülerInnen die<br />
Möglichkeit, einen Teil der schriftlichen Klausurarbeit in Form von 16 Diplomarbeiten<br />
abzuwickeln, die Detailfragen des Generellen Projektes behandelten.<br />
- 12 -
Schule:<br />
HTL Wien 3 Camillo Sitte<br />
Leberstrasse 4C<br />
A-1030 Wien<br />
Tel.: 01/799 26 31<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projektpräsentation<br />
Wildbachverbauung Pöttlergraben<br />
Verwertbarkeit: Realisierung der Verbauungsmaßnahmen bis 2005<br />
Seitens der SchülerInnen wurden im Rahmen des Team-<br />
Projektes und der darauf aufbauenden Diplomarbeiten<br />
folgende Arbeiten durchgeführt:<br />
Vermurungen 1999<br />
1. Vermessungsarbeiten<br />
2. Erstellung von Lageplänen, Längs- und<br />
Querschnitten und Detailplänen<br />
3. Geologische u. Bodenmechanische<br />
Untersuchungen<br />
4. Erstellung einer Website<br />
5. Planung von insgesamt 11 Konsolidierungs-<br />
Sperren (Neubau und Sanierung)<br />
6. Planung von 2 Brücken<br />
7. Planung eines Sortierwerkes (Rückhalt von<br />
grobem Material)<br />
8. Planung von Hangsicherungen im Bereich der<br />
Forststraße<br />
9. Planung der Sanierung der bestehende<br />
Forststraße (inklusive Ausweichen u.<br />
Umkehrplätze)<br />
10. Planung der naturnahen Gestaltung des Grabens<br />
im Schwemmkegelbereich<br />
11. Planung eines Trinkwasserbehälters<br />
12. Planung einer Beschneiungsanlage<br />
TV-Interview Mai 2002<br />
Im Rahmen der mündlichen<br />
Maturaprüfung<br />
präsentierten die<br />
SchülerInnen ihre<br />
Diplomarbeit und wurden<br />
mit vertiefenden<br />
Detailfragen konfrontiert.<br />
Das Projekt weckte reges<br />
Medieninteresse und wurde<br />
sowohl in Presse<br />
(Salzburger Nachr.,<br />
Kronenzeitung,<br />
Lokalzeitungen) als auch im<br />
TV präsentiert.<br />
Lageplan Projektierungsmaßnahmen<br />
- 13 -
Schule:<br />
HTL Linz<br />
Goethestraße 17<br />
A-4020 Linz<br />
Tel.: 0732/6626020<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Wirtschaftlichkeit von energetischen<br />
Sanierungen bei Mehrfamilienhäusern<br />
Jahrgang / Klasse: 5TA Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Tiefbau und Bauwirtschaft<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Reinhard Schild<br />
Projektteam: Buchinger Andreas, Pirngruber Markus und Wolfsteiner Michael<br />
Projektpartner: Amt der O.Ö. Landesregierung, Mag. Dipl.-Ing. Robert Kernöcker<br />
Dauer: von September 2001 bis Juni 2002<br />
Problemstellung:<br />
Zahlreiche Gebäude in Oberösterreich verbrauchen, gemessen am heutigen Wärmeschutzniveau,<br />
zuviel Energie für die Raumheizung. Dabei wäre gerade die energetische Sanierung dieser<br />
Altbauten ein wichtiger Motor für die Bauwirtschaft und den Klimaschutz.<br />
Wirtschaft und Klimaschutz schließen einander nicht aus – dies sollte anhand von konkreten<br />
Sanierungsprojekten belegt werden.<br />
Die Studie sollte eine Argumentationshilfe für zukünftige Entscheidungen sein, dass Investitionen<br />
in energetische Sanierungen von Gebäuden „sich rechnen“ und auch positive Auswirkungen auf die<br />
Umwelt haben.<br />
Ablauf und Zielsetzung:<br />
Insgesamt wurden aus den derzeit in Oberösterreich sanierten Gebäuden 9 Objekte ausgewählt.<br />
Voraussetzung für die Auswahl der Objekte war, dass Heizkostenabrechungen sowohl vor, als auch<br />
nach der Sanierung vorlagen. Dies setzte einerseits eine zentrale Heizanlage und andererseits<br />
zumindest die Daten einer Heizperiode nach der Sanierung voraus.<br />
Folgende Kenngrößen wurden vor und nach der Sanierung ermittelt:<br />
- Jährlicher Energieverbrauch;<br />
- Rechnerischer Heizwärmebedarf; Berechnung gemäß OÖ. BTV bzw. ÖNORM B8110-1<br />
- Bestimmung eines Systemfaktors (Einfluss des Bewohnerverhaltens und der Heizung)<br />
Berücksichtigung der Klimadaten der letzten Jahre und Klimabereinigung der Berechnungen<br />
Bestimmung der Energieeinsparung (in kWh und € bzw. ATS)<br />
Bestimmung der Wirtschaftlichkeit - Amortisationszeiten der Investitionen<br />
- Gesamte Investitionskosten – Energierelevante Energiekosten<br />
- Amortisationsberechnung – statische und dynamische Amortisationszeiten<br />
Berechnung der Amortisationszeiten bei Erhöhung der Dämmstoffstärken<br />
Ergebnis und Verwertbarkeit:<br />
Die Ergebnisse der Studie wurden in einer Broschüre „Energieschlau sanieren“ veröffentlicht, die<br />
am Amt der Oberösterreichischen Landesregierung – Abteilung Lärm und Strahlenschutz erhältlich<br />
ist. Weiters wurde die gut besuchte Fachtagung „Energieschlau sanieren“ mit<br />
Wohnungsgenossenschaften, Bauträgern, Bauämtern, Baufirmen, usw. abgehalten, worin auch die<br />
Ergebnisse der Studie präsentiert und diskutiert wurden.<br />
- 14 -
Schule:<br />
HTL Linz<br />
Goethestraße 17<br />
A-4020 Linz<br />
Tel.: 0732/6626020<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Wirtschaftlichkeit von energetischen<br />
Sanierungen bei Mehrfamilienhäusern<br />
Realisierte Projekte<br />
In der energetischen Sanierung von Wohngebäuden liegt<br />
ein beträchtliches Energie-Einsparpotenzial. Von<br />
entscheidender Bedeutung für den Investor ist allerdings<br />
die Frage, ob die rechnerisch prognostizierten<br />
Einsparungen auch tatsächlich in der Praxis erreicht<br />
werden.<br />
Dieser Frage ist die HTL1 - Bau und Design in einem<br />
gemeinsamen Projekt mit dem Land Oberösterreich –<br />
Abteilung Lärm- und Strahlenschutz nachgegangen und<br />
hat neun Sanierungsobjekte aus dem Bereich<br />
Mehrfamilien-Wohnhäuser energetisch unter die Lupe<br />
genommen. Dabei wurden die tatsächlich erzielten<br />
Energieeinsparungen ermittelt, diese den rechnerischen<br />
Einsparungen gegenübergestellt und auf Basis der<br />
gewonnenen Daten eine Wirtschaftlichkeitsanalyse<br />
durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse bestätigen, dass sich energetische<br />
„Rundum“-Sanierungen von Mehrfamilien-Wohnhäusern<br />
unter der Vorraussetzung, dass die für die Instandhaltung<br />
ohnehin erforderlichen Investitionskosten (sogenannte "Sowieso-Kosten") nicht in Rechnung<br />
gestellt werden, bereits innerhalb von 8-20 Jahren amortisieren. Sowieso-Kosten sind z.B. Kosten<br />
für Gerüste und Verputzarbeiten, wenn die alte Fassade ohnehin renoviert werden müsste, und bei<br />
Anlagegütern, wie z.B. Heizungskessel, der um den Restwert verminderte Investitionsbetrag.<br />
Umfassende energetische Sanierungen sparen also nicht nur Energie, sondern leisten auch einen<br />
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und bringen bares Geld für die Bewohner in Form von<br />
niedrigeren Betriebskosten.<br />
Die Studie zeigt auch auf, dass die potenziellen Möglichkeiten derzeit nicht voll ausgeschöpft<br />
werden. Größere Dämmstärken bei der Außenfassade würden durch die höhere Energieeinsparung<br />
auch wirtschaftlicher sein.<br />
- 15 -
Schule:<br />
HTL Holztechnikum Kuchl<br />
Markt 136<br />
A-5431 Kuchl<br />
Tel.: 06244/5372-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
KemFlooring<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: Va Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilungen: Betriebsmanagement - Holzwirtschaft<br />
Projektbetreuer: DI Erwin Treml, Mag. Josef Essl, DI Herbert Haslinger<br />
Projektteam: Roland Walkner, Erich Kemptner, Peter Quehenberger<br />
Projektpartner: Säge- und Hobelwerk Alfred Kemptner, Grieskirchen<br />
Dauer: von 01.09.01 bis 17.05.02<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Die angespannte Ertragslage in der Sägeindustrie erfordert die Suche nach neuen<br />
Absatzmöglichkeiten für bestehende Produkte und die Entwicklung neuer Produkte für die<br />
Erschließung neuer Märkte.<br />
Das Sägewerk Kemptner stand vor dem Problem, dass eine sinkende Nachfrage nach sogenannten<br />
„Fensterkantel“ den kostendeckenden Absatz von schlechteren Qualitäten unmöglich machte.<br />
Zielsetzung:<br />
Ziel war es ein neues Produkt auf neuer technologischer Basis am österreichischen Markt zu<br />
etablieren. Vorangehend mussten der Absatzmarkt erforscht, die technologischen Daten ermittelt<br />
und eine geeignete Produktionsanlage konstruiert werden. Das Produkt sollte fertig entwickelt und<br />
kalkuliert werden, sodass es gebrauchsfertig in den Handel gebracht werden kann.<br />
Methodik:<br />
Die Autoren gliederten das Gesamtprojekt in drei Teilbereiche:<br />
1. Konstruktion einer geeigneten Produktionsanlage<br />
2. Produktentwicklung und technologische Untersuchungen<br />
3. Produktkalkulation, Absatzmarktforschung und Entwicklung eines Marketingkonzeptes<br />
Ergebnisse:<br />
Die Realisierung einer geeigneten Produktionsanlage erfolgte nicht eigenständig, sondern es wurde<br />
ein geeigneter Anbieter gefunden, der eine Anlage nach Entwürfen des Projektteams herstellt.<br />
Das Produkt wurde am Holztechnikum Kuchl hinsichtlich der technologischen Eigenschaften<br />
untersucht. Dabei zeigte sich, dass das Hauptproblem die zugekaufte Fugenmasse darstellte. Diese<br />
löste sich bedingt durch die Quell- und Schwindvorgänge im Außenbereich ab und führte zu<br />
Schäden an der Konstruktion. An weiteren Versuchen zur Erlangung der Marktreife wird zur Zeit<br />
gearbeitet.<br />
Die Kalkulation des Produktes ergab, dass dieses in einem höherpreisigen Marktsegment<br />
positioniert werden muss. Als mögliche Vertriebsschienen wurden die Holzfachmärkte und der<br />
Direktverkauf an Entscheidungsträger in der Baubranche ins Auge gefasst.<br />
Das Projektteam entwickelte einen geeigneten Namen für das Produkt und erstellte eine<br />
Präsentation, die für Verkaufsveranstaltungen herangezogen werden soll.<br />
- 16 -
Schule:<br />
HTL Holztechnikum Kuchl<br />
Markt 136<br />
A-5431 Kuchl<br />
Tel.: 06244/5372-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
KemFlooring<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: Va Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilungen: Betriebsmanagement - Holzwirtschaft<br />
Projektbetreuer: DI Erwin Treml, Mag. Josef Essl, DI Herbert Haslinger<br />
Projektpräsentation<br />
Verwertbarkeit:<br />
Derzeit werden laufende Untersuchungen an den Versuchsflächen durchgeführt. Nach Erlangung<br />
der Marktreife soll der Boden in Serie produziert und am österreichischen und internationalen<br />
Markt abgesetzt werden.<br />
Produktbeschreibung<br />
ü 16 Stirnholzquader verklebt auf Gewebematten (Mattengröße 30 x 30 cm)<br />
ü Fugen zwischen den geklebten Quadern ca. 4 mm<br />
ü Verwendete Holzarten: Eiche, Robinie, Lärche<br />
Besondere Eigenschaften<br />
ü Neuentwickelte Verlegeart mit Mattensystem<br />
ü Härte doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Parkettböden durch stehende Jahrringe, 25 –<br />
50 mm starke Nutzschicht<br />
ü Angenehme Oberflächentemperatur<br />
Bild:<br />
Probeverlegung<br />
des neu<br />
entwickelten<br />
Bodens im<br />
Außenbereich<br />
- 17 -
Schule:<br />
HBLVA für chemische Industrie<br />
Rosensteingasse 79<br />
A-1170 Wien<br />
Tel.: 01/486 14 80<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Reaktion von Futtermittelkomponenten<br />
bei der Lagerung mit Natriumselenit<br />
Jahrgang / Klasse: 4FB Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Biochemie & Gentechnik<br />
Projektbetreuer: Prof.Dipl.Ing.Dr.techn. Rudolf Doiber<br />
Projektteam: Martin Dengler, Robert Koiner<br />
Projektpartner: Bundesamt und Forschungsanstalt für Landwirtschaft<br />
Dauer: von Sept. 01 bis April 02<br />
Problemstellung:<br />
Selenverbindungen werden Futtermitteln zugesetzt, da dieses Element neben anderen als<br />
essentielles Spurenelement für große Tiere notwendig ist. Außerdem wirkt Selen als Bestandteil des<br />
Enzyms Glutathionperoxidase antioxidativ und liegt darüber hinaus in der für den Stoffwechsel<br />
wichtigen Aminosäure Selenocystein vor.<br />
Der natürliche Se – Gehalt tierischer und pflanzlicher Futtermittel ist jedoch oft unzureichend, da<br />
das Element nicht ausreichend freigesetzt wird. Die Resorption im Verdauungstrakt, die biologische<br />
Halbwertszeit, der Transfer vom Boden in die Pflanze, sowie die Mobilität im Boden werden<br />
besonders beim Selen wesentlich durch die Form des Vorkommens bestimmt. Deshalb werden den<br />
Futtermitteln Mischfutterzusätze, meist in Form von Na – Selenit (Na 2 SeO 3 ), selten als Na – Selenat<br />
(Na 2 SeO 4 ) zugesetzt. Dabei gibt es einen gesetzlichen zulässigen Höchstgehalt von 0,5 mg Se/kg<br />
Alleinfutter.<br />
Es sollte geprüft werden, inwieweit sich diese Verbindungen bei der Lagerung verändern und ob die<br />
entstehenden Produkte noch resorbierbar sind. Die eventuell entstandenen Spaltprodukte sollten<br />
quantifiziert werden. Außerdem sollte im Rahmen der Arbeit eine HPLC-ICP-Kopplung aufgebaut,<br />
in Betrieb genommen und im Routinebetrieb getestet werden.<br />
Zielsetzung:<br />
Extraktion der Selen-Verbindungen mit unterschiedlichen Puffersystemen und Aufarbeitung der<br />
Rohextrakte. Nach der Isolation der Analyten sollten diese mittels HPLC-ICP-Kopplung gemessen<br />
und die Konzentration der Einzelspecies ermittelt werden. Parallel dazu wurde mittels Hydrid-AAS<br />
der Gesamtselengehalt nach Aufschluss der Futtermittel bestimmt.<br />
Bei kommerziell erhältlichen Futtermittel-Mischungen wurde im Rahmen eines vorhergehenden<br />
Projekts festgestellt, daß zugesetztes lösliches Natriumselenit nur zu 15-50 % in Extrakten von<br />
Wasser oder schwach sauren Puffern wiedergefunden wurde.<br />
Das den Futtermitteln zugesetzte Natriumselenit könnte beim Mischen der Futtermittel oder bei<br />
deren Lagerung chemische Reaktionen zu weniger verfügbaren Formen (z.B. elementares Selen)<br />
eingehen, und dadurch eine geringere Aufnahmerate im Darm erzielen. Weiters könnte beim<br />
Anfeuchten der Futtermittel eine Metabolisierung durch Mikroorganismen zu organischen<br />
Selenverbindungen stattfinden.<br />
- 18 -
Schule:<br />
HBLVA für chemische Industrie<br />
Rosensteingasse 79<br />
A-1170 Wien<br />
Tel.: 01/486 14 80<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Reaktion von Futtermittelkomponenten<br />
bei der Lagerung mit Natriumselenit<br />
Die Methode der HPLC – Trennung an einer Anionenaustauschersäule wurde in Citratpuffer bereits<br />
erfolgreich durchgeführt. Den Gegebenheiten vor Ort gemäß soll das ICP-MS durch ein ICP-OES<br />
ersetzt werden, und der optimale Puffer als Laufmittel hinsichtlich des Untergrundrauschens,<br />
Signalempfindlichkeit und der Trennwirkung gefunden werden. Die Nachweisstärke des optischen<br />
ICP ist zwar geringer, es bietet aber den Vorteil, dass sämtliche Verbindungen die gleiche<br />
Empfindlichkeit haben, was bei der ICP-MS nicht der Fall ist.<br />
Ablauf:<br />
Zuerst wurde die HPLC-Anlage aufgebaut, mit der OES-ICP gekoppelt und getestet. Reinstandards<br />
wurden aus Natriumselenat, Natriumselenit, Seleno-DL-Methionin und Seleno-DL-Cystin bereitet<br />
und zur Ermittlung der Retentionszeiten herangezogen.<br />
Nach der Herstellung dieser Standards und Optimierung der Laufmittelparameter wurde mit den<br />
eigentlichen Messungen begonnen. Außerdem wurden die Gasflüsse der ICP hinsichtlich eines<br />
Optimums zwischen maximaler Empfindlichkeit und Untergrundrauschen optimiert.<br />
Die für die Bestimmung des Gesamt-Selen-Gehaltes vorgesehene AAS-Methode wurde hinsichtlich<br />
ihrer Nachweisgrenze und Linearität überprüft.<br />
Danach erfolgten die Aufschlüsse der Futtermittel, welche vom Bundesamt und Forschungszentrum<br />
für Landwirtschaft, Wien, stammten. Diese wurden fein vermahlen, um ein quantitatives<br />
Herauslösen der Selenverbindungen zu gewährleisten. Es wurden Futtermittel, welche seit Juli 1998<br />
in einem Reinraum gelagert wurden, zur Bestimmung herangezogen.<br />
Es wurden verschiedene Puffergemische zur Extraktion der Se-Verbindungen verwendet. Die<br />
Futtermittel wurden in der jeweiligen Lösung 2 Stunden lang bei 200 Umdrehungen pro Minute am<br />
Schüttler extrahiert. Die Lösungen wurden 20 Minuten bei 5500 Umdrehungen pro Minute<br />
zentrifugiert, dekantiert und durch einen Rotbandfilter filtriert. Die erhaltenen Extrakte wurden für<br />
die HPLC-Analyse weiterverwendet.<br />
Ergebnis:<br />
Die Untersuchung ergab, dass zugesetztes Na – Selenit in gelöster Form, also in den Extrakten,<br />
nach längerem Lagerungszeiten nicht beständig ist und sich zu organischen sowie anorganischen<br />
Selenverbindungen abbaut.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Es wurde eine komplette Ionenchromatographie-HPLC aufgebaut und mit einer bestehenden OES-<br />
ICP gekoppelt. Die dabei erworbenen Kenntnisse hinsichtlich moderner apparativer Analytik und<br />
selbständiger Arbeitsweise stellen eine hochwertige Zusatzqualifikation dar.<br />
- 19 -
Schule:<br />
HTBLA - Kaindorf<br />
Grazerstrasse 202<br />
8430 Kaindorf/Sulm<br />
Tel.: 03452/74100-12<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Problemstellung/Zielsetzung:<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Die Zielsetzung bestand darin, den derzeitigen Bewerbungsablauf im Amt der Steiermärkischen<br />
Landesregierung zu analysieren. In weiterer Folge sollte ein effizienterer Weg der<br />
Bewerbungsabwicklung gefunden werden.<br />
Nach der Analyse und Bewertung verschiedener Lösungsansätze sollte ein Prototyp für ein E-<br />
Recruiting System (Online-Bewerbung) erstellt werden, wobei die Anbindung an den HR - Modul<br />
von SAP gewährleistet sein soll.<br />
Ablauf:<br />
E-Recruiting für das Amt der<br />
Steiermärkischen Landesregierung<br />
Abteilung: EDV und Organisation<br />
Jahrgang / Klasse: 5ADH Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: Mag. Günter Volleritsch<br />
Projektteam: Georg Pressler, Christian Reinbacher, Michael Schrotter,<br />
Andreas Töscher<br />
Projektpartner: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, DI Karl Wagner<br />
Dauer: von 02.07.2001 bis 11.05.2002<br />
Zur Anwendung kamm ein Phasenkonzept, das im wesentlichen aus folgenden Teilen bestand:<br />
- Planung<br />
- Analysen<br />
- Entwicklung Prozessablauf neu<br />
- Programmentwicklung<br />
Die Projektgruppe hat den Bewerbungsprozess im Amt der Steiermärkischen Landesregierung<br />
analysiert und in weiterer Folge einen vereinfachten Prozessablauf entworfen.<br />
Des Weiteren sind verschiedenste Realisierungsmöglichkeiten für die Online-Bewerbung in<br />
Betracht gezogen worden. Diese wurden analysiert und mittels einer Nutzwertanalyse bewertet und<br />
verglichen, wobei Vertreter des Amtes stark eingebunden waren.<br />
Zum Abschluss hat die Projektgruppe einen Prototypen erstellt, der sowohl eine Online-Bewerbung<br />
abwickeln kann und die Daten ins lokale System transferiert, als auch dem Mitarbeiter der<br />
Personalverwaltung die Möglichkeit gibt, mit Hilfe eines Administrations-Tools die Daten zu<br />
verwalten und weiterzuverarbeiten.<br />
- 20 -
Schule:<br />
HTBLA - Kaindorf<br />
Grazerstrasse 202<br />
8430 Kaindorf/Sulm<br />
Tel.: 03452/74100-12<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
E-Recruiting für das Amt der<br />
Steiermärkischen Landesregierung<br />
Abteilung: EDV und Organisation<br />
Jahrgang / Klasse: 5ADH Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: Mag. Günter Volleritsch<br />
Ergebnis:<br />
- Vollständige Analyse des Ist-Zustands des Bewerbungsablaufes<br />
- Lösungsansatz für die Programmentwicklung (Entscheidung nach Variantenanalyse und<br />
Nutzwertanalyse)<br />
- Abbildung eines neuen, effizienteren Bewerbungsablaufes<br />
- Prototyp, der sowohl eine Online-Bewerbung abwickeln kann und die Daten ins lokale<br />
System transferiert, als auch dem Mitarbeiter der Personalverwaltung die Möglichkeit gibt,<br />
mit Hilfe eines Administrations-Tools die Daten zu verwalten und weiterzuverarbeiten. Die<br />
Anbindung an den HR - Modul von SAP R/3 erfolgt online. Es wurden die Werkzeuge<br />
Apache, MySQL und PHP zur Erstellung und Implementierung des Prototyps verwendet.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung kann die Ergebnisse der einzelnen Analysen für die<br />
Umsetzung einer effizienteren Bewerberabwicklung bzw. elektronischen Abwicklung heranziehen.<br />
Der Prototyp kann eingesetzt bzw weiterentwickelt werden, oder aber einfach als Grundlage zur<br />
Entwicklung eines neuen Online-Bewerbungssystems dienen.<br />
- 21 -
Schule:<br />
HTL-Innsbruck<br />
Anichstraße 26-28<br />
6020 Innsbruck<br />
Tel.: 0512-59717<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Problemstellung:<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Entwicklung, Bau und Programmierung eines funkferngesteuerten Roboters mit<br />
microcontrollergesteuerten Stellmotoren und Sensoren zur Objekterkennung für sicheres Umgehen<br />
von Hindernissen:<br />
Mittels eines Microcontrollers sollen die von einem Funkempfänger ausgegebenen Signale,<br />
basierend auf Impulslänge, auf die Signale der vier Servomotoren umgerechnet werden, sodass die<br />
sechs Füße des Roboters so bewegt werden, dass er wie ein Modellauto gelenkt werden kann.<br />
Des weiteren soll in einer zweiten Betriebsart der Roboter sich selbst vorwärts bewegen und dabei<br />
Hindernissen ausweichen wie auch Kanten umfahren können.<br />
Zielsetzung:<br />
Entwicklung eines funktionstüchtigen, funkferngesteuerten Roboters, der mittels Microcontroller<br />
gesteuert wird und über eine handelsübliche 40 MHz-PPM-Fernsteuerung bedient werden kann.<br />
Ablauf:<br />
Das Projekt wurde in mehrere Aufgabenbereiche unterteilt:<br />
Ergebnis:<br />
· Planen und entwickeln der Mechanik für die Fortbewegung<br />
· Planen und entwickeln der elektronischen Komponenten<br />
· Softwareentwicklung zur Umrechnung der Steuerbefehle<br />
· Softwareentwicklung für eine Autopilotfunktion<br />
Fuktionsfähiger Prototyp<br />
Verwertbarkeit:<br />
Als FTKL-Demonstrationsobjekt.<br />
Funkferngesteuertes Insekt<br />
Jahrgang / Klasse: HN5A Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Elektronik<br />
Projektbetreuer: DI Kurt Höck<br />
Projektteam: Paul Sohm, Bernhard Staudt, Elmar Würtenberger<br />
Projektpartner: Innovationsagentur<br />
Dauer: von 07/2001 bis 05/2002<br />
- 22 -
Schule:<br />
HTL-Innsbruck<br />
Anichstraße 26-28<br />
6020 Innsbruck<br />
Tel.: 0512-59717<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Funkferngesteuertes Insekt<br />
Projektpräsentation<br />
Kurzbeschreibung der Problemlösung:<br />
Es wurde eine dem Gehverhalten eines Insekts nachempfundene Mechanik mit 6 Beinen<br />
entwickelt, die von einem Microcontroller über Fernsteuerservos angelenkt werden. Mit einer<br />
speziell dazu entwickelten Software werden die empfangenen analogen Steuerkommandos der<br />
Funkfernsteuerung so umgerechnet, dass eine effiziente Fortbewegung des Insekts ermöglicht wird.<br />
Über Ultraschallsensoren wird ein Hindernis erkannt und eine entsprechende Ausweichbewegung<br />
eingeleitet.<br />
Ein funktionstauglicher Prototyp mit den Abmessungen 230x200x100 mm wurde realisiert und<br />
steht als Messplattform, z. B. für Remote Sensing, zur Verfügung.<br />
- 23 -
Schule:<br />
HTL Leonding<br />
Limesstr. 12 - 14<br />
4060 Leonding<br />
Tel. 0732/673368<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Problemstellung:<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Es ist ein Gerät zu entwickeln, das den Füllstand eines Wasserbeckens zur Viehtränke auf einer<br />
schwer zugänglichen Alm elektronisch überwacht und bei Unterschreitung eines Minimalpegels<br />
Alarm auf einem 3 km entfernt gelegenen Bauernhof auslöst. Es besteht keine Sichtverbindung<br />
zwischen der Alm am Herndleck ( Ternberg ) und dem Bauernhof. Die Übertragung soll per Funk<br />
mittels handelsüblicher PMR-Geräte im Frequenzband 446 MHz. und im DTMF-Code erfolgen.<br />
Das System soll billig, wartungs- und lizenzfrei sein. Die Anlage muß autark sein, die Störungen im<br />
Gebirge, der Blitzschutz und die EMV-Richtlinien sind zu beachten.<br />
Zielsetzung:<br />
Es ist ein vollständiges System zu entwickeln und aufzubauen, das es dem Bauer ermöglicht, nur<br />
mehr bei Störfällen .auf die Alm fahren zu müssen und dort rechtzeitig einzutreffen.<br />
Die Installation muß wartungsfrei sein und außerdem manipulations- und zerstörungsfest. Weder<br />
das Gerät, noch Mensch oder Tier dürfen durch die hohe Energie bei Gewitter zu Schaden kommen.<br />
Ablauf:<br />
Jede Baugruppe wurde neu entwickelt, wobei möglichst auf handelsübliche Module zurückgegriffen<br />
wurde. Die Funkstrecke wurde nach Empfangsmessungen vor Ort geplant.<br />
Das System wurde zunächst am HTL-Gelände erprobt und dann in der Realisierungsphase<br />
mehrmals vor Ort ausprobiert, die Übertragung gemessen, die Funktionen getestet und anschließend<br />
angepaßt. Das System wurde dann übergeben.<br />
Ergebnis:<br />
Das System ist fertiggestellt und konnte dem Bauer übergeben werden. Es hat den Probebetrieb ab<br />
Mai 2002 aufgenommen. Bisher arbeitet das System zur Zufriedenheit des Kunden.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Fernüberwachung per Funk<br />
Jahrgang / Klasse: 5BHE Schuljahr:2001/2002<br />
Abteilung(en): Elektronik-Telekommunikation<br />
Projektbetreuer: Prof. DI Peter Auer<br />
Projektteam: Thomas Zinnöcker, Christian Wakolbinger, Georg Berger<br />
Projektpartner: Florian Mayer, Landwirt in Trattenbach<br />
Dauer: von Sept. 2001 bis Mai 2002<br />
Wir erhoffen uns weitere Kunden mit ähnlichen Aufgaben. In diesem Falle wird dann eine<br />
Verwertungsfirma, die das System in Serie baut und am Markt anbietet, gesucht.<br />
- 24 -
Schule:<br />
HTL Leonding<br />
Limesstr. 12 - 14<br />
4060 Leonding<br />
Tel. 0732/673368<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Fernüberwachung per Funk<br />
Projektpräsentation<br />
Blockschaltbild<br />
- 25 -
Schule:<br />
HTBL Klagenfurt<br />
Mössingerstraße 25<br />
A-9020 Klagenfurt<br />
Tel.: 0463 / 37 9 78-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte Datenblatt<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
System zur Verhaltenserforschung zerebral<br />
paretischer Kinder<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Elektronik<br />
Jahrgang / Klasse: 5BHT Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI. Harald Grünanger<br />
Projektteam: Mario Bellina, Christian Huber<br />
Projektpartner: Sonderschule für Schwerstbehinderte, Waidmannsdorf/Klagenfurt<br />
Dauer: von September 2001 bis Juni 2002<br />
Problemstellung:<br />
Zielsetzung:<br />
Ablauf:<br />
Ergebnis:<br />
Eines der größten Probleme schwerstbehinderter Kinder ist jenes, dass sie sich<br />
nicht mit ihrer Umwelt verständigen können. Dies bedeutet, dass deren<br />
Betreuer bzw. Eltern raten müssen, welche Bedürfnisse ihre Schützlinge haben.<br />
Nachdem man sehr wohl annimmt, dass diese Kinder bei vollem, geistigem<br />
Bewusstsein sind, kann man sich leicht vorstellen was es bedeutet, seine<br />
Bedürfnisse nicht mitteilen zu können. Ein Kind hat solange Hunger oder<br />
einem Kind ist solange heiß / kalt, bis dies jemand vermutet.<br />
Das Projekt soll der Erarbeitung zuverlässiger Zuordnungen von Intentionen<br />
und muskulären Bewegungen zerebral paretischer Kinder dienen. Die<br />
Stimulation erfolgt über Video- und Audiodaten, die individuell an die Kinder<br />
angepasst werden. Die Eingabe des Kindes erfolgt über einen Joystick. Es<br />
werden sämtliche Eingaben in einer Datenbank festgehalten, um daraus Rückschlüsse<br />
auf etwaige Verhaltensmuster tätigen zu können.<br />
Die Ausarbeitung des Projektes erfolgte im Teamwork. Dabei wurde durch<br />
ständigen Kontakt mit den Erziehern der Sonderschule deren Erfahrung in die<br />
Produktentwicklung miteinbezogen.<br />
Das Projekt ist seit Frühjahr 2002 in der Sonderschule im praktischen Einsatz.<br />
Auszeichnungen:<br />
4.Preis Jugend Innovativ, Einladung zur Young Scientists Congress nach Prag,<br />
Kärntner des Tages (Kleine Zeitung), Science Week in Villach<br />
Verwertbarkeit:<br />
Nicht nur in der Verhaltenserforschung von Schwerstbehinderten sondern auch<br />
in der Erforschung von Komapatienten.<br />
- 26 -
Schule:<br />
HTBL Klagenfurt<br />
Mössingerstraße 25<br />
A-9020 Klagenfurt<br />
Tel.: 0463 / 37 9 78-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projekt-Präsentation<br />
System zur Verhaltenserforschung zerebral paretischer Kinder<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Elektronik<br />
Jahrgang / Klasse: 5BHT Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI. Harald Grünanger<br />
Mittels eines Login Dialoges können sich der Betreuer und das Kind am System anmelden. Dies<br />
dient sowohl dem Zugriff auf die individuellen Daten jedes Kindes (spezielle Bilder, Töne, Lieder,<br />
Notfalldaten etc.) als auch der korrekten Datenerfassung für die Arbeitseinheiten.<br />
Ein sogenanntes Sitzungsmodul stellt die eigentliche Verhaltenserforschung der Kinder dar. Dabei<br />
kann man die vier Bewegungsrichtungen (Oben, Unten, Rechts und Links) mit unterschiedlichen<br />
Farben, Bildern oder Tönen (Liedern) belegen. Mit dem Joystick kann das Kind nun die von ihm<br />
gewünschte Richtung auswählen. Das sich in der Auswahlrichtung befindliche Objekt wird auf ein<br />
Vollbild aufgezoomt bzw. auf die Lautsprecher ausgegeben. Nach einer bestimmten, einstellbaren<br />
Zeit wird das System wieder in die Grundeinstellung zurückgeführt.<br />
Abb.1<br />
Abb.2<br />
Mit der speziellen Auswertesoftware kann man den Sitzungsverlauf (Abb.1) als auch die Häufigkeit<br />
der angewählten Richtungen (Abb.2) analysieren.<br />
Ob nun eine bestimmte Vorzugsrichtung vorliegt oder es nur spastische Zuckungen in diese<br />
Richtung gibt, kann man testen, in dem man die Zuordnungen zu den Richtungen ändert und das<br />
Ergebnis erneut bewertet.<br />
Folgt das Kind mit einem erhöhten Prozentsatz einem Reiz (Bild, Ton, etc.), so kann man<br />
annehmen, dass keine spastische Zuckung sondern eine Absicht dahinter steckt.<br />
Wenn es dann noch gelingt, gewissen Reizen gewisse Bedürfnisse zuzuordnen, hat man eine<br />
Möglichkeit für die Artikulation von schwerstbehinderten Kindern gefunden.<br />
http://elektronik.htblmo-klu.ac.at/<br />
http://www.htl-klu.at<br />
- 27 -
Schule:<br />
HTL Wien Donaustadt<br />
Donaustadtstrasse 45<br />
1220 Wien<br />
Tel.: 01/20105<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Mobile Robot<br />
Jahrgang / Klasse: 5BTH Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Elektrotechnik - Informationstechnik<br />
Projektbetreuer: Ing. Maurer, Ing. Sinn<br />
Projektteam: Christian Svatek, Christian Schleinzer<br />
Projektpartner: Fa. Wien Schall Ges.m.b.H, Herr Christian Ferenz<br />
Dauer: von Sept. 2001 bis Mai 2002<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
In Zusammenarbeit mit Herrn Ferenz von der Firma Wien Schall Ges.m.b.H soll ein mobiler<br />
Roboter entwickelt werden, der Trockenräume stochastisch abfahren kann.<br />
Zielsetzung:<br />
Es soll ein batteriebetriebener Roboter entwickelt werden, der sich in einem Trockenraum frei<br />
bewegen kann, und diesen stochastisch abfährt, ohne dabei an Hindernisse zu stoßen.<br />
Ablauf:<br />
Planungs-, Bau- und Testphase liefen reibungslos ab.<br />
Ergebnis:<br />
Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes wurde der mobile Roboter an Herrn Ferenz übergeben.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der Prototyp soll der Firma Wienschall zur Entwicklung eines automatischen Staubsaugers dienen,<br />
welcher selbständig einen Raum abfährt (und saugt).<br />
- 28 -
Schule:<br />
HTL Wien Donaustadt<br />
Donaustadtstrasse 45<br />
1220 Wien<br />
Tel.: 01/20105<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Mobile Robot<br />
Jahrgang / Klasse: 5BTH Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): IT<br />
Projektbetreuer: Ing. Maurer, Ing. Sinn<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Mit Hilfe von Infrarotsensoren und zwei Kollisionstastern werden Hindernisse erkannt. Die<br />
Infrarotsensoren erkennen Hindernisse ab einer Entfernung von 200mm, wodurch der Roboter<br />
sofort seine Fahrgeschwindigkeit reduziert. Ein Kontakt mit dem Hindernis wird durch die Taster<br />
erkannt. Jetzt stoppt der Roboter, fährt 300mm zurück und lenkt in eine zufällig gewählte neue<br />
Richtung zur Weiterfahrt. Dabei wird ein digitaler Kompass zur Erkennung der Fahrtrichtung<br />
verwendet.<br />
Wird ein Hindernis von den Infrarotsensoren übersehen, dienen die Kollisionstaster als zusätzliche<br />
Hinderniserkennung.<br />
Die Auswertung der Sensoren erfolgt über einen RISC-Prozessor (ATMEL AVR RISC<br />
AT90S8515). Dieser übernimmt ebenso die Fahrsteuerung. Ein Richtungswechsel wird z.B. durch<br />
Einzelsteuerung der Servos durchgeführt. Die Stromversorgung für diese Steuerelektronik des<br />
Roboters erfolgt über eine 9V Blockbatterie.<br />
Der Antrieb selbst ist mit Servos realisiert worden, deren Stromversorgung von vier 1.5V Batterien<br />
(Size C) sichergestellt wird.<br />
- 29 -
Schule:<br />
TGM<br />
Wexstraße 19-23<br />
A-1200 Wien<br />
Tel.: 01/33126-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
4-Quadrantennetzteil<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Abteilung: Telekommunikation mit Schwerpunkt Mikroelektronik<br />
Jahrgang / Klasse: 5DeN Schuljahr: 2001/02<br />
Projektbetreuer: DI Herbert Burger<br />
Schüler:<br />
Köck Thomas, Lager Bernhard, Tucek Josef Thomas<br />
Projektpartner: TGM<br />
Dauer: von 5.09.2001 bis 28.04.2002<br />
Problemstellung:<br />
Auf der Basis eines gegebenen 200 Watt Klasse-D Verstärkers soll eine Schaltung entwickelt<br />
werden, die vollständig dokumentiert ist und leicht gefertigt werden kann. Der Verstärker wird als<br />
4-Quadrantennetzteil eingesetzt, das mit einem PC gesteuert werden kann.<br />
Zielsetzung:<br />
Die vorhandenen Schaltungen sind zu analysieren und einem tauglichen Redesign zu unterziehen.<br />
Zu dem Zweck sind einige Messungen durchzuführen. Auf Grund dieser Daten wird die Versorgung<br />
aus dem Netz (mit/ohne Puffer-Akkumulator) festgelegt.<br />
Ablauf Klasse-D Verstärker (parallel zur Steuerung):<br />
1. Schaltungsanalyse (offensichtliche Probleme) 1 Woche<br />
2. Redesign des Ausgangsfilters 1 Woche<br />
3. Funktionsprinzip der Brücke dokumentieren 2 Wochen<br />
4. Berechnung der Transferkennlinie der PWM-Brücke 4 Wochen<br />
5. Probeaufbau konstruieren 2 Wochen<br />
6. Transferfunktion messen 1 Woche<br />
7. Dreiecksoszillator konstruieren und messen 4 Wochen<br />
8. Rückkopplung; Schaltungsoptimierung 4 Wochen<br />
9. Netzversorgung festlegen 1 Woche<br />
10. fertig konstruieren 8 Wochen<br />
- 30 -
Schule:<br />
TGM<br />
Wexstraße 19-23<br />
A-1200 Wien<br />
Tel.: 01/33126-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
4-Quadrantennetzteil<br />
Abteilung: Telekommunikation mit Schwerpunkt Mikroelektronik<br />
Jahrgang / Klasse: 5DeN Schuljahr: 2001/02<br />
Ablauf Steuerung (parallel zu Verstärker):<br />
1. Kommunikationsprotokoll zwischen PC und µ-Prozessor:<br />
1.1 Studie Zeichenübertragung 1 Woche<br />
1.2 Studie Standard-Protokolle (X-Modem, etc.) 3 Wochen<br />
1.3 Funktionsumfang und Datenstruktur festlegen 2 Wochen<br />
1.4 Protokoll fixieren 1 Woche<br />
1.5 Protokoll implementieren und testen 4 Wochen<br />
2. Analogausgabe am µP realisieren 2 Wochen<br />
3. Applikationsprogramm:<br />
3.1 im µP 4 Wochen<br />
3.2 im PC 4 Wochen<br />
4. Test & Dokumentation 2 Wochen<br />
Ergebnis:<br />
Der Verstärker wird für den Umbau älterer Netzgeräte verwendet.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Das endgültige Netzteil findet seinen Einsatzbereich im Laborbetrieb der Schule.<br />
- 31 -
Schule:<br />
HTL Steyr<br />
Schlüsselhofgasse 63<br />
A-4400 Steyr<br />
Tel.: (07252) 72914<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
VTC (Variable Transmission Control)<br />
Jahrgang / Klasse: 5BHE Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Franz Parzer<br />
Projektteam: Armin Brandl, Joachim Reif, Peter Weichselbaumer<br />
Dauer: von 10/2001 bis 06/2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Mit Hilfe des Mikrocontrollers C167 soll ein 4-Gang Getriebe<br />
vollkommen automatisch gesteuert werden. Der Antrieb ist mittels<br />
Elektromotor und die Last mittels Generator zu realisieren.<br />
Zielsetzung:<br />
Eine Aufgabe bestand darin, via CAN-Bus die Frequenzumrichter anzusteuern. Diese dienen dazu,<br />
die Elektromotoren zu bremsen bzw. zu beschleunigen. Den anderen Schwerpunkt bildete die<br />
Konstruktion und Fertigung einer Platine zur Steuerung der Getriebemotoren, welche die<br />
Schaltvorgänge durchführen.<br />
Ablauf:<br />
Analyse der Problemstellung;<br />
Entwicklung einer Leiterplatte mittels AccelEda;<br />
Platine fertigen, bestücken und testen;<br />
State Maschine zur Ansteuerung der Frequenzumrichter; Programmentwicklung;<br />
CAN-Bus; C++ Programmentwicklung.<br />
- 32 -
Schule:<br />
HTL Steyr<br />
Schlüsselhofgasse 63<br />
A-4400 Steyr<br />
Tel.: (07252) 72914<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projekpräsentation<br />
Jahrgang / Klasse: 5BHE Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Franz Parzer<br />
Ergebnis:<br />
I/O - Board ist funktionsfähig<br />
Ansteuerung der Frequenzumrichter via CAN-Bus möglich<br />
Ansteuerung der Getriebemotoren funktioniert<br />
Verwertbarkeit: Vollautomatische Getriebesteuerung<br />
- 33 -
Schule:<br />
HTL Klagenfurt<br />
Lastenstraße 1<br />
9020-Klagenfurt<br />
Tel.: 0463/31605<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Optimierung einer Schneckenfaltmaschine SFM<br />
Jahrgang / Klasse: 5AHR Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Computer und Netzwerktechnik<br />
Projektbetreuer: DI Hannes Bidner, Ing. Helmut Steurer<br />
Projektteam: Markus Burian, Andreas Kreuzer, Christian Robnig<br />
Projektpartner: Mahle Filtersystems, 9143 St. Michael ob Bleiburg<br />
Dauer von: Oktober 2001 bis: Mai 2002<br />
Problemstellung:<br />
Zwei getrennt bedienbare Maschinenteile einer Schneckenfaltmaschine sollten von einem<br />
Bedienfeld aus gesteuert werden können.<br />
Zielsetzung:<br />
Die Lösung soll die Wegzeiten zwischen den Bedienpulten durch Vernetzung vermeiden und<br />
dadurch Produktivität steigern und Fehler vermindern.<br />
Ablauf:<br />
Von der Fa. Mahle Filtersystems wurden die Softwarestände der aktuell verwendeten Konfiguration<br />
einer SFM zur Verfügung gestellt (SIMATIC S7 Programmabzüge). In der Schule wurde diese<br />
dann nachgestellt.<br />
Mit Hilfe eines Siemens Bussystems wurde eine Verbindung zwischen den beiden<br />
speicherprogrammierbaren Steuerungen der SFM hergestellt. Nach Erstellen der MPI –<br />
Busverbindung (Multi – Point – Interface), mussten die zwei Maschinensteuerungen auf der<br />
Softwareebene in den Programmen SIMATIC S7-Manager und ProTool miteinander verbunden<br />
werden.<br />
Nach einer Testphase in der Schule wurde die neu erstellte Software bei MAHLE Filtersystems<br />
installiert und getestet.<br />
Ergebnis:<br />
Nach der Erstinstallation auf einer SFM lief ein Probebetrieb. Dieser sollte etwaige Mängel<br />
herausfinden oder Änderungswünsche bis zur Abnahme ermöglichen.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Nach dem Probebetrieb bei MAHLE Filtersystems erfolgte die Abnahme und die sukzessive<br />
Umrüstung aller Maschinen dieser Produktionslinie auf die neue Software.<br />
- 34 -
Schule:<br />
HTL Klagenfurt<br />
Lastenstraße 1<br />
9020-Klagenfurt<br />
Tel.: 0463/31605<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Jahrgang / Klasse: 5AHR Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Computer und Netzwerktechnik<br />
Projektbetreuer: DI Hannes Bidner, Ing. Helmut Steurer<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Optimierung einer Schneckenfaltmaschine SFM<br />
Ziel dieser Diplomarbeit war es, eine Kommunikation zwischen verschiedenen Siemens SPS und<br />
einem Bedienpaneel Siemens OP17 herzustellen.<br />
Der Grund war, dass die Maschineneinsteller an der Schneckenfalt-Filterproduktionsmaschine<br />
zwischen dem Steuerpult des Extruders und dem Steuerpult der Schneckenfaltmaschine Wegzeiten<br />
verbrauchen, die produktiv genutzt werden sollten.<br />
Das Projekt wurde wie folgt abgearbeitet:<br />
· Kundenwünsche laut Lastenheft erarbeiten und ein Pflichtenheft erstellen.<br />
· Die Maschinendaten vor Ort abziehen und speichern.<br />
· Einen Testaufbau mit den äquivalenten SPS in der HTL Lastenstraße realisieren.<br />
· Die bestehende Software analysieren.<br />
· Die Bedienfelder des Extruders in die Bedienfelder der Schneckenfaltmaschine integrieren.<br />
· Die neuen Funktionen testen.<br />
· Die physikalische und netzwerktechnische Verbindung zwischen den beiden<br />
Produktionsmaschinen vor Ort herstellen.<br />
· Den Transfer der neuen Softwarestände vorbereiten und vor Ort einspielen.<br />
· Einen Erstinstallation mit Probebetrieb durchführen.<br />
· Etwaige Änderungswünsche des Kunden einarbeiten.<br />
· Ein Bedienerhandbuch und eine Dokumentation für den Kunden erstellen.<br />
· Änderungsupgrades vor Ort durchführen<br />
· Abnahme und Einsatz der Lösung im Echtbetrieb.<br />
Realisierung:<br />
Die Fertigstellung der Lösung zu den obigen Aufgaben erfolgte im engen Kontakt mit dem Kunden.<br />
Immer wieder wurden Kundengespräche geführt, und so eine erfolgreiche Abwicklung des Projekts<br />
ermöglicht.<br />
Die Lösung wird derzeit an allen Maschinen gleichen Typs bei Mahle Filtersystems in St. Michael<br />
eingesetzt und läuft klaglos.<br />
- 35 -
Schule:<br />
HTLuVA Waidhofen<br />
Im Vogelsang 8<br />
3340-Waidhofen a.d. Ybbs<br />
Tel. Nr. 07442/52590-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Messung der dielektrischen<br />
Eigenschaften von Papier<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Elektrotechnik<br />
Jahrgang / Klasse: 5AE Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI Dr. techn. Helmut WALTER<br />
Projektteam: Markus BRANDSTETTER, Franz NOVAK<br />
Projektpartner: Neusiedler AG<br />
Dauer: von September 2001 bis Mai 2002<br />
Projektdaten<br />
Projektziel:<br />
Die Papierfabrik Neusiedler in A-3363 Ulmerfeld Hausmening (Jahresumsatz € 1 Mrd.) arbeitet an<br />
der Entwicklung von Papieren, die auch bei sehr hohen Druckgeschwindigkeiten (Ziel ist der<br />
Ausdruck einer A4 Farbseite in nur einer Sekunde) noch ausreichend gute Bildqualität erreichen.<br />
Diese hohen Druckgeschwindigkeiten erzeugen große Probleme (Farb- und<br />
Kontrastverfälschungen), deren Ursachen gemäß Fachliteratur im dielektrischen Verhalten des<br />
Papiers zu suchen sind. In der Folge wurden nun die zur Messung der dielektrischen Eigenschaften<br />
erforderlichen theoretischen und mathematischen Grundlagen erarbeitet. Weiters sollte das<br />
dielektrische Verhalten von Papier in Abhängigkeit von der chem. Zusammensetzung, dem<br />
Produktionsverfahren und mechanischen Parametern untersucht werden, um Messparameter zu<br />
finden, mit denen eine zuverlässige Voraussage der Druckqualität eines neuen Papiertyps möglich<br />
wird.<br />
Ergebnis:<br />
Die von den Papierdesignern der Forschungsabteilung der Fa. Neusiedler geforderten<br />
Vorhersageparameter für die Druckqualität (die Papierzeitkonstante t und die dielektrische Dicke<br />
d e ) konnten gefunden und zuverlässige Messverfahren erarbeitet werden. Diese Ergebnisse<br />
ermöglichten die Entwicklung einer neuen, viel leistungsfähigeren Papiersorte, die mittlerweile in<br />
Serie produziert wird. Es konnten aber auch völlig neue Eigenschaften von Papier entdeckt werden.<br />
So z.B., dass die dielektrischen Eigenschaften von Wasser, anders als in der Fachliteratur<br />
angegeben, stark von der Ionenkonzentration abhängen. Der große Erfolg überzeugte die<br />
Geschäftsleitung der Fa. Neusiedler, im Spätherbst 2001 beim FWF ein Forschungsprojekt zu<br />
beantragen, das die Untersuchung der grundlegenden Leitungsmechanismen zum Ziel hat. Dieses<br />
Projekt wurde bewilligt und läuft seit Jänner 2001.<br />
- 36 -
Schule:<br />
HTLuVA Waidhofen<br />
Im Vogelsang 8<br />
3340-Waidhofen a.d. Ybbs<br />
Tel. Nr. 07442/52590-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Messung der dielektrischen<br />
Eigenschaften von Papier<br />
Projekt-Präsentation<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Elektrotechnik<br />
Jahrgang / Klasse: 5 AE Schuljahr: 2001/02<br />
Projektbetreuer: DI Dr. techn. Helmut Walter<br />
Die Papierfabrik Neusiedler AG in A-3363 Ulmerfeld Hausmening (Jahresumsatz € 1 Mrd.) arbeitet<br />
an der Entwicklung von Papieren, die auch bei sehr hohen Druckgeschwindigkeiten noch<br />
ausreichend gute Bildqualität erreichen (Ziel ist der Ausdruck einer A4-Farbkopie in nur einer<br />
Sekunde). Diese hohen Druckgeschwindigkeiten erzeugen große Probleme (Farb- und<br />
Kontrastverfälschungen), deren Ursachen gemäß Fachliteratur im dielektrischen Verhalten des<br />
Papiers zu suchen sind. Da die bisherige rein statische Betrachtungsweise für die Deutung des<br />
Papierverhaltens nicht mehr ausreicht, muss daher auf eine dynamische Betrachtung übergegangen<br />
werden. Speziell beim Farbdruck sind die Forderungen nach optimaler Farbwiedergabequalität und<br />
geringem Bildrauschen nur mehr durch Optimieren des verwendeten Papiers zu erfüllen.<br />
Bei der Auswertung der Messergebnisse zeigte sich etwa, dass mit steigender dielektrischer Dicke<br />
die Farbwiedergabequalität der Kopie zunimmt und es einen optimalen Wert für die, die<br />
dielektrische Relaxation bestimmende Zeitkonstante t gibt. Weiters wurde der Einfluss der<br />
Umweltbedingungen, wie etwa Temperatur und Luftfeuchtigkeit, auf das Papierverhalten<br />
untersucht. Hier konnten Methoden zur Beeinflussung der Feuchtigkeitsaufnahme entwickelt<br />
werden, was eine wesentliche Verbesserung dieser, in der Papierindustrie seit langem bekannten<br />
Problematik darstellt.<br />
Durch Verändern der chemischen Zusammensetzung (Zelluloseart, Füllstofftyp und -anteil,<br />
Pigmentstrich, Art und Anteil des ionischen Leitfähigkeitmittels, usw.) gelingt es nun, die<br />
Papierparameter soweit zu optimieren, dass höhere Druckgeschwindigkeiten bei gleichbleibender<br />
Qualität erreicht werden. Die dabei gefundenen Gesetzmäßigkeiten konnten durch die Entwicklung<br />
einer viel leistungsfähigeren Papiersorte bestätigt werden.<br />
Bei der Durchsicht der einschlägigen Fachliteratur zeigte sich, dass im Rahmen dieser Arbeit<br />
Erkenntnisse und Zusammenhänge gefunden wurden, die bisher nicht entdeckt bzw. veröffentlicht<br />
wurden.<br />
An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass es für zwei angehende Ingenieure ein großer Erfolg<br />
war, dass mit ihrem Wissen ein Milliardenunternehmen in der Lage war, eine neue, viel<br />
leistungsfähigere Papiersorte zu entwickeln, die mittlerweile in Serie produziert wird.<br />
- 37 -
Schule:<br />
HTBL Wien Ottakring<br />
Thaliastraße 125<br />
A-1160 Wien<br />
Tel.: 01/51579<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Computerarbeitsplatz für einen<br />
Körperbehinderten<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: 5HEE Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Elektrotechnik<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Kurt STADLER<br />
Projektteam: Dragan NIKOLIC, Martin HREN und Cavit ACAR<br />
Projektpartner: Karin OBENBIGLER und Margit MARKL Erzieherinnen an der<br />
Adolf-Lorenz-Schule für Körperbehinderte<br />
Dauer: von September 2001 bis Juni 2002<br />
Problemstellung:<br />
Ein Körperbehinderter, der an Athetose oder spastischen Lähmungen leidet, kann eine herkömmliche<br />
Computermaus nur sehr schwer bedienen. Die ausfahrenden Bewegungen der Hände<br />
lassen eine gezielte Platzierung des Cursors auf dem Bildschirm kaum zu. Die Tasten auf der Maus<br />
sind zu klein und können nicht gezielt gedrückt werden. Außerdem verschiebt sich die Maus beim<br />
Drücken.<br />
Zielsetzung:<br />
Ein Computerarbeitsplatz in der Adolf-Lorenz-Schule sollte so umgestaltet werden, dass er<br />
sowohl von einem behinderten Kind, als auch von einem nicht behinderten verwendet werden kann.<br />
Die vorhandenen Gerätschaften für das behinderte Kind werden durch Neuentwicklungen sinnvoll<br />
ergänzt.<br />
Ablauf:<br />
Die Schüler haben sich in mehreren Zusammenkünften mit den Erzieherinnen der Adolf-Lorenz-<br />
Schule über die Zielsetzung beraten. Die größten Probleme für den Behinderten ergeben sich<br />
daraus, dass ein moderner PC über eine Computermaus bedient werden muss.<br />
Von den Schülern wurde im Laufe des Schuljahrs ein Trackball mit zwei freistehenden Tastern<br />
gebaut. Der Trackball besteht aus einer großen Holzkugel. Er ist so ausgelegt, dass der Cursor am<br />
Bildschirm gegenüber einer herkömmlichen Maus wesentlich träger bewegt wird. Die Taster<br />
besitzen einen großen Pilzkopf und sind leicht zu betätigen.<br />
Damit der PC aber auch von nicht behinderten benutzt werden kann, wurde eine Schaltung<br />
entwickelt, die den gleichzeitigen Betrieb von Trackball und herkömmlicher Maus ermöglicht.<br />
Ergebnis:<br />
Der Trackball wurde am Ende des Schuljahres der Adolf-Lorenz-Schule übergeben. Schon nach<br />
sehr kurzer Zeit war der Behinderte Jeffrey Hübel in der Lage selbständig am PC zu arbeiten.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der Trackball ist in der Adolf-Lorenz-Schule auch heuer wieder in Verwendung.<br />
- 38 -
Schule:<br />
HTBL Wien Ottakring<br />
Thaliastraße 125<br />
A-1160 Wien<br />
Tel.: 01/51579<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Computerarbeitsplatz für einen<br />
Körperbehinderten<br />
Switch-Box<br />
Projektpräsentation<br />
Für den Parallelbetrieb einer herkömmlichen<br />
Maus und dem Trackball wurde eine Schaltung<br />
entworfen, die die Signale von beiden<br />
Eingabegeräten gleichzeitig auf den PC führt.<br />
Trackball<br />
Für den Trackball wurde eine Standard-Computermaus in<br />
stark vergrößertem Maßstab nachgebaut. Die Achsen haben<br />
massive Lager und die Lochscheibe wurde so ausgelegt, dass<br />
sich der Zeiger am Bildschirm nicht zu schnell bewegt.<br />
Taster<br />
Die Taster sind mechanisch robust aus Aluminium gebaut.<br />
Sie besitzen intern zwei parallele Schalter, damit auch ein<br />
ungenaues Drücken erkannt wird. Der Pilzkopf ist aus Holz<br />
gedrechselt.<br />
Fertiger Arbeitsplatz<br />
Auf dem Markt gibt es nur wenige Anbieter für die<br />
behindertengerechte Ausstattung eines PCs. Die<br />
Geräte sind nicht immer durchdacht und von der<br />
Anschaffung her sehr teuer. Bei diesem Projekt<br />
wurde in einer konstruktiven Zusammenarbeit mit<br />
dem "Kunden" ein kostengünstiges und nützliches<br />
Gerät gebaut.<br />
- 39 -
Schule:<br />
HTBL Hollabrunn<br />
Dechant-Pfeifer-Straße 1<br />
2020 Hollabrunn<br />
Tel. 02952/3361-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Dreiphasiger Sperrwandler<br />
Datenblatt<br />
Abteilung: Elektrotechnik<br />
Jahrgang / Klasse: 5AE Schuljahr: 2001/02<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Johann Miniböck<br />
Projektteam: Martin Winalek, Roman Wondra<br />
Projektpartner: Pulse Electronics – UK, Johann Miniböck<br />
Dauer: von September 2001 bis Juni 2002<br />
Problemstellung:<br />
Entwicklung eines Dreiphasensperrwandlers mit geänderten Ausgangsspannungsverhältnissen auf<br />
Basis eines existierenden Konzepts. Der Sperrwandler soll in 3~115VAC Flugzeugbordnetzen<br />
verwendet werden.<br />
Zielsetzung:<br />
Das Projekt beinhaltet die Entwicklung, den Bau, die Inbetriebnahme, den Test und die<br />
Dokumentation dieser Einheit. Von dieser Einheit wurden insgesamt vier Stück angefertigt.<br />
Ablauf:<br />
Am Beginn des Projekts wurde die Anpassung der existierenden Schaltung und des<br />
Leiterplattenlayouts für die Anhebung der Ausgangsspannung von 28VDC auf 48VDC<br />
durchgeführt. Der erste Prototyp wurde bereits im Dezember 2001 nach erfolgreichem Bau,<br />
Inbetriebnahme und Test an den Partner Pulse Electronics UK übermittelt. Danach wurde ein<br />
weiterer Prototyp erstellt, um die Einheit auch optimieren und dokumentieren zu können. Die<br />
Optimierung bestand im Wesentlichen auf einer Reduktion des Kühlkörpervolumens, wodurch die<br />
Leistungsdichte des Systems von 290W/l auf 450W/l erhöht werden konnte.<br />
Ergebnis:<br />
Es zeigte sich, dass das System einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 87.8% und einen<br />
Leistungsfaktor von 99.8% aufweist, beides sind sehr gute Werte. Die Erwärmung der Bauelemente<br />
war an allen aktiven und passiven Komponenten unter 60K.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die Prototypen sind in industrieller Form erstellt worden, den endgültigen Einsatz des Systems in<br />
Flugzeugen wird jedoch der Partner Pulse Electronics (UK) entscheiden müssen. Für Netze mit<br />
höherer Eingangsspannung als der bei Flugzeugbordnetzen üblichen Phasenspannung von 115V ist<br />
das System nur schlecht geeignet, da die Spannungsbeanspruchung der Leistungshalbleiter relativ<br />
groß ist. Das heißt, die gegenständliche Arbeit hat nur einen sehr eingeschränkten<br />
Anwendungsbereich.<br />
- 40 -
Schule:<br />
HTBL Hollabrunn<br />
Dechant-Pfeifer-Straße 1<br />
2020 Hollabrunn<br />
Tel. 02952/3361-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Dreiphasiger Sperrwandler<br />
Abteilung: Elektrotechnik<br />
Jahrgang / Klasse: 5-AE Schuljahr: 2001/02<br />
Projektleiter: Dipl.-Ing. Johann Miniböck<br />
Projekt-Präsentation<br />
Die gegenständliche Arbeit beschäftigt sich mit der Modifikation eines bereits bestehenden<br />
dreiphasigen Sperrwandlerkonzepts, wobei im Wesentlichen die Ausgangsspannung von<br />
ursprünglichen 28VDC auf jetzt 48VDC erhöht wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad signifikant<br />
verbessert und durch die Reduktion des Kühlkörpervolumens konnte die Leistungsdichte des<br />
Systems von 290W/l auf 450W/l ebenfalls erhöht werden. Die Funktionsweise des Systems wurde<br />
durch den Einsatz von digitaler Simulation mittels PSPICE, die Wirkungsgradverbesserung<br />
analytisch verifiziert. Der Anwendungsbereich dieses Systems bleibt jedoch durch die hohe<br />
Spannungsbeanspruchung der Leistungshalbleiter auf Flugzeugbordnetze (115VAC) beschränkt.<br />
- 41 -
Schule:<br />
HTBL Pinkafeld<br />
Meierhofplatz 1<br />
A-7423 Pinkafeld<br />
Tel.: 03357/42491-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Audiodosimeter<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: 5BE Schuljahr: 2001 / 2002<br />
Abteilung(en): Elektrotechnik<br />
Projektbetreuer: DI. Dr. Kirisits Helmut, DI. Dr. Walla Thomas<br />
Projektteam: Wolfgang Buchegger, Eva-Maria Hanzl, Martin Pongratz<br />
Projektpartner: Firma NOVA TECH RESEARCH<br />
Firma BECOM<br />
Dauer: von Oktober 2001 bis April 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Aus einer Umfrage der Universität Gießen (Deutschland) geht hervor, dass bereits 28% der<br />
deutschen 20-Jährigen unter einem Verlust der Hörfähigkeit um 25dB leiden. Der Grund dafür ist<br />
ein breites Interesse der jungen Generation an Musik und der Spaß daran, diese so laut wie möglich<br />
zu konsumieren. Stundenlange Aufenthalte in Discos und bis zum Anschlag aufgedrehte Walkmans<br />
sind die Hauptgründe für die auftretenden Gehörbeeinträchtigungen. Grund dafür ist, dass dem<br />
Menschen ein Sinnesorgan zur Beurteilung der Schallbelastung fehlt. Darum haben wir uns nun<br />
zum Ziel gesetzt, die Leute auf die Risiken, denen sie sich in überlauter Umgebung aussetzen,<br />
aufmerksam zu machen.<br />
Zielsetzung:<br />
Wir Schüler bauen ein Gerät, das in der Fachsprache "Audiodosimeter" genannt wird. Dieses<br />
praktische Gerät ist nicht größer als 8 cm. Es wird am Oberarm befestigt und misst und speichert<br />
über eine Dauer von 8 Stunden sämtliche Lärmpegel, denen sich der Träger aussetzt. Es macht<br />
diesen darauf aufmerksam, sich bei Überbeanspruchung des Gehöres in eine ruhigere Umgebung<br />
zurückzuziehen.<br />
Die erschreckenden Tatsachen: In einer Disco darf man sich zum Beispiel maximal 4 Minuten<br />
aufhalten, ohne Gefahr zu laufen, bleibende Gehörschäden davon zu tragen!<br />
Ergebnis:<br />
Der fertiggestellte Prototyp funktionierte zur vollsten Zufriedenheit.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Das Gerät soll eventuell auf den Markt gebracht werden.<br />
- 42 -
Schule:<br />
HTBL Pinkafeld<br />
Meierhofplatz 1<br />
A-7423 Pinkafeld<br />
Tel.: 03357/42491-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Audiodosimeter<br />
Jahrgang / Klasse: 5BE Schuljahr: 2001 / 2002<br />
Abteilung(en): Elektrotechnik<br />
Projektbetreuer: DI. Dr. Kirisits Helmut, DI. Dr. Walla Thomas<br />
Ablauf:<br />
- 43 -
Schule:<br />
HTL-Wels<br />
Fischergasse 30<br />
4600-Wels<br />
Tel.: 07242/65801<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Echtzeit-Bahnberechnung<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: 5AER Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Elektrotechnik/Regelungstechnik<br />
Projektbetreuer: DI Peter Kinberger<br />
Projektteam: Christoph Glechner, Gerald Stögmüller, Michael Straßl<br />
Projektpartner: Trotec Produktions- und Vertriebs- GmbH, Marchtrenk<br />
Dauer: von 1.6.2001 bis 10.5.2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Für eine Trotec Lasergravurmaschine sind während eines Positioniervorganges die für die<br />
Geschwindigkeits- und Positionsregelung notwendigen Sollwerte für jeden Abtastpunkt zu<br />
berechnen.<br />
Das wesentliche Kriterium ist dabei die benötigte Rechenzeit auf einem 16 Bit Mikrokontroller und<br />
die Einhaltung bestimmte Toleranzen für die aktuellen Sollpositionen und Sollgeschwindigkeiten.<br />
Zielsetzung:<br />
Der von der Firma Trotec verwendete rekursive Algorithmus soll, da dieser große Schwierigkeiten<br />
mit Rundungsfehlern bereitet, durch eine direkte Berechnung zu jedem Abtastzeitpunkt ersetzt<br />
werden.<br />
Dabei muss untersucht werden, wie weit Vorausberechnungen vor dem Start der Bewegung<br />
möglich sind, und wie viele Rechenoperationen während der Bewegung notwendig sind. Weiters<br />
sind für alle Variablen die optimalen Zahlendarstellungen zu ermitteln.<br />
Der programmierte Algorithmus ist für alle Kombinationen der Startwerte auf Genauigkeit und<br />
Ausführungszeit zu testen.<br />
Ablauf:<br />
Die notwendigen Untersuchungen laut Zielsetzung wurden durchgeführt und für die Methode für<br />
realisierbar befunden. Die gesamte Berechung ist in eine Vorausberechnung und eine Berechnung<br />
zu jedem Abtastpunkt aufgeteilt worden. Die Realisierung für den Mikrokontroller Infineon C167<br />
erfolgte in C und Assembler. Die jeweiligen Ausführungszeiten wurden gemessen und die<br />
maximale Abweichung von den exakten Werten mit einer eigenen Testsoftware ermittelt.<br />
Ergebnis:<br />
Die von Trotec vorgegebenen Ausführungszeiten wurden eingehalten und auch die maximalen<br />
Abweichungen blieben im Toleranzbereich.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der entwickelte Sourcecode wurde von Trotec ohne Probleme in die Gesamtsoftware integriert und<br />
wird bereits in Serie eingesetzt.<br />
- 44 -
Schule:<br />
HTL-Wels<br />
Fischergasse 30<br />
4600-Wels<br />
Tel.: 07242/65801<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Die Bewegung des Laserstrahles der Gravurmaschine erfolgt nach einem exakt definierten Verlauf.<br />
Um einen möglichst schleppfehlerfreien Bewegungsablauf zu erreichen, benötigt die Regelung zu<br />
jedem Abtastzeitpunkt (1ms) die Momentanwerte für Sollposition, Sollgeschwindigkeit und<br />
Sollbeschleunigung.<br />
Die Steuerung der Gravurmaschine erfolgt mit einem 16 Bit Mikrokontroller (Infineon C167). Da<br />
dieser Mikrokontroller sämtliche Steuerungs- und Regelungsaufgaben übernimmt, steht zur<br />
Berechnung der Sollwerte nur begrenzt Zeit zur Verfügung. Für Vorausberechnungen vor dem Start<br />
der Bewegung wurden 10ms und während der Bewegung wurden 100µs als Maximalwerte<br />
festgelegt.<br />
Daraus ergab sich eine Trennung der Aufgabe in zwei Module, der Vorausberechung und der<br />
Echtzeitberechnung.<br />
a ( t )<br />
v ( t )<br />
s ( t )<br />
Beschleunigung<br />
Geschwindigkeit<br />
Weg<br />
Echtzeit-Bahnberechnung<br />
Bewegungsprofil<br />
t<br />
In der Vorausberechnung wird aus den übergebenen<br />
Parametern der durchzuführenden<br />
Bewegung (Weg, max. Geschwindigkeit,<br />
max. Beschleunigung und Ruck) ein<br />
Bewegungsprofil ermittelt. Dabei wurden vier<br />
Fälle unterschieden, je nachdem ob die<br />
Maximalwerte für Geschwindigkeit und Beschleunigung<br />
erreicht werden. Das Bewegungsprofil<br />
wird in bis zu sieben<br />
Abschnitte unterteilt. In jedem Abschnitt kann<br />
das Profil durch ein Polynom 3.Ordnung<br />
dargestellt werden. Diese Polynomkoeffizienten<br />
werden in einem Feld<br />
gespeichert und stehen damit dem<br />
Echtzeitmodul zur Verfügung.<br />
Diese Vorausberechnungen wurden in C mit<br />
Gleitkommaarithmetik programmiert.<br />
Ausgehend von den Polynomkoeffizienten werden im Echtzeitmodul für jeden Abtastzeitpunkt die<br />
aktuellen Sollwerte berechnet. Um die geforderten Rechenzeiten zu erreichen, wurde dieser Teil in<br />
Assembler mit Fixkommadualzahlen realisiert.<br />
Für den Funktionstest wurden die berechneten Sollwerte vom Mikrokontroller zu einem PC<br />
übertragen und in diesem mit einem eigenen LabView – Testprogramm, das die Sollwerte mit 64-<br />
Bit Gleitkommazahlen berechnete, verglichen. Die festgestellten Abweichungen blieben im<br />
zulässigen Toleranzbereich.<br />
Auch die Ausführungszeiten blieben mit 6,8ms für die Vorausberechnung und mit 86µs für das<br />
Echtzeitmodul deutlich unter den vorgegebenen Maximalwerten.<br />
Somit konnte der bis dahin verwendete rekursive Algorithmus, der Probleme mit Rundungsfehlern<br />
bereitete, ersetzt werden.<br />
Bei der Projektpräsentation wurde bereits eine Laser-Gravurmaschine mit den neuen Softwaremodulen<br />
erfolgreich vorgeführt.<br />
- 45 -
Schule:<br />
HTBLA Hallstatt<br />
Lahnstraße 69<br />
A-4830 Hallstatt<br />
Tel.: 06134/8214-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Büroeinrichtung - Ergonomie<br />
Jahrgang / Klasse: 5 Jhg. Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilungen: Innenraumgestaltung und Möbelbau<br />
Projektbetreuer: Architekt Dipl. Ing. Wolfgang Pineker<br />
Projektteam: Mario Schmaranzer, Gerald Staudinger<br />
Projektpartner: Fa. Sunhouse, Marchtrenk<br />
Dauer: von Juli 2001 bis Mai 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Das Team versuchte im Rahmen der neuen Matura (Ingenieurprojekt) eine neue<br />
Büroeinrichtungslinie zu entwickeln.<br />
Zielsetzung:<br />
Entwicklung von ergonomischen 3D Arbeitsplätzen, die auf die unterschiedlichen<br />
Teilarbeitsbereiche Rücksicht nehmen.<br />
Neben dem Entwerfen der Möbel und Systeme, die ein Höchstmaß an Flexibilität und Variabilität<br />
darstellen und ermöglichen sollen, wird auch auf das Design der Linie großer Wert gelegt.<br />
Es sollten flexible Büroarbeitsplätze mit systemorientiertem (EDV-Bildschirm) Arbeitsbereich<br />
sowie zur natürlichen Belichtung hin geöffnetem belegorientiertem Arbeitsbereich geschaffen<br />
werden, die in ergonomischer und gestalterischer Hinsicht ein Höchstmaß an Qualität erreichen<br />
sollen.<br />
Ablauf:<br />
Nachdem die Grundlagenforschung, die Terminplanung, der Entwurf, die Konstruktion und das<br />
Design der Möbellinie abgeschlossen wurden, ging das Projektteam schließlich daran, zu zeigen,<br />
dass dieses Möbelkonzept in einem konkreten Bürohausprojekt einsetzbar ist.<br />
Ergebnis:<br />
Ergonomiestudien, Präsentations- und Werkpläne in CAD-Ausarbeitung mit fotorealistischen<br />
Bildern sowie Animationen.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Es wird versucht, insbesondere das Arbeitsplatzsystem zur Serienreife zu bringen und das<br />
Möblierungskonzept beim Projektpartner zu verwirklichen.<br />
- 46 -
Schule:<br />
HTBLA Hallstatt<br />
Lahnstraße 69<br />
A-4830 Hallstatt<br />
Tel.: 06134/8214-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Büroeinrichtung - Ergonomie<br />
Projektpräsentation<br />
- 47 -
Schule:<br />
HTBLuVA VILLACH<br />
Tschinowitscherweg 5<br />
9500 Villach<br />
Tel.: 04242/37061<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Gestaltung eines Kirchenraumes<br />
Jahrgang / Klasse: 5AIT Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Innenraumgestaltung und Holztechnik<br />
Projektbetreuer: Zimmermann Georg, Prof. Arch. DI<br />
Projektteam: Faullant Angela, Wernig Kerstin<br />
Projektpartner: Bauabteilung des bischöflichen Gurker Ordinariates<br />
Dauer: Schuljahr 2001/2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Für das neu erbaute Pfarrzentrum Franz von Sales in Klagenfurt-Waidmannsdorf sollten ein Altar<br />
und ein Ambo entworfen werden. Bei dem Zentrum handelt es sich um einen modernen,<br />
zeitgemäßen konstruktiven Holzbau mit sparsamer Formensprache.<br />
Der zu entwerfende Altar sollte von "mobilem und variablem Charakter" sein, um sowohl in der<br />
kleineren Werktagskapelle als auch in der größeren Feiertagskapelle einsetzbar zu sein und den sehr<br />
unterschiedlichen Ansprüchen beider Räume zu genügen.<br />
Zielsetzung:<br />
Ausarbeitung von Entwürfen für Altar, Ambo, Kreuz und Kerzenständer mit der Problematik, dass<br />
diese Gegenstände sowohl für die Feiertagskapelle als auch für die Werktagskapelle verwendbar<br />
sein sollten, d.h. speziell die Größe des Altars sollte veränderbar sein.<br />
Ablauf:<br />
1. Ausarbeitung einer Grundlagenforschung unter folgenden Gesichtspunkten:<br />
· Geschichte und Entwicklung des Altars und des Ambos<br />
· Richtlinien der Diözese Gurk<br />
· Funktionsschemen nach H. Muck<br />
· Liturgische Räume und ihre Ausstattung<br />
· Gebaute Beispiele von Altar und Ambo.<br />
2. Entwurfsphase:<br />
· Entwurfsgedanke<br />
· Grundrissstudien<br />
· Ausarbeitung der Entwürfe für Volksaltar, Ambo, Kreuz, Kerzenständer.<br />
Ergebnis:<br />
Die im Rahmen der Diplomarbeit vorgelegten Entwürfe entsprechen in ihrer reduzierten<br />
Formensprache, ihrer Beschränkung auf das Wesentliche, wie auch in ihrer Funktionalität den<br />
Ansprüchen zeitgemäßer Kirchenmöblierung und sind auf die vorliegende Situation bestens<br />
zugeschnitten.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die Diözese Gurk hat die Absicht einen der Entwürfe baldmöglichst zu verwirklichen.<br />
- 48 -
Schule:<br />
HTBLuVA VILLACH<br />
Tschinowitscherweg 5<br />
9500 Villach<br />
Tel.: 04242/37061<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Gestaltung eines Kirchenraumes<br />
Projektpräsentation<br />
Zusammenfassung der Diplomanden:<br />
Wir hatten den Auftrag für die Diözese Gurk<br />
einen Volksaltar und einen Ambo für einen<br />
bestehenden Kirchenraum zu planen.<br />
Als Ausgangssituation stellte sich das<br />
Pfarrzentrum Franz von Sales in Klagenfurt,<br />
Waidmannsdorf. In diesem Zentrum sollten<br />
Volksaltar und Ambo für eine Werktagskapelle<br />
und für eine Feiertagskapelle entworfen<br />
werden. Die Problematik lag in der Tatsache,<br />
dass der Altar mobil in beiden Räumen, welche<br />
sehr unterschiedliche Größen haben, verwendet<br />
werden sollte. Der Altar sollte daher die<br />
Möglichkeit zur Vergrößerung bzw. zur<br />
Verkleinerung zwecks Verwendung in beiden<br />
Räumen haben.<br />
Wir entschieden uns im Rahmen unserer Arbeit<br />
auch weitere liturgische Gegenstände wie<br />
Kreuz und Kerzenständer zu entwerfen.<br />
Zu Beginn des Projektes beschäftigten wir uns<br />
mit den Vorschriften des 2. Vatikanischen<br />
Konzils und der Diözese Gurk. Verschiedene<br />
fachbezogene Literatur bildete die<br />
Grundlagenforschung. Es wurden Beispiele<br />
gesammelt und bewertet.<br />
Auf Grund der Erkenntnisse entwickelten wir<br />
die Raumkonzepte und anschließend die<br />
Entwürfe für Altar und Ambo. Aus diesen<br />
Arbeiten ergaben sich dann Kreuz und<br />
Kerzenständer.<br />
Im Anschluss wurden die Entwürfe genau<br />
ausgearbeitet, Pläne erstellt und Schaubilder<br />
gefertigt.<br />
Unsere Entwürfe wurden auch in Form von<br />
Modellen ausgeführt um sie besser zu<br />
visualisieren.<br />
Die Diözese Gurk möchte einen unserer<br />
Entwürfe verwirklichen.<br />
- 49 -
Schule:<br />
HTL SAALFELDEN<br />
Almerstraße 33<br />
5760-Saalfelden<br />
Tel.: 06582/72568<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Tragseilklemmapparat<br />
Jahrgang: V. M Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung: Maschineningenieurwesen<br />
Projektbetreuer: VL DI. Walter Gruber, AV DI. Josef Harl<br />
Projektteam: Trixl Thomas, Zehentner Stefan<br />
Projektpartner: Fa. Koller Forsttechnik GesmbH<br />
Dauer: von Juli 2001 bis Mitte Mai 2002<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Der zu entwickelnde Tragseilklemmapparat dient zur Positionsfixierung eines Laufwagens durch<br />
reibschlüssige Verbindung zum Tragseil. Er wird im Laufwagen in der Holzbringung eingesetzt.<br />
- Aufnahme des Ist-Zustandes des sich im Einsatz befindlichen Klemmapparates, sowie<br />
Ermittlung der Schwachstellen.<br />
- Entwicklung eines neuen Tragseilklemmapparates.<br />
- Erhöhung der Klemmsicherheit.<br />
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.<br />
- Entwicklung einer kosten- u. gewichtsgünstigen Lösung.<br />
- Seilschonende Klemmung.<br />
- Fertigung eines Prototypen mit darauffolgenden Testläufen.<br />
Zielsetzung:<br />
Verhinderung des Herausspringens des Tragseiles aus dem Klemmapparat bei auftretenden<br />
Schwingungen durch die Ausführung eines schwenkbaren Tragseilklemmapparates. Entwicklung<br />
eines neues kosten- und gewichtsgünstigen Konzepts zur schonenden Klemmung des Laufwagens<br />
am Tragseil mit Vorteilen auf die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems.<br />
Ablauf:<br />
Nach der Analyse des von der Firma verwendeten Klemmapparates in den Sommermonaten 2001<br />
wurden Materialversuche an der HTL-Saalfelden durchgeführt. Als mehreren Varianten wurde eine<br />
Konstruktion ausgewählt und vollständig ausgearbeitet und berechnet.<br />
Ergebnis:<br />
Ein Prototyp konnte aus Kosten- und Zeitproblemen nicht gebaut werden.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die gewählte Konstruktion wird von der Firma weiterentwickelt.<br />
- 50 -
Schule:<br />
HTL SAALFELDEN<br />
Almerstraße 33<br />
5760-Saalfelden<br />
Tel.: 06582/72568<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Tragseilklemmapparat<br />
Die gewählte Konstruktion in einer Explosionsskizze:<br />
1 Federzylinder ( Stahl )<br />
4 Rückstellfeder<br />
6+10 geteilter Grundteil ( hochfeste Aluminiumlegierung )<br />
9 Ritzelwellen mit Lagerungen und Exzenter ( 4 Stück )<br />
12 Zahnkolbenstange<br />
13 Hydraulikzylinder<br />
14 V-Klemmbacken ( 2 Stück )<br />
15 V-Klemmbacken-Haltefedern ( 2 Stück )<br />
19 Backenhalteplatten ( 2 Stück )<br />
- 51 -
Schule:<br />
HTL BULME Graz<br />
Ibererstraße 15 - 21<br />
A-8051 Graz<br />
Tel.: 0316/6081-218<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Move Theresa<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: 5 AMH Schuljahr: 2001 / 02<br />
Abteilung(en): Maschineningenieurwesen<br />
Projektbetreuer: Prof. Dipl.-Ing. Klaus-J. Nutz<br />
Projektteam: Bernhard Kager, Joachim Reicher, Philipp Hasenhüttl<br />
Projektpartner:<br />
Dauer: von September 2001 bis Juli 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Theresa wurde am 19.12.1994 in der 32. Schwangerschaftswoche – 8 Wochen zu früh - geboren.<br />
Infolge von Blutdruckschwankungen während der Geburt kam es zu einer Schädigung des noch<br />
nicht vollständig ausgebildeten Gehirns. Die Schädigung traf Gehirnteile, die für die Steuerung der<br />
Motorik zuständig sind. Als Folge kam es zu einer „spastischen Tetraplegie“.<br />
Wir wissen, dass wir nur einen kleinen Teil unseres Gehirns nützen. Warum sollen also nicht andere<br />
Teile des Gehirns diese Funktionen übernehmen können? Bei der Therapie kommt es wesentlich<br />
auf die Anzahl der Bewegungen an, die von einer Maschine zwar nicht so individuell, aber zeitlich<br />
öfter und genauer durchgeführt werden können. Theresas Mutter, eine Freundin einer Professorin<br />
unserer Schule, trat also an die Schule mit der Bitte heran, so einen Bewegungsapparat zu<br />
konstruieren.<br />
Zielsetzung:<br />
· Entwurf, Konstruktion und Fertigung eines Bewegungsapparates, der die Therapeutin durch<br />
eine gezielte Bewegung zur Lockerung Theresas vor der eigentlichen Therapie unterstützt.<br />
· Die geforderten Bewegungen wurden von der Therapeutin festgelegt.<br />
· Die Bewegung sollen möglichst schonend an das zu therapierende Kind übertragen werden.<br />
· Es sollen bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllt werden.<br />
Ablauf:<br />
Nach der Klärung der grundsätzlichen Aufgabenstellung erfolgte der theoretische Entwurf unter<br />
Einsatz eins Kinematik-Simulationsprogrammes, die konstruktive Umsetzung der geforderten<br />
Funktionen auf Basis des 3D-CAD-Programmes ProE sowie, unterstützt durch bemerkenswertes<br />
Sponsoring, die Realisierung dieses Therapiegerätes.<br />
Ergebnis:<br />
Zur Zeit wird das Gerät mit Unterstützung eines Sponsors komplettiert und soll Theresa bereits zu<br />
Weihnachten übergeben werden.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Aufgrund der konstruktiven Konzeption kann dieses Gerät mit Theresa „mitwachsen“ und ist mit<br />
Sicherheit als Prototyp einer ganzen Reihe von entsprechend adaptierbaren Therapiegeräten zu<br />
sehen.<br />
- 52 -
Schule:<br />
HTL BULME Graz<br />
Ibererstraße 15 - 21<br />
A-8051 Graz<br />
Tel.: 0316/6081-218<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Move Theresa<br />
Jahrgang / Klasse: 5 AMH Schuljahr: 2001 / 02<br />
Abteilung(en): Maschineningenieurwesen<br />
Projektbetreuer: Prof. Dipl.-Ing. Klaus-J. Nutz<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Das nebenstehende Bild zeigt den 3D-Zusammenbau<br />
der Bewegungsmaschine.<br />
Man erkennt die Pleuelstangen, die für die<br />
ellipsenähnliche Bewegungsbahn der Knöchel<br />
verantwortlich.sind.<br />
Die kleineren Gestänge rufen die Winkeländerungen<br />
im Sprunggelenk hervor.<br />
Graz, am 7. 11. 02<br />
NK<br />
- 53 -
Schule:<br />
HTBLA – Eisenstadt<br />
Bad Kissingenplatz 3<br />
7000 Eisenstadt<br />
Tel. 02682/64605<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Trayfilling<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: M5 Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en):<br />
Maschineningenieurwesen<br />
Projektbetreuer:<br />
DI Robert Taucher, FL Karl Steiner<br />
Projektteam:<br />
Klikovits Martin, Oberguggenberger Markus,<br />
Szedenik Wolfgang<br />
Projektpartner:<br />
Master Foods Austria<br />
Dauer: von Oktober 2001 bis Mai 2002<br />
Problemstellung:<br />
Bei der Firma Master Foods Austria werden Schokoladeröllchen (Fanfare) in<br />
Kunststoffschalen (Trays) eingelegt und anschließend in Schlauchbeutelmaschinen luftdicht<br />
verpackt. Die Maschinen, die das Einlegen des Produktes in die Trays vornehmen, werden als<br />
Trayfillings bezeichnet.<br />
Die derzeit verwendeten Trayfillings arbeiten nicht zufriedenstellend und sind sehr<br />
störungsanfällig. Die Verschmutzung der Anlagen und die damit verbundenen Ausfallzeiten<br />
stellen das Hauptproblem dar.<br />
Zielsetzung:<br />
Analyse der derzeit in Verwendung stehenden Anlagen, Erarbeitung eines neuen<br />
Maschinenkonzeptes, Konstruktion und Bau eines Funktionsmodells<br />
Ablauf:<br />
Zunächst wurden die derzeit verwendeten Trayfillings mit Hilfe von TECH OPTIMIZER<br />
analysiert. Gleichzeitig wurden mit dieser Software auch Vorschläge zur Verbesserung der<br />
vorhandenen Anlagen erarbeitet. Da die zur Optimierung notwendigen Umbauten sehr<br />
aufwändig gewesen wären, wurden durch systematische Lösungsfindungsmethoden neue<br />
Konzepte zur Lösung des Problems erarbeitet. Insgesamt wurden neun Maschinenkonzepte<br />
entwickelt. Durch systematische Bewertung wurde eine Reihung nach technischer Wertigkeit<br />
erreicht. Nach der Präsentation dieser Lösungsvorschläge bei der Firma Master Foods wurde<br />
der Auftrag erteilt, die erstgereihte Variante konstruktiv umzusetzen und ein Funktionsmodell<br />
für Testzwecke zu bauen.<br />
Ergebnis:<br />
Es wurde ein einfacher Prototyp konstruiert und gebaut. Die mit diesem Funktionsmodell<br />
durchgeführten Tests verliefen zufriedenstellend.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Durch das vorliegende Projekt wurde ein brauchbares Maschinenkonzept erarbeitet.<br />
Die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgt im Schuljahr 2002/2003.<br />
- 54 -
Schule:<br />
HTBLA – Eisenstadt<br />
Bad Kissingenplatz 3<br />
7000 Eisenstadt<br />
Tel. 02682/64605<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Trayfilling<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Erarbeitung der technischen Grundlagen für den Bau einer Maschine zum Einlegen von<br />
Schokoladeröllchen in Kunststofftrays<br />
Die wichtigsten Anforderungen an das neue Trayfilling:<br />
- Die Maschine soll mindestens 600 Stück pro Minute verarbeiten können.<br />
- Das Produkt muss möglichst schonend behandelt werden.<br />
- Die Funktion der Maschine darf durch Produktabrieb nicht beeinträchtigt werden.<br />
- Die Abwärme der Antriebe darf das Produkt nicht erwärmen.<br />
- Die Bedienung der Maschine muss möglichst einfach sein.<br />
- Die Maschine muss leicht zu reinigen sein.<br />
- Die Betriebskosten sollen möglichst niedrig sein.<br />
Die systematische Analyse des Problems ergab neun brauchbare Lösungsvorschläge. Die<br />
Bewertung dieser Konzepte ergab die optimale Variante, von der ein Funktionsmodell<br />
konstruiert und gebaut wurde.<br />
Die Röllchen werden über ein Rundriemenfördersystem<br />
angeliefert und vom rotierenden<br />
Übergaberad aufgenommen. Dabei werden sie<br />
auf die notwendige Teilung gebracht.<br />
Durch die Drehbewegung des Übergaberades<br />
werden die Röllchen zur Einlegestelle transportiert.<br />
Dabei werden sie durch Unterdruck gehalten.<br />
Am tiefsten Punkt wird durch eine Steuerkurve<br />
der Unterdruck aufgehoben und die Röllchen fallen<br />
in die durch das Trayrad synchron bewegten Trays.<br />
- 55 -
Schule:<br />
PHTL – Lienz<br />
Linker Iselweg 22<br />
A – 9900 Lienz<br />
Tel.: 04852 / 72738<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Bohr – und Nietstation<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: 4 KO Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Kolleg für Maschineningenieurwesen / Automatisierungstechnik<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Hueter Walter<br />
Projektteam: Kollnig Stefan, Lottersberger Florian, Mattersberger Michael<br />
Projektpartner: Plansee Werk Reutte<br />
Dauer: von Februar bis Juni<br />
Problemstellung:<br />
In der Abteilung Hochtemperaturofenbau (FTO) befinden sich insgesamt sieben Nietmaschinen<br />
zum Vernieten unterschiedlicher Produkte. Das Nieten wird weitgehend ohne Automatisierung<br />
durchgeführt. Es wird zunächst eine Bohrung mit einer einfachen Ständerbohrmaschine erzeugt.<br />
Anschließend wird die Bohrung entgratet, der Niet von Hand eingesteckt und mittels<br />
handelsüblichen Klebebands fixiert. Danach wird der Niet und das Werkzeug erwärmt und mit dem<br />
Taumelwerkzeug umgeformt.<br />
Zielsetzung:<br />
Aufgabe ist es, eine Anlage zu projektieren, die eine Produktivitätssteigerung beim Nietprozess<br />
erlaubt. Die Anlage soll kostengünstig zu realisieren sein und hohe Prozesssicherheit garantieren.<br />
Im Mittelpunkt steht dabei die Zeiteinsparung durch Automatisierung. Insbesondere soll der hohe<br />
Positionieraufwand an der Bohr- und Nietmaschine und die Fixierung der Nieten durch die<br />
Automatisierung verbessert werden.<br />
Ablauf:<br />
- Erarbeitung eines Lösungskonzeptes<br />
- Konstruktion von Portal, Ausleger, Nietzuführeinheit<br />
- Erstellen der mechanischen Berechnungen<br />
- Projektieren der mechanischen und elektrischen Komponenten<br />
- Technische Dokumentation<br />
- Erstellen einer Computeranimation<br />
- Abschließende Präsentation<br />
Ergebnis:<br />
Das fertige Projekt wurde den Vertretern der Firma Plansee und hochrangigen Persönlichkeiten aus<br />
Wirtschaft, Politik und Schule am 04. Juni 2002 im Osttiroler Wirtschaftspark präsentiert.<br />
- 56 -
Schule:<br />
PHTL – Lienz<br />
Linker Iselweg 22<br />
A – 9900 Lienz<br />
Tel.: 04852 / 72738<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Jahrgang / Klasse: 4 KO Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Kolleg für Maschineningenieurwesen / Automatisierungstechnik<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Hueter Walter<br />
Auf Wunsch der Fa. Plansee sollte nur eine<br />
teilweise Automatisierung durchgeführt<br />
werden. Für den Bohr- und Nietprozess wurde<br />
eine Station konstruiert, die die Arbeitsgänge<br />
Indexieren - Bohren - Entgraten - Setzten der<br />
Nieten – Zufuhr der Nieten - und das Schlagen<br />
der Nieten selbstständig durchführt. Die<br />
Zuführung der Werkstücke wird weiterhin<br />
manuell durchgeführt. Besonderes Augenmerk<br />
musste auf die Stabilität der Station gelegt<br />
werden, damit die hohen Qualitätsanforderung<br />
erfüllt werden.<br />
Die Konstruktion der Bohr – und Nietstation wurde mittels neuester CAD – Software durchgeführt.<br />
Für die mechanischen Berechnungen wurde ein FEM - Programm verwendet.<br />
Arbeitsablauf:<br />
Nach Einlegen des Rohres von Hand und der Indexierung durch einen Indexierstift wird unter einer<br />
Aufspannung das Rohr gebohrt, entgratet und genietet. Dabei wird auch die Nietzuführung<br />
vollautomatisch durchgeführt. Nach erfolgtem Arbeitsablauf wird das Rohr wieder manuell gedreht,<br />
die Bohrung wieder indexiert und der Arbeitsablauf durch den Arbeiter erneut gestartet.<br />
- 57 -
Schule:<br />
HTL Neufelden<br />
Höferweg 47<br />
4120 Neufelden<br />
Tel.: 07282/5955<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Abteilung: Automatisierungstechnik<br />
Jahrgang / Klasse: 5AAT Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI Leopold WURM, DI Walter SCHIRZ,<br />
FOL Albert AHAMER, FL Roland SCHOPPER<br />
Projektteam: Allerstorfer, Atzlesberger, Martha, Neubauer, Niedermayr, Paar<br />
Projektpartner: KE KELIT Linz<br />
Partner:<br />
Herbert GÖTZENDORFER<br />
Dauer: von 01. März 2001 bis 07. Juni 2002<br />
Aufgabenstellung und Zielsetzung:<br />
MONTAGEAUTOMAT<br />
Es soll ein Montageautomat zur Aufbringung von Dichtringen und Presshülsen auf einen<br />
Kunststoffgrundkörper zur Herstellung<br />
von WINDOX-Formstücken entworfen,<br />
konstruiert und programmiert werden.<br />
Dabei muss der Montageautomat von nur<br />
einer Person bedient werden können. Das<br />
heißt, es müssen Magazine bzw.<br />
Zufördereinrichtungen für die zu<br />
montierenden Teile vorhanden sein. Auch<br />
sollte nach dem händischen Einlegen des<br />
Kunststoffgrundkörpers dieser von der<br />
Maschine selbst gehalten und erst nach<br />
Beendigung des Schaltvorganges wieder<br />
freigegeben werden. Die Gutabgabe soll<br />
wiederum händisch durch den<br />
Maschinenbediener erfolgen. Die<br />
Arbeitsabläufe müssen nach der Eingabe der verschiedenen Produktparameter, mittels eines<br />
steuerungsseitigen Bedienpanels, aufgrund einer SPS-Steuerung vollautomatisch ablaufen. Weiters<br />
müssen über die Steuerung die Kontrollen sämtlicher Magazinstände und Sicherheitseinrichtungen<br />
erfolgen bzw. Stück- und Zeitzähler realisiert werden.<br />
- 58 -
Schule:<br />
HTL Neufelden<br />
Höferweg 47<br />
4120 Neufelden<br />
Tel.: 07282/5955<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte Projektpräsentation<br />
Abteilung: Automatisierungstechnik<br />
Jahrgang / Klasse: 5AAT Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI Leopold WURM<br />
Ergebnis und Verwertbarkeit<br />
MONTAGEAUTOMAT<br />
Die fertige Anlage konnte dem Auftraggeber im Juni 2002 übergeben werden und arbeitet seither sehr<br />
zufriedenstellend.<br />
Presshülsensysteme werden in der Wasserinstallation zur Verbindung von Rohren mit<br />
Anschlüssen, T-Stücken, Reduzierungen, Winkelstücken und so weiter eingesetzt.<br />
Projektablauf:<br />
>> Überlegen verschiedenster Varianten zur mechanischen Realisierung<br />
>> Vorversuche<br />
>> Entwurf und Auslegung der mechanischen Bauteile<br />
>> Konstruktion mittels des Zeichenprogrammes Solid Edge in 3D und anschließend 2D<br />
>> Arbeitsvorbereitung und mechanische Fertigung im schuleigenen Werkstättenbereich<br />
>> Montage der Anlagenteile<br />
>> Installation der elektrischen und pneumatischen Anlage<br />
>> Programmierung der SPS-Steuerung<br />
>> Aufzeichnung und Auswertung der durchgeführten Arbeiten<br />
>> Testläufe<br />
>> Übergabe der Maschine<br />
Anlagenbeschreibung<br />
Der Montageautomat besteht aus folgenden fünf Teilstationen, mit welchen Dichtringe und<br />
Presshülsen auf einen Kunststoffgrundkörper montiert werden.<br />
Teilstationen:<br />
>> Bedienpanel<br />
>> Gutaufgabe + Zuführung + Gutabgabe<br />
>> Dichtringmontage<br />
>> Hülsenmontage<br />
>> Rüttlersteuerung<br />
- 59 -
Schule:<br />
HTL Wolfsberg<br />
Gartenstraße 1<br />
A-9400 Wolfsberg<br />
Tel.: 04352/48 44-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Stanzmaschine<br />
Jahrgang: 5BHA Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung: Höhere Lehranstalt für Automatisierungstechnik<br />
Projektbetreuer: Prof. Ing. Werner Buchner<br />
Projektteam: Robert Hartl, Markus Jöbstl, Florian Radl<br />
Projektpartner: Elmont Industrieanlagenbau<br />
Dauer: von 09.2001 bis 07.2002<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Entwicklung und Bau einer Stanzmaschine, die Beschriftungsplättchen für Kabel mit variablen<br />
Löchern versieht und die Plättchen ablängt.<br />
Zielsetzung:<br />
Konstruktion und Fertigung einer funktionstüchtigen automatisierten Stanzmaschine, die das<br />
Stanzen zweier variabler Löcher und den Ablängevorgang in einem Arbeitsvorgang von einem PC<br />
gesteuert verrichtet, wobei das Rohmaterial automatisch zugeführt wird.<br />
Ablauf:<br />
Unter Berücksichtigung der gewünschten Eigenschaften wurden zunächst verschiedene<br />
Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Danach erfolgte eine Dreiteilung des Gerätes in die<br />
Hauptkomponenten, für welche verschiedene Lösungsvarianten überlegt wurden. Anhand von<br />
Skizzen dieser Varianten wurden die besten Lösungen eruiert. Auf dieser Grundlage wurde die<br />
gesamte Maschine in Pro/E konstruiert. Nach Erstellung der Einzelteilzeichnungen begann die<br />
Fertigung der Einzelteile. Die Auslegung und Planung der Steuerung, sowie das Programmieren des<br />
Steuerungsprogrammes mit Automation X, erfolgte parallel zur Fertigung. Der gesamte<br />
Projektablauf wurde dokumentiert.<br />
Ergebnis:<br />
Das Ergebnis ist eine flexible Stanzmaschine, die sich durch das veränderbare Lochbild nicht nur<br />
zur Herstellung von Beschriftungsplättchen eignet, sondern generell in der blech- bzw.<br />
kunststoffverarbeitenden Industrie eingesetzt werden kann.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Hauptsächlich zur Herstellung von Beschriftungsplättchen für die Firma Elmont. Genereller Einsatz<br />
in der Kleinserienproduktion eines blech- oder kunststoffverarbeitenden Betriebes ist möglich.<br />
- 60 -
Schule:<br />
HTL Wolfsberg<br />
Gartenstraße 1<br />
A-9400 Wolfsberg<br />
Tel.: 04352/48 44-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projektbetreuer:<br />
Stanzmaschine<br />
Prof. Ing. Werner Buchner<br />
Jahrgang: 5BHA Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung: Höhere Lehranstalt für Automatisierungstechnik<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Die im Rahmen dieser Diplomarbeit entwickelte Stanzmaschine hat sowohl eine Personal- als auch<br />
Zeitersparnis bei der Herstellung von Beschriftungsplättchen zum Ziel.<br />
Dabei standen vor allem die einfache Steuerung der Maschine über PC und der weitgehend<br />
automatisierte Arbeitsablauf im Vordergrund. Besonderer Wert wurde auch auf die Kompaktheit<br />
des Gerätes gelegt.<br />
Wesentliche Konstruktionsmerkmale:<br />
· Leichte Endmontage durch modulartigen Aufbau<br />
· Kompakte Ausführung<br />
· Einfache Bedienung durch Visualisierung am PC<br />
· Automatische Rohmaterialzuführung<br />
· Per PC einstellbarer Lochabstand<br />
· Mittels Schrittmotor verstellbare Matrize und Stempel<br />
· Ausgelegt für Kunststoff- und Aluminiumplatten bis zu 1,5 mm Dicke<br />
· Hydraulische Betätigung der Stanze (Betriebsdruck von 160 bar)<br />
· Durch hohe Flexibilität in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar<br />
Die kompakte Maschine wurde<br />
speziell für das Stanzen der<br />
Beschriftungsplättchen ausgelegt,<br />
ist aber dennoch flexibel<br />
genug, um auch für andere<br />
Aufgaben verwendet zu<br />
werden. Diese Eigenschaft<br />
verdankt die Maschine vor<br />
allem den gut durchdachten<br />
Lösungen für den voll<br />
verstellbaren Stempel und die<br />
verstellbare Matrize.<br />
- 61 -
Schule:<br />
HTBLuVA St. Pölten<br />
Waldstraße 3<br />
3101 St. Pölten<br />
Tel.: 02742/750 51-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Automatisierte Nietenhärtung<br />
Jahrgang / Klasse: 8 AAA Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Maschineningenieurwesen / Automatisierungstechnik<br />
Projektbetreuer: DI. Dr. Huemer Roman, DI. Hauleitner Anton<br />
Projektteam: Gutscher Rudolf, Wilhelm Jürgen<br />
Projektpartner: Fa. Prinz KG, Ofenlochstraße 1, 3382 Albrechtsberg<br />
Dauer: Sept.2001 bis 31.5.2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Es ist eine vollautomatische Härtanlage zu entwickeln, welche es ermöglicht, Nieten am<br />
Nietenbund in der Randschicht zu härten. Weiters soll darauf geachtet werden, dass die Maschine<br />
bei einem nicht korrekten Härtevorgang abgestellt wird und signalisiert, dass der Niet nicht die<br />
erforderliche Härte erreicht hat.<br />
Zielsetzung:<br />
Zur Zeit wird der Niet von einem Becher mittels einer Pinzette entnommen und in eine eigens dafür<br />
montierte Aufnahme eingelegt. Rund um diese Aufnahme befindet sich eine Induktionsspule. Nach<br />
diesem Vorgang betätigt der Arbeiter einen Fußauslöser, aktiviert die Induktionsspule und bringt so<br />
den Niet am Rand zu glühen. Der Niet wird während dieses Vorgangs zusätzlich noch von oben mit<br />
Wasser gekühlt ( Randschichthärtung). Nach diesem Härtevorgang wird der Niet mit der Pinzette<br />
entnommen und in einen Behälter abgelegt. Dieser Vorgang dauert in etwa 5 Sekunden. Dieser<br />
Arbeiter ist das ganze Jahr über beschäftigt, Nieten auf diese Art und Weise zu härten. Es wird<br />
während des Prozesses mehrmals am Tag eine “ stichprobenartige Kontrolle “ durchgeführt. Dieser<br />
Prozess wird durch die neue Anlage automatisiert.<br />
Ablauf: Sämtliche erforderlichen technischen Berechnungen, 3D- und 2D-Konstruktion auf ProE,<br />
Pneumatikplan, ET-Schaltplan, SPS-Programm mit Visualisierung mittels ProSys, Einholen der<br />
Angebote, Kostenrechnung, Dokumentation inkl. Bedienungsanleitung, Präsentation.<br />
Ergebnis:<br />
Konstruktion der Anlage inkl. aller Zeichnungen, Pläne und Programme<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der Niet dient als Verbindungselement von Kettensägen. Er muss deshalb am Bund<br />
randschichtgehärtet werden, weil auf die gesamte Kette eine enorme Zugkraft wirkt. Zusätzlich<br />
wirkt auch ein enormer Abrieb auf den Nietenbund. Durch die relativ hohe Zugkraft muss der Kern<br />
des Niet weich bleiben. Daher ist es wesentlich, eine Randschichthärtung durchzuführen.<br />
- 62 -
Schule:<br />
HTBLuVA St. Pölten<br />
Waldstraße 3<br />
3101 St. Pölten<br />
Tel.: 02742/750 51-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Automatische Nietenhärtung<br />
Gesamtanlage (3D-CAD)<br />
Projektpräsentation<br />
Ausblase-<br />
Einheit<br />
Induktiv-<br />
Härtung<br />
Positioniereinheit nach<br />
dem Vereinzeln<br />
Rundtakttisch<br />
Klinkenrad<br />
Klinke<br />
Zylinder<br />
Beweglicher<br />
Anschlag am<br />
Drehrad<br />
Fixer<br />
Anschlag<br />
Druckfeder<br />
- 63 -
Schule:<br />
HTL Fulpmes<br />
Waldrasterstraße 21<br />
6166 Fulpmes<br />
Tel.: 05225 / 62250<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Photovoltaikanlage<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: HF5 Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung: Höhere Abteilung für Maschinenbau - Fertigungstechnik<br />
Projektbetreuer: Dipl.-Ing. Florian Mair<br />
Projektteam: Anton Plank, Günther Schranz<br />
Projektpartner: Firma Manet Beyond Systeme GmbH / Innsbruck<br />
Dauer: von 20.08.2001 bis 29.05.2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Die Firma Manet Beyond plant die Herstellung und den Vertrieb eines Photovoltaiksystems,<br />
welches zu entwickeln ist.<br />
Zielsetzung:<br />
Es soll eine Photovoltaikanlage entwickelt werden, die baukastenförmig aufgebaut und im Design<br />
sehr ansprechend zu sein hat. Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:<br />
· Aufnahme der Photovoltaikplatten<br />
· Lagerung der Aufnahme<br />
· Anbindung der Lagerung an verschiedene Fassaden<br />
· Fixe und variable Winkeleinstellung der Photovoltaikplatten<br />
Ablauf:<br />
Sobald das Projektteam sich zusammengefunden hatte, ein Projektbetreuer gefunden war und die<br />
Aufgabenstellung vorlag, stellten wir ein Pflichtenheft auf. Den Konstruktionsaufwand teilten wir je<br />
nach Auslastung auf, beziehungsweise arbeiteten wir Hand in Hand. Die Konstruktion war Anfang<br />
Februar 2002 beendet. Danach erstellten wir ein Prospekt, das für Präsentationen und den Vertrieb<br />
genutzt wird. Während der Arbeit schrieben wir die Dokumentation. Anschließend wurde eine<br />
Bildschirmpräsentation zu Werbezwecken angefertigt. Zum Abschluss wurde die inzwischen<br />
gefertigte Anlage am 18. Juni 2002 am Firmengebäude von Fiegl&Spielberger in Innsbruck der<br />
Öffentlichkeit präsentiert. Aus diesem Anlass reiste sogar eine Delegation bestehend aus<br />
Journalisten und Firmenvertretern von BP aus Wien per Flugzeug an.<br />
Ergebnis:<br />
Die von uns entwickelte Anlage erfüllt alle geforderten Funktionen und ist vom Design her auf<br />
einem anspruchsvollem Level. Sie dient der Firma Manet Beyond als Einstieg in eine neue<br />
Marktnische.<br />
- 64 -
Schule:<br />
HTL Fulpmes<br />
Waldrasterstraße 21<br />
6166 Fulpmes<br />
Tel.: 05225 / 62250<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Photovoltaikanlage<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die Anlage wurde vom Projektbetreuer Dipl. Ing. Florian Mair und von unserem Ansprechpartner,<br />
dem Eigentümer der Firma Manet Beyond, Herrn Hubert Elmer, für gut befunden. Die Anlage ist<br />
bereits gefertigt und in Betrieb.<br />
Herr Ing. Peter Rathgeber von der<br />
Wirtschaftskammer Tirol mit den<br />
beiden Preisträgern Plank Anton<br />
und Günther Schranz bei der<br />
Überreichung des ersten Preises<br />
des Wettbewerbes<br />
„PRO-WIRTSCHAFT-TIROL“<br />
Gesamtansicht der Fassade bei<br />
Fiegl&Spielberger in Innsbruck<br />
mit Photovoltaikanlage<br />
- 65 -
Schule:<br />
HTL Weiz<br />
Dr.-Karl-Widdmann-Straße 40<br />
8160-Weiz<br />
Tel.: 03172/4550<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte Projektdaten<br />
Motoroptimierung<br />
Abteilung: Maschinenbau<br />
Jahrgang / Klasse: 5M Schuljahr: 2001/2002<br />
Projektbetreuer: DI Hartmut Kuch<br />
Projektteam: Stefan Stocker, Khai Vidmar<br />
Projektpartner: -<br />
Dauer: von 1.Oktober 2001 bis 10.Mai 2002<br />
Problemstellung:<br />
Der Oldtimer Zweizylinder-Boxermotor eines Citroen 2CV weist für seine geringe Leistung einen<br />
hohen Kraftstoffverbrauch und hohen Schadstoffausstoß auf.<br />
Zielsetzung:<br />
Der Motor soll heutigen Anforderungen an Wirkungsgrad und Abgasgehalt angenähert werden.<br />
Neben der Erprobung von Vergaservarianten soll eine Umstellung auf elektronisch gesteuerte<br />
Benzineinspritzung und Zündungssteuerung vorgenommen werden.<br />
Zusätzlich ist ein kompletter Aufbau des schuleigenen Motorprüfstandes gefordert. Die<br />
Datenerfassung und –verarbeitung soll zur Gänze computerunterstützt erfolgen.<br />
Ablauf:<br />
Nach dem Erstellen von Prüfstandskonzepten und Optimierungsvorschlägen wurde der<br />
Motorprüfstand mit dem Versuchsmotor aufgebaut und mit Messtechnik bestückt.<br />
Mit ersten Testläufen folgte die Analyse des Motoristzustandes.<br />
Anschließend wurde mit Optimierungsmaßnahmen und dem Bau der Multipoint-Einspritzung<br />
begonnen. Weiters wurde die Motorsteuerung programmiert und die Anlage in Betrieb genommen.<br />
Es folgte ein abschließender Vergleich verschiedener Gemischbildungs- und Zündsysteme.<br />
Ergebnis:<br />
Voll funktionsfähiger moderner Motorprüfstand mit computerunterstützter Datenerfassung und<br />
Datenverarbeitung.<br />
Durch die Multipointeinspritzung konnte eine Vergleichmäßigung der Gemischbildung, eine<br />
Senkung des Kraftstoffverbrauches, ein Drehmomentzuwachs im mittleren Drehzahlbereich sowie<br />
eine Verbesserung der Abgaswerte erreicht werden.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der moderne Prüfstand ermöglicht anspruchsvolle Motorexperimente. Vollelektronisches<br />
Motormanagement und Einspritzung dienen der Umweltverträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit<br />
von Oldtimerfahrzeugen.<br />
- 66 -
Schule:<br />
HTL Weiz<br />
Dr.-Karl-Widdmann-Straße 40<br />
8160-Weiz<br />
Tel.: 03172/4550<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Motoroptimierung<br />
Abteilung: Maschinenbau<br />
Jahrgang / Klasse: 5M Schuljahr: 2001/02<br />
Projektleiter: DI Hartmut Kuch<br />
Diese Diplomarbeit behandelt das Optimieren eines Oldtimermotors sowie den Aufbau eines<br />
kompletten Motorprüfstandes und der dazugehörigen Messtechnik.<br />
Gegenstand des Projektes ist der luftgekühlte Zweizylinder-Boxermotor des Citroen 2CV. Er sollte<br />
hinsichtlich Kraftstoffverbrauch, Leistung und Abgasemissionen optimiert werden.<br />
Für den Prüfmotor musste ein spezieller Motorprüfstand errichtet werden.<br />
Der mechanische Aufbau dieses Prüfstandes besteht aus der hydraulischen Leistungsbremse, dem<br />
Motor mit allen Halterungen und der Verbindungswelle mit Flanschen. Der messtechnische Aufbau<br />
umfasst die gesamte Sensorik und die Vernetzung der einzelnen Messsysteme. Die Datenerfassung<br />
und Auswertung erfolgte zum größten Teil computerunterstützt mit modernsten Messsystemen der<br />
Firma AVL.<br />
Nach Aufbau des Prüfstandes folgten die Kalibrierung aller Messsysteme und erste Testläufe, bei<br />
denen der Motor mit originaler Gemischbildung und Zündung untersucht wurde. Erste<br />
Optimierungsmaßnahmen behandelten die Variation originaler Vergaser und deren Bedüsungen.<br />
Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf dem Umbau des Vergasermotors zu einer Gemischbildung<br />
mittels Multipoint-Saugrohreinspritzung. Dazu wurde der Einlasstrakt umkonstruiert. Eine<br />
Drosselklappe und elektrische Einspritzdüsen vor den Einlassventilen ersetzen den Vergaser. Ein<br />
frei programmierbares vollelektronisches Motormanagementsystem der Firma Haltech übernimmt<br />
die Steuerung von Einspritzung und die Zündung. Die notwendigen Steuerkennfelder wurden am<br />
Prüfstand erarbeitet.<br />
Die Resultate aller Optimierungsmaßnahmen<br />
wurden<br />
in Motorkennfeldern dargestellt<br />
und anschließend<br />
verglichen. Es zeigten sich die<br />
Auswirkungen verschiedener<br />
Gemischbildner und Zündsysteme<br />
in Leistungs-,<br />
Verbrauchs- und Abgasverhalten.<br />
Durch die<br />
Multipointeinspritzung konnte<br />
eine Vergleichmäßigung der<br />
Gemischbildung, eine Senkung<br />
des Kraftstoffverbrauches, ein<br />
Drehmomentzuwachs im<br />
mittleren Drehzahlbereich,<br />
sowie eine Verbesserung der<br />
Abgaswerte erreicht werden.<br />
- 67 -
Schule:<br />
HTBL Ferlach<br />
Schulhausgasse 10<br />
A-9170 Ferlach<br />
Tel.: 0463/5812<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Lern-u. Übungssystem-Waffenkunde für die<br />
Jägerausbildung<br />
Jahrgang / Klasse: 5AHW Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en): Maschineningenieurwesen: Ausbildungszweig Waffentechnik<br />
Projektbetreuer: Prof. OStR. Dipl.-Ing. Peter EGGER, Prof. Mag. Felix PUKLUKAR<br />
Projektteam: Martin GESINGER, Marc GORITSCHNIG, Patrick KARASIN,<br />
Florian PILZ, Alexander SCHÖNLIEB<br />
Projektpartner: Kärntner Jägerschaft<br />
Dauer: von 09/2001 bis 06/2002<br />
Problemstellung:<br />
Voraussetzung für die Ausstellung einer Jagdkarte ist die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung zum<br />
Nachweis der jagdlichen Eignung vor einer Prüfungskommission der Kärntner Jägerschaft. Bei<br />
dieser Prüfung werden entsprechende Kenntnisse unter anderem in Waffenkunde, Munitionslehre,<br />
Ballistik, Waffenoptik, Schiesswesen und Grundzüge des Waffengesetzes verlangt. Zur Aneignung<br />
dieses Wissens werden von verschiedenen Institutionen Vorbereitungskurse abgehalten.<br />
Zielsetzung:<br />
Diese Arbeit soll eine Abstimmung der Lehrinhalte unter den verschiedenen Kursen und der<br />
Prüfungskommission der Kärntner Jägerschaft bringen und eine interaktive Lernhilfe in Form einer<br />
CD-Rom für die auszubildenden Jung- bzw. Aufsichtsjäger sein. Damit soll auch ein wertvolles<br />
Nachschlagwerk für die verschiedenen Themenbereiche geschaffen werden.<br />
Ablauf:<br />
Auf der Suche nach einem geeignetes Projekt für eine Diplomarbeit wurde die Idee entwickelt ein<br />
Lernsystem für die Jägerausbildung zu erstellen.<br />
In Absprache mit den Verantwortlichen der Kärntner Jägerschaft wurde ein Konzept für den Inhalt<br />
der Arbeit entwickelt. Danach erfolgte die Aufteilung der Aufgaben- und Themenbereiche auf das<br />
Projektteam.<br />
Die ersten Ausarbeitungen erfolgten in handschriftlicher Form, in weiterer Folge auf dem<br />
Personalcomputer unter Anwendung des Textverarbeitungsprogramms Microsoft WORD.<br />
Abschließend wurden die einzelnen Stoffgebiete mit Hilfe des Programms FRONTPAGE auf eine<br />
CD-Rom programmiert.<br />
Der Aufbau entspricht dem einer HTML-Seite, welche sich über jeden Internet Explorer öffnen<br />
lässt.<br />
Ergebnis:<br />
Ist eine CD-Rom für das interaktive Lernen der auszubildenden Jäger, wie auch eine visuelle<br />
Unterstützung für die Referenten beim Vortrag.<br />
Durch Anklicken eines gewünschten Themenbereiches auf der linken Bildschirmseite öffnet sich<br />
automatisch die gewählte Skriptseite mit den dazugehörigen Bildern und Erklärungen. Mit dem<br />
rechts am Bildschirm liegenden Schieberegler kann auf die nächste bzw. vorige Seite geblättert<br />
werden. Ebenso ist es auch möglich den Inhalt dieser Arbeit in Form eines Skriptums auszugeben.<br />
- 68 -
Schule:<br />
HTBL Ferlach<br />
Schulhausgasse 10<br />
A-9170 Ferlach<br />
Tel.: 0463/5812<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte Projektpräsentation<br />
Lern-u. Übungssystem-Waffenkunde für die<br />
Jägerausbildung<br />
Verwertbarkeit:<br />
Nach einer Präsentation dieser Lernhilfe im Jägerhof Mageregg vor hochrangigen Vertretern der<br />
Kärntner Jägerschaft, der Jagdprüfungskommission und allen Kursleitern wurde diese Arbeit als<br />
hervorragendes Hilfsmittel für die Jägerausbildung anerkannt.<br />
Die Kärntner Jägerschaft hat den einzelnen Kursleitern in den Bezirken je ein Exemplar zum<br />
Kennenlernen zur Verfügung gestellt.<br />
- 69 -
Schule:<br />
HTL – Salzburg<br />
Itzlinger Hauptstraße 30<br />
A – 5022 Salzburg<br />
Tel.: 0662-453610<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
2 Komponenten Spritzgusswerkzeug mit Einlegeteilen<br />
Jahrgang / Klasse: 4BM - Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Höher Abteilung für Berufstätige- Maschineningenieurwesen<br />
Projektbetreuer: Prof. Dipl.- Ing. Stefan Knippitsch, Prof. Dipl.- Ing. Dr. H. Ottmann<br />
Projektteam: Karl Pichler, Martin Lindner, Thomas Forthofer<br />
Projektpartner: FCI Mattighofen<br />
Dauer: von Okt. 2001 bis April 2002<br />
Problemstellung:<br />
Es werden immer mehr Bauteile, die bislang aus Metall, vornehmlich aus Aluminiumspritzgruß,<br />
Stahl und gesintertem Stahl gefertigt wurden, durch technische Kunststoffe ersetzt.<br />
In der Automobilindustrie werden auch kritische Bauteile zunehmend substituiert.<br />
Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Kunststoffen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften.<br />
Deshalb liegt die Idee nahe, die besten Eigenschaften der unterschiedlichen Kunststoffe<br />
miteinander zu kombinieren.<br />
Diese Technik ist auch nicht neu und heißt 2K-Technik. 2K steht dabei für „zwei Komponenten“.<br />
Da die Prüfungen und Tests in der Automobilindustrie sehr streng und aufwendig sind und der<br />
Hersteller bei einer Fehlfunktion mit kostenaufwendigen Rückholaktionen rechnen muss, gibt es<br />
bislang kaum Betriebe, die sich diese Technik zu Nutze gemacht haben.<br />
Zielsetzung:<br />
Diese Diplomarbeit wird in Zusammenarbeit mit der Firma FCI Mattighofen durchgeführt.<br />
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, einen Bauteil zu entwerfen, mit dem man die gängigsten und<br />
wichtigsten qualitativen Versuche, die von der Automobilindustrie vorgeschrieben sind<br />
durchführen kann.<br />
Weiters ist ein Spritzgusswerkzeug zu konstruieren, mit dem man das Bauteil anschließend<br />
realisieren kann.<br />
Die dabei gewonnen Erkenntnisse sollen anschaulich in Tabellenform festgehalten und für die<br />
Weiterentwicklung neuer Teile in Zweikomponententechnik verwendet werden<br />
Ablauf:<br />
Der terminliche Ablauf des Projektes wurde in Zusammenarbeit mit der Firma FCI vereinbart.<br />
Das Gesamtprojekt wurde in drei Aufgabenbereiche unterteilt:<br />
· die Entwicklung des Bauteiles bzw. der Bauteile<br />
· die Konstruktion des Spritzgusswerkzeuges<br />
· die Fertigungsunterstützung und die Ausarbeitung und Betreuung der Versuche<br />
- 70 -
Schule:<br />
HTL – Salzburg<br />
Itzlinger Hauptstraße 30<br />
A – 5022 Salzburg<br />
Tel.: 0662-453610<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
2 Komponenten Spritzgusswerkzeug mit Einlegeteilen<br />
Jahrgang / Klasse: 4BM - Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Höher Abteilung für Berufstätige- Maschineningenieurwesen<br />
Projektbetreuer: Prof. Dipl.- Ing. Stefan Knippitsch, Prof. Dipl.- Ing. Dr. Horst Ottmann<br />
Ergebnis:<br />
Die Ergebnisse des Projektes waren für uns sehr aufschlussreich und riefen eine sehr große<br />
Resonanz bei der Firma FCI hervor. Mit diesen Ergebnissen, die bereits bei der Weiterentwicklung<br />
neuer Teile mittels 2-Komponenten-Technik mit Einlegeteilen verwendet werden, wird sich die<br />
Firma FCI ihren innovativen Technologievorsprung und Marktanteil auch für die Zukunft sichern<br />
können.<br />
Weiters wurde auch ein großer Bericht bei der konzerninternen technischen Zeitschrift<br />
InterConnection veröffentlicht. Diese Zeitschrift wird weltweit ausgeliefert und von ca. 50.000<br />
Menschen gelesen.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Mit Hilfe von Zweikomponententechnik kann man zwei Arbeitsverfahren zu einem Verfahren<br />
vereinen. Durch diese Technik wird die Herstellungszeit der Teile verkürzt. Weiters werden<br />
Kosten gespart, da ein aufwendiges Zwischenlagern der Teile während der Arbeitsschritte<br />
vermieden wird. Die 2K-Technik ist auch mit einer Qualitätssteigerung verbunden, da es kaum<br />
Umwelteinflüsse zwischen den Arbeitsschritten gibt (Verschmutzungen). Durch diese<br />
innovativen Arbeitstechniken kann sich der Projektpartner in Zukunft möglicherweise einen<br />
Wettbewerbsvorteil verschaffen.<br />
- 71 -
Schule:<br />
Linzer Technikum<br />
Paul Hahn Straße 4<br />
A-4020 Linz<br />
Tel.: 0732/770301<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
SOLARDUSCHE<br />
Jahrgang / Klasse : 5AHM Schuljahr 2001/2002<br />
Abteilung :<br />
Höhere Lehranstalt für Maschinenbau, Tagesschule<br />
Projektbetreuer: Prof. Dipl. Ing. Rudolf Hametner<br />
Projektteam:<br />
Hackhofer Martin, Mayrhofer Johannes, Riepl Mario<br />
Projektpartner: Labor Buchrucker , 4100 Ottensheim<br />
Dauer: Mai 2000 – Juni 2001<br />
Problemstellung:<br />
Es ist ein Gerät zu entwickeln, welches Warmwasser zum Duschen in öffentlichen Freibadeanlagen<br />
sowie in privaten Schwimmbädern aufbereitet. Die Dusche soll außerdem in der Lage sein , die<br />
während eines Sonnentages aufgenommenen Wärme zu speichern und im Bedarfsfall zu einem<br />
späteren Zeitpunkt zum Duschen zur Verfügung zu stellen.<br />
Die Wassertemperaturen zum Duschen sollen hierbei je nach persönlichem Temperaturempfinden<br />
frei einstellbar sein. Die Solardusche soll außerdem gänzlich ohne Einsatz von Fremdenergie<br />
funktionieren.<br />
Zielsetzung :<br />
Planung und Bau eines Prototyps , welcher den o.a.<br />
Anforderungen gerecht wird. Das<br />
Leistungsvermögen der Solardusche ist durch<br />
Messungen am Prototyp darzustellen.<br />
Ein sehr wesentlich Punkt in der Konzeption dieser<br />
Solardusche waren weiters die hohen Ansprüche in<br />
Bezug auf das individuelle Design. Dadurch sollte<br />
ein einzigartiges, noch nie da gewesenes Produkt<br />
auf Markt gebracht werden.<br />
Ablauf :<br />
· Planung und Erstellen von Lösungsvarianten<br />
nach fertigungstechnischen und<br />
wirtschaftlichen Aspekten.<br />
· Computerunterstütze Berechnungen und<br />
Konstruktionen<br />
· Fertigungsüberwachung<br />
· Qualitätskontrolle - Messungen<br />
· Enddokumentation<br />
Verwertbarkeit :<br />
Einsatz für Bäder im privaten Bereich sowie für<br />
kleinere Freibäder von Hotel- oder<br />
Beherbergungsanlagen .<br />
- 72 -
Schule:<br />
Linzer Technikum<br />
Paul Hahn Straße 4<br />
A-4020 Linz<br />
Tel.: 0732/770301<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
SOLARDUSCHE<br />
Ein einzigartiges Produkt, das von der Idee bis zur<br />
Serienfertigung im Zuge einer Diplomarbeit realisiert<br />
wurde.<br />
Ziel dieser Diplomarbeit war es, in Zusammenarbeit mit der<br />
Firma Labor Buchrucker eine Solardusche aus Edelstahl für<br />
den privaten Schwimmbadbereich zu entwickeln, welche<br />
als Energiequelle ausschließlich die Sonne nützt.<br />
Eine Besonderheit dieser Solardusche ist es, dass der<br />
Umlauf des Wassers im Kollektor ausschließlich auf dem<br />
Prinzip der Eigenzirkulation basiert. Weiters wurde der<br />
Warmwasserspeicher über der Dusche so isoliert, dass die<br />
Wassertemperatur auch über längere Zeit, beispielsweise<br />
die Nacht, gehalten werden kann.<br />
Große Anforderungen wurden auch an die Optik gestellt.<br />
Erst nach vielen Entwürfen sind wir zu dem Design<br />
gekommen, nach dem auch schließlich gefertigt wurde.<br />
Gefertigt wurde der Prototyp im Werk der Firma<br />
Buchrucker zur Gänze aus Edlestahl. Die Messungen von<br />
Kollektorleistung, Wassertemperatur und Eigenzirkulation<br />
wurden bei uns am LiTec durchgeführt.<br />
Dies war eine der wenigen Diplomarbeiten, deren<br />
Entwicklung letztendlich auch wirklich in Serienfertigung<br />
gehen wird. Unterstützt wurden wir bei unserer Arbeit von Herrn Mag. Buchrucker und seinen<br />
Mitarbeitern und unserem Projektbetreuer Dipl. Ing. Rudolf Hametner.<br />
Temperatur-Profil für Warmwasser<br />
Auftriebs- Widerstands- Diagramm<br />
- 73 -
Schule:<br />
HTL Braunau<br />
Osternberger Straße 55<br />
A-5280 Braunau<br />
Tel.: 07722 83690<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Schwenkarmroboter (SCARA)<br />
Jahrgang / Klasse: 5MT Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung: Mechatronik<br />
Projektbetreuer: DI Hans Plasser, FOL Günter Huber<br />
Projektteam: Franz Bachinger, Martin Bruckbauer<br />
Dauer: von September 2001 bis Juni 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Es soll ein SCA - Robot - Arm für definierte Arbeitsbedingungen entwickelt, konstruiert und<br />
gefertigt werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Kosten der verwendeten Komponenten<br />
zu legen.<br />
Zielsetzung:<br />
Entwicklung eines neuen SCARA – Konzeptes mit Billigantrieben. Die Steuerung soll durch einen<br />
Mikrokontroller, der laufend mit einem PC kommuniziert, erfolgen. Im Sinne der<br />
Kostenminimierung soll die Einsatzmöglichkeit von Sinterlagern geprüft werden.<br />
Ablauf:<br />
· Wahl der Antriebe<br />
· Dimensionierung der Lager<br />
· Erstellung eines 3D Modells, Ableitung der Fertigungsunterlagen<br />
· Materialbeschaffung<br />
· Fertigung der Bauteile in den Werkstätten der HTL<br />
· Entwurf und Fertigung der Schaltungen<br />
· Erstellung der Programme für Mikrokontroller und PC<br />
· Tests mit verschiedenen Verfahrwegen<br />
· Dokumentation<br />
· Präsentation<br />
Ergebnis:<br />
Es wurde ein voll funktionsfähiger SCARA konstruiert, gefertigt und programmiert. Ständer und<br />
Schwenkarme wurden aus einer gut schweißbaren Al-Mg-Legierung gefertigt. Um den gesamten<br />
Roboter in den Werkstätten der HTL herstellen zu können, wurden hauptsächlich Frästeile<br />
verwendet. Andere Fertigungsverfahren würden eine weitere Kostenreduktion bringen. Als<br />
Antriebe dienen kostengünstige Schrittmotoren in Kombination mit dreistufigen Stirnradgetrieben.<br />
Das Problem des erheblichen Getriebespiels wurde durch entsprechende Federvorspannungen<br />
gelöst. Es wurde völlige Spielfreiheit erreicht. Als Lagerungen wurden entsprechend dimensionierte<br />
Sinterlager eingebaut. Trotz Federvorspannung und größerer Reibung werden durch das hohe<br />
Drehmoment der Antriebe brauchbare Beschleunigungswerte erreicht. Auch bei kleinen Winkelgeschwindigkeiten<br />
treten keine stick–slip Effekte auf. Wegen der Verwendung von Schrittmotoren<br />
konnte auf Positionsgeber ganz verzichtet werde. Referenzschalter und Endschalter<br />
- 74 -
Schule:<br />
HTL Braunau<br />
Osternberger Straße 55<br />
A-5280 Braunau<br />
Tel.: 07722 83690<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Schwenkarmroboter (SCARA)<br />
Jahrgang / Klasse: 5MT Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung: Mechatronik<br />
Projektbetreuer: DI Hans Plasser, FOL Günter Huber<br />
ermöglichen die Referenzfahrt und vermeiden Kollisionen. Die Steuerung des Roboters erfolgt mit<br />
einem 80C535 Mikrokontroller. Dieser wird durch ein Kommunikationsprogramm, das auf einem<br />
PC läuft, über RS232 laufend mit den Daten eines Schrittfiles versorgt.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der Schwenkarmroboter wird ab dem Schuljahr 2002/03 für die Laborübungen der Mechatronik-<br />
Abteilung verwendet. Er stellt dafür eine ideale Kombination aus mechanischen Bauteilen,<br />
elektronischen Schaltungen und Software dar.<br />
Pro/E Modell des SCARA<br />
Fertiger<br />
Schwenkarmroboter<br />
- 75 -
Schule:<br />
HTBLVA MÖDLING<br />
Technikerstraße 1-5<br />
A-2340 Mödling<br />
Tel.: 02236 408-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Zentriervorrichtung für optische Linsen<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: F5 Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung: Mechatronik-Präzisionstechnik<br />
Projektbetreuer: Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Matzner<br />
Projektteam: Christian Leeb, Clemens Mandl, Markus Ully<br />
Projektpartner: IN-VISION Präzisionsoptik, Guntramsdorf<br />
Dauer: von September 2001 bis Mai 2002<br />
Problemstellung:<br />
Die Qualität von optischen Komponenten (z.B. Objektive für Bildverarbeitungssysteme, Objektive<br />
für Projektoren usw.) ist von der genauen Anordnung mehrerer Linsen und von der Lage ihrer<br />
optischen Achse abhängig. Beim Verkitten von Linsen ist es besonders wichtig, dass ihre optischen<br />
Achsen so genau wie möglich zusammenfallen. Deshalb erfolgt die Verkittung von Linsen auf<br />
speziellen Vorrichtungen, die die genaue Zentrierung dieser Linsen ermöglicht.<br />
Für das Messen des sogenannten Flächenkippwinkels bei rotierenden Linsen sollen ein Laser und<br />
ein zweidimensionaler PSD-Sensor (Position Sensitive Devices) mit einer aktiven Fläche von<br />
10 x 10 mm eingesetzt werden. Dazu wird der Laserstrahl entlang der Achse der Linsenaufnahme<br />
durch das zu prüfende Linsensystem gelenkt, der dann im Zentrum des darunter montierten PSD-<br />
Sensor auftrifft. Das erzeugte Ausgangssignal des Sensors soll durch ein Computerprogramm<br />
erfasst und verarbeitet und der daraus folgende Flächenkippwinkel auf einem Monitor graphisch<br />
dargestellt werden. Die Messgenauigkeit des Systems muss unter 10 Winkelsekunden liegen.<br />
Zielsetzung:<br />
Entwicklung, Konstruktion und Fertigung einer Zentriervorrichtung für Linsen von 5 bis 110 mm<br />
Außendurchmesser.<br />
Ablauf:<br />
In den Mechatronikwerkstätten der HTBLVA Mödling wurden zwei Prototypen gefertigt und<br />
montiert. Die Kosten wurden vollständig von der Firma IN-VISION getragen.<br />
Ergebnis und Verwertung:<br />
Ein Gerät wird in einem Reinraum der Firma IN-VISION, welche im Bereich Entwicklung und<br />
Herstellung von hochgenauen optischen Systemen tätig ist, zur Anwendung kommen. Das zweite<br />
Gerät wurde der Schule zur Verfügung gestellt und wird im Werkstätten- und Laborunterricht<br />
verwendet.<br />
- 76 -
Schule:<br />
HTBLVA MÖDLING<br />
Technikerstraße 1-5<br />
A-2340 Mödling<br />
Tel.: 02236 408-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Zentriervorrichtung für optische Linsen<br />
Bei diesem Projekt wurde eine neuartige Methode zum<br />
Zentrieren von Linsen beim Verkitten entwickelt.<br />
Verkittete („verklebte“) Linsen findet man heute in fast<br />
allen optischen Systemen (von den Hubble Teleskopen bis<br />
zum Feldstecher), da sie auf Grund ihrer optischen<br />
Eigenschaften diverse Abbildungsfehler, bei kurzer<br />
Baulänge, ausgleichen können. Es gibt zwar Geräte, die<br />
für das Zentrieren und Verkitten von Linsen verwendet<br />
werden können, jedoch weisen diese nur eine sehr<br />
schlechte Adaptierfähigkeit bezüglich verschiedener<br />
Linsendurchmesser auf. Weiters sind die<br />
Anschaffungskosten dieser Vorrichtungen bei geringer<br />
Genauigkeit sehr hoch.<br />
Abbildung: Messprinzip mit Laser, Linsenhalterung,<br />
Antrieb und PSD-Sensor schematisch dargestellt.<br />
Die vom Projektteam entwickelte,<br />
hochgenaue, patentrechtlich geschützte<br />
(Patentanmeldung März 2002),<br />
feinjustierbare Linsenaufnahme, welche<br />
von einem neuartigen Messsystem<br />
unterstützt wird, ermöglicht eine<br />
hochgenaue Zentrierung und<br />
Verkittung von Linsen mit einer bisher<br />
nicht erreichten Genauigkeit.<br />
Bei der Konstruktion wurde auf<br />
Multifunktionalität sowie Handhabung<br />
bei höchster Genauigkeit besonders Wert<br />
gelegt. Durch den einfachen und robusten<br />
Aufbau ist die Durchführung einer<br />
etwaigen Nachjustierung auch für nicht<br />
spezialisierte Arbeitskräfte möglich.<br />
Weiters wurde auch die Möglichkeit eines<br />
weiteren Ausbaus der Vorrichtung<br />
vorgesehen. Durch die Portalbauweise<br />
des Gestells der Vorrichtung wäre sogar<br />
eine Integration in ein Förderbandsystem<br />
möglich.<br />
Abbildung: Gesamte Prüfvorrichtung mit<br />
Messelektronik und UV-Lampe zur Aushärtung<br />
des Kitts nach dem Zentriervorgang<br />
der Linsen.<br />
- 77 -
Schule:<br />
HTBL Hallein<br />
Davisstraße 5<br />
5400 Hallein<br />
Tel.: 06245/80163<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Optimierung eines Common-Rail-<br />
Zahnradförderpumpendeckels<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: 4AW Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en):<br />
Höhere Abteilung für Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Projektbetreuer:<br />
Dipl.-Ing. Robert Vasak; Dipl.-Ing. Albrecht Kohler<br />
Projektteam:<br />
Erich Hirscher , Ralph Kovacic<br />
Projektpartner:<br />
Robert Bosch AG Hallein<br />
Dauer: von Juni 2001 bis Juni 2002<br />
1. Aufgabenstellung:<br />
Es soll das Herstellverfahren des Deckels von Zahnradförderpumpen für ein Common-Rail-<br />
Einspritzsystem optimiert werden.<br />
Folgende Punkte sind zu erarbeiten:<br />
• In dem gewählten oder optimierten Herstellverfahren muss die derzeit vorliegende<br />
Qualität gewährleistet sein.<br />
• Bei einem alternativen Herstellverfahren müssen gegebenenfalls die Spezifikation<br />
(Zeichnungen, Werkstoff-Bestellvorschrift, usw.) erarbeitet werden.<br />
• Der derzeitige Einkaufspreis der Deckel muss um 20% reduziert werden.<br />
• Die benötigte Kapazität von ca. 4 Millionen Deckeln muss abgesichert werden.<br />
2. Ist - Zustand:<br />
Die Rohteile der Deckel werden derzeit durch Stanzen aus einem Aluminium-Blech hergestellt. Die<br />
gestanzten Rohteile werden nachfolgend gefräst, gebohrt, geschliffen, gebürstet und später<br />
hartanodisiert. Der derzeitige Einkaufspreis liegt bei € 3,40. Da die vorliegenden Vorausplanzahlen<br />
einen extremen Anstieg zeigen, müsste in weitere Maschinen bei den derzeitigen Zulieferanten<br />
investiert werden.<br />
3. Soll - Zustand:<br />
Ziel ist es, die Deckel durch günstigere Herstellverfahren zu produzieren, um Kosten zu sparen und<br />
gleichzeitig die geforderten Kapazitäten zu schaffen. Qualität und Funktionen müssen beibehalten<br />
werden.<br />
- 78 -
Schule:<br />
HTBL Hallein<br />
Davisstraße 5<br />
5400 Hallein<br />
Tel.: 06245/80163<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projektpräsentation<br />
Optimierung eines Common-Rail-<br />
Zahnradförderpumpendeckels<br />
4. Durchführung:<br />
Nachdem die Zeichnungen für die Druckguss-Variante fertiggestellt waren, wurden Anfragen bei<br />
Druckgießern gestartet. Die Angebotspreise waren wie erwartet weit unter den derzeitigen<br />
Einkaufspreisen. Durch diese Feststellung musste das Projekt schneller als geplant umgesetzt<br />
werden. So entstand eine Vorserienlösung. Parallel dazu wurde ein Serienkonzept erarbeitet. Der<br />
anfangs geschätzte Zeitaufwand für dieses Projekt wurde dadurch wesentlich höher als geplant.<br />
5. Ergebnis:<br />
Durch die rasche Umsetzung des Vorserienkonzeptes setzte die Phase der Einsparung bereits früher<br />
ein als geplant. Der Einkaufspreis wurde ab Januar 2002 von € 3,40 auf € 2,036 reduziert. Eine<br />
weitere Reduzierung findet ab 01.07.2002 durch die Umsetzung des Serienkonzeptes statt<br />
(Zusatzziel). Der Einkaufspreis wird dadurch auf € 1,65 reduziert. Durch die benötigte Menge von<br />
ca. 1,5 Millionen Deckeln im Jahr 2002 bedeutet dies eine Kostenreduzierung von € 989.582,- bis<br />
01.07.2002 und € 1.269.625,- für die zweite Jahreshälfte.<br />
Gesamteinsparung: € 2.259.207,-<br />
Zahnradförderpumpe (Explosionsdarstellung):<br />
Deckel<br />
- 79 -
Schule:<br />
HTL Dornbirn<br />
Höchsterstrasse 73<br />
A-6851 Dornbirn<br />
Tel: 05572/3883<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Webunterstützte Koordination<br />
internationaler Vermarktungspläne<br />
Jahrgang / Klasse: 5HWI Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Wirtschaftswesen Betriebsinformatik<br />
Projektbetreuer: Dipl. Phys. Ulrich Radzieowski<br />
Projektteam: S. Bitschnau, C. Lecher, M. Menghin<br />
Projektpartner: Zumtobel Staff GmbH – Dornbirn – Hr. Mag. C. Mathis<br />
Dauer: von 09/2001 bis 04/2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Im Rahmen des Markteinführungsprozesses von Neuprodukten werden durch die diversen<br />
Marketingmanager international abgestimmte Vermarktungspläne (Kommunikations-Mix)<br />
erarbeitet und implementiert. Bisher war die Koordination zwischen den einzelnen, dezentralen<br />
Marketingabteilungen nur durch Absprache und aufwendige Datenabgleiche möglich.<br />
Ziel ist es, diese Arbeit durch eine intranetfähige Projektplanungssoftware effizienter zu gestalten.<br />
Das Webportal hat die Aufgabe, die Projektkoordination und die Projektplanung zu vereinfachen<br />
und für jeden Mitarbeiter zugänglich zu machen.<br />
Zielsetzung:<br />
· Aufbau eines Webportals zur Koordination internationaler Vermarktungspläne der Firma<br />
Zumtobel Staff Abteilung Produktmarketing.<br />
· Integration der Software in das Firmennetzwerk unter Einhaltung aller Vorgaben der<br />
Informatik- Abteilung<br />
· Entwurf der User- Interfaces nach ISO 9241 Teil 10<br />
· Einhaltung des Corporate Design eines Web-Interface von Zumtobel Staff<br />
· Software Entwurf nach der Methode der Strukturierten Analyse (SA)<br />
· Einführung der Software im Produktmarketing Dornbirn<br />
Ablauf:<br />
· Analyse der Abläufe, Strukturen und Marketing-Prozesse<br />
· Erstellung eines detaillierten Software-Pflichtenheftes<br />
· Freigabe durch Zumtobel Staff auf Basis des Software-Pflichtenheftes<br />
· Umsetzung des Pflichtenheftes und Entwicklung der Softwarepakete<br />
· Einführung der Software und Einweisung in das Webportal<br />
Ergebnis:<br />
Auf Basis eines detaillierten Pflichtenheftes wurde der Auftrag zur Entwicklung des Webportals<br />
erteilt. Die softwaretechnische Umsetzung erfolgte daraufhin innerhalb von 6 Wochen.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die Software findet heute Einsatz im Produktmarketing der Zumtobel Staff GmbH.<br />
- 80 -
Schule:<br />
HTL Dornbirn<br />
Höchsterstrasse 73<br />
A-6851 Dornbirn<br />
Tel: 05572/3883<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Webunterstützte Koordination<br />
internationaler Vermarktungspläne<br />
- 81 -
Schule:<br />
HTL Vöcklabruck<br />
Bahnhofstrasse 42<br />
4840-Vöcklabruck<br />
Tel. 07672/246050<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Flächendruckmessung von Langlaufschiern<br />
Jahrgang / Klasse: 5WMA Schuljahr: 2001 / 2002<br />
Abteilung(en): Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Projektbetreuer: DI Dr. S. Gründl<br />
Projektteam: Christian Breitwieser, Mark Gattermann<br />
Projektpartner: Fischer Ges.m.b.H, Ried<br />
Dauer: von Juni 01 bis Mai 02<br />
Problemstellung:<br />
Von der Firma Fischer wurde im Jahr 2001 ein Gerät zur Flächendruckmessung an der<br />
Lauffläche des Langlaufskis zugekauft. Die an uns übertragene Aufgaben waren vorerst, uns auf<br />
der Maschine einzuarbeiten und in weiterer Folge die gewonnenen Messergebnisse auszuwerten<br />
und mögliche Einflüsse heraus zu filtern bzw. die Messmaschine zu optimieren.<br />
Zielsetzung:<br />
• Einarbeitung in das Messsystem (Soft- u. Hardware)<br />
•• Interpretation der Messergebnisse<br />
• Auflistung diverser Einflussgrößen<br />
• grobe Sollwertermittlung<br />
• Eichungs- u. Prüfanweisung<br />
• Entscheidungsgrundlage für Ausbau liefern<br />
• Marketingargumente<br />
Ablauf:<br />
• Durchführung diverser Messungen an den Skitypen 180 und 190<br />
(um die Messpalette mögl. klein zu halten)<br />
•• Auswertung der gewonnen Ergebnisse<br />
• Versuche zur Ermittlung von Einflussgrößen (Temperatur, zentrale Kraftaufbringung,...)<br />
• Erstellung einer Prüf- bzw. Eichanweisung inkl. Einschulung der zuständigen Mitarbeiter<br />
• Versuche mit dynamischen Messungen<br />
Ergebnis:<br />
Anfangs war seitens Fischer eigentlich nur eine Verwendung des Messsystems in statischer<br />
Hinsicht geplant. Da die dynamische Messung jedoch derart große Vorteile gegenüber der<br />
statischen besitzt, wurde beschlossen, fast ausschließlich dynamisch zu messen. Die statische<br />
Messung bildet jedoch die Grundlage der dynamischen.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Durch den Einsatz der Flächendruckmessung ist die Kraftverteilung an der Lauffläche sehr<br />
gut zu erkennen und es können somit Rückschlüsse auf die Produktentwicklung getroffen<br />
werden.<br />
Das Laufverhalten des Skis kann bereits in der Entwicklungsphase abgeschätzt werden und<br />
auftretende Mängel ausgeglichen werden.<br />
- 82 -
Schule:<br />
HTL Vöcklabruck<br />
Bahnhofstrasse 42<br />
4840-Vöcklabruck<br />
Tel. 07672/246050<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Flächendruckmessung von Langlaufschiern<br />
Digitale Fotos:<br />
Bild links: Druckverteilung unter einem<br />
Langlaufski. Gut ersichtlich ist das sogenannte<br />
Wachsloch in der Mitte, in dem der Ski in der<br />
Gleitphase keinen Schneekontakt haben soll.<br />
Bild unten: Foto der Messmaschine samt<br />
aufgelegtem Ski und Messmatten.<br />
Im oberen Bild ist ein von der Firma Tekscan<br />
stammender Sensor abgebildet, den wir für<br />
unsere Messungen verwendeten. In der linken<br />
Darstellung ist der Aufbau dieses Sensors zu<br />
erkennen.<br />
- 83 -
Schule:<br />
HTBLA Wien 3<br />
Ungargasse 69<br />
1030 Wien<br />
Tel.: 01/7131518<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
W2MC 2 - World Wide Mobile<br />
Communication Center<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: 5HWB Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Höhere Abteilung für Wirtschaftsingenieurwesen - Betriebsinformatik<br />
Projektbetreuer: Mag. Johannes Neuhofer<br />
Projektteam: Jürgen Bis, Christian Freisleben, Jürgen Kral, Bernhard Leutgeb,<br />
Dario Maglov, Wolfgang Schuster<br />
Projektpartner: Topcall<br />
Dauer: von September 2001 bis April 2002<br />
Problemstellung:<br />
Die vielfältigen Möglichkeiten der OTA (Over the Air: MMS, EMS, Smart-Messaging)<br />
Konfiguration von mobilen Telefonen sollen durch eine Web-, bzw. WAP-Applikation mit<br />
folgenden Funktionen veranschaulicht werden:<br />
Terminverwaltung, Adressverwaltung, Profilverwaltung, Klingeltöne, CallerGroupIcons und Logos<br />
Zielsetzung:<br />
Aufbau eines Web- und WAP-Portals basierend auf den Funktionalitäten des SMART- Messaging<br />
Standard für Mobiltelefone.<br />
Implementierung eines Betriebssystemservices mit COM-Interface zur Unterstützung des Wireless<br />
Data Access Protokoll (WDAP) und deren praktischer Einsatz in Office-Paketen und in den<br />
verschiedensten Programmiersprachen (ASP, JavaScript, C++, VB, ...).<br />
Bereitstellen einer komfortablen Programmierschnittstelle mit Hilfe eines COM (Component Object<br />
Model) Objekts, basierend auf standardisierten Schnittstellen der modernen Telekommunikation<br />
TCP/IP, Sockets und AT Command Set for GSM Mobile Equipment.<br />
Speicherung der Userdaten und -Informationen in einem Web-Organizer dessen Basis ein MS SQL<br />
Server 2000 ist.<br />
Arbeitsaufwand:<br />
Im Schuljahr 2000/2001 wurde W2MC 2 in 2.800 Arbeitsstunden realisiert.<br />
- 84 -
Schule:<br />
HTBLA Wien 3<br />
Ungargasse 69<br />
1030 Wien<br />
Tel.: 01/7131518<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
W2MC 2 - World Wide Mobile<br />
Communication Center<br />
Erfolge:<br />
· Cyberscool-Landeswettbewerb: Landessieger Wien,<br />
· Cyberscool-Bundeswettbewerb: 3.er Platz<br />
· Artikel im Standard am 12.6.2002 und 22.6.2002<br />
Projektpräsentation<br />
Generelle Anforderungen:<br />
W2MC² soll der Prototyp einer möglichst leicht zu bedienenden Schnittstelle zwischen Internet und<br />
Mobiltelefon werden, die in erster Linie dazu dient, um Mobiltelefone zu konfigurieren. Kern der<br />
Applikation ist eine C++ Schnittstelle, welche die Verbindung zum Modem herstellt, Daten in die<br />
entsprechenden Formate (Smart Messaging, EMS, MMS) konvertiert und dann über das Modem an<br />
das Mobiltelefon verschickt.<br />
· Die Daten, die diese Schnittstelle an das Modem weiterleitet, soll der Endbenutzer im Zuge<br />
seines Besuches auf WAP- oder Website eingeben können.<br />
· Für autorisierte Benutzer soll es die Möglichkeit geben, mehrere Mobiltelefone auf einmal zu<br />
konfigurieren (um z. B. die Mobiltelefone aller Vertreter eines Unternehmens gleichzeitig auf<br />
einen einheitlichen Standard zu konfigurieren).<br />
· Auch über WAP soll dem Benutzer, soweit sinnvoll, die Konfiguration seines Mobiltelefons<br />
bzw. die Bearbeitung seiner Daten ermöglicht werden.<br />
· Durch das standardisierte COM-Interface soll der einfache Einsatz anhand von Office-<br />
Applikationen demonstriert werden.<br />
- Verschicken von Adressbucheinträgen aus dem Firmennetz in das Handy-Adressbuch des<br />
Mitarbeiters.<br />
- Übertragen der Terminplandaten des Unternehmens in die Kalenderfunktionen des Handys.<br />
- 85 -
Schule:<br />
HTL Steyr<br />
Schlüsselhofgasse 63<br />
A-4400 Steyr<br />
Tel.: (07252) 72914<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Testmustergenerator TPG 02<br />
Jahrgang / Klasse: 4E Schuljahr: 2001/02<br />
Abteilung(en):<br />
Fachschule für Elektronik<br />
Projektbetreuer:<br />
FOL Ing. Franz Brunner<br />
Projektteam:<br />
Nursel Türkmen, Alois Zangl<br />
Dauer: von 01/2002 bis 05/2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Die Erfahrungen im Konstruktionsunterricht der vierten Klassen und Jahrgänge haben gezeigt, dass<br />
die Anforderung an die Schüler, ihre Hardware- und Software-Entwicklungen über das<br />
Entwurfstadium hinaus auch zur Funktion zu bringen, einen wesentlichen Beitrag zum<br />
Erfolgserlebnis leisten kann. Entsprechende Aufgabenstellungen verlangen dem Elektronikdesigner<br />
neben Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit vermehrte Verantwortungsbereitschaft für das<br />
gelieferte Ergebnis ab. Dem betreuenden Lehrer fällt die Aufgabe zu, für ausreichende<br />
Testmöglichkeiten auch schon in der Entwicklungsphase zu sorgen.<br />
Zielsetzung:<br />
Im Rahmen des FTKL-Unterrichtes der Fachschule für Elektronik wurde im Schuljahr 2001/02 die<br />
Idee geboren, einen vielseitig einsetzbaren Generator zu konzipieren, der mehrere, leicht<br />
abänderbare Testmuster für digitale Systeme liefern kann und zudem einfach handhabbar ist. Die<br />
Umsetzung dieser Idee entspricht den Möglichkeiten in der Fachschule, anhand kleiner, dafür aber<br />
überschaubarer und in der verfügbaren Zeit realisierbarer Aufgabenstellungen fachübergreifenden<br />
Projekt-Unterricht zu praktizieren.<br />
Ablauf:<br />
Bei der Realisierung des Testpatterngenerators TPG02 sollen die Schüler einige Phasen des<br />
Produktdesigns samt dazugehöriger Höhen und Tiefen erleben.<br />
Ergebnis:<br />
Entwickelt wurde ein auf dem Microcontroller PIC16F84 basierendes Testgerät für individuelle<br />
Digitalentwicklungen, welches sich neben erstaunlich niedrigem Preis (ca. 20 €) durch einfache<br />
Handhabung, flexible Einsatzmöglichkeiten und gefälliges Design auszeichnet.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der Testgenerator wurde erstmals im Rahmen der Projektarbeit des Jahrganges 5BHE im Juni 2002<br />
erfolgreich eingesetzt. Für die Entwicklung und den Funktionsnachweis eines Bitstream-Analyzers<br />
lieferte der TPG02-Modul umschaltbare Bitmuster, die den Datenstrom in einem Rechner-Netzwerk<br />
einfach und doch möglichst realistisch simulieren können.<br />
- 86 -
Schule:<br />
HTL Steyr<br />
Schlüsselhofgasse 63<br />
A-4400 Steyr<br />
Tel.: (07252) 72914<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projektpräsentation<br />
So gingen die Schüler ans Werk:<br />
Testmustergenerator TPG 02<br />
Ø Pflichtenhefterstellung<br />
Ø Hardwareentwicklung<br />
Ø Softwareerstellung<br />
Ø Fertigung<br />
Ø Inbetriebnahme<br />
Ø Dokumentation<br />
Bedienelemente:<br />
... und auch das Gehäusedesign ist Teil der Aufgabenstellung.<br />
Taste P (Programm) => Umschaltung zwischen vier verfügbaren Mustern<br />
Taste S (Start) => Start der Mustergenerierung<br />
Taste R (Reset) => Definierter Beginn durch System-Reset<br />
Die Verbindung zum zu testenden System erfolgt über ein 8-poliges Flachbandkabel, über welches<br />
der Testgenerator auch seine Versorgung erhält. In der folgenden Anwendung werden zunächst nur<br />
zwei (von 6) Signalleitungen verwendet. Das folgende Oszillogramm verdeutlicht anhand eines<br />
vorgegebenen Testmusters eine Einsatzmöglichkeit von TPG02:<br />
Datenleitung SDAT:<br />
Ein serieller Datenstrom besteht aus unterschiedlichen,<br />
willkürlich gewählten Bitmustern.<br />
In weiterer Folge soll z.B. ein<br />
FPGA-basierender Bitstream-Analyzer die<br />
Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten<br />
Bitkombination feststellen.<br />
Taktleitung SCLK<br />
Die Taktgewinnung aus dem Datenstrom<br />
wird dem Entwickler in dieser Applikation<br />
erspart. Der Testgenerator liefert Taktsignale,<br />
die jedes Bit auf der Datenleitung quittieren.<br />
In einer nächsten Ausbaustufe von TPG 02 ist mit folgenden Erweiterungen zu rechnen:<br />
Ø Programmänderungen sind in der Schaltung möglich (In-System-Programming)<br />
Ø Testmuster stehen nicht im Source-Code, sondern im internen Daten-EEPROM<br />
Ø Versorgung nicht nur vom Device Under Duty (DUT), sondern auch autark möglich<br />
- 87 -
Schule:<br />
HTL Rankweil<br />
Negrellistrasse 50<br />
6830 Rankweil<br />
TEL:: 05522-42190<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Distanzmessgerät auf Ultraschallbasis<br />
Abteilung:<br />
Fachschule für Elektronik<br />
Jahrgang / Klasse: 4 FN<br />
Projektbetreuer Schwarz Karl Werner<br />
Projektteam:<br />
Filipovic Slavco, Mathies Lukas, Ströhle Marcel<br />
Projektpartner: Sommer Messtechnik, Koblach<br />
Dauer: Oktober 2001 bis Mai 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Es wurde uns seitens der Fa. Sommer – Messtechnik, die Möglichkeit einer Entwicklung<br />
eines Ultraschallmessgerätes für Netz- und Inselbetriebes, als Teilentwicklung einer<br />
meteorlogischen Messstation gegeben. Die geforderte Messdistanz sollte ca. 30m und die<br />
Genauigkeit +/- 2mm betragen. Die Messfrequenz war auf Grund des zu verwendenden<br />
Ultraschallgebers mit 30 kHz vorgegeben. Das Gerät sollte in einem vorgegebenen Gehäuse mit<br />
einer 5-stelligen LCD-Anzeige mit allen erforderlichen Bedienungselementen entwickelt sowie mit<br />
der gesamten Dokumentation im vorgegebenen Zeitraum (Ende Mai) 2002 geliefert werden.<br />
Zielsetzung:<br />
Es ist im Zuge des FTKL- und Werkstättenunterrichtes ein Abstandsmessgerät für Distanzen bis 30<br />
Meter im Ultraschallbereich (30kHz) für diffuse Oberflächen (Schnee, Eis etc.) zu entwickeln, zu<br />
dimensionieren, zu konstruieren, aufzubauen, zu dokumentieren und seinen Entwicklungsanteil bei<br />
der Abschlussprüfung in einem 15-minütigen Vortrag vorzustellen.<br />
Ablauf:<br />
Schaltungs- und Gerätekonzept 1. Entwurf 15. 12. 2001<br />
Schaltpläne, Layout, Stücklisten, Gehäusekonstruktion. Ende 1. Semester<br />
Sämtliche Konstruktionsunterlagen: Printentwurf,<br />
Gehäuse, Schaltpläne, Stücklisten, Bestellungen,<br />
Dokumentation ( in gebundener Form) und Kalkulation 15.05.2002<br />
Ergebnis:<br />
Das Gerät wurde bis auf die µC- gesteuerte Anzeigeeinheit fertiggestellt. Die Hauptprobleme<br />
entstanden durch nicht ausreichende Programmierkenntnisse in C+ und das Handhaben von Micro-<br />
Controllern in der Fachschule. Für die Fa. Sommer Messtechnik wurde das Ziel erreicht, da durch<br />
den neuen Ultraschallgenerator in Power-MOS-Technik mit einer Sendeleistung von ca. 1 kW<br />
sowie den hochselektiven und hochempfindlichen Empfangsteil für 30kHz, für sie völlig neue<br />
Möglichkeiten in dieser Art von Messtechnik eröffnet wurden.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Dieses Gerät wird zur Messung von Schneehöhen, Schneeverfrachtungen und zur<br />
Bewegungserfassung von Berghängen etc. verwendet und ist ein Teil einer meteorologischen und<br />
geologischen Messdatenerfassungsanlage.<br />
- 88 -
Schule:<br />
HTL Rankweil<br />
Negrellistrasse 50<br />
6830 Rankweil<br />
TEL:: 05522-42190<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Distanzmessgerät auf Ultraschallbasis<br />
Abteilung:<br />
Jahrgang / Klasse:<br />
Projektbetreuer<br />
Fachschule für Elektronik<br />
4 FN<br />
Schwarz Karl Werner<br />
Nach der Erklärung der Aufgabenstellung durch den Betreuer und einer gemeinsamen<br />
Einarbeitungsphase, welche sich eingehend mit der Erzeugung, Ausbreitung, Messung und der<br />
Verarbeitung von Ultraschall und seinen vorgegebenen Wandlern befasste, wurden die anstehenden<br />
Einzelaufgaben in drei Gruppen zusammengefasst und den einzelnen Schülern als Projektarbeit<br />
zugeteilt, welche sie im Verlaufe des Schuljahres im Team zu lösen hatten.<br />
So wurde Slavko Filipovic die Entwicklung des 30kHz Generators in Power-MOS Technik<br />
sowie die Entwicklung der PWM Ansteuerschaltung mittels des PWM Bausteines ST 3525A<br />
zugeteilt.<br />
Mathies Lukas wurde mit der Entwicklung des Eingangsfilters und der Signalaufbereitung bis zur<br />
Übergabe an die Anzeigeeinheit sowie der Entwicklung des Netzteiles betraut und musste auf<br />
Grund der schaltungstechnischen Zwänge sehr stark mit Filipovic zusammenarbeiten, da sie mit<br />
erreichen höherer Sendeleistung ( ca. 1 kW) und höherer Selektion, Rauscharmut und hoher<br />
Verstärkung ( ca. A = 4500-10.000), die Gesamtempfindlichkeit der Schaltung entscheidend<br />
beeinflussten und das Entwicklungsziel, eine Messempfindlichkeit bis 30m zu erreichen, eine nicht<br />
zu unterschätzende Herausforderung für Fachschüler der 4. Klasse darstellte.<br />
Ströhle Marcel hatte sich für die Entwicklung der µP-unterstützten Auswertung (AT89C52) und<br />
der Anzeige mittels einer 2 x 16 Charakter LCD Anzeige von Hitachi ( HD44780 ) entschieden. Er<br />
übernahm auch die dazugehörige Programmierung des MCU.<br />
Die Aufgabe war für dieses Team eine besondere Herausforderung, da sich die Schüler in großen<br />
Bereichen auf absolutem Neuland bewegten und einer starken Unterstützung durch den Betreuer<br />
bedurften. Das Gerät wurde bis zum Schulschluss bis auf die Programmierung, welche sich<br />
hartnäckig weigerte ihren Dienst aufzunehmen, fertig entwickelt, konstruiert sowie dokumentiert<br />
und vereinbarungsgemäß der Firma Sommer-Messtechnik übergeben, welche der Schule nach<br />
eingehender Prüfung und Adaption in ihre Messstation ein fertiges Gerät übergeben wird. Die<br />
Lehrziele der Schule, praxisbezogene Fähigkeiten, wie Teamwork, Schaltungstechnik,<br />
Konstruktion, Messtechnik und Dokumentation sowie eine Aufgabe bis zum Ende durchzuziehen,<br />
wurden sehr gut erfüllt.<br />
- 89 -
Schule:<br />
HTL-Innsbruck<br />
Anichstraße 26-28<br />
6020 Innsbruck<br />
Tel.: 0512-59717<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Problemstellung:<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Für eine elektrisch angetriebene Markise soll eine vollautomatische Steuerung in Hinsicht auf<br />
Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Sonne zum Schutz der Markise selbst, sowie des zu<br />
beschattenden Objektes, konzipiert und ausgelegt werden.<br />
Ebenso ist ein funktionstüchtiger Prototyp zu planen und für die Simulation herzustellen.<br />
Zielsetzung:<br />
Erstellung eines Demonstrationsobjektes für SPS-gesteuerte Markisenfunktionen.<br />
Ablauf:<br />
§ Erstellen eines Konzeptes sowie Netzplanes für das gesamte Projekt.<br />
§ Anfertigen der gesamten System-, Schalt- und Baupläne für die Herstellung der Steuerung,<br />
§ Herstellen des Prototyps der Steuerung sowie den Aufbau in Zusammenhang mit einer<br />
Markise für die Präsentation<br />
§ Eine Kostenkalkulation mit genauer Stückliste sowie den Arbeitsaufwand.<br />
Ergebnis:<br />
Funktionsfähiger Prototyp<br />
Verwertbarkeit:<br />
Markisensteuerung<br />
Jahrgang / Klasse: FE4 Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en):<br />
Elektrotechnik<br />
Projektbetreuer:<br />
Ing. Werner Mair, Ing. Hubert Margreiter<br />
Projektteam:<br />
Bernhard Nuener, Martin Gumpesberger<br />
Projektpartner:<br />
Dauer: von 02/2002 bis 05/2002<br />
Als Übungsobjekt im Werkstätten und Laborbetrieb.<br />
- 90 -
Schule:<br />
HTL-Innsbruck<br />
Anichstraße 26-28<br />
6020 Innsbruck<br />
Tel.: 0512-59717<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Markisensteuerung<br />
Projektpräsentation<br />
Realisierung verschiedener Steuerungsmöglichkeiten:<br />
Automatikbetrieb<br />
In diesem Modus fährt die Markise aus, wenn es in dem zu beschattenden Raum zu heiß wird.<br />
Diese Funktion setzt voraus, dass der Thermostat eingestellt ist und die Sonne scheint.<br />
Die Markise fährt ein, wenn der am Thermostat eingestellte Wert unterschritten wird. Die Markise<br />
fährt auch bei Regen oder einer Windstärke, bei der die Markise Schaden nehmen könnte, ein.<br />
Handbetrieb<br />
Durch das Umschalten in den Handbetrieb wird das automatische Ausfahren bzw. das Einfahren<br />
gestoppt – jedoch nicht, wenn die Markise aufgrund zu starken Windes oder Regens einfährt!<br />
Im Handbetrieb ist die Möglichkeit gegeben, durch Drücken der Tasten ‚Auf’ und ‚Ab’ die Markise<br />
selbst ein- und ausfahren zu lassen. Auch hier wird das Ausfahren im Falle zu starken Windes oder<br />
Regens unterbrochen und die Markise wird selbstständig eingefahren. Durch den Handbetrieb ist es<br />
möglich, dass die Markise jede beliebige Position einnimmt.<br />
Betriebszeiten<br />
Für beide Betriebszustände gilt nach unserer Programmierung, dass die Markise um 22:00 Uhr<br />
einfährt und erst um 7:00 Uhr wieder ausgefahren werden kann. Die beiden Uhrzeiten können<br />
jederzeit verändert werden.<br />
- 91 -
Schule:<br />
HTL Holztechnikum Kuchl<br />
Markt 136<br />
A-5431 Kuchl<br />
Tel.: 06244/5372-0<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte Projektdaten<br />
Dämpfen von Nadelschnittholz<br />
Jahrgang / Klasse: 4 FS Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Fachschule Holzwirtschaft und Sägetechnik<br />
Projektbetreuer: DI. Herwig Gütler; Mag. Dietmar Juriga; DI. Erwin Treml<br />
Projektteam: Herbert Irnberger , Hubert Sageder<br />
Projektpartner: REMA Massivholzplattenwerk Niedernfritz<br />
Dauer: von Juni 2001 bis Mai 2002<br />
Problemstellung und Zielsetzung:<br />
Die Fa. Rettenegger mit Sitz in Niedernfritz (Plattenwerk) und Bischofshofen (Hobelwerk)<br />
produziert hauptsächlich mehrschichtige Massivholzplatten als Halbfertigprodukt für Türen,<br />
Möbelbau und als Fassadenplatten im Holzbau.<br />
Die Firma ist erst seit kurzer Zeit im Besitz einer Dämpfkammer und hat daher wenig bis gar keine<br />
Zeit um Versuche, über Auswirkungen des Dämpfens auf verschiedenste Holzeigenschaften,<br />
durchzuführen.<br />
Technologische Zielsetzung:<br />
Es sollten die Auswirkungen der Dämpfbedingungen auf technologische Eigenschaften (wie z.B.<br />
Festigkeits- und Härteeigenschaften, Schwindverhalten des Holzes sowie Farbveränderungen in<br />
Abhängigkeit von der Dämpfzeit für die Holzarten Fichte, Kiefer, Lärche und Douglasie) untersucht<br />
werden.<br />
Wirtschaftliche Zielsetzung:<br />
Es werden die Einflüsse der Dämpfdauer auf die Produktionskosten, unter Berücksichtigung der<br />
Wirtschaftlichkeit, ermittelt.<br />
Es werden Kostenvergleiche für 90, 140, 260 und 400 Dämpfstunden durchgeführt. Die ermittelten<br />
Daten dienen als Grundlage für die Produktkalkulation für mehrschichtige Massivholzplatten.<br />
- 92 -
Schule:<br />
HTL Holztechnikum Kuchl<br />
Markt 136<br />
A-5431 Kuchl<br />
Tel.: 06244/5372-0<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte Projektpräsentation<br />
Dämpfen von Nadelschnittholz<br />
Jahrgang / Klasse: 4 FS Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Fachschule Holzwirtschaft und Sägetechnik<br />
Projektbetreuer: DI. Herwig Gütler; Mag. Dietmar Juriga; DI. Erwin Treml<br />
Projektablauf:<br />
Nachfolgend wird der Projektablauf anhand wichtiger Meilensteine dargestellt:<br />
a) Literaturrecherche<br />
August/September 2001<br />
b) Durchführung der Dämpfversuche<br />
Oktober 2001 bis Januar 2002<br />
c) Durchführung der Prüfungen (Festigkeiten, Härte, Schwindverhalten)<br />
November 2001 bis Februar 2002<br />
d) Auswertung per EDV sowie Dokumentation der Ergebnisse<br />
November 2001 bis April 2002<br />
e) Interpretation der Ergebnisse und Fertigstellung der Dokumentation<br />
März 2002 bis Mai 2002<br />
Kurzdarstellung der Ergebnisse der Projektarbeit:<br />
Die Druckfestigkeit sowie die Biegefestigkeit nehmen bei Nadelschnittholz mit zunehmender<br />
Dämpfzeit ab.<br />
Bei der Härteprüfung sowie bei den Schwinduntersuchungen ergab sich kein wesentlicher<br />
Unterschied von ungedämpftem zu gedämpftem Nadelschnittholz.<br />
Im Rahmen der Produktkalkulation stellte sich heraus, dass mit zunehmender Dämpfzeit die<br />
Dämpfkosten steigen (z.B. Im Vergleich zu 90 Dämpfstunden steigen die Kosten bis auf 400<br />
Dämpfstunden um 61,6%), was bei der Preisgestaltung der Endprodukte zu berücksichtigen ist.<br />
Verwertbarkeit der Projektergebnisse:<br />
Da die Firma Rettenegger erst seit rund 1,5 Jahren im Besitz einer Dämpfkammer ist und noch<br />
wenig Erfahrungen über die Auswirkungen unterschiedlicher Dämpfzeiten auf technologische<br />
Eigenschaften gemacht hat, wird der Firma diese Arbeit sicher hilfreich sein.<br />
Außer den Festigkeitsprüfungen wurde auch eine Produktkalkulation bei verschiedenen<br />
Dämpfzeiten durchgeführt.<br />
Dies wird der Buchhaltung der Firma sicher etwas nutzen, da eine Produktkalkulation in diesem<br />
Ausmaß bei der Firma Rettenegger bislang noch nicht durchgeführt wurde.<br />
Die Farbbeurteilung bei den unterschiedlichen Dämpfzeiten wurde ebenfalls noch nie untersucht<br />
und dokumentiert. Durch die Dokumentation der Farbunterschiede kann jedem Kunden rasch eine<br />
Vorstellung der unterschiedlichen Farbgebungen mitgeteilt werden, was diesem eine Erleichterung<br />
der Kaufentscheidung ermöglicht.<br />
- 93 -
Schule:<br />
HTL Fulpmes<br />
Waldrasterstraße 21<br />
6166 Fulpmes<br />
Tel.: 05225 / 62250<br />
Technikerprojekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projektdaten<br />
Konfektions- und Verpressvorrichtung<br />
Jahrgang / Klasse: FF4 Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung: Fachschule für Maschinenbau - Fertigungstechnik<br />
Projektbetreuer: FL Martin Wilberger<br />
Projektteam: Alexander Birnleitner, Hannes Beiler, Hans Höck<br />
Projektpartner: Elektro Terminal / Innsbruck<br />
Dauer: von 06.12.01 bis 15.05.2002<br />
Problemstellung:<br />
Es sind zwei unabhängige Vorrichtungen zu konstruieren und zu fertigen: erstens die Verpress-<br />
Vorrichtung, welche fünf Kontaktschneiden in ein vorgegebenes Kunststoffteil einzupressen hat<br />
und zweitens die Konfektionsvorrichtung, die anschließend das mit Kontaktschneiden versehene<br />
Kunststoffteil mit fünf Endlosdrähten zu verbinden hat.<br />
Zielsetzung:<br />
Es sind zwei voneinander unabhängige Verpressvorrichtungen mit dazugehörigem Gestell<br />
herzustellen, welche von Hand bestückt werden und vollautomatisch verpressen sollen. Zusätzlich<br />
ist eine Bedienungsanleitung in deutscher und englischer Sprache verlangt, da die Werkzeuge in<br />
einer Produktionsstätte in New Jersey / USA eingesetzt werden sollen.<br />
Ablauf:<br />
Zuerst erhielten wir einen Prototyp und die Zeichnung des Spritzgussteiles. Nach einer Phase der<br />
Ideenfindung konzentrierten wir uns auf die Konfektionsvorrichtung. Als diese Konstruktion<br />
abgeschlossen war wendeten wir uns der Verpressvorrichtung und dem Pressengestell zu. Mit Hilfe<br />
des Auftraggebers und unseres Projektbetreuers konnten wir dann unser Konzept überarbeiten.<br />
Nach erfolgter Auftragserteilung begannen wir mit der Fertigung der Einzelteile.<br />
Ergebnis:<br />
Die von uns hergestellten Vorrichtungen erfüllten die Erwartungen, wobei insbesondere die<br />
Isolierung der Drähte durch das Verpressen so sauber gelöst wurde, dass ein nachträgliches Löten<br />
nicht mehr notwendig war.<br />
- 94 -
Schule:<br />
HTL Fulpmes<br />
Waldrasterstraße 21<br />
6166 Fulpmes<br />
Tel.: 05225 / 62250<br />
Technikerprojekt<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Projektpräsentation<br />
Konfektions- und Verpressvorrichtung<br />
Verwertbarkeit:<br />
Die Vorrichtungen wurden am Projektpräsentationstag, 17.Juni 2002, der Firma Elektro Terminal<br />
vorgestellt und noch während des Sommers 2002 in New Jersey in Betrieb genommen.<br />
Oben: Verpressvorrichtrung<br />
Rechts: Konfektionsvorrichtung<br />
Von links: Betreuer<br />
FL Martin Wilberger,<br />
Höck Hans,<br />
Birnleitner Alexander<br />
und Hannes Beiler mit<br />
ihrer Vorrichtung<br />
- 95 -
Schule:<br />
HTL Braunau<br />
Osternberger Straße 55<br />
A-5280 Braunau<br />
Tel.: 07722 83690<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
EIB Datenkoffer<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Jahrgang / Klasse: 4 FN Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en):<br />
Fachschule Nachrichtentechnik<br />
Projektbetreuer:<br />
FOL Alois Reichhartinger<br />
Projektteam:<br />
Schneeberger Michael<br />
Projektpartner:<br />
Elektro Schneeberger<br />
Dauer: von 13. September 2001 bis 29. Mai 2002<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Um die Vorzüge der EIB- Technik interessierten Kunden auf anschauliche<br />
Weise vorführen zu können, soll ein Demonstrationsaufbau gefertigt und<br />
parametriert werden.<br />
Zielsetzung:<br />
Der Demonstrationsaufbau soll in einem stabilen Koffer untergebracht sein.<br />
Die Ausführung des Ausbaus soll in vorzeigbarer Weise erfolgen.<br />
Es sollen verschiedene Lampen- und Jalousiensteuerungsweisen verführbar sein.<br />
Ablauf:<br />
Einarbeitung in die EIB- Technik, Planung des Aufbaus, Auswahl der<br />
erforderlichen Baugruppen, Zusammenschaltung der Baugruppen,<br />
Parametrierung des EIB-Systems, Funktionsüberprüfung, Auswahl des<br />
geeigneten Koffers, Einbau der EIB- Komponenten in den Koffer, Bearbeitung<br />
und Beschriftung der nötigen Abdeckungen.<br />
Ergebnis:<br />
Fertiger, funktionstüchtiger EIB- Demokoffer<br />
Verwertbarkeit:<br />
Der Demokoffer wird zur Vorführung der EIB- Technik und ihrer<br />
Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Elektro-Installation von der Firma<br />
Schneeberger eingesetzt.<br />
- 96 -
Schule:<br />
HTL Braunau<br />
Osternberger Straße 55<br />
A-5280 Braunau<br />
Tel.: 07722 83690<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
EIB Datenkoffer<br />
Jahrgang / Klasse: 4 FN Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en):<br />
Fachschule Nachrichtentechnik<br />
Projektbetreuer:<br />
FOL Alois Reichhartinger<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektpräsentation<br />
Bild: Ansicht des fertigen EIB-Koffers<br />
- 97 -
Schule:<br />
PHTL Lienz<br />
Linker Iselweg 22<br />
9900 Lienz<br />
Tel.: 04852/72738<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Problemstellung:<br />
Planung, Konstruktion, Fertigung und Zusammenbau eines Stanzwerkzeuges. Mit diesem<br />
Werkzeug sollen 1.5 Mio. Stück Gabelschlüssel pro Jahr hergestellt werden.<br />
Zielsetzung:<br />
Ausführung laut Pflichtenheft<br />
(erstellt von Hr. Bachlechner, Fa. Liebherr)<br />
Einige Eckdaten<br />
Stanzwerkzeug Gabelschlüssel<br />
· Spaltbandbreite festlegen nach Vorlage der<br />
Werkzeugkonstruktion<br />
· Schlüsselausführung laut Vorgabe bzw. Änderungen der<br />
Außenkontur, um Stanzabfälle zu minimieren<br />
· Werkzeugentwurf bzw. Werkzeugaufbau muss für die Freigabe<br />
vorgelegt werden (FP-Liebherr)<br />
· Hubzahlvorgabe 27-34 Hub/min<br />
· Standzeit für Schnittgeometrie 1 Mio. Stk.<br />
· Standzeit Ausführung Werkzeugaufbau 5 Mio. Stk.<br />
· Für die allgemeine Ausführung des Stanzwerkzeuges ist die<br />
Richtlinie für Ausstattung von Schnitt- u. Folgewerkzeuge<br />
gültig<br />
Projektdaten<br />
Jahrgang / Klasse: 4FFA Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Fachschule für Fertigungstechnik<br />
Projektbetreuer: FOL Josef Fuetsch VL Brunner Raimund<br />
Projektteam: Thomas Holzer, Mathias Mair, Sebastian Martinz, Roland Uhsar<br />
Projektpartner: Liebherr-Werk Lienz GmbH<br />
Dauer: von Februar 2002 bis Mai 2002<br />
Ablauf:<br />
Bild: Prototypzeichnung Gabelschlüssel<br />
· Kontaktaufnahme und Besprechung mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Fa. Liebherr-<br />
Werk Lienz mit Besichtigung<br />
· Erstellung einer Machbarkeitsstudie<br />
· Ausarbeitung verschiedener Lösungsvarianten<br />
· Grobplanung<br />
· Vereinbarungen mit dem Kooperationspartner (Bestellungen, Kosten, Bezug der Normteile)<br />
· Feinplanung<br />
· Erstellung normgerechter Einzelteilzeichnungen sowie einer Zusammenbauzeichnung (CAD)<br />
- 98 -
Schule:<br />
PHTL Lienz<br />
Linker Iselweg 22<br />
9900 Lienz<br />
Tel.: 04852/72738<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Stanzwerkzeug Gabelschlüssel<br />
Jahrgang / Klasse: 4FFA Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Fachschule für Fertigungstechnik<br />
Projektbetreuer: FOL Josef Fuetsch VL Brunner Raimund<br />
Projektpräsentation<br />
· Materialorganisation<br />
· Auswahl der Normteile<br />
· Fertigung der Einzelteile mit Qualitätskontrolle<br />
· Zusammenbau und Abstimmungsarbeiten am Stanzwerkzeug<br />
· Funktionsüberprüfung mit Probebetrieb<br />
· Dokumentation<br />
· Präsentation<br />
Ergebnis:<br />
Am 26. April wurde das Stanzwerkzeug zum Probebetrieb ausgeliefert und getestet. Nach<br />
geringfügigen Modifizierungsarbeiten konnte die erste Produktion mit 5000 Stk. Gabelschlüssel<br />
problemlos durchgeführt werden.<br />
Am 04 Juni 2002 wurde dieses Technikerprojekt im Saal der Wirtschaftskammer Lienz öffentlich<br />
präsentiert.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Mit diesem Stanzwerkzeug werden im Liebherr-Werk Lienz Bild: 1.5 Ober- Mio. und Stück Unterteil Gabelschlüssel des 250 kg pro schweren Jahr<br />
hergestellt.<br />
Werkzeuges mit Schnittstreifen und<br />
fertigen Gabelschlüsseln.<br />
Bild: Die Projektgruppe beim<br />
Zusammenbau des Werkzeuges.<br />
- 99 -
Schule:<br />
HTBLA – Hallstatt<br />
Lahnstraße 69<br />
4830 Hallstatt<br />
Tel.: 06134/8214-0<br />
Vorstellung ausgewählter Projekte<br />
Vino in Giro<br />
Jahrgang / Klasse: 4.FT Schuljahr: 2001/2002<br />
Abteilung(en): Fachschule für Tischler<br />
Projektbetreuer: Mag. Spiesberger<br />
Projektteam: Gruber Anton<br />
Projektpartner:<br />
Dauer: von Jänner 2002 bis Mai 2002<br />
Ingenieur -<br />
Techniker -<br />
Projekt<br />
Projektdaten<br />
Problemstellung:<br />
Zielsetzung:<br />
Ablauf:<br />
Lagerung von Weinflaschen samt Gläsern und Zubehör in einem Möbel der<br />
besonderen Art.<br />
Eine neue revolutionäre Idee zur Aufbewahrung von edlen Weinen.<br />
Horizontale Lagerung der Weinflaschen, Etiketten gut lesbar,<br />
leichtes Hantieren bei der Präsentation verpackt in einzigartigen<br />
Design und hervorragender, voll funktioneller Konstruktion.<br />
Maßaufnahme von div. Weinflaschen und Gläsern.<br />
Erarbeiten von Vorentwürfen und Entwurfsplänen.<br />
Gespräche mit einem Winzer und einem Weinhändler.<br />
Nach kleinen Änderungen in Entwurf und Ausführung erfolgt die<br />
Materialbeschaffung und Vorplanung für die Fertigung.<br />
Ergebnis:<br />
Ein neuartiges Weinregal!<br />
Eine edle Materialkombination aus Ahorn, Kirsch und Nirosta.<br />
Pflegeleichte und alkoholbeständige Oberfläche.<br />
Zerlegbar ausgeführt auf Grund der Übergröße und des hohen Gewichtes.<br />
Verwertbarkeit:<br />
Geeignet für die Lagerung und Präsentation von über 100 Weinflaschen.<br />
- 100 -