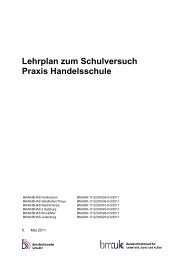LEITFADEN - Berufsbildende Schulen
LEITFADEN - Berufsbildende Schulen
LEITFADEN - Berufsbildende Schulen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Technische und gewerbliche <strong>Schulen</strong><br />
<strong>LEITFADEN</strong><br />
ZUR DURCHFÜHRUNG VON<br />
INGENIEUR/TECHNIKERPROJEKTEN<br />
AN TECHNISCHEN UND GEWERBLICHEN SCHULEN<br />
Oktober 1998
ZUM NACHFOLGENDEN <strong>LEITFADEN</strong><br />
Ingenieur/Technikerprojekte<br />
im Unterricht des technisch-gewerblichen Schulwesens<br />
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Ingenieur/Technikerprojekte stellen eine neue Qualität in der Ausbildung des technischgewerblichen<br />
Schulwesens dar. Sie sind aus einer jahrzehntelangen Tradition gewachsen und<br />
haben sich entsprechend den Bedürfnissen an eine moderne und praxisnahe Ausbildung zu ihrer<br />
jetzigen Gestalt und Erscheinungsform entwickelt. Als wesentliche Neuerungen der jüngsten<br />
Zeit sind dabei vor allem die gezielte Einbindung außerschulischer Partner, die Ausweitung<br />
von Projektdauer und -umfang, sowie die Möglichkeit der Anrechnung bei der Reife- und<br />
Diplomprüfung zu nennen. Dies alles brachte einerseits eine Aufwertung dieses Unterrichtsangebotes,<br />
andererseits aber auch erhöhte Ansprüche und einen deutlichen Mehraufwand mit<br />
sich.<br />
Trotz dieses Mehraufwandes für alle Betroffenen erfreut sich diese spezielle Form der Unterrichtsführung<br />
sowohl bei Schülern als auch bei den Lehrkräften immer größerer Beliebtheit,<br />
die Zahl der durchgeführten Ingenieur/Technikerprojekte steigt ständig. Die Durchführung<br />
von Projekten in der gegenwärtigen Form hat sich nicht nur als äußerst wertvoller Bestandteil<br />
des Unterrichts herausgestellt, der frühzeitig einen realen und konkreten Bezug zur späteren<br />
Berufspraxis herzustellen vermag, sondern der allen Beteiligten auch die Gelegenheit zur verstärkten<br />
individuellen Identifikation mit der erbrachten Leistung gibt.<br />
Was ist ein Ingenieur/Technikerprojekt?<br />
Eine exakte Beschreibung eines ITP ist gar nicht so einfach und eine Darstellung muß daher stets<br />
etwas aufwendig ausfallen. Im nächsten Absatz wird deshalb versucht, in einer Art Definition<br />
die wesentlichen Merkmale zusammenzufassen.<br />
Ein ITP ist eine von einem zwei- bis fünfköpfigen Schülerteam durchzuführende, in sich<br />
geschlossene Arbeit. Das Team steht dabei unter der Leitung eines hauptverantwortlichen<br />
Projektbetreuers, der ein Lehrer mit entsprechender Fachexpertise sein muß. Die Aufgabenstellung<br />
soll industriespezifischen oder gewerblichen Charakter haben und die Durchführung<br />
möglichst in Kooperation mit einem außerschulischen Partner erfolgen. Die Dauer des Projektes<br />
beträgt bei Ingenieurprojekten mindestens 6 Monate, bei Technikerprojekten mindestens<br />
3 Monate während des letzten Ausbildungsjahres 1 . Neben den technischen Aufgaben und Analysen<br />
sollen umweltrelevante Fragestellungen, Aspekte des Produktdesign sowie Kalkulation und<br />
Marketingplanung miteingeschlossen werden. Integrierter Bestandteil eines ITP ist eine<br />
möglichst professionelle Dokumentation und eine gut vorbereitete Präsentation, die sich<br />
moderner Technologien zur Veranschaulichung bedienen soll.<br />
1 . Vorprojekte oder eine Ausweitung in den 4. Jahrgang sind möglich.<br />
Seite 1
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Das zu Grunde liegende pädagogische Konzept<br />
Das pädagogische Konzept ist durch einige wesentliche Prinzipien geleitet, die hier kurz<br />
schlagwortartig angeführt werden sollen:<br />
• Optimale Praxisnähe<br />
• Planung und Umsetzung eines komplexen Projektes<br />
• Schulung der Teamfähigkeit<br />
• Hohe Anteile an Eigenverantwortung für die Schüler<br />
• Individuelles Zeitmanagement der Schüler<br />
• Einbindung moderner Präsentationstechniken<br />
• Freiwilligkeit der Arbeitsleistung<br />
Einschränkende Rahmenvorgaben<br />
Einige einschränkende Rahmenbedingungen sind aber bei der Umsetzung von ITP vorgegeben:<br />
• Ein rechtzeitiger Ausstieg (und Umstieg auf den „klassichen Weg“) muß für den Schüler in<br />
einem sinnvoll vorgegebenen Zeitrahmen (beim Schulversuch „Neue Matura“ etwa Ende 1.<br />
Semester) möglich sein.<br />
• Das Erreichen des vorgegebenen Endzieles ist nicht zwingend Vorraussetzung für den<br />
positiven Abschluß eines Projektes! Hier gilt der Grundsatz: „Der Weg ist das Ziel“. Ein<br />
Schüler kann also durchaus auch eine positive Beurteilung im Projekt erhalten, wenn er<br />
verantwortungsvoll und konsequent gearbeitet hat, das gesteckte Ziel aber aus vom Schüler<br />
nicht zu verantwortenden Gründen (unvorhersehbare technische Probleme, Krankheit,<br />
Materialprobleme, Rechtsprobleme....) nicht erreicht werden konnte.<br />
Aus diesen Vorgaben ergeben sich zwei weitere wesentliche Einschränkungen:<br />
• In Vereinbarungen mit außerschulischen Partnern (schriftlich oder mündlich) können keine<br />
festgesetzten Verpflichtungen eingegangen werden. Dies betrifft sowohl Terminzusagen als<br />
auch allgemeine Erfüllungsverpflichtungen.<br />
• Aus dem gleichen Grunde kann es auch keine vertraglich festgesetzte Abgeltung von<br />
Leistungen geben, da ja ein Abbruch des Projektes aus pädagogischen Gründen immer<br />
möglich sein muß.<br />
Vereinbarungen mit Vertragspartnern können daher immer nur auf der Basis der Freiwilligkeit<br />
getroffen werden. Die Vertragspartner können keine Erfüllungsgarantie für zu erbringende<br />
Leistungen erhalten (auch wenn sein Risiko, wie die Praxis zeigt, äußerst gering ist...).<br />
Es lag nun nahe, einem so weiträumigen Konzept, das in sich fast eine unüberschaubare Zahl an<br />
Möglichkeiten der konkreten Umsetzung bietet, einen Arbeitsbehelf zur Seite zu stellen, der in<br />
erster Linie als Unterstützung und Orientierungshilfe gedacht ist. Das Ergebnis dieses Ansinnens<br />
liegt nun in Form dieses Leitfadens vor.<br />
Aufbau des Leitfadens<br />
In der Folge finden Sie einige Anmerkungen zum Konzept des vorliegenden Leitfadens. Sie<br />
sollen einem besseren Verständnis dienen und einen zielgerechten Einsatz erleichtern.<br />
Seite 2
Zum Stil des Leitfadens<br />
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Der Leitfaden soll in erster Linie als informatives Nachschlagewerk dienen, gleichzeitig aber<br />
auch geeignet sein, gelesen zu werden. Deshalb wurde folgenden Stilelementen der Vorzug<br />
gegeben:<br />
• Übersichtlichkeit<br />
Dem Leitfaden basiert auf einer durchdachten Struktur, die optisch möglichst auf dem ersten<br />
Blick auch erkennbar sein sollte. Aus diesen Grunde wurde hoher Bedacht auf Überschriften,<br />
Einrückungen und unterschiedliche Textformatierungen gelegt.<br />
• Angepaßte Kürze<br />
Ausführlichere Textformulierungen und langatmige Beschreibungen wurden grundsätzlich<br />
vermieden. Das angestrebte Ziel war, wo immer es notwendig war, genauer zu erklären, sonst<br />
aber grundsätzlich sich an eine übersichtliche Kürze zu halten. Sie werden deshalb wiederholt<br />
Textteile in Telegrammstil vorfinden 2 .<br />
• Höchstmaß an allgemeiner Verständlichkeit<br />
Ebenso wurden vielfach Hinweise und Erläuterungen in einer Art freizügigeren „Gebrauchssprache“<br />
dargestellt. Wo immer es zielführend erschien wurden solche Formulierungen<br />
bewußt gewählt, da sie dort unmittelbarer und allgemeinverständlicher den Sinn wiedergeben<br />
als umfangreiche, meist trockene Fachdefinitionen.<br />
Die Ziele des Leitfadens<br />
• Praxisnahe Arbeitsunterlage und Orientierungshilfe<br />
ITPs sind in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt und auch in das Blickfeld der<br />
Öffentlichkeit gerückt. Damit sind aber auch die Ansprüche an die Durchführung gestiegen.<br />
Ein möglichst professionelles "Know how" ist wesentlich, um auch außerhalb des Arbeitsfeldes<br />
der Schule bestehen zu können. Die Durchführung solcher Projekte legt stets einen<br />
deutlichen und vor allem objektiven Maßstab an die Ausbildungsqualität und Fachexpertise<br />
der jeweiligen Schule. Der Leitfaden hat deshalb das Hauptziel, zu helfen, die eigene Professionalität<br />
genau dort zu steigern, wo es an eigener Erfahrung noch fehlt oder diese erst in den<br />
Anfängen steckt.<br />
• Förderung der Vielfalt, zusätzliche Impulse<br />
In den letzten Jahren hat sich österreichweit, meist völlig unabhängig, eine regelrechte<br />
„Projektkultur“ entwickelt, die sich bereits heute durch eine breite Vielfalt auszeichnet.<br />
Durch das Aufzeigen bereits realisierter Ideen und das Darlegen möglichst vieler Beispiele<br />
soll die „Fülle“ in dieser „Projektlandschaft“ noch weiter gefördert werden.<br />
• Information<br />
Zuletzt soll dieser Leitfaden auch dazu dienen zu dokumentieren, was bei der Durchführung<br />
eines ITP wirklich zu leisten ist. Dieser Leitfaden beschreibt letztlich doch recht klar Umfang<br />
und Intensität der notwendigen Arbeiten, ebenso die pädagogischen Zielen, die mit diesem<br />
Konzept verwirklicht werden können. Alleine dem letzten angesprochenen Punkt ist der<br />
gesamte erste Abschnitt gewidmet.<br />
2 So wurde auch im Sinne einer Umfangreduzierung des Textes konsequent für den Begriff<br />
Ingenieur/Technikerprojekte die Abkürzung ITP verwendet.<br />
Seite 3
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Die Zielgruppe(n)<br />
Der vorliegende Leitfaden richtet sich deshalb vorerst grundsätzlich an alle Personen, die in<br />
irgendeiner Form in die Durchführung solcher Ingenieur/Technikerprojekte eingebunden sind,<br />
insbesondere natürlich an die Projektleiter. Darüber hinaus aber auch an alle, die indirekt mit<br />
der Thematik in Berührung kommen. In der Folge der (sicherlich unvollständige) Versuch<br />
einer Aufzählung:<br />
Direkt Betroffene (Arbeitshilfe): Indirekt Betroffene (Information):<br />
Projektleiter Schüler unterer Jahrgänge<br />
Projektbetreuer Eltern<br />
Schüler Andere Lehrer<br />
Direktoren Schulnahe Institutionen<br />
Abteilungsvorstände (Elternverein, Förderungsverein....)<br />
Werkstättenleiter Schulaufsicht (LSI, Maturavorsitzende...)<br />
Firmen (als involvierter Partner) Firmen (als potentielle Partner)<br />
Presse<br />
Die Autoren: der „Arbeitskreis Ingenieur/Technikerprojekte“<br />
Für die Inhalte dieses Leitfaden zeichnet der „Arbeitskreis für<br />
Ingenieur/Technikerprojekte“ verantwortlich, der von der pädagogischen Abteilung des<br />
technisch-gewerblichen Schulwesens des BMUK im Mai 1998 ins Leben gerufen wurde. Vordringliches<br />
Ziel dieses Arbeitskreises war die Erstellung dieses Leitfadens, zu welchem Zweck<br />
der sich selbst wiederum in Untergruppen zur Ausarbeitung der einzelnen Abschnitte unterteilte.<br />
Sie finden in der nachstehenden Aufzählung der Mitglieder in Klammer die jeweilige Kapitelnummer<br />
angeführt:<br />
Seite 4<br />
- Prof. DI Johann Bernkopf (HTL Zeltweg) [ 1]<br />
- AV DI Siegfried Eckart (HTL Braunau) [ 4,5,7 ]<br />
- LSI DI Edith Fenz (LSR Tirol) [ 2,3 ]<br />
- AV DI Erich Fuß (HTL Pinkafeld) [ 1]<br />
- AV RR DI Friedrich Geretslehner (HTL Braunau) [ 4,5,7 ]<br />
- Prof. DI Otto Jagschitz (HTL Rankweil) [ 1]<br />
- DI Jakob Khayat (HTL Wien 3L) [ 1]<br />
- AV DI Carmen Lechner (HTL Wien 1) [ 4,5,7 ]<br />
- DI. Johann Müller (HTL Wr. Neustadt) [ 2,3 ]<br />
- Prof. DI Jerczy Olbrych (HTL Weiz) [ 4,5,7 ]<br />
- AV DI Johann Painold (HTL Graz-Göstig) [ 2,3 ]<br />
- DI Erich Schrottenholzer (HTL Linz Göthestraße) [ 4,5,7 ]<br />
- DI Heinz Spitzauer (HTL Salzburg) [ 2,3 ]<br />
- DI Reinhard Treptow (HTL Wien 22) [ 2,3 ]<br />
- MR Dr. Peter Schüller (BMUK, II/2) [ 6 ]<br />
An dieser Stelle sei allen Mitgliedern des Arbeitskreises für ihre Arbeit und ihren hohen persönlichen<br />
Einsatz beim Entstehen dieses Leitfadens gedankt. Der gleiche Dank gilt auch den<br />
Fachexperten aus den zuständigen Rechtsabteilungen des BMUK (II/B/5 und II/B/16), die bei<br />
der Abfassung des Abschnittes 6 (Rechtsfragen) mitgearbeitet haben.
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Der Arbeitskreis wird mit seiner Fachexpertise auch zukünftig den Themenbereich ITP als<br />
Beratungsgremium betreuen und in alle wesentlichen Entwicklungen eingebunden sein. Er<br />
trifft sich (zumindest) einmal jährlich zu einer zweitägigen Arbeitssitzung.<br />
Anregungen, Ergänzungen<br />
Der Leitfaden versteht sich nicht als abgeschlossenes Werk, sondern als Zwischenschritt in<br />
einem dynamischen Prozeß. Anregungen, Ergänzungen, Mitarbeit und konstruktive Kritik<br />
sind nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht. Nach etwa eineinhalb Jahren (geplant ist<br />
Frühjahr 2000) soll eine revidierte und vor allem ergänzte Auflage erscheinen. Aus diesem<br />
Grunde ist jeder fruchtbare Beitrag, der einer Qualitätsverbesserung oder einer Steigerung der<br />
Angebotsvielfalt dient, willkommen. Kontaktaufnahme in diesem Sinne entweder mit der<br />
Abteilung II/2b BMUK (Schüller) oder mit jedem anderen Mitglied des Arbeitskreises.<br />
Allgemeines<br />
Nachbestellungen<br />
Als initierender Verteilerschlüssel gingen vorerst Exemplare an alle Direktoren und Abteilungsvorstände.<br />
Nachbestellungen sind aber unter der nachstehenden Adresse jederzeit im<br />
Umfang des echten Arbeitsbedarfs möglich:<br />
Peter Schüller<br />
BMUK, Abteilung II/2b; Minoritenplatz 5, A-1014 Wien<br />
Tel.: 01-53120-4465 Fax.: 01-53120-4130<br />
Mail.: peter.schueller@bmuk.gv.at<br />
Ergänzendes Folienmaterial<br />
In den nächsten Wochen (spätestens bis Anfang Dezember) werden die Konzepte dieses Leitfadens<br />
ergänzend auch als Folien zur Verfügung stehen. Es soll damit das Service geboten<br />
werden, daß jeder für Einführungen, Erläuterungen, Besprechungen... rasch und problemlos auf<br />
fertige Folien zugreifen kann.<br />
Diese Folien werden in Form einer PowerPoint Datei angeboten und können in der Abteilung<br />
II/2b angefordert werden. Das Angebot auf Basis PowerPoint hat mehrere Vorteile:<br />
• Übermittlung per E-Mail möglich<br />
• Individuelle Anpassungen rasch und problemlos<br />
• Nur wirklich benötigte Seiten werden gedruckt<br />
• Ausweitung in eine animierte Präsentation problemlos<br />
Die pädagogische Abteilung des Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten<br />
hofft, daß der vorliegende Leitfaden sich als hilfreich und unterstützend erweisen und<br />
auch entsprechend angenommen wird. Er will zur Weiterentwicklung der Ingenieur/Technikerprojekte<br />
bezüglich Qualität, Vielfalt und allgemeiner Bewußtseinsbildung<br />
beitragen. Letztlich sollte er so auch helfen, die Freude am Unterricht und an der eigenen<br />
Leistung weiter zu erhöhen.<br />
Für die Abteilung II/2<br />
Dr. Peter Schüller<br />
Seite 5
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
ABSCHNITT 1: PROJEKTE , FREUDE - QUALITÄT - ZUKUNFT !<br />
An erster Stelle, als erstes Kapitel soll eine Darstellung aller Vorteile stehen, die die Durchführung<br />
solcher Projekte für Schule, Lehrer und Schüler bringt. Diese Darstellung will einerseits<br />
denen, die den ITP skeptisch gegenüberstehen, sachliche Informationen für ein objektives<br />
Urteil geben, andererseits kann sie jenen, die vom Wert der Durchführung solcher Projekte<br />
bereits überzeugt sind, als Argumentationshilfe in Diskussionen oder Verhandlungen hinsichtlich<br />
der Zulassung und Zustimmung eventuell skeptischer Gesprächspartner dienen. Sie können<br />
dieses erste Kapitel aber ruhig auch als Werbung verstehen. Die Verfasser dieses Leitfadens sind<br />
letztlich von der Qualität dieses Unterrichtsangebotes für Schule und Schüler doch so überzeugt,<br />
daß es durchaus berechtigt erscheint, ein wenig Werbung für eine Sache zu machen, die ihrer<br />
Ansicht nach eine neue Qualität in das Unterrichtsangebot bringt.<br />
1.1 Eine neue Qualität in der Ausbildung<br />
Die ITP vermitteln eine Reihe von Kompetenzen in einer Intensität und Qualität, wie es bisher<br />
mit klassischen Unterrichtsformen nur bedingt möglich war.<br />
• Fachkompetenz<br />
ITPs erfordern eine Konfrontation in Theorie und Praxis mit Inhalten, die unmittelbar mit<br />
dem Berufsfeld zusammenhängen und vermitteln so praxisbezogene Fachkompetenz.<br />
• Methodenkompetenz<br />
ITPs machen es erforderlich ausreichend Informationen zu beschaffen, unterschiedliche<br />
Problemlösungen zu überlegen und daraus geeignete Lösungsmethoden auszuwählen,<br />
von denen letztlich der Erfolg des Projektes abhängt.<br />
• Sozialkompetenz<br />
ITPs geben das Bewußtsein von Mitverantwortung (auch der Erfolg der Guppenpartner<br />
hängt von der eigenen Leistung ab) und bedingen so die Bereitschaft zu Kooperation und<br />
Kommunikation, vermitteln also reale Teamfähigkeit.<br />
• Selbstkompetenz<br />
ITPs fördern die Entwicklung der Fähigkeit zur aktivem Lebens- und Berufsgestaltung,<br />
zur Selbstorganisation, zu Eigeninitiative und lassen den Wert freiwilliger Weiterbildung<br />
erkennen.<br />
1.2 Spezielle Didaktik der ITP<br />
Die Durchführung von ITP erfordert in vielen Bereichen eine spezielle Didaktik. Die hinzukommenden<br />
Unterrichts- und Arbeitsformen stellen dabei wichtige Ergänzungen gegenüber<br />
jenen des klassischen Unterrichts dar und können in jeder Hinsicht als Qualitätssteigerung<br />
angesehen werden.<br />
• Prinzip des fächerübergreifenden Unterrichts<br />
Die Durchführung eines ITPs bedingt in vielen Fällen (insbesondere wenn dies sinnvollerweise<br />
Teil des Konzepts ist) ein Aufheben der oft starren Grenzen von Stundentafeln<br />
und Fächergruppen.<br />
• Ausbildung in Kommunikations- und Präsentationstechniken<br />
Dies stellt für das spätere Berufsleben die Vermittlung einer ganz wesentlichen Kompetenz<br />
dar. Doch Achtung, die Präsentation darf nicht Selbstzweck werden!<br />
• Verschiebung vom „lehrerzentrierten“ zum „schülerzentrierten“ Unterricht<br />
Diese Verschiebung, die sich aus der grundsätzlichen Natur eines projektorientierten<br />
Unterrichts ergibt, erwirkt bei den Schülern eine Motivationssteigerung, da diese nach<br />
Seite 6
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Überwinden der ersten Schwellenängste selbst entscheiden und in hohem Maße eigenständig<br />
agieren dürfen.<br />
• „Meisterprinzip“<br />
Da der Hauptbetreuer das ganze Jahr über bei einer Projektgruppe bleibt, erfährt der<br />
Schüler die Bedeutung einer zentralen Ansprechperson, die jederzeit verfügbar ist und die<br />
bei Problemen koordinierend und lenkend eingreift.<br />
• „Team-teaching“, auch durch Lehrer verschiedener Fächergruppen<br />
Neben dem Hauptbetreuer stehen den Projektgruppen gleichzeitig weitere Lehrpersonen<br />
für spezielle Problemlösungen als „Konsulenten“ zur Verfügung.<br />
• alternatives Zeitmanagement<br />
Für eine erfolgreiche Durchführung eines ITPs ist es erforderlich, terminbedingt in den<br />
Stundenplan einzugreifen, so etwa durch Blockung oder Schwerpunktsetzung.<br />
• Arbeiten in der Gruppe<br />
Verschiedene Gruppengrößen und -zusammensetzungen sind möglich, wodurch sich ein<br />
hoher Praxisbezug ergibt. Begabte Schüler haben dabei Freiraum für besondere Leistungen,<br />
durchschnittliche und schwächer Schüler werden „aufgebaut“ und lernen, ihre<br />
Fähigkeiten zu entwickeln.<br />
1.3 Innovationsgehalt von ITP´s<br />
Konkrete Problemlösungen erfordern (und fördern somit) innovatives Denken und Handel bei<br />
den Schülern.<br />
• kreativitätsförderndes Arbeitsklima<br />
Neue Ideen und Ansätze sollten jederzeit willkommen sein. Unbekümmerte, lernwillige,<br />
neugierige junge Menschen und die Erfahrung sowie das Fachwissen der Lehrer ergänzen<br />
sich oft sehr fruchtbar.<br />
• pragmatische Lösungen anstreben<br />
Die Umsetzbarkeit der einzelnen in Betracht gezogenen Schritte ist stets sorgfältig zu<br />
untersuchen. Durch das zielorientierte „Lernen für die unmittelbare Problemlösung“ wird<br />
ein hoher Lernwirkungsgrad erreicht.<br />
• Fehler zulassen - aus Fehlern lernen<br />
Nicht ein mehr oder weniger perfektes Endergebnis, sondern der Weg dorthin ist der<br />
eigentliche Erfolg eines ITPs.<br />
• verschiedene Lösungen zulassen<br />
Die Schülern erkennen, daß Vielfalt sich in der Qualität der Arbeit niederschlägt.<br />
• Recherchen, Quellenstudium<br />
Die Projektgruppen haben zu prüfen, ob das Projektziel mit gleichen oder ähnlichen<br />
Lösungsansätzen bereits einmal erreicht wurde.<br />
• Erfahrungsaustausch<br />
Die Schüler erfahren Sinn und Wert einer sachorientierten Kommunikation (Austausch<br />
und Sicherung von Erfahrungen aus bereits abgewickelten Projekten, Funktion von<br />
Multiplikatoren, Adaptierung der Rahmenbedingungen…).<br />
• Einbindung Neulehrer<br />
Die Einbindung von Neulehrern kann für die Schule doppelten Vorteil bringen. Einerseits<br />
werden diese durch aktiven Einsatz an das lokale Unterrichtsumfeld rascher herangeführt,<br />
andererseits zeigen gerade Neulehrer oftmals extrem hohes Engagement.<br />
• Wechselwirkung mit externen Partnern<br />
Von der Nutzung außerschulischer Ressourcen und dem Know-how beteiligter Firmen<br />
und Institutionen profitieren in der Regel beide Seiten.<br />
Seite 7
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
1.4 Zusammensetzung des Lehrerteams<br />
Es seien hier einige Notwendigkeiten angeführt, die in ihrer Umsetzung nicht immer leicht zu<br />
bewältigen sind, sich aber letztlich in der Regel als ungemein positiv für das Arbeitsklima erweisen.<br />
• Erfordernis einer organisatorischen Struktur<br />
Mit Sorgfalt ist die Auswahl der einzelnen Teammitglieder, der Projektleitung und die<br />
Festlegung von Maßnahmen der Qualitätsicherung zu bewerkstelligen.<br />
• Die Teams sollen zusammenpassen<br />
Es sollte auf fachliche Ergänzung geachtet werden, fächerübergreifende Tätigkeiten<br />
sollen gefördert werden. Über die fachliche Notwendigkeit hinausgehend müssen aber<br />
auch die Menschen harmonieren.<br />
• Erfahrung im Teamwork<br />
Teamarbeit bringt nicht nur wertvolle Erfahrungen für Schüler, sondern durchaus auch<br />
für Lehrer.<br />
1.5 Zusammensetzung der Schülerteams<br />
Bei der Zusammenstellung der Schülerteams gelten ähnliche Rahmenbedingungen wie bei den<br />
Lehrern. Für die Schüler sind aber die Effekte besonders groß, da ein gemeinsames „überlebensnotwendiges“<br />
Ziel Gegensätze überwinden hilft. Angeführt seien hier einige Kriterien für<br />
mögliche Zusammensetzungen, die Entscheidung muß in jedem konkreten Fall nach situationsbezogenen<br />
Rahmenbedingungen und vor allem nach pädagogischen Gesichtspunkten fallen.<br />
• Selbstbestimmung durch die Schüler<br />
Ergibt gruppendynamische Effekte.<br />
• lehrergesteuert (z.B. leistungsheterogen)<br />
Ermöglicht etwa die Einbindung leistungsschwächerer Schüler in ein starkes Team. Es<br />
können aber durchaus auch andere Gesichtspunkte ausschlaggebend sein (soziale<br />
Aspekte…)<br />
• problemorientiert<br />
Die Zusammenstellung der einzelnen Teammitglieder erfolgt nach individuellen Fähigkeiten<br />
in Bezug auf das Projektziel. Jeder Teampartner macht, was er am besten kann.<br />
• Zufallsgruppe<br />
Auch sie soll hier angeführt werden, obwohl sie auf den ersten Blick eher ablehnenswert<br />
erscheint. Es muß aber darauf verwiesen werden, daß sie in der Praxis nicht selten Realität<br />
ist.<br />
1.6 Spezielle Vorteile für Schüler<br />
Wo liegen die besonderen Vorteile für den einzelnen Schüler, der bereit ist, sich der Mühe und<br />
des Aufwandes eines ITPs zu unterziehen. Die Liste ist groß, eine ausführliche Kommentierung<br />
erübrigt sich in den meisten Fällen (oder ist an anderer Stelle zu finden). Kommentare sind nur<br />
dort hinzugefügt, wo sie einem besseren Verständnis dienen.<br />
• individuelle Förderung spezieller Begabungen<br />
• Aneignen von Teamfähigkeit<br />
• Methodenvielfalt der Wissensaneignung<br />
• Erfahrung von Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit<br />
• Heranführen zu zielorientiertem und wissenschaftlich strukturiertem Arbeiten<br />
Ziele werden selbst definiert, Wege zur Umsetzung festgelegt, Termine und Qualitätsvorgaben<br />
müssen eingehalten werden, eine ausführliche Dokumentation von Zwischen-<br />
und Endergebnis ist unerläßlich.<br />
Seite 8
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
• Selbstwertsteigerung<br />
Im Rahmen eines Projektes sind für den Schüler die Eigenleistungen klar erkennbar. Der<br />
„Stolz“ am Ende ist nicht nur berechtigt, er bewirkt letztlich in der Regel eine klare<br />
Steigerung des Selbstwertgefühles.<br />
• Identifikation mit der Aufgabe<br />
Die Möglichkeit der Verwirklichung eigener Ideen (Projektidee, Konzepte, Umsetzung…)<br />
bewirkt eine Identifikation mit der Aufgabe und in der Folge ein hohes Engagement.<br />
• Kontaktaufbau u. -pflege mit Firmen, Behörden, Institutionen<br />
Das frühzeitige Kennenlernen des Branchenumfeldes ist nicht nur für das angestrebte<br />
Berufsziel wichtig, sondern stellt sehr oft auch eine wichtige Entscheidungshilfe für die<br />
weitere Lebensplanung dar.<br />
• Vorteile bei der Stellenbewerbung<br />
Sowohl die Kontakte aus dem ITP als auch der Nachweis der Spezialkenntnisse durch die<br />
Vorlage der Projektergebnisse verschaffen häufig Vorteile gegenüber Mitbewerbern beim<br />
Start in das Berufsleben.<br />
• Präsentationstechniken<br />
Der Schüler muß sich mit allen Formen klassischer und moderner Präsentatiostechniken<br />
auseinandersetzen, wie Rhetorik, Grafische Darstellungen, Einsatz neuer Medien…<br />
1.7 Vorteile für Abteilung und Schule<br />
Aber nicht nur die Schüler, auch die Schule und die Abteilung(en) ziehen Vorteile aus der aufwendigen<br />
Durchführung von ITP.<br />
• Außenwirkung und Öffentlichkeitseffekt<br />
ITPs bewirken einen hohen Werbeeffekt: öffentliche Präsentationen der Projekte, Vorstellung<br />
am Tag der Offenen Tür, Anführen der Projekte in Werbebroschüren, Erwähnung<br />
in außerschulischen Dokumentationen, Verleihung von Preisen.<br />
• Kontaktaufbau u. -pflege mit Firmen, Behörden, anderen wissenschaftlichen<br />
Organisationen<br />
Dies bringt einer Schule nicht nur den schon zuvor angeführten Erfahrungsaustausch,<br />
sondern auch einen erhöhten Stellenwert hinsichtlich anerkannter Fachexpertise..<br />
• Beschaffung von Drittmitteln<br />
Leistungen aus ITPs werden in den meisten Fällen durch Sachspenden an die <strong>Schulen</strong><br />
abgegolten. Darüber hinaus stellen erfolgreich durchgeführte ITPs häufig den Ausgangspunkt<br />
für verschiedene Formen von Sponsoring dar.<br />
• Verbesserung der Praxisnähe in der Ingenieurausbildung<br />
Die Schule kann auf ein hohes Maß an Praxisnähe bei ihrer Ausbildung verweisen<br />
(learning by doing).<br />
• Kollegiales Verhältnis Schüler/Schüler, Schüler/Lehrer und Lehrer/ Lehrer<br />
ITP bewirken soziale Effekte, wie sie bisher eher Erziehungsfeldern wie etwa den Sportwochen<br />
zugeschrieben worden sind. Die menschliche Nähe zwischen den Schülern der<br />
Projektgruppe und den betreuenden Lehrern, bedingt durch das projektorientierte Arbeiten,<br />
fördert Gruppen-, Klassen- und letztlich auch das gesamte Schulklima (positives<br />
Feedback, erhöhte Zufriedenheit…).<br />
• Mögliche Entlastung der Lehrer<br />
In manchen Fällen ist es möglich, durch die flexiblere Zeiteinteilung (Blockung) Entlastungen<br />
für den einzelnen Lehrer zu bewirken. Intensive und extensive Arbeitsphasen<br />
wechseln einander ab, was nicht selten als Vorteil empfunden wird.<br />
Seite 9
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
1.8 Zusätzliche Motivation für beteiligte Projektpartner<br />
Alle bisher aufgezählten Vorteile sind eher meßbar, vordergründig und in gewisser Hinsicht<br />
„argumentsgewichtig“. Es gibt aber auch eine Reihe weiterer Vorteile, die eher als zusätzliche<br />
Motivationen (animierende Begleiterscheinungen) anzusehen sind, aber gerade aus dieser<br />
Sicht in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden dürfen.<br />
• Zertifikat oder Urkunde für erfolgreiche Teilnahme am ITP<br />
Dies könnte zusätzlich zur entsprechenden Erwähnung im Reifeprüfungszeugnis erfolgen<br />
(das Reifeprüfungszeugnis hängt man sich in der Regel nicht an die Wand…).<br />
• Wettbewerbserfolge, Preise<br />
Eine mögliche Teilnahme an einem Leistungswettbewerb bildet einen sowohl ideellen als<br />
auch materiellen Leistungsanreiz.<br />
• Umsetzung eigener Ideen<br />
Der Schüler vermag sich am Ende im Rahmen des erfolgreich abgeschlossenen Projektes<br />
persönlich wiederzufinden. Er kann seine persönlichen Anteile am Projekt nicht nur<br />
erkennen, sondern sogar gegenüber Dritten darauf verweisen.<br />
• Abwechslungsreicher Unterricht<br />
Innovative didaktische Modelle bringen Abwechslung in den Unterrichtsalltag des<br />
Schülern und steigern so die Freude.<br />
• Erarbeitung von Teilen des Projektes auch disloziert möglich<br />
Die oft notwendige lokale Dislozierung gewisser Projektanteile (Firmenlabors, Uni-<br />
Bibliotheken, „training on the job“…) bewirkt bei Schülern faktisch immer einen<br />
Motivationsschub.<br />
• Die 40-stündige Projektarbeit im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung kann<br />
entfallen (Schulversuch „Neue Matura“)<br />
Dies gilt vorerst natürlich nur im Bereich des laufenden Schulversuches „Neue Matura“.<br />
Sollte dies jedoch einmal in das Regelschulwesen übergehen, so stellt dieser Punkt für<br />
eine Teil der Schüler sicherlich ebenfalls einen zusätzlichen Anreiz dar.<br />
1.9 Einsatzmöglichkeiten für moderne (Medien-)Technologien<br />
Hier seien einige Punkte angeführt, die von vorneherein nicht zwingend mit einem ITP verbunden<br />
sind, aber vielfach bereits zur Umsetzung herangezogen werden. Schüler (und auch ihre<br />
Lehrer...) lernen so, die Qualitäten dieser Medien zu nutzen, ihre Probleme zu erkennen, den<br />
notwendigen Aufwand zu schätzen und sie kritisch zu bewerten.<br />
• Internet<br />
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Mediums sind vielfach. Der Bogen spannt sich dabei<br />
von der Informationsbeschaffung (Überregionale und internationale Beiträge zum<br />
Thema) über Gedanken- und Erfahrungsaustausch (andere <strong>Schulen</strong>, Institutionen, auch<br />
international…) bis hin zur Präsentation des abgeschlossenen Projektes.<br />
• Intranet<br />
Lokale (innerschulische) Netze können einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung eines<br />
Projektes bieten. Aufgezählt seinen exemplarisch die Anbindung an eine schulinterne<br />
Bibliothek, der unmittelbare Kontakt zwischen den Abteilungen, Einrichtung von<br />
problemorientierten Diskussionsecken, Zugriff auf schulinterne Datenbanken (alte<br />
Projekte…) und vieles mehr. Die Möglichkeiten richten sich hier jedoch stark nach der<br />
vorhandenen Infrastruktur.<br />
• E-mail<br />
Als extrem rasche, billige und äußerst effiziente Kommunikationform, sowohl intern und<br />
als auch extern.<br />
Seite 10
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
• Projekt- Homepage<br />
Einrichtung einer eigenen Homepage der Schule, auf welcher alle Projekte vorgestellt<br />
werden.<br />
• CD-ROM<br />
Die CD-ROM hat sich in jüngster Zeit im multimedialen Umfeld zu einem interaktiven<br />
und äußerst effektiven Medium der Wissensvermittlung entwickelt, welches gerade im<br />
Selbststudienbereich besondere Qualitäten aufweist. Da ITP von den Schülern stets sehr<br />
hohe Anteile an individueller Lernarbeit fordern, bietet sich hier eine äußerst effektvolle<br />
und vor allem zeitgemäße Ergänzung.<br />
• Video- Projektion<br />
Die Schüler haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Präsentationen ihres<br />
Projektes die Anwendung spezieller Software- Programme und der dafür notwendigen<br />
Technologie kennenzulernen.<br />
1.10 Projekt- Beurteilung und Benotung<br />
Da ITPs ja auch einer Beurteilung unterliegen (in den meisten Fällen stellen sie ja sogar einen<br />
Teil der Reife- und Diplom/Abschlußprüfung dar), werden Beurteilungskriterien maßgebend,<br />
die in den klassischen Formen der Leistungserhebung in diesem Ausmaß nicht vertreten<br />
waren. Alleine das Faktum, daß diese Kriterien nun Teil der Beurteilung sind, lassen sie in ihrer<br />
Wichtigkeit in das Bewußtsein der Schüler rücken und sie auch ernst nehmen.<br />
• allgemeine Beurteilungskriterien<br />
Die Beurteilungskriterien sollten zu Projektbeginn von allen Partnern gemeinsam definiert<br />
und eventuell auch schriftlich festgelegt werden. Dazu sollten in jedem Falle gehören:<br />
- das rein fachliche Ergebnis (Erfüllung der technischen Aufgabe)<br />
- die organisatorische Kompetenz (Einhaltung von Projektstruktur, Terminen,<br />
Qualitätssicherung)<br />
- soziale Kompetenz (Interaktion innerhalb der Projektgruppe)<br />
- Dokumentation (Umfang und Vollständigkeit)<br />
- Präsentation (Darstellung des Projektes nach außen, (fremd-)sprachliche<br />
Kompetenz)<br />
Eine Einbeziehung von Selbstbeurteilungsanteilen durch Schüler ist durchaus denkbar.<br />
• Individueller Erfolg versus Teamerfolg<br />
Getrennte Teilbeurteilungen sollten in die Note einfließen.<br />
• Zwischenbeurteilung, begleitende Kontrolle<br />
Die Beurteilung sollte niemals eine Einzelbeurteilung des Schlußergebnisses sein.<br />
Getrennte und laufende Teilbeurteilungen der einzelnen „Meilensteine“ sollten wesentlich<br />
in die Endnote einfließen.<br />
• Perfektionsgrad<br />
Nicht die 100%-ige Erfüllung des Projektzieles, sondern der eigenständige Weg sollte<br />
vordergründig bewertet werden. Auch Projekte, die das gesteckte Ziel aus sachlichen<br />
(außerhalb des Einflußbereiches der Schüler liegenden) Gründen nicht erreichen, können<br />
durchaus ausgezeichnete Beurteilungen erhalten.<br />
• Beurteilung durch den (die)Projektbetreuer<br />
Grundsätzlich erfolgt die Beurteilung durch den (die) Projektbetreuer. Es liegt aber im<br />
Ermessen des Lehrers, auch die Beurteilung anderer Beteiligter einfließen zu lassen:<br />
- Einbeziehung von Bewertungen von Projektpartnern (Eigenbeurteilung<br />
Schüler, schulfremde Partner wie Firmen- oder Behördenvertreter…)<br />
Seite 11
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Seite 12<br />
- Schulaufsicht (Vertreter anderer Abteilungen oder <strong>Schulen</strong>, Wettbewerbsjury…)<br />
1.11 Bezug zur „Neuen Matura“<br />
Der überwiegende Teil der Projekte des letzten Schuljahres wurden im Rahmen des Schulversuches<br />
„Neue Matura“ durchgeführt. Diese Verbindung ist häufig, aber nicht notwendig. Die<br />
Anbindung an den Schulversuch bringt aber auch einige Vorteile, die hier kurz aufgezählt<br />
werden sollen.<br />
• „Neue Matura“ als Abschluß von ITP´s ist sinnvoll, aber nicht notwendigerweise<br />
erforderlich<br />
Der Schulversuch sieht den Abschluß des ITP als Teil der Reife- und Diplomprüfung<br />
zwar vor, macht ihn aber nicht zum zwingenden Bestandteil. Eine Entscheidung von<br />
Anbeginn an für die „klassische“ 40-stündige Klausurarbeit ist möglich, sogar ein rechtzeitiges<br />
„Umsteigen“ ist vorgesehen.<br />
• 40-stündige Klausurarbeit versus mindestens 6-monatige Projektarbeit<br />
Viele sehen im ITP eine reellere Beurteilunggrundlage. Die Beurteilung erfolgt auf<br />
Grund einer längerfristigen und nicht einer „punktuell“ (innerhalb einer Woche)<br />
erbrachten Leistung. Zusätzlich wird ein reales Praxisprojekt beurteilt entgegen häufig<br />
weitgehend „theoretischen Reißbrettprojekten“ bei der 40-stündigen Projektarbeit.<br />
• Die Präsentation als zusätzliche mündliche Prüfungskomponente<br />
Die Präsentation bringt neue Dimensionen in die Beurteilung ein, die gerade für das<br />
spätere Berufsleben von eminenter Bedeutung sind.<br />
• Besondere Gewichtung der fremdsprachlichen Kompetenz<br />
Die Abfassung eines „Abstracts“ in englischer Sprache ist verpflichtender Bestandteil des<br />
Schulversuches. Vielfach erfolgt aber bereits auch die Präsentation (oder zumindest Teile<br />
derselben) in englischer Sprache. Obwohl dies in keiner Weise verpflichtend vorgesehen<br />
ist (es existieren nur Empfehlungen), hat sich hier mit Eigendynamik so etwas wie eine<br />
Projektkultur entwickelt. Immer mehr <strong>Schulen</strong> und Schüler erkennen den Wert der Einbindung<br />
der lebendigen englischen Sprache.
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
2. ABSCHNITT : WEGE ZU PROJEKTEN - SCHWERPUNKTE SETZEN<br />
Ein ITP wird nicht von heute auf morgen „aus dem Boden gestampft“. Es gibt im Vorfeld des<br />
eigentlichen Projektes eine Reihe von Faktoren, die das Umsetzen eines geplanten ITP wesentlich<br />
beeinflussen, ja im Extremfall durchaus auch zum Scheitern bringen können. Es steht deshalb<br />
am Beginn der Kapitel, die sich mit der Umsetzung eines Projektes befassen, eine Zusammenstellung<br />
von möglichen Aktivitäten und Maßnahmen, die langfristig beachtet und vorbereitet<br />
werden können, um das Feld für die eigentliche Realisierung zu bereiten und zu optimieren.<br />
2.1. Finden geeigneter Arbeitsfelder<br />
Alle in Abschnitt 1 angeführten Qualitäten von durchgeführten ITPs hängen stark davon ab, ob<br />
sie in einem passenden Arbeitsfeld angesiedelt sind. Interesse alleine ist hier nicht ausschlaggebend.<br />
An die Bewältigung dieses Punktes kann durchaus auch strategisch herangegangen<br />
werden.<br />
• vorhandene Fachkompetenzen auflisten<br />
Wo liegen die Schwerpunkte in Ausbildung, Interesse und Erfahrung von Lehrern,<br />
Schülern und Dritten? Können eventuell auch Weiterbildungsangebote abgestimmt<br />
werden?<br />
• vorhandene Ressourcen auflisten<br />
Was ist vorhanden an Geräteausstattung, Software, Werkstätten, Labors, Firmenressourcen...?<br />
Wie und in welchem Ausmaße sind diese Ressourcen auch nutzbar?<br />
• (realistische) Herausforderungen suchen<br />
Projekte sind in der Regel auch eine Chance, neue Kompetenzen zu entwickeln.<br />
• „Marktnischen“ aufspüren<br />
Projekte, bei welchen:<br />
- der Aufwand für die Firma unrentabel erscheint<br />
- die Dringlichkeit nicht hoch genug ist<br />
- der Auftraggeber eine „finanzschwächere“ Institution ist (Sozialbereich,<br />
Körperschaften...)<br />
- Klein- und Mittelbetriebe, die sich professionelle Entwicklung mit vertraglicher<br />
Erfolgsgarantie nicht leisten können....<br />
• „interne Marktforschung“ betreiben<br />
Weiß jemand um einen echten Bedarf? Gewissenhaft und kritisch Reaktion auf eingegangene<br />
Vorschläge (z.B. bei der Eröffnungskonferenz) sammeln. Selbstehrlichkeit<br />
ist dabei dringend erforderlich. Falscher Ehrgeiz gefährdet letztlich den Erfolg der<br />
Schüler.<br />
• vorhandene Firmenkontakte nutzen<br />
Vergleiche auch Abschnitte 2.5 und 5.1.1<br />
2.2. Zielsetzungen für zukünftige Entwicklungen festlegen<br />
Konzepte für die Durchführung von ITP können (sollten) über die Orientierung am Zeitrahmen<br />
eines einzelnen Schuljahres hinausreichen. So sind etwa Planungszyklen von 3 Jahren denkbar.<br />
Langfristige Konzepte bringen nicht nur Erleichterung und Klarheit bei der Durchführung,<br />
sondern auch Synergieeffekte durch Ausweitung auf indirekt beeinflussende Größen (Weiterbildungsziele<br />
für Lehrer, Budget, Beschaffung, . . .)<br />
Seite 13
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
2.3. Interessenabstimmung zwischen den Abteilungen<br />
Ein wesentlicher Kernpunkt der ITP ist das interdisziplinäre Arbeiten. Dieses kann zuerst<br />
fächerübergreifend verstanden und umgesetzt werden, noch erstrebenswerter erscheint es jedoch,<br />
auch die Grenzen der einzelnen Abteilungen zu durchbrechen.<br />
Als gangbarer Weg könnte sich anbieten:<br />
• Errichtung von Arbeitsgruppen „Projekte“ auf Schul- und Abteilungsebene.<br />
• Entwicklung und Förderung (durch Direktor, AVs) von interdisziplinären<br />
Projekten, was zusätzliches Innovationspotential mit sich bringt.<br />
• laufende Projektbegleitung durch diese Arbeitsgruppen.<br />
2.4 Anbindung an das Schulprofil<br />
Schulautonome Profile („Corporate Identity“) können sich durchaus auch in Großkonzepten bei<br />
der Durchführung von ITP widerspiegeln. Dies bringt äußerst starke Wechselwirkungen mit sich.<br />
Zum einen profitieren die Projektgruppen von der speziellen Fachexpertise der Schule, zum<br />
anderen betont und festigt die Durchführung vieler Projekte gerade auf diesem „Spezialgebiet“<br />
den Stellen- und „Markt“-Wert der Schule. Langfristig projektierende Maßnahmen in dieser<br />
Richtung wären:<br />
Seite 14<br />
• Schwerpunktsetzungen in Hinblick auf die angestrebte Profilierung der Schule<br />
Gemeint ist eine eher strategische Planung und Einigung auf Leiterebene der Schule<br />
(Direktor, AVs, WL…)<br />
• Projekte als vollwertigen Beitrag zu dieser Schwerpunktssetzung verstehen<br />
Dies erfordert meist erhebliche Bemühungen um schulinterne Bewußtseins- und<br />
Meinungsbildung.<br />
• diesbezügliche Konzepte im Rahmen einer Arbeitsgruppe „Projekte“ auf<br />
Schulebene (abteilungsübergreifend) entwickeln<br />
Einbindung aller betroffenen Ebenen in die Realisierung der unter dem obigen Punkt<br />
entwickelten Konzepte.<br />
2.5. „Projektakquisition“<br />
Projekte mit außerschulischen Partnern „kommen“ in den seltensten Fällen „von alleine“ an eine<br />
Schule. Es ist deshalb notwendig, bereits frühzeitig Möglichkeiten und Angebote potentiellen<br />
Partnern bewußt zu machen. Solche Aquisitions-Aktivitäten dürfen sich aber nicht auf einmalige<br />
Aktionen beschränken, sonder erfordern eine regelmäßige Pflege und langfristige Planung.<br />
• Installation und Pflege von Firmenkontakten<br />
Dies sollte für eine technisch-gewerbliche Schule schon aus anderen Gründen eine<br />
Selbstverständlichkeit sein. Hier liegt jedenfalls der Vorteil in einem mehrfachen<br />
Nutzen für die Schule.<br />
- Vertiefung des Unterrichts, Steigerung des Realitätsbezuges<br />
- Projektthemen und -angebote<br />
- Möglichkeiten für Sponsoring<br />
- Vermittlung weiterer Firmenkontakte<br />
• Kontakte mit Behörden, Körperschaften, anderen <strong>Schulen</strong><br />
Hier sind immer potentielle Partner zu finden. Sie bieten in der Regel äußerst interessante<br />
Projekte an, die häufig etwas von der Norm abweichen (soziale und gemeinnützige<br />
Ausrichtung…).
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
• Bedarf seitens der Gesellschaft (z.B. Umwelt, Gesundheit, . . . )<br />
Hier gilt exakt das gleiche wie im vorigen Punkt.<br />
(Österreichweit machen Projekte dieser beiden Gruppen bereits etwa 40% aller<br />
Projekte mit außerschulischen Partnern aus.)<br />
• „Werbeaktivitäten“<br />
Waren die ersten drei Punkte vor allem auf persönliche Kontakte ausgerichtet, ist hier<br />
an die mögliche Schaffung regelrechten „Werbematerials“ (Informationsbroschüren,<br />
Folder) gedacht, das an potentielle Partner versandt wird. Hier liegen bereits gute<br />
Erfahrungen verschiedener <strong>Schulen</strong> vor (siehe Abschnitt 5.1).<br />
Seite 15
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
3. ABSCHNITT : PROJEKTABWICKLUNG<br />
Dieses Kapitel soll nun den eigentlichen Ablauf eines Projektes beschreiben und ist durchaus<br />
als so etwas wie eine Checkliste gedacht. Aus dem mehrfach an uns herangetragenen Wusch<br />
nach einer solchen Orientierungshilfe ist eigentlich diese Broschüre gewachsen. Bedenken sie<br />
dabei aber bitte zweierlei Dinge: zum einen will dieser Leitfaden nicht normieren, sondern<br />
helfen. Dies heißt, die einzelnen Punkte haben in keiner Weise vorschreibenden, sondern<br />
ausschließlich aufzeigenden Charakter. Weiters ist Projekt nicht gleich Projekt. Die ungewöhnliche<br />
Vielfalt an unterschiedlichen Formen von Projekten bedingt, daß von vornherein nicht<br />
alle Punkte für alle Projekte zutreffen können, weshalb auch gar nicht all angeführten Punkte in<br />
allen Umfeldern umgesetzt werden können.<br />
3.1 Formulierung und Beschluß von Projekten<br />
3.1.1 Projektideen, Projektvorschläge<br />
Beiträge sollen grundsätzlich von allen interessierten Seiten möglich (und erwünscht) sein,<br />
sofern sie in ihrer Motivation ernst gemeint sind. Ideen und Vorschläge werden somit in der<br />
Regel von unmittelbar Betroffenen (Lehrer, Schülern, Abteilungsvorstände), von schulinternen<br />
Gremien (Direktor, Arbeitsgruppen, andere …), aber auch von „Dritten“ (außerschulische<br />
Partner) eingebracht werden. Dabei empfiehlt sich folgender Ablauf:<br />
• Ideensammlung<br />
In einer Art "Brainstorming" Sammlung nicht nur von Vorschlägen, sondern zu allen eingebrachten<br />
Ideen auch möglichst vieler technischer, industrieller, kommerzieller und<br />
gesellschaftlicher Aspekte.<br />
• Recherchen<br />
Nähere Recherchen zu diesen Ideen (Fachliteratur, Patente, Veröffentlichungen, Marktsituation,<br />
...). Bei allem sollte die Frage im Vordergrund stehen: Was gibt es schon und in<br />
welcher Form? Im Idealfall ist das Ergebnis ein Recherchenbericht als wesentliche<br />
Grundlage für spätere Entscheidungen.<br />
• Projektkonzepte<br />
Abfassung von groben Konzepten zu jedem Projektvorschlag (Was, wie, womit, wozu) .<br />
• Zusammenfassung der Entscheidungsgrundlagen<br />
Herausarbeiten der Entscheidungsgrundlagen für Projektbewertung und Projektauswahl<br />
(Recherchenbericht, Projektkonzept, "grobes Pflichtenheft"…)<br />
3.1.2 Bewertung, Auswahl und Beschluß der Projekte<br />
Dieser Schritt sollte möglichst nicht durch Einzelpersonen erfolgen, sondern durch eine qualifizierte<br />
Gruppe (Abteilungsgremium, Arbeitsgruppe „Projekte“,…). Dabei empfiehlt sich<br />
folgender Ablauf:<br />
• Bewertung der Projektideen<br />
Machbarkeit, Innovationsgehalt, Beitrag zum Schulprofil, Kosten….<br />
Als Ergebnis Vorlage von bewerteten Vorschlägen ("Bewertungsanalyse").<br />
• (Vor)Auswahl der Projekte<br />
Unbedingt nach offenen, nachvollziehbaren Kriterien.<br />
Seite 16
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
• Beschluß der Projekte<br />
Die ausgewählten Projekte werden durch ein offizielles Gremium (Abteilungskonferenz,<br />
abteilungsinterne Projektgruppe…) beschlossen.<br />
• Bildung (Auswahl) der Projektteams<br />
Lehrer, Schüler, außerschulische Partner, externe Kontaktpersonen, …<br />
Modelle zur Auswahl siehe Abschnitt 1.4 und 1.5<br />
• Festlegung der Beurteilungskriterien<br />
Bereits zu diesem Zeitpunkt sollte eine ausführliche Besprechung der Beurteilungskriterien<br />
mit den betroffenen Schülern erfolgen. Details siehe Abschnitt 1.10.<br />
• Einreichung der Projekte<br />
(Dieser Punkt trifft nur zu, wenn das ITP Teil der Reife- und Diplomprüfung ist)<br />
Die Einreichung der Projekte bei der Schulbehörde 1. Instanz kann erst nach Bildung der<br />
Projektteams erfolgen, da die Themenstellung im Einvernehmen mit dem Schüler erfolgen<br />
muß.<br />
• Begleitende Maßnahmen<br />
Einbindung der Projekte in Lehrveranstaltungen, Berücksichtigung bei Lehrfächerverteilung,<br />
Weiterbildungserfordernisse und -angebote für Lehrer und Schüler…<br />
3.2 Projektdurchführung (Durchführung des Einzelprojektes)<br />
Hier geht es nun konkret um das Einzelprojekt. Welcher Detailablauf empfiehlt sich? Was kann<br />
dabei alles beachtet werden?<br />
3.2.1 Projektgliederung<br />
Am Beginn steht die grobe Gliederung des Projektes nach zweierlei Gesichtspunkten:<br />
• Inhaltlich<br />
Festlegen von Teilaufgaben ("Module"), gegebenenfalls Aufspaltung in Teilprojekte.<br />
• Zeitlich<br />
Aufgliederung des Projektes in einzelne, in sich geschlossene Abläufe, also klar<br />
definierte "Projektphasen".<br />
3.2.2 Projektplan<br />
Es folgt eine detaillierte Planung auf Basis der Projektgliederung, die kurz mit „Wer? - Was? -<br />
Wann? - Womit?“ beschrieben werden könnte.<br />
• Detailliertes Pflichtenheft<br />
Das Pflichtenheft ist eine übersichtliche Zusammenstellung der technischen, wirtschaftlichen<br />
und sonstigen Spezifikationen unter Berücksichtigung der effektiven<br />
Realisierungsmöglichkeiten.<br />
Sie finden eine übersichtliche Zusammenstellung der Inhalte eines Pflichtenheftes im<br />
Anhang.<br />
• Organisatorische und zeitliche Feinplanung<br />
Möglichst reale Detailplanung (z.B. mittels Balken- oder Netzplan…) als Grundlage für<br />
den konkreten Projektablauf.<br />
• Wirtschaftliche Detailplanung<br />
Marktrecherchen für Zukäufe, Lieferanten, Bestellungen; Einbindung von Sponsoren,<br />
Sachspenden, Leihgaben; am Ende erfolgt eine detaillierte Aufstellung der abschätzbaren<br />
realen Projektkosten.<br />
Seite 17
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
3.2.3 Projektabwicklung<br />
Ab hier beginnt nun die konkrete Arbeit an der eigentlichen Aufgabe und Problemstellung. In<br />
der Regel ist dies jener Teil des gesamten Projektes, dem die Schüler mit hohen Erwartungen<br />
entgegensehen und an den sie deshalb auch mit viel Elan herangehen.<br />
Die nachstehend angeführten Punkte sind primär in einer logischen Abfolge zu sehen, greifen in<br />
der Praxis jedoch ineinander über und werden sich oft mehrmals in einer Art Regelkreis wiederholen.<br />
• Feinmodellierung von Problem und Problemlösung<br />
• Entwicklungstätigkeit, Entwürfe<br />
• Konkrete Umsetzung der Entwürfe, Modell<br />
• Prototyp(en), Überprüfung, Simulation<br />
Diese kreative und für die Schüler interessanteste Phase, die natürlich einen großen Zeitraum<br />
einnimmt, muß begleitet sein von laufenden Projektbesprechungen und Teamgesprächen<br />
(Zwischenberichte, Problemerörterungen…). Zu diesen sollten unbedingt auch nicht unmittelbar<br />
Beteiligte hinzugezogen werden! Dieses oft sehr unbequeme (und deshalb auch häufig<br />
gemiedene) Regulativ stellt für Schüler einen ganz wesentlichen Lerninhalt dar. Es gilt bewußt<br />
zu machen, wie gefährlich es für die Qualität des Endproduktes sein kann, nur eigene Ideen und<br />
Sichtweisen vor Augen zu haben und zu verfolgen.<br />
Ebenso empfiehlt sich eine laufende Einbringung von Projekt(zwischen)ergebnissen und<br />
Erkenntnissen in den Unterricht und in die Tätigkeit anderer Projektgruppen (Verallgemeinerung).<br />
Im Sinne von Synergieeffekten und einer Horizonterweiterung sollte in den Phasen "Projektplan"<br />
und "Projektabwicklung" ständig eine Abstimmung mit parallellaufenden, "benachbarten"<br />
Projekten erfolgen, insbesondere solchen, die einen gleichen oder verwandten Projektschwerpunkt<br />
aufweisen.<br />
3.2.4 Projektbegleitung<br />
Projekte sollen „begleitet“ werden. Dafür ist ein Gremium (Arbeitsgruppe "Projekte", Abteilungsgremium…)<br />
erforderlich, das über die entsprechenden Kompetenzen verfügt.<br />
• Unterstützung im Hinblick auf technische/betriebswirtschaftliche Aspekte<br />
• Ergänzende Fachexpertise in den Bereichen Natur- und Humanwissenschaften<br />
• Spezielle Unterstützung in flankierenden Bereichen wie in Englisch, Deutsch,<br />
Präsentationstechnik…<br />
Seite 18<br />
Solche Maßnahmen haben einerseits das Ziel der Qualitätsverbesserung, andererseits<br />
beugen sie einem "Dahinwursteln", "Versanden" bzw. "Einschlafen" von Projekten<br />
vor. In einer Arbeitsgruppe "Projekte" bzw. um diese herum können sich Spezialisten<br />
herausbilden, welche in ihren Fachgebieten mit Spezialkenntnissen den Projektteams<br />
Unterstützung und Flankenschutz bieten können.<br />
3.2.5 Controlling<br />
Projekte sollten, sofern möglich, auch einem gewissen Controlling unterliegen. Diese Aufgabe<br />
würde ebenfalls den vorhin angesprochenen Gremien zufallen, könnte aber notfalls auch durch<br />
Einzelpersonen (Abteilungsvorstand, Fachexperte) wahrgenommen werden. Gedacht ist vor
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
allem an eine laufende Überprüfung des Projektes hinsichtlich technischer und betriebswirtschaftlicher<br />
Aspekte.<br />
3.2.6 Laufende Protokollierung<br />
Alle wichtigen Projektphasen und -ergebnisse sind laufend zu protokollieren, sowohl in<br />
Hinblick auf aktuelle Recherchen im Verlaufe der Arbeit als auch hinsichtlich der abschließenden<br />
Projektdokumentation.<br />
3.3 Projektabschluß<br />
In die Abschlußphase des Projektes und in die Zeit danach fallen eine Reihe von Tätigkeiten<br />
unterschiedlicher Dimension und Dringlichkeit. Einige davon sind von vornherein zwingend<br />
(Projektdokumentation, Projektpräsentation), einige aber werden oft gar nicht oder nur in geringem<br />
Ausmaße wahrgenommen, sei es aus Geringschätzung oder aber einfach aus Zeitnot heraus.<br />
• Abschließende Projektdokumentation<br />
In einer ausführlichen Dokumentation wird das gesamte Projekt in allen wesentlichen<br />
Punkten hinsichtlich Ideen, Konzepten, Kalkulationen, Entwicklungsschritten…<br />
beschrieben. Enthalten sein müssen dabei auch alle wichtigen Fertigungsunterlagen,<br />
eventuelle Prototypen, Ausführungspläne…<br />
Eine übersichtliche Aufstellung über die Inhalte einer Projektdokumentation finden Sie<br />
im Anhang.<br />
• Projektbericht<br />
Projekttätigkeit (und Projektleitung) bedeutet auch ein hohes Maß an Verantwortung<br />
gegenüber Schülern, mitwirkenden Lehrkräften, Schule, Sponsoren, Steuerzahlern… Aus<br />
diesem Grunde sollte eine Rechenschaft in Form eines Projektberichtes obligat sein.<br />
Dieser Projektbericht sollte sich an alle richten, die in irgendeiner Form „fördernd“ am<br />
Zustandekommen des Projekts beteiligt waren oder durch die Aktivitäten betroffen<br />
wurden. Als Beispiel seien angeführt: die Arbeitsgruppe "Projekte" (auf Abteilungs- bzw.<br />
Schulebene), andere eingebundene Gremien, die Abteilung, der Direktor… Grundsätzlich<br />
sollte allen Interessierten Einblick gewährt werden (mit gewissen Einschränkungen bei<br />
Patentansprüchen).<br />
Ebenso ist auch eine jährliche (ev. öffentliche) Veranstaltung „Projekt“ denkbar, in<br />
welcher die Projektberichte mündlich vorgebracht werden und direkte Anfragen<br />
möglich sind. Es wäre dies vorrangig eine (Fach-)Veranstaltung zwecks Absicherung,<br />
Unterstützung und Ausbau der Projektschwerpunkte und des Innovationsprofils der<br />
Schule.<br />
Der Projektbericht sollte auch alle negativen Erfahrungen, Rückschläge u.ä. darstellen,<br />
günstigere Lösungsansätze aufzeigen, bzw. gegebenenfalls ein allfälliges Scheitern des<br />
Projektes erläutern.<br />
• Publikation in Fachliteratur<br />
Bei aufwendigeren und vor allem innovativen Projekten ist im allgemeinen Interesse<br />
(Schule, Lehrer, Schüler, Partner) eine Publikation in der entsprechenden Fachliteratur<br />
ins Auge zu fassen. Federführend sollte diesbezüglich der Projektleiter sein.<br />
Eine eventuelle Publikation kann in den Projektbericht übernommen werden und somit<br />
den dortigen Arbeitsaufwand deutlich verringern.<br />
Seite 19
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
• Anmeldung von Patenten<br />
Sicher der Ausnahmefall, aber durchaus denkbar (bereits mehrere Präzedenzfälle).<br />
Detailinformationen in Kapitel 6 – Rechtliche Fragestellungen.<br />
• Projektpräsentation(en)<br />
Ein grundlegender Bestandteil des Ausbildungskonzeptes ITP. Die Präsentation<br />
erfolgt nach Abschluß des Projektes durch das Projektteam. Eine abschließende Präsentation<br />
sollte unbedingt auch in jenen Fällen stattfinden, in welchen das Projekt nicht im<br />
Zusammenhang mit der Reife- und Diplomprüfung steht.<br />
Seite 20<br />
Darüber hinaus sind weitere Präsentationen empfehlenswert. Diese können einerseits<br />
der intensiveren (Vor)Schulung der Präsentationsfähigkeiten der Schüler in<br />
Hinblick auf die zu beurteilende Präsentation dienen, ebenso aber durchaus auch<br />
repräsentativen Charakter haben (Schul- oder Abteilungsprofil, Demonstration der<br />
Qualität der Ausbildung, Aquirierung weiterer Projekte…)<br />
[zum Thema Präsentation siehe auch Literaturliste Abschnitt 7].<br />
• „Projekt-Review“<br />
Selbstkritische Gegenüberstellung Planung versus Realisierung bezüglich aller relevanten<br />
Bereiche des Projektes (Zielsetzungen, Innovationsgehalt, Kosten, ... ,…).<br />
• Evaluierung der Ergebnisse<br />
Nachträgliche Evaluierung der Ergebnisse eines Projektes im Hinblick auf Projektschwerpunkt(e)<br />
und Profil der Schule.
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
4. ABSCHNITT : VERMARKTUNG<br />
Unter Vermarktung sind hier nicht finanzielle Aspekte zu verstehen, sondern in erster Linie<br />
ideelle. Eine Schule, die Projekte vorzuweisen hat, wird diese natürlich so gut wie möglich ins<br />
Blickfeld rücken (Klappern gehört zum Handwerk!), um größtmöglichen Nutzen daraus zu<br />
ziehen. Ein eventueller finanzieller Erlös ist erst an zweiter Stelle zu nennen, kann bestenfalls ein<br />
wenig „Butter aufs Brot“ bedeuten und darf unter keinen Umständen Ziel eines ITP sein.<br />
4.1. Projekte als Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Dokumentation<br />
Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung ist eine professionelle Dokumentation.<br />
Diese kann bei den verschiedensten Anlässen genützt werden.<br />
Beispiel: Jahresbericht, Einreichen bei Wettbewerben, Verteilen an Firmen, Veröffentlichung<br />
in lokaler Presse und lokales Fernsehen, Kurzfassung in D/E im Internet<br />
(Briefing)<br />
• Präsentation<br />
Die ausgeführten Projekte (Geräte, Modelle, Schautafeln, Videos, CD´s etc) können bei verschiedenen<br />
Anlässen zur Vorführung gebracht werden.<br />
Beispiel: Bildungsinformationsmessen, Tag der offenen Tür, Besuchern der Schule<br />
(Schulverwaltung, Firmen, Politiker)<br />
• Public Relations<br />
Diese vorgenannten Aktivitäten erhöhen das Ansehen der Schule in der Öffentlichkeit und<br />
machen die Schüler stolz auf „ihre“ Schule. Dies wirkt sich langfristig auch positiv auf die<br />
Schülerzahlen aus.<br />
4.2. Wirtschaftliche Nutzung von Projekten<br />
Eine echte wirtschaftliche Nutzung darf niemals die primäre Motivation für die Durchführung<br />
eines Projektes sein, da sonst sofort Konflikte mit den pädagogischen Zielsetzungen auftreten.<br />
Dennoch ist es notwendig, das Thema Abgeltung für erbrachte Leistungen hier auszuführen, da<br />
im Zusammenhang mit ITP unterschiedliche Stufen oder Formen des Geldflusses auftreten,<br />
die mit Gewinnorientierung nichts zu tun haben. Eine rechtzeitige Regelung der beiden nachfolgend<br />
angeführten Punkte sollten deshalb im Interesse von Schule und Schülern angestrebt<br />
werden.<br />
• Ersatz des Sachaufwandes<br />
Der außerschulische Partner trägt die Kosten des für die Durchführung des Projektes notwendigen<br />
Sachaufwands (Material, Bauelemente…). Weiters stellt er gegebenenfalls auch<br />
noch Mittel temporär zur Verfügung (Geräte, Räumlichkeiten, Laboratorien, Werkstätten,<br />
Maschinen, Software....).<br />
Dies ist in der Regel relativ einfach, wenn der Partner ein privatwirtschaftliches Unternehmen<br />
ist. Probleme kann es hier jedoch geben, wenn der Partner selbst nur beschränkte<br />
Verfügungsgewalt über Mittel besitzt, wie dies bei der öffentlichen Hand oder sozialen<br />
Institutionen der Fall ist. In diesen Fällen ist es notwendig, eine eventuelle Aufteilung der<br />
Sachaufwandsfinanzierung bereits zu Projektbeginn möglichst genau zu vereinbaren und in<br />
schriftlicher Form festzulegen.<br />
Seite 21
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Da in all diesen Fällen kein wirklicher Geschäftsvorgang entsteht, ist eine Belegung mit<br />
Rechnungen nicht notwendig. Aus pädagogischen Gründen empfiehlt es sich jedoch, jeden<br />
Vorgang dieser Art von den Schülern genauest, auch mit Betrag, in die Projektdokumentation<br />
aufnehmen zu lassen (die Kalkulation müßte zwingender Teil jedes Projektes sein).<br />
Seite 22<br />
Die Kalkulation, Angebotslegung und Abrechnung kann z.B. im Rahmen des Gegenstandes<br />
Wirtschaftliche Bildung durchgeführt werden. Durch die unmittelbar Verknüpfung<br />
mit der Praxis kann dies ein wichtiger Teil der kaufmännischen Ausbildung sein.<br />
• Gegenleistungen durch Sach- oder Geldspenden<br />
Aufbauend auf den vorigen Punkt ist festzuhalten, daß im Regelfalle der Partner Leistungen<br />
durch das Projektteam erhält, für welche er im Wege der freien Marktwirtschaft Geldleistungen<br />
zu erbringen hätte, die über die soeben besprochenen Belastungen hinausreichen. Da<br />
aber echte „Bezahlungen“ von Dienstleistungen im Umfeld der ITP nicht nur rechtlich<br />
äußerst problematisch, sondern (wie schon besprochen) auch gar nicht erstrebenswert sind,<br />
bieten sich andere Gegenleistungen an, die für beide Partner vorteilhaft und zufriedenstellend<br />
sind. Dies wären etwa:<br />
• Sachleitungen an die Schule (Technologieausstattung, Geldspenden…)<br />
• Geld- oder Sachspenden an die Schüler des Projektteams<br />
• Projektprämierungen<br />
Obwohl es sich hier um freiwillige „Gaben“ handelt, empfiehlt sich auch hier eine Vereinbarung<br />
bereits zu Projektbeginn.<br />
Abschließend noch grundsätzliche Kommentare zu zwei oft gestellten Fragen im Zusammenhang<br />
mit diesem Thema.<br />
• Vertraglich festgelegte Honorare<br />
Solche erscheinen in jedem Falle äußerst problematisch. Eine ordnungsgemäße Bezahlung<br />
von Leistungen steht stets in Verbindung mit vertraglichen Verpflichtungen (Termine!<br />
Erfolgsgarantie!), was dem pädagogischen Konzept der ITP grundsätzlich zuwider läuft.<br />
Zudem erscheint auch eine finanzielle Honorierung rechtlich unhaltbar, da Leistungen, die<br />
im Rahmen des normalen Unterrichts erbracht werden, nicht verdienstorientiert sein können,<br />
egal ob die Schule oder ein Schüler als Begünstigter aufscheinen.<br />
• Teilrechtsfähigkeit<br />
Aus gleichem Grunde kann auch Teilrechtsfähigkeit kein Thema für ITP sein. Teilrechtsfähige<br />
Einrichtungen sind eigene Rechtskörper, die für Bereiche außerhalb des regulären<br />
Unterrichtsgeschehen begründet werden. Da aber ITP im Rahmen des normalen Unterrichts<br />
durchgeführt werden, ist dieser Rechtsbereich grundsätzlich nicht zugänglich.
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
5. ABSCHNITT : DAS PROJEKT IN DER SCHULISCHEN ORGANISATION<br />
Dieser Abschnitt setzt sich mit den organisatorischen Problemen innerhalb des schulischen<br />
Umfeldes auseinander. So wird etwa besprochen, wie die erforderlichen Mittel für die Durchführung<br />
von ITP aufgebracht werden können. Ganz besonders behandelt wird die Frage der<br />
Unterrichtsorganisation. Gerade auf diesem Bereich wurde an den einzelnen Schulstandorten<br />
eine Vielzahl von gangbaren Modellen entwickelt, von denen einige hier als Anregung aufgezeigt<br />
werden. Sie finden deshalb in diesem Kapitel eine Reihe konkreter Beispiele angeführt.<br />
5.1 Projektakquisition<br />
(vergleiche auch Abschnitt 2.5)<br />
5.1.1. Projekte mit außerschulischen Partnern<br />
• Nutzung persönlicher Kontakte<br />
Projektideen ergeben sich sehr oft aus zwanglosen Kontakten der Schule (Direktor, AV,<br />
Lehrer, Schüler, Elternverein…) mit Vertretern von oder Kontaktpersonen zu Firmen, Unternehmen,<br />
anderen Partnern (Behörden, Soziale Institutionen…). Besonders sei darauf<br />
hingewiesen, daß auch sehr oft schuleigene Absolventen als solche Kontaktpersonen fungieren.<br />
Bei der örtlichen Gewerbeausstellung knüpft ein engagierter Privatmann den Kontakt<br />
zur HTL. Er ist gerade dabei, ein Kleinkraftwerk in Form einer Kraft-Wärmekopplung<br />
zu bauen. Aus dem vorerst losen Kontakt entsteht ein Ingenieurprojekt. Die HTL bringt<br />
in die entstehende Kooperation Planung, elektrische Ausrüstung, Regelung und<br />
Automatisierung ein.<br />
An einer HTL unterrichtet seit Jahren ein Mitarbeiter der Fa. Swarovki. Aus diesem<br />
Firmenkontakt ergab sich die Themenstellung für ein Projekt "Augenbelastung bei<br />
Bildschirmarbeit und Trainingsprogramm gegen diverse Belastungen". Testpersonen<br />
für die Trainingsprogramme waren dabei Mitarbeiter der Fa. Swarovski Optik.<br />
• Gezielte Projektakquisition<br />
Projektakquisition kann nicht ausschließlich dem Zufall überlassen werden. Dies zeigt<br />
nachfolgendes Beispiel aus Tirol:<br />
Die HTL Jenbach erstellte eine Werbeschrift (Folder), in der sie Firmen anbietet,<br />
kleine Entwicklungen im Projektunterricht durchzuführen. Dieser Folder, dem eine<br />
Rückmeldekarte beigelegt war, wurde im Jänner an alle Firmen der Region versandt.<br />
In der Folge meldeten sich einige Firmen, die der AV alle persönlich besuchte. Die<br />
konkreten Projekte wurden dann bereits Ende des auslaufenden Schuljahres gestartet,<br />
um den Schülern Gelegenheit zu geben, während der Sommermonate eventuell<br />
bereits bei der betreffenden Firma eine Ferialpraxis zu absolvieren.<br />
Ergebnis: zur Zeit sind 80% der Projekte dieser Schule Firmenprojekte.<br />
Besonders sei an dieser Stelle nochmals auf soziale Institutionen und Behörden als Partner<br />
für Projekte hingewiesen. Hier ist oft Phantasie und aktive Kontaktaufnahme von Seiten der<br />
Schule erforderlich, die daraus resultierenden Projekte erweisen sich in der Regel dann jedoch<br />
als äußerst lohnend!<br />
Seite 23
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Projekte mit sozialem Engagement erreichen bei Schülern einen hohen Grad an Stolz und<br />
Befriedigung.<br />
Seite 24<br />
Eine HTL, Abteilung Möbelbau und Innenausbau, entwickelt für ein spastisch<br />
gelähmtes Mädchen einen behindertengerechten Schreibtisch.<br />
Die beiden HTLs in Innsbruck führen in einer bereits mehrere Jahre dauernden<br />
Partnerschaft mit dem Elisabethinum in Axams wiederholt Ingenieurprojekte für diese<br />
Betreuungsstätte durch, wie etwa die Entwicklung eines automatischen Türöffners mit<br />
Zeitsteuerung für Rollstuhlfahrer.<br />
Weiters haben Projekte in Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen sehr oft nicht unerhebliche<br />
regionale Werbewirkung und heben das Prestige der Schule.<br />
Eine Schülergruppe einer HTL, Abteilung Bautechnik, gewinnt einen Wettbewerb der<br />
ÖBB zur Gestaltung der Bahnhofhalle und fertigt diesen Entwurf auch aus. Neben<br />
einem Geldpreis ist der Lohn ein „dauerhafte und kostenlose Reklame“ für Schüler<br />
und Schule.<br />
• Aus Projekten entstehen Folgeprojekte!<br />
Eine Firma wird im Falle einmal gemachter positiver Erfahrungen bei weiteren anstehenden<br />
Projekten von sich aus wieder den Kontakt zur Schule suchen. Einmal geleistete gute Arbeit<br />
schafft somit (neben allen anderen pädagogischen Effekten) auch die Basis für weitere<br />
Projekte und stärkt somit das Ansehen der Schule.<br />
Ein Fachlehrer einer HTL nahm an einem als PI-Seminar ausgeschriebenen<br />
Betriebspraktikum der Fa. Westcam Datentechnik teil. In der Folge ersuchte der<br />
Geschäftsführer dieser Firma (selbst HTL-Absolvent) die Schule, Konstruktion,<br />
Planung und Bau eines Messtisches mitsamt Halterung für einen dreidimensionalen<br />
Digitalisierkopf zu übernehmen. Eine Projektgruppe löste die Aufgabe trotz großer<br />
Schwierigkeiten zur vollsten Zufriedenheit des Auftragsgebers. Die Firma zeigt sich<br />
nun an Folgeprojekten interessiert.<br />
5.1.2. Schulinterne Projekte<br />
Bereiche für schulinterne Projekte können nach ihrer grundsätzlichen Art eingeteilt werden (die<br />
nachfolgend angeführten Beispiele sind alle der Broschüre „ITP im Schuljahr 96/97 entnommen):<br />
• direkte Wertschöpfung<br />
Aufgaben aus dem innerschulischen Bereich, die für die Schule reale Kosteneinsparungen<br />
(meist noch bei gleichzeitig optimal angepaßter Lösung!) erbringen. Es handelt sich hier<br />
häufig (aber durchaus nicht ausschließlich) um bauliche Maßnahmen.<br />
Bau einer Solaranlage auf dem Schuldach, Entwicklung eines Energiemanagments für<br />
die eigene Schule, Errichtung einer Empore als Erweiterung der Unterrichtsraumes…<br />
• indirekte Wertschöpfung<br />
Aufgaben aus dem schulischen Umfeld, deren Realisierung eine qualitative Verbesserung des<br />
Ausbildungsangebotes mit sich bringt.<br />
Erhebung über Arbeitsmarktlage für Absolventen der eigenen Fachrichtung, Bau von<br />
Geräten für den schuleigenen Werkstätten- oder Laborbetrieb, Entwicklung einer<br />
Robotersteuerung zu Unterrichtszwecken…
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
• Innovative Aufgaben<br />
Aufgaben, die aus forschungsorientierter Neugier nach Machbarkeit entstehen.<br />
Entwicklung eines 3D-Objektscanners, Bau eines Elektromobiles, Kontinuierliche<br />
Erzeugung von Bio-Diesel (führte in der Folge zu einer Patentanmeldung…)<br />
Eine zusätzlicher Hinweis: sollen möglichst innovative Projekt-Ideen gefunden werden, so<br />
liefert eine Reise per Internet zu verschiedenen Technischen Universitäten gute Anregungen.<br />
5.1.3 Projekte für Wettbewerbe<br />
Schüler sind in der Regel sehr kreativ und sollten ermuntert werden, möglichst selbst Projektideen<br />
einzubringen. Können sie in der Folge eigene Ideen realisieren, wird die Motivation<br />
besonders groß sein.<br />
Bei Projekten, wie sie oben beschrieben worden sind, werden von Schülern eingebrachte<br />
Themenstellungen naturgemäß eher die Ausnahme bleiben, ebenso wird der Kreativität durch<br />
meist klare Zielvorgaben Grenzen gesetzt sein. Jedes Jahr gibt es aber eine Unzahl von Wettbewerben,<br />
an denen sich <strong>Schulen</strong> beteiligen können und bei denen sich die Kreativität der<br />
Schüler voll entfalten kann. In vielen Fällen übernehmen die Veranstalter sogar Teile der Kosten<br />
und laden die Preisträger zu einer öffentlichen Preisverleihung mit Projektpräsentation ein.<br />
Jährlicher Wettbewerb "Jugend Innovativ" der Innovationsagentur, Wettbewerbe der<br />
OCG (österreichische Computer Gesellschaft) oder anderer Computerfirmen<br />
(Informatikwettbewerb) .... (siehe auch Anhang).<br />
5.2 Die Projektabwicklung im Rahmen der Schulorganisation<br />
5.2.1 Grundsätzliches<br />
Die Abwicklung von ITP ist bezüglich des organisatorischen Aufwandes sehr stark an die<br />
Abteilungsstruktur (Lehrplansruktur, Organisationsstruktur, Personalstruktur…) gebunden.<br />
Deshalb sind von vornherein zwei Aspekte zu sehen:<br />
• Es wird (und muß !!) immer völlig unterschiedliche Modelle geben, die wegen durchaus<br />
konträrer Rahmenbedingungen sehr oft überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind.<br />
• Ein Erfahrungsaustausch mit andern, ähnlich konditionierten <strong>Schulen</strong> ist hier in jedem<br />
Fall der beste Weg neue Anregungen für praktikable Lösungsmöglichkeiten zu finden. Der<br />
Blick über den eigenen Zaun kann sehr oft zu einem wesentlichen Faktor der Qualitäts- und<br />
Effizienzverbesserung werden.<br />
Aus diesem Grunde finden Sie in der Folge an Hand einer Reihe konkreter, praktisch erprobter<br />
Modelle ausgeführt, wie sich der Organisationsrahmen in den letzten Jahren an verschiedenen<br />
<strong>Schulen</strong> entwickelt hat.<br />
Die nachfolgend angeführten Beispiele haben dabei (aus den angeführten Gründen) aber nur<br />
informativen, horizonterweiternden Charakter und sollen (wie schon so oft betont) in keiner<br />
Weise regulierend wirken!<br />
Seite 25
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Allen Modellen liegt eine optimierende Handhabung von Gegenständen mit unterschiedlichen<br />
Teilern, eine möglichst gerechte Aufteilung der anfallenden Werteinheiten an die beteiligten<br />
Lehrer bei fächerübergreifendem Unterricht zu Grunde, ebenso die Einbindung der Projekte in<br />
andere Gegenstände wie etwa Deutsch, Englisch oder Wirtschaftliche Bildung.<br />
Grundsätzlich kann gesagt werden (und es beweist auch die Praxis), daß eine projektfreundliche<br />
Gestaltung des Stundenplanes ebenso durchführbar ist wie die reibungsfreie<br />
Einbettung der Projekte in die kaufmännische Organisationsstruktur der jeweiligen Schule.<br />
Zu den in der Folge angeführten Modellen bezüglich Werteinheitenaufteilung sei ergänzt, daß<br />
für jene ITP, die im Rahmen einer Reife- und Diplomprüfung oder Abschlußprüfung durchgeführt<br />
werden, eine zusätzliche Abgeltung in Form einer Novellierung der Verordnung über<br />
die Prüfungsgebühren in Aussicht gestellt ist. Die Verhandlungen in dieser Richtung sind weit<br />
fortgeschritten und lassen einen positiven Abschluß in nächster Zeit reell erscheinen.<br />
5.2.2 Allgemeine Modelle<br />
Die nachfolgenden Möglichkeiten sind vorerst allgemeine Modelle, ohne Bezug zu einer<br />
bestimmten Ausbildungsform. Sie haben sich bereits mehrfach in der Praxis bewährt und fördern<br />
den Ablauf von Projekten auf unterschiedliche Art und Weise:<br />
• Führung eines schulautonomen Pflicht- oder eines Freigegenstandes „Projekt“ im<br />
V. Jahrgang.<br />
• Nutzung des „Laborteilers“, sofern das Projekt (auch) im Rahmen des Laborunterrichts<br />
durchgeführt wird.<br />
• In gleichem Sinne Nutzung des „CAD-Teilers“ im Gegenstand Konstruktionsübungen<br />
(FTKL, KU), falls eine entsprechende Software-Orientierung des Projektes gegeben ist (hoher<br />
CAD-Anteil).<br />
• Bereitstellen eines eigenen Projekt-Arbeitsplatzes, zumindest jedoch eines abschließbaren<br />
Schrankes für jedes Projekt.<br />
• Es hat sich in den meisten Fällen als sehr wichtig erwiesen, Werkstättenlehrer konkret in<br />
Projekte einzubinden. Dies kann durch die Übernahme von Teilaufgaben erfolgen oder durch<br />
die Mitarbeit im Projektteam (Printherstellung, Fertigung mechanischer Teile, Unterstützung<br />
bei der Herstellung elektrischer Geräte, Gehäuse, Stromversorgung…).<br />
• Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur für Projektpräsentation (Video-Beamer,<br />
Video-Kamera, Video-Schnittplatz, CD-Brenner…).<br />
Grundsätzlich soll die einzelne Schule (Abteilung) bei der Abwicklung von Projekten den ihr<br />
zustehenden Freiraum voll ausnützen.<br />
Grundlage für eine positive Umsetzung initierter Projekte ist, daß an die Schüler klare Arbeitsanweisungen<br />
ausgegeben werden.<br />
Seite 26<br />
Als Beispiel finden sie eine solche Arbeitsanleitung der HTL Braunau im Anhang.<br />
Die wesentlichen Unterrichtsziele im fiktiven Gegenstand „Projekt“ sind die Termintreue und<br />
der positive Abschluß. Daß die Klassenstruktur dabei aufgerissen wird, liegt auf der Hand.<br />
Die Gruppen arbeiten in verschiedenen Räumen oder befinden sich oft auch an Arbeitsplätzen<br />
außer Haus. Somit ergibt sich auch für den betroffenen Lehrer ein stark verändertes Arbeitsbild.<br />
Er wird während seiner Unterrichtszeit nicht immer allen ihm anvertrauten Schülern
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
gleichzeitig zur Verfügung stehen können (Fragen bezüglich Aufsichtspflicht, dislozierter<br />
Schülerarbeit und dergleichen werden im Abschnitt 6 behandelt). Auch wird die Einsatzintensität<br />
für den Lehrer sehr stark von der jeweiligen Projektphase abhängen.<br />
5.2.3 Konkrete Modelle verschiedener <strong>Schulen</strong> und Abteilungen<br />
In der Folge finden Sie nun einige Modelle angeführt, wie die obige allgemeinen Prinzipien in<br />
einzelnen <strong>Schulen</strong> (Abteilungen) konkret umgesetzt wurden (das Verständnis der einzelnen<br />
Modelle erfordert dabei Kenntnisse der jeweiligen ausbildungsbezogenen Stundentafel).<br />
Beispiele Elektronik, Elektrotechnik<br />
HTL Braunau, Abt. Elektrotechnik<br />
KU (Konstruktionsübungen ) (KU-Teiler) 4 Einheiten<br />
ELA (Labor ) (Labor-Teiler) 8 Einheiten (ab Weihnachten)<br />
WLA (Werkstättenlabor) 3 Einheiten<br />
Summe 15 Einheiten<br />
KU und ELA an einem Projekttag. WLA 2 Tage später, damit bei Material-Engpässen<br />
Zeit für Besorgungen ist.<br />
HTL Braunau, Abt. Elektronik<br />
FTKL (Fertigungstechnik u. Konstruktionslehre) 4 Einheiten<br />
LA ( Labor) 8 Einheiten<br />
Summe 12 Einheiten<br />
Diese 12 Einheiten sind an 1½ aufeinanderfolgenden Tagen geblockt, dadurch<br />
ergeben sich minimale Rüstzeiten.<br />
Die Gruppengröße ergibt sich aus der Stundenzahl des Lehrers, d.h. ein Lehrer, der<br />
nicht in beiden Gegenständen in der Klasse ist, hat eine kleinere Gruppe zu betreuen.<br />
In der Folge ergibt sich, daß er nicht in allen Projektstunden bei seinen Schülern ist,<br />
sondern diese in der Zeit seiner Abwesenheit von den andern Lehrern betreut werden.<br />
Jedes Projekt erhält nach entsprechender Vorkalkulation eine Auftragsnummer. Damit<br />
ist es eingebettet in die Werkstättenorganisation.<br />
1. Mit dieser Nummer erhält der Schüler Kleinmaterial (Elektronische Bauteile) aus<br />
dem Materiallager der Werkstätte gegen einen Materialentnahmeschein.<br />
2. Die Erfassung der Materialkosten ist damit automatisch sichergestellt.<br />
3. Auch die Bezahlung von Bauteilen, die in geringen Mengen im Fachhandel<br />
gekauft werden, ist durch die Rechnungsführung damit organisiert.<br />
4. Nach dem Abschluß des Auftrages erfolgt durch Schüler der Arbeitsvorbereitung<br />
die Materialabrechnung<br />
HTL Pinkafeld, Abt. Steuer-Regeltechnik<br />
WS: KÜ 3 Einheiten<br />
SS: KÜ + WLA 6 Einheiten<br />
1 Werkstättenlehrer ist immer verfügbar.<br />
HTL Wien 22 (Donaustadt), Abt. Steuer-Regeltechnik<br />
Labor 6 Einheiten<br />
KU 3 Einheiten<br />
WLA 3 Einheiten<br />
Freigegenstand Betriebswirtschaftliches Labor 2 Einheiten<br />
Summe 15 Einheiten<br />
Seite 27
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Beispiele Bautechnik<br />
Seite 28<br />
HTL 1 Linz, Goethestraße 17, Abt. Hochbau<br />
Modell 97/98:<br />
EZ (Entwurfszeichnen) 8 Einheiten<br />
+ MOB (Modellbau) 1 Einheiten<br />
Summe 9 Einheiten<br />
an einem Unterrichtstag.<br />
Teiler derzeit: 8 Schüler + 1 EZ-Lehrer.<br />
Blockunterricht in MOB, sobald erforderlich. SBB + BBMK (Stahlbetonbau +<br />
Baubetrieb/Baumaschinenkunde) setzt nach Bedarf fächerübergreifend ein, ohne<br />
stundenplanmäßig eingebunden zu sein.<br />
Modell 98/99:<br />
Vorgesehen: 6 Schüler + 1 EZ-Lehrer<br />
wenn möglich wird SBB + BBMK stundenplanmäßig mehr eingebunden.<br />
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT Wien 3, Leberstraße Abtl.Bautechnik- Hochbau:<br />
Ingenieurprojekte in allen vier parallelen 5.Jg. im laufenden Schuljahr :<br />
Gegenstand "Projekt" , gebildet aus:<br />
Entwurfzeichnen (EZ) 8 Einheiten<br />
Bauzeichnen Stat.Fächer (BZU) 2 Einheiten<br />
Freigegenstand Moderne Baumethoden (AF) 2 Einheiten<br />
Summe 12 Einheiten<br />
Stundenplanmäßig an 2 Halbtagen im Zeichensaal + CAD-Saal.<br />
§ AF wird aufgeteilt auf BBMK, SHB und SBB- Schwerpunkte, bzw. TEAM-<br />
TEACHING, d.h. mehrere Lehrer sind fächerübergreifend zugleich im Zeichensaal<br />
mit den Schülern beschäftigt.<br />
§ Gruppengrößen ca. 8 - 10 Schüler für einen Betreuer , erreicht durch zusätzliche<br />
Teilung in EZ.<br />
§ Zusätzlich: Förderunterricht in Deutsch und Englisch (Schwerpunkt Kommunikation<br />
und Präsentationstechnik)<br />
§ Es sind zwar leider nur 2 x 8 UE je Semester, was aber sicherlich noch etwas<br />
stärker aufgewertet werden könnte.<br />
HTL Innsbruck, Trenkwalderstraße 2, Abt. Bautechnik - Hochbau:<br />
Pro Woche 1 "Projekttag", stundenplanmäßig bestehend aus<br />
EZ (Entwurfzeichnen; EZ-Teiler) 7 Einheiten<br />
MOB (Modellbau) 2 Einheiten<br />
9 Einheiten<br />
Unterrichtserteilung in Zeichensaal bzw. CAD-Saal.<br />
Ständige Betreuung der Gruppen in den Fächern S (Statik), SBB (Stahlbetonbau),<br />
SHB (Stahl- und Holzbau) und BBB (Baubetrieb), vorwiegend in den<br />
stundenplanmäßigen Unterrichtsstunden, darüber hinaus auch am Projekttag in den<br />
EZ-Stunden.<br />
Spezielle Projekttage im Jänner (3 aufeinanderfolgende Tage) mit ganztägiger<br />
Anwesenheit aller Betreuungslehrer; seit diesen Projekttagen auch ständige<br />
Betreuung in Englisch und Deutsch (Präsentationsübungen mit Video).
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
HTL Innsbruck, Trenkwalderstraße 2, Abt. Bautechnik - Tiefbau:<br />
Pro Woche 1 "Projekttag", stundenplanmäßig bestehend aus<br />
BZU (Bauzeichnen mit Übungen) 2 Einheiten<br />
pro beteiligtem Gegenstand (d.h. Baubetrieb,<br />
Baukonstruktion, Brückenbau, Siedlungswasserbau,<br />
Stahlbetonbau, Statik, Vermessungswesen,<br />
Verkehrswegebau) je 1 Einheit, insgesamt 7 Einheiten<br />
9 Einheiten<br />
Ständige Betreuung aller Gruppen an diesem Projekttag, weitere Betreuung nach<br />
Bedarf auch außerhalb dieser Zeiten.<br />
HTL Imst, Abt. Bautechnik, - Tiefbau-Holzbau:<br />
Modell 97/98<br />
Pro Woche 1 "Projekttag", stundenplanmäßig bestehend aus<br />
BZU (Bauzeichnen mit Übungen; KU/CAD-Teiler) 5 Einheiten<br />
Darüber hinaus an diesem Projekttag möglichst viele Stunden aus<br />
Pflichtgegenständen, die gleichfalls am Projekt beteiligt sind.<br />
Geplantes Modell (ab 98/99)<br />
Gegenstand "Projekt", gebildet aus:<br />
Vorteile:<br />
Bauzeichnen (KU/CAD-Teiler) 5 (von 5) Einheiten<br />
Statik 1 (von 3) Einheiten<br />
Holzbau 1 (von 5) Einheiten<br />
Stahlbetonbau 1 (von 3) Einheiten<br />
Baubetrieb 1 (von 3) Einheiten<br />
9 (von 19) Einheiten<br />
* Es wären den ganzen Tag mind. 2 Betreuungslehrer anwesend.<br />
* Je nach Projektphase könnten die Fachtheoretiker fachspezifisch eingebunden<br />
werden.<br />
* In den jeweiligen Fachgebieten wäre je nach Bearf eine intensivere und flexible<br />
Betreuung der Schüler möglich.<br />
* Die Betreuung der Schüler wäre qualitativ und quantitativ verbessert.<br />
* Die Schüler könnten ganztägig an ihren Projekten arbeiten und die Infrastruktur<br />
wie CAD-Anlagen stünden ihnen länger zur Verfügung als derzeit.<br />
Beispiele Wirtschaftsingenieur<br />
HTL Jenbach, Abt. Wirtschaftsingenieurwesen:<br />
Pro Woche 1 "Projekttag", an dem ganztägig an den Projekten gearbeitet wird und<br />
kein weiterer lehrplanmäßiger Unterricht (auch kein Laborunterricht) stattfindet.<br />
Für die Betreuung werden dzt. 3 (von 6) Laborstunden verwendet ("normaler"<br />
Laborunterricht in den restlichen 3 Laborstunden).<br />
Für die 3 Themenschwerpunkte<br />
- Betriebstechnik, -organisation und -management, Materialfluß, Logistik etc.<br />
- Produktionsplanung und -steuerung, EDV, Betriebstechnik,<br />
Qualitätsmanagement etc.<br />
Seite 29
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Seite 30<br />
- Produktentwicklung u. -gestaltung, Entwicklung von Vorrsichtungen u.<br />
Konstruktion etc.<br />
werden dzt. 3 Betreuungslehrer eingesetzt.<br />
Bei 4 Laborgruppen betreut jeder Betreuungslehrer 4 Projektgruppen für jeweils 3<br />
Stunden, hat somit 12 Wochenstunden für Projektbetreuung zur Verfügung. Der<br />
Betreuungslehrer hat in Eigenverantwortung für die korrekte Einhaltung der ihm<br />
abgegoltenen Wochenstunden zu sorgen.<br />
Hinweis:<br />
5.3 Finanzierung<br />
Im Falle des Einstellens eines Projektes arbeiten die betroffenen Schüler ab diesem<br />
Zeitpunkt für den Rest des Schuljahres in den 3 Laborstunden wie bisher üblich im<br />
Labor und bereiten sich damit auf die 40-stündige Projektklausur vor.<br />
Projekte kosten Geld. Auch bei Ausnutzung aller Möglichkeiten einer Fremdfinanzierung ist es<br />
notwendig, einzelne wichtige Bestandteile auf dem freien Markt zuzukaufen, auch wenn dadurch<br />
das Schulbudget belastet wird. Daher ist die Unterstützung durch die Schulleitung Voraussetzung<br />
für einen optimale Durchführung von Projekten.<br />
5.3.1 Externe (Re)Finanzierung<br />
• Außerschulischer Projektpartner<br />
Sofern ein Projekt gemeinsam mit einer Firma realisiert wird, ist ein Auftraggeber vorhanden<br />
und die grundlegende Finanzierung bereitet im Wesentlichen keine Schwierigkeiten<br />
(Detailliertere Ausführungen siehe Abschnitt 4.2).<br />
• (Re)Finanzierung durch Institutionen<br />
Darüber hinaus gibt es aber auch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, die Projektkosten<br />
teilweise wieder ersetzt zu bekommen. Anzuführen sind hier Elternverein, Schulball, Kuratorium,<br />
Absolventenverein, Förderverein,... Aber auch Institutionen ohne unmittelbaren<br />
Bezug zur Schule („Jugend innovativ“, Umweltfonds, Sponsorbörsen…) bieten Möglichkeiten<br />
für Förderungsmittel.<br />
Eine Liste solcher weiterer Förderer mit Adresse und Telefon- bzw. Faxangabe findet<br />
sich im Anhang. Es sollte aber nicht verabsäumt werden, bei den genannten Institutionen<br />
vor einem Ansuchen um Unterstützung anzurufen, um herauszufinden, welche<br />
Schwerpunkte im Projekt-Antrag als besonders förderungswürdig angesehen werden.<br />
• Wettbewerbe<br />
Oftmals werden Projekte durch erfahrene Projektleiter bei verschiedenen Wettbewerben eingereicht<br />
und gewinnen dort einen Preis oder zumindest einen Anerkennungspreis. Ist vereinbart,<br />
daß Preisgelder (ev. anteilig) der Schule zufließen, verfügt der Projektleiter in der<br />
Folge über eine „Handkassa“, aus der viele Kleinigkeiten unbürokratisch bestritten werden<br />
können. Sehr günstig sind dabei zur Zeit Projekte, die in Richtung Umweltschutz oder alternative<br />
Energien ausgerichtet sind, da es hier zusätzliche Wettbewerbe und Mittel gibt.<br />
Beispiele: Umweltschutzpreis des Landes oder der Stadt, Wettbewerb des regionalen<br />
Energieversorgungsunternehmens. Projekte, die der Verkehrssicherheit dienen,<br />
werden auch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit prämiert.
5.3.2 Interne Finanzierung aus dem Schulbudget (UT3, UT8)<br />
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Was an Mitteln nicht aus den oben genannten Quellen aufgebracht werden kann, muß unter<br />
Beachtung der Wirtschaftlichkeit aus Schulmitteln bestritten werden. Die Modelle der Aufteilung<br />
sind dabei unterschiedlich:<br />
• Individuelle Zuteilung direkt durch die Schulleitung je einzelnes Projekt<br />
• Generelle Zuteilung mit fixem Kostenlimit für jedes Projekt<br />
• Mittelzuteilung an die Abteilung, die dann eigenverantwortlich unter ihren Projekten<br />
verteilt<br />
Als Besonderheit sind Projekte anzusehen, mit deren Realisierung eine innerschulische<br />
Wertschöpfung verbunden ist. Sie finanzieren sich, unmittelbar oder langfristig, direkt oder<br />
indirekt, selbst (Abwicklung über sogenannte „Lieferschein-Rechnung“ ).<br />
Beispiele: Spitzenlastüberwachung mit Lastabwurfschaltung erspart 20.000,-<br />
Stromkosten pro Jahr, Selbstbau von Labormodellen, Erzeugung von Warmwasser für<br />
die Schule mit einer Solaranlage, ...<br />
5.4 Materialbeschaffung und Abrechnung<br />
Das Wissen über Möglichkeiten einer günstigen Beschaffung von Materialien ist eine<br />
Kompetenz, die sich nach einiger Zeit von selbst einstellt und die auch Teil des Lehrzieles ist.<br />
Schüler sollten deshalb hier möglichst eigeninitiativ agieren können, müssen aber natürlich<br />
einer ständigen Kontrolle unterliegen. Die Information, ob und welche Materialien in der<br />
eigenen Schule vorhanden sind, welche Materialien von Firmen kostenlos zur Verfügung gestellt<br />
werden etc., erhalten Schüler aus vielfältigen Quellen (Projektleiter, andere betreuende Lehrer,<br />
Mitschüler aus anderen Projekten…).<br />
Bei der Materialbeschaffung steht sehr oft der Wunsch nach Kostenminimierung in Widerspruch<br />
mit Qualitätsansprüchen und der Forderung nach termingerechter Fertigstellung.<br />
Die Optimierung dieser „Schere“ ist ebenfalls wesentlicher Teil des Bildungszieles.<br />
Eine ordnungsgemäße Abrechnung des Projektes sollte unbedingt gewährleistet sein. Es ist<br />
auch sinnvoll, dabei den Arbeitsaufwand mit erfassen zu lassen.<br />
Seite 31
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
6. ABSCHNITT : RECHTLICHE FRAGESTELLUNGEN<br />
Das folgende Kapitel soll grundlegende und allgemein als wesentlich angesehene Rechtsfragen<br />
im Zusammenhang mit der Durchführung von ITP in den wichtigsten Punkten beantworten,<br />
respektive auf offene Fragen und Probleme hinweisen. Die einzelnen Themen betreffen ausschließlich<br />
konkrete Fragen und Probleme, die bereits in der Praxis aufgetreten sind. Eine<br />
laufende Erweiterung der Liste aus Anfragen und konkreten Anlaßfällen für spätere Ausgaben ist<br />
beabsichtigt.<br />
Die einzelnen Punkte dieses Kapitels wurden in Zusammenarbeit mit der zuständigen Rechtsabteilung<br />
des BMUK (III/B/5 und III/D/16) ausgearbeitet.<br />
6.1 Aufsichtspflicht<br />
Eine der häufigst gestellten Fragen betrifft die Aufsichtspflicht bei selbständigen Schülerarbeiten<br />
im Rahmen des Unterrichtes in Werkstätten, Labors und besonders außer Haus.<br />
Diesbezüglich finden der Aufsichtserlaß (derzeit gültige Fassung vom 20. August 1997 mit der<br />
Zl. 10.361/115-III/4/96) und (in eingeschränktem Maße) der Grundsatzerlaß zum Projektunterricht<br />
vom 3. November 1992 (RS 400/1992 mit der Zl. 10.055/23-Präs. 20a/92) Anwendung.<br />
In beiden finden sich zu dem angesprochenen Thema klare Aussagen. Die Wesentlichen<br />
seien hier in der Folge angeführt.<br />
Im Grundsatzerlaß zum Projektunterricht findet sich gerade unter dem Punkt „Aufsichtspflicht“<br />
vorerst ein klarer Hinweis über die Ziele projektorientierten Arbeitens und über die grundsätzlichen<br />
Rahmenbedingungen:<br />
„Bezüglich der Aufsichtspflicht möge unter Beachtung des Prinzips der Selbsttätigkeit der<br />
Schüler/innen dafür gesorgt werden, daß<br />
§ die Schüler/innen zur Projektdurchführung innerhalb eines bestimmten räumlich abgegrenzten<br />
Bereiches und innerhalb eines genau festgesetzten Zeitraumes selbsttätig wirken,<br />
§ die Schüler/innen vor etwaigen besonderen Gefahren gewarnt wurden,<br />
§ der aufsichtsführende Lehrer/die aufsichtsführende Lehrerin von den Schüler/innen jederzeit<br />
erreicht werden kann (Festlegung eines Treffpunktes),<br />
§ bei der Festlegung des räumlich abgegrenzten Bereichs und des festgesetzten Zeitraumes<br />
auf die körperliche und geistige Reife der Schüler/innen zu achten ist und diese gegenüber<br />
möglichen Gefahren abzuwägen sind,<br />
§ die Schüler/innen im Zuge des selbsttätigen Handelns nicht einzeln, sondern zumindest<br />
paarweise agieren.“<br />
Wesentlich detailliertere Aussagen finden sich dann im Aufsichtserlaß:<br />
Betreffend Aufsichtspflicht bei selbständiger Arbeit außerhalb der Schule:<br />
§ „Wenn ein Schüler ab der 9. Schulstufe in Erfüllung lehrplanmäßiger Aufgaben, die ein<br />
selbständiges Handeln erfordern, während des Unterrichtes[,…]Tätigkeiten (zum Beispiel<br />
[…], Ausführung von Arbeitsaufträgen im Rahmen eines projektorientierten Unterrichts etc.)<br />
an einem anderen Ort verrichten muß, so kann eine Beaufsichtigung sowohl auf dem Weg<br />
als auch an dem betreffenden Ort entfallen; der Schüler ist jedoch vorher vom Lehrer vor<br />
etwaigen besonderen Gefahren zu warnen.“ (Aufsichtserlaß, Abs. 1.5)<br />
Seite 32
Betreffend inhaltliche Bedeutung des Begriffes Aufsichtspflicht:<br />
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
„…ergibt sich, daß sich eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufsichtspflicht nicht nur auf<br />
die ausdrücklich erwähnte körperliche Sicherheit bzw. Gesundheit der Schüler bezieht, sondern<br />
darüber hinaus auch die Verpflichtung beinhaltet, körperlichen bzw. wirtschaftlichen Schaden<br />
von dritten Personen bzw. deren Eigentum, ebenso wie etwa von Bundeseigentum, hintanzuhalten.“<br />
(Aufsichtserlaß, Abs. 5.1)<br />
Des weiteren finden sich klare Aussagen bezüglich Instruktionen für das Arbeiten an<br />
Maschinen:<br />
„Die Schüler sind vor dem Gebrauch von Maschinen und Geräten, die eine Gefährdung verursachen<br />
können, auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam zu machen.“<br />
(Aufsichtserlaß, Abs. 6)<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, ob an dritte Personen (z.B. Firmenangestellte)<br />
Aufsichtspflicht weitergegeben werden kann. Auch hier finden sich im Aufsichtserlaß, Punkt<br />
11, (respektive im SchUG) klare Aussagen:<br />
„§44a SchUG: Die Beaufsichtigung von Schülern […] kann auch durch andere geeignete<br />
Personen als durch den Lehrer oder Erzieher erfolgen, wenn dies<br />
• zur Gewährleistung der Sicherheit für die Schüler erforderlich ist und<br />
• im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben der Schule zweckmäßig ist.<br />
Diese Personen […] werden funktionell als Bundesorgane tätig.<br />
Hierbei ist allerdings zu beachten, daß der Schulleiter, welchem in diesem Fall die Übertragung<br />
der Aufsichtspflicht obliegt, gemäß §1313a ABGB das Auswahlverschulden […] treffen kann.<br />
[…]. Diese Personen sind auf die die Aufsichtspflicht betreffenden Vorschriften ausdrücklich<br />
hinzuweisen.“<br />
Die Übertragung der Aufsichtspflicht an verantwortliche Personen (etwa in Firmen) obliegt<br />
grundsätzlich dem Direktor. Wenn ein Lehrer die Aufsicht in besonderen Situationen nicht<br />
führen kann, so hat er andere geeignete Personen zur Aufsichtsführung heranzuziehen. Es kann<br />
aber durchaus auch der Fall eintreten (bei ITP gar nicht so selten), daß diese Übertragung der<br />
Aufsichtspflicht notwendigerweise auf Grund ad hoc eintretender Situationen dem Aufsicht<br />
führenden Lehrer zufällt. Dabei ist zu beachten, daß das Auswahlverschulden gemäß § 1313 a<br />
ABGB dann den die Aufsicht übertragenden Lehrer treffen kann. Ebenso darf nicht unterlassen<br />
werden, dritte Personen, denen eine Aufsichtsführung übertragen wird, klar auf die Übernahme<br />
ihrer damit verbundenen Pflichten hinzuweisen.<br />
Ansonsten scheinen alle Aussagen so klar, daß eine weitere Kommentierung entfallen kann.<br />
6.2 Haftungsansprüche und Versicherungsschutz<br />
In dieser Frage verweist die Rechtsabteilung vorerst grundsätzlich auf den Aufsichtserlaß,<br />
Abschnitt ”Aufsichtsführung und Zivilrecht” (Punkte 20. bis 24.), der insbesondere die<br />
Amtshaftung und die Schülerunfallversicherung behandelt.<br />
Zur weiteren Präzisierung läßt sich dieses Kapitel dann in 2 Punkte unterteilen.<br />
Seite 33
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
6.2.1 Haftungsansprüche an den Lehrer, respektive an dritte Aufsichtspersonen<br />
Dieser Punkt ist klar und einfach zu beantworten. Für Schäden, die Lehrer oder andere Aufsichtspersonen<br />
in Vollziehung des Schulrechtes wem immer rechtswidrig und schuldhaft zufügen,<br />
haftet der BUND (eine zivilrechtliche Haftung des Lehrers ist dadurch ausgeschlossen).<br />
Lediglich im Falle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens des Lehrers oder einer anderen<br />
Aufsichtsperson kann der Bund Regreßansprüche geltend machen (im Detail siehe oben<br />
zitierten Erlaß).<br />
6.2.2 Haftungsansprüche an Schüler/innen<br />
Hierzu ist zu vermerken, daß Schüler prinzipiell mit vollendetem 14. Lebensjahr deliktsfähig<br />
sind, d.h. diese können für den von ihnen rechtswidrig und schuldhaft zugefügten Schaden selbst<br />
zur Haftung herangezogen werden!<br />
In Einzelfällen könnte im Rahmen eines Ingenieur/Technikerprojektes von einem erhöhten<br />
Risiko auszugehen sein, bei dem sich der Abschluß einer zusätzlichen Haftpflichtversicherung<br />
empfiehlt. Damit verbundene Kosten könnten jedoch nicht auf den Bund überwälzt<br />
werden, sondern müßten grundsätzlich von außerschulischen Partnern oder den Schülern selbst<br />
finanziert werden. Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, daß der Elternverein auf<br />
freiwilliger Basis eine eventuelle Versicherungsprämie bezahlt. Eine unmittelbare Finanzierung<br />
durch die Eltern der am jeweiligen Projekt beteiligten Schüler ist jedoch in jedem Falle wegen<br />
der Schulgeldfreiheit auszuschließen.<br />
6.3 Dislozierte Arbeiten im Rahmen des ITP<br />
6.3.1 Stellung nicht eigenberechtigter Schüler<br />
Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, inwieweit für nicht eigenberechtigte Schüler etwa bei<br />
Tätigkeiten außerhalb des Schulbereiches oder bei Mitfahrten Einverständniserklärungen der<br />
Erziehungsberechtigten notwendig sind.<br />
Bei den ITP handelt es sich um lehrplanmäßigen Unterricht. Hinsichtlich der Tätigkeiten von<br />
nicht eigenberechtigten Schülern außerhalb des Schulbereiches finden sich im Aufsichtserlaß<br />
klare Regelungen. Demnach können Schüler ab der 9. Schulstufe anschließend an einen in der<br />
Schule stattfindenden Unterricht, wenn es ihre körperliche und geistige Reife zuläßt, auch ohne<br />
Aufsicht und ohne Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten an den betreffenden Ort<br />
und zurückgeschickt werden bzw. können sie gleich vom Ort dieses Unterrichts, wenn dies<br />
zweckmäßig erscheint, nach Hause geschickt werden. Findet der Unterricht in der ersten Unterrichtsstunde<br />
an einem anderen Ort statt, so sind die Erziehungsberechtigten davon zu verständigen<br />
(nur Verständigungspflicht!).<br />
6.3.2 Benutzung von Privat-PKW durch Schüler<br />
Ein dabei häufig auftretenden Problem, speziell außerhalb der städtischen Ballungszentren, wo<br />
eine ausreichende Versorgung durch öffentliche Verkehrsmittel nicht gegeben ist, ist die Benutzung<br />
privater Kraftfahrzeuge durch Schüler bei der Erledigung von Arbeitsaufträgen außerhalb<br />
des Schulbereiches.<br />
Seite 34
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Eine solche Benutzung privater Fahrzeuge wird durch die Rechtsabteilung grundsätzlich aus<br />
der Sicht des Schülers als problematisch angesehen, sowohl aus haftungsrechtlichen Gründen<br />
(keine Haftung durch den Bund!), aus Gründen der Sicherheit und letztlich auch in Hinblick auf<br />
das finanzielle Risiko für den Schüler selbst.<br />
6.3.3 Benutzung von Privat-PKW durch Lehrer, Dienstreiseauftrag<br />
Anders stellt sich die Situation für den Lehrer dar. Benutzt dieser für eine Fahrt in Ausübung<br />
seiner Tätigkeit als Projektbetreuer den Privat-PKW, so versieht er seinen regulären Dienst<br />
und bedarf deshalb auch des ihm zustehenden rechtlichen Schutzes (Sachschäden, Unfallfolgen…)<br />
durch den Bund. Basis dafür ist grundsätzlich ein ordnungsgemäßer Dienstreiseauftrag.<br />
Da aber ein (schriftlicher) Dienstreiseauftrag sich lediglich auf eine bestimmte Fahrt<br />
bezieht, ist es häufig bürokratisch zu aufwendig (z..B.: jede Woche Mittwoch über 8 Monate<br />
hinweg ergeben gut 30 Dienstreiseaufträge…) oder auch gar nicht möglich (spontan auftretende<br />
Situationen), für jede einzelne Fahrt einen solchen auszustellen. Aus diesem Grund wurde die<br />
Frage an uns herangetragen, ob nicht so etwas wie ein „Pauschal-Dienstreiseauftrag“ (etwa<br />
projektbezogen) möglich wäre.<br />
Ein solcher ist in diesem Sinne nicht möglich, aber auch gar nicht erforderlich! Die Rechtslage<br />
ist einfacher und unbürokratischer. Eine mündliche Anweisung des Dienststellenleiters für<br />
eine Fahrt in Ausübung des regulären Dienstes (Unterrichts) ist hinsichtlich der dienstrechtlichen<br />
Sicherstellung des Beamten einem schriftlichen Dienstreiseauftrag gleichzusetzen. Der notwendige<br />
Schutz des Lehrers ist also bereits gegeben, wenn der Direktor seine mündliche<br />
Zustimmung zu der (Dienst)Fahrt gibt, es bedarf nicht zwingend einer schriftlichen Form.<br />
Probleme könnten sich allenfalls nur ergeben, wenn der Vorgesetzte, aus welchen Gründen<br />
auch immer, sich später nicht mehr an seine mündlich gegebene Anweisung erinnert. Es empfiehlt<br />
sich daher, von vornherein ein Übereinkommen anzustreben, das im Ernstfall einen<br />
Nachweis erleichtert oder garantiert. Ein Weg wäre beispielsweise das Auflegen einer Liste in<br />
der Direktionskanzlei, in welche der Lehrer beim Einholen der mündlichen Fahrtanweisung kurz<br />
Datum, Ziel und Zweck einträgt, mit kurzer Gegenzeichnung des Direktors. Dieser minimale<br />
Bürokratieaufwand bringt hohe Sicherheit für den Betroffenen. Aber auch andere Modelle, die<br />
einen Nachweis sicherstellen, sind möglich.<br />
6.3.4 Mitfahren von Schülern im PKW des Lehrers<br />
Das Mitfahren von Schülern in Privat-Pkw´s von Lehrern kann seitens der Rechtsabteilung<br />
aus haftungsrechtlichen Gründen grundsätzlich nicht empfohlen werden.<br />
6.4 Benutzung fremder Ressourcen<br />
Diese Frage wäre im Einzelfalle mit dem jeweiligen schulischen Partner auszuverhandeln.<br />
Klare Regelungen sollten von Anbeginn an in einem eventuellen Vertrag aufgenommen werden.<br />
Nachträgliche Veränderungen bedürfen des gegenseitigen Einverständnisses.<br />
Seite 35
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
6.5 Produkthaftung<br />
Eine der häufigst gestellten Fragen im Zusammenhang mit den ITP betrifft die Produkthaftung.<br />
Dazu gibt es ebenfalls klare Aussagen aus der Rechtsabteilung:<br />
Unter Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) versteht man die schadenersatzrechtliche<br />
Verantwortlichkeit des Herstellers für sein Erzeugnis. Sie ist eine vom Verschulden<br />
unabhängige Haftung, die jeder beliebige Geschädigte in Anspruch nehmen kann. Ersetzt<br />
werden Personen- und Sachschäden, die durch Fehler verursacht werden, welche das Produkt<br />
beim Inverkehrbringen durch den Haftpflichtigen hatte. Nach dem Produkthaftungsgesetz<br />
haftet der Unternehmer, der das Produkt hergestellt und in den Verkehr gebracht hat.<br />
Hersteller ist jener, der das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt erzeugt hat. Ein<br />
Produkt ist in Verkehr gebracht, sobald es der Unternehmer, gleich aufgrund welchen Titels (z.B.<br />
Kauf, Tausch, Leihe, Schenkung !!), einem anderen zu dessen Gebrauch übergeben hat.<br />
Das Bundesgesetz zum Schutz vor gefährlichen Produkten (Produktsicherungsgesetz – PSG) hat<br />
darüber hinaus das Ziel, Leben und Gesundheit von Menschen vor Gefährdungen durch gefährliche<br />
Produkte zu schützen und legt den Herstellern und Importeuren diverse Pflichten auf (Aufklärungspflichten,<br />
erforderlichenfalls Rückruf, Pflicht, nur sichere Produkte in Verkehr zu bringen,<br />
sich auch nach dem Inverkehrbringen eines Produktes über Tatsachen und Umstände zu<br />
informieren, die auf eine Gefahr hinweisen), deren Zuwiderhandeln als Verwaltungsübertretung<br />
bestraft werden kann.<br />
Im Zusammenhang mit den Ingenieur/Technikerprojekten ist bei Herstellung eines Teil-<br />
oder Endproduktes und bei Übereignung dieses Produktes an den außerschulischen Partner<br />
(”Inverkehrbringen”) eine Inanspruchnahme nach dem PHG bzw. ein Zuwiderhandeln gegen<br />
die Vorschriften des PSG möglich.<br />
Achtung!! Seit 1.1.1994 ist der vertragliche Ausschluß oder die Beschränkung der Produkthaftungsansprüche<br />
im Voraus gesetzlich nicht mehr möglich.<br />
(Anmerkung: Vor dem 1.1.1994 war es rechtlich zulässig, die Haftung nach dem PHG für Sachschäden<br />
eines Unternehmers auszuschließen).<br />
Für im Rahmen der Ingenieur/Technikerprojekte hergestellte Produkte haftet somit der<br />
Bund (siehe Punkt 6.2) nach dem Produkthaftungsgesetz und nach dem Produktsicherungsgesetz.<br />
Eine vertragliche Ausschlussklausel wäre gesetzeswidrig und im Streitfalle vor Gericht<br />
unwirksam.<br />
6.6 CE-Kennzeichnung und deren Finanzierung<br />
Die CE-Kennzeichnung von Produkten, mit der die Übereinstimmung des Produktes mit einer<br />
harmonisierten europäischen Norm dokumentiert wird, ist kein Qualitäts-, Güte- oder Normkennzeichen.<br />
Die Idee des CE-Zeichen ist, die zum Teil unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften<br />
der einzelnen EU-Staaten betreffend Produktsicherheit durch eine einheitliche<br />
gemeinschaftliche Kennzeichnung zu ersetzen und dadurch Handelshemmnisse zu beseitigen. Da<br />
die CE-Richtlinien nicht direkt anwendbar sind, erfolgt die Umsetzung durch den nationalen<br />
Gesetzgeber, in Österreich durch entsprechende Verordnungen. In den CE-Richtlinien ist daher<br />
eine Übergangsfrist festgelegt, bis zu welchem Zeitpunkt spätestens die Richtlinie national<br />
umgesetzt werden muß.<br />
Seite 36
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Ob beim Inverkehrbringen eines Produktes im konkreten Fall eine Kennzeichnungspflicht<br />
besteht, hängt davon ab,<br />
- ob das Produkt überhaupt unter eine CE-Richtlinie fällt und<br />
- ab welchem Zeitpunkt die CE-Richtlinie zwingend die CE-Kennzeichnung vorschreibt.<br />
Eine gute Übersicht mit den aktuellen Richtlinien und den dazugehörigen Verordnungen sowie<br />
den zwingenden Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie, weiters eine Liste der notifizierten<br />
Prüfstellen finden Sie auf der Webseite des WIFI unter der Adresse: http://www.wifi.at. Ob<br />
und in welcher Weise eine notifizierte Prüfstelle eingeschaltet werden muß, hängt von den in<br />
den Anhängen der Richtlinien aufgelisteten Anforderungen oder Gefährdungen des Produktes<br />
ab. Im Regelfall kann der Hersteller dies selbst vornehmen (siehe gleiche Webseite unter ”Der<br />
Weg zum CE-Zeichen”).<br />
Wenn ein Produkt nicht oder falsch gekennzeichnet wird, so ist eine Rückholung des Produktes<br />
(Außerverkehrsetzung), eine Geldstrafe nach § 366 GewO und eine strafrechtliche Verfolgung<br />
nach UWG (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) möglich.<br />
Auch eine Deklaration als „Prototyp“ verhindert eine CE-Auszeichnungspflicht grundsätzlich<br />
nicht. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob der Hersteller selbst die in den Richtlinien aufgelisteten<br />
Anforderungen oder Gefährdungen des Produktes überprüfen kann (Konformitätsbewertungsverfahren).<br />
In diesem Falle ist er berechtigt, die nach den EG-Richtlinien notwendige<br />
Konformitätserklärung (Name und Adresse der Herstellers, Beschreibung des Produktes, die<br />
beachteten Richtlinien und Normen u.a) selbst zu erstellen und das CE-Kennzeichnen am<br />
Produkt anzubringen (siehe gleiche Webseite unter „Wie kommen sie zu einem CE-Zeichen? –<br />
Im Regelfall: Do it yourself).<br />
Die Kosten für eine solche Produktkennzeichnung hat in jedem Falle der Auftraggeber zu<br />
übernehmen.<br />
6.7 Patentrecht, Urheberrecht, Publikationsrecht<br />
Hier gab die Rechtsabteilung eine sehr ausführliche Darstellung, die hier weitgehend ungekürzt<br />
wiedergegeben werden soll.<br />
6.7.1 Patentrecht:<br />
Unter Patentrecht versteht man das dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger durch Verwaltungsakt<br />
erteilte Recht auf ausschließlichen Gebrauch und ausschließliche Verwertung einer<br />
Erfindung. Das Patentrecht entsteht erst durch die Patenterteilung und dauert längstens 18<br />
Jahre ab Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt. Der Anspruch auf das Patent<br />
(=Patenterteilung) wird durch Patentanmeldung geltend gemacht und steht dem Erfinder oder<br />
seinem Rechtsnachfolger zu.<br />
Angesichts des fortgeschrittenen Standes der Technik ist es heute fast die Regel, daß eine Erfindung<br />
nicht von einem Einzelnen gemacht, sondern gemeinsam erarbeitet wird. Mehreren Miterfindern<br />
wird das Patent gemeinsam (ohne Festsetzung von Quotenanteilen) verliehen. Sie<br />
können darüber nur gemeinsam verfügen, doch ist jeder Einzelne befugt, Patentverletzungen<br />
gerichtlich zu verfolgen.<br />
Seite 37
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Der Anspruch auf ”Nennung als Erfinder” steht dem Erfinder auch dann zu, wenn er seinen<br />
Anspruch auf das Patent übertragen hat. Dieser ”Schutz der Erfinderehre” nach § 20 PatG ist<br />
unübertragbar und unverzichtbar.<br />
Erfindungen von Dienstnehmern<br />
Grundsätzlich haben Dienstnehmer auch für Diensterfindungen Anspruch auf Patenterteilung.<br />
An Diensterfindungen eines in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden<br />
Erfinders hat der Dienstgeber kraft Gesetz (§ 7 Abs. 2 PatG) ein Aufgriffsrecht. Er kann,<br />
ohne daß es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindung zur<br />
Gänze für sich in Anspruch nehmen oder er kann sich mit einem gegen Dritte wirkenden<br />
Benützungsrecht begnügen. Ist das Dienstverhältnis privatrechtlich, so bedarf es für den Übergang<br />
der Diensterfindung auf den Dienstgeber einer schriftlichen einzel- oder kollektivvertraglichen<br />
Regelung. Der Dienstnehmer ist dann verpflichtet, eine Erfindung unverzüglich dem<br />
Dienstgeber mitzuteilen. Der Dienstgeber hat innerhalb von 4 Monaten nach dieser Mitteilung zu<br />
erklären, ob er die Erfindung als Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt (§ 12 Abs. 1<br />
PatG). Versäumt der Dienstgeber die Erklärung oder gibt er eine verneinende Erklärung ab, so<br />
verbleibt die Erfindung dem Dienstnehmer.<br />
Nimmt der Dienstgeber die Diensterfindung für sich in Anspruch, so gebührt dem Dienstnehmer<br />
eine angemessene Vergütung (§ 8ff PatG), auf die der Dienstnehmer nicht verzichten<br />
kann (§ 17 PatG).<br />
Erfindungen von Schülern<br />
Bereits Kinder können eine patentierfähige Erfindung machen, bedürfen jedoch, um ihren<br />
Anspruch auf Patenterteilung durch Anmeldung beim Patentamt geltend zu machen, der<br />
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Schüler im Alter von 14-19 Jahren (so genannte<br />
”Mündige Minderjährige”) sind beschränkt geschäftsfähig und können sich soweit verpflichten,<br />
als dadurch nicht die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse gefährdet wird. Sie bedürfen<br />
daher in der Regel für die Anmeldung ihres Patentanspruches nicht der Zustimmung des gesetzlichen<br />
Vertreters, da die mit der Patentanmeldung verbundenen Jahresgebühren relativ niedrig<br />
sind und auf Antrag die Anmeldegebühr und die Jahresgebühr für die ersten 3 Jahre gestundet<br />
werden können,<br />
- wenn der Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist oder<br />
- eine Anmeldung vorliegt, die offensichtlich zur Gewinnung oder Einsparung von Energie<br />
zum Ziel hat (§ 171 PatG).<br />
Wenn das Patent bis zum Ablauf des dritten Jahres der Schutzdauer erlischt, werden die gestundeten<br />
Gebühren sogar erlassen.<br />
In Kooperationsverträgen, die der Bund abschließt, kann er aus patentrechtlicher Sicht nur<br />
über jene Rechte verfügen, die ihm durch Gesetz (z.B. Erfindungen eines Dienstnehmers im<br />
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis) oder Vertrag (z. B. Erfindungen eines Dienstnehmers<br />
im privatrechtlichen Dienstverhältnis, Schüler) übertragen wurden. Bei Schülern bedarf es<br />
hiebei der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.<br />
Seite 38
6.7.2 Urheberrecht<br />
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat. Haben mehrere gemeinsam ein Werk geschaffen,<br />
bei dem die Ergebnisse ihres Schaffens eine untrennbare Einheit bilden, so steht das Urheberrecht<br />
allen Miturhebern gemeinsam zu. Damit ein Ergebnis menschlichen Schaffens als<br />
Werk im urheberrechtlichen Sinn qualifiziert werden kann, muß es eine eigentümliche geistige<br />
Schöpfung (d.h. das Werk muß Einmaligkeit und Individualität aufweisen) auf den Gebieten der<br />
Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste (Baukunst, Kunstgewerbe, Lichtbildkunst) und der<br />
Filmkunst sein. Auch Computerprogramme genießen urheberrechtlichen Schutz, da Software<br />
als Sprachwerk und somit als Werk der Literatur angesehen wird. Im Unterschied zum<br />
Patentrecht entsteht das Urheberrecht bereits mit der geistigen Schöpfung. Dem Urheber steht<br />
das alleinige Recht zu, über sein Werk zu verfügen. Er darf sein Werk veröffentlichen, vervielfältigen,<br />
verbreiten, senden (Rundfunk und Fernsehen), vortragen, vorführen oder aufführen<br />
lassen. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, der Urheber kann jedoch in Verträgen anderen<br />
Personen Befugnisse an seinem Werk einräumen. Man unterscheidet die Einräumung ausschließlicher<br />
Befugnisse (=Werknutzungsrechte) und nicht ausschließlicher Befugnisse<br />
(=Werknutzungsbewilligungen). Im Unterschied zum Urheberrecht kann das Werknutzungsrecht<br />
auch übertragen werden.<br />
Das österreichische Urheberrecht sieht im Gegensatz zum Patentrecht keine Regelung der<br />
Rechte an einem im Arbeitsverhältnis geschaffenen Werk vor. Es bedarf daher einer vertraglichen<br />
Vereinbarung, um urheberrechtliche Werke eines Dienstnehmers an den<br />
Dienstgeber zu übertragen. Auch Schüler sind bereits mit der Schaffung des Werkes Urheber<br />
bzw. Miturheber. Zur Übertragung von urheberrechtlichen Befugnissen in Form von Werknutzungsberechtigungen<br />
und -bewilligungen bedarf es der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.<br />
Der Bund kann dem Kooperationspartner daher nur dann Rechte an urheberrechtlichen<br />
Werken einräumen, wenn sie ihm seinerseits vertraglich von den Urhebern (Schülern,<br />
Lehrern) übertragen wurden.<br />
6.8 Abgabe rechtsverbindlicher Aussagen gegenüber Dritten<br />
Häufig angesprochen wird die Frage, wieweit etwa Terminabmachungen oder Aussagen bezüglich<br />
Erfüllungszusagen, die vor Ort während der Ablaufs des Projektes durch Lehrer oder gar<br />
Schüler getroffen werden, Rechtsgültigkeit haben. Diesen Punkt erläutert die Rechtsabteilung<br />
folgendermaßen:<br />
Kooperationsverträge können nur durch den Bund, vertreten durch den Landesschulrat<br />
(Stadtschulrat für Wien), dieser gegebenenfalls wiederum vertreten durch den Schuldirektor/die<br />
Schuldirektorin abgeschlossen werden. Eine weitere Vertretung (AV, Lehrer…) ist nicht<br />
möglich. Für die Abgabe rechtsverbindlicher Aussagen seitens der Schule ist daher nur der<br />
Schuldirektor/die Schuldirektorin zuständig. Um Streitigkeiten bezüglich der Verbindlichkeit<br />
von Aussagen über Kosten, Termine usw. aus rechtlicher Sicht von vornherein auszuschließen,<br />
empfiehlt es sich, im Kooperationsvertrag schriftlich festzulegen, daß verbindliche Aussagen<br />
seitens des Auftragnehmers nur von den genannten Organen erfolgen können.<br />
Seite 39
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
6.9 Abfassung eines Mustervertrages<br />
Im Verlauf der Entstehung dieser Broschüre wurde die Abfassung eines Mustervertrages öfters<br />
diskutiert, letztlich aber wiederum verworfen - und zwar sowohl von Seiten der Mitglieder des<br />
Arbeitskreises als auch durch die Rechtsabteilung selbst. Da die Landschaft der Abteilungen an<br />
den technisch-gewerblichen <strong>Schulen</strong> eine ungeheuer vielfältige ist und darüber hinaus in jeder<br />
Abteilung selbst wiederum das Feld der Themen und Aufgaben für ITP und somit die konkreten<br />
Detailprobleme einer gewaltigen Streuung unterliegen, erscheint die Abfassung eines allgemein<br />
sinnvoll verwendbaren Mustervertrages nicht möglich.<br />
Eine beratende Unterstützung bei der Abfassung von Kooperationsverträgen kann aber in<br />
Einzelfällen durch die jeweilige Schulbehörde 1. Instanz in Zusammenarbeit mit der zuständigen<br />
Rechtsabteilung (III/B/5) des BMUK erfolgen.<br />
Um als Orientierungshilfe ein konkretes Muster bereitzustellen, finden Sie im Anhang einen<br />
Vertrag, der zwischen der HTL-Eisenstadt und dem Forschungszentrum Seibersdorf abgeschlossen<br />
wurde und der durch die Rechtsabteilung III/B/5 sanktioniert wurde.<br />
6.10 Teilrechtsfähigkeit ausgeschlossen<br />
Im §128c (5) Z2 SchOG ist ausgeführt, daß im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit nur Lehrveranstaltungen<br />
durchgeführt werden können, wenn es sich nicht um schulische Lehrveranstaltungen<br />
im Rahmen des öffentlichen Bildungsauftrages handelt. Da ITP jedoch prinzipiell im Rahmen<br />
des lehrplanmäßigen Unterrichtes ablaufen, ist eine gänzliche oder auch nur teilweise<br />
Abwicklung im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit ausgeschlossen.<br />
Abschließend weist die Rechtsabteilung noch darauf hin, daß die Punkte 6.5 (Produkthaftung)<br />
und 6.6 (CE-Kennzeichnung) auch für sonstige Schülerarbeiten im lehrplanmäßigen Unterricht<br />
(etwa Erzeugnisse und Leistungen des fachpraktischen Unterrichtes) Geltung haben.<br />
Seite 40
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
7. ABSCHNITT : LITERATURANREGUNGEN<br />
zusammengestellt von AV DI F. Geretslehner, HTBLA Braunau<br />
7.1. Rechtlicher Rahmen<br />
GRUNSATZERLASS zum Projektunterricht 1992 BMUK<br />
7.2. Rhetorik<br />
Sicher präsentieren - wirksamer vortragen<br />
Emil Hierhold 1992 Überreuther Verlag<br />
Makrandreou, Mag. Margit et al.: Rhetorik, Kommunikation, Präsentation;<br />
Manz Verlag Schulbuch GmbH, Wien 1996; ISBN 3-7068-0085-3<br />
7.3. Technik<br />
Entwickler-Leitfaden Elektronik<br />
Alan D. Wilcox 1991 Hanser Verlag<br />
Maschinensicherheit<br />
auf der Grundlage der europäischen Sicherheitsnormen<br />
Winfried Gräf 1997 Hüthig Verlag<br />
Technische Dokumentation leichtgemacht<br />
H.P. Hahn Carl Hanser Verlag<br />
CE-Kennzeichnung leichtgemacht<br />
H.P. Hahn Carl Hanser Verlag<br />
Qualtiätstechniken<br />
Die Praxis der CE-Kennzeichnung Maschinen<br />
P. Theden/H.Colsman Carl Hanser Verlag<br />
Markus Hofer Wirschaftskammer OÖ<br />
Seite 41
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
ANHANG<br />
BEILAGE 1: AUFBAU EINES PFLICHTENHEFTS<br />
Seite 42<br />
1.) Einleitung<br />
§ Einführung in das Projekt<br />
§ Hintergrundinformationen<br />
§ Projektbezeichnung<br />
2.) Verwendungszweck des Produkts<br />
3.) Bezugsunterlagen<br />
§ Normen und gesetzliche Vorschriften<br />
§ Literatur zum Stand der Technik<br />
4.) Begriffe<br />
§ Legende ( die im Pflichtenheft und im Projekt verwendeten<br />
Symbole und Abkürzungen sind zu definieren)<br />
5.) Verantwortung<br />
§ Die Verantwortlichen für das Projekt müssen im Pflichtenheft<br />
festgehalten werden.<br />
6.) Spezifikationen<br />
Hinweis: Beispielhafte Auflistung - je nach Projekt sinngemäß anzuwenden!<br />
§ wirtschaftliche<br />
Marktsituation, Termine und Kosten<br />
§ technische<br />
Funktionsbeschreibung, Betriebsdaten und<br />
Leistungsmerkmale, Design<br />
Sicherheit, Zuverlässigkeit , QS-Forderungen,<br />
Umweltverträglichkeit, Zusatzbedingungen<br />
§ allgemeine<br />
Produkthaftung ( wer für das Produkt haftet )<br />
Lager- Transportbedingungen und Verpackung<br />
Wartung (Garantiezeiten, Service)
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
BEILAGE 2: PROJEKTDOKUMENTATION<br />
1. Laufende projektbegleitende Dokumentation<br />
[ unmittelbar während der Arbeit in gebundenem Heft durchzuführen (keine losen Blätter!)]<br />
• Tagesbericht über jeden Projekttag (lückenlos) - Stichworte<br />
Hinweis auf Arbeitsfortschritt: im Zeitplan in Verzug<br />
• Projekttagebuch:<br />
• Problemstellung - Pflichtenheft<br />
• Grobkonzept des Lösungsweges<br />
• Terminplan bis zur Reife- und Diplomprüfung<br />
• An jedem Tag fortlaufend - lückenlos<br />
- Alle Tätigkeiten (wie Überlegungen, Schaltungsentwürfe, Meßergebnisse,<br />
Ergebnisse von Literaturstudien, ........., Erkrankung)<br />
- Protokolle von Besprechung, Telefonaten, Diskussionen, Kundenbesuchen<br />
• Aufzeichnungen über Material und Zeitaufwand<br />
2. Reinschrift der Dokumentation<br />
Die (möglichst) gebundene Schlußdokumentation sollte nachfolgende Punkte, entsprechend dem<br />
jeweiligen Fachbereich und der speziellen Themenstellung, enthalten:<br />
§ Evaluation des Projektes<br />
(Erfahrungen des Schülers - Lernschritte - Lernergebnisse)<br />
§ Dokumentation des technischen Ablaufes ausgehend von Problemstellung - Pflichtenheft<br />
(zielführende Wege aber auch Sackgassen mit Begründungen)<br />
§ Dokumentation der Herstellung des Produktes<br />
(Fertigungsunterlagen .....)<br />
§ Kalkulation<br />
(Entwicklungskosten - Herstellungskosten)<br />
§ Dokumentation für den Kunden<br />
(Anleitung für Bedienung und Wartung,...)<br />
§ Rechtliche Vereinbarungen mit dem Kunden<br />
§ Präsentationsunterlagen<br />
§ Zusammenfassung – Schlüsselwörter<br />
(Deutsch/Englisch)<br />
§ Literatur<br />
Seite 43
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
BEILAGE 3: PROJEKTANLEITUNG FÜR SCHÜLER<br />
HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT<br />
und BUNDESFACHSCHULE<br />
im Hermann Fuchs Bundesschulzentrum<br />
A-5280 BRAUNAU/INN, Osternbergerstraße 55<br />
TEL.NR.07722/83690, FAX.NR. 07722/83690-225<br />
EMAIL: HTL.BRAUNAU@TELECOM.AT<br />
www:www.asn-linz.ac.at/schule/htlbraunau<br />
Seite 44<br />
Abteilung Elektronik/Informatik<br />
INGENIEURPROJEKT<br />
im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung<br />
Sofort mit Beginn des Schuljahres sind anzulegen:<br />
1. Projekt-Tagebuch<br />
2. Ordner für die Reinschrift der Dokumentation<br />
Zur Gestaltung des Arbeitsplatzes und zur Präsentation der Arbeit ist die Problemstellung und der Lösungsweg in<br />
einem Poster festzuhalten.<br />
Termin: 30.10.1998<br />
In dem Projekt-Tagebuch sind folgende Aufzeichnungen zu führen:<br />
1. Tätigkeitsbericht über jeden Arbeitstag (am gleichen Tag einzutragen)<br />
z.B. 16.10.98 Schaltungsentwurf: ZF-Stufe<br />
17.10.98 Literaturstudium: Auszug erarbeiten und festhalten;<br />
Besprechung oder Telefonat mit ......; Ergebnis: .........;<br />
23.10.98 Erkrankung<br />
24.10.98 Messung - Protokoll, usw.<br />
2. Eine Beschreibung des Problems (Pflichtheft)<br />
• Blockschaltbild<br />
• Grobkonzept<br />
3. Eine Terminplanung anhand des Grobkonzeptes über das Unterrichtsjahr<br />
(30 Wochen)<br />
4. Alle Arbeiten wie Entwürfe, Überlegungen, Ideen, Meßprotokolle usw. sind mit Datum<br />
in diesem Tagebuch durchzuführen bzw. einzukleben.<br />
Ebenso Besprechungsprotokolle über jedes Meeting und jedes Tel.-Gespräch.<br />
5. Auflistungen aller Bauteile und Materialien mit dem jeweiligen Preis auf dem<br />
entsprechenden Formular (Arbeitsauftrag).<br />
Aus dieser Auflistung müssen die Fertigungskosten des Gerätes und die Kosten<br />
für die Entwicklung hervorgehen.<br />
Die Reinschrift ist für fertige Teilaufgaben laufend durchzuführen und soll in einem Ordner gesammelt enthalten:<br />
• Problemstellung<br />
• Schaltpläne<br />
• Funktionsbeschreibung<br />
• Ausführliche Dokumentation für Bedienung, Wartung und Erweiterung<br />
• Kostenzusammenstellung:<br />
a) Entwicklungskosten<br />
b) Fertigungskosten für das Gerät<br />
• Fertigungsunterlagen<br />
• Präsentationsunterlagen<br />
Zusammenfassung (Englisch/Deutsch); Schlüsselwörter (Suchbegriffe)<br />
Die Dokumentation und das Projekt-Tagebuch werden laufend kontrolliert. Sie sind wesentlich für die Beurteilung<br />
der Arbeit.<br />
Als Präsentationsübung ist - nach entsprechendem Fortschritt der Problemlösung - das Projekt einschließlich des<br />
fachlichen Umfeldes den Mitschülern und den betreuenden Lehrern vorzustellen und zu diskutieren.<br />
Im Rahmen der mündlichen Reife- und Diplomprüfung ist das Ingenieurprojekt<br />
umfassend zu präsentieren.<br />
Die Befragung im fachlichen Umfeld wird kommissionell durchgeführt.
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
BEILAGE 4: VERZEICHNIS VON INSTITUTIONEN, DIE PROJEKTE FÖRDERN<br />
1. Sponsorbörse hilft bei der Suche nach Sponsoren.<br />
Die Sponsorbörse hilft bei der Suche nach Unternehmen, die Projekte in den Bereichen Sport,<br />
Kultur, Umwelt, Wissenschaft und Soziales unterstützen wollen.<br />
Kontaktadresse: Amway Sponsorbörse, c/o Hauska & Partner, Templergasse 31, 2340 Mödling,<br />
Tel.: (2236)26114-0.<br />
2. Umwelt- und Gesundheits-Bildungsfonds.<br />
Zuletzt wurden Projekte bis zu einem Maximalbetrag von S 20.000.- gefördert!<br />
Kantaktadresse: Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, Freyung 1,<br />
1014 WIEN; Tel.: (0222) 53120-0.<br />
3. „Jugend Innovativ“, Wettbewerb, Innovationsagentur G.m.b.H.,<br />
Taborstraße 10, 1020 WIEN, Tel.: (0222)2165293 - 14:<br />
Preisgelder S 100.000.--, Projektunterstützung S 7.000.--, für Internetunterstützung an der<br />
Schule gibt es eine Option.<br />
5. Projektunterstützungen bis zu S 10.000.- pro Team bei:<br />
• GPA-Jugend Hotlines, (0222) 31393-438, Deutschmeisterplatz 2, 1013 WIEN:<br />
Dort sind auch die einzelnen Landeskontaktstellen und nähere Daten zu erfragen.<br />
• „Umweltschutzpreis“ des Landes Oberösterreich. Wird jährlich vergeben.<br />
Einreichtermin 1996 S 360.000.-<br />
Kontaktadresse: OÖ. Umweltakademie, Fr. Johanna Lang, Tel.: (0732) 7720-4418 .<br />
• Erwin-Wenzl-Preis für Schüler oberösterreichischer AHS und BHS<br />
Es werden 3 Preise á S 15.000.- vergeben.<br />
Kontaktadresse: Bildungszentrum St. Magdalena, 4040 Linz, Schatzweg 177,<br />
Tel..: (0732)253041-0.<br />
Seite 45
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
BEILAGE 5: VERTRAG HTL EISENSTADT – FORSCHUNGSZENTRUM SEIBERSDORF<br />
Nachfolgend finden Sie den Inhalt eines Vertrages abgedruckt, welchen die HTL Eisenstadt für<br />
das Schuljahr 1997/98 mit dem Forschungszentrum Seibersdorf für die Durchführung von<br />
Ingenieurprojekten abgeschlossen hat. Dieser Vertrag soll eine Möglichkeit aufzeigen, wie<br />
solche Übereinkommen abgefaßt werden können, darf aber unter keinen Umständen als<br />
„Muster-Norm-Vertrag“ gesehen oder verstanden werden!<br />
Seite 46<br />
V E R T R A G<br />
über eine Kooperation bei „Ingenieurprojekten“ im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung an<br />
berufsbildenden höheren <strong>Schulen</strong>, abgeschlossen zwischen dem Bund, vertreten durch den<br />
Landesschulrat für Burgenland, dieser vertreten durch die Höhere technische Bundeslehranstalt<br />
Eisenstadt, 7000 Eisenstadt, Bad-Kissingen-Platz 3 (im Folgenden kurz „HTL-E“ genannt) und<br />
dem Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf, Gesellschaft m.b.H., 2444 Seibersdorf<br />
(im Folgenden kurz „ÖFZS“ genannt)<br />
P r ä a m b e l<br />
Das ÖFZS und die HTL-E beabsichtigen, gemeinsam ihre wissenschaftliche und technologische<br />
Kompetenz zur kooperativen Durchführung von „Ingenieurprojekten“ gemäß § 29 der<br />
Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten über die Reife-<br />
und Diplomprüfung in den berufsbildenden höheren <strong>Schulen</strong>, BGBl. Nr. 847/1992, in der<br />
Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 269/1993, Nr. 467/1996 und BGBl. II Nr. 123/97<br />
einzusetzen. Durch die Zusammenarbeit sollen insbesondere die Schüler/innen der HTL-E die<br />
Möglichkeit erhalten, im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung bei der Durchführung eines<br />
„Ingenieurprojektes“ der Reife- und Diplomprüfung an die Verhältnisse im technischen<br />
Berufsleben herangeführt zu werden, für das ÖFZS soll dabei die Verwertungsmöglichkeit der<br />
Arbeitsergebnisse gegeben sein, was durch eine effiziente Nutzung der den Vertragspartnern zur<br />
Verfügung stehenden Ressourcen erreicht werden soll. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass<br />
die Ausführung eines „Ingenieurprojektes“ in jedem Fall eine Schülerarbeit darstellt.<br />
Durch die Tätigkeit im Rahmen der Kooperation darf die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen<br />
Schule gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der dzt.<br />
geltenden Fassung sowie die Erfüllung des Lehrplanes nicht beeinträchtigt werden.<br />
Die Durchführung der „Ingenieurprojekte“ stellt einen Bestandteil der schulischen Ausbildung<br />
dar. Diese erfordert zeitweise einen dislozierten Unterricht, weshalb eine Übertragung der<br />
Aufsichtspflicht über die Schüler/innen an geeignete Personen des ÖFZS im Sinne des § 44 a<br />
SchUG notwendig ist.
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
§ 1<br />
Vertragsgegenstand<br />
Vertragsgegenstand ist:<br />
a) die Durchführung von „Ingenieurprojekten“, für die ein gemeinsames Interesse der Vertragspartner<br />
besteht,<br />
b) die Ressourcenbereitstellung für diese Arbeiten, sowie<br />
c) die Nutzung der Ergebnisse<br />
Die vorliegende Vereinbarung regelt die damit zusammenhängenden Modalitäten.<br />
§ 2<br />
Kooperationsgebiete<br />
Die Zusammenarbeit erfolgt vorwiegend im Schwerpunkt Werkstoffe im Bereich Engineering<br />
der angewandten Forschung des ÖFZS.<br />
§ 3<br />
Kooperationsarten<br />
Das Kooperationsziel soll erreicht werden durch:<br />
1) Durchführung von „Ingenieurprojekten“ mit Schüler/innen der HTL-E zu vereinbarten<br />
Themen aus dem kooperationsgebiet. (Die fachliche und pädagogische Betreuung dieser<br />
Arbeiten erfolgt dabei durch Lehrer der HTL-E in Zusammenarbeit mit zugeordneten<br />
Experten des ÖFZS).<br />
2) Gemeinsame fachliche Publikationstätigkeiten von Mitarbeitern des ÖFZS, Mitarbeitern der<br />
HTL-E und den Schüler/innen der HTL-E.<br />
3) Gemeinsame Veranstaltung von Konferenzen, Workshops und Präsentationen der Ergebnisse<br />
der Zusammenarbeit.<br />
§ 4<br />
Benützung von Einrichtungen des ÖFZS<br />
1) Das ÖFZS räumt der HTL-E das Recht zur Mitbenützung seiner Räumlichkeiten mit<br />
Infrastruktur (Inventar, Beheizung, Strom, Telefon, Reinigung), seiner Bücher, Zeitschriften,<br />
EDV-Infrastruktur und Geräte ein und stellt die notwendigen Ausgangsmaterialien und<br />
Betriebsmittel in dem für die einzelnen Kooperationsprojekte erforderlichen Ausmaß auf<br />
seine Kosten zur Verfügung.<br />
2) Mitarbeiter und Schüler/innen der HTL-E, die in Einrichtungen des ÖFZS arbieten,<br />
unterliegen der Betriebsordnung und den Arbeitsbedingungen des ÖFZS, die nachweislich<br />
zur Kenntnis zu bringen sind.<br />
3) Für den Ersatz von Schäden, die Lehrer oder Schüler bei der Benützung der Einrichtungen<br />
des ÖFZS schuldhaft verursachen, wurde eine Haftpflichtversicherung durch den<br />
Elternverein der HTL-E abgeschlossen.<br />
4) Unfälle und Schäden an Leib und Leben werden durch die Schülerunfallversicherung und<br />
die abgeschlossene Zusatzversicherung abgedeckt.<br />
Seite 47
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
§ 5<br />
Beaufsichtigung der Schüler/innen im ÖFZS<br />
Die Beaufsichtigung von Schüler/innen bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen<br />
durch andere geeignete Personen als Lehrer wird durch den § 44 a SchUG geregelt.<br />
Diese Aufsichtspersonen übernehmen dabei alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen.<br />
§ 6<br />
Leistungsverrechnung<br />
1) Im allgemeinen ist kein Geldmittelfluss direkt zwischen den Vertragspartnern vorgesehen<br />
(„to exchange of funds“).<br />
2) Für gemeinsam durchgeführte Projekte ist eine detaillierte Kostenrechnung durchzuführen,<br />
die am Projektende quantitativ ausgewiesen wird.<br />
§ 7<br />
Geheimhaltung<br />
Im Wesentlichen sind Informationen über die Zusammenarbeit der Vertragspartner und die<br />
daraus entspringenden Ergebnisse öffentlich. In jenen Fällen jedoch, in denen einer der Vertragspartner<br />
Geheimhaltung verlangt, hat Folgendes zu gelten:<br />
1) Die Vertragspartner verpflichten sich, die zur Geheimhaltung bestimmten Informationen<br />
weder während der Vertragsdauer noch nach deren Ablauf an Dritte weiterzugeben.<br />
2) Die Partner werden dafür sorgen, dass auch die jeweils beteiligten Mitarbeiter in diese<br />
Geheimhaltungspflicht eingebunden werden.<br />
§ 8<br />
Urheberrechte, Nutzung der Ergebnisse<br />
Urheberrechte und Erkenntnisse aus Forschungsprojekten stehen grundsätzlich nur dem Vertragspartner<br />
ÖFZS zur kommerziellen Nutzung zu (es sei denn, die Nutzung der Erkenntnisse<br />
wird vom externen Auftraggeber generell untersagt).<br />
§ 9<br />
Erfindungen<br />
1) Sofern die Arbeit an einem „Ingenieurprojekt“ zu einer patentfähigen Erfindung führt,<br />
verpflichten sich die Vertragspartner, hievon einander unverzüglich zu verständigen. Beide<br />
Partner haben in einem solchen Fall alles zu unterlassen, was der Patentierbarkeit dieser<br />
Erfindung schädlich sein könnte.<br />
2) Prinzipiell steht dem Vertragspartner ÖFZS das alleinige Recht zu (sofern nicht Rechte<br />
Dritter betroffen sind), solche Erfindungen zum Patent anzumelden.<br />
§ 10<br />
Wissenschaftliche und sonstige Publikationen<br />
1) Sofern nicht im Widerspruch zu § 7, § 8 und § 9, steht es den Vertragspartnern frei,<br />
wissenschaftliche Ergebnisse aus gemeinsamen Arbeiten selbstständig zu publizieren, wobei<br />
die übliche Anerkennung ovn Beiträgen der am Forschungsprojekt beteiligten Mitarbeiter<br />
und Organisationen vorzusehen ist.<br />
2) Veröffentlichungen und Vorträge sind im Vorhinein zwischen den Vertragspartnern abzusprechen.<br />
Seite 48
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
3) Bei der Veröffentlichung in Medien und bei Messen ist stets deutlich zu machen, dass diese<br />
Ergebnisse einer Zusammenarbeit beider Vertragspartner entsprungen sind.<br />
§ 11<br />
Laufzeit<br />
Dieser Vertrag tritt rückwirkend mit 1. September 1997 in Kraft und wird auf die Dauer des<br />
Schuljahres 199/7/98 abgeschlossen.<br />
§ 12<br />
Sonstiges<br />
1) Allfällige mit der Errichtung und Durchführung dieses Vertrages verbundenen Gebühren<br />
und Abgaben werden vom ÖFZS getragen. Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen<br />
Beratung trägt jeder Vertragspartner selbst.<br />
2) Die Vertragspartner halten fest, dass neben dieser Vereinbarung keine Abmachungen über<br />
das gegenständliche Rechtsverhältnis bestehen.<br />
3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertragsverhältnisses bedürfen zur Rechtswirksamkeit<br />
der Schriftform.<br />
§ 13<br />
Ausfertigungen<br />
Dieser Vertrag wird zweifach errichtet, wovon die Erstschrift die HTL-E und die Zweitschrift<br />
das ÖFZS in Verwahrung nehmen.<br />
Eisenstadt,<br />
Für den Bund, vertreten<br />
durch den Landesschulrat<br />
für Burgenland, dieser<br />
war vertreten durch die<br />
Höhere technische<br />
Bundeslehranstalt<br />
Eisenstadt<br />
Direktor DI Rudolf Berghofer<br />
Seibersdorf, 16.1.1998<br />
Für das<br />
Österreichische<br />
Forschungszentrum<br />
Seibersdorf<br />
Gesellschaft m.b.H.<br />
oUniv.-Prof.<br />
DI Dr. techn. Franz Leberl<br />
Seite 49
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
Seite 50<br />
INHALTSÜBERSICHT<br />
ZUM NACHFOLGENDEN <strong>LEITFADEN</strong> 1<br />
ABSCHNITT 1: PROJEKTE , FREUDE - QUALITÄT - ZUKUNFT ! 6<br />
1.1 Eine neue Qualität in der Ausbildung 6<br />
1.2 Spezielle Didaktik der ITP 6<br />
1.3 Innovationsgehalt von ITP´s 7<br />
1.4 Zusammensetzung des Lehrerteams 8<br />
1.5 Zusammensetzung der Schülerteams 8<br />
1.6 Spezielle Vorteile für Schüler 8<br />
1.7 Vorteile für Abteilung und Schule 9<br />
1.8 Zusätzliche Motivation für beteiligte Projektpartner 10<br />
1.9 Einsatzmöglichkeiten für moderne (Medien-)Technologien 10<br />
1.10 Projekt- Beurteilung und Benotung 11<br />
1.11 Bezug zur „Neuen Matura“ 12<br />
2. ABSCHNITT : WEGE ZU PROJEKTEN - SCHWERPUNKTE SETZEN 13<br />
2.1. Finden geeigneter Arbeitsfelder 13<br />
2.2. Zielsetzungen für zukünftige Entwicklungen festlegen 13<br />
2.3. Interessenabstimmung zwischen den Abteilungen 14<br />
2.4 Anbindung an das Schulprofil 14<br />
2.5. „Projektakquisition“ 14<br />
3. ABSCHNITT : PROJEKTABWICKLUNG 16<br />
3.1 Formulierung und Beschluß von Projekten 16<br />
3.2 Projektdurchführung (Durchführung des Einzelprojektes) 17<br />
3.3 Projektabschluß 19<br />
4. ABSCHNITT : VERMARKTUNG 21<br />
4.1. Projekte als Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit 21<br />
4.2. Wirtschaftliche Nutzung von Projekten 21
Leitfaden für Ingenieur- und Technikerprojekte<br />
5. ABSCHNITT : DAS PROJEKT IN DER SCHULISCHEN ORGANISATION 23<br />
5.1 Projektakquisition 23<br />
5.2 Die Projektabwicklung im Rahmen der Schulorganisation 25<br />
5.3 Finanzierung 30<br />
5.4 Materialbeschaffung und Abrechnung 31<br />
6. ABSCHNITT : RECHTLICHE FRAGESTELLUNGEN 32<br />
6.1 Aufsichtspflicht 32<br />
6.2 Haftungsansprüche und Versicherungsschutz 33<br />
6.3 Dislozierte Arbeiten im Rahmen des ITP 34<br />
6.4 Benutzung fremder Ressourcen 35<br />
6.5 Produkthaftung 36<br />
6.6 CE-Kennzeichnung und deren Finanzierung 36<br />
6.7 Patentrecht, Urheberrecht, Publikationsrecht 37<br />
6.8 Abgabe rechtsverbindlicher Aussagen gegenüber Dritten 39<br />
6.9 Abfassung eines Mustervertrages 40<br />
6.10 Teilrechtsfähigkeit ausgeschlossen 40<br />
7. ABSCHNITT : LITERATURANREGUNGEN 41<br />
ANHANG 42<br />
Seite 51